während Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger deutsche Hochschulen derzeit dazu drängt, ihre Konfuzius-Institute zu überdenken und die Uni Erlangen in diesen Tagen bestätigte, keine Stipendiaten des China Scholarship Council mehr aufzunehmen, wollte es die Universität Bielefeld anders machen: In der chinesischen Sonderwirtschaftszone Hainan startet man die erste unabhängige ausländische Hochschule in China, die Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH).
Was die Bielefelder über Jahre mühevoll planten und vorbereiteten, passt jetzt offenbar nicht mehr jedem: Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung deutlich von dem Projekt: Vor dem Hintergrund der China-Strategie sehe man die BiUH nun kritisch. Ähnlich verhalten äußert sich der Deutsche Akademische Austauschdienst. Die Projektführer Ingeborg Schramm-Wölk (Hochschule Bielefeld) und der Präsident der neuen BiUH, Jürgen Kretschmann, sehen ihr Projekt hingegen von der China-Strategie gedeckt! Tim Gabel hat mit ihnen gesprochen.
Wie lassen sich sie Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen, ohne dabei die Risiken dieser mächtigen Technologie außer Acht zu lassen? In der Frage der Regulierung verlässt sich Deutschland auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft und Start-ups, meiner Kollegin Corinna Visser.
Seit Januar spreche ich mit entscheidenden Köpfen der Wissenschaftsszene über ihre Strategien aus der Krise. “Was jetzt, Forschung?” habe ich jetzt auch die Präsidentin der TU Darmstadt gefragt. Tanja Brühl verrät in unserem Gespräch maßgebliche Strategien, wie sie zu Dati steht und was es mit dem Mehr an Forschung und Transfer auf sich hat.
Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre und einen guten Start in den August,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


Am 18. Juli hatten die Verantwortlichen der Hochschule Bielefeld (HSBI) einen “Paukenschlag” verkündet: die Gründung der ersten unabhängigen ausländischen Hochschule in China, gelegen auf der Tropeninsel Hainan. Das rückte Bielefeld in den Fokus der Debatte über deutsch-chinesische Wissenschaftsbeziehungen. Während die Uni Erlangen in diesen Tagen bestätigte, keine Stipendiaten des China Scholarship Council mehr aufzunehmen und die Bundesregierung Hochschulen drängt, ihre Konfuzius-Institute zu überdenken, soll es an der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) erst so richtig losgehen.
Im Wintersemester werden bis zu 140 Studierende Computer Science und Digital Technologies auf Bachelor studieren. Im Jahr 2034 will man nach Angabgen der HSBI auf einem neuen Campus bis zu 12 000 Studierende unterbringen. Aus politischer Perspektive besonders brisant: Während die Forschungsministerin für ihre harten Töne gegenüber China bekannt ist und dies auch in der Chinastrategie platzierte, finanziert ihr Ministerium die Hochschulgründung über das DAAD-Programm “Transnationale Bildung” mit. Die HSBI bekommt bis 2024 rund 1,9 Millionen Euro an Steuergeldern.
Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger inzwischen von dem Projekt: Vor dem Hintergrund der Chinastrategie sehe man das Projekt der Hochschule Bielefeld kritisch und es gehe keine Signalwirkung davon aus, sagte eine Sprecherin. Die Entscheidung für eine Förderung des Projektes habe der DAAD bereits im Jahr 2020 im damaligen Kontext getroffen. “Die Hochschule Bielefeld ist nun in der Verantwortung, die mit der Wissenschaftsfreiheit verbunden ist. Sie muss ihre Achtung sicherstellen und Risiken wie dual-use minimieren”, fordert das Ministerium.
Auch beim DAAD will sich keine richtige Premieren-Stimmung einstellen. Man betont, dass die Hochschule Bielefeld ihr internationales Bildungsprojekt im chinesischen Hainan als “autonom agierende, nordrhein-westfälische Landeshochschule und in wissenschaftlicher Eigenständigkeit” entwickle, sagte ein DAAD-Sprecher. Das Projekt sei Ende 2020 von einer wissenschaftlichen Kommission für das Programm “Transnationale Bildung” empfohlen worden. Diese Förderempfehlung sei für den DAAD bindend.
Im Interview mit Table.Media bedauern die Präsidentin der HSBI, Ingeborg Schramm-Wölk und der Präsident der neuen BiUH, Jürgen Kretschmann, die Distanzierung auf politischer Ebene. Natürlich seien in den vergangenen Jahren Veränderungen eingetreten, in China selbst und im Verhältnis zu China, “allerdings lässt sich aus der aktuellen Chinastrategie der Bundesregierung nach wie vor herauslesen, dass Zusammenarbeit im Hochschulbereich erwünscht ist”, sagte Schramm-Wölk.
Auch Jürgen Kretschmann sieht das Projekt in der Sonderwirtschaftszone Hainan von der neuen Chinastrategie gedeckt. In China lebe rund ein Fünftel der Weltbevölkerung und die Volksrepublik sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auch die Bundesregierung habe in ihrer Chinastrategie betont, dass es ohne China nicht gelingen werde, die globalen, ökologischen und ökonomischen Probleme des Planeten zu lösen. “Man muss die Kooperation auf Augenhöhe und vertrauensvoll gestalten und zudem sensibel für die Kultur der anderen Seite sein”, sagte Kretschmann, der im Bereich Steinkohlenbergbau viel Erfahrung mit deutsch-chinesischen Kooperationen gesammelt hat.
Tatsächlich hat die neue Hochschule für chinesische Verhältnisse besondere Freiheiten. Der rechtliche Status der Wirtschaftsentwicklungszone Yangpu/Danzhou im Norden der Insel entbindet das deutsch-chinesische Projekt davon, den chinesischen Partner 51 Prozent der Anteile zu überlassen. Die unabhängigen, wissenschaftlichen Auswahlkommission, die das Projekt begutachtete, hatte trotzdem schon 2020 “mit Blick auf die zunehmende Komplexität in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern” die Erstellung einer “Exitstrategie” zur Auflage für eine Förderung gemacht, teilte der DAAD mit. Zudem würde nur der Aufbau der Bachelorstudiengänge gefördert, nicht aber etwaige Forschungsaktivitäten.
Ingeborg Schramm-Wölk stößt sich an dem Begriff Exitstrategie. Man habe sich dazu bekannt, dass das Projekt beendet wird, wenn “Dinge passieren, die mit den Hochschulgesetzen oder dem deutschen Wirtschaftsrecht nicht vereinbar sind”. Ein großes finanzielles Risiko trage die Hochschule nicht, da keine Landesmittel für das Projekt eingesetzt worden seien. Lediglich rund 140.000 Euro aus Überschüssen selbst erwirtschafteter Mittel habe man eingesetzt, um eine GmbH, eine Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) und die Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) in der Rechtsform einer “Privaten Non-Profilt-Organisation” gründen zu können.
Rote Linien für das Projekt sind für Schramm-Wölk ebenjene Punkte, “die wir in unserem Memorandum of Understanding formuliert haben”. In dieser Rahmenvereinbarung stehe, dass die BiUH eine Hochschuleinrichtung mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit ist. “Die Hochschule genießt und garantiert die akademische Freiheit. Alle akademischen Aktivitäten wie Lehre und Forschung dienen friedlichen Zwecken.”
Die Gefahr einer Abhängigkeit durch die hohen chinesischen Subventionen für Bau und Betrieb sieht die Hochschulpräsidentin nicht. Ziel des Projektes sei es, gemeinsam eine Hochschule nach deutschem Vorbild aufzubauen. “Wir stellen den Präsidenten, und es ist geplant, mehrheitlich in allen wichtigen Gremien vertreten zu sein”, sagte Schramm-Wölk. Man dürfe in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass es keine Blaupause gebe und das Projekt einzigartig sei. Ohne Unterstützung von staatlicher Seite könnte das Projekt nicht umgesetzt werden. “Jedoch soll sich die BiUH langfristig selbst tragen, und als gemeinnützige Einrichtung wird das Geld, das erwirtschaftet wird, immer den Studierenden zugutekommen.”
Lesen Sie im ausführlichen Interview von Table.Media mit Ingeborg Schramm-Wölk, Präsidentin der HSBI, und Jürgen Kretschmann, dem Präsidenten der BiUH, wie die Kooperation zur Gründung der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences zustande kam. Was sind die Ziele der Partner? Was ist die besondere Ausrichtung der BiUH?
Überall auf der Welt befassen sich Regierungen mit der Frage, wie sie die Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser mächtigen Technologie minimieren können. Deutschland verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, im Gespräch mit Table.Media.
Auch das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) sieht keinen Anlass, in Deutschland eigene Wege zu gehen. “Wir wollen Entwicklern von KI in unserem Land den Rücken stärken, indem wir den Zugang zu Daten vereinfachen und Klarheit über künftige Standards schaffen”, sagt ein Sprecher des BMDV. “Rein nationalstaatliche Regeln sind hier kontraproduktiv.”
Daher beteiligt sich die Bundesregierung an verschiedenen internationalen Regulierungsprozessen – mit verteilten Verantwortlichkeiten. Während das Wirtschafts- und das Justizministerium bei den Verhandlungen zum AI Act in der EU federführend sind, ist es das Digitalministerium beim G7-Hiroshima-Prozess zu generativer KI. Als Exportnation setze sich Deutschland für möglichst internationale Standards ein, “damit Entwicklungen aus Deutschland anschlussfähig sind und umgekehrt”, sagt der Sprecher des BMDV. Dort legt man Wert darauf, Entwicklungen nicht auszubremsen, “indem wir zu viele, komplizierte Regeln aufstellen”. Darum werbe Deutschland auf G7-Ebene “für klare Transparenzregeln, die Freiräume für Innovationen lassen”.
Auch Christmann sagt: “Wir dürfen in diesem frühen Stadium die Entwicklung nicht abwürgen. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa unattraktiv wird für die Entwickler von KI.” Klar sei aber auch, dass wir Leitplanken für KI brauchen, die die Grundrechte betreffen. “So etwas wie Social Scoring oder eine anlasslose biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum hat in einer Demokratie nichts zu suchen.”
Christmann ist gerade von einer US-Reise zurückgekehrt, bei der sie in Kalifornien unter anderem KI-Forscher und -Unternehmer getroffen hat. “In den USA gibt es kein Verständnis dafür, diese innovative Technologie so hart zu regulieren”, sagt sie. “Wir müssen Regulierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung ins Gleichgewicht bringen.” Dabei sei auch wichtig zu bedenken, dass KI-Unternehmen in Europa gerade erst entstehen und Europa daher andere Voraussetzungen habe als etwa die USA. Dennoch: “Wir dürfen nicht immer nur neidisch auf die USA schauen. Unsere Start-up-Szene wird immer besser.”
Dass die Amerikaner jetzt nicht abgewartet haben bis sich die G7 oder die EU auf Leitplanken oder Regeln für KI geeinigt haben, sondern ihre Unternehmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gebracht haben, sieht Christmann sportlich. “Es ist wichtig, mit den großen Technologieunternehmen im Austausch zu sein, gerade um Bias zu vermeiden.” Und es sei richtig, die Modelle, die bereits da sind, auf eine vernünftige Basis zu stellen. “Aber die Ansicht, dass eine Selbstverpflichtung allein ausreichend ist, teile ich nicht“, betont sie.
Nach der Sommerpause in Brüssel treten die Trilog-Verhandlungen in die heiße Phase ein. Ziel ist es, diese noch unter spanischer Ratspräsidentschaft abzuschließen. Auch Christmann hält es für wichtig ist, die Verhandlungen zum AI Act zeitnah abzuschließen, um eine verlässliche Regulierung zu haben. “Solange unklar ist, was kommt, halten sich die Investoren zurück. Das ist keine gute Situation.” Das Gesetz müsse vor den Europawahlen fertig sein.
Deutschland hatte zur allgemeinen Ausrichtung des Rates einige Anmerkungen gemacht und unter anderem gefordert, dass nur relevante und verhältnismäßige Anforderungen für Allzweck-KI-Systeme (GPAI) gelten sollten. Und verwies darauf, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich war dies noch bevor die Diskussion über ChatGPT die Öffentlichkeit erreichte.
Das bedeutet, die Diskussionen – auch im Rat – sind noch nicht beendet. Man müsse sich die Frage stellen, ob die Regulierung ihren Zweck erfüllt, die Technologie zum Wohle der Menschen zu gestalten oder ob sie die Entwicklung ausbremse, mahnt Christmann. Es sei richtig, die Regulierung auf Hochrisikoanwendungen zu beschränken. Im Moment gehe es in Europa jedoch um immer mehr Detailregulierung. “Das führt zu erschwerten Bedingungen, gerade für junge KI-Unternehmen, wie wir sie in Europa haben.”

Beispiel: “Ich kann nicht einsehen, warum es Unternehmen auferlegt werden soll, zusätzlich eine Grundrechtsfolgenabschätzung zu machen, wie es das EU-Parlament vorschlägt” kritisiert Christmann. Denn das sei aufwendig bis unmöglich, gerade für junge Unternehmen. Allerdings war es die Fraktion der Grünen/EFA, die das Fundamental Rights Assessment in den Gesetzesvorschlag eingebracht haben.
Was in den kommenden Verhandlungen für Deutschland noch wichtig ist? “Gute Entwicklungsbedingungen für KMU und Start-ups zu schaffen”, sagt Christmann. “Wir brauchen Experimentierfelder. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren, bevor die volle Regulierung greift.” Deswegen lege die deutsche Seite Wert auf die Etablierung von Reallaboren und dass es zeitliche Ausnahmen für KMU gibt.
Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von Ausnahmen innerhalb der Hochrisikobereiche. Sodass etwa für Putzroboter im Krankenhaus nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten wie zum Beispiel für Patientenakten. “Hier arbeiten wir an Lösungen, die Diskussion läuft noch”, sagte Christmann.
Da der Rat seine Allgemeine Ausrichtung bereits beschlossen hatte, bevor die Diskussion über Gründungsmodelle (Foundation Models) oder generative KI (wie ChatGPT) an Dynamik gewann, hatten die Mitgliedstaaten das Thema kaum beleuchtet. “Es ist richtig, dass das EU-Parlament Foundation Models aufgegriffen hat”, meint Christmann. Doch welche Regulierung dafür angemessen sei, dazu führe die Bundesregierung noch Gespräche. Die Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Beschluss der Ratsposition viel stärker verändert als sonst. Daher sei der Bedarf, an konkreten Lösungen zu arbeiten, größer.
Digitalminister Wissing hat dazu in der FAZ schon mal einen Vorschlag gemacht: Er stellt sich für generative KI eine verpflichtende Selbstregulierung vor. Allerdings warnt auch er davor, die Formulierung allein den großen US-Tech-Firmen zu überlassen. Zudem müsse es bereits nach zwei Jahren eine Überprüfung geben. Dann könne man einschätzen, ob ein Code of Conduct für generative KI als Ergänzung zum AI Act ausreiche – oder ob es doch einer harten Regulierung und der Integration in das Gesetz bedarf.
Derweil hat die Diskussion über die Umsetzung des AI Acts noch nicht begonnen. Eines kann Christmann aber bereits dazu sagen: “Wir wollen aber die Fehler der DSGVO vermeiden und es nicht wieder zu 16 verschiedenen Auslegungen der Regeln kommen lassen.” Die Lösung könnte eine zentrale Stelle sein, ein AI Office – etwa so, wie es das EU-Parlament vorgeschlagen hat. Aber auch da gibt es Klärungsbedarf. “Ein europäisches AI Office darf nicht zum Nadelöhr für die KI-Zulassung in ganz Europa werden”, warnt Christmann.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Vertreter aus dem Open-Source-KI-Ökosystem fordern die EU auf, bei der Fertigstellung des AI Acts Open-Source-Innovation zu schützen. In einem Positionspapier schreiben GitHub, Hugging Face, Creative Commons und andere, die Gesetzgeber müssten “sicherstellen, dass das endgültige KI-Gesetz das offene Ökosystem zum Aufbau einer sicheren, zuverlässigen und nützlichen KI-Technologie unterstützen kann”.
Der AI Act habe das Potenzial, maßgeblich zu beeinflussen, wie KI weltweit entwickelt, implementiert und reguliert werde, heißt es darin. Dabei könnte es kontraproduktiv sein, wenn die Nuancen der Open-Source-Entwicklung außer Acht gelassen würden.
“Open Source und Open Science befinden sich im Kern der KI-Entwicklung, wurden aber sowohl in der Politik als auch in der Presse oft übersehen”, beklagen die Autoren. Sie machen in ihrem Positionspapier konkrete Änderungsvorschläge, die sicherstellen sollen, “dass der AI Act für Open Source funktioniert“.
Vor allem zwei Punkte heben die Unterzeichner hervor:
Die aktuellen Gesetzesvorschläge würden dagegen Hindernisse und Nachteile für die Teilnehmer des offenen Ökosystems schaffen. Die Organisationen vertreten sowohl kommerzielle als auch gemeinnützige Interessengruppen im Open-Source-KI-Ökosystem. vis
Der britische Physiker und Experte für erneuerbare Energien James “Jim” Ferguson Skea wird für die nächsten fünf bis sieben Jahre als Vorsitzender den UN-Klimarat IPCC leiten. Eine Mehrheit der Delegationsvertreter bei der 59. IPCC-Versammlung im kenianischen Nairobi stimmte vergangene Woche für den Briten. Er wird als neuer Chef das einflussreiche Gremium an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik leiten.
Jim Skea ist beim IPCC und in der Politik kein Unbekannter: Seit 40 Jahren ist der 69-Jährige, der am Imperial College in London als Professor für nachhaltige Energie lehrt, in der Klimawissenschaft aktiv, seit 30 Jahren beim IPCC. Zuletzt leitete er als Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe III (Mitigation of Climate Change) die Arbeit an diesem Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichts. Zuvor schrieb er maßgeblich am einflussreichen “1,5-Grad-Bericht” des IPCC von 2018 und am Sondergutachten zur Landnutzung 2019 mit.
Skea erklärte nach seiner Wahl seine Prioritäten für die Arbeit, zu der unter anderem die Erstellung des 7. Sachstandsberichts gehört. Er will:
Skea hatte in seiner Bewerbung seine Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft herausgestellt – an dieser Schnittstelle arbeitet auch der IPCC. Denn die Organisation rekrutiert sich zwar aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vieler Fachrichtungen aus der ganzen Welt, stimmt aber alle ihre Berichte bis ins letzte Detail mit Vertretern der jeweiligen Regierungen ab. Auch die Kandidaten für IPCC-Posten werden offiziell von ihren Herkunftsländern nominiert, Skea also von der britischen Regierung.
Dabei setzte sich Skea gegen drei Mitbewerber durch, im zweiten Wahlgang gegen die Mathematikerin und Klimaforscherin Thelma Krug aus Brasilien mit 90 zu 69 Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang waren der Belgier Jean-Pascal von Ypersele und die Südafrikanerin Debra Roberts ausgeschieden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gremiums hatten zwei Frauen für den prestigeträchtigen Posten als IPCC-Vorsitzende kandidiert. bp
Nach vorläufigen Daten von US-Forschern ist der Nordatlantik so heiß wie nie seit Beginn ihrer Datenreihe vor rund 40 Jahren. Seine Durchschnittstemperatur lag nach Daten der Plattform “Climate Reanalyzer” der University of Maine am 29. Juli – dem bis Montagnachmittag letzten ausgewerteten Datum – bei 25,0 Grad. Der Rekordwert betrug bislang 24,9 Grad und wurde in den Tagen 1. bis 7. September 2022 erreicht.
Bei den Auswertungen von “Climate Reanalyzer” handele es sich um sogenannte Reanalysen, erklärte Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel kürzlich. “Es fließen nicht nur real gemessene Wetterdaten ein, sondern auch Modellrechnungen.” Die endgültigen Temperaturanalysen folgen später.
Als Hauptgrund für den Anstieg gelten die menschengemachten Treibhausgase. Über 90 Prozent der durch sie entstehenden Wärme werde von den Ozeanen aufgenommen, sagte Latif am Montag. Dadurch seien sie in bis zu 2000 Meter Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden – mit Folgen nicht nur für die Ökosysteme. Seit März weise die Oberfläche der Meere global Rekordtemperaturen für den jeweiligen Monat auf. Nun komme allmählich das Klimaphänomen El Niño hinzu. Das natürliche Wetterphänomen könne die im Zuge der Klimakrise ohnehin steigenden Temperaturen zusätzlich in die Höhe treiben.
Zum Nordatlantik zählen die Experten der Uni Maine die Fläche vom Äquator bis zum 60. Breitengrad Nord, der nördlich von Schottland liegt sowie vom nullten Längengrad, der durch London geht, bis zum 80. Längengrad West, an dem Florida liegt. dpa
Bildung.Table. Rechtsextremismus in Schule. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) gerät wegen der rechtsextremen Vorfälle an einer Schule in die Kritik. Im Gespräch mit Table.Media verteidigt er seine Doppelstrategie von Transparenz und Dienstweg. Und warnt vor Schnellschüssen. Mehr
ESG.Table. Wasserverbrauch der Industrie: Es drohen Verteilungskonflikte. Die Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung hat kürzlich den Bundestag passiert. Sie soll eine Harmonisierung oder sogar eine bundesweite Regelung zum Wasserentnahmeentgelt prüfen. Noch bedienen sich Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft überwiegend nach Belieben. Das birgt angesichts der Klimakrise aber erhebliches Konfliktpotenzial. Mehr
China.Table. De-Risking: “Wir müssen die Risiken aushalten.” Die auf China spezialisierte Ökonomin Doris Fischer beschreibt die Risiken, denen sich die Wirtschaft stellen muss – und die Schwierigkeiten dabei, sie abzubauen. Unternehmen und Politik tun sich trotz des Aufrufs zum De-Risking schwer, effektiv umzusteuern. Klar ist aber auch: Die Firmen brauchen die Regierung gar nicht, um Risiken zu erkennen. Mehr
AgriFood.Table. Die Dürre zeigt die Gefahren des Klimawandels für die Landwirtschaft. China leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten – und das in eigentlich wasserreichen Regionen des Südens und Südwestens. Die Expertin für Landwirtschaft und Lebensmittel in China, Michaela Böhme, sieht die Lage auch als Weckruf an Peking, die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit ernst zu nehmen. Mehr
Climate.Table. Deutschland: Unterstützung für Klimabewegung drastisch gesunken. Die Unterstützung für die Klimabewegung in Deutschland sinkt über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg drastisch, zeigt eine neue Studie. Klimaschutz bleibt den Menschen zwar wichtig. Doch Forschende warnen vor einem Kulturkampf. Mehr

Veränderung ist eine wichtige Antwort auf viele Zukunftsfragen, die sich aktuell stellen, sagt Tanja Brühl. “Was ist unser Beitrag zu den notwendigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen – zur Nachhaltigkeitswende oder zur fortschreitenden Digitalisierung? Wie gehen wir als Universität mit veränderten und sich weiter dynamisch entwickelnden globalen Rahmenbedingungen um? Wie können wir als Universitäten wieder agieren und weniger auf immer neue Krisen reagieren?” Die Präsidentin der TU Darmstadt weiß, dass strategische Ziele überdacht und sich Universitäten ein Stück weit neu erfunden müssen.
An der TU Darmstadt gehe man diese Veränderungen ganz konkret an, es gebe einen Strategieprozess, der Neues für Forschung, Studium und Lehre, die Dritte Mission, Internationalisierung, und Diversität bedeutet und Schritt für Schritt umgesetzt wird. “An den Strategien für Nachhaltigkeit und Digitalisierung arbeiten wir gerade. Und, ganz im Sinne der twin transformation, denken wir diese beiden Strategien zusammen”, sagt Brühl.
Dass Veränderungen auch im Wissenschaftssystem insgesamt notwendig sind, zeigt für Brühl exemplarisch die Debatte rund um die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. “Die hier vorgebrachten Argumente und Vorschläge gehen weit über die Gestaltung von Regelungen für Befristungen für wissenschaftliche Qualifizierungsphasen hinaus. Es gilt, über akademische Karrierewege und die Ausgestaltung von Stellen ganz neu nachzudenken”. Das geschehe bereits jetzt – an den einzelnen Institutionen, auch in Darmstadt, aber auch im Kreis der Universitäten insgesamt.
Dabei gehe es ganz klar auch um Fragen der Finanzierung. “Wissenschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Dafür brauchen die Universitäten eine auskömmliche Finanzierung. Wir benötigen Unterstützung, um die zusätzlichen Belastungen zu tragen.”
Um etwa dem lauter werdenden Ruf nach mehr und schnelleren Innovationen begegnen zu können, hat die TU Darmstadt die Strategie für die sogenannte Dritte Mission unserer Universität entwickelt – neben Forschung und Lehre. “Wir wollen mehr leisten als im Bild des klassischen Wissens- und Technologietransfers angelegt”, sagt Brühl. Man denke jenseits des unidirektionalen Transfers von Innovationen aus der Universität in die Anwendung in Wirtschaft und Industrie. “Wir leben die Interaktion und den Austausch mit all unseren Partner:innen – in Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Kultur. Wir wollen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse nach außen tragen, sondern ebenso genau zuhören, was unsere Partner brauchen.”
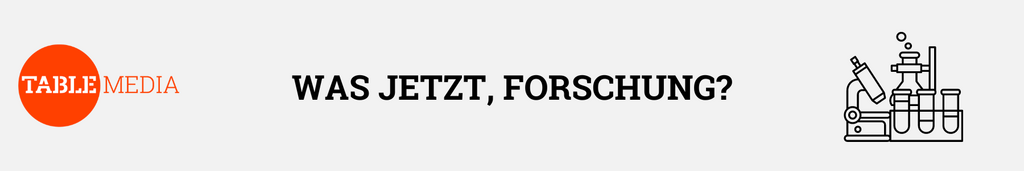
Selbstverständlich bleiben Ausgründungen und Start-ups an der TU Darmstadt wichtig. “Darauf bin ich stolz, als TU Darmstadt sind wir in diesem Bereich auch äußerst erfolgreich”, sagt Brühl. “Wir zählen zu den innovativsten Universitäten in Deutschland.” Studierende und Mitarbeitende setzten ihre vielen kreativen Ideen in die Tat um und gründeten erfolgreich neue Unternehmen. Man will noch erfolgreicher werden und Start-ups noch besser unterstützen, sagt Brühl.
“Da die möglichen Strukturen innerhalb der Universität an Grenzen stoßen, gründen wir gerade eine gGmbH zur Innovationsförderung. Hier können wir zusätzliches, auch privates Geld, einwerben, um junge Unternehmen noch besser zu begleiten. Denn allein mit den Mitteln aus der Grundfinanzierung des Landes können wir das nicht stemmen; damit bleiben wir nicht wettbewerbsfähig.”
In Sachen Dati begrüßt Tanja Brühl die im Juli veröffentlichte Förderrichtlinie. Diese mache deutlich, Dati sei zuallererst ein Förderinstrument für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. “Diese Klarstellung ist gut. Dati kann kein Instrument sein, um den Wissens- und Technologietransfer in Deutschland grundlegend zu verändern.” Es sei nicht sinnvoll, eine Förderung durch Dati abhängig zu machen von der Größe einer Institution.
“Disruptive Innovationen entstehen aus der Grundlagenforschung. Und die wiederum findet statt an forschungsstarken Universitäten. Gerade als Technische Universität entwickeln wir mit unseren gut aufgestellten Ingenieur- und Naturwissenschaften Lösungen für Zukunftsfragen.” An der TU Darmstadt sei man eingebunden in lebendige und stetig wachsende Innovationsökosysteme und verfüge über ausgezeichnete Expertise im Bereich Start-ups und Ausgründungen. Diese hätte man gern im Rahmen von Dati eingebracht und von einer Förderung profitiert. Die andere politische Schwerpunktsetzung gelte es nun zu akzeptieren.
Wenn Tanja Brühl einen Blick nach vorne werfen dürfte und einen Wunsch frei hätte, dann würde sie sich eine angemessene Finanzierung des Hochschulsystems in Deutschland wünschen. “Eine Finanzierung, mit der wir unsere Ziele in Forschung, Lehre und Dritter Mission realisieren können. Damit Universitäten weiterhin Orte der Innovation bleiben, an denen wir gemeinsam kreativ sein können.”
Das ganze Interview lesen Sie in unserer Rubrik “Was jetzt, Forschung?” Diese Reihe enthält Impulse aus den Gesprächen u. a. mit Jan Wörner (Acatech), Rafael Laguna de la Vera (Sprind), Volker Meyer-Guckel (Stifterverband), Georg Schütte (VolkswagenStiftung), Otmar D. Wiestler (Helmholtz-Gemeinschaft) und Walter Rosenthal (Uni Jena).

Die USA haben außerirdische Flugobjekte geborgen und untersucht! Glauben Sie nicht? Damit sind Sie nicht allein – dazu aber später. Tatsächlich behaupteten zwei frühere Militärpiloten und ein früherer Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums vor dem US-Kongress, die USA habe außerirdische Flugobjekte geborgen und untersucht. Letzterer heißt David Grusch und erklärte, es habe “über Jahrzehnte” ein Programm der US-Regierung gegeben, um geborgene Ufo-Teile zu untersuchen. Laut Grusch sei Material “nicht menschlichen” Ursprungs gefunden worden, wie Agenturen berichten. Der Newsseite “The Debrief” hatte er bereits im Juni erzählt, die US-Regierung sei in Besitz eines außerirdischen Flugobjekts “von der Größe eines Football-Feldes“. Unter Eid vor dem US-Kongress hat er diese beiden Aussagen jetzt allerdings nicht wiederholt.
Die Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) glaubt sowieso nicht daran, dass die US-Regierung außerirdische Flugobjekte geborgen hat, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. 28 Prozent der Befragten allerdings halten die Möglichkeit solcher Entdeckungen für plausibel, während 17 Prozent sich zu keiner Aussage bezüglich des Themas äußerten. Befragt wurden über 13.000 Menschen in Deutschland, die älter als 18 Jahre waren. Ein Trost für alle Ufosis: Die USA bleiben dran! Man will weiter penibel Ausschau halten, es sei schließlich potenziell eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Nicola Kuhrt
während Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger deutsche Hochschulen derzeit dazu drängt, ihre Konfuzius-Institute zu überdenken und die Uni Erlangen in diesen Tagen bestätigte, keine Stipendiaten des China Scholarship Council mehr aufzunehmen, wollte es die Universität Bielefeld anders machen: In der chinesischen Sonderwirtschaftszone Hainan startet man die erste unabhängige ausländische Hochschule in China, die Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH).
Was die Bielefelder über Jahre mühevoll planten und vorbereiteten, passt jetzt offenbar nicht mehr jedem: Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung deutlich von dem Projekt: Vor dem Hintergrund der China-Strategie sehe man die BiUH nun kritisch. Ähnlich verhalten äußert sich der Deutsche Akademische Austauschdienst. Die Projektführer Ingeborg Schramm-Wölk (Hochschule Bielefeld) und der Präsident der neuen BiUH, Jürgen Kretschmann, sehen ihr Projekt hingegen von der China-Strategie gedeckt! Tim Gabel hat mit ihnen gesprochen.
Wie lassen sich sie Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen, ohne dabei die Risiken dieser mächtigen Technologie außer Acht zu lassen? In der Frage der Regulierung verlässt sich Deutschland auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft und Start-ups, meiner Kollegin Corinna Visser.
Seit Januar spreche ich mit entscheidenden Köpfen der Wissenschaftsszene über ihre Strategien aus der Krise. “Was jetzt, Forschung?” habe ich jetzt auch die Präsidentin der TU Darmstadt gefragt. Tanja Brühl verrät in unserem Gespräch maßgebliche Strategien, wie sie zu Dati steht und was es mit dem Mehr an Forschung und Transfer auf sich hat.
Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre und einen guten Start in den August,
Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.


Am 18. Juli hatten die Verantwortlichen der Hochschule Bielefeld (HSBI) einen “Paukenschlag” verkündet: die Gründung der ersten unabhängigen ausländischen Hochschule in China, gelegen auf der Tropeninsel Hainan. Das rückte Bielefeld in den Fokus der Debatte über deutsch-chinesische Wissenschaftsbeziehungen. Während die Uni Erlangen in diesen Tagen bestätigte, keine Stipendiaten des China Scholarship Council mehr aufzunehmen und die Bundesregierung Hochschulen drängt, ihre Konfuzius-Institute zu überdenken, soll es an der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) erst so richtig losgehen.
Im Wintersemester werden bis zu 140 Studierende Computer Science und Digital Technologies auf Bachelor studieren. Im Jahr 2034 will man nach Angabgen der HSBI auf einem neuen Campus bis zu 12 000 Studierende unterbringen. Aus politischer Perspektive besonders brisant: Während die Forschungsministerin für ihre harten Töne gegenüber China bekannt ist und dies auch in der Chinastrategie platzierte, finanziert ihr Ministerium die Hochschulgründung über das DAAD-Programm “Transnationale Bildung” mit. Die HSBI bekommt bis 2024 rund 1,9 Millionen Euro an Steuergeldern.
Auf Anfrage von Table.Media distanzierte sich das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger inzwischen von dem Projekt: Vor dem Hintergrund der Chinastrategie sehe man das Projekt der Hochschule Bielefeld kritisch und es gehe keine Signalwirkung davon aus, sagte eine Sprecherin. Die Entscheidung für eine Förderung des Projektes habe der DAAD bereits im Jahr 2020 im damaligen Kontext getroffen. “Die Hochschule Bielefeld ist nun in der Verantwortung, die mit der Wissenschaftsfreiheit verbunden ist. Sie muss ihre Achtung sicherstellen und Risiken wie dual-use minimieren”, fordert das Ministerium.
Auch beim DAAD will sich keine richtige Premieren-Stimmung einstellen. Man betont, dass die Hochschule Bielefeld ihr internationales Bildungsprojekt im chinesischen Hainan als “autonom agierende, nordrhein-westfälische Landeshochschule und in wissenschaftlicher Eigenständigkeit” entwickle, sagte ein DAAD-Sprecher. Das Projekt sei Ende 2020 von einer wissenschaftlichen Kommission für das Programm “Transnationale Bildung” empfohlen worden. Diese Förderempfehlung sei für den DAAD bindend.
Im Interview mit Table.Media bedauern die Präsidentin der HSBI, Ingeborg Schramm-Wölk und der Präsident der neuen BiUH, Jürgen Kretschmann, die Distanzierung auf politischer Ebene. Natürlich seien in den vergangenen Jahren Veränderungen eingetreten, in China selbst und im Verhältnis zu China, “allerdings lässt sich aus der aktuellen Chinastrategie der Bundesregierung nach wie vor herauslesen, dass Zusammenarbeit im Hochschulbereich erwünscht ist”, sagte Schramm-Wölk.
Auch Jürgen Kretschmann sieht das Projekt in der Sonderwirtschaftszone Hainan von der neuen Chinastrategie gedeckt. In China lebe rund ein Fünftel der Weltbevölkerung und die Volksrepublik sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auch die Bundesregierung habe in ihrer Chinastrategie betont, dass es ohne China nicht gelingen werde, die globalen, ökologischen und ökonomischen Probleme des Planeten zu lösen. “Man muss die Kooperation auf Augenhöhe und vertrauensvoll gestalten und zudem sensibel für die Kultur der anderen Seite sein”, sagte Kretschmann, der im Bereich Steinkohlenbergbau viel Erfahrung mit deutsch-chinesischen Kooperationen gesammelt hat.
Tatsächlich hat die neue Hochschule für chinesische Verhältnisse besondere Freiheiten. Der rechtliche Status der Wirtschaftsentwicklungszone Yangpu/Danzhou im Norden der Insel entbindet das deutsch-chinesische Projekt davon, den chinesischen Partner 51 Prozent der Anteile zu überlassen. Die unabhängigen, wissenschaftlichen Auswahlkommission, die das Projekt begutachtete, hatte trotzdem schon 2020 “mit Blick auf die zunehmende Komplexität in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern” die Erstellung einer “Exitstrategie” zur Auflage für eine Förderung gemacht, teilte der DAAD mit. Zudem würde nur der Aufbau der Bachelorstudiengänge gefördert, nicht aber etwaige Forschungsaktivitäten.
Ingeborg Schramm-Wölk stößt sich an dem Begriff Exitstrategie. Man habe sich dazu bekannt, dass das Projekt beendet wird, wenn “Dinge passieren, die mit den Hochschulgesetzen oder dem deutschen Wirtschaftsrecht nicht vereinbar sind”. Ein großes finanzielles Risiko trage die Hochschule nicht, da keine Landesmittel für das Projekt eingesetzt worden seien. Lediglich rund 140.000 Euro aus Überschüssen selbst erwirtschafteter Mittel habe man eingesetzt, um eine GmbH, eine Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) und die Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) in der Rechtsform einer “Privaten Non-Profilt-Organisation” gründen zu können.
Rote Linien für das Projekt sind für Schramm-Wölk ebenjene Punkte, “die wir in unserem Memorandum of Understanding formuliert haben”. In dieser Rahmenvereinbarung stehe, dass die BiUH eine Hochschuleinrichtung mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit ist. “Die Hochschule genießt und garantiert die akademische Freiheit. Alle akademischen Aktivitäten wie Lehre und Forschung dienen friedlichen Zwecken.”
Die Gefahr einer Abhängigkeit durch die hohen chinesischen Subventionen für Bau und Betrieb sieht die Hochschulpräsidentin nicht. Ziel des Projektes sei es, gemeinsam eine Hochschule nach deutschem Vorbild aufzubauen. “Wir stellen den Präsidenten, und es ist geplant, mehrheitlich in allen wichtigen Gremien vertreten zu sein”, sagte Schramm-Wölk. Man dürfe in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass es keine Blaupause gebe und das Projekt einzigartig sei. Ohne Unterstützung von staatlicher Seite könnte das Projekt nicht umgesetzt werden. “Jedoch soll sich die BiUH langfristig selbst tragen, und als gemeinnützige Einrichtung wird das Geld, das erwirtschaftet wird, immer den Studierenden zugutekommen.”
Lesen Sie im ausführlichen Interview von Table.Media mit Ingeborg Schramm-Wölk, Präsidentin der HSBI, und Jürgen Kretschmann, dem Präsidenten der BiUH, wie die Kooperation zur Gründung der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences zustande kam. Was sind die Ziele der Partner? Was ist die besondere Ausrichtung der BiUH?
Überall auf der Welt befassen sich Regierungen mit der Frage, wie sie die Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser mächtigen Technologie minimieren können. Deutschland verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, im Gespräch mit Table.Media.
Auch das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) sieht keinen Anlass, in Deutschland eigene Wege zu gehen. “Wir wollen Entwicklern von KI in unserem Land den Rücken stärken, indem wir den Zugang zu Daten vereinfachen und Klarheit über künftige Standards schaffen”, sagt ein Sprecher des BMDV. “Rein nationalstaatliche Regeln sind hier kontraproduktiv.”
Daher beteiligt sich die Bundesregierung an verschiedenen internationalen Regulierungsprozessen – mit verteilten Verantwortlichkeiten. Während das Wirtschafts- und das Justizministerium bei den Verhandlungen zum AI Act in der EU federführend sind, ist es das Digitalministerium beim G7-Hiroshima-Prozess zu generativer KI. Als Exportnation setze sich Deutschland für möglichst internationale Standards ein, “damit Entwicklungen aus Deutschland anschlussfähig sind und umgekehrt”, sagt der Sprecher des BMDV. Dort legt man Wert darauf, Entwicklungen nicht auszubremsen, “indem wir zu viele, komplizierte Regeln aufstellen”. Darum werbe Deutschland auf G7-Ebene “für klare Transparenzregeln, die Freiräume für Innovationen lassen”.
Auch Christmann sagt: “Wir dürfen in diesem frühen Stadium die Entwicklung nicht abwürgen. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa unattraktiv wird für die Entwickler von KI.” Klar sei aber auch, dass wir Leitplanken für KI brauchen, die die Grundrechte betreffen. “So etwas wie Social Scoring oder eine anlasslose biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum hat in einer Demokratie nichts zu suchen.”
Christmann ist gerade von einer US-Reise zurückgekehrt, bei der sie in Kalifornien unter anderem KI-Forscher und -Unternehmer getroffen hat. “In den USA gibt es kein Verständnis dafür, diese innovative Technologie so hart zu regulieren”, sagt sie. “Wir müssen Regulierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung ins Gleichgewicht bringen.” Dabei sei auch wichtig zu bedenken, dass KI-Unternehmen in Europa gerade erst entstehen und Europa daher andere Voraussetzungen habe als etwa die USA. Dennoch: “Wir dürfen nicht immer nur neidisch auf die USA schauen. Unsere Start-up-Szene wird immer besser.”
Dass die Amerikaner jetzt nicht abgewartet haben bis sich die G7 oder die EU auf Leitplanken oder Regeln für KI geeinigt haben, sondern ihre Unternehmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gebracht haben, sieht Christmann sportlich. “Es ist wichtig, mit den großen Technologieunternehmen im Austausch zu sein, gerade um Bias zu vermeiden.” Und es sei richtig, die Modelle, die bereits da sind, auf eine vernünftige Basis zu stellen. “Aber die Ansicht, dass eine Selbstverpflichtung allein ausreichend ist, teile ich nicht“, betont sie.
Nach der Sommerpause in Brüssel treten die Trilog-Verhandlungen in die heiße Phase ein. Ziel ist es, diese noch unter spanischer Ratspräsidentschaft abzuschließen. Auch Christmann hält es für wichtig ist, die Verhandlungen zum AI Act zeitnah abzuschließen, um eine verlässliche Regulierung zu haben. “Solange unklar ist, was kommt, halten sich die Investoren zurück. Das ist keine gute Situation.” Das Gesetz müsse vor den Europawahlen fertig sein.
Deutschland hatte zur allgemeinen Ausrichtung des Rates einige Anmerkungen gemacht und unter anderem gefordert, dass nur relevante und verhältnismäßige Anforderungen für Allzweck-KI-Systeme (GPAI) gelten sollten. Und verwies darauf, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich war dies noch bevor die Diskussion über ChatGPT die Öffentlichkeit erreichte.
Das bedeutet, die Diskussionen – auch im Rat – sind noch nicht beendet. Man müsse sich die Frage stellen, ob die Regulierung ihren Zweck erfüllt, die Technologie zum Wohle der Menschen zu gestalten oder ob sie die Entwicklung ausbremse, mahnt Christmann. Es sei richtig, die Regulierung auf Hochrisikoanwendungen zu beschränken. Im Moment gehe es in Europa jedoch um immer mehr Detailregulierung. “Das führt zu erschwerten Bedingungen, gerade für junge KI-Unternehmen, wie wir sie in Europa haben.”

Beispiel: “Ich kann nicht einsehen, warum es Unternehmen auferlegt werden soll, zusätzlich eine Grundrechtsfolgenabschätzung zu machen, wie es das EU-Parlament vorschlägt” kritisiert Christmann. Denn das sei aufwendig bis unmöglich, gerade für junge Unternehmen. Allerdings war es die Fraktion der Grünen/EFA, die das Fundamental Rights Assessment in den Gesetzesvorschlag eingebracht haben.
Was in den kommenden Verhandlungen für Deutschland noch wichtig ist? “Gute Entwicklungsbedingungen für KMU und Start-ups zu schaffen”, sagt Christmann. “Wir brauchen Experimentierfelder. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren, bevor die volle Regulierung greift.” Deswegen lege die deutsche Seite Wert auf die Etablierung von Reallaboren und dass es zeitliche Ausnahmen für KMU gibt.
Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von Ausnahmen innerhalb der Hochrisikobereiche. Sodass etwa für Putzroboter im Krankenhaus nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten wie zum Beispiel für Patientenakten. “Hier arbeiten wir an Lösungen, die Diskussion läuft noch”, sagte Christmann.
Da der Rat seine Allgemeine Ausrichtung bereits beschlossen hatte, bevor die Diskussion über Gründungsmodelle (Foundation Models) oder generative KI (wie ChatGPT) an Dynamik gewann, hatten die Mitgliedstaaten das Thema kaum beleuchtet. “Es ist richtig, dass das EU-Parlament Foundation Models aufgegriffen hat”, meint Christmann. Doch welche Regulierung dafür angemessen sei, dazu führe die Bundesregierung noch Gespräche. Die Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Beschluss der Ratsposition viel stärker verändert als sonst. Daher sei der Bedarf, an konkreten Lösungen zu arbeiten, größer.
Digitalminister Wissing hat dazu in der FAZ schon mal einen Vorschlag gemacht: Er stellt sich für generative KI eine verpflichtende Selbstregulierung vor. Allerdings warnt auch er davor, die Formulierung allein den großen US-Tech-Firmen zu überlassen. Zudem müsse es bereits nach zwei Jahren eine Überprüfung geben. Dann könne man einschätzen, ob ein Code of Conduct für generative KI als Ergänzung zum AI Act ausreiche – oder ob es doch einer harten Regulierung und der Integration in das Gesetz bedarf.
Derweil hat die Diskussion über die Umsetzung des AI Acts noch nicht begonnen. Eines kann Christmann aber bereits dazu sagen: “Wir wollen aber die Fehler der DSGVO vermeiden und es nicht wieder zu 16 verschiedenen Auslegungen der Regeln kommen lassen.” Die Lösung könnte eine zentrale Stelle sein, ein AI Office – etwa so, wie es das EU-Parlament vorgeschlagen hat. Aber auch da gibt es Klärungsbedarf. “Ein europäisches AI Office darf nicht zum Nadelöhr für die KI-Zulassung in ganz Europa werden”, warnt Christmann.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)
6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin
Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr
11.-13. September 2023, Osnabrück
18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr
20.-22. September 2023, Hyperion Hotel, Leipzig
Konferenz SEMANTiCS und Language Intelligence 2023 Mehr
27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin
Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr
Vertreter aus dem Open-Source-KI-Ökosystem fordern die EU auf, bei der Fertigstellung des AI Acts Open-Source-Innovation zu schützen. In einem Positionspapier schreiben GitHub, Hugging Face, Creative Commons und andere, die Gesetzgeber müssten “sicherstellen, dass das endgültige KI-Gesetz das offene Ökosystem zum Aufbau einer sicheren, zuverlässigen und nützlichen KI-Technologie unterstützen kann”.
Der AI Act habe das Potenzial, maßgeblich zu beeinflussen, wie KI weltweit entwickelt, implementiert und reguliert werde, heißt es darin. Dabei könnte es kontraproduktiv sein, wenn die Nuancen der Open-Source-Entwicklung außer Acht gelassen würden.
“Open Source und Open Science befinden sich im Kern der KI-Entwicklung, wurden aber sowohl in der Politik als auch in der Presse oft übersehen”, beklagen die Autoren. Sie machen in ihrem Positionspapier konkrete Änderungsvorschläge, die sicherstellen sollen, “dass der AI Act für Open Source funktioniert“.
Vor allem zwei Punkte heben die Unterzeichner hervor:
Die aktuellen Gesetzesvorschläge würden dagegen Hindernisse und Nachteile für die Teilnehmer des offenen Ökosystems schaffen. Die Organisationen vertreten sowohl kommerzielle als auch gemeinnützige Interessengruppen im Open-Source-KI-Ökosystem. vis
Der britische Physiker und Experte für erneuerbare Energien James “Jim” Ferguson Skea wird für die nächsten fünf bis sieben Jahre als Vorsitzender den UN-Klimarat IPCC leiten. Eine Mehrheit der Delegationsvertreter bei der 59. IPCC-Versammlung im kenianischen Nairobi stimmte vergangene Woche für den Briten. Er wird als neuer Chef das einflussreiche Gremium an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik leiten.
Jim Skea ist beim IPCC und in der Politik kein Unbekannter: Seit 40 Jahren ist der 69-Jährige, der am Imperial College in London als Professor für nachhaltige Energie lehrt, in der Klimawissenschaft aktiv, seit 30 Jahren beim IPCC. Zuletzt leitete er als Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe III (Mitigation of Climate Change) die Arbeit an diesem Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichts. Zuvor schrieb er maßgeblich am einflussreichen “1,5-Grad-Bericht” des IPCC von 2018 und am Sondergutachten zur Landnutzung 2019 mit.
Skea erklärte nach seiner Wahl seine Prioritäten für die Arbeit, zu der unter anderem die Erstellung des 7. Sachstandsberichts gehört. Er will:
Skea hatte in seiner Bewerbung seine Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft herausgestellt – an dieser Schnittstelle arbeitet auch der IPCC. Denn die Organisation rekrutiert sich zwar aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vieler Fachrichtungen aus der ganzen Welt, stimmt aber alle ihre Berichte bis ins letzte Detail mit Vertretern der jeweiligen Regierungen ab. Auch die Kandidaten für IPCC-Posten werden offiziell von ihren Herkunftsländern nominiert, Skea also von der britischen Regierung.
Dabei setzte sich Skea gegen drei Mitbewerber durch, im zweiten Wahlgang gegen die Mathematikerin und Klimaforscherin Thelma Krug aus Brasilien mit 90 zu 69 Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang waren der Belgier Jean-Pascal von Ypersele und die Südafrikanerin Debra Roberts ausgeschieden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gremiums hatten zwei Frauen für den prestigeträchtigen Posten als IPCC-Vorsitzende kandidiert. bp
Nach vorläufigen Daten von US-Forschern ist der Nordatlantik so heiß wie nie seit Beginn ihrer Datenreihe vor rund 40 Jahren. Seine Durchschnittstemperatur lag nach Daten der Plattform “Climate Reanalyzer” der University of Maine am 29. Juli – dem bis Montagnachmittag letzten ausgewerteten Datum – bei 25,0 Grad. Der Rekordwert betrug bislang 24,9 Grad und wurde in den Tagen 1. bis 7. September 2022 erreicht.
Bei den Auswertungen von “Climate Reanalyzer” handele es sich um sogenannte Reanalysen, erklärte Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel kürzlich. “Es fließen nicht nur real gemessene Wetterdaten ein, sondern auch Modellrechnungen.” Die endgültigen Temperaturanalysen folgen später.
Als Hauptgrund für den Anstieg gelten die menschengemachten Treibhausgase. Über 90 Prozent der durch sie entstehenden Wärme werde von den Ozeanen aufgenommen, sagte Latif am Montag. Dadurch seien sie in bis zu 2000 Meter Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden – mit Folgen nicht nur für die Ökosysteme. Seit März weise die Oberfläche der Meere global Rekordtemperaturen für den jeweiligen Monat auf. Nun komme allmählich das Klimaphänomen El Niño hinzu. Das natürliche Wetterphänomen könne die im Zuge der Klimakrise ohnehin steigenden Temperaturen zusätzlich in die Höhe treiben.
Zum Nordatlantik zählen die Experten der Uni Maine die Fläche vom Äquator bis zum 60. Breitengrad Nord, der nördlich von Schottland liegt sowie vom nullten Längengrad, der durch London geht, bis zum 80. Längengrad West, an dem Florida liegt. dpa
Bildung.Table. Rechtsextremismus in Schule. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) gerät wegen der rechtsextremen Vorfälle an einer Schule in die Kritik. Im Gespräch mit Table.Media verteidigt er seine Doppelstrategie von Transparenz und Dienstweg. Und warnt vor Schnellschüssen. Mehr
ESG.Table. Wasserverbrauch der Industrie: Es drohen Verteilungskonflikte. Die Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung hat kürzlich den Bundestag passiert. Sie soll eine Harmonisierung oder sogar eine bundesweite Regelung zum Wasserentnahmeentgelt prüfen. Noch bedienen sich Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft überwiegend nach Belieben. Das birgt angesichts der Klimakrise aber erhebliches Konfliktpotenzial. Mehr
China.Table. De-Risking: “Wir müssen die Risiken aushalten.” Die auf China spezialisierte Ökonomin Doris Fischer beschreibt die Risiken, denen sich die Wirtschaft stellen muss – und die Schwierigkeiten dabei, sie abzubauen. Unternehmen und Politik tun sich trotz des Aufrufs zum De-Risking schwer, effektiv umzusteuern. Klar ist aber auch: Die Firmen brauchen die Regierung gar nicht, um Risiken zu erkennen. Mehr
AgriFood.Table. Die Dürre zeigt die Gefahren des Klimawandels für die Landwirtschaft. China leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten – und das in eigentlich wasserreichen Regionen des Südens und Südwestens. Die Expertin für Landwirtschaft und Lebensmittel in China, Michaela Böhme, sieht die Lage auch als Weckruf an Peking, die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit ernst zu nehmen. Mehr
Climate.Table. Deutschland: Unterstützung für Klimabewegung drastisch gesunken. Die Unterstützung für die Klimabewegung in Deutschland sinkt über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg drastisch, zeigt eine neue Studie. Klimaschutz bleibt den Menschen zwar wichtig. Doch Forschende warnen vor einem Kulturkampf. Mehr

Veränderung ist eine wichtige Antwort auf viele Zukunftsfragen, die sich aktuell stellen, sagt Tanja Brühl. “Was ist unser Beitrag zu den notwendigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen – zur Nachhaltigkeitswende oder zur fortschreitenden Digitalisierung? Wie gehen wir als Universität mit veränderten und sich weiter dynamisch entwickelnden globalen Rahmenbedingungen um? Wie können wir als Universitäten wieder agieren und weniger auf immer neue Krisen reagieren?” Die Präsidentin der TU Darmstadt weiß, dass strategische Ziele überdacht und sich Universitäten ein Stück weit neu erfunden müssen.
An der TU Darmstadt gehe man diese Veränderungen ganz konkret an, es gebe einen Strategieprozess, der Neues für Forschung, Studium und Lehre, die Dritte Mission, Internationalisierung, und Diversität bedeutet und Schritt für Schritt umgesetzt wird. “An den Strategien für Nachhaltigkeit und Digitalisierung arbeiten wir gerade. Und, ganz im Sinne der twin transformation, denken wir diese beiden Strategien zusammen”, sagt Brühl.
Dass Veränderungen auch im Wissenschaftssystem insgesamt notwendig sind, zeigt für Brühl exemplarisch die Debatte rund um die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. “Die hier vorgebrachten Argumente und Vorschläge gehen weit über die Gestaltung von Regelungen für Befristungen für wissenschaftliche Qualifizierungsphasen hinaus. Es gilt, über akademische Karrierewege und die Ausgestaltung von Stellen ganz neu nachzudenken”. Das geschehe bereits jetzt – an den einzelnen Institutionen, auch in Darmstadt, aber auch im Kreis der Universitäten insgesamt.
Dabei gehe es ganz klar auch um Fragen der Finanzierung. “Wissenschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Dafür brauchen die Universitäten eine auskömmliche Finanzierung. Wir benötigen Unterstützung, um die zusätzlichen Belastungen zu tragen.”
Um etwa dem lauter werdenden Ruf nach mehr und schnelleren Innovationen begegnen zu können, hat die TU Darmstadt die Strategie für die sogenannte Dritte Mission unserer Universität entwickelt – neben Forschung und Lehre. “Wir wollen mehr leisten als im Bild des klassischen Wissens- und Technologietransfers angelegt”, sagt Brühl. Man denke jenseits des unidirektionalen Transfers von Innovationen aus der Universität in die Anwendung in Wirtschaft und Industrie. “Wir leben die Interaktion und den Austausch mit all unseren Partner:innen – in Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Kultur. Wir wollen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse nach außen tragen, sondern ebenso genau zuhören, was unsere Partner brauchen.”
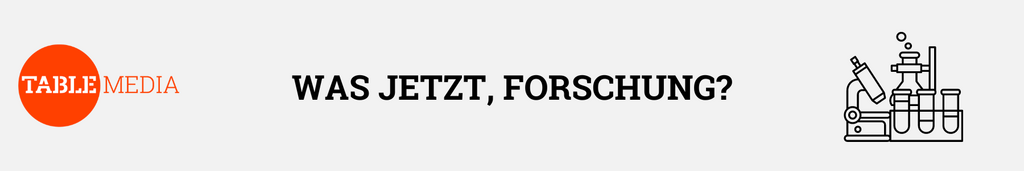
Selbstverständlich bleiben Ausgründungen und Start-ups an der TU Darmstadt wichtig. “Darauf bin ich stolz, als TU Darmstadt sind wir in diesem Bereich auch äußerst erfolgreich”, sagt Brühl. “Wir zählen zu den innovativsten Universitäten in Deutschland.” Studierende und Mitarbeitende setzten ihre vielen kreativen Ideen in die Tat um und gründeten erfolgreich neue Unternehmen. Man will noch erfolgreicher werden und Start-ups noch besser unterstützen, sagt Brühl.
“Da die möglichen Strukturen innerhalb der Universität an Grenzen stoßen, gründen wir gerade eine gGmbH zur Innovationsförderung. Hier können wir zusätzliches, auch privates Geld, einwerben, um junge Unternehmen noch besser zu begleiten. Denn allein mit den Mitteln aus der Grundfinanzierung des Landes können wir das nicht stemmen; damit bleiben wir nicht wettbewerbsfähig.”
In Sachen Dati begrüßt Tanja Brühl die im Juli veröffentlichte Förderrichtlinie. Diese mache deutlich, Dati sei zuallererst ein Förderinstrument für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. “Diese Klarstellung ist gut. Dati kann kein Instrument sein, um den Wissens- und Technologietransfer in Deutschland grundlegend zu verändern.” Es sei nicht sinnvoll, eine Förderung durch Dati abhängig zu machen von der Größe einer Institution.
“Disruptive Innovationen entstehen aus der Grundlagenforschung. Und die wiederum findet statt an forschungsstarken Universitäten. Gerade als Technische Universität entwickeln wir mit unseren gut aufgestellten Ingenieur- und Naturwissenschaften Lösungen für Zukunftsfragen.” An der TU Darmstadt sei man eingebunden in lebendige und stetig wachsende Innovationsökosysteme und verfüge über ausgezeichnete Expertise im Bereich Start-ups und Ausgründungen. Diese hätte man gern im Rahmen von Dati eingebracht und von einer Förderung profitiert. Die andere politische Schwerpunktsetzung gelte es nun zu akzeptieren.
Wenn Tanja Brühl einen Blick nach vorne werfen dürfte und einen Wunsch frei hätte, dann würde sie sich eine angemessene Finanzierung des Hochschulsystems in Deutschland wünschen. “Eine Finanzierung, mit der wir unsere Ziele in Forschung, Lehre und Dritter Mission realisieren können. Damit Universitäten weiterhin Orte der Innovation bleiben, an denen wir gemeinsam kreativ sein können.”
Das ganze Interview lesen Sie in unserer Rubrik “Was jetzt, Forschung?” Diese Reihe enthält Impulse aus den Gesprächen u. a. mit Jan Wörner (Acatech), Rafael Laguna de la Vera (Sprind), Volker Meyer-Guckel (Stifterverband), Georg Schütte (VolkswagenStiftung), Otmar D. Wiestler (Helmholtz-Gemeinschaft) und Walter Rosenthal (Uni Jena).

Die USA haben außerirdische Flugobjekte geborgen und untersucht! Glauben Sie nicht? Damit sind Sie nicht allein – dazu aber später. Tatsächlich behaupteten zwei frühere Militärpiloten und ein früherer Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums vor dem US-Kongress, die USA habe außerirdische Flugobjekte geborgen und untersucht. Letzterer heißt David Grusch und erklärte, es habe “über Jahrzehnte” ein Programm der US-Regierung gegeben, um geborgene Ufo-Teile zu untersuchen. Laut Grusch sei Material “nicht menschlichen” Ursprungs gefunden worden, wie Agenturen berichten. Der Newsseite “The Debrief” hatte er bereits im Juni erzählt, die US-Regierung sei in Besitz eines außerirdischen Flugobjekts “von der Größe eines Football-Feldes“. Unter Eid vor dem US-Kongress hat er diese beiden Aussagen jetzt allerdings nicht wiederholt.
Die Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) glaubt sowieso nicht daran, dass die US-Regierung außerirdische Flugobjekte geborgen hat, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. 28 Prozent der Befragten allerdings halten die Möglichkeit solcher Entdeckungen für plausibel, während 17 Prozent sich zu keiner Aussage bezüglich des Themas äußerten. Befragt wurden über 13.000 Menschen in Deutschland, die älter als 18 Jahre waren. Ein Trost für alle Ufosis: Die USA bleiben dran! Man will weiter penibel Ausschau halten, es sei schließlich potenziell eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Nicola Kuhrt
