bis zu den nächsten Bundestagswahlen ist es (höchstwahrscheinlich) noch etwas hin, aber die Hochschulen für angewandte Forschung (HAW) haben in einem Zehn-Punkte-Papier, dessen Entwurf uns vorliegt, schon einmal ihre wichtigsten Forderungen an eine neue Regierung aufgestellt. Darin nennen sie unter anderem eine bessere finanzielle Ausstattung für Forschung und Transfer. Sie streben eine Milliarde Euro jährlich für die Transferagentur Dati an und plädieren für insgesamt 150 Millionen Euro für die Forschung an HAWs. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, sollen internationale Studierende leichter nach Deutschland kommen. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.
In der Berliner BBAW traf sich am Dienstag der Scientific Council des European Research Council (ERC). Mehrfach wurde betont, dass die Forschungsförderung durch den Europäischen Forschungsrat ein Erfolgsmodell sei. ERC-Präsidentin Maria Leptin hob den Bedarf für ein höheres Budget hervor. Fast parallel dazu wurde in Brüssel der Bericht der Heitor-Experten-Gruppe zur Zukunft des Horizon-Programms vorgestellt. In “Align, Act, Accelerate” machen die 15 Experten, darunter Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, konkrete Empfehlungen, um mit “Forschung, Technologie und Innovation die europäische Wettbewerbsfähigkeit” zu steigern.
Nach vielen Jahren der Untätigkeit in der Förderung der Batterieforschung hat Deutschland in den vergangenen 15 Jahren eine Aufholjagd gestartet, sich international etabliert und große Erfolge erzielt, berichtet Martin Winter von der Universität Münster. Dieser Infrastrukturaufbau brauche im Betrieb Verlässlichkeit und Kontinuität in der Förderung. Mit der Entscheidung des BMBF, ab 2025 keine neuen Projekte in der Batterieforschung zu fördern, ist das Dachkonzept Batterieforschung hinfällig, kritisiert Winter in seinem Standpunkt. “Diese besorgniserregenden Entwicklungen stellen keinesfalls nur die Batterieforschung vor Probleme. Sie führen uns vielmehr vor Augen, mit welcher (politischen) Kurzsichtigkeit Deutschland technologieübergreifend konfrontiert ist.”
Ich wünsche Ihnen einen weitsichtigeren Start in den Tag,

Bereits ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl positionieren sich die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). In einem Zehn-Punkte-Papier, das Table.Briefings im Entwurf vorliegt, fordern sie von einer neuen Bundesregierung, den “Innovationsmotor HAW” anzuerkennen und stärker zu fördern. Dort entstünden viele Ideen und Innovationen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Kernpunkte des Forderungskatalogs sind:
Volker Banholzer von der TH Nürnberg begrüßt die Forderungen mit Blick auf die generell geringere Ausstattung der HAWs für Forschung und Transfer. Sowohl die Gewinnung von Professorinnen und Professoren mit fundierter Berufserfahrung und wissenschaftlicher Expertise, als auch der Ausbau der Dauerstellen in der angewandten Wissenschaft seien tatsächlich förderbedürftig. Diese Förderung sei gerade mit Blick auf noch ungehobene Potenziale der HAWs im Bereich der Netzwerkbildung wichtig, betont der Professor für Innovationskommunikation. Und: Man könne den HAWs diese Aufgaben im Bereich Forschung und Transfer zutrauen. “Die Kompetenzen haben sie. Die Ausstattung und die Mission hierfür muss seitens der F&I-Politik auf Bundes- und Länderebene kommen.”
Der Zehn-Punkte-Plan wird aktuell auf der Bad Wiesseer Tagung der HAWs diskutiert und soll am heutigen Donnerstag verabschiedet werden. Eine finale Fassung wird in Kürze auf www.badwiesseerkreis.de veröffentlicht.

Aus forschungspolitischer Sicht bleibt es eine der “unendlichen Geschichten” dieser Legislaturperiode: die ungelöste Situation rund um das Besserstellungsverbot für gemeinnützige industrienahe Forschungseinrichtungen. Mit einer veränderten Verwaltungspraxis hatten BMF, BMWK und BMBF die Institute 2021 – noch in der vorangegangenen Legislatur – vor die Perspektive gestellt, auf Fördermittel des Bundes verzichten zu müssen, wenn sie ihr Leitungspersonal übertariflich bezahlen. Diese empfanden das als Benachteiligung. Im Februar schien das Problem gelöst: Durch einen neuen Passus im Haushaltsgesetz für das Jahr 2024 können industrienahe Forschungsinstitute Leitungspersonal wieder marktüblich zahlen, so die weitläufige Interpretation.
Doch anschließend wurden neue Fragen und Unsicherheiten laut: Unklar bleibt, was es für die Institute bedeutet, wenn bessergestelltes Leitungspersonal “weder mittelbar noch unmittelbar von der deutschen öffentlichen Hand” bezahlt werden darf, so die Zusammenfassung des Passus. Juristisch ließe sich das nämlich so interpretieren: Die Einrichtungen dürfen niemanden besserstellen, der auch nur zu einem kleinen Teil aus einem Bundes- oder auch beispielsweise EU-Projekt – denn das wäre mittelbar – finanziert wird. In der Koalition wusste man im April – in der Stellungnahme auf eine Unionsanfrage – auch keine abschließende Antwort, wollte aber zunächst die Verwaltungspraxis abwarten.
Für mehr Klarheit, wenn auch eine unerfreuliche aus Sicht der Institute, sorgte dann im Juli ein Anhang zu einem BMWK-Rundschreiben, der Table.Briefings vorliegt. In dem als “FAQ zu § 8 Abs. 2 S. 3 HG 2024” betitelten Schreiben, stellt das Ministerium klar, wie der Zusatz zum Haushaltsgesetz zu interpretieren ist. Es heißt: “Grundsätzlich sind Personen, deren Vergütung nicht in den Personaleinzelkosten der Kalkulation bzw. den Personalausgaben des Projektes ausgewiesen sind, nicht unmittelbar im Projekt beschäftigt”. Dieses Personal kann damit besser als Entgeltgruppe 15 TVöD gestellt sein. Auch Mittel aus öffentlichen Aufträgen können für die Besserstellung verwendet werden, sie fallen nicht unter den Passus “Finanzierung von der deutschen öffentlichen Hand”. Der Begriff “mittelbar” beziehe sich auf Förderung durch EU-Mittel. So weit, so gut.
Entscheidend für den wieder aufflammenden Unmut der Institute ist dann aber eine weitere Ausführung: “Das übersteigende Gehalt darf in Gänze nicht aus Mitteln der öffentlichen Hand bezahlt werden, damit die Ausnahme gem. § 8 Abs. 2 S. 3 HG 2024 einschlägig ist”, heißt es zur Erläuterung wie der Begriff “übersteigendes Gehalt” auszulegen ist. Damit ist klar, die Institute müssen ihr bessergestelltes Führungspersonal zukünftig allein aus Drittmitteln bezahlen, selbst den Gehaltsanteil, der nicht über eine TVöD-gemäße Bezahlung hinaus geht.
Was das für die Institute bedeutet, schildern Kathrin Goldammer und Christine Kühnel, Geschäftsführerinnen des Reiner Lemoine Instituts (RLI) in Berlin. Das Institut ist auf anwendungsorientierte Forschung für die Energie- und Verkehrswende ausgerichtet. Ein erstes Projekt in der Größenordnung von knapp einer Million Euro steht – nach monatelangen Vorbereitungen – plötzlich wieder auf der Kippe. “Wir machen anwendungsorientierte Forschung, aber nicht im Auftrag der Großindustrie, wo man vielleicht Umsätze erwirtschaftet, mit denen man ein volles Jahresgehalt außerhalb des TVöD finanzieren kann. Und ich vermute, dass es auch anderen Instituten so geht”, sagt Christine Kühnel im Gespräch mit Table.Briefings.
Überraschend habe man Anfang Oktober erfahren, dass man vor einem “wirklich großen Problem” stehe. Ein Projektträger habe die Genehmigung eines unterschriftsreifen Verbundprojekts auf Eis gelegt, an dem man – gemeinsam mit Wirtschaftspartnern – seit April zusammengearbeitet hatte. Begründung: das RLI halte das Besserstellungsverbot nicht ein. Hintergrund: Ende September lief eine – bis dahin immer wieder verlängerte – Übergangsfrist aus, die der Gesetzgeber Instituten eingeräumt hatte. Dass man über solche wichtigen Entscheidungen wie neue Auslegungen der Rechtslage nur über Umwege erfahre, sei für das ganze Thema “leider so üblich”, sagt Kathrin Goldammer.
Seit dem Jahr 2022 hätte man mehrmals versucht, Kontakt zu den Ministerien aufzunehmen. Neue Entwicklungen seien aber immer nur über einen Projektträger kommuniziert worden. Auf Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, die auch über den PT eingereicht wurden, sei nie eine Reaktion erfolgt. Darunter würden besonders kleine Institute wie das RLI leiden, die keinem größeren Verband, wie etwa der Zuse-Gemeinschaft angehören, und keine politische Lobby haben. “Wir zahlen hier forschungsübliche Gehälter und befinden uns – wir sind ein ingenieurwissenschaftliches Institut – im Wettbewerb mit Unternehmen und großen Forschungsgesellschaften um geeignetes Personal”, sagt Goldammer. Man kämpfe um jedes Projekt und immer wieder um die Förderquote.
Wenn die aktuelle Situation so bleibt, werde dem RLI die Arbeitsgrundlage entzogen. Man finde es grundsätzlich richtig, dass es das Besserstellungsverbot gibt, damit Steuergelder nicht verschwendet werden. “Besonders frustrierend finde ich aber, dass sich in den vergangenen zwei Jahren niemand die Arbeit gemacht hat, zu überlegen, was denn verlässliche Regeln für eine Ausnahmegenehmigung wären”, sagt Goldammer. Diese Sacharbeit sei nicht geleistet worden. Es gebe zum Beispiel auch für den öffentlichen Dienst Tabellen, die für besondere Aufgaben eine höhere Bezahlung vorsehen. Diese könnte man als Grundlage für die Geschäftsführungen von Forschungsinstituten auch heranziehen. “Man beobachtet eine Ungleichbehandlung in der Forschungslandschaft, obwohl der Gesetzgeber an Wettbewerb in dem Bereich interessiert sein müsste”.
Goldammer und Kühnel bleibt nichts übrig, als wieder Ausnahmeanträge zu stellen und die parteipolitische Debatte zu verfolgen. Für die Union waren die neuen Unsicherheiten Anlass dazu, im Juni einen zweiten Antrag zur Flexibilisierung des Besserstellungsverbots zu stellen. Der erste, mit dem Vorschlag, die betreffenden Institutionen unter das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) zu stellen, erhielt im April erwartungsgemäß keine Parlamentsmehrheit. Im zweiten, der in der vergangenen Woche zum ersten Mal im Bundestag debattiert wurde, wird diese Forderung nun erneuert. Mit der Ergänzung, “dass die Bezahlungen, die über den öffentlichen Dienst hinaus gehen, einfach aus privaten Mitteln erstattet werden könnten”, fasste es Thomas Jarzombek (CDU) in seiner Rede zusammen und bat die Regierung bis dahin, um eine pragmatische Auslegung der geltenden Verwaltungspraxis.
“Sie haben es geschafft, aus einer schlechten Regelung eine noch schlechtere zu machen”, warf Stefan Albani (CDU), der Ampelkoalition vom Rednerpult aus vor. Dass Betriebe ihre geförderten Mitarbeitenden anders als die übrigen bezahlen sollten, sei “realitätsfern”. Auch die Tatsache, dass sich die Einrichtungen jetzt wieder gezwungen sähen, Ausnahmegenehmigungen für das laufende Jahr zu stellen, obwohl die Frist zur Einreichung bereits im September abgelaufen sei, sei “kaum zu glauben”.
Die Bundesregierung hatte in den vergangenen beiden Jahren mit Verweis auf die Rechtslage darauf bestanden, dass Institute, die Ausnahmen vom Besserstellungsverbot, zum Beispiel für ihre Geschäftsführung erreichen wollen, einen Ausnahmeantrag stellen müssen. Nach der Zusatzregelung im Haushaltsgesetz hatte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums im Februar, auf Anfrage von Table.Briefings, die bereits eingereichten Anträge als “gegenstandslos” bezeichnet. Auf eine spätere Anfrage der Union zum aktuellen Bearbeitungs- und Sachstand eingegangener Anträge hat die Bundesregierung bislang nicht reagiert.
In der Debatte gab sich die Koalition dann auch kleinlaut. Während die SPD-Parlamentarier Ye-One Rhie und Holger Becker ihre Reden zu Protokoll geben ließen, stellte sich als einziger Regierungsvertreter Stephan Seiter (FDP) der Diskussion. Das Thema sei “sehr komplex”, sagte Seiter. Eine Regelung über das WissFG würde dazu führen, dass man dieses immer wieder anfassen müsse, um neue Institutionen aufzunehmen. Das sei nicht praktikabel. Man sei aber zu “weiteren Änderungen und Anpassungen bereit“, sollte sich herausstellen, dass die Lösung über das Haushaltsgesetz nicht praktikabel sei. Für Kathrin Goldammer und Christine Kühnel vom Reiner-Lemoine-Institut ist dieser Fall längst eingetreten. Politisch geht das Thema dann in absehbarer Zeit im Forschungsausschuss in die nächste Runde.


Jonas Andrulis – Gründer und Geschäftsführer von Aleph Alpha
Der Wirtschaftsingenieur Jonas Andrulis zählt zu den wenigen Rückkehrern aus dem Silicon Valley. Nach drei Jahren als Engineering Manager für KI-Forschung bei Apple gründete er im Jahr 2019 in Heidelberg das KI-Unternehmen Aleph Alpha. Als er an der US-Westküste in der Entwicklung gearbeitet habe, sei jeder Fünfte dort aus Deutschland gewesen, sagte er Table.Briefings. Nun müssten ähnliche Ökosysteme auch in Deutschland und Europa entstehen. Aleph Alpha hat sich auf Anwendungen für öffentliche Verwaltung und Industrie spezialisiert, es legt Wert auf erklärbare und vertrauenswürdige Produkte und ist Partner des von der Schwarz-Stiftung geförderten IPAI-Campus. Vor einem Jahr gelang es dem Unternehmen, mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar von Investoren zu erhalten.

Stephan Kothrade – CTO von BASF SE
Stephan Kothrade ist Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer (CTO) der BASF SE in Ludwigshafen am Rhein. Kothrade studierte Chemie an der Universität Heidelberg und promovierte in Organischer Chemie an der LMU München, bevor er 1995 seine Laufbahn bei BASF begann. BASF beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Forschung. Insgesamt investiert das Unternehmen jährlich rund zwei Milliarden Euro in diesen Bereich. Mehr als 1.000 Patentanmeldungen gingen im Jahr 2023 aus den F&E-Anstrengungen von BASF hervor.

Marie-Luise Wolff – Vorsitzende des Vorstands von Entega Plus
Eine der wichtigsten Energiemanagerinnen Deutschlands steht seit 2013 an der Spitze der Entega AG mit Sitz in Darmstadt. Seit 2015 ist sie außerdem Vorstandsvorsitzende der Entega Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz zu fördern. Ihre berufliche Laufbahn in der Industrie startete die Anglistin und Musikwissenschaftlerin 1987 bei der Bayer AG. Ihr Engagement für Wissenschaft und Forschung unterstreicht die Vorstandsvorsitzende, die 2019 als erste Frau zur Energiemanagerin des Jahres gewählt wurde, unter anderem als Mitglied und Vorsitzende des Hochschulrates der Technischen Universität Darmstadt.
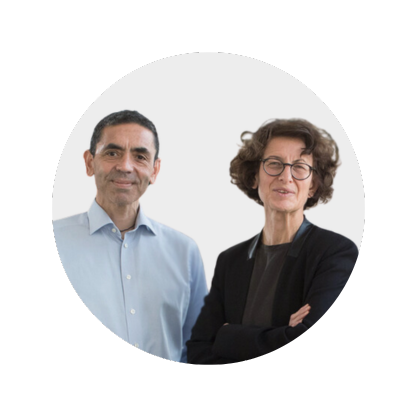
Uğur Şahin und Özlem Türeci – CEO und CMO von BioNTech
Die beiden gibt es grundsätzlich als Duo. Özlem Türeci und Uğur Şahin, Chief Medical Officer beziehungsweise Chief Executive Officer des Mainzer Unternehmens Biontech, reüssieren als forschendes Ehepaar und als Kinder von türkischen Migranten (Türecis Vater kam nach Hannover, um als Chirurg zu arbeiten; Şahins Vater nach Köln zu den Ford-Werken). Vor allem aber haben sie auf dem Weg von der Grundlagenforschung in die Anwendung einen langen Atem bewiesen. Die Zulassung ihres ersten Produkts hat die ganze Welt ersehnt: Es war der erste Impfstoff gegen Covid-19. Ihre ursprüngliche Motivation für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ist es, individualisierte Krebstherapien zu entwickeln. Dass sie Anfang 2023 die Biontech-Krebsforschung nach London verlegt haben, begründeten sie mit starren Rahmenbedingungen hierzulande.

Stefan von Holtzbrinck – Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
Stefan von Holtzbrinck ist bekannt als CEO der Holtzbrinck Verlagsgruppe. Seit 2021 ist er dort Vorsitzender der Geschäftsführung. Die Verlagsgruppe legt Schwerpunkte auf den Wissenschaftsverlag (Springer Nature) und das Technologiegeschäft (Digital Science). Zur Gruppe gehören außerdem namhafte Medienunternehmen wie ZEIT, Macmillan Publishers und die Holtzbrinck Buchverlage. Mit seinem Privatvermögen nimmt von Holtzbrinck aber auch außerhalb der Verlagsgruppe großen Einfluss auf die Wissenschaft. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Max-Planck-Förderstiftung, die er 2006 gemeinsam mit Reinhard Pöllath gründete, und Ehrensenator der Max-Planck-Gesellschaft.

Claudia Nemat – Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG
Claudia Nemat ist nicht nur Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzende der T-Systems International und Mitglied des Verwaltungsrats von Airbus. Geboren wurde Nemat in Bensberg im Bergischen Land, ihr Vater war Atomphysiker. Nemat selbst studierte Physik und Mathematik an der Universität zu Köln – und war eine der wenigen Frauen im Hörsaal. Ihr Vorbild wurde Nobelpreisträgerin Marie Curie. Der Ausspruch: “Es gibt nichts zu fürchten und viel zu verstehen!” wurde Nemats Motto. Bevor sie zur Telekom ging, arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Detlev Riesner – Gründer / CEO von Qiagen
Wer im Labor arbeitet, kommt an Detlev Riesner nicht vorbei – zumindest indirekt: 1984, Riesner leitete das Institut für Physikalische Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, entwickelten drei seiner Studenten (Metin Colpan, Karsten Henco und Jürgen Schumacher) ein neues chemisches Verfahren, um Nukleinsäuren schneller und zuverlässiger vom Rest des Zellmaterials zu trennen. Mit der neuen Methode verringerte sich die Dauer der Probenvorbereitung von drei Tagen auf zwei Stunden – eine Revolution für die Forschung. Gemeinsam gründeten sie die “Diagen Institut für Molekularbiologische Diagnostik GmbH”. Aus einem der ersten deutschen Biotech-Spin-offs entwickelte sich innerhalb weniger Jahre das globale Unternehmen Qiagen, das heute an der Börse gelistet ist und weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Markus Roth – Mitgründer und Chief Science Officer von Focused Energy
Hype oder nicht – Fusionsenergie ist ein Trendthema der wissenschaftspolitischen Debatte in den vergangenen Jahren. Angefangen mit dem viel zitierten erfolgreichen Experiment an der National Ignition Facility in Kalifornien, über die Diskussionen, wie eine sinnvolle deutsche Förderstrategie aussehen soll, bis hin zu millionenschweren Finanzierungsrunden, von denen auch Deutschlands Start-up-Szene profitiert. Einer der führenden Köpfe dieser Szene ist Markus Roth. Selbst renommierter Fusionsforscher an der TU Darmstadt, ist Roth Mitgründer und Chief Science Officer des Laserfusion-Start-ups Focused Energy. Roth glaubt, dass es Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Förderung ist. Auf dem Weg zu einem ersten Fusionskraftwerk sollte nicht mehr die Wissenschaft, sondern die Industrie den Lead übernehmen.

Roland Busch – Vorstandsvorsitzender der Siemens AG
Seit drei Jahren ist Roland Busch Siemens-Chef. Seine berufliche Karriere bei der Siemens AG begann der promovierte Physiker 1994 als Projektleiter in der Zentralabteilung für Forschung und Entwicklung in Erlangen. Seit 2011 ist er Mitglied des Vorstands, 2016 wurde er Chief Technology Officer, zwei Jahre später Chief Operating Officer. Im Oktober 2019 wurde Busch zum Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser ernannt, dem er zum 3. Februar 2021 nachgefolgte. Busch ist Mitglied des acatech-Senats. Die Siemens AG hat im Jahr 2023 rund 6,2 Milliarden Euro in die Forschung investiert. Im Bereich F&E hat sie mehr als 50.000 Mitarbeitende, die im vergangenen Jahr rund 5.400 Erfindungen gemacht und 2.900 Patente eingereicht haben.

Gernot Döllner – Vorstandsvorsitzender der Audi AG
Der Ingenieur und Manager wurde 2023 zum Vorsitzenden des Audi-Vorstands berufen. Der bisherige Entwicklungschef musste im Frühjahr 2024 gehen, Döllner übernahm den Posten zusätzlich. Von 1998 bis 2021 war Döllner bei Porsche – zuletzt als Leiter Produkt und Konzept. Bei seinem Wechsel zu Audi kündigte er an, die Marke wieder nach vorne zu bringen. Zuletzt wurde bekannt, dass er kräftig restrukturiert und im Entwicklungsbereich das Baureihenprinzip einführen will. Zur E-Mobilität spricht er Klartext. Im Dezember 2033 soll der letzte Audi ohne Batterieantrieb vom Band laufen. Das wäre zwei Jahre vor dem in der EU geplanten Aus für die Verbrennerproduktion.
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
28. November 2024, Berlin
Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr
In der parlamentarischen Debatte zur 1. Lesung des Gesetzesentwurfs zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes lieferten sich Regierungs- und Oppositionsparteien am Dienstagabend einen launigen, aber vorhersehbaren Schlagabtausch. Gleich zu Beginn war eher das erwähnenswert, was nicht erwähnt wurde. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger konstatierte, dass “Wissenschaft sich nicht in eine Schema F pressen lässt” und die Leistung der Gesetzesnovelle daher sein müsse, einerseits die Planbarkeit für Karrieren, andererseits den Wettbewerbsgedanken der Wissenschaft miteinander zu vereinbaren.
Stark-Watzinger betonte auch die Erfolge der Bundesregierung im Ringen um flankierende Maßnahmen, wie ein Bund-Länder-Programm für Tenure-Track-Professuren – noch von der Vorgängerregierung initiiert – und das Professorinnen-Programm. Gänzlich unerwähnt ließ die Ministerin allerdings das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur. Das BMBF war bei dem Versuch gescheitert, einen Dialog mit den Ländern dazu zu eröffnen. Ein Bericht, den das Ministerium dem Haushaltsausschuss Ende September vorlegen musste, war auch aus der Koalition selbst scharf kritisiert worden.
Mit Kritik am Gesetzgebungsprozess des WissZeitVG sparte dann auch Thomas Jarzombek, forschungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, nicht. Das Vorgehen des Ministeriums hätte ihn an ein Kinderbuch mit dem Titel “Bettina bummelt” erinnert, sagte Jarzombek und nannte Stark-Watzinger mit Verweis auch auf weitere stockende Großprojekte wie die Gründung der Dati oder die verzögerte Besetzung des Ethikrats die “Ministerin der Bauruinen”. Inhaltlich forderte Jarzombek eine Mittelbau-Strategie, Anreize für Department-Strukturen an Hochschulen, neue Stellenkategorien neben der Professur und Verbesserungen im Bereich des Kapazitätsrechts.
In den Beiträgen der Regierungsparteien, namentlich Carolin Wagner, Holger Mann und Oliver Kaczmarek (alle SPD), Laura Kraft (Grüne) und Stephan Seiter (FDP), zeichneten sich dann die möglichen Bruch- und Kompromisslinien ab. Während die SPD vor allem eine weitgehende Aufhebung der Tarifsperre fordert, erneuerte Laura Kraft ihre Forderung an das BMBF, das flankierende Dauerstellen-Programm in Angriff zu nehmen. Stephan Seiter betonte dagegen die Andersartigkeit des Wissenschafts-Arbeitsmarktes und verwies auf die besondere Bedeutung der Qualifikation. Erwartet wird, dass die Ampelparteien die teilweise Aufhebung der Tarifsperre in Angriff nehmen. Für welche konkreten Punkte die Sperre entfallen könnte, war aus der Debatte derweil nicht abzulesen.
Nicole Gohlke (Die Linke) mahnte die Bundesregierung zur Eile. Die unhaltbaren Befristungs-Bedingungen, die Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften berechtigterweise kritisierten, würden seit mehr als 15 Jahren bestehen. Insbesondere Frauen würden sich noch zu oft gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, weil diese nicht planbar sei. Nach fast vier Jahren Ampelregierung hätte sich daran nichts geändert. Die unbefristete Beschäftigung müsse zur Regel werden und die Tarifsperre komplett verschwinden. “Schreiben sie gerne aus unserem Antrag ab, er liegt ihnen vor”, schloss Gohlke die erste parlamentarische Debatte. tg
In der Berliner BBAW hat sich am Mittwoch der Scientific Council des European Research Council (ERC) getroffen. Bei der Veranstaltung “Shaping Excellent Research in Europe – Excellent Research Shaping Europe’s Tomorrow” wurde mehrfach betont, dass die Forschungsförderung durch den ERC – er wurde im Jahr 2007 gegründet – ein Erfolgsmodell sei. ERC-Präsidentin Maria Leptin hob den Bedarf für ein höheres Budget hervor, denn der ERC könne bei weitem nicht alle förderungswürdigen Anträge fördern. “Vierzig Prozent der guten Ideen gehen leer aus”, sagte sie. Noch dazu sei bisher keinerlei Inflationsausgleich bei der Höhe der Grants erfolgt. “Das muss korrigiert werden.”
Fast parallel dazu wurde in Brüssel der Bericht der High Level Experten-Gruppe zur Zukunft des Horizon-Programms unter Führung des ehemaligen portugiesischen Wissenschaftsministers Manuel Heitor vorgestellt. In “Align, Act, Accelerate” nennen die 15 Experten konkrete Punkte, um mit “Forschung, Technologie und Innovation die europäische Wettbewerbsfähigkeit” zu steigern. Die Gruppe empfiehlt ebenfalls, das Budget des ERC zu verdoppeln und die Unabhängigkeit fortzusetzen. “Eine Verdopplung des Budgets ist das Mindeste, was wir brauchen”, sagte Maria Leptin dazu in Berlin. Es würde bedeuten: statt 100 künftig 200 Milliarden für sieben Jahre.
Zu den Spekulationen über Pläne, Teile von Horizon Europe einem EU-weiten Wettbewerbsfähigkeitsfonds zuzuordnen, nahm Leptin nicht explizit Stellung. Sie wies aber darauf hin, dass es “nicht einen Prozess für alle” geben könne.
Die Experten der Heitor-Gruppe werden in ihrem Bericht ebenfalls auffallend deutlich: “Disruptive, Paradigmenwechsel auslösende Forschung und Innovation, die ganze Volkswirtschaften oder Gesellschaften umgestaltet, wird wahrscheinlich nicht durch die herkömmlichen Verfahren und Programme gefördert, die heute in der EU vorherrschen”, heißt es darin. Die meisten Forschungsprogramme der EU und auch der einzelnen Länder seien nur “inkrementelle wissenschaftliche Fortschritte, Entwicklung und Innovation” und würden keine Paradigmenwechsel unterstützen.
Agenturen auf der ganzen Welt experimentieren aktuell mit neuen Arten der Finanzierung, und die EU müsse sich dringend dieser Welle anschließen. Sonst laufe sie Gefahr, abgehängt zu werden, warnte Manuel Heitor in einem Interview mit dem Magazin ScienceBusiness. “Europa muss diesen Prozess anführen.”
Im “Align, Act, Accelerate”-Bericht fordern die Experten die EU auf, “umgehend” eine “Experimentiereinheit” einzurichten, um “neue Programme, Bewertungsverfahren und Instrumente” zu testen.
Außerdem rät die Heitor-Gruppe, die Ambitionen zu steigern: Zu viele Start-ups würden aktuell wegziehen, weil es in Europa keine Finanzierungsperspektiven gibt. Gleichzeitig überholten andere Weltregionen Europa, insbesondere in innovativen Technologiefeldern, wie der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Daher müssten alle Forschungs- und Innovationsprojekte, die als herausragend anerkannt werden, umfassender gefördert werden. Daher müsse das Budget von derzeit 95 Milliarden Euro auf 220 Milliarden Euro erhöht werden.
Forschen in der EU müsse dringend attraktiver werden, schreibt die Heitor-Gruppe. Die europäische Industrie habe offenbar das Interesse an der EU-Forschungsförderung verloren. Auch der Vorteil, im vorwettbewerblichen Bereich mit Partnern aus anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, sei aufgrund zunehmender bürokratischer Belastungen verloren gegangen. “Es braucht ein Rahmenprogramm, das grenzüberschreitende Forschungskooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen einfacher und nutzerfreundlicher macht”, erklärt Georg Schütte zu den Empfehlungen. Der Generalsekretär der VolkswagenStiftung war einer der 15 Experten der Heitor-Gruppe.
Europa könne nur erfolgreich agieren, wenn es von den Mitgliedsstaaten unterstützt und gestärkt wird. “Mehrwert entsteht, wenn wir unsere Kräfte bündeln, etwa bei gemeinsam genutzten Großgeräten oder Testplattformen für neue Technologien”, erklärt Schütte. Aktuell gebe es hier noch zu viel Stückwerk, zu viele kleinteilige Kompromisse.
Die Heitor-Gruppe empfiehlt außerdem, auch mit schwierigen Partnern zu kooperieren: Man könne über Europas Grenzen hinaus erfolgreich arbeiten, wenn vorab die eigenen Forschungsinteressen definiert werden. Die Länder Europas könnten die nationale Sicherheit nicht mehr allein gewährleisten, es brauche Kooperationen.
Heitors Bericht ist der zweite Bericht zur EU-Forschung innerhalb von wenigen Wochen, mit dem die EU aufgefordert wird, ihre eigene Darpa zu gründen – oder zumindest eine Art von Darpa-inspirierter Innovationsagentur. Zunächst erklärte dies der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi in seinen wichtigsten Empfehlungen für Forschung und Innovation der EU. Auch die Heitor-Gruppe möchte, dass der EIC mit Programmen vom Typ Arpa experimentiert. Wenn dieses Modell erfolgreich sei, könnte es in anderen Bereichen des Rahmenprogramms eingeführt werden. abg / nik
Den utopischen Heilsversprechen, aber auch den dystopischen Warnungen in Bezug auf generative Künstliche Intelligenz (KI) stellt sich ein Diskussionspapier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina entgegen. Das Papier mit dem Titel “Generative KI – jenseits von Euphorie und einfachen Lösungen”, das am heutigen Donnerstag veröffentlicht wird, wirft stattdessen, wie die Autorinnen schreiben, “einen realistischen Blick” auf die Chancen und Risiken.
Die drei Autorinnen Judith Simon (Lehrstuhl für Ethik in der Informationstechnologie, Universität Hamburg), Indra Spiecker gen. Döhmann (Lehrstuhl für das Recht der Digitalisierung, Universität Köln) und Ulrike von Luxburg (Professur für Theorie des Maschinellen Lernens, Universität Tübingen) kommen zu dem Schluss, dass eine Reihe von ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen beziehungsweise Gefahren bisher zu wenig beachtet und debattiert werden. Zu den “nicht ausreichend reflektierten, gleichwohl schwerwiegenden Gefahren” für Individuen, Demokratie, Wirtschaft und Gesellschaft gehören demnach:
Die Autorinnen weisen darauf hin, dass viele der von ihnen genannten Gefahren durch den AI Act der EU und andere Gesetzeswerke nicht oder nicht ausreichend adressiert werden. Die Vor- und Nachteile offener KI-Modelle beispielsweise gelte es öffentlich zu diskutieren und angemessen abzuwägen, um “ausbalancierte, praktikable und demokratieverträgliche Technologielösungen” bereitzustellen.
Vor dem Hintergrund laufender Diskussionen um die Entwicklung vertrauenswürdiger KI in Europa und eines damit verbundenen Wettbewerbsvorteils sei es geboten, Maßnahmen zur Schadensvermeidung zu forcieren – und vor überhöhten Erwartungen zu warnen. abg
Welt: Unsicherheit bei KI-Einsatz an Hochschulen. Universitäten überlassen es den Dozenten, mit welchen Methoden sie überprüfen, wie stark KI bei Hausarbeiten verwendet wurden. Einheitliche Regelungen gibt es nicht. Viele Studenten sind deshalb unsicher, wie sie KI bei ihrer Arbeit einsetzen können. (“Betrug bei schriftlichen Arbeiten? Das KI-Problem für die Unis”)
Forschung & Lehre: Zahl der Teilzeitstudenten ist zurückgegangen. Im Wintersemester 2023/24 studierten nur noch 217.000 Menschen in Teilzeit. Das entspricht einem Rückgang von 6.000 Studierenden im Vergleich zum Vorjahr. Seit dem Höchststand im Jahr 2020 ist die Zahl der Teilzeitstudierenden insgesamt um 13.000 gesunken. Damit liegt der Anteil der Teilzeitstudierenden an der Gesamtzahl der Studenten aktuell bei nur noch 7,6 Prozent. (“Weniger Teilzeitstudierende in Deutschland”)
taz: Diskussion über Finanzbildung. Die Bundesregierung will mit dem Online-Portal “mitgeldundverstand.de” die Finanzbildung stärken. Über 200 Experten und Organisationen haben eigene Beiträge eingereicht. Kritiker halten das Angebot für zu finanzmarktfreundlich. (“”FDP-Inhalte” getarnt als Bildung”)
Standard: Mehr Labore zur Pandemievorbereitung. Wissenschaftler fordern in Österreich die Einrichtung von Hochsicherheitslaboren, um schnell auf weltweite Seuchen reagieren zu können. Zurzeit existiert in dem Land keine Einrichtung, die dem Biosafety Level 4, der höchsten Schutzstufe, entspricht. (“Mehr Hochsicherheitslabore gegen neue Erreger und Pandemien gefordert”)
FAZ: Hessischen Hochschulen droht ein heißer Herbst. In den nächsten Wochen könnte es an den hessischen Hochschulen zu zahlreichen Protesten kommen. Wenn es um Klima, den Krieg im Nahen Osten und geplante Einsparungen an den Universitäten geht, sind Straftaten der Demonstranten nicht auszuschließen. Auf diese sollten die Hochschulen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln reagieren. (“Wo die Toleranz enden muss”)
Tagesspiegel: Exzellenzverbund der Berliner Unis muss sich beweisen. Die Berliner Hochschulen müssen im Exzellenzverbund zeigen, dass ihre Zusammenarbeit zu Synergien führt. Es muss das Ziel sein, die Gutachter, die über die Exzellenzförderung des Bundes entscheiden, zu überzeugen. (“Berliner Exzellenzverbund der Unis: Ist er “too big to fail”?”)
FAZ: Thüringer Akademiker gegen die AfD. Akademiker in Thüringen fürchten den wachsenden Einfluss der AfD in der Hochschulpolitik. Die Partei akzeptiere Wissenschaft nur, wenn ihre Ergebnisse in das ideologische Konzept der AfD passen. Ziel der Akademiker-Initiative ist es auch, Bürgern aufzuzeigen, dass die AfD keine Alternative sei. (“Wie sich die AfD auf Forschung und Studium auswirkt”)
BNN: Meuthen kehrt an die Hochschule zurück. Der ehemalige AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen wird ab von Januar kommenden Jahres wieder als Hochschullehrer an der Hochschule für öffentliche Verwaltung im baden-württembergischen Kehl arbeiten. Meuthens Dienstverhältnis war seit 2016 unterbrochen, als er für die AfD in den Stuttgarter Landtag einzog. (“Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen unterrichtet bald angehende Staatsdiener”)

Dass das BMBF keine Haushaltsmittel für die Förderung der Batterieforschung in 2025 eingeplant hat, entsetzt die Community. Erste Konsequenzen wie der Verlust von Know-how sind spürbar, dabei müsste gerade jetzt der Transfer von Forschungsergebnissen forciert werden.
Nach vielen Jahren der Untätigkeit in der Förderung in diesem Forschungsgebiet hat Deutschland in den vergangenen 15 Jahren eine Aufholjagd gestartet, sich in der Batterieforschung international etabliert und große Erfolge erzielt. Und das mit einer durchdachten Strategie: Mit dem Dachkonzept Batterieforschung des BMBF ist das Ökosystem Batterieforschung in Deutschland strukturiert und mit fest definierten Zielen aufgebaut worden und stetig gewachsen.
Bund und Länder haben in den letzten Jahren enorme Mittel in die Hand genommen, um große Forschungsinfrastrukturen zu realisieren. Darunter zum Beispiel das Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL) in Aachen, das MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster, die Helmholtz-Institute in Ulm (KIT) und in Münster (Forschungszentrum Jülich) sowie die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in Münster.
Dieser Infrastrukturaufbau braucht im Betrieb Verlässlichkeit und Kontinuität in der Förderung. Gerade Transferzentren wie die Fraunhofer FFB sind auf eine funktionierende, dauerhaft angelegte Innovationspipeline angewiesen. Anders gesagt: ohne Ökosystem, kein Transfer. Wir stellen uns also selbst aufs Abstellgleis. Das bedeutet konkret:
Diese besorgniserregenden Entwicklungen stellen keinesfalls nur die Batterieforschung vor Probleme. Sie führen uns vielmehr vor Augen, mit welcher (politischen) Kurzsichtigkeit Deutschland technologieübergreifend konfrontiert ist. Anders formuliert, lassen sich die obigen drei Punkte auch auf andere Technologien und Forschungszweige übertragen:
Deutschland braucht Klarheit und Verlässlichkeit in der Förderung, ebenso wie die notwendige Priorisierung, welche Technologien nachhaltig gefördert werden. Das gibt Forschungseinrichtungen, Nachwuchskräften und Unternehmen gleichermaßen Planungssicherheit, um Potenziale vollständig ausschöpfen zu können. Nur so können wir Deutschlands Position als globalen Hightech-Standort sichern.

Man muss kein Klimawandelleugner sein, um das Gefühl zu haben, dass Klimadaten und -Modelle mitunter ganz schön abstrakt sein können. Verhaltensänderungen oder zumindest die Motivation dazu, sind aber vom direkten Erleben abhängig, das ist gut untersucht. Was wäre also, wenn man Klimadaten nicht nur sehen, sondern auch riechen, anfassen und schmecken könnte? Diese Idee stellt die Designerin Tiange Wang im November auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin vor.
Sie hat gezeigt, dass sich aus den Daten zur weltweiten Gletscherschmelze oder zum CO₂-Fußabdruck der Industrie ein sinnliches Erlebnis machen lässt. Tiange Wang, eine multidisziplinäre Designerin und Technikvisionärin aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts, hat sich von der traditionellen japanischen Süßwarenkunst Wagashi inspirieren lassen. Sie hat mit ihrem Partner I-Yang Huang mit DataWagashi ein neues Medium geschaffen, das darauf abzielt, Klimadaten greifbarer, zugänglicher und unterhaltsamer zu gestalten.

“DataWagashi sollen die Kluft zwischen Informationen und persönlichen Beziehungen überbrücken und eine besser informierte und einfühlsamere Gesellschaft fördern”, sagt die Designerin in einem Interview mit der Falling Walls Foundation. Häufig sind es Szenen aus der Natur, die als Motive für die Herstellung von traditionellen Wagashi dienen – DataWagashi haben die Klimakrise zum Thema.
Um das Komplexe offensichtlich zu machen, serviert Tiange Wang innerhalb eines DataWagashi-Sets, das jeweils aus mehreren süßen Würfeln besteht, immer extremere Inhalte: Je mehr Kaffee sich in einem DataWagashi-Würfel befindet, desto größer ist die CO₂-Bilanz und desto bitterer schmeckt er. Je mehr weißer Sesam und je mehr trockene Blütenblätter ein Würfel enthält, desto trüber der Würfel und desto körniger die Textur, die ebenfalls den höheren CO₂-Gehalt in der Luft widerspiegeln soll.

“DataWagashi sollen die Art und Weise, wie wir Daten wahrnehmen und mit ihnen umgehen, verändern und sie interaktiver, integrativer und wirkungsvoller zu machen”, sagt Wang.
In ihrer Arbeit geht es Tiange Wang, die an der University of California in Berkeley und an der Harvard Graduate School of Design Architektur studiert hat, um positive Nutzererlebnisse. Zusammen mit I-Yang Huang realisiert Tiange Wang in ihrem multidisziplinären “V-Lab” in Cambridge seit 2021 Designprojekte, die die Perspektiven von Usern und Unternehmen verbinden und neue, innovative Lösungen schaffen.
Eine ihrer ersten Arbeiten: Ein digital aktiviertes Raumverkaufssystem für die Stadt der nahen Zukunft, bei dem Nutzer die Raumnutzung für verschiedene Wellness-Aktivitäten über ein Verkaufssystem erwerben können. Mit solchen Projekten hat sich Wang auch international längst einen Namen gemacht: Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und zum Beispiel auf dem NYCxDesign Festival und dem Vancouver International Film Festival präsentiert.
Wie kann man sich den Arbeitsprozess der Designerin vorstellen? “Den ganzen Tag über tauchen wir in den Designprozess ein, skizzieren Konzepte, verfeinern Details und hinterfragen Annahmen“, sagt Wang. Freuen würden sie sich über die “Heureka”-Momente, wenn eine Lösung auf Anhieb funktioniert: “Wenn der Tag sich banal anfühlt, sind es die kleinen Überraschungen – eine clevere Einsicht oder eine bahnbrechende Idee -, die unsere Begeisterung neu entfachen und uns weitermachen lassen.”
Neben ihrer Arbeit im “V-Lab” ist Wang seit 2022 Designerin bei IDEO, einer internationalen Design- und Innovationsberatung. Hier beschäftigt sie sich zum Beispiel mit der Frage, wie sich Emotionen in Produkte einbauen lassen. Auf Wangs Linkedin-Profil kann man sich anschauen, wie so ein Produkt aussehen könnte: Ein Mann und ein sozialer Roboter umarmen einander. Gabriele Voßkühler
Tiange Wang ist Gewinnerin des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Kunst und Wissenschaft. Sie spricht am 9. November 2024 um 12.15 Uhr auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summits finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Antje Boetius, wissenschaftliche Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, wechselt nach Kalifornien. Die Meeresbiologin verlässt Deutschland, um ab Mai 2025 das Amt der Präsidentin des renommierten Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) zu übernehmen. Boetius steht seit sieben Jahren an der Spitze des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Das Institut und das BMBF kündigten an, zeitnah eine Nachfolge zu suchen.
Philipp Niemann wird neuer Geschäftsführer des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Er übernimmt das Amt zum 1. November 2024 von Beatrice Lugger, die die Einrichtung der Klaus Tschira Stiftung gGmbH und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zum Jahresende verlässt. Der promovierte Medienwissenschaftler Niemann ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung und wissenschaftlicher Leiter der NaWik gGmbH. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der qualitativen Rezeptionsforschung.
Daniel Rudolf ist neuer Leiter der Leitungsabteilung im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Er folgt auf Jörn Hasler, der künftig die Abteilung für Grundsatzfragen und Strategien leitet. Rudolf war bereits in verschiedenen Positionen im BMBF tätig, unter anderem als Leiter Planung und Steuerung sowie als Leiter Kommunikation. Vor seiner Zeit im BMBF war er Bereichsleiter in der Parlamentarischen Geschäftsführung der FDP-Fraktion im Bundestag.
Gerhard Schneider, ehemaliger Rektor der Hochschule Aalen, ist mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Der Naturwissenschaftler stand von 2008 bis 2022 an der Spitze der Hochschule und setzte sich in dieser Zeit für die strategische Weiterentwicklung der Hochschule Aalen sowie für den Bildungs- und Innovationsstandort Ostwürttemberg ein. Auch hatte er maßgeblichen Anteil an der Erteilung des Promotionsrechts an die baden-württembergischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Empirische Bildungsforschung: Was das neue Rahmenprogramm des BMBF bietet. Gut 300 Millionen Euro will das BMBF in den kommenden Jahren für die empirische Bildungsforschung ausgeben. Jetzt steht der Rahmen dafür fest. Einige Schwerpunkte sind neu gesetzt. Mehr
Bildung.Table. Digitalpakt: Warum sich Bund und Länder weiter uneins sind. Bund und Länder sind sich weiter uneinig, wie die Finanzierung eines neuen Digitalpakts aussehen soll. Die Verhandlungen laufen weiter. Mehr
Climate.Table. Kreislaufwirtschaft: Dieses Potenzial für Klimaschutz schlummert in Pilzen. Mit der Nationalen Kreislaufstrategie will die Bundesregierung vollständig recyclebare Stoffkreisläufe schaffen. Die Forschung und erste Start-ups sehen Pilze als geeignetes Material dafür. Sie können auch an vielen anderen Stellen zum Klimaschutz beitragen. Mehr
Agrifood.Table. NGT: Warum der Non-GMO-Sektor bei der Regulierung Zeit gewinnen will. Der Non-GMO-Sektor kämpft weiter dafür, dass neue Züchtungstechniken als Gentechnik klassifiziert und gekennzeichnet werden müssen. Die Branche sieht sich aber auch vor großen Herausforderungen, da noch immer offene Fragen bestehen, wie diese Forderung in der Praxis umgesetzt werden könnte. Mehr
Europe.Table. Energierat: “Russisches Gas ist eine gefährliche Wahl”. Auseinandersetzungen um Atomenergie und um russisches Gas bestimmen das erste reguläre Treffen der Energieminister unter ungarischem Vorsitz. Die scheidende Energiekommissarin richtet einen emotionalen Appell an die Mitgliedstaaten. Mehr

Peking – Washington DC – Berlin: Das klingt forschungspolitisch momentan eher nach einem wenig harmonischen Dreiklang. In Deutschland sind in dieser Legislatur China-Strategien und Papiere zur Forschungssicherheit geschrieben worden. Die USA bauen gar ein Secure-Center auf. MPG-Präsident Patrick Cramer hat gesagt, dass der globale Innovationsmotor ins Stocken gerät, weil die Amerikaner sich von den Chinesen abkoppeln. De-Risking statt De-Coupling? War gestern für einen Tag alles egal.
Denn die Stunde der Panda-Diplomatie hat geschlagen. Während in der US-Hauptstadt ein eigens für die beiden dreijährigen Pandas Bao Li und Qing Bao umgebautes und umgestaltetes FedEx-Frachtflugzeug namens “Panda-Express” aus Peking landete, wurde etwa zeitgleich in Berlin der neueste Panda-Nachwuchs des Hauptstadt-Zoos der Öffentlichkeit präsentiert. Auch die zwei Monate alten Zwillingsschwestern sind Nachwuchs der chinesischen “Leihmutter” Meng Meng. Am Dienstag wurde brav in die Kameras gewinkt (siehe Foto), am gestrigen Mittwoch durfte der erste Publikumsbesuch empfangen werden. Der Andrang war riesig.
Währenddessen müssen die beiden Pandas in DC noch für einen Monat in Quarantäne. First Lady Jill Biden hatte den “historischen Moment” für die US-Hauptstadt bereits im Mai offiziell angekündigt. Sie betonte dabei die Bedeutung des Austauschs, der neben dem Artenschutz auch als Symbol der diplomatischen Bemühungen zwischen China und den USA gilt. Wie nachhaltig diese Form der Diplomatie ist, bleibt abzuwarten. 2034 müssen die beiden neuen Washingtonians zurück nach Peking. Die Berliner Bären schon 2028. Hoffentlich können sie ihren nicht ganz einfachen Job bis dahin erfüllen. Tim Gabel
bis zu den nächsten Bundestagswahlen ist es (höchstwahrscheinlich) noch etwas hin, aber die Hochschulen für angewandte Forschung (HAW) haben in einem Zehn-Punkte-Papier, dessen Entwurf uns vorliegt, schon einmal ihre wichtigsten Forderungen an eine neue Regierung aufgestellt. Darin nennen sie unter anderem eine bessere finanzielle Ausstattung für Forschung und Transfer. Sie streben eine Milliarde Euro jährlich für die Transferagentur Dati an und plädieren für insgesamt 150 Millionen Euro für die Forschung an HAWs. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, sollen internationale Studierende leichter nach Deutschland kommen. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet.
In der Berliner BBAW traf sich am Dienstag der Scientific Council des European Research Council (ERC). Mehrfach wurde betont, dass die Forschungsförderung durch den Europäischen Forschungsrat ein Erfolgsmodell sei. ERC-Präsidentin Maria Leptin hob den Bedarf für ein höheres Budget hervor. Fast parallel dazu wurde in Brüssel der Bericht der Heitor-Experten-Gruppe zur Zukunft des Horizon-Programms vorgestellt. In “Align, Act, Accelerate” machen die 15 Experten, darunter Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, konkrete Empfehlungen, um mit “Forschung, Technologie und Innovation die europäische Wettbewerbsfähigkeit” zu steigern.
Nach vielen Jahren der Untätigkeit in der Förderung der Batterieforschung hat Deutschland in den vergangenen 15 Jahren eine Aufholjagd gestartet, sich international etabliert und große Erfolge erzielt, berichtet Martin Winter von der Universität Münster. Dieser Infrastrukturaufbau brauche im Betrieb Verlässlichkeit und Kontinuität in der Förderung. Mit der Entscheidung des BMBF, ab 2025 keine neuen Projekte in der Batterieforschung zu fördern, ist das Dachkonzept Batterieforschung hinfällig, kritisiert Winter in seinem Standpunkt. “Diese besorgniserregenden Entwicklungen stellen keinesfalls nur die Batterieforschung vor Probleme. Sie führen uns vielmehr vor Augen, mit welcher (politischen) Kurzsichtigkeit Deutschland technologieübergreifend konfrontiert ist.”
Ich wünsche Ihnen einen weitsichtigeren Start in den Tag,

Bereits ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl positionieren sich die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). In einem Zehn-Punkte-Papier, das Table.Briefings im Entwurf vorliegt, fordern sie von einer neuen Bundesregierung, den “Innovationsmotor HAW” anzuerkennen und stärker zu fördern. Dort entstünden viele Ideen und Innovationen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Kernpunkte des Forderungskatalogs sind:
Volker Banholzer von der TH Nürnberg begrüßt die Forderungen mit Blick auf die generell geringere Ausstattung der HAWs für Forschung und Transfer. Sowohl die Gewinnung von Professorinnen und Professoren mit fundierter Berufserfahrung und wissenschaftlicher Expertise, als auch der Ausbau der Dauerstellen in der angewandten Wissenschaft seien tatsächlich förderbedürftig. Diese Förderung sei gerade mit Blick auf noch ungehobene Potenziale der HAWs im Bereich der Netzwerkbildung wichtig, betont der Professor für Innovationskommunikation. Und: Man könne den HAWs diese Aufgaben im Bereich Forschung und Transfer zutrauen. “Die Kompetenzen haben sie. Die Ausstattung und die Mission hierfür muss seitens der F&I-Politik auf Bundes- und Länderebene kommen.”
Der Zehn-Punkte-Plan wird aktuell auf der Bad Wiesseer Tagung der HAWs diskutiert und soll am heutigen Donnerstag verabschiedet werden. Eine finale Fassung wird in Kürze auf www.badwiesseerkreis.de veröffentlicht.

Aus forschungspolitischer Sicht bleibt es eine der “unendlichen Geschichten” dieser Legislaturperiode: die ungelöste Situation rund um das Besserstellungsverbot für gemeinnützige industrienahe Forschungseinrichtungen. Mit einer veränderten Verwaltungspraxis hatten BMF, BMWK und BMBF die Institute 2021 – noch in der vorangegangenen Legislatur – vor die Perspektive gestellt, auf Fördermittel des Bundes verzichten zu müssen, wenn sie ihr Leitungspersonal übertariflich bezahlen. Diese empfanden das als Benachteiligung. Im Februar schien das Problem gelöst: Durch einen neuen Passus im Haushaltsgesetz für das Jahr 2024 können industrienahe Forschungsinstitute Leitungspersonal wieder marktüblich zahlen, so die weitläufige Interpretation.
Doch anschließend wurden neue Fragen und Unsicherheiten laut: Unklar bleibt, was es für die Institute bedeutet, wenn bessergestelltes Leitungspersonal “weder mittelbar noch unmittelbar von der deutschen öffentlichen Hand” bezahlt werden darf, so die Zusammenfassung des Passus. Juristisch ließe sich das nämlich so interpretieren: Die Einrichtungen dürfen niemanden besserstellen, der auch nur zu einem kleinen Teil aus einem Bundes- oder auch beispielsweise EU-Projekt – denn das wäre mittelbar – finanziert wird. In der Koalition wusste man im April – in der Stellungnahme auf eine Unionsanfrage – auch keine abschließende Antwort, wollte aber zunächst die Verwaltungspraxis abwarten.
Für mehr Klarheit, wenn auch eine unerfreuliche aus Sicht der Institute, sorgte dann im Juli ein Anhang zu einem BMWK-Rundschreiben, der Table.Briefings vorliegt. In dem als “FAQ zu § 8 Abs. 2 S. 3 HG 2024” betitelten Schreiben, stellt das Ministerium klar, wie der Zusatz zum Haushaltsgesetz zu interpretieren ist. Es heißt: “Grundsätzlich sind Personen, deren Vergütung nicht in den Personaleinzelkosten der Kalkulation bzw. den Personalausgaben des Projektes ausgewiesen sind, nicht unmittelbar im Projekt beschäftigt”. Dieses Personal kann damit besser als Entgeltgruppe 15 TVöD gestellt sein. Auch Mittel aus öffentlichen Aufträgen können für die Besserstellung verwendet werden, sie fallen nicht unter den Passus “Finanzierung von der deutschen öffentlichen Hand”. Der Begriff “mittelbar” beziehe sich auf Förderung durch EU-Mittel. So weit, so gut.
Entscheidend für den wieder aufflammenden Unmut der Institute ist dann aber eine weitere Ausführung: “Das übersteigende Gehalt darf in Gänze nicht aus Mitteln der öffentlichen Hand bezahlt werden, damit die Ausnahme gem. § 8 Abs. 2 S. 3 HG 2024 einschlägig ist”, heißt es zur Erläuterung wie der Begriff “übersteigendes Gehalt” auszulegen ist. Damit ist klar, die Institute müssen ihr bessergestelltes Führungspersonal zukünftig allein aus Drittmitteln bezahlen, selbst den Gehaltsanteil, der nicht über eine TVöD-gemäße Bezahlung hinaus geht.
Was das für die Institute bedeutet, schildern Kathrin Goldammer und Christine Kühnel, Geschäftsführerinnen des Reiner Lemoine Instituts (RLI) in Berlin. Das Institut ist auf anwendungsorientierte Forschung für die Energie- und Verkehrswende ausgerichtet. Ein erstes Projekt in der Größenordnung von knapp einer Million Euro steht – nach monatelangen Vorbereitungen – plötzlich wieder auf der Kippe. “Wir machen anwendungsorientierte Forschung, aber nicht im Auftrag der Großindustrie, wo man vielleicht Umsätze erwirtschaftet, mit denen man ein volles Jahresgehalt außerhalb des TVöD finanzieren kann. Und ich vermute, dass es auch anderen Instituten so geht”, sagt Christine Kühnel im Gespräch mit Table.Briefings.
Überraschend habe man Anfang Oktober erfahren, dass man vor einem “wirklich großen Problem” stehe. Ein Projektträger habe die Genehmigung eines unterschriftsreifen Verbundprojekts auf Eis gelegt, an dem man – gemeinsam mit Wirtschaftspartnern – seit April zusammengearbeitet hatte. Begründung: das RLI halte das Besserstellungsverbot nicht ein. Hintergrund: Ende September lief eine – bis dahin immer wieder verlängerte – Übergangsfrist aus, die der Gesetzgeber Instituten eingeräumt hatte. Dass man über solche wichtigen Entscheidungen wie neue Auslegungen der Rechtslage nur über Umwege erfahre, sei für das ganze Thema “leider so üblich”, sagt Kathrin Goldammer.
Seit dem Jahr 2022 hätte man mehrmals versucht, Kontakt zu den Ministerien aufzunehmen. Neue Entwicklungen seien aber immer nur über einen Projektträger kommuniziert worden. Auf Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, die auch über den PT eingereicht wurden, sei nie eine Reaktion erfolgt. Darunter würden besonders kleine Institute wie das RLI leiden, die keinem größeren Verband, wie etwa der Zuse-Gemeinschaft angehören, und keine politische Lobby haben. “Wir zahlen hier forschungsübliche Gehälter und befinden uns – wir sind ein ingenieurwissenschaftliches Institut – im Wettbewerb mit Unternehmen und großen Forschungsgesellschaften um geeignetes Personal”, sagt Goldammer. Man kämpfe um jedes Projekt und immer wieder um die Förderquote.
Wenn die aktuelle Situation so bleibt, werde dem RLI die Arbeitsgrundlage entzogen. Man finde es grundsätzlich richtig, dass es das Besserstellungsverbot gibt, damit Steuergelder nicht verschwendet werden. “Besonders frustrierend finde ich aber, dass sich in den vergangenen zwei Jahren niemand die Arbeit gemacht hat, zu überlegen, was denn verlässliche Regeln für eine Ausnahmegenehmigung wären”, sagt Goldammer. Diese Sacharbeit sei nicht geleistet worden. Es gebe zum Beispiel auch für den öffentlichen Dienst Tabellen, die für besondere Aufgaben eine höhere Bezahlung vorsehen. Diese könnte man als Grundlage für die Geschäftsführungen von Forschungsinstituten auch heranziehen. “Man beobachtet eine Ungleichbehandlung in der Forschungslandschaft, obwohl der Gesetzgeber an Wettbewerb in dem Bereich interessiert sein müsste”.
Goldammer und Kühnel bleibt nichts übrig, als wieder Ausnahmeanträge zu stellen und die parteipolitische Debatte zu verfolgen. Für die Union waren die neuen Unsicherheiten Anlass dazu, im Juni einen zweiten Antrag zur Flexibilisierung des Besserstellungsverbots zu stellen. Der erste, mit dem Vorschlag, die betreffenden Institutionen unter das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) zu stellen, erhielt im April erwartungsgemäß keine Parlamentsmehrheit. Im zweiten, der in der vergangenen Woche zum ersten Mal im Bundestag debattiert wurde, wird diese Forderung nun erneuert. Mit der Ergänzung, “dass die Bezahlungen, die über den öffentlichen Dienst hinaus gehen, einfach aus privaten Mitteln erstattet werden könnten”, fasste es Thomas Jarzombek (CDU) in seiner Rede zusammen und bat die Regierung bis dahin, um eine pragmatische Auslegung der geltenden Verwaltungspraxis.
“Sie haben es geschafft, aus einer schlechten Regelung eine noch schlechtere zu machen”, warf Stefan Albani (CDU), der Ampelkoalition vom Rednerpult aus vor. Dass Betriebe ihre geförderten Mitarbeitenden anders als die übrigen bezahlen sollten, sei “realitätsfern”. Auch die Tatsache, dass sich die Einrichtungen jetzt wieder gezwungen sähen, Ausnahmegenehmigungen für das laufende Jahr zu stellen, obwohl die Frist zur Einreichung bereits im September abgelaufen sei, sei “kaum zu glauben”.
Die Bundesregierung hatte in den vergangenen beiden Jahren mit Verweis auf die Rechtslage darauf bestanden, dass Institute, die Ausnahmen vom Besserstellungsverbot, zum Beispiel für ihre Geschäftsführung erreichen wollen, einen Ausnahmeantrag stellen müssen. Nach der Zusatzregelung im Haushaltsgesetz hatte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums im Februar, auf Anfrage von Table.Briefings, die bereits eingereichten Anträge als “gegenstandslos” bezeichnet. Auf eine spätere Anfrage der Union zum aktuellen Bearbeitungs- und Sachstand eingegangener Anträge hat die Bundesregierung bislang nicht reagiert.
In der Debatte gab sich die Koalition dann auch kleinlaut. Während die SPD-Parlamentarier Ye-One Rhie und Holger Becker ihre Reden zu Protokoll geben ließen, stellte sich als einziger Regierungsvertreter Stephan Seiter (FDP) der Diskussion. Das Thema sei “sehr komplex”, sagte Seiter. Eine Regelung über das WissFG würde dazu führen, dass man dieses immer wieder anfassen müsse, um neue Institutionen aufzunehmen. Das sei nicht praktikabel. Man sei aber zu “weiteren Änderungen und Anpassungen bereit“, sollte sich herausstellen, dass die Lösung über das Haushaltsgesetz nicht praktikabel sei. Für Kathrin Goldammer und Christine Kühnel vom Reiner-Lemoine-Institut ist dieser Fall längst eingetreten. Politisch geht das Thema dann in absehbarer Zeit im Forschungsausschuss in die nächste Runde.


Jonas Andrulis – Gründer und Geschäftsführer von Aleph Alpha
Der Wirtschaftsingenieur Jonas Andrulis zählt zu den wenigen Rückkehrern aus dem Silicon Valley. Nach drei Jahren als Engineering Manager für KI-Forschung bei Apple gründete er im Jahr 2019 in Heidelberg das KI-Unternehmen Aleph Alpha. Als er an der US-Westküste in der Entwicklung gearbeitet habe, sei jeder Fünfte dort aus Deutschland gewesen, sagte er Table.Briefings. Nun müssten ähnliche Ökosysteme auch in Deutschland und Europa entstehen. Aleph Alpha hat sich auf Anwendungen für öffentliche Verwaltung und Industrie spezialisiert, es legt Wert auf erklärbare und vertrauenswürdige Produkte und ist Partner des von der Schwarz-Stiftung geförderten IPAI-Campus. Vor einem Jahr gelang es dem Unternehmen, mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar von Investoren zu erhalten.

Stephan Kothrade – CTO von BASF SE
Stephan Kothrade ist Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer (CTO) der BASF SE in Ludwigshafen am Rhein. Kothrade studierte Chemie an der Universität Heidelberg und promovierte in Organischer Chemie an der LMU München, bevor er 1995 seine Laufbahn bei BASF begann. BASF beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Forschung. Insgesamt investiert das Unternehmen jährlich rund zwei Milliarden Euro in diesen Bereich. Mehr als 1.000 Patentanmeldungen gingen im Jahr 2023 aus den F&E-Anstrengungen von BASF hervor.

Marie-Luise Wolff – Vorsitzende des Vorstands von Entega Plus
Eine der wichtigsten Energiemanagerinnen Deutschlands steht seit 2013 an der Spitze der Entega AG mit Sitz in Darmstadt. Seit 2015 ist sie außerdem Vorstandsvorsitzende der Entega Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz zu fördern. Ihre berufliche Laufbahn in der Industrie startete die Anglistin und Musikwissenschaftlerin 1987 bei der Bayer AG. Ihr Engagement für Wissenschaft und Forschung unterstreicht die Vorstandsvorsitzende, die 2019 als erste Frau zur Energiemanagerin des Jahres gewählt wurde, unter anderem als Mitglied und Vorsitzende des Hochschulrates der Technischen Universität Darmstadt.
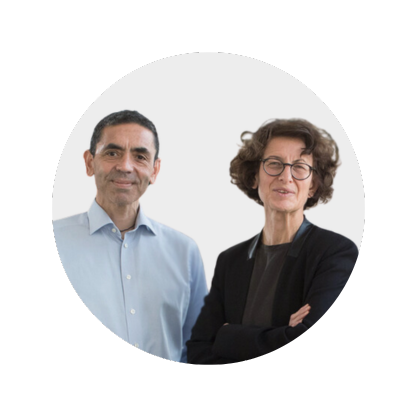
Uğur Şahin und Özlem Türeci – CEO und CMO von BioNTech
Die beiden gibt es grundsätzlich als Duo. Özlem Türeci und Uğur Şahin, Chief Medical Officer beziehungsweise Chief Executive Officer des Mainzer Unternehmens Biontech, reüssieren als forschendes Ehepaar und als Kinder von türkischen Migranten (Türecis Vater kam nach Hannover, um als Chirurg zu arbeiten; Şahins Vater nach Köln zu den Ford-Werken). Vor allem aber haben sie auf dem Weg von der Grundlagenforschung in die Anwendung einen langen Atem bewiesen. Die Zulassung ihres ersten Produkts hat die ganze Welt ersehnt: Es war der erste Impfstoff gegen Covid-19. Ihre ursprüngliche Motivation für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ist es, individualisierte Krebstherapien zu entwickeln. Dass sie Anfang 2023 die Biontech-Krebsforschung nach London verlegt haben, begründeten sie mit starren Rahmenbedingungen hierzulande.

Stefan von Holtzbrinck – Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
Stefan von Holtzbrinck ist bekannt als CEO der Holtzbrinck Verlagsgruppe. Seit 2021 ist er dort Vorsitzender der Geschäftsführung. Die Verlagsgruppe legt Schwerpunkte auf den Wissenschaftsverlag (Springer Nature) und das Technologiegeschäft (Digital Science). Zur Gruppe gehören außerdem namhafte Medienunternehmen wie ZEIT, Macmillan Publishers und die Holtzbrinck Buchverlage. Mit seinem Privatvermögen nimmt von Holtzbrinck aber auch außerhalb der Verlagsgruppe großen Einfluss auf die Wissenschaft. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Max-Planck-Förderstiftung, die er 2006 gemeinsam mit Reinhard Pöllath gründete, und Ehrensenator der Max-Planck-Gesellschaft.

Claudia Nemat – Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG
Claudia Nemat ist nicht nur Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzende der T-Systems International und Mitglied des Verwaltungsrats von Airbus. Geboren wurde Nemat in Bensberg im Bergischen Land, ihr Vater war Atomphysiker. Nemat selbst studierte Physik und Mathematik an der Universität zu Köln – und war eine der wenigen Frauen im Hörsaal. Ihr Vorbild wurde Nobelpreisträgerin Marie Curie. Der Ausspruch: “Es gibt nichts zu fürchten und viel zu verstehen!” wurde Nemats Motto. Bevor sie zur Telekom ging, arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Detlev Riesner – Gründer / CEO von Qiagen
Wer im Labor arbeitet, kommt an Detlev Riesner nicht vorbei – zumindest indirekt: 1984, Riesner leitete das Institut für Physikalische Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, entwickelten drei seiner Studenten (Metin Colpan, Karsten Henco und Jürgen Schumacher) ein neues chemisches Verfahren, um Nukleinsäuren schneller und zuverlässiger vom Rest des Zellmaterials zu trennen. Mit der neuen Methode verringerte sich die Dauer der Probenvorbereitung von drei Tagen auf zwei Stunden – eine Revolution für die Forschung. Gemeinsam gründeten sie die “Diagen Institut für Molekularbiologische Diagnostik GmbH”. Aus einem der ersten deutschen Biotech-Spin-offs entwickelte sich innerhalb weniger Jahre das globale Unternehmen Qiagen, das heute an der Börse gelistet ist und weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Markus Roth – Mitgründer und Chief Science Officer von Focused Energy
Hype oder nicht – Fusionsenergie ist ein Trendthema der wissenschaftspolitischen Debatte in den vergangenen Jahren. Angefangen mit dem viel zitierten erfolgreichen Experiment an der National Ignition Facility in Kalifornien, über die Diskussionen, wie eine sinnvolle deutsche Förderstrategie aussehen soll, bis hin zu millionenschweren Finanzierungsrunden, von denen auch Deutschlands Start-up-Szene profitiert. Einer der führenden Köpfe dieser Szene ist Markus Roth. Selbst renommierter Fusionsforscher an der TU Darmstadt, ist Roth Mitgründer und Chief Science Officer des Laserfusion-Start-ups Focused Energy. Roth glaubt, dass es Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Förderung ist. Auf dem Weg zu einem ersten Fusionskraftwerk sollte nicht mehr die Wissenschaft, sondern die Industrie den Lead übernehmen.

Roland Busch – Vorstandsvorsitzender der Siemens AG
Seit drei Jahren ist Roland Busch Siemens-Chef. Seine berufliche Karriere bei der Siemens AG begann der promovierte Physiker 1994 als Projektleiter in der Zentralabteilung für Forschung und Entwicklung in Erlangen. Seit 2011 ist er Mitglied des Vorstands, 2016 wurde er Chief Technology Officer, zwei Jahre später Chief Operating Officer. Im Oktober 2019 wurde Busch zum Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser ernannt, dem er zum 3. Februar 2021 nachgefolgte. Busch ist Mitglied des acatech-Senats. Die Siemens AG hat im Jahr 2023 rund 6,2 Milliarden Euro in die Forschung investiert. Im Bereich F&E hat sie mehr als 50.000 Mitarbeitende, die im vergangenen Jahr rund 5.400 Erfindungen gemacht und 2.900 Patente eingereicht haben.

Gernot Döllner – Vorstandsvorsitzender der Audi AG
Der Ingenieur und Manager wurde 2023 zum Vorsitzenden des Audi-Vorstands berufen. Der bisherige Entwicklungschef musste im Frühjahr 2024 gehen, Döllner übernahm den Posten zusätzlich. Von 1998 bis 2021 war Döllner bei Porsche – zuletzt als Leiter Produkt und Konzept. Bei seinem Wechsel zu Audi kündigte er an, die Marke wieder nach vorne zu bringen. Zuletzt wurde bekannt, dass er kräftig restrukturiert und im Entwicklungsbereich das Baureihenprinzip einführen will. Zur E-Mobilität spricht er Klartext. Im Dezember 2033 soll der letzte Audi ohne Batterieantrieb vom Band laufen. Das wäre zwei Jahre vor dem in der EU geplanten Aus für die Verbrennerproduktion.
30. Oktober – 1. November 2024, Heidelberg
Konferenz Wissenswerte Mehr
4. November 2024, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Diskussion Bedrohte Wissenschaft: Ungeliebte Wahrheit Mehr
7.-9. November 2024, Berlin
Konferenz Falling Walls Science Summit 2024 Mehr
28. November 2024, Berlin
Tagung Tag der Hochschulmedizin Mehr
In der parlamentarischen Debatte zur 1. Lesung des Gesetzesentwurfs zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes lieferten sich Regierungs- und Oppositionsparteien am Dienstagabend einen launigen, aber vorhersehbaren Schlagabtausch. Gleich zu Beginn war eher das erwähnenswert, was nicht erwähnt wurde. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger konstatierte, dass “Wissenschaft sich nicht in eine Schema F pressen lässt” und die Leistung der Gesetzesnovelle daher sein müsse, einerseits die Planbarkeit für Karrieren, andererseits den Wettbewerbsgedanken der Wissenschaft miteinander zu vereinbaren.
Stark-Watzinger betonte auch die Erfolge der Bundesregierung im Ringen um flankierende Maßnahmen, wie ein Bund-Länder-Programm für Tenure-Track-Professuren – noch von der Vorgängerregierung initiiert – und das Professorinnen-Programm. Gänzlich unerwähnt ließ die Ministerin allerdings das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bund-Länder-Programm für mehr Dauerstellen neben der Professur. Das BMBF war bei dem Versuch gescheitert, einen Dialog mit den Ländern dazu zu eröffnen. Ein Bericht, den das Ministerium dem Haushaltsausschuss Ende September vorlegen musste, war auch aus der Koalition selbst scharf kritisiert worden.
Mit Kritik am Gesetzgebungsprozess des WissZeitVG sparte dann auch Thomas Jarzombek, forschungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, nicht. Das Vorgehen des Ministeriums hätte ihn an ein Kinderbuch mit dem Titel “Bettina bummelt” erinnert, sagte Jarzombek und nannte Stark-Watzinger mit Verweis auch auf weitere stockende Großprojekte wie die Gründung der Dati oder die verzögerte Besetzung des Ethikrats die “Ministerin der Bauruinen”. Inhaltlich forderte Jarzombek eine Mittelbau-Strategie, Anreize für Department-Strukturen an Hochschulen, neue Stellenkategorien neben der Professur und Verbesserungen im Bereich des Kapazitätsrechts.
In den Beiträgen der Regierungsparteien, namentlich Carolin Wagner, Holger Mann und Oliver Kaczmarek (alle SPD), Laura Kraft (Grüne) und Stephan Seiter (FDP), zeichneten sich dann die möglichen Bruch- und Kompromisslinien ab. Während die SPD vor allem eine weitgehende Aufhebung der Tarifsperre fordert, erneuerte Laura Kraft ihre Forderung an das BMBF, das flankierende Dauerstellen-Programm in Angriff zu nehmen. Stephan Seiter betonte dagegen die Andersartigkeit des Wissenschafts-Arbeitsmarktes und verwies auf die besondere Bedeutung der Qualifikation. Erwartet wird, dass die Ampelparteien die teilweise Aufhebung der Tarifsperre in Angriff nehmen. Für welche konkreten Punkte die Sperre entfallen könnte, war aus der Debatte derweil nicht abzulesen.
Nicole Gohlke (Die Linke) mahnte die Bundesregierung zur Eile. Die unhaltbaren Befristungs-Bedingungen, die Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften berechtigterweise kritisierten, würden seit mehr als 15 Jahren bestehen. Insbesondere Frauen würden sich noch zu oft gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, weil diese nicht planbar sei. Nach fast vier Jahren Ampelregierung hätte sich daran nichts geändert. Die unbefristete Beschäftigung müsse zur Regel werden und die Tarifsperre komplett verschwinden. “Schreiben sie gerne aus unserem Antrag ab, er liegt ihnen vor”, schloss Gohlke die erste parlamentarische Debatte. tg
In der Berliner BBAW hat sich am Mittwoch der Scientific Council des European Research Council (ERC) getroffen. Bei der Veranstaltung “Shaping Excellent Research in Europe – Excellent Research Shaping Europe’s Tomorrow” wurde mehrfach betont, dass die Forschungsförderung durch den ERC – er wurde im Jahr 2007 gegründet – ein Erfolgsmodell sei. ERC-Präsidentin Maria Leptin hob den Bedarf für ein höheres Budget hervor, denn der ERC könne bei weitem nicht alle förderungswürdigen Anträge fördern. “Vierzig Prozent der guten Ideen gehen leer aus”, sagte sie. Noch dazu sei bisher keinerlei Inflationsausgleich bei der Höhe der Grants erfolgt. “Das muss korrigiert werden.”
Fast parallel dazu wurde in Brüssel der Bericht der High Level Experten-Gruppe zur Zukunft des Horizon-Programms unter Führung des ehemaligen portugiesischen Wissenschaftsministers Manuel Heitor vorgestellt. In “Align, Act, Accelerate” nennen die 15 Experten konkrete Punkte, um mit “Forschung, Technologie und Innovation die europäische Wettbewerbsfähigkeit” zu steigern. Die Gruppe empfiehlt ebenfalls, das Budget des ERC zu verdoppeln und die Unabhängigkeit fortzusetzen. “Eine Verdopplung des Budgets ist das Mindeste, was wir brauchen”, sagte Maria Leptin dazu in Berlin. Es würde bedeuten: statt 100 künftig 200 Milliarden für sieben Jahre.
Zu den Spekulationen über Pläne, Teile von Horizon Europe einem EU-weiten Wettbewerbsfähigkeitsfonds zuzuordnen, nahm Leptin nicht explizit Stellung. Sie wies aber darauf hin, dass es “nicht einen Prozess für alle” geben könne.
Die Experten der Heitor-Gruppe werden in ihrem Bericht ebenfalls auffallend deutlich: “Disruptive, Paradigmenwechsel auslösende Forschung und Innovation, die ganze Volkswirtschaften oder Gesellschaften umgestaltet, wird wahrscheinlich nicht durch die herkömmlichen Verfahren und Programme gefördert, die heute in der EU vorherrschen”, heißt es darin. Die meisten Forschungsprogramme der EU und auch der einzelnen Länder seien nur “inkrementelle wissenschaftliche Fortschritte, Entwicklung und Innovation” und würden keine Paradigmenwechsel unterstützen.
Agenturen auf der ganzen Welt experimentieren aktuell mit neuen Arten der Finanzierung, und die EU müsse sich dringend dieser Welle anschließen. Sonst laufe sie Gefahr, abgehängt zu werden, warnte Manuel Heitor in einem Interview mit dem Magazin ScienceBusiness. “Europa muss diesen Prozess anführen.”
Im “Align, Act, Accelerate”-Bericht fordern die Experten die EU auf, “umgehend” eine “Experimentiereinheit” einzurichten, um “neue Programme, Bewertungsverfahren und Instrumente” zu testen.
Außerdem rät die Heitor-Gruppe, die Ambitionen zu steigern: Zu viele Start-ups würden aktuell wegziehen, weil es in Europa keine Finanzierungsperspektiven gibt. Gleichzeitig überholten andere Weltregionen Europa, insbesondere in innovativen Technologiefeldern, wie der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Daher müssten alle Forschungs- und Innovationsprojekte, die als herausragend anerkannt werden, umfassender gefördert werden. Daher müsse das Budget von derzeit 95 Milliarden Euro auf 220 Milliarden Euro erhöht werden.
Forschen in der EU müsse dringend attraktiver werden, schreibt die Heitor-Gruppe. Die europäische Industrie habe offenbar das Interesse an der EU-Forschungsförderung verloren. Auch der Vorteil, im vorwettbewerblichen Bereich mit Partnern aus anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, sei aufgrund zunehmender bürokratischer Belastungen verloren gegangen. “Es braucht ein Rahmenprogramm, das grenzüberschreitende Forschungskooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen einfacher und nutzerfreundlicher macht”, erklärt Georg Schütte zu den Empfehlungen. Der Generalsekretär der VolkswagenStiftung war einer der 15 Experten der Heitor-Gruppe.
Europa könne nur erfolgreich agieren, wenn es von den Mitgliedsstaaten unterstützt und gestärkt wird. “Mehrwert entsteht, wenn wir unsere Kräfte bündeln, etwa bei gemeinsam genutzten Großgeräten oder Testplattformen für neue Technologien”, erklärt Schütte. Aktuell gebe es hier noch zu viel Stückwerk, zu viele kleinteilige Kompromisse.
Die Heitor-Gruppe empfiehlt außerdem, auch mit schwierigen Partnern zu kooperieren: Man könne über Europas Grenzen hinaus erfolgreich arbeiten, wenn vorab die eigenen Forschungsinteressen definiert werden. Die Länder Europas könnten die nationale Sicherheit nicht mehr allein gewährleisten, es brauche Kooperationen.
Heitors Bericht ist der zweite Bericht zur EU-Forschung innerhalb von wenigen Wochen, mit dem die EU aufgefordert wird, ihre eigene Darpa zu gründen – oder zumindest eine Art von Darpa-inspirierter Innovationsagentur. Zunächst erklärte dies der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi in seinen wichtigsten Empfehlungen für Forschung und Innovation der EU. Auch die Heitor-Gruppe möchte, dass der EIC mit Programmen vom Typ Arpa experimentiert. Wenn dieses Modell erfolgreich sei, könnte es in anderen Bereichen des Rahmenprogramms eingeführt werden. abg / nik
Den utopischen Heilsversprechen, aber auch den dystopischen Warnungen in Bezug auf generative Künstliche Intelligenz (KI) stellt sich ein Diskussionspapier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina entgegen. Das Papier mit dem Titel “Generative KI – jenseits von Euphorie und einfachen Lösungen”, das am heutigen Donnerstag veröffentlicht wird, wirft stattdessen, wie die Autorinnen schreiben, “einen realistischen Blick” auf die Chancen und Risiken.
Die drei Autorinnen Judith Simon (Lehrstuhl für Ethik in der Informationstechnologie, Universität Hamburg), Indra Spiecker gen. Döhmann (Lehrstuhl für das Recht der Digitalisierung, Universität Köln) und Ulrike von Luxburg (Professur für Theorie des Maschinellen Lernens, Universität Tübingen) kommen zu dem Schluss, dass eine Reihe von ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen beziehungsweise Gefahren bisher zu wenig beachtet und debattiert werden. Zu den “nicht ausreichend reflektierten, gleichwohl schwerwiegenden Gefahren” für Individuen, Demokratie, Wirtschaft und Gesellschaft gehören demnach:
Die Autorinnen weisen darauf hin, dass viele der von ihnen genannten Gefahren durch den AI Act der EU und andere Gesetzeswerke nicht oder nicht ausreichend adressiert werden. Die Vor- und Nachteile offener KI-Modelle beispielsweise gelte es öffentlich zu diskutieren und angemessen abzuwägen, um “ausbalancierte, praktikable und demokratieverträgliche Technologielösungen” bereitzustellen.
Vor dem Hintergrund laufender Diskussionen um die Entwicklung vertrauenswürdiger KI in Europa und eines damit verbundenen Wettbewerbsvorteils sei es geboten, Maßnahmen zur Schadensvermeidung zu forcieren – und vor überhöhten Erwartungen zu warnen. abg
Welt: Unsicherheit bei KI-Einsatz an Hochschulen. Universitäten überlassen es den Dozenten, mit welchen Methoden sie überprüfen, wie stark KI bei Hausarbeiten verwendet wurden. Einheitliche Regelungen gibt es nicht. Viele Studenten sind deshalb unsicher, wie sie KI bei ihrer Arbeit einsetzen können. (“Betrug bei schriftlichen Arbeiten? Das KI-Problem für die Unis”)
Forschung & Lehre: Zahl der Teilzeitstudenten ist zurückgegangen. Im Wintersemester 2023/24 studierten nur noch 217.000 Menschen in Teilzeit. Das entspricht einem Rückgang von 6.000 Studierenden im Vergleich zum Vorjahr. Seit dem Höchststand im Jahr 2020 ist die Zahl der Teilzeitstudierenden insgesamt um 13.000 gesunken. Damit liegt der Anteil der Teilzeitstudierenden an der Gesamtzahl der Studenten aktuell bei nur noch 7,6 Prozent. (“Weniger Teilzeitstudierende in Deutschland”)
taz: Diskussion über Finanzbildung. Die Bundesregierung will mit dem Online-Portal “mitgeldundverstand.de” die Finanzbildung stärken. Über 200 Experten und Organisationen haben eigene Beiträge eingereicht. Kritiker halten das Angebot für zu finanzmarktfreundlich. (“”FDP-Inhalte” getarnt als Bildung”)
Standard: Mehr Labore zur Pandemievorbereitung. Wissenschaftler fordern in Österreich die Einrichtung von Hochsicherheitslaboren, um schnell auf weltweite Seuchen reagieren zu können. Zurzeit existiert in dem Land keine Einrichtung, die dem Biosafety Level 4, der höchsten Schutzstufe, entspricht. (“Mehr Hochsicherheitslabore gegen neue Erreger und Pandemien gefordert”)
FAZ: Hessischen Hochschulen droht ein heißer Herbst. In den nächsten Wochen könnte es an den hessischen Hochschulen zu zahlreichen Protesten kommen. Wenn es um Klima, den Krieg im Nahen Osten und geplante Einsparungen an den Universitäten geht, sind Straftaten der Demonstranten nicht auszuschließen. Auf diese sollten die Hochschulen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln reagieren. (“Wo die Toleranz enden muss”)
Tagesspiegel: Exzellenzverbund der Berliner Unis muss sich beweisen. Die Berliner Hochschulen müssen im Exzellenzverbund zeigen, dass ihre Zusammenarbeit zu Synergien führt. Es muss das Ziel sein, die Gutachter, die über die Exzellenzförderung des Bundes entscheiden, zu überzeugen. (“Berliner Exzellenzverbund der Unis: Ist er “too big to fail”?”)
FAZ: Thüringer Akademiker gegen die AfD. Akademiker in Thüringen fürchten den wachsenden Einfluss der AfD in der Hochschulpolitik. Die Partei akzeptiere Wissenschaft nur, wenn ihre Ergebnisse in das ideologische Konzept der AfD passen. Ziel der Akademiker-Initiative ist es auch, Bürgern aufzuzeigen, dass die AfD keine Alternative sei. (“Wie sich die AfD auf Forschung und Studium auswirkt”)
BNN: Meuthen kehrt an die Hochschule zurück. Der ehemalige AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen wird ab von Januar kommenden Jahres wieder als Hochschullehrer an der Hochschule für öffentliche Verwaltung im baden-württembergischen Kehl arbeiten. Meuthens Dienstverhältnis war seit 2016 unterbrochen, als er für die AfD in den Stuttgarter Landtag einzog. (“Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen unterrichtet bald angehende Staatsdiener”)

Dass das BMBF keine Haushaltsmittel für die Förderung der Batterieforschung in 2025 eingeplant hat, entsetzt die Community. Erste Konsequenzen wie der Verlust von Know-how sind spürbar, dabei müsste gerade jetzt der Transfer von Forschungsergebnissen forciert werden.
Nach vielen Jahren der Untätigkeit in der Förderung in diesem Forschungsgebiet hat Deutschland in den vergangenen 15 Jahren eine Aufholjagd gestartet, sich in der Batterieforschung international etabliert und große Erfolge erzielt. Und das mit einer durchdachten Strategie: Mit dem Dachkonzept Batterieforschung des BMBF ist das Ökosystem Batterieforschung in Deutschland strukturiert und mit fest definierten Zielen aufgebaut worden und stetig gewachsen.
Bund und Länder haben in den letzten Jahren enorme Mittel in die Hand genommen, um große Forschungsinfrastrukturen zu realisieren. Darunter zum Beispiel das Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL) in Aachen, das MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster, die Helmholtz-Institute in Ulm (KIT) und in Münster (Forschungszentrum Jülich) sowie die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in Münster.
Dieser Infrastrukturaufbau braucht im Betrieb Verlässlichkeit und Kontinuität in der Förderung. Gerade Transferzentren wie die Fraunhofer FFB sind auf eine funktionierende, dauerhaft angelegte Innovationspipeline angewiesen. Anders gesagt: ohne Ökosystem, kein Transfer. Wir stellen uns also selbst aufs Abstellgleis. Das bedeutet konkret:
Diese besorgniserregenden Entwicklungen stellen keinesfalls nur die Batterieforschung vor Probleme. Sie führen uns vielmehr vor Augen, mit welcher (politischen) Kurzsichtigkeit Deutschland technologieübergreifend konfrontiert ist. Anders formuliert, lassen sich die obigen drei Punkte auch auf andere Technologien und Forschungszweige übertragen:
Deutschland braucht Klarheit und Verlässlichkeit in der Förderung, ebenso wie die notwendige Priorisierung, welche Technologien nachhaltig gefördert werden. Das gibt Forschungseinrichtungen, Nachwuchskräften und Unternehmen gleichermaßen Planungssicherheit, um Potenziale vollständig ausschöpfen zu können. Nur so können wir Deutschlands Position als globalen Hightech-Standort sichern.

Man muss kein Klimawandelleugner sein, um das Gefühl zu haben, dass Klimadaten und -Modelle mitunter ganz schön abstrakt sein können. Verhaltensänderungen oder zumindest die Motivation dazu, sind aber vom direkten Erleben abhängig, das ist gut untersucht. Was wäre also, wenn man Klimadaten nicht nur sehen, sondern auch riechen, anfassen und schmecken könnte? Diese Idee stellt die Designerin Tiange Wang im November auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin vor.
Sie hat gezeigt, dass sich aus den Daten zur weltweiten Gletscherschmelze oder zum CO₂-Fußabdruck der Industrie ein sinnliches Erlebnis machen lässt. Tiange Wang, eine multidisziplinäre Designerin und Technikvisionärin aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts, hat sich von der traditionellen japanischen Süßwarenkunst Wagashi inspirieren lassen. Sie hat mit ihrem Partner I-Yang Huang mit DataWagashi ein neues Medium geschaffen, das darauf abzielt, Klimadaten greifbarer, zugänglicher und unterhaltsamer zu gestalten.

“DataWagashi sollen die Kluft zwischen Informationen und persönlichen Beziehungen überbrücken und eine besser informierte und einfühlsamere Gesellschaft fördern”, sagt die Designerin in einem Interview mit der Falling Walls Foundation. Häufig sind es Szenen aus der Natur, die als Motive für die Herstellung von traditionellen Wagashi dienen – DataWagashi haben die Klimakrise zum Thema.
Um das Komplexe offensichtlich zu machen, serviert Tiange Wang innerhalb eines DataWagashi-Sets, das jeweils aus mehreren süßen Würfeln besteht, immer extremere Inhalte: Je mehr Kaffee sich in einem DataWagashi-Würfel befindet, desto größer ist die CO₂-Bilanz und desto bitterer schmeckt er. Je mehr weißer Sesam und je mehr trockene Blütenblätter ein Würfel enthält, desto trüber der Würfel und desto körniger die Textur, die ebenfalls den höheren CO₂-Gehalt in der Luft widerspiegeln soll.

“DataWagashi sollen die Art und Weise, wie wir Daten wahrnehmen und mit ihnen umgehen, verändern und sie interaktiver, integrativer und wirkungsvoller zu machen”, sagt Wang.
In ihrer Arbeit geht es Tiange Wang, die an der University of California in Berkeley und an der Harvard Graduate School of Design Architektur studiert hat, um positive Nutzererlebnisse. Zusammen mit I-Yang Huang realisiert Tiange Wang in ihrem multidisziplinären “V-Lab” in Cambridge seit 2021 Designprojekte, die die Perspektiven von Usern und Unternehmen verbinden und neue, innovative Lösungen schaffen.
Eine ihrer ersten Arbeiten: Ein digital aktiviertes Raumverkaufssystem für die Stadt der nahen Zukunft, bei dem Nutzer die Raumnutzung für verschiedene Wellness-Aktivitäten über ein Verkaufssystem erwerben können. Mit solchen Projekten hat sich Wang auch international längst einen Namen gemacht: Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und zum Beispiel auf dem NYCxDesign Festival und dem Vancouver International Film Festival präsentiert.
Wie kann man sich den Arbeitsprozess der Designerin vorstellen? “Den ganzen Tag über tauchen wir in den Designprozess ein, skizzieren Konzepte, verfeinern Details und hinterfragen Annahmen“, sagt Wang. Freuen würden sie sich über die “Heureka”-Momente, wenn eine Lösung auf Anhieb funktioniert: “Wenn der Tag sich banal anfühlt, sind es die kleinen Überraschungen – eine clevere Einsicht oder eine bahnbrechende Idee -, die unsere Begeisterung neu entfachen und uns weitermachen lassen.”
Neben ihrer Arbeit im “V-Lab” ist Wang seit 2022 Designerin bei IDEO, einer internationalen Design- und Innovationsberatung. Hier beschäftigt sie sich zum Beispiel mit der Frage, wie sich Emotionen in Produkte einbauen lassen. Auf Wangs Linkedin-Profil kann man sich anschauen, wie so ein Produkt aussehen könnte: Ein Mann und ein sozialer Roboter umarmen einander. Gabriele Voßkühler
Tiange Wang ist Gewinnerin des Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2024 in der Kategorie Kunst und Wissenschaft. Sie spricht am 9. November 2024 um 12.15 Uhr auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin. Das Programm des Summits finden Sie hier, weitere Porträts der Table.Briefings-Reihe “Breakthrough-Minds” lesen Sie hier.
Antje Boetius, wissenschaftliche Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, wechselt nach Kalifornien. Die Meeresbiologin verlässt Deutschland, um ab Mai 2025 das Amt der Präsidentin des renommierten Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) zu übernehmen. Boetius steht seit sieben Jahren an der Spitze des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Das Institut und das BMBF kündigten an, zeitnah eine Nachfolge zu suchen.
Philipp Niemann wird neuer Geschäftsführer des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Er übernimmt das Amt zum 1. November 2024 von Beatrice Lugger, die die Einrichtung der Klaus Tschira Stiftung gGmbH und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zum Jahresende verlässt. Der promovierte Medienwissenschaftler Niemann ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung und wissenschaftlicher Leiter der NaWik gGmbH. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der qualitativen Rezeptionsforschung.
Daniel Rudolf ist neuer Leiter der Leitungsabteilung im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Er folgt auf Jörn Hasler, der künftig die Abteilung für Grundsatzfragen und Strategien leitet. Rudolf war bereits in verschiedenen Positionen im BMBF tätig, unter anderem als Leiter Planung und Steuerung sowie als Leiter Kommunikation. Vor seiner Zeit im BMBF war er Bereichsleiter in der Parlamentarischen Geschäftsführung der FDP-Fraktion im Bundestag.
Gerhard Schneider, ehemaliger Rektor der Hochschule Aalen, ist mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Der Naturwissenschaftler stand von 2008 bis 2022 an der Spitze der Hochschule und setzte sich in dieser Zeit für die strategische Weiterentwicklung der Hochschule Aalen sowie für den Bildungs- und Innovationsstandort Ostwürttemberg ein. Auch hatte er maßgeblichen Anteil an der Erteilung des Promotionsrechts an die baden-württembergischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!
Bildung.Table. Empirische Bildungsforschung: Was das neue Rahmenprogramm des BMBF bietet. Gut 300 Millionen Euro will das BMBF in den kommenden Jahren für die empirische Bildungsforschung ausgeben. Jetzt steht der Rahmen dafür fest. Einige Schwerpunkte sind neu gesetzt. Mehr
Bildung.Table. Digitalpakt: Warum sich Bund und Länder weiter uneins sind. Bund und Länder sind sich weiter uneinig, wie die Finanzierung eines neuen Digitalpakts aussehen soll. Die Verhandlungen laufen weiter. Mehr
Climate.Table. Kreislaufwirtschaft: Dieses Potenzial für Klimaschutz schlummert in Pilzen. Mit der Nationalen Kreislaufstrategie will die Bundesregierung vollständig recyclebare Stoffkreisläufe schaffen. Die Forschung und erste Start-ups sehen Pilze als geeignetes Material dafür. Sie können auch an vielen anderen Stellen zum Klimaschutz beitragen. Mehr
Agrifood.Table. NGT: Warum der Non-GMO-Sektor bei der Regulierung Zeit gewinnen will. Der Non-GMO-Sektor kämpft weiter dafür, dass neue Züchtungstechniken als Gentechnik klassifiziert und gekennzeichnet werden müssen. Die Branche sieht sich aber auch vor großen Herausforderungen, da noch immer offene Fragen bestehen, wie diese Forderung in der Praxis umgesetzt werden könnte. Mehr
Europe.Table. Energierat: “Russisches Gas ist eine gefährliche Wahl”. Auseinandersetzungen um Atomenergie und um russisches Gas bestimmen das erste reguläre Treffen der Energieminister unter ungarischem Vorsitz. Die scheidende Energiekommissarin richtet einen emotionalen Appell an die Mitgliedstaaten. Mehr

Peking – Washington DC – Berlin: Das klingt forschungspolitisch momentan eher nach einem wenig harmonischen Dreiklang. In Deutschland sind in dieser Legislatur China-Strategien und Papiere zur Forschungssicherheit geschrieben worden. Die USA bauen gar ein Secure-Center auf. MPG-Präsident Patrick Cramer hat gesagt, dass der globale Innovationsmotor ins Stocken gerät, weil die Amerikaner sich von den Chinesen abkoppeln. De-Risking statt De-Coupling? War gestern für einen Tag alles egal.
Denn die Stunde der Panda-Diplomatie hat geschlagen. Während in der US-Hauptstadt ein eigens für die beiden dreijährigen Pandas Bao Li und Qing Bao umgebautes und umgestaltetes FedEx-Frachtflugzeug namens “Panda-Express” aus Peking landete, wurde etwa zeitgleich in Berlin der neueste Panda-Nachwuchs des Hauptstadt-Zoos der Öffentlichkeit präsentiert. Auch die zwei Monate alten Zwillingsschwestern sind Nachwuchs der chinesischen “Leihmutter” Meng Meng. Am Dienstag wurde brav in die Kameras gewinkt (siehe Foto), am gestrigen Mittwoch durfte der erste Publikumsbesuch empfangen werden. Der Andrang war riesig.
Währenddessen müssen die beiden Pandas in DC noch für einen Monat in Quarantäne. First Lady Jill Biden hatte den “historischen Moment” für die US-Hauptstadt bereits im Mai offiziell angekündigt. Sie betonte dabei die Bedeutung des Austauschs, der neben dem Artenschutz auch als Symbol der diplomatischen Bemühungen zwischen China und den USA gilt. Wie nachhaltig diese Form der Diplomatie ist, bleibt abzuwarten. 2034 müssen die beiden neuen Washingtonians zurück nach Peking. Die Berliner Bären schon 2028. Hoffentlich können sie ihren nicht ganz einfachen Job bis dahin erfüllen. Tim Gabel
