erst kürzlich verkündete das BMBF freudig die hohe Beteiligung an den Datipilot-Calls. 3.000 Einreichungen hatte es allein für die sogenannten Innovationssprints gegeben. Doch nach der ursprünglichen Planung könnten mit den vorhandenen 30 Millionen Euro nur ungefähr 100 Projekte gefördert werden – eine Quote von lediglich drei Prozent.
Daher wird der Topf erweitert, berichtet mein Kollege Markus Weisskopf. Die geplanten Mittel seien bereits in die aktuelle Haushaltsplanung eingeflossen, erklärte ein BMBF-Sprecher. Die Erhöhung sei jedoch noch vorbehaltlich der Beschlussfassung des Bundestages über den Haushalt 2024.
Und schon sind wir mitten in den laufenden Etat-Debatten: Nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse muss die Bundesregierung den Haushalt neu aufstellen. Längst verabschiedete Projekte werden mehr oder minder offen hinterfragt. Bleibt es bei den 150 Millionen mehr fürs Bafög? Ist der Bau der Chipfabriken im Osten in Gefahr? In Gesprächen wirken auch die Forschungspolitiker zunehmend verunsichert.
Ein Nachtragshaushalt soll jetzt “Sicherheit in die Haushaltsplanung bringen”, schreibt Bundesfinanzminister Christian Lindner am Montag in einem Brief an alle Fraktionen. Kurze Zeit nach Bekanntwerden des damit verbundenen Zeitplans für die Vorlage des Nachtragshaushalts, ist dieser dann bereits überholt, berichten unsere Kollegen im Berlin.Table: Nicht erst am Mittwoch vor Ort, sondern schon am gestrigen Montag hat das Bundeskabinett das Nachtragshaushaltsgesetz beschlossen.
In einem Brief des Ministers an die Fraktionen wird später deutlich, Christian Lindner wird den neuen Haushalt für 2024 nicht mehr in diesem Jahr vorlegen. Was sich durch die verschobenen Haushaltsberatungen in dieser Woche terminlich ändert, haben wir Ihnen in einer News zusammengefasst.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

In einer Mitteilung jubelte das BMBF kürzlich über die hohe Beteiligung an den Datipilot-Calls. 3.000 Einreichungen gab es alleine für die sogenannten Innovationssprints. Nach der ursprünglichen Planung hätten mit den vorhandenen 30 Millionen Euro nur ungefähr 100 Projekte gefördert werden können – eine Quote von lediglich drei Prozent.
Daher wird der Topf nun auf 90 Millionen Euro für rund 300 geförderte Projekte erweitert, um immerhin rund 10 Prozent der eingereichten Projekte finanzieren zu können. Diese Mittel seien auch bereits in die aktuelle Haushaltsplanung eingeflossen, sagte ein BMBF-Sprecher. Die Erhöhung sei jedoch noch vorbehaltlich der Beschlussfassung des Bundestages über den Haushalt 2024. Immerhin, Ye-One Rhie, die für die SPD im Forschungsausschuss sitzt, ist optimistisch, dass dies auch so kommt.
Während die endgültige Höhe des Fördertopfes noch unsicher scheint, laufen bereits die ersten Pitches der vom BMBF initiierten Roadshow – der erste fand vergangenen Montag in Essen statt. Dort entscheidet die Community vor Ort, welche der 600 vorausgewählten Projekte gefördert werden. 150 werden über diesen Weg ausgewählt. Weitere 150 werden in einem Losverfahren ermittelt.
Prinzipiell gibt es viel Lob für die neuen Wege in der Förderung. Die Hochschulallianz für den Mittelstand begrüßt diese im Gespräch mit Table.Media ausdrücklich, betont aber auch, dass natürlich Qualität und Transferorientierung als Kriterien weiterhin vorne stehen müssten. Die Transferorientierung stellt CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek zumindest in Teilen infrage, wenn nur eine Institution im Projekt beteiligt sei. Immerhin 42,5 Prozent der eingereichten Anträge seien Einzelanträge gewesen, nur der Rest Verbünde von zwei Partnern.
In jedem Fall könnte die geringe Förderquote Frust bei den vielen nicht erfolgreichen Antragstellern hervorrufen. Auch bei den Innovationscommunities, die mit bis zu fünf Millionen für vier Jahre gefördert werden, zeichnet sich eine ähnlich schlechte Förderquote ab. Hier werden laut BMBF-Homepage gar nur zehn von insgesamt wohl rund eingereichten 300 Anträgen gefördert.
Diese geringe Aussicht auf Erfolg könnte die derzeit eher schlechte Stimmung in der Community noch verstärken. Angesichts immer weiterer Verzögerungen und einer weiterhin großen Unsicherheit, wo am Ende die Reise für die Dati hingehen soll, mehrt sich die Kritik.
Nachdem zwei Jahre wenig passiert ist, wünschen sich viele Akteure aus der Community ein schnelleres Vorgehen. Gerade angesichts der Haushaltskrise und der Restlaufzeit der aktuellen BMBF-Leitung drängt man auf konkrete Schritte.
In jedem Fall sollten die für das erste Quartal angekündigte Standortentscheidung sowie die Entscheidung über das Führungspersonal – wissenschaftlicher und kaufmännischer Geschäftsführer – nicht weiter verzögert werden. Wie bei der Sprind zu besichtigen, wäre aber selbst eine starke Leitung mit viel Durchhaltevermögen und politischem Geschick maximal gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Dati zu erstreiten, meint Thomas Jarzombek.

Auf der Landkarte deutscher Universitäten sind die Mittelgroßen mit jeweils rund 20.000 Studierenden in großer Zahl vertreten, auf der Exzellenz-Landkarte jedoch klar in Unterzahl. Im Kreis der 14 Exzellenzuniversitäten hält einzig das kleine Konstanz ihre Fahne hoch und von 35 Exzellenzclustern sind nur acht an kleinen oder mittelgroßen Universitäten angesiedelt. Das könnte sich mit der aktuellen Runde des großen Wettbewerbs ändern. Zahlreiche Mittelgroße haben ihre Stärken gebündelt und häufig auch zusammen mit außeruniversitären Partnern Projektskizzen eingereicht, über die demnächst entschieden wird. Eine treibende Kraft im neuen Miteinander ist die Ende November 2020 gegründete Universitätsallianz UA11+.
Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen seien enttäuscht gewesen über das Abschneiden in den bisherigen Exzellenzwettbewerben, sagt Birgitt Riegraf, Vorsitzende der UA11+ und Präsidentin der Universität Paderborn. “In Profilbereichen haben alle mittelgroßen Universitäten Pockets of Excellence, also international sichtbare Spitzenforschung.” Häufig fehle jedoch die kritische Masse, um sich in großen Forschungswettbewerben erfolgreich zu behaupten. Da sei es von Vorteil, dass in der Exzellenzstrategie jetzt auch Bewerbungen im Dreierverbund (statt wie früher mit höchstens einem Partner) möglich seien. Riegraf: “Diese Änderung der Teilnahmebedingungen geht wesentlich auf unsere Initiative zurück.”
Mit einer Geschäftsstelle in Berlin, einem Regelwerk und regelmäßigen Veranstaltungen ist die inzwischen als gemeinnütziger Verein anerkannte UA11+ deutlich straffer organisiert als das seit 2006 bestehende lose Netzwerk mittelgroßer Universitäten. Und anders als TU9 und German U15 will die UA11+ offen für neue Mitglieder bleiben. Zu den elf Gründern gesellten sich bisher vier weitere Universitäten und schon bald könnten neue hinzukommen, berichtet Birgitt Riegraf, die von Anfang an dabei ist.

In die Allianz der Mittelgroßen wird längst nicht jeder aufgenommen. Eine wichtige Voraussetzung ist Spitzenforschung in mindestens einem Profilbereich. Das ermöglicht anspruchsvolle Verbundanträge wie zum Beispiel die Clusterskizze “Mensch-Robotik-Interaktion”, mit der sich die Universitäten Paderborn, Bielefeld und Bremen zurzeit gemeinsam in der Exzellenzstrategie bewerben. “Zu dritt können wir die jeweils eigenen Stärken besser zur Geltung bringen und Synergien schaffen”, sagt Riegraf. Mit ihren Forschungsleistungen trügen die Mittelgroßen substantiell zur Exzellenz des Gesamtsystems bei – und dafür wünscht sich die Wissenschaftsmanagerin mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung.
Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, muss dazu nicht eigens aufgefordert werden. “Die deutsche Forschungslandschaft zeichnet sich aus durch verteilte Exzellenz”, sagt Rosenthal, der bis Ende Oktober Präsident der mittelgroßen Universität Jena war. Eine Fokussierung auf wenige Spitzenuniversitäten würde, davon ist er überzeugt, die vielen Leuchttürme in den Regionen benachteiligen. Mit universitären Verbünden habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt der HRK-Chef, bewährt hätten sie sich insbesondere auch in der Kooperation mit außeruniversitären Partnern.
Solche Partnerschaften gehören zur DNA mittelgroßer Universitäten. Viele von ihnen sind in den 1970er-Jahren mit dem Auftrag entstanden, ihre Region wissenschaftsbasiert voranzubringen. Sie haben seither enge Beziehungen zu außeruniversitären Instituten, Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen aufgebaut und ihre Forschung in die Praxis getragen. “Heute steht Transfer politisch hoch im Kurs”, sagt Birgitt Riegraf, “unsere Erfahrung auf dem Gebiet ist gefragt.” Etwa in der Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati), in die Riegraf jetzt berufen wurde. Sie wird die Gelegenheit nutzen, um eine dauerhafte staatliche Finanzierung von Vorhaben zum Wissenstransfer anzumahnen: “Allein mit Projektmitteln können wir keine tragfähigen Strukturen aufbauen.”
Pockets of Excellence, regionale Verwurzelung, Transfer-Expertise, kurze Wege, bezahlbare Mieten -mittelgroße Universitäten haben viele Pluspunkte. Dennoch: “Wir sind nicht Berlin, Heidelberg oder München”, sagt Birgitt Riegraf. Im Wettbewerb um profilierte Wissenschaftler haben die Mittelgroßen nicht selten das Nachsehen und auch Studierende zieht es eher in die Metropolen. Sorgen bereitet ihnen die wachsende Konkurrenz in den Regionen, wo Unternehmen, Behörden und Handwerk ebenfalls versuchen, den Nachwuchs für sich zu gewinnen. Riegraf: “Aber solche Probleme haben zunehmend auch die Metropoluniversitäten.”
Neue Handlungsstrategien will die UA11+ bei einem Workshop Anfang 2024 entwickeln. Ein wichtiges Thema dürfte die Stärkung bestehender internationaler Netzwerke sein. Gute Chancen eröffne das EU-finanzierte Netzwerk europäischer Universitäten, sagt Riegraf – Paderborn gehört seit Kurzem dazu.
In ihren Regionen können die Mittelgroßen ihre Stärken ausspielen. Duale Studiengänge zusammen mit langjährig verbundenen Partnern seien überall in Planung, berichtet Riegraf, gleiches gelte für das Zukunftsthema wissenschaftliche Weiterbildung.
In Deutschland leiden Schätzungen zufolge etwa 500.000 Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen an Long Covid. Das Bundesgesundheitsministerium richtet nach eigenen Angaben momentan einen Förderschwerpunkt zu versorgungsnaher Forschung zu Long Covid ein. Der Fokus liege auf Modellprojekten zu innovativen Versorgungsformen. “Für mich ist klar: Wir dürfen und wir werden die Betroffenen nicht im Stich lassen”, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitagabend beim 2. Long Covid Kongress in Jena.
Dass die Ampelparteien das Thema Long Covid ernst nehmen, bestätigte auch Katrin Göring-Eckardt (Grüne) in einer Videobotschaft: “In den vergangenen Wochen haben wir als Bundesregierung Mittel insgesamt von mehr als 200 Millionen Euro für Forschung und Versorgung bei Long Covid im Haushalt vorgesehen.” Auch die 250.000 Menschen mit chronischem Fatigue-Symptom (ME/CFS) sollen profitieren, sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Zuletzt hatte der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung die Mittel für Long Covid deutlich aufgestockt.
Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es noch immer kein Arzneimittel, das für die Bekämpfung der Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion zugelassen ist. Deshalb verwenden viele Ärzte Medikamente, die bereits eine Zulassung für eine andere Erkrankung haben, außerhalb der genehmigten Indikationen im “Off-label-Use”. Auch Lauterbach setzt auf diesen Weg. “Wir werden den Zugang zu diesen Arzneimitteln verbessern”, sagte er bei dem von Ärzten und Betroffenen organisierten Kongress.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte richte derzeit eine Expertenkommission ein, die “die Anwendung von Arzneimittel außerhalb ihrer zugelassenen Anwendungsgebiete für den Einsatz bei Long Covid anhand bestimmter Kriterien bewertet”. Eine Empfehlung dieser Kommission könnte Bürokratie verringern und die Kostenerstattung durch Krankenkassen erleichtern. “Derzeit haben die allerwenigsten Patienten die Möglichkeit, diese Medikamente zu bekommen”, sagte Carmen Scheibenbogen, Long-Covid-Expertin an der Berliner Charité. Off-Label-Therapie bedeute ein höheres Risiko und größeren Aufwand. “Wenn es eine Empfehlung gibt, wird die Bereitschaft der Ärzte größer sein, diesen Weg zu gehen”, sagte sie.
Scheibenbogen ist eine der Leiterinnen der Nationalen Klinischen Studiengruppe (NKSG), die Medikamente und Therapien zur Zulassung bringen will. “Das darf nicht mehr zu lange dauern, denn wir haben viele, die seit über drei Jahren verzweifelt darauf warten”, sagte die Infektionsforscherin. Sie habe eine Zusage des BMBF für die Finanzierung von drei weiteren Studien erhalten, die die bisherige Förderung von zehn Millionen Euro ergänze.
Enttäuscht äußerte sich die Immunologin über die geringe Unterstützung durch die pharmazeutische Industrie, die üblicherweise in Deutschland die Zulassungsstudien finanziert. Derzeit laufen bei der NKSG drei doppelt verblindete, placebokontrollierte Therapiestudien: Getestet wird das Bayer-Medikament Vericiguat für Patienten mit entzündungsbedingter Minderdurchblutung von Gefäßen und Organen. Zum Einsatz kommt auch das Glucocorticoid Methylprednisolon bei Patienten mit verminderter kognitiver Leistung. Eine dritte Studie untersucht den Erfolg eine Blutwäsche (Immunadsorption), bei der gegen den eigenen Körper gerichtete Antikörper aus dem Patientenblut gefiltert werden. Diese überschießende Autoimmunreaktion gilt als eine der möglichen Ursachen von Long Covid.
Beobachtungsstudien der NKSG zur Wirksamkeit der Immunadsorption und einer Hochdruck-Sauerstofftherapie (H-BOT) haben erste positive Ergebnisse geliefert. Diese Therapien scheinen für einen Teil der Long-Covid-Patienten zu sein, aber sicher nicht für alle. Long Covid hat als Multiorgan-Erkrankung viele Gesichter und unterschiedliche Krankheitsmechanismen. Forschung, welche Therapie für welche Untergruppe geeignet ist, sei längst überfällig, sagt Jördis Frommhold, Gründungspräsidentin des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long Covid. Die Patienten zahlen die Therapie aus eigener Tasche. “Wir müssen die Betroffenen vor unnötigen Ausgaben warnen”, fordert die Leiterin des Instituts Long Covid in Rostock.
Für 2024 ist eine Medikamentenstudie mit dem Präparat Vidofludimus Calcium (IMU 838) geplant. Sie wird vom Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) der 36 deutschen Universitätskliniken finanziert. Studienleiterin Maria Vehreschild will mehr als 300 Patienten einbeziehen, die an zwölf Standorten betreut werden sollen. Das aus der Behandlung von Multipler Sklerose bekannte Medikament behindert die Vermehrung von Corona-Viren, die sich im Körper verstecken und kann eine überschießende Immunreaktion regulieren. Das NUM stellt nicht nur eine weitgehend neu geschaffene Dateninfrastruktur zur Verfügung, sondern will auch die Arbeit der einzelnen regionalen Ethikkommissionen koordinieren, damit eine nachhaltige nationale Verwertbarkeit der Ergebnisse gesichert wird. Rainer Kurlemann
29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus
Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr
29. November 2023, 19:00 Uhr, BBAW – Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin
Diskussion Zwischen Transparenz und Heimlichtuerei: Wie viel Vertraulichkeit braucht demokratische Politik? Mehr
1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.
Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr
1. Dezember 2023, 19 Uhr, Nikolaisaal, Potsdam
Festveranstaltung der BBAW Einsteintag 2023 – u. a. mit Jutta Allmendinger und Jörg Steinbach im Gespräch über die Zukunft der Arbeit Mehr
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat in einer Sondersitzung am gestrigen Montag beschlossen, das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an HAWs weiterentwickelt fortzuführen. 528 Millionen Euro stehen für die nächsten sieben Jahre zur Verfügung. Davon trägt der Bund 445 Millionen Euro. 83 Millionen Euro steuern die Länder nach einem Stufenmodell bei. Das bedeutet, dass die Länder ihren Beitrag nach und nach erhöhen.
“Mehr Geld, mehr Zeit und mehr Fokus auf die Ziele” sei das Ergebnis der Verhandlungen, erklärte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Von einem “Paukenschlag” gar sprach der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume. Diesen Begriff fanden Vertreter der HAWs nicht passend. Es sei zwar gut, dass sich Bund und Länder geeinigt haben. Die 83 Millionen Euro, die nun zusätzlich seitens der Länder in das Programm fließen, seien aber kaum mehr als ein Inflationsausgleich über die sieben Jahre Laufzeit, meint Bernd Kriegesmann, von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Ähnlich äußerte sich Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der HAWs in der Hochschulrektorenkonferenz. Er freue sich, dass es weitergehe und dass die Laufzeit auf sieben Jahre verlängert werde. Allerdings zeigte er sich enttäuscht über die Höhe des Engagements der Länder. Man habe sich hier “eine Beteiligung in vergleichbarer Höhe wie in anderen Programmen gewünscht”.
Zwischenzeitlich schien bei den Verhandlungen im Laufe des Jahres auch ein Kompromiss entsprechend des Verteilschlüssels der Exzellenzstrategie (75 Prozent Bund, 25 Prozent Länder) möglich zu sein. Seitens des Bundes wurde nach einem Koalitionsbeschluss im Sommer gar eine paritätische Finanzierung von Bund und Ländern angestrebt. Damit hätte man, bei einer zugesagten Fördersumme von 60 Millionen Euro seitens des Bundes, 120 Millionen Euro Gesamtförderung im Jahr erreicht. Und damit den Betrag, den die HAWs seit längerem für dieses Programm fordern. mw
Durch die neuerlichen Verhandlungen und Sitzungen zum Nachtragshaushalt und zu dem aus 2024 haben sich in Berlin zahlreiche Termine verschoben, neue sind dazu gekommen – auch im Bereich Forschungspolitik. Hier finden Sie einen Überblick des aktuellen Stands:
Haushalt: Kurz nach Bekanntwerden des Zeitplans für die Vorlage des Nachtragshaushalts, ist dieser schon überholt. Nicht erst am Mittwoch vor Ort, sondern schon am Montag per Umlaufverfahren beschloss das Bundeskabinett das Nachtragshaushaltsgesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Freitag, 1. Dezember: Erste Lesung des Haushalts im Bundestag (möglich wäre auch eine Direktüberweisung an den Haushaltsausschuss, wie ein entsprechender Vorschlag des Ältestenrats besagt, die Verhandlungen hierzu laufen offenbar noch).
Spätestens am 10. Dezember: Erste Beratung des Gesetzes im Bundesrat, dies würde eine Verkürzung der ansonsten üblichen Zwei-Wochen-Frist mit sich bringen.
Mittwoch, 13. Dezember: 2. / 3. Lesung Bundestag, Voraussetzung dafür ist, dass bis dahin eine Stellungnahme des Bundesrats vorliegt.
Freitag, 15. Dezember: 2. Durchgang im Bundesrat, dieser könnte abschließend beraten (letzten reguläre Sitzung im Jahr).
Ende Dezember: Verkündung des Nachtragshaushalts im Bundesgesetzblatt.
Mittwoch, 29. November: Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung kommt zusammen (9.30 Uhr bis 12.55 Uhr, Paul-Löbe-Haus). Auf der Tagesordnung stehen die BMBF-Berichte “Aktionsplan KI” und “Aktionsplan Robotikforschung”. Des Weiteren wird der Ausschuss über den Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 und über die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beraten.
Mittwoch, 29. November: Der Bundestag berät ab ca. 17 Uhr über die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum weiteren Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich des Wissenschaftszeitvertrags-Gesetzes (20/8634). Die Unionsabgeordneten erkundigen sich in der Großen Anfrage unter anderem danach, ob die Bundesregierung weiterhin die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beabsichtigt. Eine Frage, die sicher nicht nur die Opposition beschäftigt. nik
Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) selbst eingesetzte Strukturkommission hat erste Empfehlungen zur Reform der KMK erarbeitet. Demnach empfiehlt sie, ein systematisches Monitoring der Umsetzung von Beschlüssen in den Ländern einzuführen. Zudem soll die Zahl der Gremien reduziert werden. Die Kommission rät darüber hinaus, gemeinsame Sitzungen und Beratungsstrukturen der Bereiche Schule und Hochschule/Wissenschaft stärker zu trennen. Sogar die Alternative einer eigenständigen Konferenz der Wissenschaftsminister steht im Raum.
Das Eckpunkte-Papier “Für eine zukunftsfähige Kultusministerkonferenz” liegt Table.Media vor. Im Dezember 2022 hatte die KMK die Unternehmensberatung Prognos beauftragt, die eigenen Strukturen zu durchleuchten. Während der jüngsten Konferenz der Kultusminister im Oktober wurden erste Ergebnisse bekannt – und sorgten für reichlich Wirbel. Denn die Analyse deckte einen Wildwuchs an mehr als 170 Gremien sowie langsame Entscheidungsstrukturen auf. hsc
Die EU und die Schweiz haben in einer gemeinsam erarbeiteten Erklärung Verhandlungen über ein Abkommenspaket vereinbart. Damit können auch “explorative Gespräche” zur Assoziation der Schweiz zu Horizon Europe starten, erklärte EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova.
Im angestrebten Abkommen soll neben der Wiederaufnahme der Schweiz in Horizon Europe der Beitritt zu Erasmus plus enthalten sein. Auch die regelmäßige Zahlung eines Kohäsionsbeitrages soll darin geregelt werden. Angedacht ist scheinbar ein flexibler Mechanismus, wie er auch mit Großbritannien vereinbart wurde. Hier werden je nach Erfolgsquote der Wissenschaftler bei den Calls die Beiträge des Partnerlandes bemessen.
Nach den explorativen Gesprächen könnten formale Verhandlungen über den Horizon-Beitritt im März 2024 starten. Ob allerdings ein Gesamtabkommen noch vor den EU-Wahlen erreicht werden kann, wird bezweifelt. Umstritten waren bei den bisherigen Gesprächen zwischen der Schweiz und der EU insbesondere die Personenfreizügigkeit und der Lohnschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Dass die Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe von den übrigen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU komplett getrennt werden, wie es der ETH-Rat fordert, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Damit würde die EU das “Rübli” aus Hand geben, das die Schweiz motivieren soll, in den strittigen Bereichen auf die EU zuzugehen.
Nach langwierigen Verhandlungen haben sich auch die EU und Kanada geeinigt: Ab 2024 können kanadische Forscher Teil von Horizon Europe werden. Vor rund fünf Jahren hatten die Verhandlungen begonnen, am vergangenen Freitag wurden sie auf dem EU-Kanada-Gipfel in St. John’s, Neufundland, so gut wie abgeschlossen. “Kanada tritt Horizon Europe bei, dem derzeit größten Forschungs- und Innovationsmechanismus der Welt”, freute sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau.
Kanadische Forscher und akademische Einrichtungen sowie Forschungsinstitute können dann an Säule 2 von Horizont Europa teilnehmen, einem Teil des 95,5 Milliarden Euro schweren Forschungs- und Innovationsprogramms der EU. Hier werden große Verbundprojekte zur Lösung globaler Herausforderungen finanziert, in den Bereichen Klima, Energie, digitale Wirtschaft und Gesundheit. Budget: 53,5 Milliarden Euro. mw/nik
Die meisten der 308 in diesem Jahr vergebenen Consolidator Grants des European Research Council (ERC) gehen nach Deutschland. Wie das Gremium am vergangenen Donnerstag mitteilte, erhalten hierzulande 66 Forschende individuelle Förderung von jeweils bis zu zwei Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren. An zweiter Stelle stehen die Niederlande mit 36 Preisträgern, es folgen Frankreich und Spanien mit jeweils 23.
Das klingt nach einem großen Erfolg für Deutschland. Das Resultat relativiert sich jedoch, wenn man die Zahl der Grants zum Beispiel bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt betrachtet. Darauf weist der belgische Wissenschaftler Denis Wirtz hin, der an der Johns Hopkins University in Baltimore/USA forscht. In einem Beitrag auf der Plattform X zeigt er: Bezogen auf das BIP schneiden die Niederlande, Dänemark, Österreich, Israel und Belgien überdurchschnittlich gut ab. Deutschland liegt zusammen mit Großbritannien und Spanien eher im Mittelfeld. Unterdurchschnittlich: Frankreich, Italien, Norwegen und Polen.
EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova hob erfreut hervor, dass der Anteil, der mit einem Consolidator Grant ausgezeichneten Frauen, zum dritten Mal in Folge angestiegen ist und in der aktuellen Runde 39 Prozent beträgt.
Als enttäuschend bezeichnete sie es, dass nicht alle Projekte, die es verdient hätten, unterstützt werden konnten. Aufgrund des beschränkten Budgets seien etwa 100 als hervorragend eingestufte Projektvorschläge nicht zum Zuge gekommen. Insgesamt gab es mehr als 2.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Die Fördersumme lag in diesem Jahr bei 627 Millionen Euro. Gemeinsames Ziel müsse es sein, dafür zu sorgen, dass in Europa keine brillante Idee unfinanziert bleibt, sagte Ivanova.
Unter den deutschen Universitäten schneiden die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und die Universität Bielefeld mit jeweils vier Consolidator Grants besonders gut ab. In der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft sind es jeweils fünf Preisträger.
Consolidator Grants zählen zu einer von vier Individualförderlinien des ERC. Es handelt sich um personengebundene Zuwendungen für einzelne, exzellente Forschende. Consolidator Grants sind für Forschende in einem Zeitfenster von 7 bis 12 Jahren nach der Promotion gedacht. Die Gewinner der Advanced Grants, einer für erfahrene Forschende gedachten Förderlinie, die mit jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro noch höher dotiert ist, werden voraussichtlich im April 2024 bekanntgeben. abg

Es wird behauptet, Industrieforschung sei keine Wissenschaft, sondern Wald- und Wiesenforschung, bei der Menschen ohne Sinn und Verstand rein empirisch an Knöpfen drehen und schauen, was passiert, um kommerzielle Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Da stecke zwar Forschung drin, aber keine Wissenschaft. Industrieforschung als reine Empirie? Ihre Ergebnisse das Produkt glücklichen Zufalls?
Wissenschaft und Forschung genießen einen hohen Ruf: Repräsentative Umfragen des Wissenschaftsbarometers belegen, dass die Mehrheit der Befragten Wissenschaft und Forschung “voll und ganz” beziehungsweise “eher” vertraut. Bittet man Menschen um spontane Gedanken zu Wissenschaft und Forschung, so nennen sie zwei klangvolle Namen: Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer. Beobachtet man Leitmedien, so fällt auf, dass diese regelmäßig über spektakuläre wissenschaftliche Entdeckungen vor allem dieser Akteure berichten. Einerseits belegt das den hohen öffentlichen Stellenwert von Wissenschaft und Forschung. Andererseits dokumentiert es den selektiven Blick auf Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung; diese sind aber nur zwei Forschungsbereiche, nicht “die Wissenschaft” als Ganzes.
Was aber ist Wissenschaft? Was kennzeichnet wissenschaftliches Handeln? Bis heute geht die Wissenschaftsphilosophie diesen Fragen nach und hat Kriterien zur Identifikation entwickelt. Demnach ist Wissenschaft jede Tätigkeit mit dem Ziel, geplant, zielgerichtet und systematisch begründetes, überprüfbares, irrtumsfreies, nachvollziehbares Wissen zu erarbeiten und wieder infrage zu stellen sowie dies zu dokumentieren und zu vermitteln. Ähnlich beschreibt das Bundesverfassungsgericht wissenschaftliche Tätigkeit als “alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist”.
Industrieforschung basiert auf erkenntnisgewinnorientierter Grundlagenforschung, die Zusammenhänge wissenschaftlich durchdringt und formuliert, fachlich begutachtet und für die wissenschaftliche Welt publiziert. Im Gegensatz zur Grundlagenforschung widmet sie sich – aus deren Sicht einfachen -, aus der Industrie kommenden Fragen unter den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Umfangreiche Evaluierungen sichern Standards und Qualität. Interessant ist, dass die Wissenschaftler in der Industrieforschung auch die Sprache der Wirtschaft sprechen, der es weniger auf Publikationen und Peer Reviews ankommt: Sie kennen die Märkte, wissen um den Druck von Unternehmen, eher als der Mitbewerber anbieten zu müssen und scheuen sich nicht, wissenschaftliche Erkenntnisse in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln.
Industrieforschung baut die Brücke aus der Wissenschaft in die Wirtschaft, indem sie beide Bereiche zusammenbringt und mit fokussierter Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung ergänzt. Das erschließt vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ermöglicht wissenschaftlich fundierte Produkte und Dienstleistungen. Getragen wird die Industrieforschung von gemeinnützigen, außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen (IFE), die Wert auf langfristige, wissenschaftliche Kompetenz legen. In der Regel erfolgt sie projektbasiert, ihre Forschungsergebnisse sind der Allgemeinheit zugänglich.
Diese Rolle als Mittlerin zwischen den Welten sowie die Verwechslung mit industrieller Forschung begründen die skizzierten Missverständnisse: Industrielle Forschung findet jedoch unternehmensintern in F & E-Abteilungen sowie bei Produktentwicklern statt, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Ihre Ergebnisse kommen allein Unternehmen beziehungsweise Auftraggebern zugute. Industrieforschung schließt als vorwettbewerbliche Forschung hingegen an Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung an und ist ein gleichrangiger, wissenschaftlicher Forschungsbereich – wenn auch nicht im Elfenbeinturm zu Hause.
Sie ist vielleicht etwas kleinteiliger. Mehr aufs technische Detail ausgerichtet. Offener für die Kapitalisierung ihrer Erkenntnisse durch Unternehmen und Produktentwickler. Damit trägt sie erheblich zum Gelingen gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Transformationsprozesse bei – und sollte aufgrund ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung idealiter als transfer- und innovationsorientierte Forschung bezeichnet werden.
In jedem Fall lohnt noch ein Blick auf ihre Finanzierung, denn sie basiert in aller Regel auf Projekten, die lediglich anteilig mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. IFE müssen daher stets auch Mittel aus eigenwirtschaftlicher Arbeit generieren; es gibt für sie keine milliardenschwere, institutionelle Förderung mit jährlichen Aufwüchsen. Das bremst die transfer- und innovationsorientierte Forschung im Vergleich zu ihren Schwestern, behindert den Transfer aus Wissenschaft und Forschung in die Wirtschaft und limitiert das Potenzial der (mittelständischen) Wirtschaft Deutschlands im internationalen Vergleich.
Es wird also Zeit, vom verächtlichen, abschätzigen Blick auf die transfer- und innovationsorientierte Forschung abzusehen, das Pfund zu erkennen, das in den weit über einhundert Einrichtungen für die deutsche Wirtschaft schlummert sowie deren Potenzial (endlich) zu entfesseln. Nur so kann es gelingen, dass wissenschaftliche Ergebnisse kontinuierlich zu wirtschaftlichem Erfolg und gesamtgesellschaftlichem Wohlstand führen.
Sylvia Heuchemer wird neue Präsidentin der TH Köln. Die langjährige Vizepräsidentin für Lehre und Studium wird ihr neues Amt voraussichtlich zum 1. Mai 2024 antreten.
Manja Krüger ist neue Prorektorin für Forschung, Technologie und Chancengleichheit an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Barbara Sturm wurde von der Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft erneut als Vizepräsidentin in ihren Vorstand gewählt. Sie ist Wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) in Potsdam sowie Professorin für Agrartechnik an der HU Berlin.
Patrizia Nanz wird neue Präsidentin des Europäischen Hochschulinstituts (EUI). Sie gibt damit ihr Amt als Vizepräsidentin des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ab. Wann Nanz ihre neue Stelle in Florenz antritt, ist nach ihren Angaben bislang noch nicht festgelegt.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Freitag, 1. Dezember
Laura Kraft (Grüne), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 32
Petra Sitte (Die Linke), MdB, Stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 62
Samstag, 2. Dezember
Michael Baumann, Wissenschaftlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums, 60
Sonntag, 3. Dezember
Sönke Rix (SPD), MdB, Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 47
China.Table. China Center der TU Berlin feiert Jubiläum. Das China Center an der TU Berlin hat am Freitag mit einer Tagung zum Thema “Young China” sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Klagen gab es über mangelnde Finanzierung, gerade im Hinblick auf das Ziel der Bundesregierung die China-Kompetenz in Deutschland deutlich auszbauen. Mehr
Africa.Table. CCS – Klimarettung oder Greenwashing? Einige afrikanische Länder setzen im Kampf gegen den Klimawandel auf Kohlenstoffabscheidung. Doch der Ansatz ist umstritten. Klimaforscher zweifeln an seiner Wirksamkeit, und afrikanische Bürger fühlen sich bei der Planung von ihren Regierungen übergangen. Mehr
Europe.Table. Wissing: Standardisierer sollen KI-Modelle regulieren. Deutschland will ein neues Papier in die Verhandlungen zum AI Act einbringen, in dem es die Vorschläge zur regulierten Selbstregulierung von Foundation Models konkretisiert. Noch liegen die Vorstellungen von Parlament und Rat weit auseinander. Mehr
Climate.Table. Zehn entscheidende Fragen für die COP28. Zu den wichtigen offenen Fragen der am Donnerstag beginnenden Klimakonferenz gehört, ob der Krieg in Gaza den Nord-Süd-Konflikt auch in Klimafragen verschärft, ob die Arabischen Emirate als ehrliche Makler agieren – und ob die USA und China zusammenarbeiten werden. Mehr
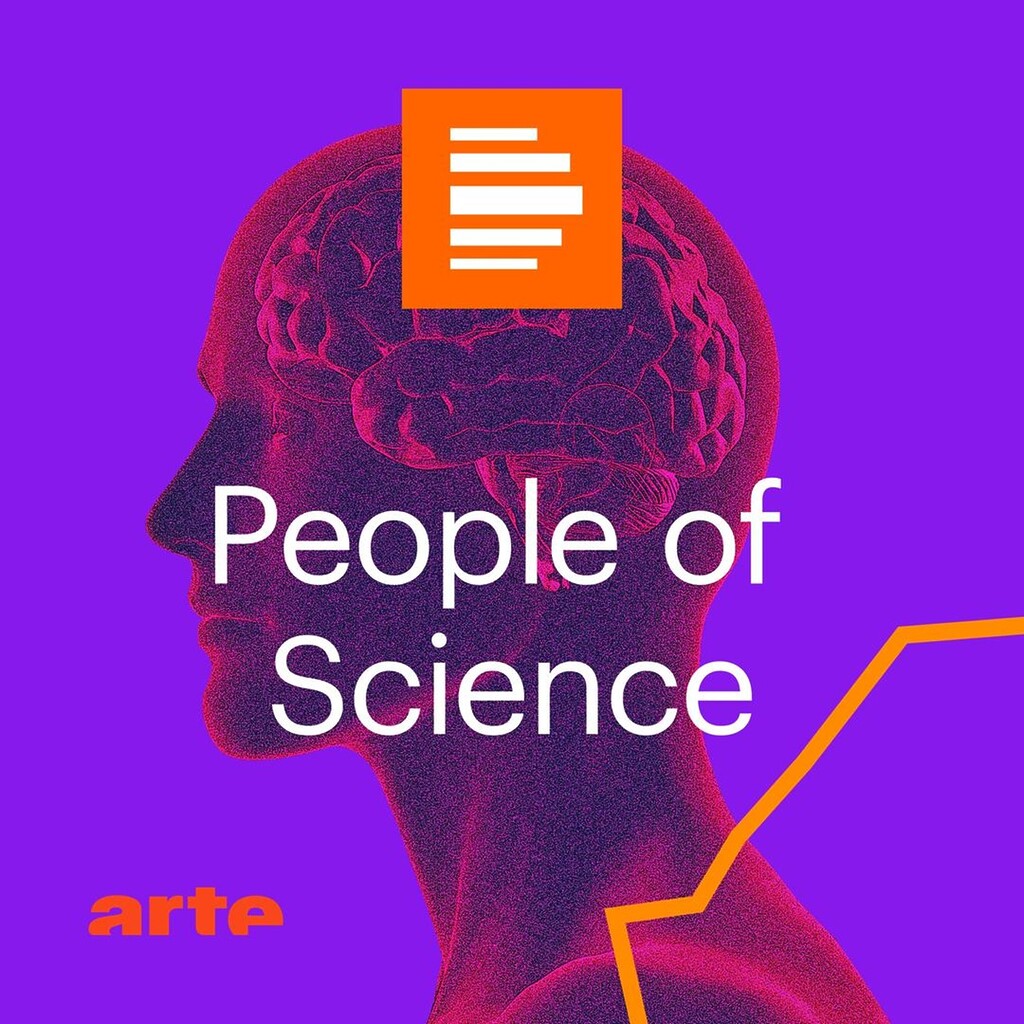
An dieser Stelle gilt es heute mal eine Empfehlung für die Arbeit von Kollegen auszusprechen: Möglicherweise keine brandaktuelle, aber dafür eine umso relevantere für all diejenigen, die davon bisher noch nichts gehört haben. Die Rede ist vom Wissenschafts-Podcast “People of Science”. Psychologieprofessor Bertolt Meyer stellt in der von Arte und Deutschlandfunk Kultur produzierten Sendung – wie der Name es sagt – Protagonisten der deutschen Scientific Community und ihre Themen vor.
Das ist sehr hörenswert und ergibt Episode für Episode ein Mosaik, das zeigt, was und wen Wissenschaft in Deutschland aktuell beschäftigt und vor welchen Herausforderungen Forscherinnen und Forscher stehen. Seit Oktober läuft die zweite Staffel. Mit dabei diesmal unter anderem die beiden Allgegenwärtigen Antje Boetius und Amrei Bahr sowie auch Onur Güntürkün, der berichtet, wie er sich mit der Kombination aus Hirnforschung und Psychologe erst seinen Platz in der Wissenschaft erkämpfen musste. Tim Gabel
erst kürzlich verkündete das BMBF freudig die hohe Beteiligung an den Datipilot-Calls. 3.000 Einreichungen hatte es allein für die sogenannten Innovationssprints gegeben. Doch nach der ursprünglichen Planung könnten mit den vorhandenen 30 Millionen Euro nur ungefähr 100 Projekte gefördert werden – eine Quote von lediglich drei Prozent.
Daher wird der Topf erweitert, berichtet mein Kollege Markus Weisskopf. Die geplanten Mittel seien bereits in die aktuelle Haushaltsplanung eingeflossen, erklärte ein BMBF-Sprecher. Die Erhöhung sei jedoch noch vorbehaltlich der Beschlussfassung des Bundestages über den Haushalt 2024.
Und schon sind wir mitten in den laufenden Etat-Debatten: Nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse muss die Bundesregierung den Haushalt neu aufstellen. Längst verabschiedete Projekte werden mehr oder minder offen hinterfragt. Bleibt es bei den 150 Millionen mehr fürs Bafög? Ist der Bau der Chipfabriken im Osten in Gefahr? In Gesprächen wirken auch die Forschungspolitiker zunehmend verunsichert.
Ein Nachtragshaushalt soll jetzt “Sicherheit in die Haushaltsplanung bringen”, schreibt Bundesfinanzminister Christian Lindner am Montag in einem Brief an alle Fraktionen. Kurze Zeit nach Bekanntwerden des damit verbundenen Zeitplans für die Vorlage des Nachtragshaushalts, ist dieser dann bereits überholt, berichten unsere Kollegen im Berlin.Table: Nicht erst am Mittwoch vor Ort, sondern schon am gestrigen Montag hat das Bundeskabinett das Nachtragshaushaltsgesetz beschlossen.
In einem Brief des Ministers an die Fraktionen wird später deutlich, Christian Lindner wird den neuen Haushalt für 2024 nicht mehr in diesem Jahr vorlegen. Was sich durch die verschobenen Haushaltsberatungen in dieser Woche terminlich ändert, haben wir Ihnen in einer News zusammengefasst.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

In einer Mitteilung jubelte das BMBF kürzlich über die hohe Beteiligung an den Datipilot-Calls. 3.000 Einreichungen gab es alleine für die sogenannten Innovationssprints. Nach der ursprünglichen Planung hätten mit den vorhandenen 30 Millionen Euro nur ungefähr 100 Projekte gefördert werden können – eine Quote von lediglich drei Prozent.
Daher wird der Topf nun auf 90 Millionen Euro für rund 300 geförderte Projekte erweitert, um immerhin rund 10 Prozent der eingereichten Projekte finanzieren zu können. Diese Mittel seien auch bereits in die aktuelle Haushaltsplanung eingeflossen, sagte ein BMBF-Sprecher. Die Erhöhung sei jedoch noch vorbehaltlich der Beschlussfassung des Bundestages über den Haushalt 2024. Immerhin, Ye-One Rhie, die für die SPD im Forschungsausschuss sitzt, ist optimistisch, dass dies auch so kommt.
Während die endgültige Höhe des Fördertopfes noch unsicher scheint, laufen bereits die ersten Pitches der vom BMBF initiierten Roadshow – der erste fand vergangenen Montag in Essen statt. Dort entscheidet die Community vor Ort, welche der 600 vorausgewählten Projekte gefördert werden. 150 werden über diesen Weg ausgewählt. Weitere 150 werden in einem Losverfahren ermittelt.
Prinzipiell gibt es viel Lob für die neuen Wege in der Förderung. Die Hochschulallianz für den Mittelstand begrüßt diese im Gespräch mit Table.Media ausdrücklich, betont aber auch, dass natürlich Qualität und Transferorientierung als Kriterien weiterhin vorne stehen müssten. Die Transferorientierung stellt CDU-Forschungspolitiker Thomas Jarzombek zumindest in Teilen infrage, wenn nur eine Institution im Projekt beteiligt sei. Immerhin 42,5 Prozent der eingereichten Anträge seien Einzelanträge gewesen, nur der Rest Verbünde von zwei Partnern.
In jedem Fall könnte die geringe Förderquote Frust bei den vielen nicht erfolgreichen Antragstellern hervorrufen. Auch bei den Innovationscommunities, die mit bis zu fünf Millionen für vier Jahre gefördert werden, zeichnet sich eine ähnlich schlechte Förderquote ab. Hier werden laut BMBF-Homepage gar nur zehn von insgesamt wohl rund eingereichten 300 Anträgen gefördert.
Diese geringe Aussicht auf Erfolg könnte die derzeit eher schlechte Stimmung in der Community noch verstärken. Angesichts immer weiterer Verzögerungen und einer weiterhin großen Unsicherheit, wo am Ende die Reise für die Dati hingehen soll, mehrt sich die Kritik.
Nachdem zwei Jahre wenig passiert ist, wünschen sich viele Akteure aus der Community ein schnelleres Vorgehen. Gerade angesichts der Haushaltskrise und der Restlaufzeit der aktuellen BMBF-Leitung drängt man auf konkrete Schritte.
In jedem Fall sollten die für das erste Quartal angekündigte Standortentscheidung sowie die Entscheidung über das Führungspersonal – wissenschaftlicher und kaufmännischer Geschäftsführer – nicht weiter verzögert werden. Wie bei der Sprind zu besichtigen, wäre aber selbst eine starke Leitung mit viel Durchhaltevermögen und politischem Geschick maximal gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Dati zu erstreiten, meint Thomas Jarzombek.

Auf der Landkarte deutscher Universitäten sind die Mittelgroßen mit jeweils rund 20.000 Studierenden in großer Zahl vertreten, auf der Exzellenz-Landkarte jedoch klar in Unterzahl. Im Kreis der 14 Exzellenzuniversitäten hält einzig das kleine Konstanz ihre Fahne hoch und von 35 Exzellenzclustern sind nur acht an kleinen oder mittelgroßen Universitäten angesiedelt. Das könnte sich mit der aktuellen Runde des großen Wettbewerbs ändern. Zahlreiche Mittelgroße haben ihre Stärken gebündelt und häufig auch zusammen mit außeruniversitären Partnern Projektskizzen eingereicht, über die demnächst entschieden wird. Eine treibende Kraft im neuen Miteinander ist die Ende November 2020 gegründete Universitätsallianz UA11+.
Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen seien enttäuscht gewesen über das Abschneiden in den bisherigen Exzellenzwettbewerben, sagt Birgitt Riegraf, Vorsitzende der UA11+ und Präsidentin der Universität Paderborn. “In Profilbereichen haben alle mittelgroßen Universitäten Pockets of Excellence, also international sichtbare Spitzenforschung.” Häufig fehle jedoch die kritische Masse, um sich in großen Forschungswettbewerben erfolgreich zu behaupten. Da sei es von Vorteil, dass in der Exzellenzstrategie jetzt auch Bewerbungen im Dreierverbund (statt wie früher mit höchstens einem Partner) möglich seien. Riegraf: “Diese Änderung der Teilnahmebedingungen geht wesentlich auf unsere Initiative zurück.”
Mit einer Geschäftsstelle in Berlin, einem Regelwerk und regelmäßigen Veranstaltungen ist die inzwischen als gemeinnütziger Verein anerkannte UA11+ deutlich straffer organisiert als das seit 2006 bestehende lose Netzwerk mittelgroßer Universitäten. Und anders als TU9 und German U15 will die UA11+ offen für neue Mitglieder bleiben. Zu den elf Gründern gesellten sich bisher vier weitere Universitäten und schon bald könnten neue hinzukommen, berichtet Birgitt Riegraf, die von Anfang an dabei ist.

In die Allianz der Mittelgroßen wird längst nicht jeder aufgenommen. Eine wichtige Voraussetzung ist Spitzenforschung in mindestens einem Profilbereich. Das ermöglicht anspruchsvolle Verbundanträge wie zum Beispiel die Clusterskizze “Mensch-Robotik-Interaktion”, mit der sich die Universitäten Paderborn, Bielefeld und Bremen zurzeit gemeinsam in der Exzellenzstrategie bewerben. “Zu dritt können wir die jeweils eigenen Stärken besser zur Geltung bringen und Synergien schaffen”, sagt Riegraf. Mit ihren Forschungsleistungen trügen die Mittelgroßen substantiell zur Exzellenz des Gesamtsystems bei – und dafür wünscht sich die Wissenschaftsmanagerin mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung.
Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, muss dazu nicht eigens aufgefordert werden. “Die deutsche Forschungslandschaft zeichnet sich aus durch verteilte Exzellenz”, sagt Rosenthal, der bis Ende Oktober Präsident der mittelgroßen Universität Jena war. Eine Fokussierung auf wenige Spitzenuniversitäten würde, davon ist er überzeugt, die vielen Leuchttürme in den Regionen benachteiligen. Mit universitären Verbünden habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt der HRK-Chef, bewährt hätten sie sich insbesondere auch in der Kooperation mit außeruniversitären Partnern.
Solche Partnerschaften gehören zur DNA mittelgroßer Universitäten. Viele von ihnen sind in den 1970er-Jahren mit dem Auftrag entstanden, ihre Region wissenschaftsbasiert voranzubringen. Sie haben seither enge Beziehungen zu außeruniversitären Instituten, Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen aufgebaut und ihre Forschung in die Praxis getragen. “Heute steht Transfer politisch hoch im Kurs”, sagt Birgitt Riegraf, “unsere Erfahrung auf dem Gebiet ist gefragt.” Etwa in der Gründungskommission der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati), in die Riegraf jetzt berufen wurde. Sie wird die Gelegenheit nutzen, um eine dauerhafte staatliche Finanzierung von Vorhaben zum Wissenstransfer anzumahnen: “Allein mit Projektmitteln können wir keine tragfähigen Strukturen aufbauen.”
Pockets of Excellence, regionale Verwurzelung, Transfer-Expertise, kurze Wege, bezahlbare Mieten -mittelgroße Universitäten haben viele Pluspunkte. Dennoch: “Wir sind nicht Berlin, Heidelberg oder München”, sagt Birgitt Riegraf. Im Wettbewerb um profilierte Wissenschaftler haben die Mittelgroßen nicht selten das Nachsehen und auch Studierende zieht es eher in die Metropolen. Sorgen bereitet ihnen die wachsende Konkurrenz in den Regionen, wo Unternehmen, Behörden und Handwerk ebenfalls versuchen, den Nachwuchs für sich zu gewinnen. Riegraf: “Aber solche Probleme haben zunehmend auch die Metropoluniversitäten.”
Neue Handlungsstrategien will die UA11+ bei einem Workshop Anfang 2024 entwickeln. Ein wichtiges Thema dürfte die Stärkung bestehender internationaler Netzwerke sein. Gute Chancen eröffne das EU-finanzierte Netzwerk europäischer Universitäten, sagt Riegraf – Paderborn gehört seit Kurzem dazu.
In ihren Regionen können die Mittelgroßen ihre Stärken ausspielen. Duale Studiengänge zusammen mit langjährig verbundenen Partnern seien überall in Planung, berichtet Riegraf, gleiches gelte für das Zukunftsthema wissenschaftliche Weiterbildung.
In Deutschland leiden Schätzungen zufolge etwa 500.000 Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen an Long Covid. Das Bundesgesundheitsministerium richtet nach eigenen Angaben momentan einen Förderschwerpunkt zu versorgungsnaher Forschung zu Long Covid ein. Der Fokus liege auf Modellprojekten zu innovativen Versorgungsformen. “Für mich ist klar: Wir dürfen und wir werden die Betroffenen nicht im Stich lassen”, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitagabend beim 2. Long Covid Kongress in Jena.
Dass die Ampelparteien das Thema Long Covid ernst nehmen, bestätigte auch Katrin Göring-Eckardt (Grüne) in einer Videobotschaft: “In den vergangenen Wochen haben wir als Bundesregierung Mittel insgesamt von mehr als 200 Millionen Euro für Forschung und Versorgung bei Long Covid im Haushalt vorgesehen.” Auch die 250.000 Menschen mit chronischem Fatigue-Symptom (ME/CFS) sollen profitieren, sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Zuletzt hatte der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung die Mittel für Long Covid deutlich aufgestockt.
Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es noch immer kein Arzneimittel, das für die Bekämpfung der Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion zugelassen ist. Deshalb verwenden viele Ärzte Medikamente, die bereits eine Zulassung für eine andere Erkrankung haben, außerhalb der genehmigten Indikationen im “Off-label-Use”. Auch Lauterbach setzt auf diesen Weg. “Wir werden den Zugang zu diesen Arzneimitteln verbessern”, sagte er bei dem von Ärzten und Betroffenen organisierten Kongress.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte richte derzeit eine Expertenkommission ein, die “die Anwendung von Arzneimittel außerhalb ihrer zugelassenen Anwendungsgebiete für den Einsatz bei Long Covid anhand bestimmter Kriterien bewertet”. Eine Empfehlung dieser Kommission könnte Bürokratie verringern und die Kostenerstattung durch Krankenkassen erleichtern. “Derzeit haben die allerwenigsten Patienten die Möglichkeit, diese Medikamente zu bekommen”, sagte Carmen Scheibenbogen, Long-Covid-Expertin an der Berliner Charité. Off-Label-Therapie bedeute ein höheres Risiko und größeren Aufwand. “Wenn es eine Empfehlung gibt, wird die Bereitschaft der Ärzte größer sein, diesen Weg zu gehen”, sagte sie.
Scheibenbogen ist eine der Leiterinnen der Nationalen Klinischen Studiengruppe (NKSG), die Medikamente und Therapien zur Zulassung bringen will. “Das darf nicht mehr zu lange dauern, denn wir haben viele, die seit über drei Jahren verzweifelt darauf warten”, sagte die Infektionsforscherin. Sie habe eine Zusage des BMBF für die Finanzierung von drei weiteren Studien erhalten, die die bisherige Förderung von zehn Millionen Euro ergänze.
Enttäuscht äußerte sich die Immunologin über die geringe Unterstützung durch die pharmazeutische Industrie, die üblicherweise in Deutschland die Zulassungsstudien finanziert. Derzeit laufen bei der NKSG drei doppelt verblindete, placebokontrollierte Therapiestudien: Getestet wird das Bayer-Medikament Vericiguat für Patienten mit entzündungsbedingter Minderdurchblutung von Gefäßen und Organen. Zum Einsatz kommt auch das Glucocorticoid Methylprednisolon bei Patienten mit verminderter kognitiver Leistung. Eine dritte Studie untersucht den Erfolg eine Blutwäsche (Immunadsorption), bei der gegen den eigenen Körper gerichtete Antikörper aus dem Patientenblut gefiltert werden. Diese überschießende Autoimmunreaktion gilt als eine der möglichen Ursachen von Long Covid.
Beobachtungsstudien der NKSG zur Wirksamkeit der Immunadsorption und einer Hochdruck-Sauerstofftherapie (H-BOT) haben erste positive Ergebnisse geliefert. Diese Therapien scheinen für einen Teil der Long-Covid-Patienten zu sein, aber sicher nicht für alle. Long Covid hat als Multiorgan-Erkrankung viele Gesichter und unterschiedliche Krankheitsmechanismen. Forschung, welche Therapie für welche Untergruppe geeignet ist, sei längst überfällig, sagt Jördis Frommhold, Gründungspräsidentin des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long Covid. Die Patienten zahlen die Therapie aus eigener Tasche. “Wir müssen die Betroffenen vor unnötigen Ausgaben warnen”, fordert die Leiterin des Instituts Long Covid in Rostock.
Für 2024 ist eine Medikamentenstudie mit dem Präparat Vidofludimus Calcium (IMU 838) geplant. Sie wird vom Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) der 36 deutschen Universitätskliniken finanziert. Studienleiterin Maria Vehreschild will mehr als 300 Patienten einbeziehen, die an zwölf Standorten betreut werden sollen. Das aus der Behandlung von Multipler Sklerose bekannte Medikament behindert die Vermehrung von Corona-Viren, die sich im Körper verstecken und kann eine überschießende Immunreaktion regulieren. Das NUM stellt nicht nur eine weitgehend neu geschaffene Dateninfrastruktur zur Verfügung, sondern will auch die Arbeit der einzelnen regionalen Ethikkommissionen koordinieren, damit eine nachhaltige nationale Verwertbarkeit der Ergebnisse gesichert wird. Rainer Kurlemann
29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus
Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr
29. November 2023, 19:00 Uhr, BBAW – Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin
Diskussion Zwischen Transparenz und Heimlichtuerei: Wie viel Vertraulichkeit braucht demokratische Politik? Mehr
1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.
Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr
1. Dezember 2023, 19 Uhr, Nikolaisaal, Potsdam
Festveranstaltung der BBAW Einsteintag 2023 – u. a. mit Jutta Allmendinger und Jörg Steinbach im Gespräch über die Zukunft der Arbeit Mehr
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat in einer Sondersitzung am gestrigen Montag beschlossen, das Bund-Länder-Programm zur Förderung der anwendungsorientierten Forschung an HAWs weiterentwickelt fortzuführen. 528 Millionen Euro stehen für die nächsten sieben Jahre zur Verfügung. Davon trägt der Bund 445 Millionen Euro. 83 Millionen Euro steuern die Länder nach einem Stufenmodell bei. Das bedeutet, dass die Länder ihren Beitrag nach und nach erhöhen.
“Mehr Geld, mehr Zeit und mehr Fokus auf die Ziele” sei das Ergebnis der Verhandlungen, erklärte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Von einem “Paukenschlag” gar sprach der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume. Diesen Begriff fanden Vertreter der HAWs nicht passend. Es sei zwar gut, dass sich Bund und Länder geeinigt haben. Die 83 Millionen Euro, die nun zusätzlich seitens der Länder in das Programm fließen, seien aber kaum mehr als ein Inflationsausgleich über die sieben Jahre Laufzeit, meint Bernd Kriegesmann, von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Ähnlich äußerte sich Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der HAWs in der Hochschulrektorenkonferenz. Er freue sich, dass es weitergehe und dass die Laufzeit auf sieben Jahre verlängert werde. Allerdings zeigte er sich enttäuscht über die Höhe des Engagements der Länder. Man habe sich hier “eine Beteiligung in vergleichbarer Höhe wie in anderen Programmen gewünscht”.
Zwischenzeitlich schien bei den Verhandlungen im Laufe des Jahres auch ein Kompromiss entsprechend des Verteilschlüssels der Exzellenzstrategie (75 Prozent Bund, 25 Prozent Länder) möglich zu sein. Seitens des Bundes wurde nach einem Koalitionsbeschluss im Sommer gar eine paritätische Finanzierung von Bund und Ländern angestrebt. Damit hätte man, bei einer zugesagten Fördersumme von 60 Millionen Euro seitens des Bundes, 120 Millionen Euro Gesamtförderung im Jahr erreicht. Und damit den Betrag, den die HAWs seit längerem für dieses Programm fordern. mw
Durch die neuerlichen Verhandlungen und Sitzungen zum Nachtragshaushalt und zu dem aus 2024 haben sich in Berlin zahlreiche Termine verschoben, neue sind dazu gekommen – auch im Bereich Forschungspolitik. Hier finden Sie einen Überblick des aktuellen Stands:
Haushalt: Kurz nach Bekanntwerden des Zeitplans für die Vorlage des Nachtragshaushalts, ist dieser schon überholt. Nicht erst am Mittwoch vor Ort, sondern schon am Montag per Umlaufverfahren beschloss das Bundeskabinett das Nachtragshaushaltsgesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Freitag, 1. Dezember: Erste Lesung des Haushalts im Bundestag (möglich wäre auch eine Direktüberweisung an den Haushaltsausschuss, wie ein entsprechender Vorschlag des Ältestenrats besagt, die Verhandlungen hierzu laufen offenbar noch).
Spätestens am 10. Dezember: Erste Beratung des Gesetzes im Bundesrat, dies würde eine Verkürzung der ansonsten üblichen Zwei-Wochen-Frist mit sich bringen.
Mittwoch, 13. Dezember: 2. / 3. Lesung Bundestag, Voraussetzung dafür ist, dass bis dahin eine Stellungnahme des Bundesrats vorliegt.
Freitag, 15. Dezember: 2. Durchgang im Bundesrat, dieser könnte abschließend beraten (letzten reguläre Sitzung im Jahr).
Ende Dezember: Verkündung des Nachtragshaushalts im Bundesgesetzblatt.
Mittwoch, 29. November: Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung kommt zusammen (9.30 Uhr bis 12.55 Uhr, Paul-Löbe-Haus). Auf der Tagesordnung stehen die BMBF-Berichte “Aktionsplan KI” und “Aktionsplan Robotikforschung”. Des Weiteren wird der Ausschuss über den Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 und über die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beraten.
Mittwoch, 29. November: Der Bundestag berät ab ca. 17 Uhr über die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum weiteren Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich des Wissenschaftszeitvertrags-Gesetzes (20/8634). Die Unionsabgeordneten erkundigen sich in der Großen Anfrage unter anderem danach, ob die Bundesregierung weiterhin die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beabsichtigt. Eine Frage, die sicher nicht nur die Opposition beschäftigt. nik
Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) selbst eingesetzte Strukturkommission hat erste Empfehlungen zur Reform der KMK erarbeitet. Demnach empfiehlt sie, ein systematisches Monitoring der Umsetzung von Beschlüssen in den Ländern einzuführen. Zudem soll die Zahl der Gremien reduziert werden. Die Kommission rät darüber hinaus, gemeinsame Sitzungen und Beratungsstrukturen der Bereiche Schule und Hochschule/Wissenschaft stärker zu trennen. Sogar die Alternative einer eigenständigen Konferenz der Wissenschaftsminister steht im Raum.
Das Eckpunkte-Papier “Für eine zukunftsfähige Kultusministerkonferenz” liegt Table.Media vor. Im Dezember 2022 hatte die KMK die Unternehmensberatung Prognos beauftragt, die eigenen Strukturen zu durchleuchten. Während der jüngsten Konferenz der Kultusminister im Oktober wurden erste Ergebnisse bekannt – und sorgten für reichlich Wirbel. Denn die Analyse deckte einen Wildwuchs an mehr als 170 Gremien sowie langsame Entscheidungsstrukturen auf. hsc
Die EU und die Schweiz haben in einer gemeinsam erarbeiteten Erklärung Verhandlungen über ein Abkommenspaket vereinbart. Damit können auch “explorative Gespräche” zur Assoziation der Schweiz zu Horizon Europe starten, erklärte EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova.
Im angestrebten Abkommen soll neben der Wiederaufnahme der Schweiz in Horizon Europe der Beitritt zu Erasmus plus enthalten sein. Auch die regelmäßige Zahlung eines Kohäsionsbeitrages soll darin geregelt werden. Angedacht ist scheinbar ein flexibler Mechanismus, wie er auch mit Großbritannien vereinbart wurde. Hier werden je nach Erfolgsquote der Wissenschaftler bei den Calls die Beiträge des Partnerlandes bemessen.
Nach den explorativen Gesprächen könnten formale Verhandlungen über den Horizon-Beitritt im März 2024 starten. Ob allerdings ein Gesamtabkommen noch vor den EU-Wahlen erreicht werden kann, wird bezweifelt. Umstritten waren bei den bisherigen Gesprächen zwischen der Schweiz und der EU insbesondere die Personenfreizügigkeit und der Lohnschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Dass die Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe von den übrigen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU komplett getrennt werden, wie es der ETH-Rat fordert, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Damit würde die EU das “Rübli” aus Hand geben, das die Schweiz motivieren soll, in den strittigen Bereichen auf die EU zuzugehen.
Nach langwierigen Verhandlungen haben sich auch die EU und Kanada geeinigt: Ab 2024 können kanadische Forscher Teil von Horizon Europe werden. Vor rund fünf Jahren hatten die Verhandlungen begonnen, am vergangenen Freitag wurden sie auf dem EU-Kanada-Gipfel in St. John’s, Neufundland, so gut wie abgeschlossen. “Kanada tritt Horizon Europe bei, dem derzeit größten Forschungs- und Innovationsmechanismus der Welt”, freute sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau.
Kanadische Forscher und akademische Einrichtungen sowie Forschungsinstitute können dann an Säule 2 von Horizont Europa teilnehmen, einem Teil des 95,5 Milliarden Euro schweren Forschungs- und Innovationsprogramms der EU. Hier werden große Verbundprojekte zur Lösung globaler Herausforderungen finanziert, in den Bereichen Klima, Energie, digitale Wirtschaft und Gesundheit. Budget: 53,5 Milliarden Euro. mw/nik
Die meisten der 308 in diesem Jahr vergebenen Consolidator Grants des European Research Council (ERC) gehen nach Deutschland. Wie das Gremium am vergangenen Donnerstag mitteilte, erhalten hierzulande 66 Forschende individuelle Förderung von jeweils bis zu zwei Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren. An zweiter Stelle stehen die Niederlande mit 36 Preisträgern, es folgen Frankreich und Spanien mit jeweils 23.
Das klingt nach einem großen Erfolg für Deutschland. Das Resultat relativiert sich jedoch, wenn man die Zahl der Grants zum Beispiel bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt betrachtet. Darauf weist der belgische Wissenschaftler Denis Wirtz hin, der an der Johns Hopkins University in Baltimore/USA forscht. In einem Beitrag auf der Plattform X zeigt er: Bezogen auf das BIP schneiden die Niederlande, Dänemark, Österreich, Israel und Belgien überdurchschnittlich gut ab. Deutschland liegt zusammen mit Großbritannien und Spanien eher im Mittelfeld. Unterdurchschnittlich: Frankreich, Italien, Norwegen und Polen.
EU-Forschungskommissarin Iliana Ivanova hob erfreut hervor, dass der Anteil, der mit einem Consolidator Grant ausgezeichneten Frauen, zum dritten Mal in Folge angestiegen ist und in der aktuellen Runde 39 Prozent beträgt.
Als enttäuschend bezeichnete sie es, dass nicht alle Projekte, die es verdient hätten, unterstützt werden konnten. Aufgrund des beschränkten Budgets seien etwa 100 als hervorragend eingestufte Projektvorschläge nicht zum Zuge gekommen. Insgesamt gab es mehr als 2.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Die Fördersumme lag in diesem Jahr bei 627 Millionen Euro. Gemeinsames Ziel müsse es sein, dafür zu sorgen, dass in Europa keine brillante Idee unfinanziert bleibt, sagte Ivanova.
Unter den deutschen Universitäten schneiden die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und die Universität Bielefeld mit jeweils vier Consolidator Grants besonders gut ab. In der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft sind es jeweils fünf Preisträger.
Consolidator Grants zählen zu einer von vier Individualförderlinien des ERC. Es handelt sich um personengebundene Zuwendungen für einzelne, exzellente Forschende. Consolidator Grants sind für Forschende in einem Zeitfenster von 7 bis 12 Jahren nach der Promotion gedacht. Die Gewinner der Advanced Grants, einer für erfahrene Forschende gedachten Förderlinie, die mit jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro noch höher dotiert ist, werden voraussichtlich im April 2024 bekanntgeben. abg

Es wird behauptet, Industrieforschung sei keine Wissenschaft, sondern Wald- und Wiesenforschung, bei der Menschen ohne Sinn und Verstand rein empirisch an Knöpfen drehen und schauen, was passiert, um kommerzielle Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Da stecke zwar Forschung drin, aber keine Wissenschaft. Industrieforschung als reine Empirie? Ihre Ergebnisse das Produkt glücklichen Zufalls?
Wissenschaft und Forschung genießen einen hohen Ruf: Repräsentative Umfragen des Wissenschaftsbarometers belegen, dass die Mehrheit der Befragten Wissenschaft und Forschung “voll und ganz” beziehungsweise “eher” vertraut. Bittet man Menschen um spontane Gedanken zu Wissenschaft und Forschung, so nennen sie zwei klangvolle Namen: Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer. Beobachtet man Leitmedien, so fällt auf, dass diese regelmäßig über spektakuläre wissenschaftliche Entdeckungen vor allem dieser Akteure berichten. Einerseits belegt das den hohen öffentlichen Stellenwert von Wissenschaft und Forschung. Andererseits dokumentiert es den selektiven Blick auf Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung; diese sind aber nur zwei Forschungsbereiche, nicht “die Wissenschaft” als Ganzes.
Was aber ist Wissenschaft? Was kennzeichnet wissenschaftliches Handeln? Bis heute geht die Wissenschaftsphilosophie diesen Fragen nach und hat Kriterien zur Identifikation entwickelt. Demnach ist Wissenschaft jede Tätigkeit mit dem Ziel, geplant, zielgerichtet und systematisch begründetes, überprüfbares, irrtumsfreies, nachvollziehbares Wissen zu erarbeiten und wieder infrage zu stellen sowie dies zu dokumentieren und zu vermitteln. Ähnlich beschreibt das Bundesverfassungsgericht wissenschaftliche Tätigkeit als “alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist”.
Industrieforschung basiert auf erkenntnisgewinnorientierter Grundlagenforschung, die Zusammenhänge wissenschaftlich durchdringt und formuliert, fachlich begutachtet und für die wissenschaftliche Welt publiziert. Im Gegensatz zur Grundlagenforschung widmet sie sich – aus deren Sicht einfachen -, aus der Industrie kommenden Fragen unter den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Umfangreiche Evaluierungen sichern Standards und Qualität. Interessant ist, dass die Wissenschaftler in der Industrieforschung auch die Sprache der Wirtschaft sprechen, der es weniger auf Publikationen und Peer Reviews ankommt: Sie kennen die Märkte, wissen um den Druck von Unternehmen, eher als der Mitbewerber anbieten zu müssen und scheuen sich nicht, wissenschaftliche Erkenntnisse in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln.
Industrieforschung baut die Brücke aus der Wissenschaft in die Wirtschaft, indem sie beide Bereiche zusammenbringt und mit fokussierter Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung ergänzt. Das erschließt vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ermöglicht wissenschaftlich fundierte Produkte und Dienstleistungen. Getragen wird die Industrieforschung von gemeinnützigen, außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen (IFE), die Wert auf langfristige, wissenschaftliche Kompetenz legen. In der Regel erfolgt sie projektbasiert, ihre Forschungsergebnisse sind der Allgemeinheit zugänglich.
Diese Rolle als Mittlerin zwischen den Welten sowie die Verwechslung mit industrieller Forschung begründen die skizzierten Missverständnisse: Industrielle Forschung findet jedoch unternehmensintern in F & E-Abteilungen sowie bei Produktentwicklern statt, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Ihre Ergebnisse kommen allein Unternehmen beziehungsweise Auftraggebern zugute. Industrieforschung schließt als vorwettbewerbliche Forschung hingegen an Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung an und ist ein gleichrangiger, wissenschaftlicher Forschungsbereich – wenn auch nicht im Elfenbeinturm zu Hause.
Sie ist vielleicht etwas kleinteiliger. Mehr aufs technische Detail ausgerichtet. Offener für die Kapitalisierung ihrer Erkenntnisse durch Unternehmen und Produktentwickler. Damit trägt sie erheblich zum Gelingen gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Transformationsprozesse bei – und sollte aufgrund ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung idealiter als transfer- und innovationsorientierte Forschung bezeichnet werden.
In jedem Fall lohnt noch ein Blick auf ihre Finanzierung, denn sie basiert in aller Regel auf Projekten, die lediglich anteilig mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. IFE müssen daher stets auch Mittel aus eigenwirtschaftlicher Arbeit generieren; es gibt für sie keine milliardenschwere, institutionelle Förderung mit jährlichen Aufwüchsen. Das bremst die transfer- und innovationsorientierte Forschung im Vergleich zu ihren Schwestern, behindert den Transfer aus Wissenschaft und Forschung in die Wirtschaft und limitiert das Potenzial der (mittelständischen) Wirtschaft Deutschlands im internationalen Vergleich.
Es wird also Zeit, vom verächtlichen, abschätzigen Blick auf die transfer- und innovationsorientierte Forschung abzusehen, das Pfund zu erkennen, das in den weit über einhundert Einrichtungen für die deutsche Wirtschaft schlummert sowie deren Potenzial (endlich) zu entfesseln. Nur so kann es gelingen, dass wissenschaftliche Ergebnisse kontinuierlich zu wirtschaftlichem Erfolg und gesamtgesellschaftlichem Wohlstand führen.
Sylvia Heuchemer wird neue Präsidentin der TH Köln. Die langjährige Vizepräsidentin für Lehre und Studium wird ihr neues Amt voraussichtlich zum 1. Mai 2024 antreten.
Manja Krüger ist neue Prorektorin für Forschung, Technologie und Chancengleichheit an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Barbara Sturm wurde von der Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft erneut als Vizepräsidentin in ihren Vorstand gewählt. Sie ist Wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) in Potsdam sowie Professorin für Agrartechnik an der HU Berlin.
Patrizia Nanz wird neue Präsidentin des Europäischen Hochschulinstituts (EUI). Sie gibt damit ihr Amt als Vizepräsidentin des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ab. Wann Nanz ihre neue Stelle in Florenz antritt, ist nach ihren Angaben bislang noch nicht festgelegt.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Freitag, 1. Dezember
Laura Kraft (Grüne), MdB im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 32
Petra Sitte (Die Linke), MdB, Stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 62
Samstag, 2. Dezember
Michael Baumann, Wissenschaftlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums, 60
Sonntag, 3. Dezember
Sönke Rix (SPD), MdB, Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, 47
China.Table. China Center der TU Berlin feiert Jubiläum. Das China Center an der TU Berlin hat am Freitag mit einer Tagung zum Thema “Young China” sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Klagen gab es über mangelnde Finanzierung, gerade im Hinblick auf das Ziel der Bundesregierung die China-Kompetenz in Deutschland deutlich auszbauen. Mehr
Africa.Table. CCS – Klimarettung oder Greenwashing? Einige afrikanische Länder setzen im Kampf gegen den Klimawandel auf Kohlenstoffabscheidung. Doch der Ansatz ist umstritten. Klimaforscher zweifeln an seiner Wirksamkeit, und afrikanische Bürger fühlen sich bei der Planung von ihren Regierungen übergangen. Mehr
Europe.Table. Wissing: Standardisierer sollen KI-Modelle regulieren. Deutschland will ein neues Papier in die Verhandlungen zum AI Act einbringen, in dem es die Vorschläge zur regulierten Selbstregulierung von Foundation Models konkretisiert. Noch liegen die Vorstellungen von Parlament und Rat weit auseinander. Mehr
Climate.Table. Zehn entscheidende Fragen für die COP28. Zu den wichtigen offenen Fragen der am Donnerstag beginnenden Klimakonferenz gehört, ob der Krieg in Gaza den Nord-Süd-Konflikt auch in Klimafragen verschärft, ob die Arabischen Emirate als ehrliche Makler agieren – und ob die USA und China zusammenarbeiten werden. Mehr
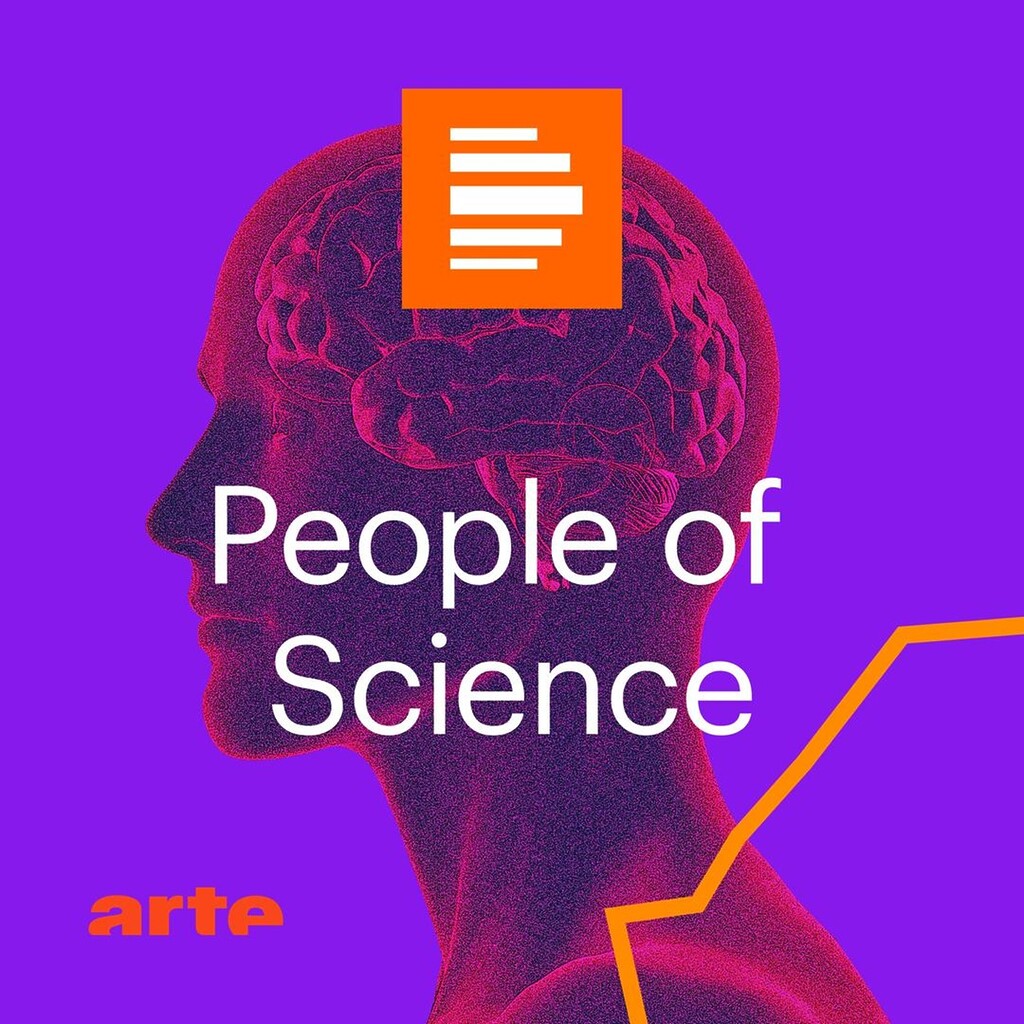
An dieser Stelle gilt es heute mal eine Empfehlung für die Arbeit von Kollegen auszusprechen: Möglicherweise keine brandaktuelle, aber dafür eine umso relevantere für all diejenigen, die davon bisher noch nichts gehört haben. Die Rede ist vom Wissenschafts-Podcast “People of Science”. Psychologieprofessor Bertolt Meyer stellt in der von Arte und Deutschlandfunk Kultur produzierten Sendung – wie der Name es sagt – Protagonisten der deutschen Scientific Community und ihre Themen vor.
Das ist sehr hörenswert und ergibt Episode für Episode ein Mosaik, das zeigt, was und wen Wissenschaft in Deutschland aktuell beschäftigt und vor welchen Herausforderungen Forscherinnen und Forscher stehen. Seit Oktober läuft die zweite Staffel. Mit dabei diesmal unter anderem die beiden Allgegenwärtigen Antje Boetius und Amrei Bahr sowie auch Onur Güntürkün, der berichtet, wie er sich mit der Kombination aus Hirnforschung und Psychologe erst seinen Platz in der Wissenschaft erkämpfen musste. Tim Gabel
