Sie haben es sicher im vergangenen Jahr mehrfach gehört und gelesen: Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft und Gesellschaft so dramatisch verändern wie wohl kaum eine Technologie zuvor. Wenn das stimmt, dann können Sie sich sicher sein, dass sie auch 2024 und in den folgenden Jahren viel über KI hören, lesen und mit KI arbeiten und leben werden.
Der MIT-Professor Daron Acemoğlu hat im Interview mit meinen beiden Kollegen Okan Bellikli und Damir Fras noch einmal betont, wie wichtig es ist, effektive Regeln für KI einzuführen. Und er meint, die EU sei mit ihrem AI Act mit gutem Beispiel vorangegangen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren ließen, ziehe nicht, sagt er. China zeige das Gegenteil. Aber inhaltlich sollten wir natürlich einen anderen Weg einschlagen als China. Wichtig sei auch, dass Europa nicht nur die Regeln, sondern auch eigene Technologie entwickele. Da wird ihm wohl niemand widersprechen.
Dass das in Europa auch gelingen kann, sieht Acemoğlu nicht so pessimistisch wie manch anderer Ökonom. Und er verweist darauf, dass Europa allein wegen der Größe seines Marktes nicht zu ignorieren ist. Doch wie steht es um den viel beschworenen europäischen Binnenmarkt?
Nicht so gut, wie gewünscht. Darum muss Europa befürchten, weiter hinter die anderen großen Wirtschaftsmächte zurückzufallen, schreibt Till Hoppe. Gerade kleine und mittlere Unternehmen beklagen den hohen Aufwand an Bürokratie, der immer noch entsteht, wenn man über die Landesgrenzen hinaus Geschäfte machen möchte. Glaubt man den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll sich das bald ändern.
Alles Gute für Sie,

Unter Ursula von der Leyen hat die EU-Kommission in den vergangenen vier Jahren eine Fülle von Gesetzen zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf den Weg gebracht. Der erhoffte Schub für die heimische Wirtschaft blieb bislang aber aus. Die Behörde erwartet für 2024 nur 1,3 Prozent Wachstum in der EU, und kaum mehr für die beiden Folgejahre. Europa muss daher befürchten, weiter an Boden an andere Wirtschaftsmächte wie die USA und China zu verlieren.
EVP-Chef Manfred Weber hat deshalb schon deutlich gemacht, dass er die Standortbedingungen ins Zentrum des anstehenden Europawahlkampfes rücken will. “Viele Menschen sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung”, sagt Christian Ehler, Sprecher der Christdemokraten im Industrieausschuss (ITRE). “Wir müssen ihnen überzeugende Antworten zur Wettbewerbsfähigkeit anbieten, um die Chance auf eine stabile Mehrheit nach der Europawahl zu erhalten.” Die Sorge ist groß, dass Populisten und EU-Gegner die Abstiegsängste der Menschen für sich zu nutzen wissen.
Auf Drängen ihrer Parteifreunde räumte von der Leyen dem Thema viel Raum ein in ihrer Rede zur Lage der EU. Im September verkündete sie, den früheren EZB-Chef Mario Draghi mit einem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit beauftragt zu haben. Der frühere italienische Premier Enrico Letta soll zudem bis März einen Bericht zum europäischen Binnenmarkt vorlegen.
Letta wird, so viel ist absehbar, auf eine Vertiefung des gemeinsamen Marktes mit seinen heute gut 450 Millionen Einwohnern und 23 Millionen Unternehmen drängen. Der Präsident des Jacques Delors Institute in Paris reist seit einigen Monaten durch die Mitgliedstaaten, um sich ein Meinungsbild einzuholen. Sein ernüchtertes Fazit: Für kaum eine Regierung habe es derzeit Priorität, Hürden zu beseitigen.
30 Jahre nach der Erschaffung des Binnenmarktes hat sich eine gewisse Integrationsermüdung breitgemacht. Der Anteil des Güterhandels zwischen den EU-Staaten an der gemeinsamen Wirtschaftsleistung ist seit 2006 lediglich um 3,5 Punkte auf 23 Prozent gestiegen. Grenzüberschreitende Dienstleistungen machen sogar nur sechs Prozent des BIP aus.
Dort sträuben sich Regierungen und Lobbys hartnäckig gegen die Öffnung ihrer Märkte. “Der Protektionismus nimmt auch innerhalb der EU zu”, kritisiert Freya Lemcke, die Leiterin des Brüsseler Büros der DIHK. So hätten etliche Länder die Entsendung ausländischer Mitarbeiter weiter erschwert.
Einige europäische Wirtschaftsverbände, darunter VDMA und ZVEI aus Deutschland, haben sich deshalb kurz vor Weihnachten per Brief an die Kommission gewandt. Von Land zu Land unterschiedliche Dokumentationspflichten und Anforderungen wie ein fester Ansprechpartner im Gastland führten zu “extremer Bürokratie und hohen Kosten, gerade für KMU”, kritisieren sie in dem Schreiben an Binnenmarktkommissar Thierry Breton und Arbeitskommissar Nicolas Schmit, das Table.Media vorlag.
Letta hofft, eine Debatte auf hoher politischer Ebene anzustoßen. Auch der Dachverband Business Europe fordert, den Binnenmarkt in der kommenden Legislaturperiode ganz oben auf die politische Agenda zu setzen. Ein umfassendes Programm zur Beseitigung hinderlicher Regeln und Bürokratie könne bis 2029 mehr als 700 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung generieren.
Die jüngsten Maßnahmen der von der Leyen-Kommission zur Entlastung von Mittelständlern seien hingegen “enttäuschend”, kritisiert Lemcke: “Die Vorschläge zum Abbau von Berichtspflichten reichen nicht aus, und das KMU-Entlastungspaket wird den Unternehmen in der Praxis wenig helfen.”
Für die neue Kommission wäre es eine Herkulesaufgabe, die wirtschaftliche Integration in der EU neu anzuschieben. Die nationalen Beharrungskräfte sind nicht nur im Dienstleistungssektor groß.
Beispiel Energiepolitik: Die jüngste Gaskrise habe gezeigt, wie wichtig eine echte Energieunion mit grenzüberschreitender Infrastruktur sei, schreiben die drei EVP-Abgeordneten Manfred Weber, Christian Ehler und Andreas Schwab in einem Brief an Letta. Wie schwer sich manche Länder damit tun, zeigte die Weigerung Frankreichs, eine Gaspipeline aus Spanien über die Pyrenäen zu bauen, die auch Deutschland versorgen sollte.
Weber, Ehler und Schwab fordern zudem einen “ehrgeizigen Vorstoß” zur Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion. Die größten Hindernisse für eine bessere Integration der Kapitalmärkte seien das Fehlen eines harmonisierten Rahmens für Insolvenzverfahren sowie die sehr unterschiedlichen Steuervorschriften in den Mitgliedstaaten.
Dabei hätten die Mitgliedstaaten eigentlich einen starken Anreiz, die Hürden für private Investoren zu beseitigen: Die meisten Staatskassen sind leer, und der Investitionsbedarf durch Dekarbonisierung und Digitalisierung ist enorm.
Die knappen Kassen könnten zudem die Diskussion über neue EU-Töpfe neu befeuern. Manche Beobachter in Brüssel rechnen damit, dass Mario Draghi in seinem Bericht dafür plädieren wird.
Bislang lehnt die Bundesregierung eine Neuauflage des Corona-Schuldenprogramms Next Generation EU ebenso ab wie mehr Mittel bereitzustellen für eine europäische Industriepolitik. Wegen des Widerstandes aus Berlin musste die Kommission ihre industriepolitischen Ambitionen stark eindampfen: Der Europäische Souveränitätsfonds wurde vertagt, für dessen Platzhalter STEP ist nach harten Haushaltsverhandlungen kein frisches Geld mehr vorgesehen.
Es wird sich zeigen, ob die Bundesregierung angesichts des schrumpfenden finanziellen Spielraumes bei diesem Kurs bleibt. Bislang will sie etwa die heimische Stahlindustrie mit Milliarden aus dem Bundeshaushalt unterstützen bei der Umstellung auf grünen Wasserstoff. Dabei ließe sich grüner Stahl an anderen Standorten in Europa wohl deutlich günstiger herstellen. “Solange es keine relevanten europäischen Fördermittel gibt, wird die Diskussion über Transformation der Industrie aber eine nationale bleiben”, sagt Philipp Jäger, Fellow am Jacques Delors Centre der Berliner Hertie School.

Herr Acemoğlu, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass neue Technologien wie KI nicht ausreichend reguliert sind und die meisten Arbeitnehmer in einer dystopischen Zukunft irrelevant werden. Ist das realistisch?
Für mich ist das ein Albtraum-Szenario. Aber Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen das für eine schöne Utopie halten. Und das ist in gewisser Weise das Problem. KI wird in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen: Auch wenn neue Technologien Arbeitsplätze nicht im großen Stil zerstören, so machen sie die Arbeit doch weniger relevant und weniger gut bezahlt. Ich bin nicht besorgt, dass es keine Büroangestellten oder keine Buchhalter mehr geben wird. Aber ich bin besorgt, dass sie nicht mehr so gut bezahlt werden wie heute. In den USA zum Beispiel gehen die Realeinkommen von Arbeitnehmern ohne Uni-Abschluss seit Jahrzehnten zurück. Der Einsatz von KI wird dieses Phänomen noch verstärken, wenn wir nicht die richtigen Weichen stellen.
Da kommen uns sofort die digitalen Kontrollmechanismen der chinesischen Führung in den Kopf. Sollte das ein Vorbild für demokratische Gesellschaften sein?
Absolut nicht. Aber in den vergangenen 20 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas Milliarden von Dollar in die Entwicklung von KI und anderen Internet-Tools gesteckt und in diesem Zusammenhang Zensur und Überwachung perfektioniert. Es gibt es also einen sehr China-spezifischen Umgang mit KI und anderen digitalen Technologien. Und das ist ein großes Problem. China mag kein allgemeiner KI-Weltmarktführer sein, aber es hat in bestimmten Feldern eine Übermacht – etwa im Bereich der Gesichtserkennung. Auch müssen wir sehen: Technologien, die in China entwickelt wurden, bleiben nicht in China. Huawei etwa hat seine Technologien in mehr als 60 Länder exportiert.
Auch europäische und amerikanische Unternehmen exportieren Überwachungstechnologie. Kann man allein China den Schwarzen Peter zuschieben?
Nein, das will ich überhaupt nicht. Auch in den USA gibt es Tech-Konzerne, die Methoden entwickelt haben dafür, gewaltige Datenmengen zu sammeln und sie für polizeiähnliche Arbeit einzusetzen. Und das ohne jeglichen Regulierungsrahmen. Das kann sogar illegal sein, aber es gibt Polizeibehörden in den USA, die diese Daten trotzdem nutzen.
Wie steht es denn um die Bemühungen, KI zu regulieren?
Das ist eine komplexe Frage. Der Umgang der Chinesen mit dieser Technologie ist fragwürdig. So ziemlich alles, was die KP macht, trägt ein Kontrollelement in sich. Andererseits: China stellt eben auch unter Beweis, dass sich diese Technologien kontrollieren lassen, wenn auch auf drakonische Art und mit Zielen, die wir in demokratischen Gesellschaften nicht teilen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren lassen, zieht also nicht. Wir sollten China nicht nacheifern. Aber China zeigt, dass es geht.
Gibt es nicht doch einen gewaltigen Unterschied? Wer in China die Regeln nicht befolgt, wird ins Gefängnis gesteckt.
Natürlich gibt es einen Unterschied. Aber ich glaube, die Androhung von Gefängnisstrafen braucht es gar nicht. Wir können es auch so machen: Wir drohen Unternehmen enorme Geldstrafen an – für den Fall, dass sie gegen Regeln verstoßen. Dann werden sie sich wahrscheinlich auch an die Regeln halten. Die EU geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Es ist ja nicht so, dass die EU diese Unternehmen schließen wollte oder gar könnte. Das sind US-Konzerne. Aber die EU ist ein sehr großer Markt. Das heißt: Die US-Unternehmen haben ein großes finanzielles Interesse, auf diesem Markt präsent zu sein.
Hat die Politik die Gefahren, die von der KI ausgehen, schon auf dem Radar?
Wenn wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten hätten, hätte ich gesagt: US-Politiker haben das Problem nicht begriffen. Das hat sich sehr verändert. Viele Regierungsstellen sind mittlerweile sehr besorgt über mögliche Folgen des KI-Einsatzes. Und die EU-Kommission war der US-Regierung in dieser Hinsicht ohnehin schon immer weit voraus. Das dürfte auch für Deutschland gelten, das wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland der EU. Aber die EU-Mitglieder stehen vor anderen Herausforderungen als die USA.
Inwiefern?
Einerseits spielt sie eine Führungsrolle bei der Regulierung, was sehr löblich ist. Andererseits muss die EU auch europäische Tech-Konzerne dazu bringen, vor Ort neue Technologien zu entwickeln. Ich will nicht zynisch klingen: Aber ein Grund, warum die EU in Sachen Regulierung den USA voraus ist, besteht darin, dass es bislang fast ausschließlich um die Regulierung von US-Konzernen geht. Europäische Politiker müssen sich also gar nicht davor fürchten, die Gans zu schlachten, die goldene Eier legt. Das ist in den USA anders. Das Silicon Valley trägt in großem Stil zur US-Wirtschaft bei, und das wissen die US-Politiker.
Was also tun?
Ich bin davon überzeugt, dass wir effektive Regeln brauchen. Und wir müssen den naiven Optimismus ablegen, dass KI schon alles zum Besseren verändern wird. Das wird nicht geschehen.
Worauf sollten wir uns vorbereiten? Worauf können wir uns vorbereiten?
Der Geist ist schon aus der Flasche. Künstliche Intelligenz wird viele Aspekte unseres sozialen Lebens und unserer Wirtschaft beeinflussen. Wir dürfen aber nicht fatalistisch werden. Wir haben noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Viele Fragen sind noch nicht beantwortet: Wer besitzt Daten? Wer kann sie wie verwenden? Was sind die Rechte von Arbeitnehmern? Wie verhindern wir, dass KI zu Massenüberwachung führt – in der politischen Sphäre ebenso wie am Arbeitsplatz?
Was können wir aus der Geschichte lernen? Wie sehr ist technologischer Fortschritt verantwortlich für Wohlstand?
In den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl Politiker als auch Wirtschaftswissenschaftler gerne gesagt: Lasst der Technologie freien Lauf, davon wird schlussendlich jeder Mensch profitieren. Das basiert auf der Annahme, dass Technologie die Produktivität steigert, was am Ende sowohl Unternehmern wie Arbeitnehmern nutzt. Aus der Geschichte lässt sich diese Prämisse allerdings nicht grundsätzlich belegen. Natürlich gab es Fälle, in denen technologischer Fortschritt viel Gutes getan hat. Ohne die industrielle Revolution würde es uns heute nicht ansatzweise so gut gehen. Wir wären nicht so wohlhabend und auch nicht bei so guter Gesundheit. Aber es gibt eben auch Beispiele, die weniger erfolgreich waren. Es gibt also keinen Automatismus, dass technologischer Fortschritt zu mehr Wohlstand führt.
Nennen Sie bitte ein positives Beispiel.
Ab den 1950er- und 60er-Jahren haben neue Produktionstechnologien mit fortschrittlichen Maschinen für ein paar Jahrzehnte zu einer gewaltigen Veränderung geführt. Die Produktivität stieg, aber auch die Reallöhne quer durch alle demographischen Gruppen stiegen in den USA im Durchschnitt um 2,5 Prozentpunkte im Jahr. In Deutschland war der Anstieg sogar noch steiler. Und in beiden Ländern nahm die soziale Ungleichheit nicht zu, sondern sogar ab. Es gibt also für diesen Zeitraum keinen Beleg, dass technologischer Fortschritt zu mehr Arbeitslosigkeit und weniger Wohlstand geführt hätte.
Und ein negatives Beispiel?
Denken Sie an die Maschine, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Baumwoll-Produktion revolutionierte. Die Entkörnungsmaschine hat aus den zuvor wirtschaftlich völlig abgehängten US-Südstaaten eine der dynamischsten Regionen der Welt dieser Zeit gemacht. Es wurden gewaltige Vermögen angehäuft. Aber die Arbeitskräfte in der Baumwollindustrie, die Sklaven, hatten gar nichts davon. Es ging ihnen sogar schlechter. Wirtschaftlich war dieser technologische Fortschritt also ein voller Erfolg. Doch für die meisten Arbeiter waren die ersten 100 Jahre der industriellen Revolution von etwa 1750 bis 1850 eine schreckliche Zeit. Die Reallöhne stagnierten, die Arbeitsbedingungen wurden schlechter, die Arbeitsstunden stiegen.
Welche dieser Folgen wird der verstärkte Einsatz von KI haben?
Das wissen wir noch nicht, aber wir stehen an einer Weggabelung. Wenn wir KI, vor allem generative KI, richtig einsetzen, dann können wir sehr viel Gutes damit bewirken. Denken Sie an den Fachkräftemangel. Überall fehlen Elektriker, deren Arbeit ohnehin in Zukunft viel komplexer sein wird als sie es heute ist. Generative KI könnte helfen, dieses Problem zu lösen. Ein Elektriker müsste sich nicht mehr nur auf seine eigene Expertise verlassen, die natürlich beschränkt ist. Er könnte stattdessen von dem akkumulierten Wissen von Tausenden von Elektrikern profitieren. Und das in Echtzeit: Probier doch diese Methode, nimm doch dieses Teil. Ein Elektriker könnte dadurch ein Problem sehr schnell lösen.
Klingt gut.
Im Grunde geht mit dem Einsatz von generativer KI eine Neuorganisation der Arbeitsabläufe in vielen Branchen einher. Das Gesundheitswesen würde freundlicher zu Patienten und überdies weniger kostenintensiv. Und in Schulen fiele es Lehrern leichter, sich um lernschwache Schüler zu kümmern. Unglaublich eigentlich, dass solche guten Ideen nicht umgesetzt werden.
Woran liegt das?
Die Antwort ist simpel. Die Tech-Konzerne kümmern sich nicht darum. Die wollen mit KI Geld verdienen – in Form von zum Beispiel digitalen Anzeigen. Und wir dürfen die ideologische Komponente nicht vergessen. Ziel der Konzerne ist es, durch den Einsatz von Computern und KI autonome Maschinenintelligenz zu generieren. Um die Arbeitskräfte geht es nicht. Das ist eine bösartige Ideologie, die in Silicon Valley weit verbreitet ist.
Wenn sich schon die Tech-Konzerne nicht kümmern, wäre das doch eine Aufgabe für die Politik.
Da sind wir wieder bei der Frage nach der Regulierung. Die Politik kann neue Technologien nicht entwickeln. Aber sie kann Regeln aufstellen. Und sie kann zusammen mit der Zivilgesellschaft versuchen, Werte und Normen zu definieren, damit Technologie den Menschen zugutekommt und nicht nur den Konzernen.
Welche Rolle spielen die Medien dabei?
Medien müssten eine wichtige Rolle übernehmen und aufklären. Sie tun es aber nicht. Stattdessen gehen sie Tech-Größen wie Elon Musk auf den Leim und glorifizieren sie sogar noch. Kritische Stimmen schaffen es dagegen kaum, sich Gehör zu verschaffen.
Es heißt, die neuen Technologien könnten bei Menschheitsaufgaben wie dem Klimawandel helfen. Müssten wir nicht gerade deswegen offener gegenüber diesen Technologien sein?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologien ein wichtiger Bestandteil sind, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Niemand wird widersprechen, dass der Ausbau der Erneuerbaren wichtig ist. Ich finde übrigens auch, dass Deutschland einen großen Fehler gemacht hat, als es aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Dadurch geht saubere Energie für die Zeit verloren, die es für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas braucht. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass Technologie ein Wundermittel ist. Wir brauchen immer noch Regeln, anhand derer wir die Technologien einsetzen. Das heißt aber wiederum nicht, dass die Regierungen Mikromanagement betreiben und sich in unternehmerische Entscheidungen einmischen sollten.
Haben wir angesichts des rasanten Klimawandels denn noch Zeit, auf das Mikromanagement des Staates zu verzichten?
Wir haben in der Tat keine Zeit zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass staatliches Mikromanagement die Lösung ist. Regierungsbürokraten sind keine Experten auf dem Gebiet der Innovation. Der Staat sollte lieber viel stärker als bisher klare Regeln aufstellen und zum Beispiel die Erneuerbaren pushen.
Daron Acemoğlu ist Professor für Ökonomie an der US-Eliteuniversität MIT. In seinem neuen Buch “Macht und Fortschritt: Unser 1000-jähriges Ringen um Technologie und Wohlstand” beschreibt er gemeinsam mit Simon Johnson den Kampf der Menschheit um die Kontrolle von Technologie und die Verteilung von Wohlstand.
Mit dem 1. Januar ist der Liberale Michael Kauch Mitglied des Europäischen Parlaments. Der Dortmunder Kauch (56) rückt damit für Nicola Beer nach, die ihre Position als stellvertretende Präsidentin der Europäischen Investitionsbank angetreten hat.
Als Nachfolger von Nicola Beer als Vizepräsident des Europäischen Parlaments hat die FDP Delegation der Renew Europe Fraktion den Niedersachsen Jan-Christoph Oetjen vorgeschlagen. Die Nachwahl des Vizepräsidenten wird für das nächste Plenum im Januar in Straßburg erwartet.
Zum neuen Vorsitzenden der FDP-Delegation im Europäischen Parlament wurde Moritz Körner gewählt. Als Delegationsleiter unterstreicht Körner mit Blick auf das europapolitische Jahr 2024: “Die Europawahl hat für uns Freie Demokraten dieses Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Für das neue Team kommt es jetzt darauf an, dass wir Europa einfach machen. Die EU braucht einen Entbürokratisierungsturbo!” tho
Trotz eines Angebots der Regierung in Kiew haben europäische Gasversorger in diesem Winter nach einem Medienbericht kaum von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Gas in der Ukraine zu speichern. Vor Beginn der Speichersaison hätten europäische Firmen lediglich 2,5 Milliarden Kubikmeter (bcm) in den ukrainischen Untergrundspeichern eingelagert, berichtete die Financial Times am Dienstag.
Das sei zwar mehr als im Winter zuvor gewesen. Im Pandemiejahr 2020 hatten europäische Versorger nach früheren Berichten aber zehn bcm in der Ukraine deponiert. Diese Menge hatte die Regierung auch in diesem Jahr für europäische Versorger reserviert und wollte mit dieser Offerte ihre Bindung an den Westen stärken.
Im vergangenen Sommer hatten europäische Gasunternehmen “die Unvorhersehbarkeit des ukrainischen Rechtsrahmens” für die Gasspeicherung und die damit verbundenen Risiken beklagt. Dennoch hätten die Entnahmen aus den Speichern in den vergangenen Wochen geholfen, das Niveau der EU-Speicher bei 90 Prozent zu halten, zitiert die FT einen Analysten von Rystad. Um einen Effekt auf die Preise zu haben, hätten EU-Firmen aber mindestens fünf bcm in der Ukraine speichern müssen, hatte die Energy Community vor Beginn der Saison geschrieben. ber
Für die Europawahl am 9. Juni setzt die SPD auf eine maximale Mobilisierung ihrer Sympathisanten und auf eine besondere Zielgruppe: die Erstwähler. Erste Eckpunkte der Kampagne stellte Generalsekretär Kevin Kühnert in der letzten Fraktionssitzung im alten Jahr vor.
Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD in absoluten Zahlen doppelt so viele Zweitstimmen erzielt wie bei der Europawahl zwei Jahre zuvor. Dieses Potenzial wollen die Kampagnenlenker im Willy-Brandt-Haus anzapfen, unter anderem an mehreren Aktionstagen (Frauentag, Tag der Arbeit, Europatag).
Mobilisieren, Mobilisieren und Mobilisieren – so lautet die Losung, die Kühnert ausgegeben hat. Mit Haustürbesuchen, an den Arbeitsplätzen, in den Fußgängerzonen. Dabei sollen sich die 207 Bundestagsabgeordneten aktiv einbringen. Nur mit ihrer Hilfe sei eine flächendeckende Kampagne möglich, versuchte ihnen der Generalsekretär zu vermitteln. Jeder von ihnen, so seine Aufforderung, solle zwischen Februar und Mai mindestens drei Veranstaltungen organisieren, um mit den wichtigsten SPD-Zielgruppen in Kontakt zu kommen. Kühnerts Motivationsdevise: “Die Europawahl 2024 ist auch eine Sprintkampagne für eure Wiederwahl 2025.”
Bei der Europawahl 2019 hatte die SPD mit 15,8 Prozent (minus 11,5 Prozent) das mit Abstand schlechteste Ergebnis aller Europawahlen erzielt. Das reichte für 16 EP-Abgeordnete. Zum Vergleich: Die Grünen waren auf 20,5 (21 Abgeordnete), die Union auf 28,9 Prozent (29 Abgeordnete) gekommen. kn
Die Zinserhöhungsserie der EZB und die flaue Konjunktur dämpfen die Kreditvergabe der Banken an Firmen in der Euro-Zone. Die Darlehensausreichung der Finanzinstitute an Unternehmen lag im November lediglich auf Vorjahresniveau, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Im Oktober war die Kreditvergabe auf Jahressicht sogar um 0,3 Prozent geschrumpft. An die Privathaushalte reichten die Banken im November dagegen 0,5 Prozent mehr Darlehen weiter als vor Jahresfrist. Für Oktober war noch ein Wachstum von 0,6 Prozent gemeldet worden.
Nach zehn EZB-Zinserhöhungen seit Sommer 2022 haben sich Kredite inzwischen deutlich verteuert. Die stagnierende Kreditvergabe belegt, dass der Straffungskurs der Währungshüter im Kampf gegen die hohe Inflation in der Wirtschaft seine Wirkung entfaltet. Dazu kommt die trübe Konjunktur – das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der 20-Länder-Gemeinschaft sank von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet kurzfristig keine Besserung. Die Euro-Notenbank hatte auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Dezember auch deshalb an den Zinsen nicht gerüttelt. rtr
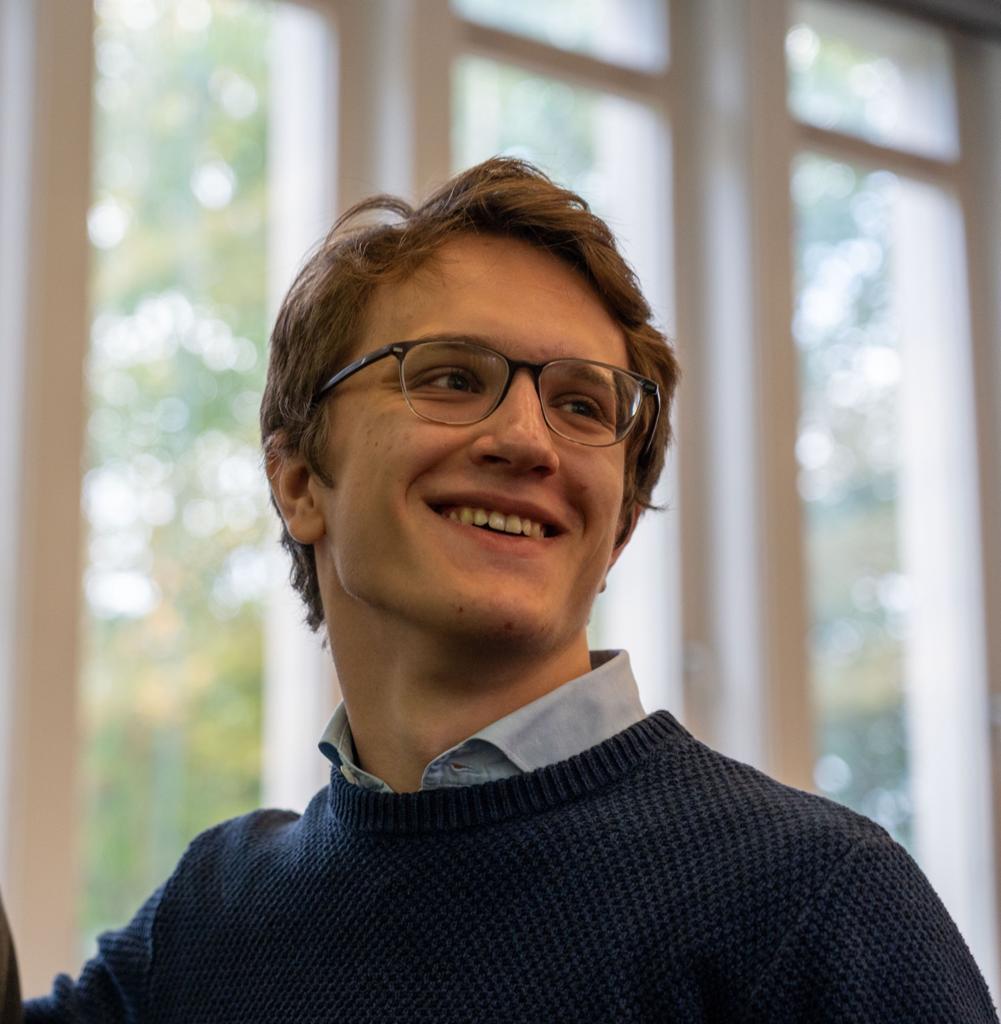
Es war eine Parlamentsdebatte wie aus dem Lehrbuch. Zwei Tage lang haben Schüler:innen miteinander um Argumente und politische Strategien gerungen. Die Simulation des Europäischen Parlaments (SIMEP), ein europapolitisches Planspiel, das wir als Junge Europäische Föderalist:innen (JEF) seit vielen Jahren organisieren, war auch 2023 ein Erfolg. Und doch, und das macht nachdenklich, haben wir mit der SIMEP gerade einmal 150 Schüler:innen erreicht, überwiegend Gymnasiast:innen.
Mit Blick auf die Europawahlen im Juni, bei der erstmals das neue Wahlrecht ab 16 Jahren greift, sind Deutschlands Bildungspolitiker:innen gut beraten, sich nicht weiter darauf zu verlassen, dass die Zivilgesellschaft ihren Job übernimmt. Europabildung muss in allen Schularten, nicht erst im Oberstufen-Politikunterricht, als Pflichtaufgabe in den Lehrplänen verankert sein – und im Unterricht auch tatsächlich ankommen. Der Zugang zur europäischen Dimension unserer Gesellschaft darf nicht vom Engagement einzelner Lehrer:innen abhängen.
Deutschland hat sich verpflichtet, an der Entwicklung der EU mitzuwirken – mehr noch: Jeder von uns ist Unionsbürger. Die Unionsbürgerschaft, ausbuchstabiert in Artikel 9 des EU-Vertrags, tritt neben den deutschen Pass. Doch bei nüchterner Betrachtung ist eine europäische Identität oft mehr Wunsch als Wirklichkeit.
Was macht das mit unserer Demokratie, wenn sich parallel, gerade in den Krisen der vergangenen 15 Jahre, immer mehr Entscheidungen von Berlin nach Brüssel verlagern? Finanzmärkte, Migration, Gesundheit, Klima, Künstliche Intelligenz: Parlament, Rat und Kommission entscheiden über zentrale Zukunftsdossiers. Wissen unsere Schüler:innen das?
Bürger zu sein, erfordert im 21. Jahrhundert mehr als ein oberflächliches Verständnis für europäische Politik – gerade jetzt, wo die EU vor entscheidenden Reformen steht. Unsere Demokratie versagt, wenn wir die Jugend auf die neue politische Realität jenseits des Nationalstaats nicht besser vorbereiten, wie es zuletzt die JEF Deutschland in einem Positionspapier forderte.
Seit 1978 gibt es eine KMK-Strategie zur Europabildung; überarbeitet wurde sie zuletzt vor drei Jahren (zum Download). Doch die Lektüre der 13 Seiten ist ernüchternd. Die KMK könnte konkrete Ziele formulieren: “In den nächsten fünf Jahren soll ein Drittel aller Lehrkräfte, mindestens aber ein Kollege je Fachbereich je Schule, eine Fortbildung zur Europabildung erhalten.” Das wär’s! In ihrer Strategie jedoch begnügen sich die Länder mit Leerformeln: “Die Länder verständigen sich auf Fortbildungsmaßnahmen zur europäischen Dimension im Unterricht.”
Die KMK will die “inhaltlichen Bezüge zur Europabildung in den curricularen Vorgaben” ausweiten. Klingt gut, gleicht aber dem Ziel, Analysis in der Mathematik zu stärken. Da wüsste auch niemand, ob es nun um Grenzwertberechnungen oder Integralfunktionen geht. Und es ist, so hart es klingt, keine brauchbare Strategie, wenn es bereits an einem systematischen Monitoring fehlt. Was ist seit 2020 passiert? Wie viele der Leerformeln haben Kontur angenommen? Mit Europa-Poesie allein ist niemandem geholfen.
Wenn die KMK ihren Verfassungsauftrag ernst nimmt, sollte sie eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation beauftragen, welche die Schulen durchleuchtet. Unterrichtskonzepte, Schulprofile, Projekte: Erst auf Basis eines solchen “Reality-Checks” werden die blinden Flecke in der Europabildung sichtbar. Dazu gehört, dass Gymnasiast:innen einen besseren Zugang zur politischen Bildung bekommen, wie es auch ein Diskussionspapier der Stiftung Lernen durch Engagement feststellt. Dazu kommen Baustellen in der Didaktik: “Viele Unterrichtsmaterialien richten sich an die gymnasiale Oberstufe, während niedrigschwellige Angebote für die Europabildung überschaubar sind”, schreibt der Politikwissenschaftler Helmar Schöne.
Wer die Europabildung an Haupt- und Berufsschulen vernachlässigt, braucht sich über europaskeptische – in letzter Konsequenz demokratiegefährdende – Ressentiments nicht zu wundern. 61 Prozent der Jugendlichen, die das Abitur anstreben oder es bereits erreicht haben, haben laut Shell-Jugendstudie 2019 ein positives Bild von der Europäischen Union. Bei den Jugendlichen, die die Mittlere Reife anstreben oder erreicht haben, sind es nur 37 Prozent. Das ist auch ein Scheitern der Schulen.
Wir wissen, wie stark Auslandsaufenthalte eine Bildungsbiografie prägen können. Und wir wissen, dass Familien mit wenig Geld sich solche Programme selten leisten können. Effektivere staatliche Zuschüsse wären ein Hebel, um Europa emotional erfahrbar zu machen. Doch kulturelle Kompetenz allein genügt nicht. Wissen bleibt Voraussetzung, um kritisch an europäischer Politik teilhaben zu können. Dazu gehört, dass moderne europäische Geschichte genauso unterrichtet werden muss wie das komplexe Zusammenspiel der europäischen Institutionen – auch wenn es altmodisch klingt.
Niemand muss dafür das Rad neu erfinden. Projekte wie die SIMEP, Europe@School, das European Youth Parliament oder Unboxing Europe zeigen beispielhaft, wie moderne Institutionenlehre aussehen kann. Das Europäische Parlament hat ein Botschafter:innenprogramm aufgelegt, über das Schulen Materialien erhalten. Die Europaschulen haben seit 2004 ein eigenes Netzwerk.
Eurotopics übersetzt Presseberichte aus ganz Europa, die sich im Unterricht einbinden lassen. Die Schwarzkopf Stiftung Junges Europa bietet über das Netzwerk Understanding Europe Peer-Education-Workshops an. Und mit Jumper hat die Universität Göttingen ein Planspiel entwickelt, das sich besonders an Jugendliche richtet, die kaum von derlei Bildungsangeboten profitieren. Ideal für Schulen sind auch die Angebote der deutschlandweit über 50 EuropeDirect-Zentren, die auch einen Expert:innen-Pool vorhalten.
Aufgabe der Länder wäre es nun, das Engagement zu bündeln, institutionelle Strukturen zu schaffen und die Projekte verbindlich so zu skalieren, dass sie in jedem Klassenzimmer ankommen. Vor der EU-Wahl im nächsten Jahr wird das sicher nicht mehr gelingen, also ist Kreativität gefragt – und ein klares politisches Signal.
Die Kultusminister:innen sollten die Schulen verpflichten, bis Juni einen Unterrichtstag den Europawahlen zu widmen – und den Schulleiter:innen dafür den nötigen Freiraum einräumen. Uns ist bewusst, dass die Belastung vieler Lehrer:innen hoch ist, daher sind die Schulinstitute oder andere Ad-hoc-Gremien gefordert, bis März geeignete Pakete mit Materialien, Planspielen und Projektskizzen bereitzustellen, um den Europatag durchzuführen. Am 9. Juni 2024 wissen wir, ob der Bildungsföderalismus auch Flexibilität beherrscht.
Dominik Geier ist Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalist:innen Berlin-Brandenburg. Die JEF ist ein überparteilicher, europaweit organisierter Verband, der sich für die Vollendung des europäischen Projekts als Europäische Föderation einsetzt.
Sie haben es sicher im vergangenen Jahr mehrfach gehört und gelesen: Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft und Gesellschaft so dramatisch verändern wie wohl kaum eine Technologie zuvor. Wenn das stimmt, dann können Sie sich sicher sein, dass sie auch 2024 und in den folgenden Jahren viel über KI hören, lesen und mit KI arbeiten und leben werden.
Der MIT-Professor Daron Acemoğlu hat im Interview mit meinen beiden Kollegen Okan Bellikli und Damir Fras noch einmal betont, wie wichtig es ist, effektive Regeln für KI einzuführen. Und er meint, die EU sei mit ihrem AI Act mit gutem Beispiel vorangegangen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren ließen, ziehe nicht, sagt er. China zeige das Gegenteil. Aber inhaltlich sollten wir natürlich einen anderen Weg einschlagen als China. Wichtig sei auch, dass Europa nicht nur die Regeln, sondern auch eigene Technologie entwickele. Da wird ihm wohl niemand widersprechen.
Dass das in Europa auch gelingen kann, sieht Acemoğlu nicht so pessimistisch wie manch anderer Ökonom. Und er verweist darauf, dass Europa allein wegen der Größe seines Marktes nicht zu ignorieren ist. Doch wie steht es um den viel beschworenen europäischen Binnenmarkt?
Nicht so gut, wie gewünscht. Darum muss Europa befürchten, weiter hinter die anderen großen Wirtschaftsmächte zurückzufallen, schreibt Till Hoppe. Gerade kleine und mittlere Unternehmen beklagen den hohen Aufwand an Bürokratie, der immer noch entsteht, wenn man über die Landesgrenzen hinaus Geschäfte machen möchte. Glaubt man den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, soll sich das bald ändern.
Alles Gute für Sie,

Unter Ursula von der Leyen hat die EU-Kommission in den vergangenen vier Jahren eine Fülle von Gesetzen zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf den Weg gebracht. Der erhoffte Schub für die heimische Wirtschaft blieb bislang aber aus. Die Behörde erwartet für 2024 nur 1,3 Prozent Wachstum in der EU, und kaum mehr für die beiden Folgejahre. Europa muss daher befürchten, weiter an Boden an andere Wirtschaftsmächte wie die USA und China zu verlieren.
EVP-Chef Manfred Weber hat deshalb schon deutlich gemacht, dass er die Standortbedingungen ins Zentrum des anstehenden Europawahlkampfes rücken will. “Viele Menschen sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung”, sagt Christian Ehler, Sprecher der Christdemokraten im Industrieausschuss (ITRE). “Wir müssen ihnen überzeugende Antworten zur Wettbewerbsfähigkeit anbieten, um die Chance auf eine stabile Mehrheit nach der Europawahl zu erhalten.” Die Sorge ist groß, dass Populisten und EU-Gegner die Abstiegsängste der Menschen für sich zu nutzen wissen.
Auf Drängen ihrer Parteifreunde räumte von der Leyen dem Thema viel Raum ein in ihrer Rede zur Lage der EU. Im September verkündete sie, den früheren EZB-Chef Mario Draghi mit einem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit beauftragt zu haben. Der frühere italienische Premier Enrico Letta soll zudem bis März einen Bericht zum europäischen Binnenmarkt vorlegen.
Letta wird, so viel ist absehbar, auf eine Vertiefung des gemeinsamen Marktes mit seinen heute gut 450 Millionen Einwohnern und 23 Millionen Unternehmen drängen. Der Präsident des Jacques Delors Institute in Paris reist seit einigen Monaten durch die Mitgliedstaaten, um sich ein Meinungsbild einzuholen. Sein ernüchtertes Fazit: Für kaum eine Regierung habe es derzeit Priorität, Hürden zu beseitigen.
30 Jahre nach der Erschaffung des Binnenmarktes hat sich eine gewisse Integrationsermüdung breitgemacht. Der Anteil des Güterhandels zwischen den EU-Staaten an der gemeinsamen Wirtschaftsleistung ist seit 2006 lediglich um 3,5 Punkte auf 23 Prozent gestiegen. Grenzüberschreitende Dienstleistungen machen sogar nur sechs Prozent des BIP aus.
Dort sträuben sich Regierungen und Lobbys hartnäckig gegen die Öffnung ihrer Märkte. “Der Protektionismus nimmt auch innerhalb der EU zu”, kritisiert Freya Lemcke, die Leiterin des Brüsseler Büros der DIHK. So hätten etliche Länder die Entsendung ausländischer Mitarbeiter weiter erschwert.
Einige europäische Wirtschaftsverbände, darunter VDMA und ZVEI aus Deutschland, haben sich deshalb kurz vor Weihnachten per Brief an die Kommission gewandt. Von Land zu Land unterschiedliche Dokumentationspflichten und Anforderungen wie ein fester Ansprechpartner im Gastland führten zu “extremer Bürokratie und hohen Kosten, gerade für KMU”, kritisieren sie in dem Schreiben an Binnenmarktkommissar Thierry Breton und Arbeitskommissar Nicolas Schmit, das Table.Media vorlag.
Letta hofft, eine Debatte auf hoher politischer Ebene anzustoßen. Auch der Dachverband Business Europe fordert, den Binnenmarkt in der kommenden Legislaturperiode ganz oben auf die politische Agenda zu setzen. Ein umfassendes Programm zur Beseitigung hinderlicher Regeln und Bürokratie könne bis 2029 mehr als 700 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung generieren.
Die jüngsten Maßnahmen der von der Leyen-Kommission zur Entlastung von Mittelständlern seien hingegen “enttäuschend”, kritisiert Lemcke: “Die Vorschläge zum Abbau von Berichtspflichten reichen nicht aus, und das KMU-Entlastungspaket wird den Unternehmen in der Praxis wenig helfen.”
Für die neue Kommission wäre es eine Herkulesaufgabe, die wirtschaftliche Integration in der EU neu anzuschieben. Die nationalen Beharrungskräfte sind nicht nur im Dienstleistungssektor groß.
Beispiel Energiepolitik: Die jüngste Gaskrise habe gezeigt, wie wichtig eine echte Energieunion mit grenzüberschreitender Infrastruktur sei, schreiben die drei EVP-Abgeordneten Manfred Weber, Christian Ehler und Andreas Schwab in einem Brief an Letta. Wie schwer sich manche Länder damit tun, zeigte die Weigerung Frankreichs, eine Gaspipeline aus Spanien über die Pyrenäen zu bauen, die auch Deutschland versorgen sollte.
Weber, Ehler und Schwab fordern zudem einen “ehrgeizigen Vorstoß” zur Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion. Die größten Hindernisse für eine bessere Integration der Kapitalmärkte seien das Fehlen eines harmonisierten Rahmens für Insolvenzverfahren sowie die sehr unterschiedlichen Steuervorschriften in den Mitgliedstaaten.
Dabei hätten die Mitgliedstaaten eigentlich einen starken Anreiz, die Hürden für private Investoren zu beseitigen: Die meisten Staatskassen sind leer, und der Investitionsbedarf durch Dekarbonisierung und Digitalisierung ist enorm.
Die knappen Kassen könnten zudem die Diskussion über neue EU-Töpfe neu befeuern. Manche Beobachter in Brüssel rechnen damit, dass Mario Draghi in seinem Bericht dafür plädieren wird.
Bislang lehnt die Bundesregierung eine Neuauflage des Corona-Schuldenprogramms Next Generation EU ebenso ab wie mehr Mittel bereitzustellen für eine europäische Industriepolitik. Wegen des Widerstandes aus Berlin musste die Kommission ihre industriepolitischen Ambitionen stark eindampfen: Der Europäische Souveränitätsfonds wurde vertagt, für dessen Platzhalter STEP ist nach harten Haushaltsverhandlungen kein frisches Geld mehr vorgesehen.
Es wird sich zeigen, ob die Bundesregierung angesichts des schrumpfenden finanziellen Spielraumes bei diesem Kurs bleibt. Bislang will sie etwa die heimische Stahlindustrie mit Milliarden aus dem Bundeshaushalt unterstützen bei der Umstellung auf grünen Wasserstoff. Dabei ließe sich grüner Stahl an anderen Standorten in Europa wohl deutlich günstiger herstellen. “Solange es keine relevanten europäischen Fördermittel gibt, wird die Diskussion über Transformation der Industrie aber eine nationale bleiben”, sagt Philipp Jäger, Fellow am Jacques Delors Centre der Berliner Hertie School.

Herr Acemoğlu, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass neue Technologien wie KI nicht ausreichend reguliert sind und die meisten Arbeitnehmer in einer dystopischen Zukunft irrelevant werden. Ist das realistisch?
Für mich ist das ein Albtraum-Szenario. Aber Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen das für eine schöne Utopie halten. Und das ist in gewisser Weise das Problem. KI wird in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen: Auch wenn neue Technologien Arbeitsplätze nicht im großen Stil zerstören, so machen sie die Arbeit doch weniger relevant und weniger gut bezahlt. Ich bin nicht besorgt, dass es keine Büroangestellten oder keine Buchhalter mehr geben wird. Aber ich bin besorgt, dass sie nicht mehr so gut bezahlt werden wie heute. In den USA zum Beispiel gehen die Realeinkommen von Arbeitnehmern ohne Uni-Abschluss seit Jahrzehnten zurück. Der Einsatz von KI wird dieses Phänomen noch verstärken, wenn wir nicht die richtigen Weichen stellen.
Da kommen uns sofort die digitalen Kontrollmechanismen der chinesischen Führung in den Kopf. Sollte das ein Vorbild für demokratische Gesellschaften sein?
Absolut nicht. Aber in den vergangenen 20 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas Milliarden von Dollar in die Entwicklung von KI und anderen Internet-Tools gesteckt und in diesem Zusammenhang Zensur und Überwachung perfektioniert. Es gibt es also einen sehr China-spezifischen Umgang mit KI und anderen digitalen Technologien. Und das ist ein großes Problem. China mag kein allgemeiner KI-Weltmarktführer sein, aber es hat in bestimmten Feldern eine Übermacht – etwa im Bereich der Gesichtserkennung. Auch müssen wir sehen: Technologien, die in China entwickelt wurden, bleiben nicht in China. Huawei etwa hat seine Technologien in mehr als 60 Länder exportiert.
Auch europäische und amerikanische Unternehmen exportieren Überwachungstechnologie. Kann man allein China den Schwarzen Peter zuschieben?
Nein, das will ich überhaupt nicht. Auch in den USA gibt es Tech-Konzerne, die Methoden entwickelt haben dafür, gewaltige Datenmengen zu sammeln und sie für polizeiähnliche Arbeit einzusetzen. Und das ohne jeglichen Regulierungsrahmen. Das kann sogar illegal sein, aber es gibt Polizeibehörden in den USA, die diese Daten trotzdem nutzen.
Wie steht es denn um die Bemühungen, KI zu regulieren?
Das ist eine komplexe Frage. Der Umgang der Chinesen mit dieser Technologie ist fragwürdig. So ziemlich alles, was die KP macht, trägt ein Kontrollelement in sich. Andererseits: China stellt eben auch unter Beweis, dass sich diese Technologien kontrollieren lassen, wenn auch auf drakonische Art und mit Zielen, die wir in demokratischen Gesellschaften nicht teilen. Das Argument, dass sich Tech-Konzerne nicht regulieren lassen, zieht also nicht. Wir sollten China nicht nacheifern. Aber China zeigt, dass es geht.
Gibt es nicht doch einen gewaltigen Unterschied? Wer in China die Regeln nicht befolgt, wird ins Gefängnis gesteckt.
Natürlich gibt es einen Unterschied. Aber ich glaube, die Androhung von Gefängnisstrafen braucht es gar nicht. Wir können es auch so machen: Wir drohen Unternehmen enorme Geldstrafen an – für den Fall, dass sie gegen Regeln verstoßen. Dann werden sie sich wahrscheinlich auch an die Regeln halten. Die EU geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Es ist ja nicht so, dass die EU diese Unternehmen schließen wollte oder gar könnte. Das sind US-Konzerne. Aber die EU ist ein sehr großer Markt. Das heißt: Die US-Unternehmen haben ein großes finanzielles Interesse, auf diesem Markt präsent zu sein.
Hat die Politik die Gefahren, die von der KI ausgehen, schon auf dem Radar?
Wenn wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten hätten, hätte ich gesagt: US-Politiker haben das Problem nicht begriffen. Das hat sich sehr verändert. Viele Regierungsstellen sind mittlerweile sehr besorgt über mögliche Folgen des KI-Einsatzes. Und die EU-Kommission war der US-Regierung in dieser Hinsicht ohnehin schon immer weit voraus. Das dürfte auch für Deutschland gelten, das wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland der EU. Aber die EU-Mitglieder stehen vor anderen Herausforderungen als die USA.
Inwiefern?
Einerseits spielt sie eine Führungsrolle bei der Regulierung, was sehr löblich ist. Andererseits muss die EU auch europäische Tech-Konzerne dazu bringen, vor Ort neue Technologien zu entwickeln. Ich will nicht zynisch klingen: Aber ein Grund, warum die EU in Sachen Regulierung den USA voraus ist, besteht darin, dass es bislang fast ausschließlich um die Regulierung von US-Konzernen geht. Europäische Politiker müssen sich also gar nicht davor fürchten, die Gans zu schlachten, die goldene Eier legt. Das ist in den USA anders. Das Silicon Valley trägt in großem Stil zur US-Wirtschaft bei, und das wissen die US-Politiker.
Was also tun?
Ich bin davon überzeugt, dass wir effektive Regeln brauchen. Und wir müssen den naiven Optimismus ablegen, dass KI schon alles zum Besseren verändern wird. Das wird nicht geschehen.
Worauf sollten wir uns vorbereiten? Worauf können wir uns vorbereiten?
Der Geist ist schon aus der Flasche. Künstliche Intelligenz wird viele Aspekte unseres sozialen Lebens und unserer Wirtschaft beeinflussen. Wir dürfen aber nicht fatalistisch werden. Wir haben noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Viele Fragen sind noch nicht beantwortet: Wer besitzt Daten? Wer kann sie wie verwenden? Was sind die Rechte von Arbeitnehmern? Wie verhindern wir, dass KI zu Massenüberwachung führt – in der politischen Sphäre ebenso wie am Arbeitsplatz?
Was können wir aus der Geschichte lernen? Wie sehr ist technologischer Fortschritt verantwortlich für Wohlstand?
In den vergangenen Jahrzehnten haben sowohl Politiker als auch Wirtschaftswissenschaftler gerne gesagt: Lasst der Technologie freien Lauf, davon wird schlussendlich jeder Mensch profitieren. Das basiert auf der Annahme, dass Technologie die Produktivität steigert, was am Ende sowohl Unternehmern wie Arbeitnehmern nutzt. Aus der Geschichte lässt sich diese Prämisse allerdings nicht grundsätzlich belegen. Natürlich gab es Fälle, in denen technologischer Fortschritt viel Gutes getan hat. Ohne die industrielle Revolution würde es uns heute nicht ansatzweise so gut gehen. Wir wären nicht so wohlhabend und auch nicht bei so guter Gesundheit. Aber es gibt eben auch Beispiele, die weniger erfolgreich waren. Es gibt also keinen Automatismus, dass technologischer Fortschritt zu mehr Wohlstand führt.
Nennen Sie bitte ein positives Beispiel.
Ab den 1950er- und 60er-Jahren haben neue Produktionstechnologien mit fortschrittlichen Maschinen für ein paar Jahrzehnte zu einer gewaltigen Veränderung geführt. Die Produktivität stieg, aber auch die Reallöhne quer durch alle demographischen Gruppen stiegen in den USA im Durchschnitt um 2,5 Prozentpunkte im Jahr. In Deutschland war der Anstieg sogar noch steiler. Und in beiden Ländern nahm die soziale Ungleichheit nicht zu, sondern sogar ab. Es gibt also für diesen Zeitraum keinen Beleg, dass technologischer Fortschritt zu mehr Arbeitslosigkeit und weniger Wohlstand geführt hätte.
Und ein negatives Beispiel?
Denken Sie an die Maschine, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Baumwoll-Produktion revolutionierte. Die Entkörnungsmaschine hat aus den zuvor wirtschaftlich völlig abgehängten US-Südstaaten eine der dynamischsten Regionen der Welt dieser Zeit gemacht. Es wurden gewaltige Vermögen angehäuft. Aber die Arbeitskräfte in der Baumwollindustrie, die Sklaven, hatten gar nichts davon. Es ging ihnen sogar schlechter. Wirtschaftlich war dieser technologische Fortschritt also ein voller Erfolg. Doch für die meisten Arbeiter waren die ersten 100 Jahre der industriellen Revolution von etwa 1750 bis 1850 eine schreckliche Zeit. Die Reallöhne stagnierten, die Arbeitsbedingungen wurden schlechter, die Arbeitsstunden stiegen.
Welche dieser Folgen wird der verstärkte Einsatz von KI haben?
Das wissen wir noch nicht, aber wir stehen an einer Weggabelung. Wenn wir KI, vor allem generative KI, richtig einsetzen, dann können wir sehr viel Gutes damit bewirken. Denken Sie an den Fachkräftemangel. Überall fehlen Elektriker, deren Arbeit ohnehin in Zukunft viel komplexer sein wird als sie es heute ist. Generative KI könnte helfen, dieses Problem zu lösen. Ein Elektriker müsste sich nicht mehr nur auf seine eigene Expertise verlassen, die natürlich beschränkt ist. Er könnte stattdessen von dem akkumulierten Wissen von Tausenden von Elektrikern profitieren. Und das in Echtzeit: Probier doch diese Methode, nimm doch dieses Teil. Ein Elektriker könnte dadurch ein Problem sehr schnell lösen.
Klingt gut.
Im Grunde geht mit dem Einsatz von generativer KI eine Neuorganisation der Arbeitsabläufe in vielen Branchen einher. Das Gesundheitswesen würde freundlicher zu Patienten und überdies weniger kostenintensiv. Und in Schulen fiele es Lehrern leichter, sich um lernschwache Schüler zu kümmern. Unglaublich eigentlich, dass solche guten Ideen nicht umgesetzt werden.
Woran liegt das?
Die Antwort ist simpel. Die Tech-Konzerne kümmern sich nicht darum. Die wollen mit KI Geld verdienen – in Form von zum Beispiel digitalen Anzeigen. Und wir dürfen die ideologische Komponente nicht vergessen. Ziel der Konzerne ist es, durch den Einsatz von Computern und KI autonome Maschinenintelligenz zu generieren. Um die Arbeitskräfte geht es nicht. Das ist eine bösartige Ideologie, die in Silicon Valley weit verbreitet ist.
Wenn sich schon die Tech-Konzerne nicht kümmern, wäre das doch eine Aufgabe für die Politik.
Da sind wir wieder bei der Frage nach der Regulierung. Die Politik kann neue Technologien nicht entwickeln. Aber sie kann Regeln aufstellen. Und sie kann zusammen mit der Zivilgesellschaft versuchen, Werte und Normen zu definieren, damit Technologie den Menschen zugutekommt und nicht nur den Konzernen.
Welche Rolle spielen die Medien dabei?
Medien müssten eine wichtige Rolle übernehmen und aufklären. Sie tun es aber nicht. Stattdessen gehen sie Tech-Größen wie Elon Musk auf den Leim und glorifizieren sie sogar noch. Kritische Stimmen schaffen es dagegen kaum, sich Gehör zu verschaffen.
Es heißt, die neuen Technologien könnten bei Menschheitsaufgaben wie dem Klimawandel helfen. Müssten wir nicht gerade deswegen offener gegenüber diesen Technologien sein?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologien ein wichtiger Bestandteil sind, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Niemand wird widersprechen, dass der Ausbau der Erneuerbaren wichtig ist. Ich finde übrigens auch, dass Deutschland einen großen Fehler gemacht hat, als es aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Dadurch geht saubere Energie für die Zeit verloren, die es für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas braucht. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass Technologie ein Wundermittel ist. Wir brauchen immer noch Regeln, anhand derer wir die Technologien einsetzen. Das heißt aber wiederum nicht, dass die Regierungen Mikromanagement betreiben und sich in unternehmerische Entscheidungen einmischen sollten.
Haben wir angesichts des rasanten Klimawandels denn noch Zeit, auf das Mikromanagement des Staates zu verzichten?
Wir haben in der Tat keine Zeit zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass staatliches Mikromanagement die Lösung ist. Regierungsbürokraten sind keine Experten auf dem Gebiet der Innovation. Der Staat sollte lieber viel stärker als bisher klare Regeln aufstellen und zum Beispiel die Erneuerbaren pushen.
Daron Acemoğlu ist Professor für Ökonomie an der US-Eliteuniversität MIT. In seinem neuen Buch “Macht und Fortschritt: Unser 1000-jähriges Ringen um Technologie und Wohlstand” beschreibt er gemeinsam mit Simon Johnson den Kampf der Menschheit um die Kontrolle von Technologie und die Verteilung von Wohlstand.
Mit dem 1. Januar ist der Liberale Michael Kauch Mitglied des Europäischen Parlaments. Der Dortmunder Kauch (56) rückt damit für Nicola Beer nach, die ihre Position als stellvertretende Präsidentin der Europäischen Investitionsbank angetreten hat.
Als Nachfolger von Nicola Beer als Vizepräsident des Europäischen Parlaments hat die FDP Delegation der Renew Europe Fraktion den Niedersachsen Jan-Christoph Oetjen vorgeschlagen. Die Nachwahl des Vizepräsidenten wird für das nächste Plenum im Januar in Straßburg erwartet.
Zum neuen Vorsitzenden der FDP-Delegation im Europäischen Parlament wurde Moritz Körner gewählt. Als Delegationsleiter unterstreicht Körner mit Blick auf das europapolitische Jahr 2024: “Die Europawahl hat für uns Freie Demokraten dieses Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Für das neue Team kommt es jetzt darauf an, dass wir Europa einfach machen. Die EU braucht einen Entbürokratisierungsturbo!” tho
Trotz eines Angebots der Regierung in Kiew haben europäische Gasversorger in diesem Winter nach einem Medienbericht kaum von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Gas in der Ukraine zu speichern. Vor Beginn der Speichersaison hätten europäische Firmen lediglich 2,5 Milliarden Kubikmeter (bcm) in den ukrainischen Untergrundspeichern eingelagert, berichtete die Financial Times am Dienstag.
Das sei zwar mehr als im Winter zuvor gewesen. Im Pandemiejahr 2020 hatten europäische Versorger nach früheren Berichten aber zehn bcm in der Ukraine deponiert. Diese Menge hatte die Regierung auch in diesem Jahr für europäische Versorger reserviert und wollte mit dieser Offerte ihre Bindung an den Westen stärken.
Im vergangenen Sommer hatten europäische Gasunternehmen “die Unvorhersehbarkeit des ukrainischen Rechtsrahmens” für die Gasspeicherung und die damit verbundenen Risiken beklagt. Dennoch hätten die Entnahmen aus den Speichern in den vergangenen Wochen geholfen, das Niveau der EU-Speicher bei 90 Prozent zu halten, zitiert die FT einen Analysten von Rystad. Um einen Effekt auf die Preise zu haben, hätten EU-Firmen aber mindestens fünf bcm in der Ukraine speichern müssen, hatte die Energy Community vor Beginn der Saison geschrieben. ber
Für die Europawahl am 9. Juni setzt die SPD auf eine maximale Mobilisierung ihrer Sympathisanten und auf eine besondere Zielgruppe: die Erstwähler. Erste Eckpunkte der Kampagne stellte Generalsekretär Kevin Kühnert in der letzten Fraktionssitzung im alten Jahr vor.
Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD in absoluten Zahlen doppelt so viele Zweitstimmen erzielt wie bei der Europawahl zwei Jahre zuvor. Dieses Potenzial wollen die Kampagnenlenker im Willy-Brandt-Haus anzapfen, unter anderem an mehreren Aktionstagen (Frauentag, Tag der Arbeit, Europatag).
Mobilisieren, Mobilisieren und Mobilisieren – so lautet die Losung, die Kühnert ausgegeben hat. Mit Haustürbesuchen, an den Arbeitsplätzen, in den Fußgängerzonen. Dabei sollen sich die 207 Bundestagsabgeordneten aktiv einbringen. Nur mit ihrer Hilfe sei eine flächendeckende Kampagne möglich, versuchte ihnen der Generalsekretär zu vermitteln. Jeder von ihnen, so seine Aufforderung, solle zwischen Februar und Mai mindestens drei Veranstaltungen organisieren, um mit den wichtigsten SPD-Zielgruppen in Kontakt zu kommen. Kühnerts Motivationsdevise: “Die Europawahl 2024 ist auch eine Sprintkampagne für eure Wiederwahl 2025.”
Bei der Europawahl 2019 hatte die SPD mit 15,8 Prozent (minus 11,5 Prozent) das mit Abstand schlechteste Ergebnis aller Europawahlen erzielt. Das reichte für 16 EP-Abgeordnete. Zum Vergleich: Die Grünen waren auf 20,5 (21 Abgeordnete), die Union auf 28,9 Prozent (29 Abgeordnete) gekommen. kn
Die Zinserhöhungsserie der EZB und die flaue Konjunktur dämpfen die Kreditvergabe der Banken an Firmen in der Euro-Zone. Die Darlehensausreichung der Finanzinstitute an Unternehmen lag im November lediglich auf Vorjahresniveau, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Im Oktober war die Kreditvergabe auf Jahressicht sogar um 0,3 Prozent geschrumpft. An die Privathaushalte reichten die Banken im November dagegen 0,5 Prozent mehr Darlehen weiter als vor Jahresfrist. Für Oktober war noch ein Wachstum von 0,6 Prozent gemeldet worden.
Nach zehn EZB-Zinserhöhungen seit Sommer 2022 haben sich Kredite inzwischen deutlich verteuert. Die stagnierende Kreditvergabe belegt, dass der Straffungskurs der Währungshüter im Kampf gegen die hohe Inflation in der Wirtschaft seine Wirkung entfaltet. Dazu kommt die trübe Konjunktur – das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der 20-Länder-Gemeinschaft sank von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet kurzfristig keine Besserung. Die Euro-Notenbank hatte auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Dezember auch deshalb an den Zinsen nicht gerüttelt. rtr
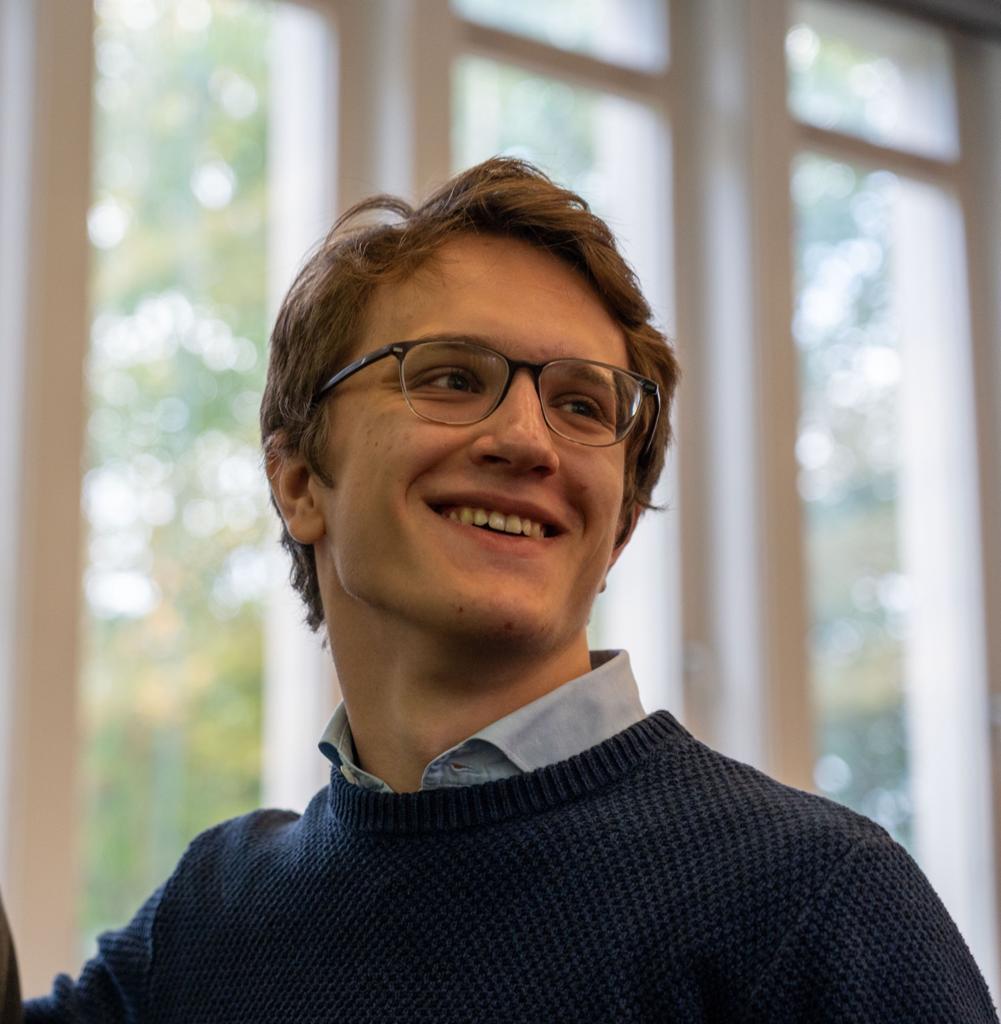
Es war eine Parlamentsdebatte wie aus dem Lehrbuch. Zwei Tage lang haben Schüler:innen miteinander um Argumente und politische Strategien gerungen. Die Simulation des Europäischen Parlaments (SIMEP), ein europapolitisches Planspiel, das wir als Junge Europäische Föderalist:innen (JEF) seit vielen Jahren organisieren, war auch 2023 ein Erfolg. Und doch, und das macht nachdenklich, haben wir mit der SIMEP gerade einmal 150 Schüler:innen erreicht, überwiegend Gymnasiast:innen.
Mit Blick auf die Europawahlen im Juni, bei der erstmals das neue Wahlrecht ab 16 Jahren greift, sind Deutschlands Bildungspolitiker:innen gut beraten, sich nicht weiter darauf zu verlassen, dass die Zivilgesellschaft ihren Job übernimmt. Europabildung muss in allen Schularten, nicht erst im Oberstufen-Politikunterricht, als Pflichtaufgabe in den Lehrplänen verankert sein – und im Unterricht auch tatsächlich ankommen. Der Zugang zur europäischen Dimension unserer Gesellschaft darf nicht vom Engagement einzelner Lehrer:innen abhängen.
Deutschland hat sich verpflichtet, an der Entwicklung der EU mitzuwirken – mehr noch: Jeder von uns ist Unionsbürger. Die Unionsbürgerschaft, ausbuchstabiert in Artikel 9 des EU-Vertrags, tritt neben den deutschen Pass. Doch bei nüchterner Betrachtung ist eine europäische Identität oft mehr Wunsch als Wirklichkeit.
Was macht das mit unserer Demokratie, wenn sich parallel, gerade in den Krisen der vergangenen 15 Jahre, immer mehr Entscheidungen von Berlin nach Brüssel verlagern? Finanzmärkte, Migration, Gesundheit, Klima, Künstliche Intelligenz: Parlament, Rat und Kommission entscheiden über zentrale Zukunftsdossiers. Wissen unsere Schüler:innen das?
Bürger zu sein, erfordert im 21. Jahrhundert mehr als ein oberflächliches Verständnis für europäische Politik – gerade jetzt, wo die EU vor entscheidenden Reformen steht. Unsere Demokratie versagt, wenn wir die Jugend auf die neue politische Realität jenseits des Nationalstaats nicht besser vorbereiten, wie es zuletzt die JEF Deutschland in einem Positionspapier forderte.
Seit 1978 gibt es eine KMK-Strategie zur Europabildung; überarbeitet wurde sie zuletzt vor drei Jahren (zum Download). Doch die Lektüre der 13 Seiten ist ernüchternd. Die KMK könnte konkrete Ziele formulieren: “In den nächsten fünf Jahren soll ein Drittel aller Lehrkräfte, mindestens aber ein Kollege je Fachbereich je Schule, eine Fortbildung zur Europabildung erhalten.” Das wär’s! In ihrer Strategie jedoch begnügen sich die Länder mit Leerformeln: “Die Länder verständigen sich auf Fortbildungsmaßnahmen zur europäischen Dimension im Unterricht.”
Die KMK will die “inhaltlichen Bezüge zur Europabildung in den curricularen Vorgaben” ausweiten. Klingt gut, gleicht aber dem Ziel, Analysis in der Mathematik zu stärken. Da wüsste auch niemand, ob es nun um Grenzwertberechnungen oder Integralfunktionen geht. Und es ist, so hart es klingt, keine brauchbare Strategie, wenn es bereits an einem systematischen Monitoring fehlt. Was ist seit 2020 passiert? Wie viele der Leerformeln haben Kontur angenommen? Mit Europa-Poesie allein ist niemandem geholfen.
Wenn die KMK ihren Verfassungsauftrag ernst nimmt, sollte sie eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation beauftragen, welche die Schulen durchleuchtet. Unterrichtskonzepte, Schulprofile, Projekte: Erst auf Basis eines solchen “Reality-Checks” werden die blinden Flecke in der Europabildung sichtbar. Dazu gehört, dass Gymnasiast:innen einen besseren Zugang zur politischen Bildung bekommen, wie es auch ein Diskussionspapier der Stiftung Lernen durch Engagement feststellt. Dazu kommen Baustellen in der Didaktik: “Viele Unterrichtsmaterialien richten sich an die gymnasiale Oberstufe, während niedrigschwellige Angebote für die Europabildung überschaubar sind”, schreibt der Politikwissenschaftler Helmar Schöne.
Wer die Europabildung an Haupt- und Berufsschulen vernachlässigt, braucht sich über europaskeptische – in letzter Konsequenz demokratiegefährdende – Ressentiments nicht zu wundern. 61 Prozent der Jugendlichen, die das Abitur anstreben oder es bereits erreicht haben, haben laut Shell-Jugendstudie 2019 ein positives Bild von der Europäischen Union. Bei den Jugendlichen, die die Mittlere Reife anstreben oder erreicht haben, sind es nur 37 Prozent. Das ist auch ein Scheitern der Schulen.
Wir wissen, wie stark Auslandsaufenthalte eine Bildungsbiografie prägen können. Und wir wissen, dass Familien mit wenig Geld sich solche Programme selten leisten können. Effektivere staatliche Zuschüsse wären ein Hebel, um Europa emotional erfahrbar zu machen. Doch kulturelle Kompetenz allein genügt nicht. Wissen bleibt Voraussetzung, um kritisch an europäischer Politik teilhaben zu können. Dazu gehört, dass moderne europäische Geschichte genauso unterrichtet werden muss wie das komplexe Zusammenspiel der europäischen Institutionen – auch wenn es altmodisch klingt.
Niemand muss dafür das Rad neu erfinden. Projekte wie die SIMEP, Europe@School, das European Youth Parliament oder Unboxing Europe zeigen beispielhaft, wie moderne Institutionenlehre aussehen kann. Das Europäische Parlament hat ein Botschafter:innenprogramm aufgelegt, über das Schulen Materialien erhalten. Die Europaschulen haben seit 2004 ein eigenes Netzwerk.
Eurotopics übersetzt Presseberichte aus ganz Europa, die sich im Unterricht einbinden lassen. Die Schwarzkopf Stiftung Junges Europa bietet über das Netzwerk Understanding Europe Peer-Education-Workshops an. Und mit Jumper hat die Universität Göttingen ein Planspiel entwickelt, das sich besonders an Jugendliche richtet, die kaum von derlei Bildungsangeboten profitieren. Ideal für Schulen sind auch die Angebote der deutschlandweit über 50 EuropeDirect-Zentren, die auch einen Expert:innen-Pool vorhalten.
Aufgabe der Länder wäre es nun, das Engagement zu bündeln, institutionelle Strukturen zu schaffen und die Projekte verbindlich so zu skalieren, dass sie in jedem Klassenzimmer ankommen. Vor der EU-Wahl im nächsten Jahr wird das sicher nicht mehr gelingen, also ist Kreativität gefragt – und ein klares politisches Signal.
Die Kultusminister:innen sollten die Schulen verpflichten, bis Juni einen Unterrichtstag den Europawahlen zu widmen – und den Schulleiter:innen dafür den nötigen Freiraum einräumen. Uns ist bewusst, dass die Belastung vieler Lehrer:innen hoch ist, daher sind die Schulinstitute oder andere Ad-hoc-Gremien gefordert, bis März geeignete Pakete mit Materialien, Planspielen und Projektskizzen bereitzustellen, um den Europatag durchzuführen. Am 9. Juni 2024 wissen wir, ob der Bildungsföderalismus auch Flexibilität beherrscht.
Dominik Geier ist Landesvorsitzender der Jungen Europäischen Föderalist:innen Berlin-Brandenburg. Die JEF ist ein überparteilicher, europaweit organisierter Verband, der sich für die Vollendung des europäischen Projekts als Europäische Föderation einsetzt.
