am Donnerstag startet der Strategische Dialog zur Zukunft der Automobilindustrie. Zwischen 10 und 13 Uhr lädt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Vorstandschefs von Herstellern und Zulieferern zu einer ersten Runde in die Kommission. Abgesehen von den Eckdaten ist auch den Teilnehmern wenig bekannt über den Ablauf des Dialogs. Das sorgt für Stirnrunzeln in der Branche.
Regelrecht befremdet ist der Branchenverband VDA über die Zusammensetzung. Dass bei der Auftaktveranstaltung “kein einziges Unternehmen aus dem Mittelstand eingeladen wurde”, die Umwelt-NGO T&E hingegen schon, “lässt daran zweifeln, dass die Kommission die Herausforderungen unserer Industrie und die damit verbundenen notwendigen Gesprächspartner vollständig erkannt hat”.
Der Dachverband der Umweltverbände T&E ist eine der Umwelt-NGOs, die Verträge mit der Kommission haben (Europe.Table berichtete). Der Sprecher von VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagt dazu: “Dass die EU-Kommission Klima- und Umweltorganisationen, hier unter anderem T&E, aktiv damit beauftragt, das Abstimmungsverhalten der EU-Parlamentarier zu beeinflussen, ist ein Skandal.” Vor allem mit Blick auf die fehlende Transparenz, die sonst in allen Bereichen richtigerweise eingefordert werde, sei das Vorgehen fragwürdig. Der Sprecher weiter: “Wenn die EU den strategischen Dialog mit der europäischen Automobilindustrie ernst meint, muss dieses Verhalten korrigiert beziehungsweise eingestellt werden.”
Für Unruhe sorgt bei den Herstellern auch eine Personalie beim Strategischen Dialog. Als Ansprechpartner für Rückfragen zu Format und Teilnehmern wurde ein Beamter aus dem Generalsekretariat der Kommission genannt, der von 2019 bis 2022 Vize der NGO Agora Verkehrswende war, bevor er zur Kommission zurückkehrte. Aus der Kommission ist jedoch zu hören, dass der Beamte keinen inhaltlichen Einfluss auf das Gesprächsformat habe.
Kommen Sie gut durch den Tag!

Viel wird derzeit darüber spekuliert, ob es zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin so etwas wie eine gute persönliche Beziehung gibt. Susan Stewart, Senior Fellow der Forschungsgruppe Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), hält das für einen Irrglauben. Auch die Vorstellung, dass Trump und Putin in einem persönlichen Gespräch einen “schnellen Deal” entwerfen können, sei unwahrscheinlich. Denn “die Einflusshebel der USA auf Russland sind begrenzt”, analysiert die Russland-Expertin Margarete Klein. Es werde im Trump-Lager nicht genügend verstanden, dass dieser Krieg für Russland “eingebettet ist in eine längere Konfrontation mit dem Westen”.
Aktuell gibt es für Moskau keinen starken Druck, eine schnelle Einigung zu finden: Die russischen Kräfte erobern in der Ukraine nach und nach weiteres Territorium. Gerade im Süden, am Asowschen Meer, gelingt es ihnen, den Landkorridor zur Krim zu verbreitern. Zugleich zeigen Umfragen des unabhängigen Meinungsforschungszentrums Lewada in Russland, dass die grundsätzliche Lebenszufriedenheit der Menschen sehr hoch ist. Und auch die Wirtschaft hat sich an die neue Kriegsnormalität angepasst, das Regime achtet zugleich darauf, die Fehler der Sowjetunion nicht zu wiederholen und die Militarisierung der Wirtschaft nicht zu übertreiben. Putin gelingt es, die Gesellschaft in Sicherheit zu wiegen und den Krieg vergessen zu lassen.
Laut SWP-Expertin Klein gibt es bislang “keine ausgearbeitete US-Strategie der neuen Administration” in Bezug auf Russland. Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine, der ehemalige Generalleutnant Keith Kellogg, hat eine Art Masterplan vorgelegt. In einem Papier des erzkonservativen Thinktanks “American First Policy Institute” (AFPI) nennt er mögliche Grundlagen für Gespräche mit Russland. Die USA werden anbieten, “die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine für einen längeren Zeitraum aufzuschieben, im Gegenzug für ein umfassendes und überprüfbares Friedensabkommen mit Sicherheitsgarantien”. Ebenfalls vorgesehen ist ein Einfrieren des Konflikts an einer Waffenstillstandslinie und die Aufhebung von Sanktionen.
Wie ein Friedensabkommen aussehen soll, ist völlig unklar. Auch wer es absichern soll. Jüngste Äußerungen von Trump, 20.000 US-Truppen aus Europa abzuziehen, legen nahe, dass der US-Präsident dafür europäische Truppen vorsieht. Der Abzug kann in Moskau auch als Zeichen verstanden werden, dass Trump kein Interesse an Europa habe. Man müsse sich sorgen, so Klein, dass es eine “Scheinlösung” gebe. “Trump kann sich dann als Dealmaker präsentieren, ohne dass der Konflikt langfristig gelöst wird.”
Trump-Vertraute haben laut Reuters zuletzt Mitte Januar bestätigt, dass es “Monate dauern werde”, bis man zu einer Lösung komme. Dies habe auch der Präsident verstanden. Trumps Versprechen, den Krieg in 24 Stunden zu beenden, sei eine “Kombination aus Wahlkampfgetöse und ein Mangel an Verständnis über die Komplexität dieses Konflikts” gewesen. “Es wird keine schnelle Lösung geben”, ist sich die Ukraine-Expertin Stewart sicher.
Interessant wird sein, welche Rolle der neue US-Außenminister Marco Rubio spielen wird. Kurz nach seiner Amtseinführung Anfang letzter Woche machte er deutlich, dass sowohl Russland als auch die Ukraine “Zugeständnisse” machen müssten. Es sei auf dem Schlachtfeld zu einer “Pattsituation” gekommen. Anders als Präsident Trump hält sich Rubio jedoch mit Details oder einem Zeitplan zurück. Das Thema sei “kompliziert” und deshalb werde man sich “nicht hinreißen lassen, im Voraus über Verhandlungen zu sprechen”.
Aber auch von Rubio ist nicht zu erwarten, dass er für eine Aufstockung der Waffenhilfe für die Ukraine plädieren wird. Letztes Jahr stimmte er gegen einen Gesetzentwurf von Ex-Präsident Joe Biden, der Ukraine weitere Milliarden an Waffenhilfe zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung der Ukraine ist in der republikanischen Partei weiterhin sehr umstritten. Ende letzten Jahres sagten 42 Prozent der Republikaner, dass die USA zu viel an Unterstützung liefere. Nur noch 36 Prozent glauben, dass die USA verpflichtet sei, der Ukraine gegen den russischen Aggressor zu helfen.
Der Entzug von Waffenhilfe ist auch Teil des Plans von Kellogg, sollte sich die Ukraine nicht gesprächsbereit zeigen. Eine bereits geplante Reise Kelloggs nach Kyjiw wurde allerdings vorerst verschoben. Laut eines Berichts des Wall Street Journals habe sich Moskau bereits über Kellogg’s Pläne “lustig gemacht”. Wie groß Kellogg’s Einfluss auf Präsident Trump wirklich ist, hat das WSJ so kommentiert: “Er wird einfach tun, was Trump ihm sagt.” Mit Viktor Funk
An die 100.000 Menschen in 30 Städten haben am Wochenende gegen den Kurs der slowakischen Regierung unter Premier Robert Fico demonstriert. Allein 60.000 Menschen kamen in der Hauptstadt Bratislava zusammen. Zuletzt hatte die Slowakei Proteste solchen Ausmaßes im Jahr 2018 erlebt, nachdem der Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte ermordet worden waren. Seinerzeit musste Fico als Premier zurücktreten. Ein solches Szenario will der 60-jährige Linksnationalist, der zum vierten Mal Premier ist, jetzt unter allen Umständen verhindern.
Fico steht an der Spitze einer Dreierkoalition und konnte anfangs im Parlament auf 79 von 150 Abgeordneten bauen. Doch die einstige Mehrheit schmilzt. Vier Abgeordnete verweigerten wiederholt die Zustimmung zur Regierungspolitik. Und drei Abtrünnige von der eher unberechenbaren Nationalpartei SNS verlangen mehr Macht – für sich, bis hin zu einem Ministerposten.
Die Regierung steht auch inhaltlich unter Druck. Soziale Wohltaten, wie Fico sie zuhauf versprochen hatte, blieben aus. Stattdessen musste die Regierung ein Konsolidierungspaket gegen die Staatsverschuldung schnüren. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auch für Lebensmittel. Das kommt auch bei den Wählern Ficos nicht gut an. Umstritten sind auch autoritäre Eingriffe der Regierung in die Justiz, die öffentlich-rechtlichen Medien und die Kultur.
Als Reaktion auf die Kritik ging Fico den Weg, den er auch in früheren Zeiten schon ging. Er sucht zur Ablenkung von seinen inneren Problemen “Feinde” im Ausland. So überwarf er sich mit der benachbarten Ukraine, die seit Anfang des Jahres kein günstiges russisches Gas mehr in die Slowakei leitet. Da die Slowakei einen Teil dieser Lieferungen bislang an andere Nachbarländer wie Tschechien weitergab, fallen jetzt die Einnahmen aus dieser Durchleitung aus.
Statt sich in dieser prekären Lage mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an einen Tisch zu setzen, reiste Fico kurz vor Weihnachten überraschend nach Moskau zu Wladimir Putin. Was nicht nur die eigene Opposition in der Slowakei völlig irritierte, sondern auch Brüssel. Putin würde Fico für seine Kriegskasse gern weiter Gas schicken.
Offen ist noch, ob möglicherweise Gas aus Aserbaidschan über die ukrainischen Leitungen in die Slowakei transportiert wird. Doch Fico eskalierte den Streit mit der Ukraine. Er drohte damit, künftig Entscheidungen über die Ukraine in der EU zu blockieren, so wie sein ungarischer Freund und Kollege Viktor Orbán. Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, so Fico, werde es mit ihm nicht geben. “Das würde einen neuen Weltkrieg auslösen.”
Mit seinem Besuch in Moskau und den verbalen Anfeindungen der Ukraine erfreute Fico seine eigene Klientel in der Slowakei. Seine Wähler sind laut Umfragen mehrheitlich der Überzeugung, dass es der Westen war, der den Krieg in der Ukraine ausgelöst habe, nicht Putin.
Doch es gibt auch die andere Hälfte der Slowaken, die sich größte Sorgen über die Annäherung Ficos an Putin macht. Entgegen den Aussagen eines Fico-Parteigängers, wonach die Slowakei nicht für immer und ewig in den westlichen Bündnissen bleiben müsse, ruderte der Premier selbst rasch zurück: “Die Verankerung in EU und Nato bleibt unantastbar.”
In den Tagen vor den angekündigten Demonstrationen schürte Fico dann massiv Angst. Als die Opposition im Parlament einen Misstrauensantrag gegen ihn einbringen wollte, griff Fico zu einem Trick, würgte die Debatte ab und warnte unter Hinweis auf den ihm hörigen Sicherheitsdienst SIS und unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einem drohenden “Maidan”. Die Opposition wolle die Regierung unter Anleitung ausländischer NGOs stürzen. Der Nationale Sicherheitsrat nannte die Lage ebenfalls “sehr ernst”. Fico gestand zwar zu, dass Proteste gegen die Regierung “erlaubt” seien, aber nur “im Rahmen der geltenden Gesetze”.
“Maidanähnliche Zwischenfälle” gab es bei den Protesten nicht. Fico wies den SIS dennoch an, “ausländische Agenten” dingfest zu machen und auszuweisen.
Die Proteste werden weitergehen. Der nächste Termin ist der 7. Februar. Ob Fico unter diesem Druck bis zu den regulären Wahlen 2027 durchhält, ist offen. Auch er selbst spricht schon von denkbaren Neuwahlen noch in diesem Jahr. Hans-Jörg Schmidt
28.01.2025 – 19:00-20:45 Uhr,
DGAP, Podiumsdiskussion Resilienz der Demokratie angesichts ausländischer Einflussnahme
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) analysiert die akuten Gefahren für die freiheitlich demokratische Grundordnung Deutschlands, die Rolle ausländischer Nachrichtendienste bei Angriffen dieser Art und die Einflussnahme durch KI und Deepfakes. INFOS & ANMELDUNG
29.01.2025 – 09:30-11:00 Uhr, online
ECFR, Discussion Don’t wait for Washington: What the EU can do for Ukraine and its own security
The European Council on Foreign Relations (ECFR) discusses the European foreign policy in face of the Trump presidency. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 10:00-12:00 Uhr, online
HBS, Presentation Launch of the Europe Sustainable Development Report 2025
The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses the Europe Sustainable Development Report 2025. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 10:00-11:00 Uhr, online
TÜV, Seminar 5S in Zeiten von Nachhaltigkeit – Effizienz trifft Umweltbewusstsein
Der TÜV beschäftigt sich mit den aktuellen und zentralen Themen zu Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung in der Unternehmenswelt. INFOS & ANMELDUNG
29.01.2025
AI, Podiumsdiskussion Tariffs, Technology, and Tensions – Managing Transatlantic Trade Risks
Das Aspen Institute (AI) geht der Frage nach, wie sich die transatlantischen Handelsbeziehungen angesichts wachsender Unsicherheiten und Spannungen weiterentwickeln können. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 16:40-18:10 Uhr, Dresden/online
KAS, Presentation The US Presidential Elections 2024 – Impacts in the United States and for US-German Relations
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) discusses the recent US Presidential elections and its impact on US-German relations. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 18:00-21:30 Uhr, Hamburg
KAS, Vortrag Trump is back – Wohin steuern die USA?
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) analysiert die Herausforderungen für die deutsche Außen- und Europapolitik in Zeiten von Trump und den vielfältigen Krisen der EU. INFOS & ANMELDUNG
30.01.2025 – 15:00-17:00 Uhr, online
ERCST, Workshop Second Stakeholders and Member States Consultation – Implementation and transposition of hydrogen regulations in the EU Member States
The European Roundtable on Climate Change (ERCST) brainstorms the outline and content of the ERCST Research Project on the implementation and transposition of hydrogen regulations in the EU Member States. INFOS & REGISTRATION
30.01.2025 – 18:30-20:00 Uhr
DGAP, Diskussion Aktuelle Themen der deutschen und französischen Außenpolitik in der EU und der Welt
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutiert die politischen Ansätze, die die französische und die deutsche Regierung vor dem Hintergrund der innen- und außenpolitischen Herausforderungen verfolgen. INFOS & ANMELDUNG
Die EU-Außenminister haben am Montag ihre Zustimmung zu einer schrittweisen und umfassenden Lockerung des Sanktionsregimes gegen Syrien gegeben. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte, dass nach der politischen Einigung die technische Umsetzung mit den Rechtstexten erfolgen müsse. Man werde spätestens bis zum nächsten Treffen der Außenminister in vier Wochen so weit sein. Schnell wird es also nicht gehen.
Eine Roadmap sieht vor, zuerst die Sanktionen zu lockern, die den Wiederaufbau des Landes sowie den Personen- und Warenverkehr behindern. So etwa die Strafmaßnahmen, die einer Reparatur der Energieversorgung im Weg stehen. Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einer guten Nachricht für die Menschen in Syrien. Als Beispiel für ein Unternehmen, das von den Lockerungen profitieren könnte, nannte Baerbock ein Siemens-Kraftwerk zur Stromerzeugung, das wegen der Strafmaßnahmen seit Jahren nicht mehr mit Unterstützung aus Deutschland gewartet werden konnte.
Damit auch private Investitionen im Land wieder möglich werden, sollen ferner die Sanktionen gegen das Finanzsystem suspendiert und Bankverbindungen wieder hergestellt werden. Ausnahmen für humanitäre Hilfe sollen unbefristet gelten, wie in einem Non-paper von Deutschland und anderen EU-Staaten vorgeschlagen.
Die Lockerungen sollen laut Kallas Syrien helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Konkret soll der Import von Baumaterialien, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen ermöglicht werden. Vorgesehen ist laut Diplomaten eine umfassende Suspendierung. Wobei die Roadmap in einer Negativliste aufführt, was weiterhin unter Embargo bleiben soll.
Nicht aufgehoben werde das Waffenembargo gegen Syrien, sagte Kallas. Auch der Import von Ausrüstungsgütern, die der internen Repression oder Überwachung dienen, soll weiterhin verboten bleiben. Untersagt bleiben der Import von Dual-Use-Gütern sowie der Export von syrischen Kulturgütern. Maßnahmen gegen Exponenten und Entitäten des Assad-Regimes bleiben ebenfalls in Kraft.
Die Roadmap sehe vor, Lockerungen wieder rückgängig zu machen, sollten die neuen Machthaber Schritte einleiten, die aus EU-Sicht in die falsche Richtung gingen, sagte Kallas. Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Wochenende, Vertreter der neuen Machthaber hätten innerhalb von 72 Stunden 35 Offiziere und andere Vertreter des Assad-Regimes hingerichtet.
Die internationale Gemeinschaft hat Syrien im vergangenen Jahrzehnt eines der umfassendsten Sanktionsregime auferlegt. Nur einen Teil der Strafmaßnahmen hat die EU autonom erlassen, einen größten Teil hingegen als Umsetzung von UN-Sanktionen. Es sei schwieriger, Strafmaßnahmen zu lockern als sie zu verhängen, sagte ein Diplomat. sti
Ungarn hat gegen Zusicherungen zur Energiesicherheit sein Veto gegen die Verlängerung von Ende Januar auslaufenden Russland-Sanktionen zurückgezogen. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán trug beim Außenministertreffen in Brüssel die für das Weiterlaufen der Strafmaßnahmen notwendige Entscheidung mit. Zuvor hatten die EU-Kommission und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Erklärung zu Forderungen aus Budapest abgegeben. In dieser wird den Ungarn zugesichert, dass auf ihre Sorgen um die Energiesicherheit eingegangen wird.
Orbán hatte für seine Zustimmung zur Sanktionsverlängerung zunächst unter anderem gefordert, dass die Ukraine eine jüngst geschlossene Pipeline wieder öffnet, die bis dahin russisches Erdgas nach Mitteleuropa und damit auch nach Ungarn befördert hatte.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó teilte mit, Ungarn habe die geforderten Garantien hinsichtlich der Energiesicherheit erhalten. Die EU-Kommission habe sich verpflichtet, die Erdgas- und Ölpipelines zu den EU-Mitgliedstaaten zu schützen, und fordere nun von der Ukraine Zusicherungen, die Ölversorgung der EU sicherzustellen. Am Mittag meldete Bloomberg, dass die Kommission ihren Fahrplan zum Auslaufen von Gasimporten aus Russland möglicherweise erst am 26. März vorlegen werde – einen Monat später als gedacht. Am Wochenende hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj außerdem signalisiert, er könne unter Umständen die Durchleitung von Gas aus Aserbaidschan Richtung EU ermöglichen.
Orbán hatte seine Blockade gegen die Sanktionsverlängerung mehrere Wochen aufrechterhalten. Eigentlich hatte sie bereits im vergangenen Jahr entschieden werden sollen. Beim EU-Gipfel kurz vor Weihnachten kündigte Orbán dann aber an, er müsse über die Sache noch nachdenken und werde eine Entscheidung erst nach der Amtseinführung des neugewählten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar treffen.
Der Republikaner hat mehrfach kundgetan, er könne den russischen Krieg gegen die Ukraine in kurzer Zeit beenden. Aus Sicht von Orbán würde dann die Grundlage für die Sanktionen wegfallen. Er hatte sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert. Wenn Ungarn der Verlängerung der EU-Sanktionen nicht zugestimmt hätte, wären sie am 31. Januar ausgelaufen. dpa/ber
Die deutsche FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde am Montag bei dessen konstituierender Sitzung zur Vorsitzenden des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) im Europäischen Parlament gewählt. Hinter den Kulissen wird allerdings über die genauen Zuständigkeiten des Ausschusses diskutiert.
“Ich freue mich sehr, dass die konstituierende Sitzung der SEDE als neuer Vollausschuss des Europäischen Parlaments heute erfolgreich durchgeführt wurde. Das Parlament trägt damit der enorm gestiegenen Bedeutung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Rechnung”, sagte Strack-Zimmermann, die von 2021 bis 2024 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag war, im Anschluss an ihre Wahl. Das Parlament hatte im Dezember entschieden, den Unterausschuss zu einem vollwertigen Ausschuss aufzuwerten.
Strack-Zimmermann betonte, dass ihr Ausschuss eine “umfassende Rolle” in allen Angelegenheiten des Europäischen Parlaments spielen soll. Das bedeutet aus ihrer Sicht als politischer Beobachter, als Haushaltsakteur, aber auch als Gesetzgeber. Sie erwähnte auch explizit das Europäische Verteidigungsindustrieprogramm, EDIP.
Von Beginn an gab es Differenzen über den Zuschnitt von SEDE und dessen Kompetenzen. Der Industrieausschuss ITRE und der außenpolitische Ausschuss AFET wollen die Zuständigkeiten für die Beratungen über das Programm zur Europäischen Verteidigungsindustrie EDIP nicht abgeben. Es handelt sich um die wichtigste Gesetzgebung im Bereich Verteidigung auf europäischer Ebene.
Es geht außerdem darum, wer Input für das Weißbuch des EU-Kommissars für Verteidigung, Andrius Kubilius, liefern darf. Auch hier soll es Streitigkeiten zwischen AFET und SEDE geben. Noch heute soll ein Austausch zwischen Kubilius und dem neu aufgewerteten Ausschuss zum Weißbuch stattfinden. Es soll am 11. März vorgestellt werden. wp/sti
Die Gespräche zur Umsetzung der EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 im Deutschen Bundestag sind gescheitert. Damit wird die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von kritischer Infrastruktur gegen Cyberangriffe durch die Neuwahlen um mehrere Monate verschoben. Zuletzt lag die Hoffnung auf der FDP, dass das Gesetz es noch vor den Neuwahlen am 23. Februar durch den Bundestag schafft. Die Union hatte SPD und Grünen bereits zuvor klargemacht, dass sie die Umsetzung der verbliebenen Sicherheitsgesetze nicht mehr unterstützen wird.
“Die FDP-Vertreter saßen ohnehin ohne Prokura am Tisch, da die FDP nicht zu Beschlüssen ohne die Union bereit ist”, sagte der SPD-Berichterstatter Sebastian Hartmann jedoch am Montag. Aus seiner Sicht war ein Kompromiss nicht möglich, weil die Differenzen mit Blick auf die Stärkung der Sicherheitsbehörden und den Schutz der Industrie zu groß waren. “Das Ergebnis wäre ein schnelles Gesetz gewesen, aber eine Schwächung der Cybersicherheit Deutschlands”, so Hartmann.
Aus Expertenkreisen und Industrie wurde dagegen zuvor sehr für eine schnelle Umsetzung plädiert und dafür geworben, die verbliebenen Differenzen zu einem späteren Zeitpunkt und womöglich nach den Bundestagswahlen anzugehen.
“Die zügige Umsetzung der Anforderungen der NIS-2-Richtlinie durch Staat und Wirtschaft ist zentral, um den Industriestandort bestmöglich gegen digitale Gefahren zu wappnen”, hatte Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vergangene Woche zu Table.Briefings gesagt. Die EU-Frist zur Umsetzung der Richtlinie ist bereits im Oktober vergangenen Jahres abgelaufen und die EU-Kommission hat bereits ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. wp
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will die Vorschläge der Kommission zur Verbesserung der Marktmacht von Landwirten “kraftvoll unterstützen”. Insbesondere die Maßnahmen zur Stärkung der Milchbauern begrüßte er am Rande des Agrarrats am Montag in Brüssel. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hatte vorgeschlagen, schriftliche Verträge zwischen Erzeugern und Abnehmern unter anderem im Milchsektor vorzuschreiben.
Erzeugergemeinschaften wären davon ausgenommen – aus Özdemirs Sicht die richtige Entscheidung. Das spare Bürokratie ein, zumal in Genossenschaften die Interessen der Milchbauern bereits vertreten seien. Auch darüber hinaus wolle er sich für eine bürokratiearme Umsetzung der Vorschläge einsetzen.
Sollte die Union die künftige Bundesregierung führen, dürfte sich die Haltung Deutschlands zur Vertragspflicht allerdings ändern. “Die Ziele der EU-Kommission sind gut gemeint; das Instrument würde aber in der Realität überhaupt nicht funktionieren”, sagt Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, zu Table.Briefings. Er fürchtet ein neues “Bürokratiemonster”. Sinnvoller sei es, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Genossenschaften zu stärken. Dass die Verhandlungen zum Vorschlag bis nach dem deutschen Regierungswechsel andauern, ist wahrscheinlich.
Auch unter den Agrarministern der EU-Länder gehen die Meinungen auseinander. Skeptisch gegenüber einer Vertragspflicht zeigten sich etwa Schweden, Dänemark, Österreich, die Slowakei und Luxemburg. Grundsätzlich für verpflichtende Verträge sprachen sich neben Özdemir unter anderem seine Kollegen aus Frankreich, Polen, Portugal, Litauen und Finnland aus.
Derweil forderte Özdemir beim Agrarrat auch Vereinfachungen für den Bio-Sektor von der Kommission. Konkret sollen sich Kontrollen und Berichtspflichten zwischen der Bio-Zertifizierung und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nicht länger doppeln. Die Forderungen beruhen auf Empfehlungen einer EU-Expertenkommission aus dem vergangenen Herbst. Die Kommission solle einen Plan vorlegen, wie sie diese umsetzen will, fordert Özdemir.
16 weitere Minister schlossen sich dieser Meinung im Rat an. Auch der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) begrüßte den Vorstoß. Hansen kündigte an, die Kommission werde sich bei der Umsetzung der EU-Ökoverordnung um Vereinfachungen bemühen. Änderungen an der Verordnung selbst stellte er dagegen nicht in Aussicht. jd

An die Osteuropaforschung hat Olaf Scholz am 27. Februar 2022 garantiert nicht gedacht, als er von der Zeitenwende sprach. Begriff hin oder her, die Zäsur durch Russlands Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geht tief und fordert ein Umdenken, das in seiner Konsequenz viele unterschiedliche, letztendlich aber miteinander verbundene Bereiche tangiert. Diese Notwendigkeit macht auch vor der Osteuropaforschung nicht halt, die sich mit Fragen befasst, die den Krieg erklären helfen, die ihn empirisch dokumentiert und sich mit der Aufgabe konfrontiert sieht, die Ereignisse für die Öffentlichkeit einzuordnen und Wissenslücken zu füllen.
Schlagartig wurde nach dem 24. Februar 2022 herum klar, dass die Ukraine, Russland und die Region Osteuropa insgesamt, die sich genauen geografischen oder politischen Grenzziehungen entzieht, im öffentlichen Diskurs nicht präsent genug waren. Die Überraschung über Russlands Invasion war dementsprechend groß. Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits mit der Krim-Annexion 2014 begann, sich im Krieg im Donbas fortsetzte und 2022 in seine dritte Phase ging, wurde erst nach Beginn der Vollinvasion umfassender thematisiert.
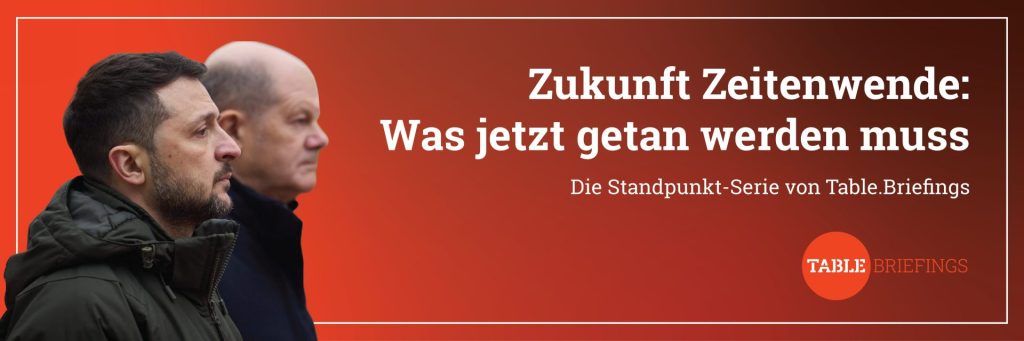
Osteuropa-Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Thinktanks wurden zu regelmäßigen Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien bis in die Talkshow-Formate hinein. Diverse Erklärformate, Podcasts und öffentliche Veranstaltungen von Forschungsinstituten, Bildungseinrichtungen und Stiftungen stießen auf großes Interesse. Inzwischen ist dieser Osteuropa-Boom schon wieder am Abklingen. Lernprozesse bleiben auch in Krisenzeiten ambivalent.
Ein langanhaltender Krieg scheint die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne zu überdehnen. Psychologische Mechanismen verdrängen zunehmend das Ausmaß und die Konsequenzen des Krieges, die weit über die Ukraine und Russland hinausgehen. Populistische Stimmenfänger am rechten und linken Rand des Parteienspektrums mobilisieren genau diesen Wunsch nach Abstand von der unschönen Realität. Die Wahlkämpfe auf Länderebene und jetzt der Bundestagswahlkampf zeigen in ihrer Akzentuierung von Frieden – wohlgemerkt ohne einen Plan, wie es zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine und Europa insgesamt kommen kann -, dass die Ukraine und Osteuropa mental weiterhin entfernter erscheinen als der Blick auf die Landkarte oder in die Geschichte suggeriert.
Das Feld der Osteuropaforschung ist und bleibt diffus. Es handelt sich um eine Schnittmenge aus Wissenschaftler*innen aus verschiedenen akademischen Disziplinen. Unter ihnen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften am prominentesten vertreten. Gemessen an der Zahl der Lehrstühle bringen die Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften mehr kritische Masse auf als die Sozialwissenschaften. Seit Februar 2022 hat sich an den Strukturen der Osteuropaforschung nur wenig verändert. Der dominante Russlandfokus in der Slawistik wird bestenfalls mittelfristig durch mehr Vielfalt ersetzt werden.
Die Professuren mit Osteuropa-Denomination sind auch nach Februar 2022 weiter rückläufig. Natürlich widmen sich nicht nur Lehrstühle mit entsprechendem Titel der Region. Es bedarf auch einer stärkeren Verankerung in der vergleichenden Forschung. Einschlägige Forschung findet auch an spezialisierten außeruniversitären Instituten statt. Es gab und gibt weiterhin Projektförderinitiativen mit Osteuropabezug, etwa vom BMBF oder Stiftungen, aber mit wenigen Ausnahmen lässt sich hier bisher keine systematische Priorisierung erkennen.
Eine Auswirkung des Krieges sind die erweiterten Netzwerke von Wissenschaftler*innen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen, einschließlich der Naturwissenschaften, zu den Auswirkungen des Krieges arbeiten. Die Präsenz geflüchteter Wissenschaftler*innen spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Aus persönlichen Netzwerken werden jedoch nicht automatisch nachhaltige Strukturen.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Relevanz Osteuropas für alle sichtbar unterstrichen, aber die finanziellen, strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Schlussfolgerungen sind weit offen. Somit ist es zu früh, von einer Zeitenwende in der Osteuropaforschung zu sprechen.
Gwendolyn Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für Vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
am Donnerstag startet der Strategische Dialog zur Zukunft der Automobilindustrie. Zwischen 10 und 13 Uhr lädt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Vorstandschefs von Herstellern und Zulieferern zu einer ersten Runde in die Kommission. Abgesehen von den Eckdaten ist auch den Teilnehmern wenig bekannt über den Ablauf des Dialogs. Das sorgt für Stirnrunzeln in der Branche.
Regelrecht befremdet ist der Branchenverband VDA über die Zusammensetzung. Dass bei der Auftaktveranstaltung “kein einziges Unternehmen aus dem Mittelstand eingeladen wurde”, die Umwelt-NGO T&E hingegen schon, “lässt daran zweifeln, dass die Kommission die Herausforderungen unserer Industrie und die damit verbundenen notwendigen Gesprächspartner vollständig erkannt hat”.
Der Dachverband der Umweltverbände T&E ist eine der Umwelt-NGOs, die Verträge mit der Kommission haben (Europe.Table berichtete). Der Sprecher von VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagt dazu: “Dass die EU-Kommission Klima- und Umweltorganisationen, hier unter anderem T&E, aktiv damit beauftragt, das Abstimmungsverhalten der EU-Parlamentarier zu beeinflussen, ist ein Skandal.” Vor allem mit Blick auf die fehlende Transparenz, die sonst in allen Bereichen richtigerweise eingefordert werde, sei das Vorgehen fragwürdig. Der Sprecher weiter: “Wenn die EU den strategischen Dialog mit der europäischen Automobilindustrie ernst meint, muss dieses Verhalten korrigiert beziehungsweise eingestellt werden.”
Für Unruhe sorgt bei den Herstellern auch eine Personalie beim Strategischen Dialog. Als Ansprechpartner für Rückfragen zu Format und Teilnehmern wurde ein Beamter aus dem Generalsekretariat der Kommission genannt, der von 2019 bis 2022 Vize der NGO Agora Verkehrswende war, bevor er zur Kommission zurückkehrte. Aus der Kommission ist jedoch zu hören, dass der Beamte keinen inhaltlichen Einfluss auf das Gesprächsformat habe.
Kommen Sie gut durch den Tag!

Viel wird derzeit darüber spekuliert, ob es zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin so etwas wie eine gute persönliche Beziehung gibt. Susan Stewart, Senior Fellow der Forschungsgruppe Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), hält das für einen Irrglauben. Auch die Vorstellung, dass Trump und Putin in einem persönlichen Gespräch einen “schnellen Deal” entwerfen können, sei unwahrscheinlich. Denn “die Einflusshebel der USA auf Russland sind begrenzt”, analysiert die Russland-Expertin Margarete Klein. Es werde im Trump-Lager nicht genügend verstanden, dass dieser Krieg für Russland “eingebettet ist in eine längere Konfrontation mit dem Westen”.
Aktuell gibt es für Moskau keinen starken Druck, eine schnelle Einigung zu finden: Die russischen Kräfte erobern in der Ukraine nach und nach weiteres Territorium. Gerade im Süden, am Asowschen Meer, gelingt es ihnen, den Landkorridor zur Krim zu verbreitern. Zugleich zeigen Umfragen des unabhängigen Meinungsforschungszentrums Lewada in Russland, dass die grundsätzliche Lebenszufriedenheit der Menschen sehr hoch ist. Und auch die Wirtschaft hat sich an die neue Kriegsnormalität angepasst, das Regime achtet zugleich darauf, die Fehler der Sowjetunion nicht zu wiederholen und die Militarisierung der Wirtschaft nicht zu übertreiben. Putin gelingt es, die Gesellschaft in Sicherheit zu wiegen und den Krieg vergessen zu lassen.
Laut SWP-Expertin Klein gibt es bislang “keine ausgearbeitete US-Strategie der neuen Administration” in Bezug auf Russland. Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine, der ehemalige Generalleutnant Keith Kellogg, hat eine Art Masterplan vorgelegt. In einem Papier des erzkonservativen Thinktanks “American First Policy Institute” (AFPI) nennt er mögliche Grundlagen für Gespräche mit Russland. Die USA werden anbieten, “die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine für einen längeren Zeitraum aufzuschieben, im Gegenzug für ein umfassendes und überprüfbares Friedensabkommen mit Sicherheitsgarantien”. Ebenfalls vorgesehen ist ein Einfrieren des Konflikts an einer Waffenstillstandslinie und die Aufhebung von Sanktionen.
Wie ein Friedensabkommen aussehen soll, ist völlig unklar. Auch wer es absichern soll. Jüngste Äußerungen von Trump, 20.000 US-Truppen aus Europa abzuziehen, legen nahe, dass der US-Präsident dafür europäische Truppen vorsieht. Der Abzug kann in Moskau auch als Zeichen verstanden werden, dass Trump kein Interesse an Europa habe. Man müsse sich sorgen, so Klein, dass es eine “Scheinlösung” gebe. “Trump kann sich dann als Dealmaker präsentieren, ohne dass der Konflikt langfristig gelöst wird.”
Trump-Vertraute haben laut Reuters zuletzt Mitte Januar bestätigt, dass es “Monate dauern werde”, bis man zu einer Lösung komme. Dies habe auch der Präsident verstanden. Trumps Versprechen, den Krieg in 24 Stunden zu beenden, sei eine “Kombination aus Wahlkampfgetöse und ein Mangel an Verständnis über die Komplexität dieses Konflikts” gewesen. “Es wird keine schnelle Lösung geben”, ist sich die Ukraine-Expertin Stewart sicher.
Interessant wird sein, welche Rolle der neue US-Außenminister Marco Rubio spielen wird. Kurz nach seiner Amtseinführung Anfang letzter Woche machte er deutlich, dass sowohl Russland als auch die Ukraine “Zugeständnisse” machen müssten. Es sei auf dem Schlachtfeld zu einer “Pattsituation” gekommen. Anders als Präsident Trump hält sich Rubio jedoch mit Details oder einem Zeitplan zurück. Das Thema sei “kompliziert” und deshalb werde man sich “nicht hinreißen lassen, im Voraus über Verhandlungen zu sprechen”.
Aber auch von Rubio ist nicht zu erwarten, dass er für eine Aufstockung der Waffenhilfe für die Ukraine plädieren wird. Letztes Jahr stimmte er gegen einen Gesetzentwurf von Ex-Präsident Joe Biden, der Ukraine weitere Milliarden an Waffenhilfe zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung der Ukraine ist in der republikanischen Partei weiterhin sehr umstritten. Ende letzten Jahres sagten 42 Prozent der Republikaner, dass die USA zu viel an Unterstützung liefere. Nur noch 36 Prozent glauben, dass die USA verpflichtet sei, der Ukraine gegen den russischen Aggressor zu helfen.
Der Entzug von Waffenhilfe ist auch Teil des Plans von Kellogg, sollte sich die Ukraine nicht gesprächsbereit zeigen. Eine bereits geplante Reise Kelloggs nach Kyjiw wurde allerdings vorerst verschoben. Laut eines Berichts des Wall Street Journals habe sich Moskau bereits über Kellogg’s Pläne “lustig gemacht”. Wie groß Kellogg’s Einfluss auf Präsident Trump wirklich ist, hat das WSJ so kommentiert: “Er wird einfach tun, was Trump ihm sagt.” Mit Viktor Funk
An die 100.000 Menschen in 30 Städten haben am Wochenende gegen den Kurs der slowakischen Regierung unter Premier Robert Fico demonstriert. Allein 60.000 Menschen kamen in der Hauptstadt Bratislava zusammen. Zuletzt hatte die Slowakei Proteste solchen Ausmaßes im Jahr 2018 erlebt, nachdem der Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte ermordet worden waren. Seinerzeit musste Fico als Premier zurücktreten. Ein solches Szenario will der 60-jährige Linksnationalist, der zum vierten Mal Premier ist, jetzt unter allen Umständen verhindern.
Fico steht an der Spitze einer Dreierkoalition und konnte anfangs im Parlament auf 79 von 150 Abgeordneten bauen. Doch die einstige Mehrheit schmilzt. Vier Abgeordnete verweigerten wiederholt die Zustimmung zur Regierungspolitik. Und drei Abtrünnige von der eher unberechenbaren Nationalpartei SNS verlangen mehr Macht – für sich, bis hin zu einem Ministerposten.
Die Regierung steht auch inhaltlich unter Druck. Soziale Wohltaten, wie Fico sie zuhauf versprochen hatte, blieben aus. Stattdessen musste die Regierung ein Konsolidierungspaket gegen die Staatsverschuldung schnüren. Dazu gehört unter anderem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auch für Lebensmittel. Das kommt auch bei den Wählern Ficos nicht gut an. Umstritten sind auch autoritäre Eingriffe der Regierung in die Justiz, die öffentlich-rechtlichen Medien und die Kultur.
Als Reaktion auf die Kritik ging Fico den Weg, den er auch in früheren Zeiten schon ging. Er sucht zur Ablenkung von seinen inneren Problemen “Feinde” im Ausland. So überwarf er sich mit der benachbarten Ukraine, die seit Anfang des Jahres kein günstiges russisches Gas mehr in die Slowakei leitet. Da die Slowakei einen Teil dieser Lieferungen bislang an andere Nachbarländer wie Tschechien weitergab, fallen jetzt die Einnahmen aus dieser Durchleitung aus.
Statt sich in dieser prekären Lage mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an einen Tisch zu setzen, reiste Fico kurz vor Weihnachten überraschend nach Moskau zu Wladimir Putin. Was nicht nur die eigene Opposition in der Slowakei völlig irritierte, sondern auch Brüssel. Putin würde Fico für seine Kriegskasse gern weiter Gas schicken.
Offen ist noch, ob möglicherweise Gas aus Aserbaidschan über die ukrainischen Leitungen in die Slowakei transportiert wird. Doch Fico eskalierte den Streit mit der Ukraine. Er drohte damit, künftig Entscheidungen über die Ukraine in der EU zu blockieren, so wie sein ungarischer Freund und Kollege Viktor Orbán. Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, so Fico, werde es mit ihm nicht geben. “Das würde einen neuen Weltkrieg auslösen.”
Mit seinem Besuch in Moskau und den verbalen Anfeindungen der Ukraine erfreute Fico seine eigene Klientel in der Slowakei. Seine Wähler sind laut Umfragen mehrheitlich der Überzeugung, dass es der Westen war, der den Krieg in der Ukraine ausgelöst habe, nicht Putin.
Doch es gibt auch die andere Hälfte der Slowaken, die sich größte Sorgen über die Annäherung Ficos an Putin macht. Entgegen den Aussagen eines Fico-Parteigängers, wonach die Slowakei nicht für immer und ewig in den westlichen Bündnissen bleiben müsse, ruderte der Premier selbst rasch zurück: “Die Verankerung in EU und Nato bleibt unantastbar.”
In den Tagen vor den angekündigten Demonstrationen schürte Fico dann massiv Angst. Als die Opposition im Parlament einen Misstrauensantrag gegen ihn einbringen wollte, griff Fico zu einem Trick, würgte die Debatte ab und warnte unter Hinweis auf den ihm hörigen Sicherheitsdienst SIS und unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einem drohenden “Maidan”. Die Opposition wolle die Regierung unter Anleitung ausländischer NGOs stürzen. Der Nationale Sicherheitsrat nannte die Lage ebenfalls “sehr ernst”. Fico gestand zwar zu, dass Proteste gegen die Regierung “erlaubt” seien, aber nur “im Rahmen der geltenden Gesetze”.
“Maidanähnliche Zwischenfälle” gab es bei den Protesten nicht. Fico wies den SIS dennoch an, “ausländische Agenten” dingfest zu machen und auszuweisen.
Die Proteste werden weitergehen. Der nächste Termin ist der 7. Februar. Ob Fico unter diesem Druck bis zu den regulären Wahlen 2027 durchhält, ist offen. Auch er selbst spricht schon von denkbaren Neuwahlen noch in diesem Jahr. Hans-Jörg Schmidt
28.01.2025 – 19:00-20:45 Uhr,
DGAP, Podiumsdiskussion Resilienz der Demokratie angesichts ausländischer Einflussnahme
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) analysiert die akuten Gefahren für die freiheitlich demokratische Grundordnung Deutschlands, die Rolle ausländischer Nachrichtendienste bei Angriffen dieser Art und die Einflussnahme durch KI und Deepfakes. INFOS & ANMELDUNG
29.01.2025 – 09:30-11:00 Uhr, online
ECFR, Discussion Don’t wait for Washington: What the EU can do for Ukraine and its own security
The European Council on Foreign Relations (ECFR) discusses the European foreign policy in face of the Trump presidency. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 10:00-12:00 Uhr, online
HBS, Presentation Launch of the Europe Sustainable Development Report 2025
The Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) discusses the Europe Sustainable Development Report 2025. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 10:00-11:00 Uhr, online
TÜV, Seminar 5S in Zeiten von Nachhaltigkeit – Effizienz trifft Umweltbewusstsein
Der TÜV beschäftigt sich mit den aktuellen und zentralen Themen zu Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung in der Unternehmenswelt. INFOS & ANMELDUNG
29.01.2025
AI, Podiumsdiskussion Tariffs, Technology, and Tensions – Managing Transatlantic Trade Risks
Das Aspen Institute (AI) geht der Frage nach, wie sich die transatlantischen Handelsbeziehungen angesichts wachsender Unsicherheiten und Spannungen weiterentwickeln können. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 16:40-18:10 Uhr, Dresden/online
KAS, Presentation The US Presidential Elections 2024 – Impacts in the United States and for US-German Relations
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) discusses the recent US Presidential elections and its impact on US-German relations. INFOS & REGISTRATION
29.01.2025 – 18:00-21:30 Uhr, Hamburg
KAS, Vortrag Trump is back – Wohin steuern die USA?
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) analysiert die Herausforderungen für die deutsche Außen- und Europapolitik in Zeiten von Trump und den vielfältigen Krisen der EU. INFOS & ANMELDUNG
30.01.2025 – 15:00-17:00 Uhr, online
ERCST, Workshop Second Stakeholders and Member States Consultation – Implementation and transposition of hydrogen regulations in the EU Member States
The European Roundtable on Climate Change (ERCST) brainstorms the outline and content of the ERCST Research Project on the implementation and transposition of hydrogen regulations in the EU Member States. INFOS & REGISTRATION
30.01.2025 – 18:30-20:00 Uhr
DGAP, Diskussion Aktuelle Themen der deutschen und französischen Außenpolitik in der EU und der Welt
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) diskutiert die politischen Ansätze, die die französische und die deutsche Regierung vor dem Hintergrund der innen- und außenpolitischen Herausforderungen verfolgen. INFOS & ANMELDUNG
Die EU-Außenminister haben am Montag ihre Zustimmung zu einer schrittweisen und umfassenden Lockerung des Sanktionsregimes gegen Syrien gegeben. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte, dass nach der politischen Einigung die technische Umsetzung mit den Rechtstexten erfolgen müsse. Man werde spätestens bis zum nächsten Treffen der Außenminister in vier Wochen so weit sein. Schnell wird es also nicht gehen.
Eine Roadmap sieht vor, zuerst die Sanktionen zu lockern, die den Wiederaufbau des Landes sowie den Personen- und Warenverkehr behindern. So etwa die Strafmaßnahmen, die einer Reparatur der Energieversorgung im Weg stehen. Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einer guten Nachricht für die Menschen in Syrien. Als Beispiel für ein Unternehmen, das von den Lockerungen profitieren könnte, nannte Baerbock ein Siemens-Kraftwerk zur Stromerzeugung, das wegen der Strafmaßnahmen seit Jahren nicht mehr mit Unterstützung aus Deutschland gewartet werden konnte.
Damit auch private Investitionen im Land wieder möglich werden, sollen ferner die Sanktionen gegen das Finanzsystem suspendiert und Bankverbindungen wieder hergestellt werden. Ausnahmen für humanitäre Hilfe sollen unbefristet gelten, wie in einem Non-paper von Deutschland und anderen EU-Staaten vorgeschlagen.
Die Lockerungen sollen laut Kallas Syrien helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Konkret soll der Import von Baumaterialien, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen ermöglicht werden. Vorgesehen ist laut Diplomaten eine umfassende Suspendierung. Wobei die Roadmap in einer Negativliste aufführt, was weiterhin unter Embargo bleiben soll.
Nicht aufgehoben werde das Waffenembargo gegen Syrien, sagte Kallas. Auch der Import von Ausrüstungsgütern, die der internen Repression oder Überwachung dienen, soll weiterhin verboten bleiben. Untersagt bleiben der Import von Dual-Use-Gütern sowie der Export von syrischen Kulturgütern. Maßnahmen gegen Exponenten und Entitäten des Assad-Regimes bleiben ebenfalls in Kraft.
Die Roadmap sehe vor, Lockerungen wieder rückgängig zu machen, sollten die neuen Machthaber Schritte einleiten, die aus EU-Sicht in die falsche Richtung gingen, sagte Kallas. Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Wochenende, Vertreter der neuen Machthaber hätten innerhalb von 72 Stunden 35 Offiziere und andere Vertreter des Assad-Regimes hingerichtet.
Die internationale Gemeinschaft hat Syrien im vergangenen Jahrzehnt eines der umfassendsten Sanktionsregime auferlegt. Nur einen Teil der Strafmaßnahmen hat die EU autonom erlassen, einen größten Teil hingegen als Umsetzung von UN-Sanktionen. Es sei schwieriger, Strafmaßnahmen zu lockern als sie zu verhängen, sagte ein Diplomat. sti
Ungarn hat gegen Zusicherungen zur Energiesicherheit sein Veto gegen die Verlängerung von Ende Januar auslaufenden Russland-Sanktionen zurückgezogen. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán trug beim Außenministertreffen in Brüssel die für das Weiterlaufen der Strafmaßnahmen notwendige Entscheidung mit. Zuvor hatten die EU-Kommission und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Erklärung zu Forderungen aus Budapest abgegeben. In dieser wird den Ungarn zugesichert, dass auf ihre Sorgen um die Energiesicherheit eingegangen wird.
Orbán hatte für seine Zustimmung zur Sanktionsverlängerung zunächst unter anderem gefordert, dass die Ukraine eine jüngst geschlossene Pipeline wieder öffnet, die bis dahin russisches Erdgas nach Mitteleuropa und damit auch nach Ungarn befördert hatte.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó teilte mit, Ungarn habe die geforderten Garantien hinsichtlich der Energiesicherheit erhalten. Die EU-Kommission habe sich verpflichtet, die Erdgas- und Ölpipelines zu den EU-Mitgliedstaaten zu schützen, und fordere nun von der Ukraine Zusicherungen, die Ölversorgung der EU sicherzustellen. Am Mittag meldete Bloomberg, dass die Kommission ihren Fahrplan zum Auslaufen von Gasimporten aus Russland möglicherweise erst am 26. März vorlegen werde – einen Monat später als gedacht. Am Wochenende hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj außerdem signalisiert, er könne unter Umständen die Durchleitung von Gas aus Aserbaidschan Richtung EU ermöglichen.
Orbán hatte seine Blockade gegen die Sanktionsverlängerung mehrere Wochen aufrechterhalten. Eigentlich hatte sie bereits im vergangenen Jahr entschieden werden sollen. Beim EU-Gipfel kurz vor Weihnachten kündigte Orbán dann aber an, er müsse über die Sache noch nachdenken und werde eine Entscheidung erst nach der Amtseinführung des neugewählten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar treffen.
Der Republikaner hat mehrfach kundgetan, er könne den russischen Krieg gegen die Ukraine in kurzer Zeit beenden. Aus Sicht von Orbán würde dann die Grundlage für die Sanktionen wegfallen. Er hatte sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert. Wenn Ungarn der Verlängerung der EU-Sanktionen nicht zugestimmt hätte, wären sie am 31. Januar ausgelaufen. dpa/ber
Die deutsche FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde am Montag bei dessen konstituierender Sitzung zur Vorsitzenden des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) im Europäischen Parlament gewählt. Hinter den Kulissen wird allerdings über die genauen Zuständigkeiten des Ausschusses diskutiert.
“Ich freue mich sehr, dass die konstituierende Sitzung der SEDE als neuer Vollausschuss des Europäischen Parlaments heute erfolgreich durchgeführt wurde. Das Parlament trägt damit der enorm gestiegenen Bedeutung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Rechnung”, sagte Strack-Zimmermann, die von 2021 bis 2024 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag war, im Anschluss an ihre Wahl. Das Parlament hatte im Dezember entschieden, den Unterausschuss zu einem vollwertigen Ausschuss aufzuwerten.
Strack-Zimmermann betonte, dass ihr Ausschuss eine “umfassende Rolle” in allen Angelegenheiten des Europäischen Parlaments spielen soll. Das bedeutet aus ihrer Sicht als politischer Beobachter, als Haushaltsakteur, aber auch als Gesetzgeber. Sie erwähnte auch explizit das Europäische Verteidigungsindustrieprogramm, EDIP.
Von Beginn an gab es Differenzen über den Zuschnitt von SEDE und dessen Kompetenzen. Der Industrieausschuss ITRE und der außenpolitische Ausschuss AFET wollen die Zuständigkeiten für die Beratungen über das Programm zur Europäischen Verteidigungsindustrie EDIP nicht abgeben. Es handelt sich um die wichtigste Gesetzgebung im Bereich Verteidigung auf europäischer Ebene.
Es geht außerdem darum, wer Input für das Weißbuch des EU-Kommissars für Verteidigung, Andrius Kubilius, liefern darf. Auch hier soll es Streitigkeiten zwischen AFET und SEDE geben. Noch heute soll ein Austausch zwischen Kubilius und dem neu aufgewerteten Ausschuss zum Weißbuch stattfinden. Es soll am 11. März vorgestellt werden. wp/sti
Die Gespräche zur Umsetzung der EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 im Deutschen Bundestag sind gescheitert. Damit wird die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von kritischer Infrastruktur gegen Cyberangriffe durch die Neuwahlen um mehrere Monate verschoben. Zuletzt lag die Hoffnung auf der FDP, dass das Gesetz es noch vor den Neuwahlen am 23. Februar durch den Bundestag schafft. Die Union hatte SPD und Grünen bereits zuvor klargemacht, dass sie die Umsetzung der verbliebenen Sicherheitsgesetze nicht mehr unterstützen wird.
“Die FDP-Vertreter saßen ohnehin ohne Prokura am Tisch, da die FDP nicht zu Beschlüssen ohne die Union bereit ist”, sagte der SPD-Berichterstatter Sebastian Hartmann jedoch am Montag. Aus seiner Sicht war ein Kompromiss nicht möglich, weil die Differenzen mit Blick auf die Stärkung der Sicherheitsbehörden und den Schutz der Industrie zu groß waren. “Das Ergebnis wäre ein schnelles Gesetz gewesen, aber eine Schwächung der Cybersicherheit Deutschlands”, so Hartmann.
Aus Expertenkreisen und Industrie wurde dagegen zuvor sehr für eine schnelle Umsetzung plädiert und dafür geworben, die verbliebenen Differenzen zu einem späteren Zeitpunkt und womöglich nach den Bundestagswahlen anzugehen.
“Die zügige Umsetzung der Anforderungen der NIS-2-Richtlinie durch Staat und Wirtschaft ist zentral, um den Industriestandort bestmöglich gegen digitale Gefahren zu wappnen”, hatte Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vergangene Woche zu Table.Briefings gesagt. Die EU-Frist zur Umsetzung der Richtlinie ist bereits im Oktober vergangenen Jahres abgelaufen und die EU-Kommission hat bereits ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. wp
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will die Vorschläge der Kommission zur Verbesserung der Marktmacht von Landwirten “kraftvoll unterstützen”. Insbesondere die Maßnahmen zur Stärkung der Milchbauern begrüßte er am Rande des Agrarrats am Montag in Brüssel. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hatte vorgeschlagen, schriftliche Verträge zwischen Erzeugern und Abnehmern unter anderem im Milchsektor vorzuschreiben.
Erzeugergemeinschaften wären davon ausgenommen – aus Özdemirs Sicht die richtige Entscheidung. Das spare Bürokratie ein, zumal in Genossenschaften die Interessen der Milchbauern bereits vertreten seien. Auch darüber hinaus wolle er sich für eine bürokratiearme Umsetzung der Vorschläge einsetzen.
Sollte die Union die künftige Bundesregierung führen, dürfte sich die Haltung Deutschlands zur Vertragspflicht allerdings ändern. “Die Ziele der EU-Kommission sind gut gemeint; das Instrument würde aber in der Realität überhaupt nicht funktionieren”, sagt Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, zu Table.Briefings. Er fürchtet ein neues “Bürokratiemonster”. Sinnvoller sei es, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Genossenschaften zu stärken. Dass die Verhandlungen zum Vorschlag bis nach dem deutschen Regierungswechsel andauern, ist wahrscheinlich.
Auch unter den Agrarministern der EU-Länder gehen die Meinungen auseinander. Skeptisch gegenüber einer Vertragspflicht zeigten sich etwa Schweden, Dänemark, Österreich, die Slowakei und Luxemburg. Grundsätzlich für verpflichtende Verträge sprachen sich neben Özdemir unter anderem seine Kollegen aus Frankreich, Polen, Portugal, Litauen und Finnland aus.
Derweil forderte Özdemir beim Agrarrat auch Vereinfachungen für den Bio-Sektor von der Kommission. Konkret sollen sich Kontrollen und Berichtspflichten zwischen der Bio-Zertifizierung und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nicht länger doppeln. Die Forderungen beruhen auf Empfehlungen einer EU-Expertenkommission aus dem vergangenen Herbst. Die Kommission solle einen Plan vorlegen, wie sie diese umsetzen will, fordert Özdemir.
16 weitere Minister schlossen sich dieser Meinung im Rat an. Auch der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) begrüßte den Vorstoß. Hansen kündigte an, die Kommission werde sich bei der Umsetzung der EU-Ökoverordnung um Vereinfachungen bemühen. Änderungen an der Verordnung selbst stellte er dagegen nicht in Aussicht. jd

An die Osteuropaforschung hat Olaf Scholz am 27. Februar 2022 garantiert nicht gedacht, als er von der Zeitenwende sprach. Begriff hin oder her, die Zäsur durch Russlands Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geht tief und fordert ein Umdenken, das in seiner Konsequenz viele unterschiedliche, letztendlich aber miteinander verbundene Bereiche tangiert. Diese Notwendigkeit macht auch vor der Osteuropaforschung nicht halt, die sich mit Fragen befasst, die den Krieg erklären helfen, die ihn empirisch dokumentiert und sich mit der Aufgabe konfrontiert sieht, die Ereignisse für die Öffentlichkeit einzuordnen und Wissenslücken zu füllen.
Schlagartig wurde nach dem 24. Februar 2022 herum klar, dass die Ukraine, Russland und die Region Osteuropa insgesamt, die sich genauen geografischen oder politischen Grenzziehungen entzieht, im öffentlichen Diskurs nicht präsent genug waren. Die Überraschung über Russlands Invasion war dementsprechend groß. Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits mit der Krim-Annexion 2014 begann, sich im Krieg im Donbas fortsetzte und 2022 in seine dritte Phase ging, wurde erst nach Beginn der Vollinvasion umfassender thematisiert.
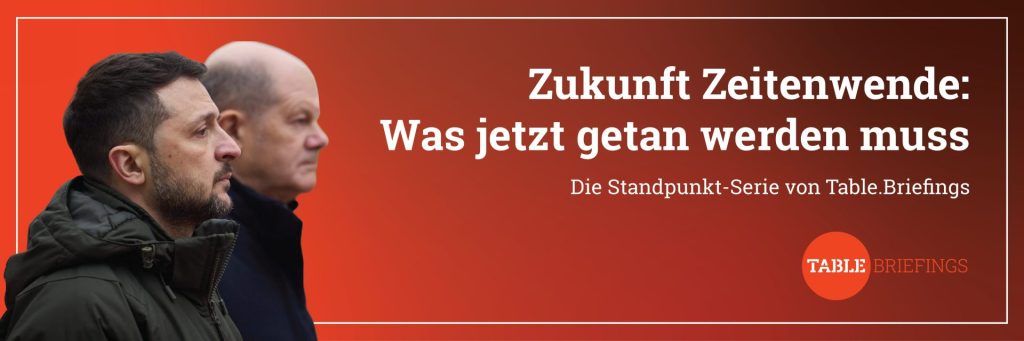
Osteuropa-Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Thinktanks wurden zu regelmäßigen Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien bis in die Talkshow-Formate hinein. Diverse Erklärformate, Podcasts und öffentliche Veranstaltungen von Forschungsinstituten, Bildungseinrichtungen und Stiftungen stießen auf großes Interesse. Inzwischen ist dieser Osteuropa-Boom schon wieder am Abklingen. Lernprozesse bleiben auch in Krisenzeiten ambivalent.
Ein langanhaltender Krieg scheint die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne zu überdehnen. Psychologische Mechanismen verdrängen zunehmend das Ausmaß und die Konsequenzen des Krieges, die weit über die Ukraine und Russland hinausgehen. Populistische Stimmenfänger am rechten und linken Rand des Parteienspektrums mobilisieren genau diesen Wunsch nach Abstand von der unschönen Realität. Die Wahlkämpfe auf Länderebene und jetzt der Bundestagswahlkampf zeigen in ihrer Akzentuierung von Frieden – wohlgemerkt ohne einen Plan, wie es zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine und Europa insgesamt kommen kann -, dass die Ukraine und Osteuropa mental weiterhin entfernter erscheinen als der Blick auf die Landkarte oder in die Geschichte suggeriert.
Das Feld der Osteuropaforschung ist und bleibt diffus. Es handelt sich um eine Schnittmenge aus Wissenschaftler*innen aus verschiedenen akademischen Disziplinen. Unter ihnen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften am prominentesten vertreten. Gemessen an der Zahl der Lehrstühle bringen die Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften mehr kritische Masse auf als die Sozialwissenschaften. Seit Februar 2022 hat sich an den Strukturen der Osteuropaforschung nur wenig verändert. Der dominante Russlandfokus in der Slawistik wird bestenfalls mittelfristig durch mehr Vielfalt ersetzt werden.
Die Professuren mit Osteuropa-Denomination sind auch nach Februar 2022 weiter rückläufig. Natürlich widmen sich nicht nur Lehrstühle mit entsprechendem Titel der Region. Es bedarf auch einer stärkeren Verankerung in der vergleichenden Forschung. Einschlägige Forschung findet auch an spezialisierten außeruniversitären Instituten statt. Es gab und gibt weiterhin Projektförderinitiativen mit Osteuropabezug, etwa vom BMBF oder Stiftungen, aber mit wenigen Ausnahmen lässt sich hier bisher keine systematische Priorisierung erkennen.
Eine Auswirkung des Krieges sind die erweiterten Netzwerke von Wissenschaftler*innen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen, einschließlich der Naturwissenschaften, zu den Auswirkungen des Krieges arbeiten. Die Präsenz geflüchteter Wissenschaftler*innen spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Aus persönlichen Netzwerken werden jedoch nicht automatisch nachhaltige Strukturen.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Relevanz Osteuropas für alle sichtbar unterstrichen, aber die finanziellen, strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Schlussfolgerungen sind weit offen. Somit ist es zu früh, von einer Zeitenwende in der Osteuropaforschung zu sprechen.
Gwendolyn Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für Vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
