der informelle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Budapest Ende nächster Woche wird voraussichtlich der letzte sein für den scheidenden Ratspräsidenten Charles Michel. Bevor er Anfang Dezember sein Amt an António Costa übergibt, mischt der Belgier die Vorbereitungen noch einmal kräftig auf.
Üblicherweise legt der Ratspräsident den EU-Botschaftern zunächst ein grobes Gerüst der Abschlusserklärung vor. Diesmal aber hat Michel gleich einen ausführlichen, neunseitigen Textentwurf erarbeitet. Sein Vorschlag für die “Budapest-Erklärung” zur Wettbewerbsfähigkeit der EU ist gespickt mit konkreten Forderungen. Michel wolle der Diskussion damit nochmal einen Schub geben, sagte sein Kabinettschef im Kreis der EU-Botschafter.
Allerdings habe Michel damit die Büchse der Pandora geöffnet, sagt ein EU-Diplomat. Denn die Formulierungen in der Erklärung sind für die Mitgliedstaaten aus ganz unterschiedlichen Gründen kaum akzeptabel: Die sparsamen Länder wollen nichts von neuen Geldtöpfen wie einem Souveränitätsfonds darin lesen, die Nettoempfängerländer verteidigen die Kohäsionsmittel, die “Freunde der Atomkraft” fordern deutlichere Worte dazu, usw.
Die Botschafter konnten sich daher bislang trotz stundenlanger Diskussionen nur auf wenig verständigen. Die Zeit wird knapp bis zum Gipfel, dem am Donnerstag noch ein Treffen mit den Nachbarstaaten im Rahmen der Europäischen Politischen Gemeinschaft vorausgeht: Es sind nur noch zwei weitere Sitzungen der Botschafter angesetzt, am Montag und Mittwoch. Einig sind sich die Mitgliedstaaten aber im Grunde darin, dass die “Budapest-Erklärung” kürzer und politischer werden soll, sprich: mehr Raum für Formelkompromisse lässt. Doch dagegen sträubt sich Michel.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Ratspräsident zum Ärger seiner Kollegen mit seinem Ehrgeiz die Gipfeldiskussionen verkompliziert, statt Kompromisse zu erleichtern. Womöglich aber wird die Debatte mit Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit am Freitagvormittag ohnehin überlagert vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Über die Konsequenzen daraus für die EU wollen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend beim Abendessen beraten. Je nach Auszählungsstand und erkennbarem Wahlsieger könnte die Diskussion aber noch mehr Raum einnehmen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenausklang!

Die Hearings starten am Montag (4. November) und gehen bis Dienstag die Woche darauf (12. November). Sie starten entweder um 9 Uhr morgens, 14:30 Uhr oder um 18:30 Uhr und dauern 180 Minuten. Bei jeweils zwei parallelen Anhörungen werden somit maximal sechs Kommissare an einem Tag angehört. Die Anhörungen finden in Brüssel in den Räumen 2Q2 und 4Q2 im ANTALL-Gebäude des EU-Parlaments statt – es gibt aber auch einen Livestream auf der Parlamentswebseite.
Am letzten Tag finden die vermeintlich wichtigsten Anhörungen statt: Dann prüft das Parlament nämlich die sechs designierten Exekutivvizepräsidenten der Kommission.
Die Anwärter werden von einem oder auch mehreren zuständigen Ausschüssen angehört. Weitere Ausschüsse können je nach fachlicher Relevanz dazu geladen werden, um mündliche Fragen zu stellen, erhalten jedoch kein Stimmrecht.
Die ersten 15 Minuten gehören den designierten Kommissaren für ein Eingangsstatement, anschließend beginnt die Fragerunde. Dabei bekommt jede Fraktion ein bestimmtes Zeitkontingent für die Fragen, das sie unter ihren Mitgliedern aufteilt. Für die Beantwortung haben die designierten Kommissare doppelt so viel Zeit wie die MEPs für ihre Fragen. Zum Abschluss können die Bewerber nochmals eine Erklärung abgeben.
Die Bewertung der designierten Kommissare findet direkt im Anschluss an die Hearings statt. Die Ausschusskoordinatoren der Fraktionen im zuständigen Ausschuss bzw. in den zuständigen Ausschüssen bewerten in einer nicht öffentlichen Sitzung, ob die Kandidaten für die ihnen zugeteilten Aufgaben geeignet sind. Es braucht eine Zweidrittel-Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder, um einen Kandidaten durchzuwinken oder abzulehnen.
Innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss der Bewertung übermitteln die Koordinatoren ein vertrauliches Empfehlungsschreiben. Dieses wird zunächst von der Konferenz der Ausschussvorsitze geprüft und anschließend zur weiteren Bearbeitung an die Konferenz der Präsidenten (Cop) weitergeleitet. Sobald die Cop alle Anhörungen bearbeitet hat, werden die Bewertungsschreiben veröffentlicht.
Kommt eine Zweidrittel-Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder nicht zustande, können weitere schriftliche Fragen eingereicht oder eine weitere 90-minütige Anhörung angesetzt werden. Für beide Optionen ist eine einfache Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder notwendig.
Kann die einfache Mehrheit der Koordinatoren ebenfalls nicht erreicht werden, wird in geheimer Abstimmung unter allen Ausschussmitgliedern über die Ernennung des Kommissars abgestimmt. Es reicht eine einfache Mehrheit. Es gibt aber auch Absprachen, gar nicht erst in die Verlängerung zu gehen, sollte es keine Zweidrittel-Mehrheit geben, sondern sofort nach der 180-Minuten-Anhörung ans Ende des Verfahrens zu springen und die Ausschüsse abstimmen zu lassen. Diese Überlegungen wurden nach Table.Briefings-Informationen bereits rechtlich geprüft.
Die Koordinatoren haben auch die Möglichkeit, Änderungen am Portfolio oder der Rolle innerhalb der Kommission einzufordern. Es liegt dann an der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ob sie dem Wunsch nachkommt, um eine Ablehnung des Kandidaten zu verhindern.
Entschließen sich die Ausschusskoordinatoren mit einer Zweidrittel-Mehrheit, einen Bewerber abzulehnen, muss der jeweilige Mitgliedstaat einen alternativen Kandidaten präsentieren. Dieser wird dann ebenfalls einem erneuten Hearing unterzogen, das erst noch angesetzt werden müsste. Die Ernennung der neuen Kommissare würde folglich verzögert werden, da das Parlament über das gesamte Personaltableau abstimmen wird. Der geplante Starttermin der neuen Kommission zum 1. Dezember wäre nicht zu halten.
Sollte sich ein Mitgliedstaat weigern, einen neuen Kandidaten zu nominieren, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, um das Land zu einer Nominierung zu zwingen.
Der ungarische Kommissaranwärter Olivér Várhelyi ist am stärksten gefährdet. Der designierte Gesundheitskommissar gilt für viele MEPs als rotes Tuch, nicht zuletzt, nachdem er die Abgeordneten einmal als “Idioten” bezeichnet hatte. Sozialdemokraten, Grüne und Linke dürften ihn grundheraus ablehnen, auch die EVP steht Várhelyi kritisch gegenüber. Ein Patzer im Hearing und der Ungar wird es schwer haben. Offen ist jedoch, wer aus Budapest an seine Stelle tritt und um wie lange eine Nachnominierung durch Viktor Orbán den Prozess bremsen würde.
Zu einem regelrechten “Shootout” könnte es am letzten Anhörungstag bei den Exekutivvizepräsidenten kommen. Sollten sich Sozialdemokraten und Liberale dazu entscheiden, den Italiener Raffaele Fitto zu blockieren, würden sie eine Zweidrittel-Mehrheit im REGI-Ausschuss verhindern. Die EVP, die den EKR-Kandidaten Fitto zwar unterstützt, müsste in einer Abstimmung allerdings auch mit den Rechten von PfE und ESN abstimmen, um den Italiener durchzubekommen. Entscheidet die EVP sich gegen eine gemeinsame Sache mit den Rechten und nimmt die Blockade Fittos hin, könnte sie als Vergeltungsmaßnahme die Sozialdemokratin Teresa Ribera und den Liberalen Stéphane Séjourné ebenfalls blockieren. Das Motto in den letzten Gesprächen vor den Anhörungen kommende Woche lautet also: Entweder alle oder keiner der drei.
Da sich die Kritiker Fittos vor allem an seinem Titel als Exekutivvize stören, könnte ein Kompromiss darin liegen, ihm diesen Titel wieder zu streichen und ihn lediglich zum Kohäsionskommissar zu machen. Dies läge in der Hand von der Leyens. Allerdings ist fraglich, ob sich die Kommissionspräsidentin darauf einlässt, da dies Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verärgern würde.
Es ist derzeit vorgesehen, dass die Abstimmung über das gesamte Personaltableau der neuen Kommission am 27. November in Straßburg stattfindet. Stimmt das EU-Parlament zu, werden die neuen Kommissare vom Rat mit qualifizierter Mehrheit offiziell ernannt. Ihr Amt würden die neuen Kommissare dann am 1. Dezember aufnehmen.
Sollte sich schon kommende Woche andeuten, dass Donald Trump die US-Wahl gewinnt, wird dies auch unmittelbare Auswirkungen auf die Anhörungen der EU-Kommissare haben. Die transatlantischen Beziehungen, Maßnahmen gegen von Trump angekündigte Zölle und die Zukunft der Ukraine-Unterstützung würden zwangsläufig Einzug in die Fragerunden an die Kommissaranwärter halten.
Die Auswahl der ersten strategischen Rohstoffprojekte auf Grundlage des Critical Raw Materials Acts (CRMA) verzögert sich. Statt bis spätestens Dezember, wie ursprünglich von der EU-Kommission geplant, wird der Prozess laut dem neuen Zeitplan bis Mitte März 2025 dauern, wie Table.Briefings erfuhr.
“Aufgrund der hohen Zahl der eingereichten Anträge hat die Kommission in der Tat den ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen für die Bearbeitung aller Anträge überarbeitet”, erklärte eine Sprecherin der Kommission. 170 Anträge seien bis zur Frist am 22. August eingegangen – ursprünglich hatte die Kommission mit rund 50 Anträgen gerechnet. Wie viele Projekte am Ende tatsächlich ausgewählt werden, stehe noch nicht fest.
Laut Informationen von Table.Briefings hat die Überprüfung der Anträge erst im Oktober begonnen; Anfang Februar 2025 will die Kommission eine vorläufige Auswahl vorlegen. Die finale Entscheidung soll bis zum 15. März fallen.
Im Jahr 2023 war der CRMA im Eiltempo verhandelt und verabschiedet worden. Denn für die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen für die Energiewende und Digitalisierung, etwa Lithium und Nickel für E-Auto-Batterien, ist die EU bislang stark von Importen abhängig, insbesondere aus China. Das Gesetz soll den Aufbau von Bergbau-, Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten in der EU regeln und anreizen, und so die einheimische Produktion und Importdiversifizierung von Rohstoffen voranbringen.
Strategische Projekte erhalten Vorrang bei der Genehmigung in den Behörden: Bei Bergbauprojekten etwa darf das Genehmigungsverfahren nicht länger als 27 Monate dauern, bei Verarbeitungs- und Recyclingprojekten nicht länger als 15 Monate. Die Projekte stehen rechtlich zudem im “überragenden öffentlichen Interesse”, wodurch Einwände aufgrund von Umwelt- oder Denkmalschutz vor Gericht erschwert werden.
Die Auswahl der ersten strategischen Projekte hatte die damalige Berichterstatterin im EU-Parlament, Nicola Beer, für den Sommer 2024 in Aussicht gestellt. Doch das Arbeitstempo bei der Anwendung hängt nun der hohen Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfahrens hinterher.
Beinahe drei Viertel der bis August bei der Kommission eingegangenen Projektanträge stammen aus der EU. Etwa ein Viertel reichten Partnerländer von außerhalb der EU ein. Nach Informationen von Table.Briefings stammen 13 der Anträge aus Deutschland, darunter Projekte aus allen vier Wertschöpfungsstufen.
Die Kommission sei nicht auf die hohe Anzahl an Anträgen vorbereitet gewesen, kritisiert Hildegard Bentele, EVP-Abgeordnete, die den CRMA mitverhandelt hat. Gerade wurde sie zur Vertreterin des Parlaments im Critical Raw Materials Board ernannt, das die EU-Kommission in der Projektauswahl berät und als Austauschplattform der Mitgliedstaaten dient. Das erste Arbeitstreffen findet im November statt; die Arbeit der Untergruppen hat bereits begonnen.
Die Verlängerung des Auswahlprozesses, so Bentele, sei nun notwendig, um jeden Antrag ausreichend prüfen zu können. “Die Verzögerung ist natürlich ärgerlich – gerade für die Projekte, die noch in der Finanzierungsphase stecken und Planungssicherheit brauchen”, sagte sie Table.Briefings. “Allerdings ist die Verschiebung auch Ausdruck des Erfolgs des Rohstoffgesetzes, denn die unerwartet hohe Anzahl an Anträgen zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben.”
“Wir bräuchten viel mehr Tempo”, fordert Anne Lauenroth, stellvertretende Abteilungsleiterin für Rohstoffe beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). “Der Aufbau europäischer Rohstoffkapazitäten, der mit Blick auf die Reduzierung unserer Abhängigkeiten eigentlich höchste Priorität haben sollte, verlangsamt sich.”
Michael Reckordt, Referent für Rohstoffpolitik bei der NGO Powershift, kritisiert fehlende Transparenz im Auswahlprozess: Es sei nicht klar, wie die EU-Kommission die Kriterien anwendet – ob sie also Versorgungssicherheit oder das Ziel, möglichst viele Projekte vorzuweisen, höher gewichtet als soziale und ökologische Kriterien.
“Informationen zu Bewerbungen erhalten wir als Zivilgesellschaft nur über Social Media-Seiten der Unternehmen“, erklärt er. “Die EU-Kommission hingegen ist vollkommen intransparent.” Dies hindere andere Akteure, weitere Informationen zu einzelnen Projekten einzubringen. “Die Bewertung der Projekte scheint auf den Eingaben der Unternehmen zu fußen. Das untergräbt die öffentliche Akzeptanz für diese Projekte noch weiter”, sagt Reckordt.
Zudem mangelt es aus seiner Perspektive an neutralen Experten: “Es gibt den berechtigten Verdacht, dass viele Gutachterinnen und Gutachter für die Bergbauindustrie tätig sind oder waren und daher in einem Interessenskonflikt stehen.” Dies erhöhe die Gefahr, gerade bei ökologischen und sozialen Themen weniger genau hinzusehen und Gefälligkeitsgutachten zu schreiben, erklärt er.
Lauenroth hält die Beteiligung von Experten auch aus der Industrie für sinnvoll: “Das Kriterium der Versorgungssicherheit sollte bei der Auswahl der strategischen Projekte im Fokus stehen”, sagt sie.
04.11.-05.11.2024
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)
Themen: Diskussion der Entlastung des Gesamthaushaltsplan der EU 2023; Diskussion des Jahresberichts 2023 zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union (Betrugsbekämpfung). Vorläufige Tagesordnung
04.11.2024 – 15:00 Uhr
Euro-Gruppe
Themen: Makroökonomische Entwicklungen und Bestandsaufnahme nach internationalen Treffen. Vorläufige Tagesordnung
05.11.2024 – 11:00 Uhr
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
Themen: Politische Einigung zum Paket “Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter”; Diskussion zu den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine; Diskussion zum Jahresbericht des Europäischen Fiskalausschusses. Vorläufige Tagesordnung
06.11.-07.11.2024
Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)
Themen: Meinungsaustausch mit dem Haushaltsausschuss des ukrainischen Parlaments (Verkhovna Rada); Diskussion mit EIB-Präsidentin Nadia Calviño über den mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027; Abstimmung zur Änderung der Satzung der EIB. Vorläufige Tagesordnung
07.11.2024
Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft
Themen: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft kommen am Vortag des EU-Gipfels zu Beratungen zusammen. Infos
08.11.2024
Europäischer Rat
Themen: Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen zu informellen Beratungen Budapest zusammen und wollen eine “Budapest Erklärung” über die Wettbewerbsfähigkeit der EU verabschieden. Infos
Der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU ist vorläufigen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr kräftig gesunken. Laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) gingen die Netto-Treibhausgasemissionen in der EU 2023 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent zurück. Das sei der größte jährliche Rückgang seit Jahrzehnten – mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020.
Die Wirtschaftszweige Energie und Industrie, die dem europäischen Emissionshandelssystem ETS unterliegen, hätten maßgeblich zu dem guten Ergebnis beigetragen. Die Reduzierung der Emissionen ist laut EEA zur Hälfte auf die Entwicklung des Energiesektors zurückführen. Dazu beigetragen habe
Auch im Industriebereich führten Effizienz- und Prozessverbesserungen zu einem Rückgang um sechs Prozent in 2023.
Andere Sektoren hätten hingegen Nachholbedarf bei der Emissionsreduktion.
Landwirtschaft und Transport sind durch die Lastenverteilungsverordnung ESR mit nationalen Minderungszielen belegt. Unter den großen ESR-geregelten Sektoren sei einzig im Baubereich ein signifikanter Rückgang um sechs Prozent zu verzeichnen, der allerdings eher durch moderate Wetterbedingungen mit weniger Heiz- und Kühlungsbedarf als durch die Installation von Wärmepumpen erreicht worden sei.
Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 weitgehend klimaneutral zu sein. Bis 2030 sollen die Emissionen verglichen mit denen des Jahres 1990 um 55 Prozent zurückgehen. Basierend auf bisherigen und geplanten Klimaschutzmaßnahmen erreicht die EU den Prognosen zufolge allerdings nur 43 bis 49 Prozent weniger Emissionen. av/mit dpa
Die EU-Kommission hat am 31. Oktober ein formelles Verfahren gegen die Online-Plattform Temu im Rahmen des Digital Services Act (DSA) eingeleitet. Der Schritt folgt auf eine vorläufige Bewertung von Temus Risikobewertungsbericht sowie auf Antworten von Temu zu den bisherigen Auskunftsersuchen der Kommission. Temu steht im Verdacht, gegen verschiedene Bestimmungen des DSA verstoßen zu haben.
Dringlich ist das Problem, weil Temu so rasant wächst. Das chinesische Unternehmen startete seine europäische Expansion im Jahr 2023. Die EU-Kommission stufte Temu im Mai 2024 als sehr große Online-Plattform (VLOP) ein. Im Februar hatte Temu angegeben, bereits 75 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU zu haben, inzwischen sind es 92 Millionen.
Die europäische Verbraucherorganisation BEUC begrüßte den Schritt der Kommission: “Es ist weder gegenüber den Verbrauchern noch gegenüber den vielen Unternehmen, die sich an die Vorschriften halten, fair, dass bestimmte Unternehmen wie Temu mit der Missachtung des Gesetzes davonkommen“, sagte Fernando Hortal Foronda, Digital Policy Officer bei BEUC.
Im Fokus der Untersuchung stehen der Verkauf illegaler Produkte, die potenziell suchtfördernde Gestaltung der Plattform, die Empfehlungsalgorithmen sowie der Zugang zu Daten für Forschende. Konkret prüft die Kommission:
Während des Verfahrens kann die Kommission zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel vorläufige Anordnungen oder Geldstrafen bei Nichtbefolgung ihrer Anweisungen. Hortal von BEUC betonte, dass die Kommission den Druck aufrechterhalten müsse, um sicherzustellen, dass Temu schnellstmöglich die Vorschriften einhält. Eine zeitliche Begrenzung für den Abschluss der Untersuchungen gibt es nicht.
Ein Vertreter der Kommission sagte, dass Temu gut mit der Kommission zusammenarbeite und auch schnell auf Anfragen reagiere. Zudem erwägt Temu, dem Memorandum of Understanding (MoU) zum Verkauf gefälschter Waren im Internet beizutreten. Das ist eine freiwillige Vereinbarung, die von der Europäischen Kommission unterstützt wird.
Die Unterzeichner arbeiten zusammen, um den Online-Verkauf gefälschter Produkte in Europa zu verhindern. Zu ihnen gehören unter anderem die Online-Händler Amazon, Alibaba und eBay sowie Marken wie Adidas, Nike, Hermes und Moncler. Nach Informationen von Reuters soll Temu auf einem Treffen der MoU-Mitglieder am 11. November als “potenzieller neuer Unterzeichner” eine Präsentation halten. vis
Die Gasspeicher der Europäischen Union sind wenige Wochen vor dem Winter gut gefüllt. Nach Angaben der Europäischen Kommission in Brüssel sind die Reservoirs der Mitgliedsstaaten aktuell zu rund 95 Prozent voll.
Damit übertrifft die Union eine selbstgesteckte Zielmarke: Infolge der Energiekrise durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten sich die Mitgliedsstaaten verordnet, dass ihre Gasspeicher jährlich bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein müssen.
Deutschland hatte sich mit 95 Prozent ein etwas höheres Ziel gesteckt. Laut Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber sind die deutschen Tanks aktuell zu rund 98 Prozent voll. dpa
Die Europäische Kommission hat ein Anti-Dumpingverfahren wegen Einfuhren von Cholinchlorid aus China eingeleitet. Eine entsprechende Bekanntgabe veröffentlichte sie dazu am Donnerstag. Das Nahrungsergänzungsmittel wird industriell für Schweine- und Geflügelfutter genutzt, um das Wachstum der Tiere zu fördern.
Das italienische Unternehmen Balchem Italia Srl und Taminco BV aus Belgien hatten am 17. September in Brüssel einen entsprechenden Antrag gestellt. Den Antragstellern zufolge ist es aufgrund nennenswerter Verzerrungen nicht angemessen, die Inlandspreise und -kosten in der Volksrepublik China zu verwenden. Sie legten Beweise dafür vor, dass die Menge und die Preise der eingeführten Ware auf die Verkaufsmengen, die in Rechnung gestellten Preise und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union negativ ausgewirkt hätten. Das habe wiederum die finanzielle Lage des EU-Wirtschaftszweigs sehr nachteilig beeinflusst, was eine Einleitung des Anti-Dumpingverfahrens legitimiere, heißt es weiter.
Die EU und China befinden sich aktuell im Handelszwist. Anfang des Monats hatte die Volksrepublik China vorübergehende Anti-Dumpingmaßnahmen gegen Branntweineineinfuhren aus der EU verhängt, was als Reaktion auf die zuvor angekündigten EU-Ausgleichszölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge verstanden wurde. mcl
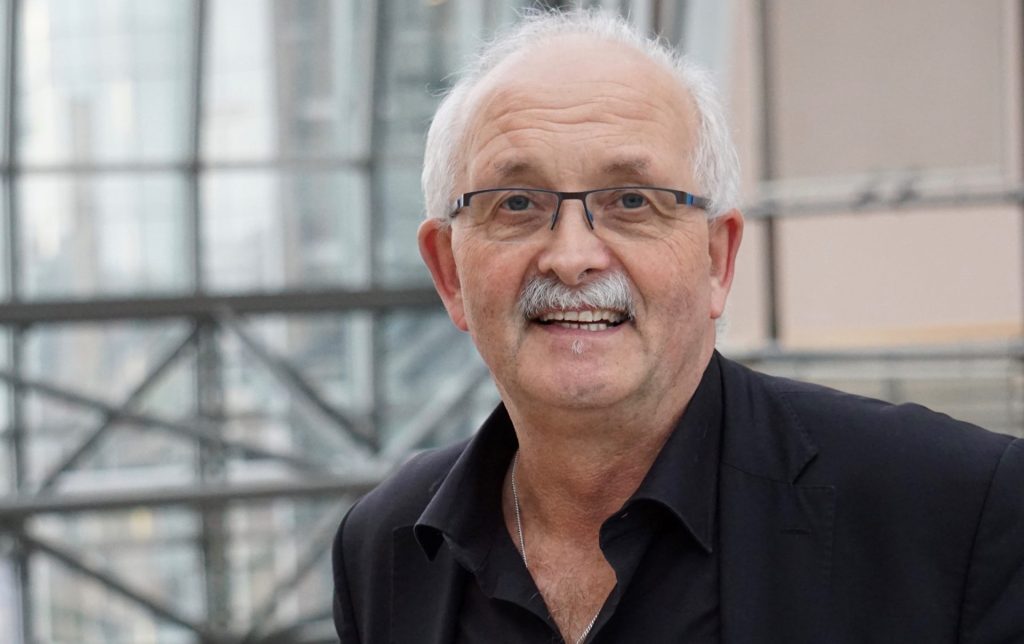
Josef Síkela, ein ehemaliger tschechischer Banker, soll im neuen Mandat Kommissar für Internationale Partnerschaften werden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat für ihn bereits einen Missionsbrief verfasst, in dem sie eine grundlegende Kursänderung für die Entwicklungspolitik der EU beschreibt.
Um die erwünschte “neue ökonomische Außenpolitik” zu fundieren, sollen die Mittel für die Global-Gateway-Initiative aufgestockt werden. Im Fokus dabei: die ökonomischen Eigeninteressen Europas. Ein Konzept, so die Lesart, das ebenfalls dem Wunsch der Entwicklungsländer nach mehr wirtschaftlicher Prosperität entspricht. Jozef Síkela, der bei der österreichischen Erste Group erfolgreich aufgestiegen ist, scheint mit seinem beruflichen Hintergrund wie geschaffen für den Job.
Schon heute ist ein zunehmend wachsender Anteil des 79,5 Milliarden Euro schweren siebenjährigen Topfs für Entwicklungspartnerschaft für Global-Gateway-Projekte vorgesehen. Die bisherigen Erfolge sind allerdings fragwürdig, wirtschaftlich wie entwicklungspolitisch, so das Fazit einer aktuellen Studie von Oxfam, Counterbalance und Eurodad.
Kein Zweifel, Infrastrukturinvestitionen spielen in vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle bei der Förderung integrativen Wachstums, der Verringerung der Armut und der Minderung von Ungleichheiten. Dennoch sind nicht alle Investitionen immer vorteilhaft für alle, wie die eklatante Ungleichverteilung des Reichtums und die fortschreitende Verarmung weiter Teile des Globalen Südens unterstreicht.
Statt alte Fehler zu wiederholen und auf vermeintliche Trickle-down-Erfolge zu setzten, sollte sich eine ehrliche Diskussion deshalb lieber auf die folgenden Fragen konzentrieren:
Führt die proklamierte Investitionsorientierung in der Tat zu einer Vertiefung nachhaltiger Wertschöpfungsketten in den Partnerländern oder kaschiert sie lediglich den Hunger des Nordens nach kritischen Rohstoffen vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund? Eine ernsthaft am gegenseitigen Nutzen orientierte Strategie wird ohne eine Stärkung der Schlüsselfaktoren Bildung und Gesundheit kaum auskommen. Kollektive Güter zugunsten breiter Bevölkerungsschichten, die Bekämpfung von Klimawandel und Ungleichheit sind es, die aus privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Investitionen erst gesellschaftliche Erfolge und soziale Stabilität erwachsen lassen. Beides sind dringend benötigte Voraussetzungen, um eine eigenständige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Bleibt die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 der UN die zentrale Kompassnadel, die mit Global Gateway effektiver wird oder läutet die “neue ökonomische Außenpolitik” eine Abkehr davon ein? Die Antwort auf diese Frage kann nicht durch verbale Bekenntnisse gegeben werden. Sie ist in der Konzeption der Projektlinien und den Modalitäten ihrer Umsetzung angelegt. Sind die Projekte anschlussfähig im Sinne einer selbsttragenden Entwicklung unserer Partnerländer, werden zivilgesellschaftliche Akteure hinreichend einbezogen und gibt es – neben der einflussreichen aus Unternehmensvertretern bestehenden Business Advisory Group – eine Stärkung bislang randständiger parlamentarischer Beteiligung?
Gute Partnerschaftsarbeit muss man an ihren Ergebnissen messen können. Die scheidende EU-Kommission hat deshalb bereits Instrumente etabliert – insbesondere den Inequality Marker – die helfen, sicherzustellen, dass Investitionen den schwächeren Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Diese Mechanismen müssen gestärkt und erweitert werden, auch weil eine Messbarkeit der Resultate den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der EU entspricht.
Will Síkela Erfolg haben, braucht Global Gateway 2.0 eine auf nachhaltige Zukunft gestellte konzeptionelle Ausrichtung, mehr Transparenz und demokratischere Beteiligungsverfahren. Nur dann würde ein solcher Ansatz der EU im geopolitischen Kontext wirklich helfen, sich im Globalen Süden zu profilieren. Anstelle Chinas Einfluss mit einer europäischen Kopie hinterher zu eifern, würde Europa seine komparativen Vorteile dort ausspielen, wo sie liegen: in der Beförderung gesellschaftlichen Fortschritts, der auf Eigenkompetenz, integrativem Wachstum und sozialer Teilhabe beruht – Werte unseres europäischen Sozialmodells, die in weiten Teilen der Welt weiterhin für Hoffnung und Erwartung stehen.
der informelle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Budapest Ende nächster Woche wird voraussichtlich der letzte sein für den scheidenden Ratspräsidenten Charles Michel. Bevor er Anfang Dezember sein Amt an António Costa übergibt, mischt der Belgier die Vorbereitungen noch einmal kräftig auf.
Üblicherweise legt der Ratspräsident den EU-Botschaftern zunächst ein grobes Gerüst der Abschlusserklärung vor. Diesmal aber hat Michel gleich einen ausführlichen, neunseitigen Textentwurf erarbeitet. Sein Vorschlag für die “Budapest-Erklärung” zur Wettbewerbsfähigkeit der EU ist gespickt mit konkreten Forderungen. Michel wolle der Diskussion damit nochmal einen Schub geben, sagte sein Kabinettschef im Kreis der EU-Botschafter.
Allerdings habe Michel damit die Büchse der Pandora geöffnet, sagt ein EU-Diplomat. Denn die Formulierungen in der Erklärung sind für die Mitgliedstaaten aus ganz unterschiedlichen Gründen kaum akzeptabel: Die sparsamen Länder wollen nichts von neuen Geldtöpfen wie einem Souveränitätsfonds darin lesen, die Nettoempfängerländer verteidigen die Kohäsionsmittel, die “Freunde der Atomkraft” fordern deutlichere Worte dazu, usw.
Die Botschafter konnten sich daher bislang trotz stundenlanger Diskussionen nur auf wenig verständigen. Die Zeit wird knapp bis zum Gipfel, dem am Donnerstag noch ein Treffen mit den Nachbarstaaten im Rahmen der Europäischen Politischen Gemeinschaft vorausgeht: Es sind nur noch zwei weitere Sitzungen der Botschafter angesetzt, am Montag und Mittwoch. Einig sind sich die Mitgliedstaaten aber im Grunde darin, dass die “Budapest-Erklärung” kürzer und politischer werden soll, sprich: mehr Raum für Formelkompromisse lässt. Doch dagegen sträubt sich Michel.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Ratspräsident zum Ärger seiner Kollegen mit seinem Ehrgeiz die Gipfeldiskussionen verkompliziert, statt Kompromisse zu erleichtern. Womöglich aber wird die Debatte mit Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit am Freitagvormittag ohnehin überlagert vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Über die Konsequenzen daraus für die EU wollen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend beim Abendessen beraten. Je nach Auszählungsstand und erkennbarem Wahlsieger könnte die Diskussion aber noch mehr Raum einnehmen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenausklang!

Die Hearings starten am Montag (4. November) und gehen bis Dienstag die Woche darauf (12. November). Sie starten entweder um 9 Uhr morgens, 14:30 Uhr oder um 18:30 Uhr und dauern 180 Minuten. Bei jeweils zwei parallelen Anhörungen werden somit maximal sechs Kommissare an einem Tag angehört. Die Anhörungen finden in Brüssel in den Räumen 2Q2 und 4Q2 im ANTALL-Gebäude des EU-Parlaments statt – es gibt aber auch einen Livestream auf der Parlamentswebseite.
Am letzten Tag finden die vermeintlich wichtigsten Anhörungen statt: Dann prüft das Parlament nämlich die sechs designierten Exekutivvizepräsidenten der Kommission.
Die Anwärter werden von einem oder auch mehreren zuständigen Ausschüssen angehört. Weitere Ausschüsse können je nach fachlicher Relevanz dazu geladen werden, um mündliche Fragen zu stellen, erhalten jedoch kein Stimmrecht.
Die ersten 15 Minuten gehören den designierten Kommissaren für ein Eingangsstatement, anschließend beginnt die Fragerunde. Dabei bekommt jede Fraktion ein bestimmtes Zeitkontingent für die Fragen, das sie unter ihren Mitgliedern aufteilt. Für die Beantwortung haben die designierten Kommissare doppelt so viel Zeit wie die MEPs für ihre Fragen. Zum Abschluss können die Bewerber nochmals eine Erklärung abgeben.
Die Bewertung der designierten Kommissare findet direkt im Anschluss an die Hearings statt. Die Ausschusskoordinatoren der Fraktionen im zuständigen Ausschuss bzw. in den zuständigen Ausschüssen bewerten in einer nicht öffentlichen Sitzung, ob die Kandidaten für die ihnen zugeteilten Aufgaben geeignet sind. Es braucht eine Zweidrittel-Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder, um einen Kandidaten durchzuwinken oder abzulehnen.
Innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss der Bewertung übermitteln die Koordinatoren ein vertrauliches Empfehlungsschreiben. Dieses wird zunächst von der Konferenz der Ausschussvorsitze geprüft und anschließend zur weiteren Bearbeitung an die Konferenz der Präsidenten (Cop) weitergeleitet. Sobald die Cop alle Anhörungen bearbeitet hat, werden die Bewertungsschreiben veröffentlicht.
Kommt eine Zweidrittel-Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder nicht zustande, können weitere schriftliche Fragen eingereicht oder eine weitere 90-minütige Anhörung angesetzt werden. Für beide Optionen ist eine einfache Mehrheit der durch die Koordinatoren vertretenen Ausschussmitglieder notwendig.
Kann die einfache Mehrheit der Koordinatoren ebenfalls nicht erreicht werden, wird in geheimer Abstimmung unter allen Ausschussmitgliedern über die Ernennung des Kommissars abgestimmt. Es reicht eine einfache Mehrheit. Es gibt aber auch Absprachen, gar nicht erst in die Verlängerung zu gehen, sollte es keine Zweidrittel-Mehrheit geben, sondern sofort nach der 180-Minuten-Anhörung ans Ende des Verfahrens zu springen und die Ausschüsse abstimmen zu lassen. Diese Überlegungen wurden nach Table.Briefings-Informationen bereits rechtlich geprüft.
Die Koordinatoren haben auch die Möglichkeit, Änderungen am Portfolio oder der Rolle innerhalb der Kommission einzufordern. Es liegt dann an der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ob sie dem Wunsch nachkommt, um eine Ablehnung des Kandidaten zu verhindern.
Entschließen sich die Ausschusskoordinatoren mit einer Zweidrittel-Mehrheit, einen Bewerber abzulehnen, muss der jeweilige Mitgliedstaat einen alternativen Kandidaten präsentieren. Dieser wird dann ebenfalls einem erneuten Hearing unterzogen, das erst noch angesetzt werden müsste. Die Ernennung der neuen Kommissare würde folglich verzögert werden, da das Parlament über das gesamte Personaltableau abstimmen wird. Der geplante Starttermin der neuen Kommission zum 1. Dezember wäre nicht zu halten.
Sollte sich ein Mitgliedstaat weigern, einen neuen Kandidaten zu nominieren, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, um das Land zu einer Nominierung zu zwingen.
Der ungarische Kommissaranwärter Olivér Várhelyi ist am stärksten gefährdet. Der designierte Gesundheitskommissar gilt für viele MEPs als rotes Tuch, nicht zuletzt, nachdem er die Abgeordneten einmal als “Idioten” bezeichnet hatte. Sozialdemokraten, Grüne und Linke dürften ihn grundheraus ablehnen, auch die EVP steht Várhelyi kritisch gegenüber. Ein Patzer im Hearing und der Ungar wird es schwer haben. Offen ist jedoch, wer aus Budapest an seine Stelle tritt und um wie lange eine Nachnominierung durch Viktor Orbán den Prozess bremsen würde.
Zu einem regelrechten “Shootout” könnte es am letzten Anhörungstag bei den Exekutivvizepräsidenten kommen. Sollten sich Sozialdemokraten und Liberale dazu entscheiden, den Italiener Raffaele Fitto zu blockieren, würden sie eine Zweidrittel-Mehrheit im REGI-Ausschuss verhindern. Die EVP, die den EKR-Kandidaten Fitto zwar unterstützt, müsste in einer Abstimmung allerdings auch mit den Rechten von PfE und ESN abstimmen, um den Italiener durchzubekommen. Entscheidet die EVP sich gegen eine gemeinsame Sache mit den Rechten und nimmt die Blockade Fittos hin, könnte sie als Vergeltungsmaßnahme die Sozialdemokratin Teresa Ribera und den Liberalen Stéphane Séjourné ebenfalls blockieren. Das Motto in den letzten Gesprächen vor den Anhörungen kommende Woche lautet also: Entweder alle oder keiner der drei.
Da sich die Kritiker Fittos vor allem an seinem Titel als Exekutivvize stören, könnte ein Kompromiss darin liegen, ihm diesen Titel wieder zu streichen und ihn lediglich zum Kohäsionskommissar zu machen. Dies läge in der Hand von der Leyens. Allerdings ist fraglich, ob sich die Kommissionspräsidentin darauf einlässt, da dies Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verärgern würde.
Es ist derzeit vorgesehen, dass die Abstimmung über das gesamte Personaltableau der neuen Kommission am 27. November in Straßburg stattfindet. Stimmt das EU-Parlament zu, werden die neuen Kommissare vom Rat mit qualifizierter Mehrheit offiziell ernannt. Ihr Amt würden die neuen Kommissare dann am 1. Dezember aufnehmen.
Sollte sich schon kommende Woche andeuten, dass Donald Trump die US-Wahl gewinnt, wird dies auch unmittelbare Auswirkungen auf die Anhörungen der EU-Kommissare haben. Die transatlantischen Beziehungen, Maßnahmen gegen von Trump angekündigte Zölle und die Zukunft der Ukraine-Unterstützung würden zwangsläufig Einzug in die Fragerunden an die Kommissaranwärter halten.
Die Auswahl der ersten strategischen Rohstoffprojekte auf Grundlage des Critical Raw Materials Acts (CRMA) verzögert sich. Statt bis spätestens Dezember, wie ursprünglich von der EU-Kommission geplant, wird der Prozess laut dem neuen Zeitplan bis Mitte März 2025 dauern, wie Table.Briefings erfuhr.
“Aufgrund der hohen Zahl der eingereichten Anträge hat die Kommission in der Tat den ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen für die Bearbeitung aller Anträge überarbeitet”, erklärte eine Sprecherin der Kommission. 170 Anträge seien bis zur Frist am 22. August eingegangen – ursprünglich hatte die Kommission mit rund 50 Anträgen gerechnet. Wie viele Projekte am Ende tatsächlich ausgewählt werden, stehe noch nicht fest.
Laut Informationen von Table.Briefings hat die Überprüfung der Anträge erst im Oktober begonnen; Anfang Februar 2025 will die Kommission eine vorläufige Auswahl vorlegen. Die finale Entscheidung soll bis zum 15. März fallen.
Im Jahr 2023 war der CRMA im Eiltempo verhandelt und verabschiedet worden. Denn für die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen für die Energiewende und Digitalisierung, etwa Lithium und Nickel für E-Auto-Batterien, ist die EU bislang stark von Importen abhängig, insbesondere aus China. Das Gesetz soll den Aufbau von Bergbau-, Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten in der EU regeln und anreizen, und so die einheimische Produktion und Importdiversifizierung von Rohstoffen voranbringen.
Strategische Projekte erhalten Vorrang bei der Genehmigung in den Behörden: Bei Bergbauprojekten etwa darf das Genehmigungsverfahren nicht länger als 27 Monate dauern, bei Verarbeitungs- und Recyclingprojekten nicht länger als 15 Monate. Die Projekte stehen rechtlich zudem im “überragenden öffentlichen Interesse”, wodurch Einwände aufgrund von Umwelt- oder Denkmalschutz vor Gericht erschwert werden.
Die Auswahl der ersten strategischen Projekte hatte die damalige Berichterstatterin im EU-Parlament, Nicola Beer, für den Sommer 2024 in Aussicht gestellt. Doch das Arbeitstempo bei der Anwendung hängt nun der hohen Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfahrens hinterher.
Beinahe drei Viertel der bis August bei der Kommission eingegangenen Projektanträge stammen aus der EU. Etwa ein Viertel reichten Partnerländer von außerhalb der EU ein. Nach Informationen von Table.Briefings stammen 13 der Anträge aus Deutschland, darunter Projekte aus allen vier Wertschöpfungsstufen.
Die Kommission sei nicht auf die hohe Anzahl an Anträgen vorbereitet gewesen, kritisiert Hildegard Bentele, EVP-Abgeordnete, die den CRMA mitverhandelt hat. Gerade wurde sie zur Vertreterin des Parlaments im Critical Raw Materials Board ernannt, das die EU-Kommission in der Projektauswahl berät und als Austauschplattform der Mitgliedstaaten dient. Das erste Arbeitstreffen findet im November statt; die Arbeit der Untergruppen hat bereits begonnen.
Die Verlängerung des Auswahlprozesses, so Bentele, sei nun notwendig, um jeden Antrag ausreichend prüfen zu können. “Die Verzögerung ist natürlich ärgerlich – gerade für die Projekte, die noch in der Finanzierungsphase stecken und Planungssicherheit brauchen”, sagte sie Table.Briefings. “Allerdings ist die Verschiebung auch Ausdruck des Erfolgs des Rohstoffgesetzes, denn die unerwartet hohe Anzahl an Anträgen zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben.”
“Wir bräuchten viel mehr Tempo”, fordert Anne Lauenroth, stellvertretende Abteilungsleiterin für Rohstoffe beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). “Der Aufbau europäischer Rohstoffkapazitäten, der mit Blick auf die Reduzierung unserer Abhängigkeiten eigentlich höchste Priorität haben sollte, verlangsamt sich.”
Michael Reckordt, Referent für Rohstoffpolitik bei der NGO Powershift, kritisiert fehlende Transparenz im Auswahlprozess: Es sei nicht klar, wie die EU-Kommission die Kriterien anwendet – ob sie also Versorgungssicherheit oder das Ziel, möglichst viele Projekte vorzuweisen, höher gewichtet als soziale und ökologische Kriterien.
“Informationen zu Bewerbungen erhalten wir als Zivilgesellschaft nur über Social Media-Seiten der Unternehmen“, erklärt er. “Die EU-Kommission hingegen ist vollkommen intransparent.” Dies hindere andere Akteure, weitere Informationen zu einzelnen Projekten einzubringen. “Die Bewertung der Projekte scheint auf den Eingaben der Unternehmen zu fußen. Das untergräbt die öffentliche Akzeptanz für diese Projekte noch weiter”, sagt Reckordt.
Zudem mangelt es aus seiner Perspektive an neutralen Experten: “Es gibt den berechtigten Verdacht, dass viele Gutachterinnen und Gutachter für die Bergbauindustrie tätig sind oder waren und daher in einem Interessenskonflikt stehen.” Dies erhöhe die Gefahr, gerade bei ökologischen und sozialen Themen weniger genau hinzusehen und Gefälligkeitsgutachten zu schreiben, erklärt er.
Lauenroth hält die Beteiligung von Experten auch aus der Industrie für sinnvoll: “Das Kriterium der Versorgungssicherheit sollte bei der Auswahl der strategischen Projekte im Fokus stehen”, sagt sie.
04.11.-05.11.2024
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)
Themen: Diskussion der Entlastung des Gesamthaushaltsplan der EU 2023; Diskussion des Jahresberichts 2023 zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union (Betrugsbekämpfung). Vorläufige Tagesordnung
04.11.2024 – 15:00 Uhr
Euro-Gruppe
Themen: Makroökonomische Entwicklungen und Bestandsaufnahme nach internationalen Treffen. Vorläufige Tagesordnung
05.11.2024 – 11:00 Uhr
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
Themen: Politische Einigung zum Paket “Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter”; Diskussion zu den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine; Diskussion zum Jahresbericht des Europäischen Fiskalausschusses. Vorläufige Tagesordnung
06.11.-07.11.2024
Sitzung des Haushaltsausschusses (BUDG)
Themen: Meinungsaustausch mit dem Haushaltsausschuss des ukrainischen Parlaments (Verkhovna Rada); Diskussion mit EIB-Präsidentin Nadia Calviño über den mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027; Abstimmung zur Änderung der Satzung der EIB. Vorläufige Tagesordnung
07.11.2024
Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft
Themen: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft kommen am Vortag des EU-Gipfels zu Beratungen zusammen. Infos
08.11.2024
Europäischer Rat
Themen: Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen zu informellen Beratungen Budapest zusammen und wollen eine “Budapest Erklärung” über die Wettbewerbsfähigkeit der EU verabschieden. Infos
Der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU ist vorläufigen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr kräftig gesunken. Laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) gingen die Netto-Treibhausgasemissionen in der EU 2023 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent zurück. Das sei der größte jährliche Rückgang seit Jahrzehnten – mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020.
Die Wirtschaftszweige Energie und Industrie, die dem europäischen Emissionshandelssystem ETS unterliegen, hätten maßgeblich zu dem guten Ergebnis beigetragen. Die Reduzierung der Emissionen ist laut EEA zur Hälfte auf die Entwicklung des Energiesektors zurückführen. Dazu beigetragen habe
Auch im Industriebereich führten Effizienz- und Prozessverbesserungen zu einem Rückgang um sechs Prozent in 2023.
Andere Sektoren hätten hingegen Nachholbedarf bei der Emissionsreduktion.
Landwirtschaft und Transport sind durch die Lastenverteilungsverordnung ESR mit nationalen Minderungszielen belegt. Unter den großen ESR-geregelten Sektoren sei einzig im Baubereich ein signifikanter Rückgang um sechs Prozent zu verzeichnen, der allerdings eher durch moderate Wetterbedingungen mit weniger Heiz- und Kühlungsbedarf als durch die Installation von Wärmepumpen erreicht worden sei.
Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 weitgehend klimaneutral zu sein. Bis 2030 sollen die Emissionen verglichen mit denen des Jahres 1990 um 55 Prozent zurückgehen. Basierend auf bisherigen und geplanten Klimaschutzmaßnahmen erreicht die EU den Prognosen zufolge allerdings nur 43 bis 49 Prozent weniger Emissionen. av/mit dpa
Die EU-Kommission hat am 31. Oktober ein formelles Verfahren gegen die Online-Plattform Temu im Rahmen des Digital Services Act (DSA) eingeleitet. Der Schritt folgt auf eine vorläufige Bewertung von Temus Risikobewertungsbericht sowie auf Antworten von Temu zu den bisherigen Auskunftsersuchen der Kommission. Temu steht im Verdacht, gegen verschiedene Bestimmungen des DSA verstoßen zu haben.
Dringlich ist das Problem, weil Temu so rasant wächst. Das chinesische Unternehmen startete seine europäische Expansion im Jahr 2023. Die EU-Kommission stufte Temu im Mai 2024 als sehr große Online-Plattform (VLOP) ein. Im Februar hatte Temu angegeben, bereits 75 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU zu haben, inzwischen sind es 92 Millionen.
Die europäische Verbraucherorganisation BEUC begrüßte den Schritt der Kommission: “Es ist weder gegenüber den Verbrauchern noch gegenüber den vielen Unternehmen, die sich an die Vorschriften halten, fair, dass bestimmte Unternehmen wie Temu mit der Missachtung des Gesetzes davonkommen“, sagte Fernando Hortal Foronda, Digital Policy Officer bei BEUC.
Im Fokus der Untersuchung stehen der Verkauf illegaler Produkte, die potenziell suchtfördernde Gestaltung der Plattform, die Empfehlungsalgorithmen sowie der Zugang zu Daten für Forschende. Konkret prüft die Kommission:
Während des Verfahrens kann die Kommission zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel vorläufige Anordnungen oder Geldstrafen bei Nichtbefolgung ihrer Anweisungen. Hortal von BEUC betonte, dass die Kommission den Druck aufrechterhalten müsse, um sicherzustellen, dass Temu schnellstmöglich die Vorschriften einhält. Eine zeitliche Begrenzung für den Abschluss der Untersuchungen gibt es nicht.
Ein Vertreter der Kommission sagte, dass Temu gut mit der Kommission zusammenarbeite und auch schnell auf Anfragen reagiere. Zudem erwägt Temu, dem Memorandum of Understanding (MoU) zum Verkauf gefälschter Waren im Internet beizutreten. Das ist eine freiwillige Vereinbarung, die von der Europäischen Kommission unterstützt wird.
Die Unterzeichner arbeiten zusammen, um den Online-Verkauf gefälschter Produkte in Europa zu verhindern. Zu ihnen gehören unter anderem die Online-Händler Amazon, Alibaba und eBay sowie Marken wie Adidas, Nike, Hermes und Moncler. Nach Informationen von Reuters soll Temu auf einem Treffen der MoU-Mitglieder am 11. November als “potenzieller neuer Unterzeichner” eine Präsentation halten. vis
Die Gasspeicher der Europäischen Union sind wenige Wochen vor dem Winter gut gefüllt. Nach Angaben der Europäischen Kommission in Brüssel sind die Reservoirs der Mitgliedsstaaten aktuell zu rund 95 Prozent voll.
Damit übertrifft die Union eine selbstgesteckte Zielmarke: Infolge der Energiekrise durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten sich die Mitgliedsstaaten verordnet, dass ihre Gasspeicher jährlich bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein müssen.
Deutschland hatte sich mit 95 Prozent ein etwas höheres Ziel gesteckt. Laut Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber sind die deutschen Tanks aktuell zu rund 98 Prozent voll. dpa
Die Europäische Kommission hat ein Anti-Dumpingverfahren wegen Einfuhren von Cholinchlorid aus China eingeleitet. Eine entsprechende Bekanntgabe veröffentlichte sie dazu am Donnerstag. Das Nahrungsergänzungsmittel wird industriell für Schweine- und Geflügelfutter genutzt, um das Wachstum der Tiere zu fördern.
Das italienische Unternehmen Balchem Italia Srl und Taminco BV aus Belgien hatten am 17. September in Brüssel einen entsprechenden Antrag gestellt. Den Antragstellern zufolge ist es aufgrund nennenswerter Verzerrungen nicht angemessen, die Inlandspreise und -kosten in der Volksrepublik China zu verwenden. Sie legten Beweise dafür vor, dass die Menge und die Preise der eingeführten Ware auf die Verkaufsmengen, die in Rechnung gestellten Preise und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union negativ ausgewirkt hätten. Das habe wiederum die finanzielle Lage des EU-Wirtschaftszweigs sehr nachteilig beeinflusst, was eine Einleitung des Anti-Dumpingverfahrens legitimiere, heißt es weiter.
Die EU und China befinden sich aktuell im Handelszwist. Anfang des Monats hatte die Volksrepublik China vorübergehende Anti-Dumpingmaßnahmen gegen Branntweineineinfuhren aus der EU verhängt, was als Reaktion auf die zuvor angekündigten EU-Ausgleichszölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge verstanden wurde. mcl
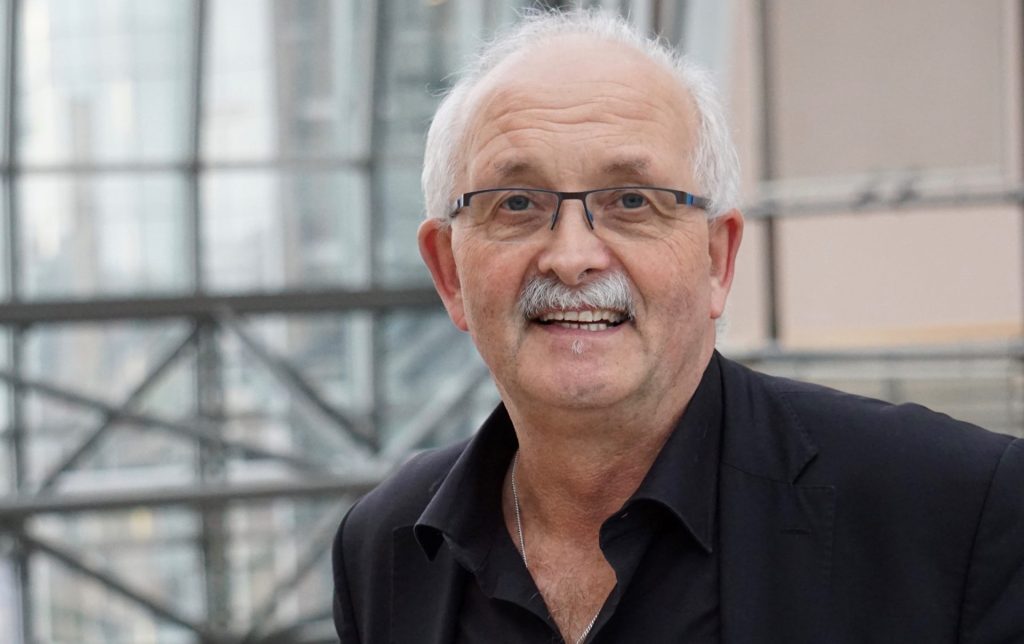
Josef Síkela, ein ehemaliger tschechischer Banker, soll im neuen Mandat Kommissar für Internationale Partnerschaften werden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat für ihn bereits einen Missionsbrief verfasst, in dem sie eine grundlegende Kursänderung für die Entwicklungspolitik der EU beschreibt.
Um die erwünschte “neue ökonomische Außenpolitik” zu fundieren, sollen die Mittel für die Global-Gateway-Initiative aufgestockt werden. Im Fokus dabei: die ökonomischen Eigeninteressen Europas. Ein Konzept, so die Lesart, das ebenfalls dem Wunsch der Entwicklungsländer nach mehr wirtschaftlicher Prosperität entspricht. Jozef Síkela, der bei der österreichischen Erste Group erfolgreich aufgestiegen ist, scheint mit seinem beruflichen Hintergrund wie geschaffen für den Job.
Schon heute ist ein zunehmend wachsender Anteil des 79,5 Milliarden Euro schweren siebenjährigen Topfs für Entwicklungspartnerschaft für Global-Gateway-Projekte vorgesehen. Die bisherigen Erfolge sind allerdings fragwürdig, wirtschaftlich wie entwicklungspolitisch, so das Fazit einer aktuellen Studie von Oxfam, Counterbalance und Eurodad.
Kein Zweifel, Infrastrukturinvestitionen spielen in vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle bei der Förderung integrativen Wachstums, der Verringerung der Armut und der Minderung von Ungleichheiten. Dennoch sind nicht alle Investitionen immer vorteilhaft für alle, wie die eklatante Ungleichverteilung des Reichtums und die fortschreitende Verarmung weiter Teile des Globalen Südens unterstreicht.
Statt alte Fehler zu wiederholen und auf vermeintliche Trickle-down-Erfolge zu setzten, sollte sich eine ehrliche Diskussion deshalb lieber auf die folgenden Fragen konzentrieren:
Führt die proklamierte Investitionsorientierung in der Tat zu einer Vertiefung nachhaltiger Wertschöpfungsketten in den Partnerländern oder kaschiert sie lediglich den Hunger des Nordens nach kritischen Rohstoffen vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund? Eine ernsthaft am gegenseitigen Nutzen orientierte Strategie wird ohne eine Stärkung der Schlüsselfaktoren Bildung und Gesundheit kaum auskommen. Kollektive Güter zugunsten breiter Bevölkerungsschichten, die Bekämpfung von Klimawandel und Ungleichheit sind es, die aus privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Investitionen erst gesellschaftliche Erfolge und soziale Stabilität erwachsen lassen. Beides sind dringend benötigte Voraussetzungen, um eine eigenständige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Bleibt die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 der UN die zentrale Kompassnadel, die mit Global Gateway effektiver wird oder läutet die “neue ökonomische Außenpolitik” eine Abkehr davon ein? Die Antwort auf diese Frage kann nicht durch verbale Bekenntnisse gegeben werden. Sie ist in der Konzeption der Projektlinien und den Modalitäten ihrer Umsetzung angelegt. Sind die Projekte anschlussfähig im Sinne einer selbsttragenden Entwicklung unserer Partnerländer, werden zivilgesellschaftliche Akteure hinreichend einbezogen und gibt es – neben der einflussreichen aus Unternehmensvertretern bestehenden Business Advisory Group – eine Stärkung bislang randständiger parlamentarischer Beteiligung?
Gute Partnerschaftsarbeit muss man an ihren Ergebnissen messen können. Die scheidende EU-Kommission hat deshalb bereits Instrumente etabliert – insbesondere den Inequality Marker – die helfen, sicherzustellen, dass Investitionen den schwächeren Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Diese Mechanismen müssen gestärkt und erweitert werden, auch weil eine Messbarkeit der Resultate den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der EU entspricht.
Will Síkela Erfolg haben, braucht Global Gateway 2.0 eine auf nachhaltige Zukunft gestellte konzeptionelle Ausrichtung, mehr Transparenz und demokratischere Beteiligungsverfahren. Nur dann würde ein solcher Ansatz der EU im geopolitischen Kontext wirklich helfen, sich im Globalen Süden zu profilieren. Anstelle Chinas Einfluss mit einer europäischen Kopie hinterher zu eifern, würde Europa seine komparativen Vorteile dort ausspielen, wo sie liegen: in der Beförderung gesellschaftlichen Fortschritts, der auf Eigenkompetenz, integrativem Wachstum und sozialer Teilhabe beruht – Werte unseres europäischen Sozialmodells, die in weiten Teilen der Welt weiterhin für Hoffnung und Erwartung stehen.
