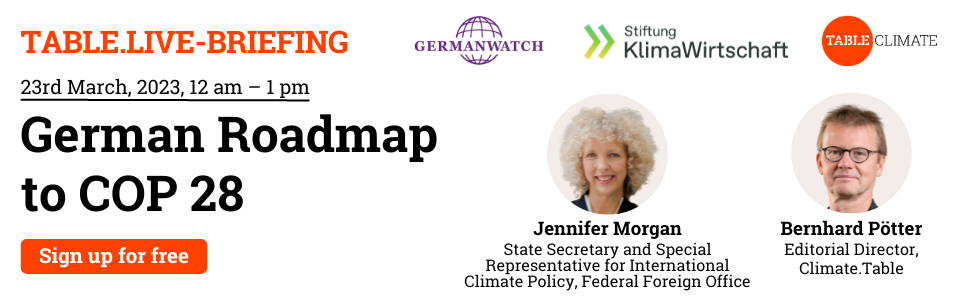das war es also mit der fröhlichen Ausgabenpolitik auf Pump. Ende des Jahres läuft die Corona-bedingte Ausnahmeregel für Schulden aus, das haben Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis nun offiziell angekündigt. An Investitionen solle aber kein Staat sparen, finden die beiden. Wie sie sich das vorstellen, das berichtet Christof Roche.
Eine weitere Baustelle: das Sorgfaltspflichtengesetz. Ginge es nach dem Rat, würde die Finanzbranche fast gänzlich von den Regeln ausgenommen. Autorin Charlotte Wirth analysiert am Beispiel eines mexikanischen Unternehmens, das mit einer Luxemburger Finanzholding verbandelt ist, wieso diese Ausnahme problematisch sein kann, und zwar.
Das hatte sich angedeutet: Der Europäische Rechnungshof hat gestern mangelnde Kontrollen der Ausgaben bei der Aufbau- und Resilienzfazilität kritisiert. In einer Untersuchung habe er “bezüglich der Gewährleistung und der Rechenschaftspflicht beim Schutz der finanziellen Interessen der EU eine Lücke festgestellt“. Mehr dazu in unserer News.
Übrigens: Autorin Charlotte Wirth macht gerade noch in anderer Hinsicht von sich reden. Sie erhielt eine “besondere Erwähnung” beim luxemburgischen Amnesty Medienpreis 2023 in der Kategorie Artikel. Und zwar mit ihrer Recherche zu ruandischen Kriegsverbrechern, die sich in Belgien aufhalten, dort Politik und Vereine infiltrieren und deren Spuren auch nach Luxemburg führen. Wir gratulieren!

Die Europäische Kommission lässt die Aussetzung der Schuldenregeln zum Jahresende auslaufen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte in Brüssel, es sei richtig gewesen, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt verankerte sogenannte Escape Clause im Frühjahr 2020 auszulösen. Dies habe den Mitgliedstaaten ermöglicht, “die durch COVID-19 und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachten wirtschaftlichen Schocks abzufedern”. Inzwischen habe sich die Konjunktur in Europa wieder stabilisiert, trotz nach wie vor hoher Unsicherheit, sodass die Deaktivierung der Ausweichklausel in Ordnung gehe.
EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis unterstrich in diesem Zusammenhang, die Kommission werde im laufenden Jahr keine Defizitverfahren gegen Mitgliedstaaten mit überhöhter Neuverschuldung starten. Dies werde aber, wo nötig, im Frühjahr 2024 geschehen. Die beiden Kommissare machten ihre Äußerungen anlässlich von Leitlinien, die die Brüsseler Behörde zur Durchführung und Koordinierung der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten im nächsten Jahr vorgelegt hat. Die Leitlinien kommen zu einem Zeitpunkt, an dem über eine Neuausrichtung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verhandelt wird. Bis das neue Fiskalregelwerk in Kraft tritt, gelten noch die aktuellen Schuldenregeln.
Gentiloni unterstrich, Elemente der Reform sollten allerdings bereits im Zyklus der aktuellen haushaltspolitischen Überwachung in die nationalen Stabilitäts- und Konvergenzprogramme einfließen, “um eine wirksame Brücke zu den künftigen Haushaltsregeln zu ermöglichen und den aktuellen Herausforderungen Rechnung zu tragen”. Der Italiener betonte, die Kommission werde in ihre länderspezifischen Haushaltsempfehlungen für 2024, die für Mai avisiert sind, “quantitative Vorgaben sowie qualitative Leitlinien für Investitions- und Energiemaßnahmen integrieren, im Einklang mit den Reformorientierungen der Kommission“.
Dabei sollen die Empfehlungen auf Grundlage der Nettoprimärausgaben formuliert und entsprechend den Herausforderungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Schuldentragfähigkeit differenziert werden. In Kreisen der Kommission hieß es, die Empfehlungen sollen sich über einen mittelfristigen Zeitraum von vier Jahren erstrecken. Die im aktuellen Fiskalregime verankerte sogenannte 1/20-Regel zur Schuldenreduzierung werde nicht zur Anwendung kommen.
In den Kreisen hieß es weiter, sollte es im kommenden Jahr zu Eröffnung eines Defizitverfahrens wegen überhöhter Neuverschuldung gegen Mitgliedstaaten kommen, dürfte sich die Vorgabe zur Reduzierung an der aktuellen Größenordnung im Stabilitätspakt orientieren. Es gebe zwar noch keine fixierte Vorgabe zum Defizitabbau, da die Reform noch ausstehe, aber die Verringerung dürfte vergleichbar sein mit dem Abbau des strukturellen Defizits in der Größenordnung von mindestens 0,5 Prozent im aktuellen Defizitverfahren. Die Kreise machten zudem deutlich, dass es im kommenden Jahr auf keinen Fall eine Eröffnung von Defizitverfahren aufgrund der Schuldenquote eines Landes geben werde.
Gentiloni hob noch einmal hervor, die Mitgliedstaaten sollten ihre Haushaltsanpassungen “nicht durch Investitionskürzungen, sondern durch eine Begrenzung der laufenden Ausgaben erreichen“. Spielraum hätten die Länder besonders bei den Maßnahmen, die sie zur sozialen und wirtschaftlichen Abfederung der Energiekrise eingeführt hatten. Jetzt, da der Energiepreisdruck nachlasse, sollten die Mitgliedstaaten diese Stützungsmaßnahmen auslaufen lassen, beginnend “mit denen, die wenig zielgerichtet sind oder das Preissignal verzerren”. Der Wirtschaftskommissar machte deutlich, im vergangenen Jahr hätten die Stützungsmaßnahmen 1,2 % des EU-Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht.
Dies sei mit erheblichen Kosten verbunden. Hätte man die Hilfsmaßnahmen auf die tatsächlichen Notfälle konzentriert, hätte der Aufwand nach Berechnung der EU-Kommission lediglich 0,3 Prozent des EU-BIP betragen. Mit Blick auf die Reform der europäischen Schuldenregeln kündigte Vizepräsident Dombrovskis an, die Kommission werde das Gesetzespaket für das neue EU-Fiskalregelwerk zeitnah nach dem nächsten EU-Gipfel vorlegen, der für den 23./24. März angesetzt ist. In den Kreisen der Behörde hieß es, die Verhandlungen würden sich voraussichtlich bis ins nächste Jahr ziehen. Sie sollten aber vor der kommenden Wahl zum neuen Europaparlament im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein

Das Parlament verhandelt noch, der Rat konnte sich dagegen bereits im Dezember auf eine gemeinsame Ausrichtung zum Sorgfaltspflichtengesetz einigen. Auf den Druck Frankreichs hin hat er eine Sonderrolle für die Finanzbranche beschlossen. Der Text, auf den sich die EU27 Ende einigten, ist so undurchsichtig, wie es immer dann der Fall ist, wenn ein Kompromiss nur mit Ach und Krach durchgedrückt werden konnte.
So viel ist jedoch klar:
Die weitreichenden Ausnahmen für die Finanzbranche überraschen. Gerade sie hat großen Einfluss auf die globalen Wertschöpfungsketten. Die Kommission hob noch in ihrer Machbarkeitsstudie zum Due Diligence Gesetz die Rolle der Finanzbranche “in der Finanzierung und Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten in nahezu jedem anderen Wirtschaftszweig” hervor. Aufgrund dieses Einflusses gilt der Finanzsektor in den UN-Leitlinien für nachhaltige Unternehmensführung beispielsweise als Risikobranche.
Doch was bedeutet es konkret, wenn für die Finanzbranche nur sehr abgeschwächte Sorgfaltspflichten gelten? Ein Blick auf den Finanzplatz Luxemburg liefert ein aktuelles Beispiel.
Es führt uns nach Mexiko. Dort sind vor einigen Wochen zwei Menschenrechtsaktivisten verschwunden, der Menschenrechtsanwalt Ricardo Arturo Lagunes Gasca und der Vertreter der indigenen Aquila-Gemeinschaft, Antonio Díaz Valencia.
Beide wurden nicht mehr gesehen, nachdem sie vor rund einem Monat von einem Meeting mit dem Minenbetreiber Ternium und der Aquila-Gemeinschaft nach Hause aufgebrochen waren. Ihr Auto ist verlassen gefunden worden. Es war von Kugeln durchlöchert. Die Angehörigen sind sicher: Ternium sei in ihr Verschwinden involviert. Der Konzern habe die Aktivisten früher bedroht. Ternium bestreitet die Vorwürfe.
Ternium Mexiko befindet sich seit Jahren im Streit mit der indigenen Gemeinschaft, auf dessen Gebiet das Unternehmen mehrere Minen betreibt. Viele Anwohner wurden aufgrund der Projekte Terniums umgesiedelt. Nur ein Teil von ihnen wurde von dem Unternehmen entschädigt. Und das, obwohl es ein entsprechendes Abkommen mit dem Minenunternehmen gab.
Der verschwundene Anwalt Lagunes Gasca vertrat bisher die Familien im Streit gegen den Stahlkonzern und machte Ternium für Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
“Es handelt sich um einen klassischen Fall von ‘teile und herrsche’, wie wir sie immer wieder sehen. Ein Unternehmen stiftet Streit zwischen betroffenen Gemeinschaften, um seine Ziele besser durchsetzen zu können”, sagt Antoniya Argirova von der Luxemburger NGO-Koalition “Initiative pour un devoir de vigilance” (Initiative für Sorgfaltspflichten) gegenüber Table.Media. Sie steht mit der Anwältin der Familien der verschwundenen Aktivisten in Kontakt.
Ternium Mexiko ist eine Tochtergesellschaft von Ternium SA, einer Luxemburger Finanzholdinggesellschaft (SOPARFI). Diese gehört wiederum der italo-argentinischen Gruppe Techint, die ebenfalls als Holding in Luxemburg angesiedelt ist.
Luxemburg sieht sich im Fall der verschwundenen Aktivisten allerdings nur bedingt als zuständig: Man habe Ternium SA in einem Brief an seine Sorgfaltspflichten unter anderem im Rahmen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen erinnert, allerdings sei Luxemburg im Rahmen dieser Leitsätze nicht für Ternium zuständig, sondern Mexiko, – schließlich betreffe der Fall Ternium die mexikanische Tochtergesellschaft, sagt das Finanzministerium.
Der Fall Ternium zeigt, wie schwer es ist, die Verantwortlichkeit in Unternehmensgeflechten konkret festzumachen. Denn alles hängt an der Frage, wer Sorgfaltspflicht leisten muss: das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe? Im Ratsmandat bleibt die Klärung dieser Frage den Mitgliedstaaten überlassen.
Für Luxemburg ist die Auslegung des Sorgfaltspflichtengesetzes besonders kritisch: Denn nur 0,1 Prozent der dort ansässigen Unternehmen würden auf Basis ihrer Mitarbeiterzahl und Umsatzes unter das Gesetz fallen. Gleichzeitig sind aber mehrere Tausend Holdinggesellschaften und Investmentfonds im Großherzogtum angesiedelt. Sie verwalten Vermögenswerte von über 5.000 Milliarden Euro. Und doch sollen sie gemäß dem Ratsmandat von dem Gesetz ausgenommen werden.
Fälle wie Ternium gibt es in Luxemburg etliche. Da wäre der Pegasus-Skandel um das israelische Unternehmen NSO, das wiederum mit den Luxemburger Holdings Q Cyber Technologies und Osy Technologies zusammenhängt. Die Luxemburger Holding Kernel, die in der Ukraine für Landraub verantwortlich ist, sowie der Fleischkonzern JBS, dem Korruption und illegale Rodungen vorgeworfen und von dem große Teile des Konzerns aus Luxemburg verwaltet werden. Bei allen genannten dürfte die Frage, wer letztlich verantwortlich ist, schwer zu klären sein.
Das Problem ist, dass in Luxemburg große Holdinggesellschaften die Rolle der Unternehmensgruppe übernehmen, sagt Charles Muller von Finance and Human Rights gegenüber Table.Media. Der Vermögensverwalter und Anwalt vertrat früher die Luxemburger Fondsindustrie ALFI, heute setzt er sich für die Wahrung von Menschenrechten in der Luxemburger Finanzbranche ein. Für ihn steht fest: In Fällen wie Ternium müsse die Verantwortung bei den Finanzholdinggesellschaften liegen. “Ihr Verwaltungsrat tagt in Luxemburg. Er entscheidet, was in den Tochtergesellschaften passiert.”
Für Muller ist schwer nachvollziehbar, wieso die EU27 die Finanzbranche ausnehmen wollen. “Wenn man etwas verändern will, muss man dort agieren, wo die Gelder herkommen, Aktien gekauft werden, Kredite ausgegeben werden. Man landet immer wieder bei der Fondsindustrie.”
Hinzu kommt, dass Finanzdienstleister bereits jetzt Sorgfaltspflicht einhalten, um beispielsweise die EU-Regeln im Bereich Korruption und Geldwäsche umzusetzen. Die EU-Gesetzgebung geht etwa so weit, dass Finanzdienstleister sicherstellen müssen, dass sie keine Gelder verwalten, die aus Zwangsarbeit stammen.
Dass die Finanzbranche in der Lage ist, ihre Sorgfaltspflicht auf die Bereiche Menschenrechte und Umwelt auszudehnen, zeigt die “Sustainable Finance and Human Rights Survey“. Es handelt sich um eine Umfrage, die 2020 und 2022 vom Luxemburger Finanzministerium in Auftrag gegeben wurde. Dort geben 87 Prozent der großen Finanzakteure in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, Schweiz und Großbritannien an, dass sie es begrüßen würden, ihre Gesetzgebung zur Wahrung der Menschenrechte zu verschärfen. Die meisten betonten zudem, dass sie auf entsprechende Auflagen gut vorbereitet seien.
Es stellt sich aber die Frage, ob ein Land wie Luxemburg tausende Finanzgesellschaften auf ihre Menschenrechts-Sorgfaltspflichten hin kontrollieren könnte. Die OECD-Kontaktstelle der Leitlinie für multinationale Unternehmen beschäftigte lange Zeit nur eine Halbtagsstelle. Inzwischen kam eine Person dazu.
Frankreich hat sich noch stärker als Luxemburg gegen die Inklusion des Finanzsektors stark gemacht. So sehr, dass Paris sogar drohte, die allgemeine Ausrichtung im Rat zu blockieren. Ursachen gibt es mehrere.
Die Regierung weiß um das Problem, Verantwortlichkeit zu verorten. In einer Evaluierung des Gesetzes von 2020 schreibt das französische Wirtschaftsministerium: “Anhand der Daten des Handelsgerichts kann nicht festgestellt werden, ob einzelne Unternehmen Teil einer größeren Gruppe sind.” Und weiter: “Bei ausländischen Unternehmen ist es aufgrund ihrer steuerlichen Eingliederung in einen internationalen Konzern nicht möglich, den einzigen französischen Teil zu identifizieren, der von dem Gesetz betroffen sein könnte.”
Auch der Brexit wird immer wieder als Grund für Frankreichs Vorstoß genannt. Denn seitdem will Paris London als einen der weltweit wichtigsten Finanzzentren ablösen und internationale Asset-Manager anziehen. Eine strengere Regulierung käme deswegen zum unpassenden Zeitpunkt.
10.03.2023 – 10:00-10:45 Uhr, online
BEUC, Briefing How to better protect consumers from electricity supplier malpractices
The European Consumer Organisation (BEUC) discusses steps to better protect and educate energy market consumers. INFOS & REGISTRATION
10.03.2023 – 10:15-16:00 Uhr, Haiger
Eco, Konferenz IIoT in der Praxis – Essenzielle Bausteine der Industrie 4.0
Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) diskutiert die wegweisenden Themenschwerpunkte für die Industrie 4.0. INFOS & ANMELDUNG
12.03.-14.03.2023, Belo Horizonte (Brasilien)
BDI Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2023
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert Themen wie erneuerbare Energien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern. INFOS & ANMELDUNG
13.03.2023 – 18:00 Uhr, Berlin/online
Forum eHealth, Seminar Digitale Identitäten im Gesundheitswesen
Das Forum eHealth präsentiert den aktuellen Stand und Ausblick zur Gesundheits-ID. INFOS & ANMELDUNG
14.03.-15.03.2023, online
HBS, Seminar Grundkurs Atomenergie
Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) informiert über die Funktionsweise, Bedeutung und Risiken der Atomenergie und hilft beim Einordnen der aktuellen Debatten. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy and Electricity Market
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) presents the results of a research exercise on developing a climate change lens to analyse and inform the EU debate on reforming the electricity market design. INFOS & REGISTRATION
14.03.2023 – 10:00-11:30 Uhr, online
ASEW, Seminar Erneuerbare Fernwärme: Solarthermie
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) wirft ein Blick auf die unterschiedlichen erneuerbaren Wärmeerzeuger für die netzgebundene Wärmeversorgung und teilt Know-How aus dem Netzwerk. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 12:30-14:00 Uhr, online
EBD, Briefing Kommission direkt zum sozialen Dialog
Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) diskutiert die Kommissionsvorschläge zur Förderung des Dialogs der Sozialpartner auf nationaler und EU-Ebene. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online
Stiftung Datenschutz, online Neues zum CCPA und zum Datentransfer in die USA
Die Stiftung Datenschutz informiert über den California Consumer Privacy Act of 2018 und wie der reformierte CCPA auch deutsche Unternehmen betreffen kann. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 15:30-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Discussion CCUS in the net-zero transition
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) explores the role of CCUS in different climate neutrality scenarios and its role in different policy mixes. Furthermore, it presents regional perspectives on how this role has been translated and the technology implemented in different regulatory jurisdictions. INFOS & REGISTRATION
Der Europäische Rechnungshof (ECA) hat das Kontrollsystem der Europäischen Kommission für die milliardenschwere Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) bemängelt. In einer Pressemitteilung des Hofs heißt es, die EU-Prüfer hätten die Ausgestaltung des Kontrollsystems untersucht und “bezüglich der Gewährleistung und der Rechenschaftspflicht beim Schutz der finanziellen Interessen der EU eine Lücke festgestellt“.
Mit dem ARF sind die EU-Länder verpflichtet, zu kontrollieren, ob ARF-Investitionsvorhaben den EU- und nationalen Vorschriften entsprechen. Allerdings verfüge die Kommission “kaum über selbst ermittelte und abgesicherte Informationen darüber, ob und wie diese nationalen Kontrollen durchgeführt werden”, bemängelt der Rechnungshof. Ohne die Gewähr, dass diese Vorschriften eingehalten würden, bestehe “auf EU-Ebene ein Mangel an Rechenschaftspflicht“.
Im Rahmen der Aufbaufazilität, die den größten Teil der EU-Mittel zur Finanzierung des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie ausmacht, stehen den Mitgliedstaaten 338 Milliarden Euro an Zuschüssen und 385,8 Milliarden Euro in Form von Darlehen zur Verfügung. Mit dem Geld soll die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie vorangetrieben werden, besonders für die grüne und digitale Transformation. Der Präsident des Rechnungshofes, Tony Murphy, unterstrich: “Die Bürgerinnen und Bürger werden neuartigen EU-Finanzierungen nur dann Vertrauen entgegenbringen, wenn sie sicher sein können, dass ihr Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird.”
Der Rechnungshof verweist dabei auf Erfahrungswerte mit anderen EU-Ausgabenprogrammen. Dort kämen Verstöße, darunter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei staatlichen Beihilfen, immer wieder vor. Der Hof fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die Lücke für die ARF hinsichtlich der Gewährleistung auf EU-Ebene zu schließen.
Die Kommission müsse unter anderem eine Handlungsanleitung an die Mitgliedstaaten für den Fall vorlegen, dass eine finanzierte Maßnahme bei Nichterfüllung rückabgewickelt wird. Das deutsche ECA-Mitglied Klaus-Heiner Lehne hatte bereits Mitte Februar im Gespräch mit Table.Media gefordert: “Die Kommission muss klar aufzeigen, welche Bedeutung und welcher Wert jede einzelne Reform und jede Investitionsvorgabe für den Mitgliedstaat hat, damit klar ist, was auf diesen bei Nichterfüllung zukommt, etwa mit der Rückholung ausgezahlter Gelder.” cr
Die Verteidigungsminister der EU haben bei einem informellen Treffen Stockholm einen Vorschlag des Außenbeauftragten Josep Borrell grundsätzlich begrüßt, die Munitionsbeschaffung für die Ukraine und für die Mitgliedstaaten mit europäischen Mitteln zu beschleunigen. Es habe eine allgemeine Übereinstimmung gegeben, doch einige Fragen seien noch offen, sagte Borrell. Der Spanier hatte der Runde ein sogenanntes Non Paper mit einem dreigleisigen Ansatz präsentiert.
So schlägt Borrell in einem ersten Schritt vor, eine Milliarde Euro zur Beschaffung von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sollen aus der Europäischen Friedensfazilität (EFF) kommen. Konkret werden Mitgliedstaaten aus dem Fonds entschädigt, wenn sie der Ukraine Waffen oder Geschosse aus ihren Beständen zur Verfügung stellen. Im Gespräch ist, die Rückerstattungsquote von zuletzt 50 auf 90 Prozent zu erhöhen. Dies ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mitgliedstaat die Munition auch innerhalb einer bestimmten Frist liefert. Man sei sich über die Dringlichkeit einig, die Lieferung von Munition zu beschleunigen.
Parallel dazu wollen der Außenbeauftragte und die Kommission, nach dem Vorbild der Corona-Impfstoffe, eine gemeinsame Beschaffung von Munition für Artillerie und Kampfpanzer anstoßen. Eine zweite Milliarde Euro soll dafür über die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) zur Verfügung gestellt werden: “Wenn wir zusammen vorgehen, können wir nicht nur den Preis drücken, sondern auch die Lieferzeiten reduzieren”, sagte der Außenbeauftragte. Ergänzend sieht das Non Paper an dritter Stelle vor, den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten der Rüstungsindustrie zu unterstützen. So sollen unter anderem Engpässe bei der Produktion identifiziert und beseitigt werden. Im Gespräch ist auch, Produktionsstätten in die EU zurückzuholen. Borrell hat sein Papier zusammen mit Binnenmarktkommissar Thierry Breton ausgearbeitet.
Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow kritisierte die EU-Planungen beim Treffen in Stockholm als unzureichend. Die Ukraine brauche eine Million Artilleriegeschosse, und dafür seien bis zu vier Milliarden Euro notwendig. Hintergrund ist, dass die Ukraine chronisch knapp ist an Artilleriemunition und derzeit nur bis zu maximal 120.000 Schuss pro Monat abfeuern kann, während den russischen Streitkräften gut zehnmal mehr zur Verfügung stehen.
“Wir müssen die Unterstützung ausweiten und dynamisieren“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Ende des Treffens in Stockholm. Zu den Waffensystemen brauche es auch die notwendige Munition, das liege auf der Hand. Die Kapazitäten müssten nun hochgefahren werden, die Industrie die richtigen Entscheidungen treffen. Das geschehe zum Teil schon, brauche aber Zeit. Deshalb müsse es jetzt darum gehen, Bestände zusammenzusuchen und zu liefern, zumindest, was mit Blick auf die eigene Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit möglich sei.
Josep Borrell setzt darauf, dass die Verteidigungsminister beim formellen Rat vom 20. März seinem dreigleisigen Vorschlag zustimmen. Die Munitionsbeschaffung für die Ukraine und die Auffüllung der eigenen Bestände könnte sonst auch am EU-Gipfel vom 23. und 24. März die Staats- und Regierungschefs beschäftigen. sti
Im derzeit abgeschalteten Atomreaktor Nummer 1 in Penly (Nordwestfrankreich) wurde ein neuer Riss entdeckt, der als “signifikant” vom Betreiber EDF in einer Ende Februar veröffentlichten Notiz bezeichnet wurde. Contexte hatte zuerst berichtet. Dieser Riss zwingt das staatliche französische Unternehmen, seine derzeitige Strategie zur Behebung von Korrosionsschäden zu überdenken.
Dieser Riss beeinträchtigt die Festigkeit der Rohrleitungen und die mit der Kühlung des Reaktors verbundene Sicherheitsfunktion, meint die französische Atomaufsichtsbehörde (ASN), die das Ereignis auf Stufe 2 der Ines-Risikoskala einstuft. Laut ASN habe das Ereignis “keine Auswirkungen auf die Umwelt oder das Personal” gehabt. Der Riss erstreckt sich über 155 Millimeter, d. h. etwa einem Viertel des Rohrumfangs und ist bis zu 23 Millimetern tief – bei einer Rohrdicke von 27 mm. “Es ist ein besonders tiefer Riss“, sagte die stellvertretende Generaldirektorin des Instituts für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (IRSN), Karine Herviou, die dazu im öffentlichen Radiosender France Info befragt wurde: “Wir waren ziemlich nahe an einem Leck.”
Während EDF gerade mehr als 150 Schweißnähte prüft und im Laufe des Jahres 2023 die Rohrleitungen aller Reaktoren der Stufe P’4 (1300 MW) austauschen will, fordert die ASN den Betreiber auf, seine Prüfstrategie zu überarbeiten, um diesem Ereignis Rechnung zu tragen. Diese wird “in den nächsten Tagen” vorgelegt werden, so EDF, das am gestrigen Mittwoch außerdem bestätigte, dass auch Korrosionsschäden an drei anderen Reaktoren (Civaux 2, Chooz 2 und Penly 2) entdeckt wurden. Diese Ereignisse werden auf Stufe 1 der Ines-Skala eingestuft.
Bei einer Anhörung im Senat, dem französischen Pendant zum Bundesrat, am Mittwoch, erklärte der Präsident der ASN, Bernard Doroszczuk, dass der Riss auf eine “Abweichung bei der Anpassung der Rohrleitungen bei ihrer Reparatur” zurückzuführen sei, “ein Ansatz, der insofern nicht akzeptabel ist, als man die Rohrleitungen gewaltsam geöffnet hat”, wie er betonte. Die Entdeckung des Risses dürfte Auswirkungen auf die Wiederinbetriebnahme der betroffenen Reaktoren haben. Bisher hält EDF am 2. Mai als Datum für den Wiederanschluss des seit Oktober 2021 abgeschalteten Reaktors Penly 1 an das Netz fest. cst
Am Mittwoch hat Dänemark mit der Einspeicherung von CO₂ unter der Nordsee begonnen. Auf dem ausgeförderten Ölfeld Nini West sollen bis Anfang April in der Pilotphase des Projekts Greensand bis zu 15.000 Tonnen verflüssigtes CO₂ aus Belgien gut 1.800 Meter in die Tiefe gepumpt werden.
“Heute schlagen wir ein neues Kapitel für die Nordsee auf, ein grünes Kapitel”, sagte Dänemarks Kronprinz Frederik. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich positiv per Videobotschaft: “Dies ist ein großer Moment für den grünen Wandel in Europa.”
Beim sogenannten Carbon Capture and Storage (CO₂-Abscheidung und -Einlagerung), kurz CCS, wird CO₂ etwa bei industriellen Prozessen eingefangen, zu einer unterirdischen Lagerstätte gebracht und dort eingespeichert. Bei Greensand arbeitet ein Konsortium um die BASF-Tochter Wintershall Dea und den britischen Chemiekonzern Ineos zusammen. Nach Wintershall-Angaben handelt es sich um die weltweit erste grenzüberschreitende Offshore-CO₂-Einspeicherung, die explizit den Zweck hat, den Klimawandel zu mindern.
Dänemark hatte jüngst erste Zulassungen erteilt, damit Konzerne im größeren Maßstab CO₂ unter dem Nordsee-Grund einlagern können. Ein bilaterales Abkommen mit Belgien ermöglicht dabei den CO₂-Transport nach Dänemark. Das Konsortium aus Wintershall Dea und Ineos hofft, dass die Politik den gesetzlichen Rahmen dafür auch in anderen Ländern schafft – vor allem in Deutschland.
Auf seiner Website stellt Habecks Ministerium die CCS-Technologie bereits als Teil der deutschen Klimastrategie dar. Ab 2050 will man der Atmosphäre sogar mehr Treibhausgas entziehen, als man ausstößt. Damit das klappt, könne für unvermeidbare oder schwer vermeidbare CO₂-Emissionen eine Abscheidung mit anschließender Nutzung oder Speicherung infrage kommen, heißt es von Ministeriumsseite.
Unter Umweltverbänden und Klimaschützern ist CCS dagegen umstritten. Sie fürchten, dass die Technologie den Ehrgeiz beim Klimaschutz und beim Ausbau erneuerbarer Energien dämpft, und warnen vor Gefahren für die Umwelt zum Beispiel durch Leckagen von Kohlendioxid. dpa

Wenn die Bürger in Europa jederzeit Strom und Gas haben, mit dem Zug grenzenlos reisen oder günstig das Internet nutzen können, dann liegt das auch an der Arbeit von Beamtinnen wie Annegret Groebel. Die rührige Volkswirtin hilft seit Jahrzehnten dabei, den Binnenmarkt in den Netzindustrien der EU zusammenzuschweißen: Eisenbahn, Post, Telekommunikation und Energie.
“Vor der Pandemie war ich eigentlich jede Woche in Brüssel oder einer anderen europäischen Stadt”, erzählt die Abteilungsleiterin Internationales der Bundesnetzagentur. Groebel reist in gleich mehreren Rollen durch den Kontinent – etwa als Präsidentin des Council of European Energy Regulators (CEER).
“Wir entwickeln die Methoden, damit Europas Regulierer die Ziele des Brüsseler Rechtsrahmens am besten erreichen können”, sagt die 62-Jährige. Im CEER organisieren sich Europas Regulierungsbehörden und überwachen, wie verbraucherfreundlich die Endkundenmärkte für Gas und Strom funktionieren.
Damit ergänzt das Gremium ACER, die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Die Agentur in Ljubljana soll eher den Großhandel mit Energie beaufsichtigen – und im Regulierungsrat von ACER mischt die omnipräsente Annegret Groebel als Mitglied ebenfalls mit.
In der Energiekrise, in der hohe Preise Europas Verbraucher belasten, liefern die Regulierer den Generaldirektionen Informationen, die später Grundlage von Gesetzesvorschlägen werden. “Als das REPowerEU-Paket kam, hat sich die Kommission schon sehr früh an CEER gewandt und nach Daten zu Lieferverträgen für Strom und Gas gefragt“, erzählt Groebel.
Wie viele Verbraucher haben überhaupt Verträge mit Preisgarantien? Wie haben die Mitgliedstaaten geregelt, ob und zu welchen Tarifen Kunden noch versorgt werden, wenn ihr Lieferant pleitegeht? All diese Fragen hatten auf einmal höchste Dringlichkeit. “Teilweise sind Versorger umgekippt, weil sie sich nicht gegen hohe Preise abgesichert hatten, und in einigen Mitgliedstaaten fallen Kunden nicht automatisch in eine Ersatzversorgung“, berichtet die Regulierungsexpertin.
Solide Daten sind für Groebel auch in der Diskussion um eine Reform des Strommarktdesigns essenziell: “Ohne ausreichende Informationen besteht das Risiko, dass die Politik gut gemeinte Vorschläge macht, aber eine Reform fehlschlägt.” Besonders vor einem Schritt warnt die CEER-Präsidentin: “Der EU-Gesetzgeber sollte den Strompreis nicht vom Gaspreis entkoppeln. Die Preissignale des Marktes nach der Merit Order der Kraftwerke drücken Knappheiten aus und bilden das Fundament für den Stromhandel zwischen den EU-Staaten“, erklärt Groebel.
“Wenn das Marktdesign zu stark angepasst wird, besteht die Gefahr, den europäischen Binnenmarkt zu verzerren und schlimmstenfalls zu zerstören. Die Regulierungsbehörden müssten zu viele Methoden für den grenzüberschreitenden Stromhandel ändern. Das können innerhalb weniger Monate weder die Behörden handhaben noch die Marktakteure umsetzen.” Außerdem wären laut Groebel Investoren verunsichert, wenn die Preise ihre Anreizwirkung verlören, sodass nicht ausreichend in erneuerbare Energien und Flexibilität investiert würde.
Erst Anfang Februar hatte der Europäische Rechnungshof moniert, dass die Mitgliedstaaten bisher nicht einmal alle Regulierungsmethoden nach dem dritten Energiemarktpaket von 2009 vollständig umgesetzt hätten.
Die Karriere von Annegret Groebel begann bereits ein Jahrzehnt früher bei der Geburt der europäisch regulierten Märkte in den Netzindustrien. Nach der Promotion in Mannheim kam die Volkswirtin 1997 in das Postministerium: “Angestellt wurde ich damals aber schon für die neue Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Damals haben wir in Bonn bereits etwas gemacht, was es noch in keinem anderen europäischen Land gab.”
Die Tüftler in den Amtsstuben hatten eine Methode ersonnen, um die Leitungen der Telefonanschlüsse der Kunden vom “Monopolisten” Deutsche Telekom zu entbündeln und sie vollständig neuen Wettbewerbern zugänglich zu machen. “In anderen Ländern gab es ein großes Interesse, wie das funktioniert. Und da ich in der zuständigen Kammer war und auch noch Englisch konnte, bin ich eingeladen worden mitzufahren”, erzählt Annegret Groebel.
Der Präsident der Behörde holte die Hessin 2001 in den Stabsbereich, wo sie nach und nach den Bereich Internationales aufbaute, der dann mit der Postabteilung zusammengelegt wurde. In Brühl machte die Volkswirtin an der Europäischen Fachhochschule noch einen Master of European Administrative Management. “Den konnte man glücklicherweise nebenher machen, und dieses Studium hat mir ein Grundgerüst an europäischem Wissen für meine tägliche Arbeit gegeben”, erzählt die vor Wissen sprudelnde Ökonomin.
Umgekehrt kommt Annegret Groebel ihr breiter Erfahrungsschatz in Brüssel zugute. “In europäischen Gremien bekommt man nie alle auf genau dieselbe Methode eingeschworen. Das richtige Maß an Konsistenz und Handlungsspielräumen hinzubekommen, das ist das Kunststück in der EU.” Manuel Berkel
das war es also mit der fröhlichen Ausgabenpolitik auf Pump. Ende des Jahres läuft die Corona-bedingte Ausnahmeregel für Schulden aus, das haben Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis nun offiziell angekündigt. An Investitionen solle aber kein Staat sparen, finden die beiden. Wie sie sich das vorstellen, das berichtet Christof Roche.
Eine weitere Baustelle: das Sorgfaltspflichtengesetz. Ginge es nach dem Rat, würde die Finanzbranche fast gänzlich von den Regeln ausgenommen. Autorin Charlotte Wirth analysiert am Beispiel eines mexikanischen Unternehmens, das mit einer Luxemburger Finanzholding verbandelt ist, wieso diese Ausnahme problematisch sein kann, und zwar.
Das hatte sich angedeutet: Der Europäische Rechnungshof hat gestern mangelnde Kontrollen der Ausgaben bei der Aufbau- und Resilienzfazilität kritisiert. In einer Untersuchung habe er “bezüglich der Gewährleistung und der Rechenschaftspflicht beim Schutz der finanziellen Interessen der EU eine Lücke festgestellt“. Mehr dazu in unserer News.
Übrigens: Autorin Charlotte Wirth macht gerade noch in anderer Hinsicht von sich reden. Sie erhielt eine “besondere Erwähnung” beim luxemburgischen Amnesty Medienpreis 2023 in der Kategorie Artikel. Und zwar mit ihrer Recherche zu ruandischen Kriegsverbrechern, die sich in Belgien aufhalten, dort Politik und Vereine infiltrieren und deren Spuren auch nach Luxemburg führen. Wir gratulieren!

Die Europäische Kommission lässt die Aussetzung der Schuldenregeln zum Jahresende auslaufen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte in Brüssel, es sei richtig gewesen, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt verankerte sogenannte Escape Clause im Frühjahr 2020 auszulösen. Dies habe den Mitgliedstaaten ermöglicht, “die durch COVID-19 und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachten wirtschaftlichen Schocks abzufedern”. Inzwischen habe sich die Konjunktur in Europa wieder stabilisiert, trotz nach wie vor hoher Unsicherheit, sodass die Deaktivierung der Ausweichklausel in Ordnung gehe.
EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis unterstrich in diesem Zusammenhang, die Kommission werde im laufenden Jahr keine Defizitverfahren gegen Mitgliedstaaten mit überhöhter Neuverschuldung starten. Dies werde aber, wo nötig, im Frühjahr 2024 geschehen. Die beiden Kommissare machten ihre Äußerungen anlässlich von Leitlinien, die die Brüsseler Behörde zur Durchführung und Koordinierung der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten im nächsten Jahr vorgelegt hat. Die Leitlinien kommen zu einem Zeitpunkt, an dem über eine Neuausrichtung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verhandelt wird. Bis das neue Fiskalregelwerk in Kraft tritt, gelten noch die aktuellen Schuldenregeln.
Gentiloni unterstrich, Elemente der Reform sollten allerdings bereits im Zyklus der aktuellen haushaltspolitischen Überwachung in die nationalen Stabilitäts- und Konvergenzprogramme einfließen, “um eine wirksame Brücke zu den künftigen Haushaltsregeln zu ermöglichen und den aktuellen Herausforderungen Rechnung zu tragen”. Der Italiener betonte, die Kommission werde in ihre länderspezifischen Haushaltsempfehlungen für 2024, die für Mai avisiert sind, “quantitative Vorgaben sowie qualitative Leitlinien für Investitions- und Energiemaßnahmen integrieren, im Einklang mit den Reformorientierungen der Kommission“.
Dabei sollen die Empfehlungen auf Grundlage der Nettoprimärausgaben formuliert und entsprechend den Herausforderungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Schuldentragfähigkeit differenziert werden. In Kreisen der Kommission hieß es, die Empfehlungen sollen sich über einen mittelfristigen Zeitraum von vier Jahren erstrecken. Die im aktuellen Fiskalregime verankerte sogenannte 1/20-Regel zur Schuldenreduzierung werde nicht zur Anwendung kommen.
In den Kreisen hieß es weiter, sollte es im kommenden Jahr zu Eröffnung eines Defizitverfahrens wegen überhöhter Neuverschuldung gegen Mitgliedstaaten kommen, dürfte sich die Vorgabe zur Reduzierung an der aktuellen Größenordnung im Stabilitätspakt orientieren. Es gebe zwar noch keine fixierte Vorgabe zum Defizitabbau, da die Reform noch ausstehe, aber die Verringerung dürfte vergleichbar sein mit dem Abbau des strukturellen Defizits in der Größenordnung von mindestens 0,5 Prozent im aktuellen Defizitverfahren. Die Kreise machten zudem deutlich, dass es im kommenden Jahr auf keinen Fall eine Eröffnung von Defizitverfahren aufgrund der Schuldenquote eines Landes geben werde.
Gentiloni hob noch einmal hervor, die Mitgliedstaaten sollten ihre Haushaltsanpassungen “nicht durch Investitionskürzungen, sondern durch eine Begrenzung der laufenden Ausgaben erreichen“. Spielraum hätten die Länder besonders bei den Maßnahmen, die sie zur sozialen und wirtschaftlichen Abfederung der Energiekrise eingeführt hatten. Jetzt, da der Energiepreisdruck nachlasse, sollten die Mitgliedstaaten diese Stützungsmaßnahmen auslaufen lassen, beginnend “mit denen, die wenig zielgerichtet sind oder das Preissignal verzerren”. Der Wirtschaftskommissar machte deutlich, im vergangenen Jahr hätten die Stützungsmaßnahmen 1,2 % des EU-Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht.
Dies sei mit erheblichen Kosten verbunden. Hätte man die Hilfsmaßnahmen auf die tatsächlichen Notfälle konzentriert, hätte der Aufwand nach Berechnung der EU-Kommission lediglich 0,3 Prozent des EU-BIP betragen. Mit Blick auf die Reform der europäischen Schuldenregeln kündigte Vizepräsident Dombrovskis an, die Kommission werde das Gesetzespaket für das neue EU-Fiskalregelwerk zeitnah nach dem nächsten EU-Gipfel vorlegen, der für den 23./24. März angesetzt ist. In den Kreisen der Behörde hieß es, die Verhandlungen würden sich voraussichtlich bis ins nächste Jahr ziehen. Sie sollten aber vor der kommenden Wahl zum neuen Europaparlament im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein

Das Parlament verhandelt noch, der Rat konnte sich dagegen bereits im Dezember auf eine gemeinsame Ausrichtung zum Sorgfaltspflichtengesetz einigen. Auf den Druck Frankreichs hin hat er eine Sonderrolle für die Finanzbranche beschlossen. Der Text, auf den sich die EU27 Ende einigten, ist so undurchsichtig, wie es immer dann der Fall ist, wenn ein Kompromiss nur mit Ach und Krach durchgedrückt werden konnte.
So viel ist jedoch klar:
Die weitreichenden Ausnahmen für die Finanzbranche überraschen. Gerade sie hat großen Einfluss auf die globalen Wertschöpfungsketten. Die Kommission hob noch in ihrer Machbarkeitsstudie zum Due Diligence Gesetz die Rolle der Finanzbranche “in der Finanzierung und Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten in nahezu jedem anderen Wirtschaftszweig” hervor. Aufgrund dieses Einflusses gilt der Finanzsektor in den UN-Leitlinien für nachhaltige Unternehmensführung beispielsweise als Risikobranche.
Doch was bedeutet es konkret, wenn für die Finanzbranche nur sehr abgeschwächte Sorgfaltspflichten gelten? Ein Blick auf den Finanzplatz Luxemburg liefert ein aktuelles Beispiel.
Es führt uns nach Mexiko. Dort sind vor einigen Wochen zwei Menschenrechtsaktivisten verschwunden, der Menschenrechtsanwalt Ricardo Arturo Lagunes Gasca und der Vertreter der indigenen Aquila-Gemeinschaft, Antonio Díaz Valencia.
Beide wurden nicht mehr gesehen, nachdem sie vor rund einem Monat von einem Meeting mit dem Minenbetreiber Ternium und der Aquila-Gemeinschaft nach Hause aufgebrochen waren. Ihr Auto ist verlassen gefunden worden. Es war von Kugeln durchlöchert. Die Angehörigen sind sicher: Ternium sei in ihr Verschwinden involviert. Der Konzern habe die Aktivisten früher bedroht. Ternium bestreitet die Vorwürfe.
Ternium Mexiko befindet sich seit Jahren im Streit mit der indigenen Gemeinschaft, auf dessen Gebiet das Unternehmen mehrere Minen betreibt. Viele Anwohner wurden aufgrund der Projekte Terniums umgesiedelt. Nur ein Teil von ihnen wurde von dem Unternehmen entschädigt. Und das, obwohl es ein entsprechendes Abkommen mit dem Minenunternehmen gab.
Der verschwundene Anwalt Lagunes Gasca vertrat bisher die Familien im Streit gegen den Stahlkonzern und machte Ternium für Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
“Es handelt sich um einen klassischen Fall von ‘teile und herrsche’, wie wir sie immer wieder sehen. Ein Unternehmen stiftet Streit zwischen betroffenen Gemeinschaften, um seine Ziele besser durchsetzen zu können”, sagt Antoniya Argirova von der Luxemburger NGO-Koalition “Initiative pour un devoir de vigilance” (Initiative für Sorgfaltspflichten) gegenüber Table.Media. Sie steht mit der Anwältin der Familien der verschwundenen Aktivisten in Kontakt.
Ternium Mexiko ist eine Tochtergesellschaft von Ternium SA, einer Luxemburger Finanzholdinggesellschaft (SOPARFI). Diese gehört wiederum der italo-argentinischen Gruppe Techint, die ebenfalls als Holding in Luxemburg angesiedelt ist.
Luxemburg sieht sich im Fall der verschwundenen Aktivisten allerdings nur bedingt als zuständig: Man habe Ternium SA in einem Brief an seine Sorgfaltspflichten unter anderem im Rahmen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen erinnert, allerdings sei Luxemburg im Rahmen dieser Leitsätze nicht für Ternium zuständig, sondern Mexiko, – schließlich betreffe der Fall Ternium die mexikanische Tochtergesellschaft, sagt das Finanzministerium.
Der Fall Ternium zeigt, wie schwer es ist, die Verantwortlichkeit in Unternehmensgeflechten konkret festzumachen. Denn alles hängt an der Frage, wer Sorgfaltspflicht leisten muss: das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe? Im Ratsmandat bleibt die Klärung dieser Frage den Mitgliedstaaten überlassen.
Für Luxemburg ist die Auslegung des Sorgfaltspflichtengesetzes besonders kritisch: Denn nur 0,1 Prozent der dort ansässigen Unternehmen würden auf Basis ihrer Mitarbeiterzahl und Umsatzes unter das Gesetz fallen. Gleichzeitig sind aber mehrere Tausend Holdinggesellschaften und Investmentfonds im Großherzogtum angesiedelt. Sie verwalten Vermögenswerte von über 5.000 Milliarden Euro. Und doch sollen sie gemäß dem Ratsmandat von dem Gesetz ausgenommen werden.
Fälle wie Ternium gibt es in Luxemburg etliche. Da wäre der Pegasus-Skandel um das israelische Unternehmen NSO, das wiederum mit den Luxemburger Holdings Q Cyber Technologies und Osy Technologies zusammenhängt. Die Luxemburger Holding Kernel, die in der Ukraine für Landraub verantwortlich ist, sowie der Fleischkonzern JBS, dem Korruption und illegale Rodungen vorgeworfen und von dem große Teile des Konzerns aus Luxemburg verwaltet werden. Bei allen genannten dürfte die Frage, wer letztlich verantwortlich ist, schwer zu klären sein.
Das Problem ist, dass in Luxemburg große Holdinggesellschaften die Rolle der Unternehmensgruppe übernehmen, sagt Charles Muller von Finance and Human Rights gegenüber Table.Media. Der Vermögensverwalter und Anwalt vertrat früher die Luxemburger Fondsindustrie ALFI, heute setzt er sich für die Wahrung von Menschenrechten in der Luxemburger Finanzbranche ein. Für ihn steht fest: In Fällen wie Ternium müsse die Verantwortung bei den Finanzholdinggesellschaften liegen. “Ihr Verwaltungsrat tagt in Luxemburg. Er entscheidet, was in den Tochtergesellschaften passiert.”
Für Muller ist schwer nachvollziehbar, wieso die EU27 die Finanzbranche ausnehmen wollen. “Wenn man etwas verändern will, muss man dort agieren, wo die Gelder herkommen, Aktien gekauft werden, Kredite ausgegeben werden. Man landet immer wieder bei der Fondsindustrie.”
Hinzu kommt, dass Finanzdienstleister bereits jetzt Sorgfaltspflicht einhalten, um beispielsweise die EU-Regeln im Bereich Korruption und Geldwäsche umzusetzen. Die EU-Gesetzgebung geht etwa so weit, dass Finanzdienstleister sicherstellen müssen, dass sie keine Gelder verwalten, die aus Zwangsarbeit stammen.
Dass die Finanzbranche in der Lage ist, ihre Sorgfaltspflicht auf die Bereiche Menschenrechte und Umwelt auszudehnen, zeigt die “Sustainable Finance and Human Rights Survey“. Es handelt sich um eine Umfrage, die 2020 und 2022 vom Luxemburger Finanzministerium in Auftrag gegeben wurde. Dort geben 87 Prozent der großen Finanzakteure in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, Schweiz und Großbritannien an, dass sie es begrüßen würden, ihre Gesetzgebung zur Wahrung der Menschenrechte zu verschärfen. Die meisten betonten zudem, dass sie auf entsprechende Auflagen gut vorbereitet seien.
Es stellt sich aber die Frage, ob ein Land wie Luxemburg tausende Finanzgesellschaften auf ihre Menschenrechts-Sorgfaltspflichten hin kontrollieren könnte. Die OECD-Kontaktstelle der Leitlinie für multinationale Unternehmen beschäftigte lange Zeit nur eine Halbtagsstelle. Inzwischen kam eine Person dazu.
Frankreich hat sich noch stärker als Luxemburg gegen die Inklusion des Finanzsektors stark gemacht. So sehr, dass Paris sogar drohte, die allgemeine Ausrichtung im Rat zu blockieren. Ursachen gibt es mehrere.
Die Regierung weiß um das Problem, Verantwortlichkeit zu verorten. In einer Evaluierung des Gesetzes von 2020 schreibt das französische Wirtschaftsministerium: “Anhand der Daten des Handelsgerichts kann nicht festgestellt werden, ob einzelne Unternehmen Teil einer größeren Gruppe sind.” Und weiter: “Bei ausländischen Unternehmen ist es aufgrund ihrer steuerlichen Eingliederung in einen internationalen Konzern nicht möglich, den einzigen französischen Teil zu identifizieren, der von dem Gesetz betroffen sein könnte.”
Auch der Brexit wird immer wieder als Grund für Frankreichs Vorstoß genannt. Denn seitdem will Paris London als einen der weltweit wichtigsten Finanzzentren ablösen und internationale Asset-Manager anziehen. Eine strengere Regulierung käme deswegen zum unpassenden Zeitpunkt.
10.03.2023 – 10:00-10:45 Uhr, online
BEUC, Briefing How to better protect consumers from electricity supplier malpractices
The European Consumer Organisation (BEUC) discusses steps to better protect and educate energy market consumers. INFOS & REGISTRATION
10.03.2023 – 10:15-16:00 Uhr, Haiger
Eco, Konferenz IIoT in der Praxis – Essenzielle Bausteine der Industrie 4.0
Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) diskutiert die wegweisenden Themenschwerpunkte für die Industrie 4.0. INFOS & ANMELDUNG
12.03.-14.03.2023, Belo Horizonte (Brasilien)
BDI Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2023
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert Themen wie erneuerbare Energien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern. INFOS & ANMELDUNG
13.03.2023 – 18:00 Uhr, Berlin/online
Forum eHealth, Seminar Digitale Identitäten im Gesundheitswesen
Das Forum eHealth präsentiert den aktuellen Stand und Ausblick zur Gesundheits-ID. INFOS & ANMELDUNG
14.03.-15.03.2023, online
HBS, Seminar Grundkurs Atomenergie
Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) informiert über die Funktionsweise, Bedeutung und Risiken der Atomenergie und hilft beim Einordnen der aktuellen Debatten. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy and Electricity Market
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) presents the results of a research exercise on developing a climate change lens to analyse and inform the EU debate on reforming the electricity market design. INFOS & REGISTRATION
14.03.2023 – 10:00-11:30 Uhr, online
ASEW, Seminar Erneuerbare Fernwärme: Solarthermie
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) wirft ein Blick auf die unterschiedlichen erneuerbaren Wärmeerzeuger für die netzgebundene Wärmeversorgung und teilt Know-How aus dem Netzwerk. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 12:30-14:00 Uhr, online
EBD, Briefing Kommission direkt zum sozialen Dialog
Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) diskutiert die Kommissionsvorschläge zur Förderung des Dialogs der Sozialpartner auf nationaler und EU-Ebene. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online
Stiftung Datenschutz, online Neues zum CCPA und zum Datentransfer in die USA
Die Stiftung Datenschutz informiert über den California Consumer Privacy Act of 2018 und wie der reformierte CCPA auch deutsche Unternehmen betreffen kann. INFOS & ANMELDUNG
14.03.2023 – 15:30-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online
ERCST, Discussion CCUS in the net-zero transition
The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) explores the role of CCUS in different climate neutrality scenarios and its role in different policy mixes. Furthermore, it presents regional perspectives on how this role has been translated and the technology implemented in different regulatory jurisdictions. INFOS & REGISTRATION
Der Europäische Rechnungshof (ECA) hat das Kontrollsystem der Europäischen Kommission für die milliardenschwere Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) bemängelt. In einer Pressemitteilung des Hofs heißt es, die EU-Prüfer hätten die Ausgestaltung des Kontrollsystems untersucht und “bezüglich der Gewährleistung und der Rechenschaftspflicht beim Schutz der finanziellen Interessen der EU eine Lücke festgestellt“.
Mit dem ARF sind die EU-Länder verpflichtet, zu kontrollieren, ob ARF-Investitionsvorhaben den EU- und nationalen Vorschriften entsprechen. Allerdings verfüge die Kommission “kaum über selbst ermittelte und abgesicherte Informationen darüber, ob und wie diese nationalen Kontrollen durchgeführt werden”, bemängelt der Rechnungshof. Ohne die Gewähr, dass diese Vorschriften eingehalten würden, bestehe “auf EU-Ebene ein Mangel an Rechenschaftspflicht“.
Im Rahmen der Aufbaufazilität, die den größten Teil der EU-Mittel zur Finanzierung des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie ausmacht, stehen den Mitgliedstaaten 338 Milliarden Euro an Zuschüssen und 385,8 Milliarden Euro in Form von Darlehen zur Verfügung. Mit dem Geld soll die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie vorangetrieben werden, besonders für die grüne und digitale Transformation. Der Präsident des Rechnungshofes, Tony Murphy, unterstrich: “Die Bürgerinnen und Bürger werden neuartigen EU-Finanzierungen nur dann Vertrauen entgegenbringen, wenn sie sicher sein können, dass ihr Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird.”
Der Rechnungshof verweist dabei auf Erfahrungswerte mit anderen EU-Ausgabenprogrammen. Dort kämen Verstöße, darunter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei staatlichen Beihilfen, immer wieder vor. Der Hof fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die Lücke für die ARF hinsichtlich der Gewährleistung auf EU-Ebene zu schließen.
Die Kommission müsse unter anderem eine Handlungsanleitung an die Mitgliedstaaten für den Fall vorlegen, dass eine finanzierte Maßnahme bei Nichterfüllung rückabgewickelt wird. Das deutsche ECA-Mitglied Klaus-Heiner Lehne hatte bereits Mitte Februar im Gespräch mit Table.Media gefordert: “Die Kommission muss klar aufzeigen, welche Bedeutung und welcher Wert jede einzelne Reform und jede Investitionsvorgabe für den Mitgliedstaat hat, damit klar ist, was auf diesen bei Nichterfüllung zukommt, etwa mit der Rückholung ausgezahlter Gelder.” cr
Die Verteidigungsminister der EU haben bei einem informellen Treffen Stockholm einen Vorschlag des Außenbeauftragten Josep Borrell grundsätzlich begrüßt, die Munitionsbeschaffung für die Ukraine und für die Mitgliedstaaten mit europäischen Mitteln zu beschleunigen. Es habe eine allgemeine Übereinstimmung gegeben, doch einige Fragen seien noch offen, sagte Borrell. Der Spanier hatte der Runde ein sogenanntes Non Paper mit einem dreigleisigen Ansatz präsentiert.
So schlägt Borrell in einem ersten Schritt vor, eine Milliarde Euro zur Beschaffung von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sollen aus der Europäischen Friedensfazilität (EFF) kommen. Konkret werden Mitgliedstaaten aus dem Fonds entschädigt, wenn sie der Ukraine Waffen oder Geschosse aus ihren Beständen zur Verfügung stellen. Im Gespräch ist, die Rückerstattungsquote von zuletzt 50 auf 90 Prozent zu erhöhen. Dies ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mitgliedstaat die Munition auch innerhalb einer bestimmten Frist liefert. Man sei sich über die Dringlichkeit einig, die Lieferung von Munition zu beschleunigen.
Parallel dazu wollen der Außenbeauftragte und die Kommission, nach dem Vorbild der Corona-Impfstoffe, eine gemeinsame Beschaffung von Munition für Artillerie und Kampfpanzer anstoßen. Eine zweite Milliarde Euro soll dafür über die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) zur Verfügung gestellt werden: “Wenn wir zusammen vorgehen, können wir nicht nur den Preis drücken, sondern auch die Lieferzeiten reduzieren”, sagte der Außenbeauftragte. Ergänzend sieht das Non Paper an dritter Stelle vor, den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten der Rüstungsindustrie zu unterstützen. So sollen unter anderem Engpässe bei der Produktion identifiziert und beseitigt werden. Im Gespräch ist auch, Produktionsstätten in die EU zurückzuholen. Borrell hat sein Papier zusammen mit Binnenmarktkommissar Thierry Breton ausgearbeitet.
Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow kritisierte die EU-Planungen beim Treffen in Stockholm als unzureichend. Die Ukraine brauche eine Million Artilleriegeschosse, und dafür seien bis zu vier Milliarden Euro notwendig. Hintergrund ist, dass die Ukraine chronisch knapp ist an Artilleriemunition und derzeit nur bis zu maximal 120.000 Schuss pro Monat abfeuern kann, während den russischen Streitkräften gut zehnmal mehr zur Verfügung stehen.
“Wir müssen die Unterstützung ausweiten und dynamisieren“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Ende des Treffens in Stockholm. Zu den Waffensystemen brauche es auch die notwendige Munition, das liege auf der Hand. Die Kapazitäten müssten nun hochgefahren werden, die Industrie die richtigen Entscheidungen treffen. Das geschehe zum Teil schon, brauche aber Zeit. Deshalb müsse es jetzt darum gehen, Bestände zusammenzusuchen und zu liefern, zumindest, was mit Blick auf die eigene Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit möglich sei.
Josep Borrell setzt darauf, dass die Verteidigungsminister beim formellen Rat vom 20. März seinem dreigleisigen Vorschlag zustimmen. Die Munitionsbeschaffung für die Ukraine und die Auffüllung der eigenen Bestände könnte sonst auch am EU-Gipfel vom 23. und 24. März die Staats- und Regierungschefs beschäftigen. sti
Im derzeit abgeschalteten Atomreaktor Nummer 1 in Penly (Nordwestfrankreich) wurde ein neuer Riss entdeckt, der als “signifikant” vom Betreiber EDF in einer Ende Februar veröffentlichten Notiz bezeichnet wurde. Contexte hatte zuerst berichtet. Dieser Riss zwingt das staatliche französische Unternehmen, seine derzeitige Strategie zur Behebung von Korrosionsschäden zu überdenken.
Dieser Riss beeinträchtigt die Festigkeit der Rohrleitungen und die mit der Kühlung des Reaktors verbundene Sicherheitsfunktion, meint die französische Atomaufsichtsbehörde (ASN), die das Ereignis auf Stufe 2 der Ines-Risikoskala einstuft. Laut ASN habe das Ereignis “keine Auswirkungen auf die Umwelt oder das Personal” gehabt. Der Riss erstreckt sich über 155 Millimeter, d. h. etwa einem Viertel des Rohrumfangs und ist bis zu 23 Millimetern tief – bei einer Rohrdicke von 27 mm. “Es ist ein besonders tiefer Riss“, sagte die stellvertretende Generaldirektorin des Instituts für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (IRSN), Karine Herviou, die dazu im öffentlichen Radiosender France Info befragt wurde: “Wir waren ziemlich nahe an einem Leck.”
Während EDF gerade mehr als 150 Schweißnähte prüft und im Laufe des Jahres 2023 die Rohrleitungen aller Reaktoren der Stufe P’4 (1300 MW) austauschen will, fordert die ASN den Betreiber auf, seine Prüfstrategie zu überarbeiten, um diesem Ereignis Rechnung zu tragen. Diese wird “in den nächsten Tagen” vorgelegt werden, so EDF, das am gestrigen Mittwoch außerdem bestätigte, dass auch Korrosionsschäden an drei anderen Reaktoren (Civaux 2, Chooz 2 und Penly 2) entdeckt wurden. Diese Ereignisse werden auf Stufe 1 der Ines-Skala eingestuft.
Bei einer Anhörung im Senat, dem französischen Pendant zum Bundesrat, am Mittwoch, erklärte der Präsident der ASN, Bernard Doroszczuk, dass der Riss auf eine “Abweichung bei der Anpassung der Rohrleitungen bei ihrer Reparatur” zurückzuführen sei, “ein Ansatz, der insofern nicht akzeptabel ist, als man die Rohrleitungen gewaltsam geöffnet hat”, wie er betonte. Die Entdeckung des Risses dürfte Auswirkungen auf die Wiederinbetriebnahme der betroffenen Reaktoren haben. Bisher hält EDF am 2. Mai als Datum für den Wiederanschluss des seit Oktober 2021 abgeschalteten Reaktors Penly 1 an das Netz fest. cst
Am Mittwoch hat Dänemark mit der Einspeicherung von CO₂ unter der Nordsee begonnen. Auf dem ausgeförderten Ölfeld Nini West sollen bis Anfang April in der Pilotphase des Projekts Greensand bis zu 15.000 Tonnen verflüssigtes CO₂ aus Belgien gut 1.800 Meter in die Tiefe gepumpt werden.
“Heute schlagen wir ein neues Kapitel für die Nordsee auf, ein grünes Kapitel”, sagte Dänemarks Kronprinz Frederik. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich positiv per Videobotschaft: “Dies ist ein großer Moment für den grünen Wandel in Europa.”
Beim sogenannten Carbon Capture and Storage (CO₂-Abscheidung und -Einlagerung), kurz CCS, wird CO₂ etwa bei industriellen Prozessen eingefangen, zu einer unterirdischen Lagerstätte gebracht und dort eingespeichert. Bei Greensand arbeitet ein Konsortium um die BASF-Tochter Wintershall Dea und den britischen Chemiekonzern Ineos zusammen. Nach Wintershall-Angaben handelt es sich um die weltweit erste grenzüberschreitende Offshore-CO₂-Einspeicherung, die explizit den Zweck hat, den Klimawandel zu mindern.
Dänemark hatte jüngst erste Zulassungen erteilt, damit Konzerne im größeren Maßstab CO₂ unter dem Nordsee-Grund einlagern können. Ein bilaterales Abkommen mit Belgien ermöglicht dabei den CO₂-Transport nach Dänemark. Das Konsortium aus Wintershall Dea und Ineos hofft, dass die Politik den gesetzlichen Rahmen dafür auch in anderen Ländern schafft – vor allem in Deutschland.
Auf seiner Website stellt Habecks Ministerium die CCS-Technologie bereits als Teil der deutschen Klimastrategie dar. Ab 2050 will man der Atmosphäre sogar mehr Treibhausgas entziehen, als man ausstößt. Damit das klappt, könne für unvermeidbare oder schwer vermeidbare CO₂-Emissionen eine Abscheidung mit anschließender Nutzung oder Speicherung infrage kommen, heißt es von Ministeriumsseite.
Unter Umweltverbänden und Klimaschützern ist CCS dagegen umstritten. Sie fürchten, dass die Technologie den Ehrgeiz beim Klimaschutz und beim Ausbau erneuerbarer Energien dämpft, und warnen vor Gefahren für die Umwelt zum Beispiel durch Leckagen von Kohlendioxid. dpa

Wenn die Bürger in Europa jederzeit Strom und Gas haben, mit dem Zug grenzenlos reisen oder günstig das Internet nutzen können, dann liegt das auch an der Arbeit von Beamtinnen wie Annegret Groebel. Die rührige Volkswirtin hilft seit Jahrzehnten dabei, den Binnenmarkt in den Netzindustrien der EU zusammenzuschweißen: Eisenbahn, Post, Telekommunikation und Energie.
“Vor der Pandemie war ich eigentlich jede Woche in Brüssel oder einer anderen europäischen Stadt”, erzählt die Abteilungsleiterin Internationales der Bundesnetzagentur. Groebel reist in gleich mehreren Rollen durch den Kontinent – etwa als Präsidentin des Council of European Energy Regulators (CEER).
“Wir entwickeln die Methoden, damit Europas Regulierer die Ziele des Brüsseler Rechtsrahmens am besten erreichen können”, sagt die 62-Jährige. Im CEER organisieren sich Europas Regulierungsbehörden und überwachen, wie verbraucherfreundlich die Endkundenmärkte für Gas und Strom funktionieren.
Damit ergänzt das Gremium ACER, die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Die Agentur in Ljubljana soll eher den Großhandel mit Energie beaufsichtigen – und im Regulierungsrat von ACER mischt die omnipräsente Annegret Groebel als Mitglied ebenfalls mit.
In der Energiekrise, in der hohe Preise Europas Verbraucher belasten, liefern die Regulierer den Generaldirektionen Informationen, die später Grundlage von Gesetzesvorschlägen werden. “Als das REPowerEU-Paket kam, hat sich die Kommission schon sehr früh an CEER gewandt und nach Daten zu Lieferverträgen für Strom und Gas gefragt“, erzählt Groebel.
Wie viele Verbraucher haben überhaupt Verträge mit Preisgarantien? Wie haben die Mitgliedstaaten geregelt, ob und zu welchen Tarifen Kunden noch versorgt werden, wenn ihr Lieferant pleitegeht? All diese Fragen hatten auf einmal höchste Dringlichkeit. “Teilweise sind Versorger umgekippt, weil sie sich nicht gegen hohe Preise abgesichert hatten, und in einigen Mitgliedstaaten fallen Kunden nicht automatisch in eine Ersatzversorgung“, berichtet die Regulierungsexpertin.
Solide Daten sind für Groebel auch in der Diskussion um eine Reform des Strommarktdesigns essenziell: “Ohne ausreichende Informationen besteht das Risiko, dass die Politik gut gemeinte Vorschläge macht, aber eine Reform fehlschlägt.” Besonders vor einem Schritt warnt die CEER-Präsidentin: “Der EU-Gesetzgeber sollte den Strompreis nicht vom Gaspreis entkoppeln. Die Preissignale des Marktes nach der Merit Order der Kraftwerke drücken Knappheiten aus und bilden das Fundament für den Stromhandel zwischen den EU-Staaten“, erklärt Groebel.
“Wenn das Marktdesign zu stark angepasst wird, besteht die Gefahr, den europäischen Binnenmarkt zu verzerren und schlimmstenfalls zu zerstören. Die Regulierungsbehörden müssten zu viele Methoden für den grenzüberschreitenden Stromhandel ändern. Das können innerhalb weniger Monate weder die Behörden handhaben noch die Marktakteure umsetzen.” Außerdem wären laut Groebel Investoren verunsichert, wenn die Preise ihre Anreizwirkung verlören, sodass nicht ausreichend in erneuerbare Energien und Flexibilität investiert würde.
Erst Anfang Februar hatte der Europäische Rechnungshof moniert, dass die Mitgliedstaaten bisher nicht einmal alle Regulierungsmethoden nach dem dritten Energiemarktpaket von 2009 vollständig umgesetzt hätten.
Die Karriere von Annegret Groebel begann bereits ein Jahrzehnt früher bei der Geburt der europäisch regulierten Märkte in den Netzindustrien. Nach der Promotion in Mannheim kam die Volkswirtin 1997 in das Postministerium: “Angestellt wurde ich damals aber schon für die neue Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Damals haben wir in Bonn bereits etwas gemacht, was es noch in keinem anderen europäischen Land gab.”
Die Tüftler in den Amtsstuben hatten eine Methode ersonnen, um die Leitungen der Telefonanschlüsse der Kunden vom “Monopolisten” Deutsche Telekom zu entbündeln und sie vollständig neuen Wettbewerbern zugänglich zu machen. “In anderen Ländern gab es ein großes Interesse, wie das funktioniert. Und da ich in der zuständigen Kammer war und auch noch Englisch konnte, bin ich eingeladen worden mitzufahren”, erzählt Annegret Groebel.
Der Präsident der Behörde holte die Hessin 2001 in den Stabsbereich, wo sie nach und nach den Bereich Internationales aufbaute, der dann mit der Postabteilung zusammengelegt wurde. In Brühl machte die Volkswirtin an der Europäischen Fachhochschule noch einen Master of European Administrative Management. “Den konnte man glücklicherweise nebenher machen, und dieses Studium hat mir ein Grundgerüst an europäischem Wissen für meine tägliche Arbeit gegeben”, erzählt die vor Wissen sprudelnde Ökonomin.
Umgekehrt kommt Annegret Groebel ihr breiter Erfahrungsschatz in Brüssel zugute. “In europäischen Gremien bekommt man nie alle auf genau dieselbe Methode eingeschworen. Das richtige Maß an Konsistenz und Handlungsspielräumen hinzubekommen, das ist das Kunststück in der EU.” Manuel Berkel