in dieser Woche wird die EU-Kommission den zweiten Teil ihres Naturschutzpakets für den Green Deal vorstellen. Geplant sind ein neues Bodengesundheitsgesetz, eine Verordnung über Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken erzeugt wurden, die Überarbeitung der EU-Abfallrahmenrichtlinie hinsichtlich Lebensmittel- und Textilabfällen sowie die Überarbeitung der Rechtsvorschriften über Saatgut.
Das Paket kommt zu einem heiklen Zeitpunkt und hätte eigentlich schon Anfang Juni vorgestellt werden sollen. Doch die Debatte um das erste Naturschutzpaket aus Renaturierungsgesetz und Pestizide-Verordnung hat für ordentlich Wirbel gesorgt und die Kommission womöglich auch dazu veranlasst, den zweiten Teil aufzuschieben und noch einmal zu überarbeiten. Denn die EVP will weiterhin alle neuen Gesetze, die den Agrarsektor betreffen, blockieren. Und die Drohung zeigt offenbar Wirkung.
Ursprünglich wollte die Kommission den Mitgliedstaaten strengere Regeln und verbindliche Grenzwerte für gesunde Böden auferlegen. Nun kommt es anders, heißt es aus Kommissionskreisen. Auch aus einem Entwurf des Gesetzes geht hervor: Statt ein ambitioniertes Bodengesundheitsgesetz soll es im Wesentlichen um Datenerhebung und Monitoring gehen – um den Erosionsgrad und den Gehalt von Kohlenstoff und schädlichen Chemikalien. Die neue Verordnung für genmodifizierte Pflanzen dagegen sieht Lockerungen der Regeln vor, darunter die Abschwächung der Kennzeichnungspflicht – ganz im Sinne der EVP. Umwelt- und Verbraucherschützer sowie auch das Bundeslandwirtschaftsministerium üben Kritik.
Auch wenn Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans vorgibt, sich nicht von der EVP beeinflussen zu lassen, steht außer Frage, dass der Kurs von Manfred Weber den von ihm erhofften Effekt erzielt: weniger Naturschutz und weniger strenge Regeln für europäische Landwirte. Ob das die Debatte allerdings entspannen wird, ist unwahrscheinlich. Das nächste Kapitel folgt am Mittwoch, wenn die Kommission die Vorschläge offiziell vorstellt.

Eigentlich sollte der EMFA die Medienfreiheit in der gesamten EU garantieren. Insbesondere die gewaltsamen Tode von Ján Kuciak in der Slowakei und von Daphne Caruana Galizia auf Malta zeigten die Dringlichkeit eines besseren Schutzes auf. Ereignisse in Ungarn, Polen und Griechenland, wo Regierungen mit umstrittenen Maßnahmen einzelne Journalisten drangsalierten, etwa durch Spyware-Einsätze, erhöhten den Handlungsdruck.
Kernanliegen des Vorhabens: Etwa die Unabhängigkeit von Medien vom politischen Betrieb zu garantieren. Das könnte zum Beispiel in Frankreich nötig werden, wo die öffentlich-rechtlichen Medien inzwischen über Steuern statt Haushaltsabgaben finanziert werden. Ein weiteres Ziel des Media Freedom Acts: Dass große Digital-Intermediäre die Unabhängigkeit der Presse auch auf ihren per DSA regulierten Angeboten gewährleisten müssen und sie diese nicht wie beliebige andere Nutzerinhalte behandeln dürfen.
All das wollte EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová eigentlich per EU-Verordnung adressieren. Doch bereits der Entwurf der EU-Kommission stieß auf ein geteiltes Echo: Gut gemeint ist nicht gut gemacht, hieß es da. Die deutschen Bundesländer kritisierten das Vorhaben, per Verordnung den Bundesländern Vorgaben zur Medienregulierung zu machen, das sei europarechtlich nicht vorgesehen und ein Verstoß gegen die Europäischen Verträge. Höchstens eine Richtlinie, deren Umsetzung und konkrete Ausgestaltung den Mitgliedstaaten überlassen wäre, sei denkbar.
Der Bundesrat beschloss eine formale Rüge. Das wiederum sorgte für scharfe Kritik aus der EU-Kommission: Deutschland stelle sich damit faktisch an die Seite Ungarns und Polens. Die kritisieren das Gesetz zwar aus ganz anderen Gründen, aber das warum ist für das Zustandekommen von Mehrheiten eben zweitrangig.
Die Hoffnung der deutschen Vertreter lag zuerst auf einem Rechtsgutachten des juristischen Dienstes des Rates. Das sollte die deutsche Auffassung bestätigen – sah aber im Ergebnis keine größeren Probleme mit der gewählten Rechtsgrundlage und der Kompetenz der EU. Eine politische Blamage für die Ländervertreter, die das Argument seitdem nur noch kleinlaut anführen: Man könne das vielleicht auch anders sehen.
Tatsächlich zeigte die Debatte in Rat und den zuständigen Parlamentsausschüssen aber schnell die ersten großen Probleme mit den hehren Zielen und dem mäßigen Vorschlag der Kommission. Insbesondere im Rat zeigte sich, dass einige Mitgliedstaaten sehr genau darauf achten, dass der Schutz von Journalisten auf keinen Fall dazu führt, die Hürden für eine Überwachung besonders hoch zu hängen. In der Ratsposition verstecken sich wenig Verbesserungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag, der an zu vielen Stellen viel zu ungenau formuliert war. Für einen Aufschrei sorgt hingegen der Plan der Mitgliedstaaten, den Kommissionsvorschlag bei der Überwachung von Journalisten deutlich abzuschwächen.
Der Vorfall des angezapften Pressetelefons der Letzten Generation in Deutschland ist dabei harmlos, angesichts der Vergleichsmaßstäbe. Gezielte Ausspähung mit neuester Überwachungstechnologie in Polen oder Ungarn etwa, mit der Mobiltelefone gezielt ausgeforscht wurden, beschäftigten das EP im PEGA-Sonderausschuss intensiv. Doch das Schleifen des Informanten- und Quellenschutzes wurde nicht vor allem von der Orbán-Regierung oder aus Warschau vorangetrieben. Frankreich, mit seiner Tradition eines überaus starken Staates, unterbreitete den entsprechenden Vorschlag. Selbst Österreichs Änderungswünsche gingen in die gleiche Richtung.
Und Deutschland? “Wir wissen auch, dass weitere Verbesserungen wünschenswert sind, zum Beispiel beim Verhältnis des journalistischen Quellenschutzes zur nationalen Sicherheit”, schreibt Kulturstaatsministerin Claudia Roth in dieser Woche in einem Gastbeitrag für die FAZ. Die Grünenpolitikerin hat gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) die Verhandlungen im Rat für Deutschland geführt, ohne nennenswerten Erfolg. Stattdessen wird nun, wie derzeit anscheinend üblich, in Deutschland wieder einmal auf das Europaparlament gehofft.
Gestritten wird auch dort intensiv – und mit dem Rat. Scharfe Kritik an der Ratsposition zum Media Freedom Act kam etwa am Freitag vom konservativen IMCO-Berichterstatter Didier Geoffroy. “Als Berichterstatter des Medienfreiheitsgesetzes im Europäischen Parlament fordere ich @EmmanuelMacron und seine Regierung auf, ihren Plan aufzugeben, Journalisten legal ausspionieren zu können. Diese europäische Verordnung muss den Pluralismus schützen und nicht die Polizeiarbeit genehmigen!” twitterte Geffroy, offenbar wütend auf die französische Regierung.
Der LIBE-Ausschuss ist für diesen komplizierten Teil des Medienschutzes, der mit den nicht vereinheitlichten Bereichen der inneren Sicherheit kollidiert, federführend zuständig. Und auch im CULT-Ausschuss wird intensiv am EMFA gearbeitet. Die Abgeordneten dort haben bereits einige Fortschritte im Dossier erzielen können.
Doch auch hier liegen noch einige heikle Debatten vor den Verhandlern, bis die längst ersehnte Sommerpause naht. Etwa die hochumstrittene Frage, ob das deutsche öffentlich-rechtliche Mediensystem die hohen Anforderungen des geplanten Artikels 5 vollumfänglich erfüllt. Der Kommissionsvorschlag konnte hier so gelesen werden, dass die Auswahl und Wahl von Mitgliedern der Geschäftsleitung der deutschen Sendeanstalten künftig mit anderen Verfahren als den derzeit, auch in Deutschland in der Kritik stehenden, gefunden werden müssen.
Selbst die Frage der Medienkonzentration auf europäischer Ebene hat nach dem Tod Silvio Berlusconis neue Fahrt aufgenommen. Denn dessen Doppelrolle als Politiker und Medienmogul verhinderte bislang etwa die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch sein Medienkonglomerat. Die Vielzahl an Änderungsanträgen wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter gelichtet werden. Wie standfest sich das Parlament beim Schutz der Medienfreiheit wirklich aufstellen will, ist dabei kaum abzusehen. Derzeit ist das Ziel der Verhandlungen im Europaparlament der September. Wahrscheinlicher ist aber eine Abstimmung über den Bericht im Oktoberplenum. Danach könnte es im November in den Trilog gehen.
Doch selbst im Trilog könnte das Vorhaben noch scheitern. Denn läuft es schlecht, könnte das sogenannte Medienfreiheitsgesetz am Ende das Gegenteil von dem sein, was damit beabsichtigt ist: eine niedrigschwellige Definition von Mindestkriterien, die selbst die Problemstaaten ohne große Änderungen erfüllen.
Schon wird in Verhandlerkreisen spekuliert, ob der Vorschlag nicht doch durch die Kommission zurückgezogen wird, wenn die Mitgliedstaaten so weitermachen. Denn die Blöße, ein Medienfreiheitsgesetz zu verabschieden, das im Ergebnis die Standards für viele senkt und wenig hilft, wolle man sich dort zum Ende der Legislatur mit einer ungarischen und dann einer polnischen Ratspräsidentschaft eher nicht geben.
Sie sei “entschlossen, den Media Freedom Act durch den legislativen Prozess zu steuern”, ließ Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová am Freitag die European Broadcasting Union wissen. Es gehe darum, dass das Gesetz einen “Wandel zum Besseren, ein Sicherheitsnetz für die Medien und notwendige und fehlende Sicherungen für die Medien” schaffen müsse. Daran wird sie sich messen lassen müssen.
Im Herbst 2022 hatten EU-Klimapolitiker einen Verdacht: Die Kommission würde in Abstimmung mit der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft so viele Dossiers des Klimapakets Fit for 55 durchdrücken wie möglich – bevor Schweden im Januar 2023 die Ratspräsidentschaft übernahm. Die Befürchtung: Die neu gewählte rechte schwedische Regierung, die sich auf die rechtsextremen, EU-skeptischen Schwedendemokraten stützt (die teilweise den Klimawandel leugnen), könnte versuchen, legislative Entscheidungen zu Fragen von Klimapolitik und EU-Green-Deal zu blockieren.
Am Ende der schwedischen Ratspräsidentschaft zeigt sich: Die Befürchtungen waren teilweise berechtigt, weil sich Schweden – als Mitgliedstaat – in einigen Fällen (alle im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft) gegen die von Schweden – dem EU-Ratspräsidenten – vorgelegten Kompromisse stellte. Allgemein aber habe die schwedische Regierung die Rolle des “ehrlichen Maklers” in der EU-Präsidentschaft gut und professionell ausgefüllt, so Experten. Und sie hat viele Vorschläge der Kommission in Beschlüsse oder zumindest in Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament überführt.
Langfristig am wichtigsten war wohl die endgültige Verabschiedung der neuen Fassungen der drei Säulen der EU-Klimagesetzgebung:
In allen drei Fällen wurden die Trilog-Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament bereits während der tschechischen Präsidentschaft abgeschlossen. Die Schweden verwalteten nur noch die formellen Beschlüsse, die im März und April 2023 gefasst wurden. Damit gibt es seit Mai eine EU-Gesetzgebung, die garantiert, dass die Netto-Treibhausgasemissionen der EU 2030 um 57 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen werden. Das ist ein Meilenstein.
Darüber hinaus wurden während der schwedischen Ratspräsidentschaft Vereinbarungen über mehr als zehn sektorbezogene Klimagesetzgebungen getroffen. Unter ihnen sind:
Zu Bremsern im Prozess wurden nicht wie erwartet die Schweden, sondern die deutsche und die französische Regierung. Plötzlich unterstützten sie Trilog-Vereinbarungen nicht mehr, denen sie zuvor zugestimmt hatten:
Diese Konflikte wurden schließlich gelöst, offenbar mehr durch Interventionen der Kommission als durch Bemühungen des Ratspräsidenten, hieß es in Brüssel.
Deutlich wurde auch wieder einmal bei mehreren Gelegenheiten, dass Schweden in Fragen der Forstwirtschaft im Widerspruch zur Mehrheit der Union steht. Schweden enthielt sich der Stimme, als die endgültigen Beschlüsse über die Verordnungen zur Entwaldung und zu den Kohlenstoffsenken (LULUCF) gefasst wurden. Das Argument: Die neuen Rechtsvorschriften würden der Entwicklung einer nachhaltigen Forstwirtschaft schaden.
In einer Koalition mit anderen Mitgliedstaaten gelang es Schweden auch, die Naturschutzanforderungen an Waldbiomasse in der Richtlinie über erneuerbare Energien zu verwässern. Diese Anforderungen garantieren eine “Nullanrechnung” der Emissionen aus biogenem Kohlendioxid im Rahmen des Emissionshandelssystems. Der Hintergrund: Bei strengeren ökologischen Anforderungen an die Forstwirtschaft müssten die schwedische Zellstoff- und Papierindustrie sowie die vielen großen schwedischen Fernheizwerke, die auf Biomasse basieren, viel Geld für den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeben, um diese Emissionen abzudecken.
Bemerkenswert allerdings: Auf der letzten Tagung des Umweltrates unter schwedischer Führung am 20. Juni stimmte Schweden gegen seinen eigenen Kompromiss für einen gemeinsamen Standpunkt der EU-Regierungen zur Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (“Nature Restoration Law”). Eine Woche vor der Tagung zog Schweden einen Kompromisstext, der bereits von einer stabilen Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt wurde, von der Tagesordnung der Sitzung der EU-Botschafter zurück.
Mehrere Mitgliedstaaten werteten dies als Hinweis darauf, dass Schweden nicht beabsichtigte, den Kompromiss auf der Ministertagung vorzulegen, wodurch sich seine Annahme verzögerte. Aus Protest schrieben Frankreich, Deutschland, Spanien und Luxemburg einen Brief an Schweden und baten um Klarstellung. Schließlich tauchte das Thema auf der Tagesordnung des Rates auf, wo der schwedische Kompromissvorschlag trotz der Gegenstimme Schwedens weitgehend angenommen wurde.
“Im Allgemeinen wurde die Ratspräsidentschaft sehr professionell und erfolgreich geführt, aber der Umgang mit der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur könnte ihr einen kleinen Makel verpassen”, meint Ylva Nilsson, Kommentatorin der Tageszeitung Expressen. “Schweden ist bekannt dafür, dass es ziemlich aggressiv ist, wenn es um Umweltanforderungen an die Forstwirtschaft und die Forstindustrie geht”.
Mats Engström, leitender Berater beim Schwedischen Institut für Europapolitik (SIEPS), erklärt das schwedische Votum gegen den eigenen Kompromiss zum “Nature Restoration Law” damit, es passe zur Rolle des Ratsvorsitzes als “ehrlicher Makler”. Er fügt hinzu: “Das Verhalten ist selten, kommt aber hin und wieder vor. Was es problematisch und bemerkenswert macht, ist das Protestschreiben von vier Mitgliedsstaaten”. Magnus Nilsson
Mehrere Fraktionen im EU-Parlament fordern von der EU-Kommission, den Entwurf für die Europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards (ESRS) nachzuschärfen. Table.Media liegt ein Brief vor, den eine Gruppe Abgeordneter um Pascal Durand (Frankreich, S&D) am vergangenen Donnerstag an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Vizepräsidenten der Kommission, Valdis Dombrovskis, und Finanzkommissarin Mairead McGuinness geschickt hat. Durand war Berichterstatter für die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), für deren Anwendung die neuen Standards entwickelt werden.
Die Abgeordneten fordern in ihrem Schreiben die Beibehaltung der ursprünglich geplanten Pflicht zu verbindlichen Erklärungen in den Nachhaltigkeitsberichten. Die Kommission gestattet den Unternehmen in ihrem Entwurf für einen delegierten Rechtsakt anhand einer Wesentlichkeitsanalyse die Notwendigkeit zu bemessen, bestimmte Informationen offenzulegen. Dabei müssen sie keine Begründung vorlegen, die Wesentlichkeitsanalyse ist zudem nicht standardisiert.
Das Beratungsgremium EFRAG hatte im November 2022 eine Empfehlung für einen ersten Satz an branchenunabhängigen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der CSRD veröffentlicht. Die Kommission hatte ihren darauf basierenden Entwurf am 9. Juni vorgelegt. Die vierwöchige Konsultationsphase endet am 7. Juli.
Zehn für die Weiterverfolgung der CSRD zuständige Abgeordnete der S&D, Renew, Grünen und Linken haben den Brief unterzeichnet, darunter René Repasi, Lara Wolters (beide S&D), Bas Eickhout und Marie Toussaint (beide Grüne). Das Schreiben ist ihre offizielle Antwort auf die Konsultation zum delegierten Rechtsakt, erklärten sie. “Ich bedauere, dass die EVP unsere Bemerkungen zur Stärkung des delegierten Rechtsakts nicht unterstützt”, sagte Pascal Durand.
“Die ursprüngliche Absicht der Kommission und des von den Mitgesetzgebern bekräftigten Mandats war es, verbindliche Erklärungen vorzuschreiben, in denen erforderlichenfalls begründet wird, warum ein bestimmter Indikator oder Datenpunkt nicht wesentlich ist“, heißt es in dem Brief. “Der verbindliche oder begründete Charakter der Standards ist der Schlüssel zu zuverlässigen, gemeinsamen und unverzerrten Informationen.”
Es sei daher notwendig, den obligatorischen Charakter der Datenpunkte zum Klima wieder einzuführen,
unabhängig vom Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen. Wie von der EFRAG gefordert, sei es außerdem notwendig, die Unternehmen zu verpflichten, im Falle einer fehlenden Wesentlichkeit auch eine Begründung anzuführen. leo
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treibt die Arbeit an einer Sonderabgabe auf Gewinne aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen voran, trotz der Bedenken von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundeskanzler Olaf Scholz. Von der Leyen sagte nach dem EU-Gipfel am Freitag, die EU und ihre Verbündeten hätten den wichtigsten Schritt bereits vor über einem Jahr getan, als sie nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine erstmals mehr als 200 Milliarden Euro an russischen Zentralbankguthaben blockierten. Die Reaktionen an den Finanzmärkten darauf seien sehr ruhig ausgefallen, sagte von der Leyen. Das sei “ein Indiz dafür, dass der von uns gewählte vorsichtige Ansatz sehr gut verstanden wird”.
Scholz bezeichnete die Nutzung von Erträgen des eingefrorenen russischen Vermögens hingegen als “furchtbar kompliziert”. Niemand wisse gegenwärtig, “was überhaupt geht und wie”. Die Staats- und Regierungschefs hätten die Kommission gebeten, sich weiter “den Kopf zu zerbrechen” und ihn und seine EU-Kollegen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu informieren. Es wird erwartet, dass von der Leyen bis Ende Juli einen Vorschlag präsentiert.
90 Prozent der Zentralbankgelder sind in Belgien bei der Clearingstelle Euroclear eingefroren. Die Erlöse etwa durch Steuern oder Zinsen würden auf drei Milliarden pro Jahr geschätzt, sagte der belgische Premier Alexander De Croo. Die Gelder sollen für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Die Weltbank schätzt die Kosten dafür auf mehr als 400 Milliarden Dollar.
Am Freitag hatten die Staats- und Regierungschefs noch über die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die China-Politik diskutiert, ohne größere Überraschungen. So forderten sie unter anderem die Einsetzung einer hochrangigen Expertengruppe, die bis März 2024 einen unabhängigen Bericht über die Zukunft des Binnenmarkts vorlegen soll. Dies ist ein Anliegen der belgischen Regierung, die Anfang 2024 den rotierenden Vorsitz im Rat der EU übernimmt.
Geprägt worden war der Gipfel von einem Streit über die Migrationspolitik: Ungarn und Polen verhinderten eine gemeinsame Erklärung zur Migrationspolitik und drohten weitere Schritte an. Die beiden Staaten protestierten dagegen, dass die Asylpläne von den Innenministern vor rund drei Wochen gegen ihren Willen per Mehrheitsentscheidung auf den Weg gebracht wurden. Aus Sicht von Scholz und von der Leyen wird die Blockade den Gesetzgebungsprozess allerdings nicht aufhalten. tho/dpa
Das neutrale Österreich plant den Beitritt zum deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems. Das gab Kanzler Karl Nehammer am Wochenende bekannt. “Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft”, begründete der konservative Politiker die laufenden Beitrittsverhandlungen. Österreich müsse sich deshalb gemeinsam mit anderen europäischen Ländern vor Drohnen- und Raketenangriffen schützen.
Die von Deutschland initiierte “European Sky Shield Initiative” soll vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine helfen, Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt es beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern. Mehr als ein Dutzend europäische Staaten haben sich dem Projekt bereits angeschlossen.
Österreichs Status als militärisch neutraler Staat sei durch einen Beitritt nicht gefährdet, sagten Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in einer gemeinsamen Erklärung. “Es handelt sich um die Beteiligung an einem Schutzschirm, der zur Gefahrenabwehr dient”, argumentierten sie.
Österreich, Irland und Malta hatten als neutrale EU-Mitglieder diese Woche weitreichende Sicherheitsgarantien der Europäischen Union für die Ukraine blockiert. dpa
Zur Strommarktreform haben die Ständigen Vertreter auch bei ihrer letzten Sitzung unter schwedischer Präsidentschaft am Freitag keine Einigung erzielen können. Grund sei abermals der Widerstand Frankreichs wegen ungewisser Fördermöglichkeiten für die Atomenergie gewesen, berichtete eine Quelle aus dem Rat. Damit muss nun die spanische Ratspräsidentschaft versuchen, eine gemeinsame Position unter den Mitgliedstaaten zu finden.
Erörtern könnten die Energieminister die Reform am Rande ihres informellen Treffens am 11. und 12. Juli im nordspanischen Valladolid. Bisher stehen allerdings andere Themen auf dem Programm, wie die Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz COP28 und die “effektivere Kommunikation von Vorteilen der Klima- und Energiepolitik”.
In einem letzten Kompromissversuch hatte Schweden zur Vorbereitung des Treffens am Freitag genauere Regeln für die Förderung über CfDs vorgeschlagen. Demnach soll es Differenzverträge für den Retrofit von bestehenden Kraftwerken nur geben, wenn die erneuerte Anlage anschließend noch mindestens zehn Jahre läuft und die Investition den Wert des Kraftwerks mindestens verdoppelt.
Bei der Rückverteilung von Einnahmen aus CfDs kamen die Schweden der Industrie noch weiter entgegen. Sie strichen die entscheidende Einschränkung, dass die Staaten nur so viel an Unternehmen umverteilen dürfen, wie es dem Gesamtanteil des Unternehmenssektors am nationalen Stromverbrauch entspricht. Die EU-Staaten sollen ausdrücklich die Gelegenheit bekommen, einzelne Gruppen von Unternehmen zu bevorzugen, soweit es das Wettbewerbsrecht zulässt. Ein entsprechendes Konzept hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Mai für die im internationalen Wettbewerb stehende Industrie vorgeschlagen.
Die Abschöpfung von Übererlösen von bestehenden Erneuerbaren-Anlagen und Atomkraftwerken wollte Schweden außerdem bis Mitte 2024 verlängern. Vor allem Spanien drängt auf diese Möglichkeit, Bundesregierung und Kommission stehen ihr skeptisch gegenüber. Im Parlament setzt sich auch der spanische Berichterstatter Nicolas Casares für eine längere Erlösabschöpfung ein. ber
Europaabgeordnete und die EU-Kommission haben am Freitag verärgert auf den offenen Brief zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz reagiert, den 150 Wirtschaftsvertreter nach Brüssel geschickt haben. Handelsblatt und Financial Times hatten ihn zuvor veröffentlicht. “Ich bin überzeugt, dass sie den Gesetzestext nicht sorgfältig gelesen haben”, sagte Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter des AI Acts.
Unterzeichnet haben den Brief unter anderem die Chefs von Deutscher Telekom, Siemens und Airbus, aber auch der des französischen KI-Start-up Mistral AI, das gerade 105 Millionen Euro Finanzierung eingesammelt hat. Der Gesetzesentwurf würde “die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährden”, ohne den Herausforderungen wirksam zu begegnen, heißt es im Schreiben. Dies gelte vor allem für generative KI.
Als die Kommission ihren Entwurf 2021 vorgelegte, war generative KI weder so weit entwickelt noch stand sie so sehr im Zentrum des öffentlichen Interesses wie heute. “Die neue KI-Verordnung wird dafür sorgen, dass die Europäer den Möglichkeiten der KI vertrauen können”, sagte ein Sprecher der Kommission. Die geplanten Vorschriften seien ausgewogen, risikobasiert und zukunftssicher und “werden sich mit den spezifischen Risiken von KI-Systemen befassen und weltweit den höchsten Standard setzen”.
Die Trilog-Arbeitsgruppen beginnen ihre Arbeit am AI Act am heutigen Montag. Das Table.Media vorliegende Arbeitspapier (4-column-document) enthält die Vorschläge des Parlaments zu generativer KI. Das Thema wird also Verhandlungsgegenstand im Trilog sein. Der Trilog soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Die einzigen konkreten Vorschläge im Brief entsprächen dem, was der Parlamentstext bereits enthalte, sagte Tudorache. “Ein von der Industrie geleiteter Prozess zur Festlegung von Standards, Governance, mit der Industrie am Tisch. Und ein leichtes Regulierungssystem, das Transparenz fordert.” Es sei schade, “dass die aggressive und irreführende Lobby einiger weniger” andere seriöse Unternehmen vereinnahme. Im gesamten Gesetzgebungsverfahren habe das Parlament mit Unternehmen zusammengearbeitet.
Ähnlich äußerte sich auch Sergey Lagodinsky, Schattenberichterstatter der Grünen. Er höre gern den Stimmen aus der Wirtschaft zu. Aber er ziehe es dabei vor, informierten und abwägenden Stimmen zuzuhören und keiner “Lobby-Stimmungsmache in Form von offenen Briefen“. Die habe auch wenig mit den konkreten Sorgen der KI-Entwickler oder dem Gesetzentwurf zu tun. Auf dieser Basis funktioniere kein Gespräch, sagte Lagodinsky. “Das sind Brief-Ultimaten mit Falschinformationen.”
Axel Voss, Schattenberichterstatter der EVP, sieht das anders: “Der Aufschrei der Wirtschaft ist völlig berechtigt, auch wenn er jetzt sehr, sehr spät kommt.” An einigen Stellen enthalte der Parlamentstext nicht wirklich umsetzbare Anforderungen. “Einiges ist überzogen und vieles viel zu umständlich”, sagte Voss. “Als EVP haben wir alleine schon unzählige Punkte ausfindig gemacht, die geändert werden müssten, um den Text halbwegs praktikabel zu machen.” Er hoffe, dass das im Trilog noch erreicht werden könne. “Wenn es so bleibt, ist der AI Act für die einen der Grund, Europa zu verlassen und für die anderen der Grund, besser erst gar nicht mit neuen Ideen anzufangen.” Beides könne nicht Intention des Gesetzgebers sein.
Antonio Krüger, Informatiker und CEO des Deutschen Forschungszentrums für KI (DFKI) hält die Sorgen der Wirtschaft ebenfalls für berechtigt. Daher hat auch er den Brief für das DFKI mitunterzeichnet. “Regulierung ist wichtig”, sagte Krüger. “Aber gleichzeitig sollten genauso viele Anstrengungen unternommen werden, KI-Innovationen in Europa voranzubringen.” vis
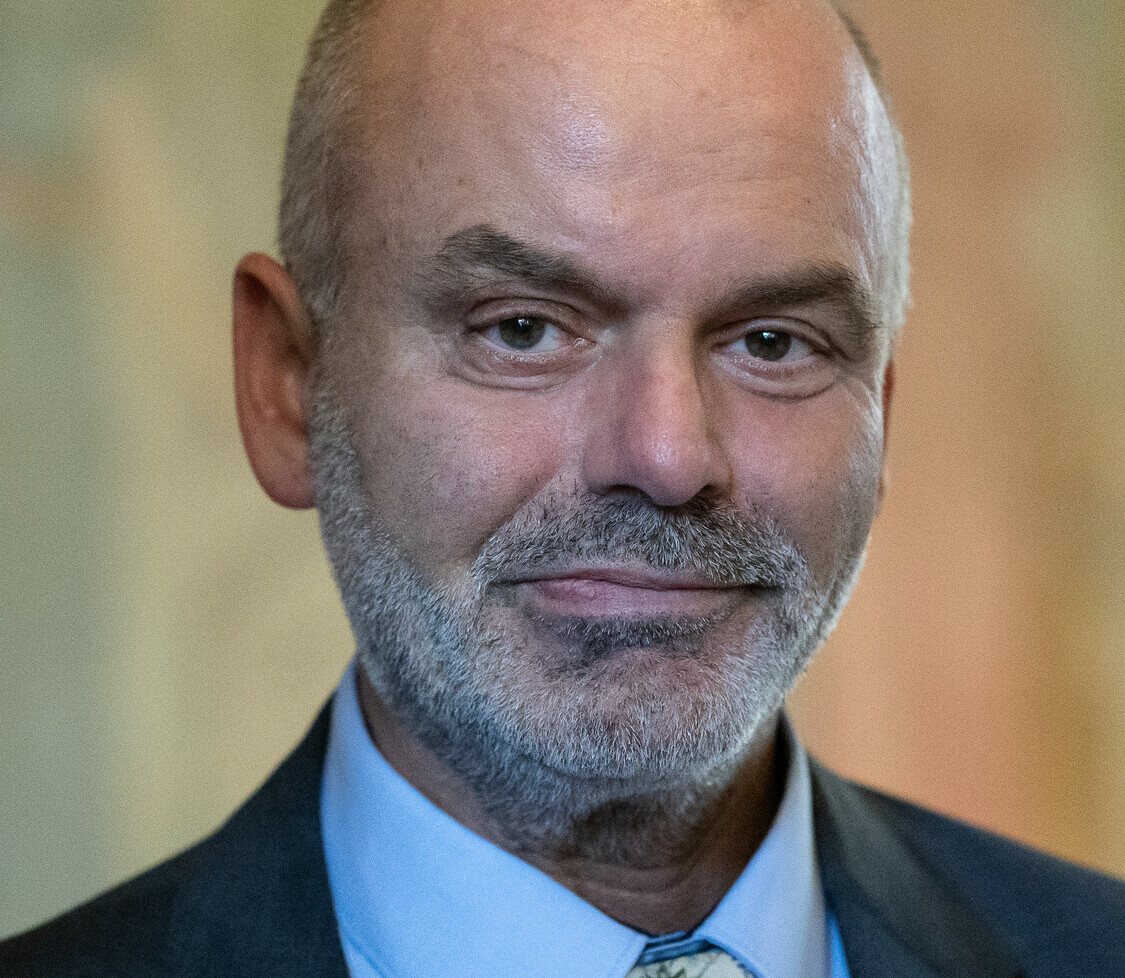
“Ich lebe die EU”, sagt der 58-jährige Wahl-Hanseat Thorsten Augustin frei heraus. Frühzeitig über aktuelle EU-Politiken, Rechtsetzungsverfahren und europapolitische Entwicklungen zu informieren, steht im Fokus von Thorsten Augustins Aufgaben. Der Jurist leitet das Hanse-Office für Schleswig-Holstein, eine gemeinsame Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der Europäischen Union. Die Vielfalt der beiden heimischen Standorte versuchen sein Team und er durch Veranstaltungen, Begegnungen und kulturelle Ereignisse in Brüssel zu präsentieren.
Der Ukraine-Krieg überschattet aus Augustins Sicht derzeit alles andere. “Alles ist durcheinander geraten. Die Auswirkungen haben die gesamte Politik auf den Kopf gestellt.” Und offenbar nicht nur die Politik. Die Abkommen der EU seien für ihn immer das größte Friedensprojekt gewesen. Der globale Handel – für den studierten Juristen bisher eine Friedensdividende. Russland hat ihn hier jedoch, sagt Augustin, eines Schlechteren belehrt.
Mit der Europäischen Union beschäftigt sich Augustin seit knapp 30 Jahren. Den gebürtigen Mindener lässt sie nicht mehr los. Und er ist sich sicher, dass das jedem so ergeht, der sich einmal mit dem Thema befasst. Die EU sieht er als “Chancenraum”, in dem es unglaublich viele Möglichkeiten gibt zu arbeiten und sich zu entwickeln. Deshalb ist Augustin auch großer Befürworter des Erasmus+ Förderprogramms. Dass es trotzdem nicht so leicht ist, junge Menschen für Brüssel zu begeistern, muss Augustin immer wieder feststellen.
1992 hat es Augustin ins Bonner Bundesfinanzministerium unter der Leitung von Theo Waigel geführt. Dort war er unter anderem mit der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Euro-Einführung befasst, später wechselte er dann in die deutsche EU-Botschaft nach Brüssel. Im Rückblick auf seine Laufbahn sieht Augustin entscheidende Veränderungen. Die frühzeitige Berichterstattung durch die Ländervertretungen sei nicht mehr exklusiv. “Jede Entscheidung in Brüssel ist in wenigen Minuten transparent”, sagt er. Umso wichtiger sei es, das große Ganze zu sehen und einordnen zu können.
Die zielstrebige Lebensweise der Norddeutschen hat den gebürtigen Ostwestfalen sehr geprägt. “Der Norden spricht Klartext, und das passt zu mir”, sagt er. Für die Entscheidungsverfahren auf EU-Ebene gelte für ihn: Alles hänge mit allem zusammen. “Jedes kleine Teilchen, das man in Brüssel bewegt, hat Auswirkungen.” Wenn es jemals ein fehlendes Puzzleteil in Augustins Leben gegeben hat, hat er es sicher in der belgischen Hauptstadt gefunden. Julia Klann
in dieser Woche wird die EU-Kommission den zweiten Teil ihres Naturschutzpakets für den Green Deal vorstellen. Geplant sind ein neues Bodengesundheitsgesetz, eine Verordnung über Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken erzeugt wurden, die Überarbeitung der EU-Abfallrahmenrichtlinie hinsichtlich Lebensmittel- und Textilabfällen sowie die Überarbeitung der Rechtsvorschriften über Saatgut.
Das Paket kommt zu einem heiklen Zeitpunkt und hätte eigentlich schon Anfang Juni vorgestellt werden sollen. Doch die Debatte um das erste Naturschutzpaket aus Renaturierungsgesetz und Pestizide-Verordnung hat für ordentlich Wirbel gesorgt und die Kommission womöglich auch dazu veranlasst, den zweiten Teil aufzuschieben und noch einmal zu überarbeiten. Denn die EVP will weiterhin alle neuen Gesetze, die den Agrarsektor betreffen, blockieren. Und die Drohung zeigt offenbar Wirkung.
Ursprünglich wollte die Kommission den Mitgliedstaaten strengere Regeln und verbindliche Grenzwerte für gesunde Böden auferlegen. Nun kommt es anders, heißt es aus Kommissionskreisen. Auch aus einem Entwurf des Gesetzes geht hervor: Statt ein ambitioniertes Bodengesundheitsgesetz soll es im Wesentlichen um Datenerhebung und Monitoring gehen – um den Erosionsgrad und den Gehalt von Kohlenstoff und schädlichen Chemikalien. Die neue Verordnung für genmodifizierte Pflanzen dagegen sieht Lockerungen der Regeln vor, darunter die Abschwächung der Kennzeichnungspflicht – ganz im Sinne der EVP. Umwelt- und Verbraucherschützer sowie auch das Bundeslandwirtschaftsministerium üben Kritik.
Auch wenn Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans vorgibt, sich nicht von der EVP beeinflussen zu lassen, steht außer Frage, dass der Kurs von Manfred Weber den von ihm erhofften Effekt erzielt: weniger Naturschutz und weniger strenge Regeln für europäische Landwirte. Ob das die Debatte allerdings entspannen wird, ist unwahrscheinlich. Das nächste Kapitel folgt am Mittwoch, wenn die Kommission die Vorschläge offiziell vorstellt.

Eigentlich sollte der EMFA die Medienfreiheit in der gesamten EU garantieren. Insbesondere die gewaltsamen Tode von Ján Kuciak in der Slowakei und von Daphne Caruana Galizia auf Malta zeigten die Dringlichkeit eines besseren Schutzes auf. Ereignisse in Ungarn, Polen und Griechenland, wo Regierungen mit umstrittenen Maßnahmen einzelne Journalisten drangsalierten, etwa durch Spyware-Einsätze, erhöhten den Handlungsdruck.
Kernanliegen des Vorhabens: Etwa die Unabhängigkeit von Medien vom politischen Betrieb zu garantieren. Das könnte zum Beispiel in Frankreich nötig werden, wo die öffentlich-rechtlichen Medien inzwischen über Steuern statt Haushaltsabgaben finanziert werden. Ein weiteres Ziel des Media Freedom Acts: Dass große Digital-Intermediäre die Unabhängigkeit der Presse auch auf ihren per DSA regulierten Angeboten gewährleisten müssen und sie diese nicht wie beliebige andere Nutzerinhalte behandeln dürfen.
All das wollte EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová eigentlich per EU-Verordnung adressieren. Doch bereits der Entwurf der EU-Kommission stieß auf ein geteiltes Echo: Gut gemeint ist nicht gut gemacht, hieß es da. Die deutschen Bundesländer kritisierten das Vorhaben, per Verordnung den Bundesländern Vorgaben zur Medienregulierung zu machen, das sei europarechtlich nicht vorgesehen und ein Verstoß gegen die Europäischen Verträge. Höchstens eine Richtlinie, deren Umsetzung und konkrete Ausgestaltung den Mitgliedstaaten überlassen wäre, sei denkbar.
Der Bundesrat beschloss eine formale Rüge. Das wiederum sorgte für scharfe Kritik aus der EU-Kommission: Deutschland stelle sich damit faktisch an die Seite Ungarns und Polens. Die kritisieren das Gesetz zwar aus ganz anderen Gründen, aber das warum ist für das Zustandekommen von Mehrheiten eben zweitrangig.
Die Hoffnung der deutschen Vertreter lag zuerst auf einem Rechtsgutachten des juristischen Dienstes des Rates. Das sollte die deutsche Auffassung bestätigen – sah aber im Ergebnis keine größeren Probleme mit der gewählten Rechtsgrundlage und der Kompetenz der EU. Eine politische Blamage für die Ländervertreter, die das Argument seitdem nur noch kleinlaut anführen: Man könne das vielleicht auch anders sehen.
Tatsächlich zeigte die Debatte in Rat und den zuständigen Parlamentsausschüssen aber schnell die ersten großen Probleme mit den hehren Zielen und dem mäßigen Vorschlag der Kommission. Insbesondere im Rat zeigte sich, dass einige Mitgliedstaaten sehr genau darauf achten, dass der Schutz von Journalisten auf keinen Fall dazu führt, die Hürden für eine Überwachung besonders hoch zu hängen. In der Ratsposition verstecken sich wenig Verbesserungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag, der an zu vielen Stellen viel zu ungenau formuliert war. Für einen Aufschrei sorgt hingegen der Plan der Mitgliedstaaten, den Kommissionsvorschlag bei der Überwachung von Journalisten deutlich abzuschwächen.
Der Vorfall des angezapften Pressetelefons der Letzten Generation in Deutschland ist dabei harmlos, angesichts der Vergleichsmaßstäbe. Gezielte Ausspähung mit neuester Überwachungstechnologie in Polen oder Ungarn etwa, mit der Mobiltelefone gezielt ausgeforscht wurden, beschäftigten das EP im PEGA-Sonderausschuss intensiv. Doch das Schleifen des Informanten- und Quellenschutzes wurde nicht vor allem von der Orbán-Regierung oder aus Warschau vorangetrieben. Frankreich, mit seiner Tradition eines überaus starken Staates, unterbreitete den entsprechenden Vorschlag. Selbst Österreichs Änderungswünsche gingen in die gleiche Richtung.
Und Deutschland? “Wir wissen auch, dass weitere Verbesserungen wünschenswert sind, zum Beispiel beim Verhältnis des journalistischen Quellenschutzes zur nationalen Sicherheit”, schreibt Kulturstaatsministerin Claudia Roth in dieser Woche in einem Gastbeitrag für die FAZ. Die Grünenpolitikerin hat gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) die Verhandlungen im Rat für Deutschland geführt, ohne nennenswerten Erfolg. Stattdessen wird nun, wie derzeit anscheinend üblich, in Deutschland wieder einmal auf das Europaparlament gehofft.
Gestritten wird auch dort intensiv – und mit dem Rat. Scharfe Kritik an der Ratsposition zum Media Freedom Act kam etwa am Freitag vom konservativen IMCO-Berichterstatter Didier Geoffroy. “Als Berichterstatter des Medienfreiheitsgesetzes im Europäischen Parlament fordere ich @EmmanuelMacron und seine Regierung auf, ihren Plan aufzugeben, Journalisten legal ausspionieren zu können. Diese europäische Verordnung muss den Pluralismus schützen und nicht die Polizeiarbeit genehmigen!” twitterte Geffroy, offenbar wütend auf die französische Regierung.
Der LIBE-Ausschuss ist für diesen komplizierten Teil des Medienschutzes, der mit den nicht vereinheitlichten Bereichen der inneren Sicherheit kollidiert, federführend zuständig. Und auch im CULT-Ausschuss wird intensiv am EMFA gearbeitet. Die Abgeordneten dort haben bereits einige Fortschritte im Dossier erzielen können.
Doch auch hier liegen noch einige heikle Debatten vor den Verhandlern, bis die längst ersehnte Sommerpause naht. Etwa die hochumstrittene Frage, ob das deutsche öffentlich-rechtliche Mediensystem die hohen Anforderungen des geplanten Artikels 5 vollumfänglich erfüllt. Der Kommissionsvorschlag konnte hier so gelesen werden, dass die Auswahl und Wahl von Mitgliedern der Geschäftsleitung der deutschen Sendeanstalten künftig mit anderen Verfahren als den derzeit, auch in Deutschland in der Kritik stehenden, gefunden werden müssen.
Selbst die Frage der Medienkonzentration auf europäischer Ebene hat nach dem Tod Silvio Berlusconis neue Fahrt aufgenommen. Denn dessen Doppelrolle als Politiker und Medienmogul verhinderte bislang etwa die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch sein Medienkonglomerat. Die Vielzahl an Änderungsanträgen wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter gelichtet werden. Wie standfest sich das Parlament beim Schutz der Medienfreiheit wirklich aufstellen will, ist dabei kaum abzusehen. Derzeit ist das Ziel der Verhandlungen im Europaparlament der September. Wahrscheinlicher ist aber eine Abstimmung über den Bericht im Oktoberplenum. Danach könnte es im November in den Trilog gehen.
Doch selbst im Trilog könnte das Vorhaben noch scheitern. Denn läuft es schlecht, könnte das sogenannte Medienfreiheitsgesetz am Ende das Gegenteil von dem sein, was damit beabsichtigt ist: eine niedrigschwellige Definition von Mindestkriterien, die selbst die Problemstaaten ohne große Änderungen erfüllen.
Schon wird in Verhandlerkreisen spekuliert, ob der Vorschlag nicht doch durch die Kommission zurückgezogen wird, wenn die Mitgliedstaaten so weitermachen. Denn die Blöße, ein Medienfreiheitsgesetz zu verabschieden, das im Ergebnis die Standards für viele senkt und wenig hilft, wolle man sich dort zum Ende der Legislatur mit einer ungarischen und dann einer polnischen Ratspräsidentschaft eher nicht geben.
Sie sei “entschlossen, den Media Freedom Act durch den legislativen Prozess zu steuern”, ließ Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová am Freitag die European Broadcasting Union wissen. Es gehe darum, dass das Gesetz einen “Wandel zum Besseren, ein Sicherheitsnetz für die Medien und notwendige und fehlende Sicherungen für die Medien” schaffen müsse. Daran wird sie sich messen lassen müssen.
Im Herbst 2022 hatten EU-Klimapolitiker einen Verdacht: Die Kommission würde in Abstimmung mit der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft so viele Dossiers des Klimapakets Fit for 55 durchdrücken wie möglich – bevor Schweden im Januar 2023 die Ratspräsidentschaft übernahm. Die Befürchtung: Die neu gewählte rechte schwedische Regierung, die sich auf die rechtsextremen, EU-skeptischen Schwedendemokraten stützt (die teilweise den Klimawandel leugnen), könnte versuchen, legislative Entscheidungen zu Fragen von Klimapolitik und EU-Green-Deal zu blockieren.
Am Ende der schwedischen Ratspräsidentschaft zeigt sich: Die Befürchtungen waren teilweise berechtigt, weil sich Schweden – als Mitgliedstaat – in einigen Fällen (alle im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft) gegen die von Schweden – dem EU-Ratspräsidenten – vorgelegten Kompromisse stellte. Allgemein aber habe die schwedische Regierung die Rolle des “ehrlichen Maklers” in der EU-Präsidentschaft gut und professionell ausgefüllt, so Experten. Und sie hat viele Vorschläge der Kommission in Beschlüsse oder zumindest in Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament überführt.
Langfristig am wichtigsten war wohl die endgültige Verabschiedung der neuen Fassungen der drei Säulen der EU-Klimagesetzgebung:
In allen drei Fällen wurden die Trilog-Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament bereits während der tschechischen Präsidentschaft abgeschlossen. Die Schweden verwalteten nur noch die formellen Beschlüsse, die im März und April 2023 gefasst wurden. Damit gibt es seit Mai eine EU-Gesetzgebung, die garantiert, dass die Netto-Treibhausgasemissionen der EU 2030 um 57 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen werden. Das ist ein Meilenstein.
Darüber hinaus wurden während der schwedischen Ratspräsidentschaft Vereinbarungen über mehr als zehn sektorbezogene Klimagesetzgebungen getroffen. Unter ihnen sind:
Zu Bremsern im Prozess wurden nicht wie erwartet die Schweden, sondern die deutsche und die französische Regierung. Plötzlich unterstützten sie Trilog-Vereinbarungen nicht mehr, denen sie zuvor zugestimmt hatten:
Diese Konflikte wurden schließlich gelöst, offenbar mehr durch Interventionen der Kommission als durch Bemühungen des Ratspräsidenten, hieß es in Brüssel.
Deutlich wurde auch wieder einmal bei mehreren Gelegenheiten, dass Schweden in Fragen der Forstwirtschaft im Widerspruch zur Mehrheit der Union steht. Schweden enthielt sich der Stimme, als die endgültigen Beschlüsse über die Verordnungen zur Entwaldung und zu den Kohlenstoffsenken (LULUCF) gefasst wurden. Das Argument: Die neuen Rechtsvorschriften würden der Entwicklung einer nachhaltigen Forstwirtschaft schaden.
In einer Koalition mit anderen Mitgliedstaaten gelang es Schweden auch, die Naturschutzanforderungen an Waldbiomasse in der Richtlinie über erneuerbare Energien zu verwässern. Diese Anforderungen garantieren eine “Nullanrechnung” der Emissionen aus biogenem Kohlendioxid im Rahmen des Emissionshandelssystems. Der Hintergrund: Bei strengeren ökologischen Anforderungen an die Forstwirtschaft müssten die schwedische Zellstoff- und Papierindustrie sowie die vielen großen schwedischen Fernheizwerke, die auf Biomasse basieren, viel Geld für den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeben, um diese Emissionen abzudecken.
Bemerkenswert allerdings: Auf der letzten Tagung des Umweltrates unter schwedischer Führung am 20. Juni stimmte Schweden gegen seinen eigenen Kompromiss für einen gemeinsamen Standpunkt der EU-Regierungen zur Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (“Nature Restoration Law”). Eine Woche vor der Tagung zog Schweden einen Kompromisstext, der bereits von einer stabilen Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt wurde, von der Tagesordnung der Sitzung der EU-Botschafter zurück.
Mehrere Mitgliedstaaten werteten dies als Hinweis darauf, dass Schweden nicht beabsichtigte, den Kompromiss auf der Ministertagung vorzulegen, wodurch sich seine Annahme verzögerte. Aus Protest schrieben Frankreich, Deutschland, Spanien und Luxemburg einen Brief an Schweden und baten um Klarstellung. Schließlich tauchte das Thema auf der Tagesordnung des Rates auf, wo der schwedische Kompromissvorschlag trotz der Gegenstimme Schwedens weitgehend angenommen wurde.
“Im Allgemeinen wurde die Ratspräsidentschaft sehr professionell und erfolgreich geführt, aber der Umgang mit der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur könnte ihr einen kleinen Makel verpassen”, meint Ylva Nilsson, Kommentatorin der Tageszeitung Expressen. “Schweden ist bekannt dafür, dass es ziemlich aggressiv ist, wenn es um Umweltanforderungen an die Forstwirtschaft und die Forstindustrie geht”.
Mats Engström, leitender Berater beim Schwedischen Institut für Europapolitik (SIEPS), erklärt das schwedische Votum gegen den eigenen Kompromiss zum “Nature Restoration Law” damit, es passe zur Rolle des Ratsvorsitzes als “ehrlicher Makler”. Er fügt hinzu: “Das Verhalten ist selten, kommt aber hin und wieder vor. Was es problematisch und bemerkenswert macht, ist das Protestschreiben von vier Mitgliedsstaaten”. Magnus Nilsson
Mehrere Fraktionen im EU-Parlament fordern von der EU-Kommission, den Entwurf für die Europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards (ESRS) nachzuschärfen. Table.Media liegt ein Brief vor, den eine Gruppe Abgeordneter um Pascal Durand (Frankreich, S&D) am vergangenen Donnerstag an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Vizepräsidenten der Kommission, Valdis Dombrovskis, und Finanzkommissarin Mairead McGuinness geschickt hat. Durand war Berichterstatter für die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), für deren Anwendung die neuen Standards entwickelt werden.
Die Abgeordneten fordern in ihrem Schreiben die Beibehaltung der ursprünglich geplanten Pflicht zu verbindlichen Erklärungen in den Nachhaltigkeitsberichten. Die Kommission gestattet den Unternehmen in ihrem Entwurf für einen delegierten Rechtsakt anhand einer Wesentlichkeitsanalyse die Notwendigkeit zu bemessen, bestimmte Informationen offenzulegen. Dabei müssen sie keine Begründung vorlegen, die Wesentlichkeitsanalyse ist zudem nicht standardisiert.
Das Beratungsgremium EFRAG hatte im November 2022 eine Empfehlung für einen ersten Satz an branchenunabhängigen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der CSRD veröffentlicht. Die Kommission hatte ihren darauf basierenden Entwurf am 9. Juni vorgelegt. Die vierwöchige Konsultationsphase endet am 7. Juli.
Zehn für die Weiterverfolgung der CSRD zuständige Abgeordnete der S&D, Renew, Grünen und Linken haben den Brief unterzeichnet, darunter René Repasi, Lara Wolters (beide S&D), Bas Eickhout und Marie Toussaint (beide Grüne). Das Schreiben ist ihre offizielle Antwort auf die Konsultation zum delegierten Rechtsakt, erklärten sie. “Ich bedauere, dass die EVP unsere Bemerkungen zur Stärkung des delegierten Rechtsakts nicht unterstützt”, sagte Pascal Durand.
“Die ursprüngliche Absicht der Kommission und des von den Mitgesetzgebern bekräftigten Mandats war es, verbindliche Erklärungen vorzuschreiben, in denen erforderlichenfalls begründet wird, warum ein bestimmter Indikator oder Datenpunkt nicht wesentlich ist“, heißt es in dem Brief. “Der verbindliche oder begründete Charakter der Standards ist der Schlüssel zu zuverlässigen, gemeinsamen und unverzerrten Informationen.”
Es sei daher notwendig, den obligatorischen Charakter der Datenpunkte zum Klima wieder einzuführen,
unabhängig vom Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen. Wie von der EFRAG gefordert, sei es außerdem notwendig, die Unternehmen zu verpflichten, im Falle einer fehlenden Wesentlichkeit auch eine Begründung anzuführen. leo
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treibt die Arbeit an einer Sonderabgabe auf Gewinne aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen voran, trotz der Bedenken von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundeskanzler Olaf Scholz. Von der Leyen sagte nach dem EU-Gipfel am Freitag, die EU und ihre Verbündeten hätten den wichtigsten Schritt bereits vor über einem Jahr getan, als sie nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine erstmals mehr als 200 Milliarden Euro an russischen Zentralbankguthaben blockierten. Die Reaktionen an den Finanzmärkten darauf seien sehr ruhig ausgefallen, sagte von der Leyen. Das sei “ein Indiz dafür, dass der von uns gewählte vorsichtige Ansatz sehr gut verstanden wird”.
Scholz bezeichnete die Nutzung von Erträgen des eingefrorenen russischen Vermögens hingegen als “furchtbar kompliziert”. Niemand wisse gegenwärtig, “was überhaupt geht und wie”. Die Staats- und Regierungschefs hätten die Kommission gebeten, sich weiter “den Kopf zu zerbrechen” und ihn und seine EU-Kollegen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu informieren. Es wird erwartet, dass von der Leyen bis Ende Juli einen Vorschlag präsentiert.
90 Prozent der Zentralbankgelder sind in Belgien bei der Clearingstelle Euroclear eingefroren. Die Erlöse etwa durch Steuern oder Zinsen würden auf drei Milliarden pro Jahr geschätzt, sagte der belgische Premier Alexander De Croo. Die Gelder sollen für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Die Weltbank schätzt die Kosten dafür auf mehr als 400 Milliarden Dollar.
Am Freitag hatten die Staats- und Regierungschefs noch über die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die China-Politik diskutiert, ohne größere Überraschungen. So forderten sie unter anderem die Einsetzung einer hochrangigen Expertengruppe, die bis März 2024 einen unabhängigen Bericht über die Zukunft des Binnenmarkts vorlegen soll. Dies ist ein Anliegen der belgischen Regierung, die Anfang 2024 den rotierenden Vorsitz im Rat der EU übernimmt.
Geprägt worden war der Gipfel von einem Streit über die Migrationspolitik: Ungarn und Polen verhinderten eine gemeinsame Erklärung zur Migrationspolitik und drohten weitere Schritte an. Die beiden Staaten protestierten dagegen, dass die Asylpläne von den Innenministern vor rund drei Wochen gegen ihren Willen per Mehrheitsentscheidung auf den Weg gebracht wurden. Aus Sicht von Scholz und von der Leyen wird die Blockade den Gesetzgebungsprozess allerdings nicht aufhalten. tho/dpa
Das neutrale Österreich plant den Beitritt zum deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems. Das gab Kanzler Karl Nehammer am Wochenende bekannt. “Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft”, begründete der konservative Politiker die laufenden Beitrittsverhandlungen. Österreich müsse sich deshalb gemeinsam mit anderen europäischen Ländern vor Drohnen- und Raketenangriffen schützen.
Die von Deutschland initiierte “European Sky Shield Initiative” soll vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine helfen, Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt es beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern. Mehr als ein Dutzend europäische Staaten haben sich dem Projekt bereits angeschlossen.
Österreichs Status als militärisch neutraler Staat sei durch einen Beitritt nicht gefährdet, sagten Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in einer gemeinsamen Erklärung. “Es handelt sich um die Beteiligung an einem Schutzschirm, der zur Gefahrenabwehr dient”, argumentierten sie.
Österreich, Irland und Malta hatten als neutrale EU-Mitglieder diese Woche weitreichende Sicherheitsgarantien der Europäischen Union für die Ukraine blockiert. dpa
Zur Strommarktreform haben die Ständigen Vertreter auch bei ihrer letzten Sitzung unter schwedischer Präsidentschaft am Freitag keine Einigung erzielen können. Grund sei abermals der Widerstand Frankreichs wegen ungewisser Fördermöglichkeiten für die Atomenergie gewesen, berichtete eine Quelle aus dem Rat. Damit muss nun die spanische Ratspräsidentschaft versuchen, eine gemeinsame Position unter den Mitgliedstaaten zu finden.
Erörtern könnten die Energieminister die Reform am Rande ihres informellen Treffens am 11. und 12. Juli im nordspanischen Valladolid. Bisher stehen allerdings andere Themen auf dem Programm, wie die Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz COP28 und die “effektivere Kommunikation von Vorteilen der Klima- und Energiepolitik”.
In einem letzten Kompromissversuch hatte Schweden zur Vorbereitung des Treffens am Freitag genauere Regeln für die Förderung über CfDs vorgeschlagen. Demnach soll es Differenzverträge für den Retrofit von bestehenden Kraftwerken nur geben, wenn die erneuerte Anlage anschließend noch mindestens zehn Jahre läuft und die Investition den Wert des Kraftwerks mindestens verdoppelt.
Bei der Rückverteilung von Einnahmen aus CfDs kamen die Schweden der Industrie noch weiter entgegen. Sie strichen die entscheidende Einschränkung, dass die Staaten nur so viel an Unternehmen umverteilen dürfen, wie es dem Gesamtanteil des Unternehmenssektors am nationalen Stromverbrauch entspricht. Die EU-Staaten sollen ausdrücklich die Gelegenheit bekommen, einzelne Gruppen von Unternehmen zu bevorzugen, soweit es das Wettbewerbsrecht zulässt. Ein entsprechendes Konzept hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Mai für die im internationalen Wettbewerb stehende Industrie vorgeschlagen.
Die Abschöpfung von Übererlösen von bestehenden Erneuerbaren-Anlagen und Atomkraftwerken wollte Schweden außerdem bis Mitte 2024 verlängern. Vor allem Spanien drängt auf diese Möglichkeit, Bundesregierung und Kommission stehen ihr skeptisch gegenüber. Im Parlament setzt sich auch der spanische Berichterstatter Nicolas Casares für eine längere Erlösabschöpfung ein. ber
Europaabgeordnete und die EU-Kommission haben am Freitag verärgert auf den offenen Brief zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz reagiert, den 150 Wirtschaftsvertreter nach Brüssel geschickt haben. Handelsblatt und Financial Times hatten ihn zuvor veröffentlicht. “Ich bin überzeugt, dass sie den Gesetzestext nicht sorgfältig gelesen haben”, sagte Dragoș Tudorache (Renew), einer der beiden Berichterstatter des AI Acts.
Unterzeichnet haben den Brief unter anderem die Chefs von Deutscher Telekom, Siemens und Airbus, aber auch der des französischen KI-Start-up Mistral AI, das gerade 105 Millionen Euro Finanzierung eingesammelt hat. Der Gesetzesentwurf würde “die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährden”, ohne den Herausforderungen wirksam zu begegnen, heißt es im Schreiben. Dies gelte vor allem für generative KI.
Als die Kommission ihren Entwurf 2021 vorgelegte, war generative KI weder so weit entwickelt noch stand sie so sehr im Zentrum des öffentlichen Interesses wie heute. “Die neue KI-Verordnung wird dafür sorgen, dass die Europäer den Möglichkeiten der KI vertrauen können”, sagte ein Sprecher der Kommission. Die geplanten Vorschriften seien ausgewogen, risikobasiert und zukunftssicher und “werden sich mit den spezifischen Risiken von KI-Systemen befassen und weltweit den höchsten Standard setzen”.
Die Trilog-Arbeitsgruppen beginnen ihre Arbeit am AI Act am heutigen Montag. Das Table.Media vorliegende Arbeitspapier (4-column-document) enthält die Vorschläge des Parlaments zu generativer KI. Das Thema wird also Verhandlungsgegenstand im Trilog sein. Der Trilog soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Die einzigen konkreten Vorschläge im Brief entsprächen dem, was der Parlamentstext bereits enthalte, sagte Tudorache. “Ein von der Industrie geleiteter Prozess zur Festlegung von Standards, Governance, mit der Industrie am Tisch. Und ein leichtes Regulierungssystem, das Transparenz fordert.” Es sei schade, “dass die aggressive und irreführende Lobby einiger weniger” andere seriöse Unternehmen vereinnahme. Im gesamten Gesetzgebungsverfahren habe das Parlament mit Unternehmen zusammengearbeitet.
Ähnlich äußerte sich auch Sergey Lagodinsky, Schattenberichterstatter der Grünen. Er höre gern den Stimmen aus der Wirtschaft zu. Aber er ziehe es dabei vor, informierten und abwägenden Stimmen zuzuhören und keiner “Lobby-Stimmungsmache in Form von offenen Briefen“. Die habe auch wenig mit den konkreten Sorgen der KI-Entwickler oder dem Gesetzentwurf zu tun. Auf dieser Basis funktioniere kein Gespräch, sagte Lagodinsky. “Das sind Brief-Ultimaten mit Falschinformationen.”
Axel Voss, Schattenberichterstatter der EVP, sieht das anders: “Der Aufschrei der Wirtschaft ist völlig berechtigt, auch wenn er jetzt sehr, sehr spät kommt.” An einigen Stellen enthalte der Parlamentstext nicht wirklich umsetzbare Anforderungen. “Einiges ist überzogen und vieles viel zu umständlich”, sagte Voss. “Als EVP haben wir alleine schon unzählige Punkte ausfindig gemacht, die geändert werden müssten, um den Text halbwegs praktikabel zu machen.” Er hoffe, dass das im Trilog noch erreicht werden könne. “Wenn es so bleibt, ist der AI Act für die einen der Grund, Europa zu verlassen und für die anderen der Grund, besser erst gar nicht mit neuen Ideen anzufangen.” Beides könne nicht Intention des Gesetzgebers sein.
Antonio Krüger, Informatiker und CEO des Deutschen Forschungszentrums für KI (DFKI) hält die Sorgen der Wirtschaft ebenfalls für berechtigt. Daher hat auch er den Brief für das DFKI mitunterzeichnet. “Regulierung ist wichtig”, sagte Krüger. “Aber gleichzeitig sollten genauso viele Anstrengungen unternommen werden, KI-Innovationen in Europa voranzubringen.” vis
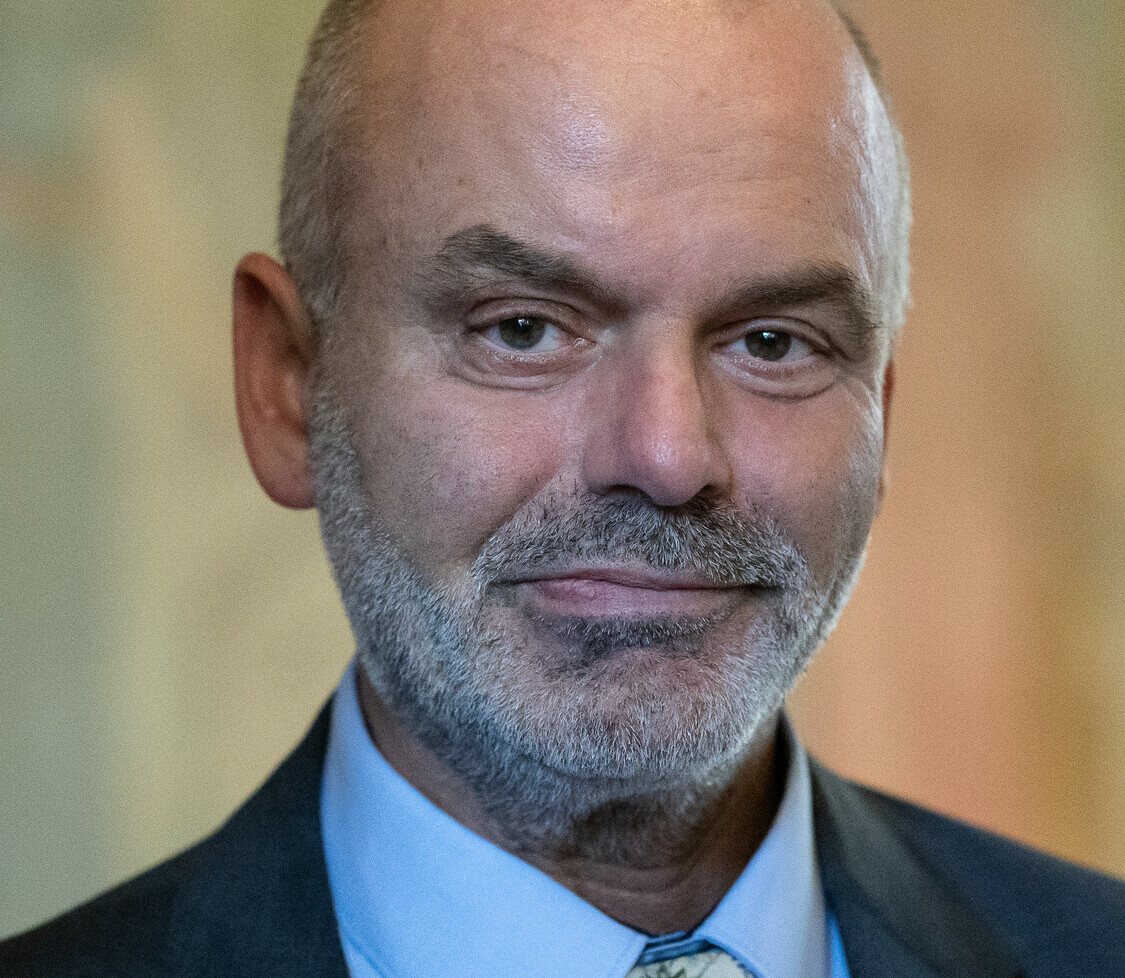
“Ich lebe die EU”, sagt der 58-jährige Wahl-Hanseat Thorsten Augustin frei heraus. Frühzeitig über aktuelle EU-Politiken, Rechtsetzungsverfahren und europapolitische Entwicklungen zu informieren, steht im Fokus von Thorsten Augustins Aufgaben. Der Jurist leitet das Hanse-Office für Schleswig-Holstein, eine gemeinsame Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der Europäischen Union. Die Vielfalt der beiden heimischen Standorte versuchen sein Team und er durch Veranstaltungen, Begegnungen und kulturelle Ereignisse in Brüssel zu präsentieren.
Der Ukraine-Krieg überschattet aus Augustins Sicht derzeit alles andere. “Alles ist durcheinander geraten. Die Auswirkungen haben die gesamte Politik auf den Kopf gestellt.” Und offenbar nicht nur die Politik. Die Abkommen der EU seien für ihn immer das größte Friedensprojekt gewesen. Der globale Handel – für den studierten Juristen bisher eine Friedensdividende. Russland hat ihn hier jedoch, sagt Augustin, eines Schlechteren belehrt.
Mit der Europäischen Union beschäftigt sich Augustin seit knapp 30 Jahren. Den gebürtigen Mindener lässt sie nicht mehr los. Und er ist sich sicher, dass das jedem so ergeht, der sich einmal mit dem Thema befasst. Die EU sieht er als “Chancenraum”, in dem es unglaublich viele Möglichkeiten gibt zu arbeiten und sich zu entwickeln. Deshalb ist Augustin auch großer Befürworter des Erasmus+ Förderprogramms. Dass es trotzdem nicht so leicht ist, junge Menschen für Brüssel zu begeistern, muss Augustin immer wieder feststellen.
1992 hat es Augustin ins Bonner Bundesfinanzministerium unter der Leitung von Theo Waigel geführt. Dort war er unter anderem mit der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Euro-Einführung befasst, später wechselte er dann in die deutsche EU-Botschaft nach Brüssel. Im Rückblick auf seine Laufbahn sieht Augustin entscheidende Veränderungen. Die frühzeitige Berichterstattung durch die Ländervertretungen sei nicht mehr exklusiv. “Jede Entscheidung in Brüssel ist in wenigen Minuten transparent”, sagt er. Umso wichtiger sei es, das große Ganze zu sehen und einordnen zu können.
Die zielstrebige Lebensweise der Norddeutschen hat den gebürtigen Ostwestfalen sehr geprägt. “Der Norden spricht Klartext, und das passt zu mir”, sagt er. Für die Entscheidungsverfahren auf EU-Ebene gelte für ihn: Alles hänge mit allem zusammen. “Jedes kleine Teilchen, das man in Brüssel bewegt, hat Auswirkungen.” Wenn es jemals ein fehlendes Puzzleteil in Augustins Leben gegeben hat, hat er es sicher in der belgischen Hauptstadt gefunden. Julia Klann
