nach fünf Jahren findet heute und morgen erstmals wieder die Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel statt. Die 16 Regierungschefs der Bundesländer treffen sich mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie mehreren Kommissaren. Am Donnerstag ist auch ein Mittagessen mit dem Ständigen Vertreter, Michael Clauß, geplant. Die wichtigsten Themen sind: Wie kann die Abwanderung der Industrie verhindert werden? Was tut die Kommission, um die illegale Migration in den Griff zu bekommen? Wann passiert etwas beim Bürokratieabbau?
Die Bundesländer sind ja nicht direkt in das EU-Gesetzgebungsverfahren eingebunden, sondern haben Mitwirkungsrechte über den Bundesrat. Das hält die MPs aber nicht davon ab, konkrete Forderungen zu stellen und deutlich Kritik zu üben. Etwa in der “Brüsseler Erklärung”, dem sieben Seiten langen Dokument der MPK in Brüssel.
So fordern die Länderchefs unabhängig von ihrer Partei einen “Brückenstrompreis für die energieintensive Industrie”. Der derzeitige Vorsitzende der MPK, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), dürfte von der Leyen an den Vorschlag seines Landes in der Sache aus dem April erinnern und darauf hinweisen, dass beihilferechtliche Probleme in den Griff zu bekommen wären.
Weils Stellvertreter, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), fordert “deutliche Vereinfachungen im Beihilfe- und Vergaberecht”. Wüst sagte Table.Media: “Wenn es um Verfahrensbeschleunigung geht, verweist die Bundesregierung (uns) allzu oft nach Brüssel und sagt: Das geht europarechtlich nicht.” Weil sich die Bundesregierung in Europa dann aber nicht für entsprechende Änderungen einsetze, wollten er und die anderen MPs diese Forderung nun direkt selbst bei der Kommission erheben. Mal sehen, ob sie Gehör finden.
In Deutschland stehen zudem die Haushaltsberatungen des Bundestages an. Und mit ihnen geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Wir von Table.Media fragen Sie in einer Umfrage: Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Wie bewerten Sie generell die bisherige Arbeit der Ampel und die Leistungen der Ministerinnen und Minister? Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Sechs Millionen Fahrzeuge erreichen in Europa jährlich das Ende ihrer Lebensdauer. Dann gelten sie als Altfahrzeuge – und bergen einen enormen Schatz an Materialien, von energieintensiven Grundstoffen wie Stahl und Aluminium über Edelmetalle bis hin zu Seltenen Erden.
Die EU-Altfahrzeugrichtlinie aus dem Jahr 2000, die in Deutschland durch die Altfahrzeug-Verordnung umgesetzt ist, legt Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Abfällen aus Altfahrzeugen und deren Bauteilen fest und stellt sicher, dass diese wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden.
Seit 2015 müssen mindestens 95 Prozent des Leergewichts aller Altfahrzeuge wiederverwendet oder verwertet werden. Davon müssen mindestens 85 Gewichtsprozent wiederverwendet oder recycelt werden. Die Mitgliedstaaten berichten jährlich über die Menge an Altfahrzeugen sowie die Wiederverwertungs- und Recyclingraten; diese sind bereits sehr hoch: Im EU-Durchschnitt beträgt die Wiederverwertungsrate knapp 95 Prozent, die Recyclingrate 89 Prozent. In Deutschland liegt sie nur knapp darunter, bei 94 Prozent Wiederverwertung und 87 Prozent Recycling.
Die EU-Kommission überarbeitet die Richtlinie nun und hat im Juli einen Entwurf für eine Verordnung vorgestellt. Denn trotz hoher Recyclingquoten stehen einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Automobilsektor einige Hindernisse im Weg: Nur geringe Mengen an Kunststoffen werden bislang recycelt und wiederverwendet, und die anfallenden Altmetalle sind von geringer Qualität. Zudem wird mit dem Übergang zur Elektromobilität und der zunehmenden Integration von Elektronik in Fahrzeugen die Nachfrage nach Kupfer und kritischen Rohstoffen steigen. Deshalb liegt der Fokus der Überarbeitung auf Zielen für den Einsatz von Rezyklat. Zudem adressiert sie das Problem des “unbekannten Verbleibs” von Altfahrzeugen.
Die Automobilindustrie gehört zu den größten Verbrauchern von Primärrohstoffen und setzt bisher nur wenig recycelte Materialien ein. Laut Angaben der EU-Kommission kommt der europäische Automobilsektor im Jahr auf:
Dazu kommen die Rohstoffe für Batterien, deren Bedarf mit dem Hochlauf der E-Mobilität immens steigen wird: Kobalt, Lithium, Nickel, Mangan und Graphit. Vorgaben zur Zirkularität der Batterierohstoffe werden in der Batterieverordnung reguliert, die Anfang 2024 in Kraft tritt.
Die Kommission geht zudem davon aus, “dass die Automobilindustrie in Europa zum größten Verbraucher kritischer Rohstoffe für Dauermagnete von Elektromotoren werden wird”. Hier besteht eine immense Abhängigkeit von China: Permanentmagnete werden zu 94 Prozent aus China importiert, die dafür benötigten Seltenen Erden zum Großteil in China abgebaut und verarbeitet.
Kupfer und Seltene Erden steht bereits auf der EU-Liste der Rohstoffe, die aufgrund der derzeitigen Abhängigkeiten von einzelnen Exportländern, ihrer Bedeutung für die Industrie und der rasant steigenden Nachfrage als strategisch gelten. Für sie sieht der derzeit im EU-Parlament verhandelte Critical Raw Materials Act größere Produktionskapazitäten innerhalb der EU, eine Importdiversifizierung und größere Recyclingkapazitäten vor. Bauxit, aus dem Aluminium hergestellt wird, steht auf der Liste kritischer Rohstoffe. Für sie gelten die Ziele, das Versorgungsrisiko zu überwachen und zu mindern sowie ihren freien Verkehr im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten. Laut dem Verhandlungsmandat des Rats sollen Bauxit, Aluminiumoxid und Aluminium als strategische Rohstoffe eingestuft werden.
Die Kommission will das Recycling und die Wiederverwertung dieser Rohstoffe im Automobilsektor fördern und deshalb in der neuen Verordnung Zielvorgaben für den Einsatz von Rezyklat in Fahrzeugen festlegen. Im Entwurf gibt es jedoch nur eine konkrete Zahl: 25 Prozent des Kunststoffs, der für den Bau eines neuen Fahrzeugs verwendet wird, müssen aus dem Recycling stammen. Davon wiederum müssen 25 Prozent aus Altfahrzeugen rezykliert werden. Für eine mögliche Festlegung von Zielvorgaben für den Recyclinganteil von Seltenen Erden, Aluminium und Magnesium sowie deren Legierungen soll die Kommission zunächst Machbarkeitsstudien durchführen.
Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) ist laut einem aktuellen Positionspapier zur Kreislaufwirtschaft “bestrebt, den Einsatz von Sekundärmaterialien zu erhöhen und somit weniger Neumaterialien aus fossilen Quellen und Erzen zu verwenden”. Bislang werden nur wenig Sekundärmaterialien eingesetzt; viele Vorhaben beziehen sich vor allem auf das Recycling der Batterien von E-Autos. Fahrzeuge der BMW Group bestehen laut eigenen Angaben aktuell aus “bis zu 30 Prozent recyceltem und wiederverwendetem Material”. Audi hat in diesem Jahr ein Projekt gestartet, um “den Anteil an eingesetzten Rezyklaten in der Audi-Flotte in den nächsten Jahren beständig zu erhöhen”.
Anders als im Gesetzesentwurf der EU-Kommission vorgesehen, sollte die Nutzung aller Materialquellen ermöglicht werden, sagt Michael Püschner, Leiter des Fachgebiets Umwelt und Nachhaltigkeit beim VDA. Der Kommissionsentwurf sehe zum Beispiel für Kunststoff lediglich einen Post-Consumer- sowie einen Closed-Loop-Ansatz vor, bei dem die Rezyklateinsatzquoten durch wiedergewonnene Materialien desselben Fahrzeugtyps erreicht werden müssen. Dies sei in der Praxis nicht umsetzbar. Deshalb sollte es mehr und branchenübergreifende Optionen für die Unternehmen geben, um vorgegebenen Quoten überhaupt ansatzweise erreichen zu können. Der VDA schlägt daher vor, die Höhe und Zusammensetzung der Rezyklateinsatzquote noch einmal grundsätzlich zu überdenken und an die tatsächlichen Marktgegebenheiten anzupassen.
Ein weiteres Hindernis für die Kreislaufwirtschaft: Etwa 78 Prozent der Altfahrzeuge werden exportiert und sind deshalb für eine Verwertung in Deutschland nicht mehr verfügbar. Laut einer neuen Publikation des Wuppertal Instituts und der nordrhein-westfälischen Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate ist dies zwar zunächst begrüßenswert, da durch die Weiternutzung im Ausland die Lebensdauer verlängert werde. Allerdings sei fraglich, was mit den Fahrzeugen im Ausland passiere.
Fast 90 Prozent der Altfahrzeuge aus Deutschland werden zwar in andere EU-Staaten exportiert. Anschließend folgt jedoch oft der Export ins außereuropäische Ausland, etwa nach Westafrika. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms (UNEP) wurden 42 Prozent der Gebrauchtfahrzeuge, die von 2015 bis 2020 in EU-Ländern gehandelt wurden, in Länder außerhalb der EU exportiert. “Grundsätzlich gehen mit diesen Exporten signifikante Mengen an Sekundärrohstoffen für eine Verwertung in Deutschland verloren, was den Bedarf nach energieintensiver Primärproduktion erhöht und gerade bei kritischen Rohstoffen zur Abhängigkeit von globalen Lieferketten beiträgt”, heißt es in der Analyse des Wuppertal Instituts.
Darüber hinaus werden in Deutschland jährlich rund 150.000 Altfahrzeuge überhaupt nicht erfasst. Laut der Analyse ist oft eine nicht anerkannte Demontage in illegalen Verwertungsbetrieben der Grund. Hier setzt auch der Vorschlag der EU-Kommission an: Durch mehr Inspektionen, eine digitale Verfolgung von Altfahrzeugen in der gesamten EU und höhere Geldbußen für Verstöße soll das Verschwinden von Fahrzeugen gestoppt werden. Die Ausfuhr nicht verkehrstauglicher Gebrauchtfahrzeuge soll zudem verboten werden.
Der Entwurf enthält darüber hinaus die folgenden Vorgaben:
Bis Ende Oktober läuft nun die öffentliche Konsultation zu dem Entwurf.
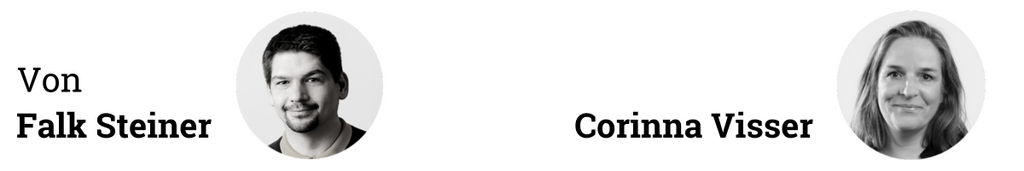
Das Ende der Mandatsperiode rückt näher und die EU-Politiker haben noch gut zu tun, um ihre Gesetzesvorhaben im Bereich des Digitalen abzuschließen. Die größte Aufmerksamkeit liegt dabei sicher auf dem KI-Gesetz (AI Act). Europa will den ersten umfassenden Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz weltweit vorlegen und hofft damit, einen Brussels Effect auszulösen. Doch die Verhandlungen sind noch lange nicht abgeschlossen – und es steht noch mehr auf dem Zettel.
Sogar noch neue Vorschläge der Kommission werden in dieser Mandatsperiode noch erwartet, zu:
Allerdings gibt es für diese Themen noch keinen Zeitplan. Folgende Themen stehen aber in diesem Herbst ganz sicher auf der Digitalagenda:
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Bereits seit Ende August treffen sich die Arbeitsgruppen wieder zweimal in der Woche jeweils vier Stunden zu den Verhandlungen. Dabei tasten sich die Verhandler langsam vor. Das derzeit am meisten diskutierte Thema, generative Künstliche Intelligenz, stand noch nicht auf der Agenda. Die Schwierigkeit ist, dass die Kommission diese Modelle in ihrem Entwurf gar nicht berücksichtigt hat und sie auch nicht in die Struktur des Gesetzes passen. Denn das Gesetz teilt KI-Anwendungen in Risikoklassen ein. KI, die für eine Vielzahl von Zwecken geschaffen ist, lassen sich dort eigentlich nicht eingruppieren.
Der Rat hatte dennoch etwas zu Allzweck-KI (General Purpos AI, kurz: GPAI) formuliert, das Parlament Foundation Models eingebracht. Über das Thema werden die Arbeitsgruppen voraussichtlich erst im Oktober diskutieren. Ebenso über die strittigen Themen Umweltauswirkungen, Grundrechte-Assessment und Ausnahmen für die Strafverfolgung.
Zeitplan: Die nächste Runde im Trilog ist für den 2. und 3. Oktober angesetzt, ein weiterer Termin Ende Oktober. Ziel ist es, noch unter spanischer Ratspräsidentschaft eine Einigung zu erreichen.
Akteure: federführend ist der JURI-Ausschuss, Berichterstatter Axel Voss (CDU)
Stand der Dinge: Der Entwurf der Kommission zu den Haftungsregeln für KI liegt vor. Das Parlament will die Beratung aber erst beginnen, wenn der AI Act abgeschlossen ist.
Zeitplan: offen
Akteure: Kommission
Stand der Dinge: Die Gesetze über digitale Dienste (DSA) und digitale Märkte (DMA) sind zwar in Kraft, doch jetzt geht es um die Anwendung. Der DSA ist bereits für 19 sehr große Onlineplattformen und Onlinesuchmaschinen rechtsverbindlich. Unternehmen wie X (Twitter), Facebook, Tiktok oder Instagram müssen Verpflichtungen zu Transparenz und Datenschutz einhalten sowie illegale Inhalte und Desinformation bekämpfen. Zalando und Amazon wehren sich jedoch auf dem Rechtsweg gegen ihre Einstufung als sehr große Onlineplattformen.
DMA: Das Gesetz soll unfaire und wettbewerbsverzerrende Praktiken sehr großer Technologieunternehmen eindämmen. Heute will die Kommission die Unternehmen benennen, die eine wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern bilden (Core Platform Services, kurz: CPS) und somit unter die Regulierung fallen. Sieben Gatekeeper – Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Alphabet (Google), Meta (Facebook) und Bytedance (Tiktok) – haben der EU-Kommission mitgeteilt, dass sie die Kriterien erfüllen. Ziel ist es, dass die großen Player ihre Technologie und Geschäftsmodelle anpassen, sodass kleinere, innovative Unternehmen eine Chance am Markt haben.
Auch hier sind Diskussionen zu erwarten, für wen die strengen Regeln gelten oder nicht, denn die Kommission hat einen gewissen Ermessensspielraum. Wie die Financial Times berichtet, wehren sich Apple und Microsoft dagegen, dass die Kommission ihre Dienste – die Chat-App iMessage und die Suchmaschine Bing – als Gatekeeper einstuft.
Andreas Schwab (CDU), Berichterstatter für den DMA und binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, hat zum Thema der Einstufung gerade an Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager geschrieben. Schwab weist darauf hin, dass auch Kartendienste wie Google Maps zur Onlinesuche verwendet und somit als Suchmaschine gewertet werden sollten. Zudem schlägt er vor, durch delegierte Rechtsakte die Verpflichtungen für Suchmaschinen auf andere CPS auszuweiten. Außerdem rät er, Unternehmen, die sowohl Social-Media- als auch Verkaufsplattform sind, als Marktplatz zu werten.
Zeitplan: Die Regeln des DSA gelten bereits für die sehr großen Anbieter, ab 24. Februar 2024 für alle. Die Verpflichtungen des DMA gelten ab März 2024.
Akteure: federführend ist der ITRE-Ausschuss, Berichterstatter ist Alin Mituța (Renew)
Stand der Dinge: Ohne digitale Infrastruktur gibt es keine Digitalisierung. Mit der im Februar 2023 vorgelegten Gigabit-Infrastrukturverordnung (einer Aktualisierung der Richtlinie zur Breitbandkostenreduktion) will die EU-Kommission einheitliche Bedingungen schaffen und die Kosten für den Netzausbau senken. Derzeit befindet sich der Parlamentsausschuss in der Phase der technischen Meetings. Plan des Rapporteurs war es, diese bis zur Sommerpause abzuschließen und anschließend rasch die Abstimmung anzusetzen.
Kontrovers diskutiert haben die Verhandler unter anderem die Fragen,
Zeitplan: noch offen
Akteure: Kommission
Stand der Dinge: Mit großer Spannung erwartet die Branche die Ergebnisse der Konsultation zur Zukunft der Kommunikationsnetze. Die Kommission betont dabei, dass es um eine sehr breit aufgestellte – ergebnisoffene – Umfrage zu der erwarteten technischen Entwicklung und den dafür benötigten Investitionen geht. Politisch brisanter Zankapfel ist dabei die Frage, ob sich die großen Technologiefirmen aus den USA, die riesigen Datenverkehr in Europa verursachen, an den Kosten der Netzbetreiber für den Ausbau ihrer Infrastruktur beteiligen sollen (Fair Share).
Zeitplan: noch offen. Die Ergebnisse der Konsultation sollen bald kommen.
Akteure: federführend ist der ITRE-Ausschuss, Berichterstatter Nicola Danti (Renew)
Stand der Dinge: Mit dem Rechtsakt will die EU die Cybersicherheit von Produkten verbessern, die miteinander oder mit dem Internet verbunden sind. Der Rat hat seine Position im Juli festgelegt. Der federführende ITRE-Ausschuss hat seine Positionierung im Juni beschlossen. Derzeit ist der CRA noch nicht auf der Tagesordnung des EP verankert.
Zeitplan: Nach dem EP-Mandat soll der Trilog schnellstmöglich beginnen, voraussichtlich noch im Oktober.
Akteure: federführend ist der CULT-Ausschuss, Berichterstatterin Sabine Verheyen (CDU)
Stand der Dinge: Das europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) will den Pluralismus und die Unabhängigkeit der Medien schützen – unter anderem gegen politische Einflussnahme und Überwachung. Gerade aus Deutschland, wo die Medienaufsicht Ländersache ist, kam viel Kritik. Ein Streitpunkt im Parlament ist Artikel 17, in dem es eine Ausnahme von der Moderationspflicht für Medien geben soll, die es im DSA nicht gibt.
Zeitplan: Der Rat hat seine Position im Juni festgelegt. Der Trilog soll schnellstmöglich beginnen. Am Donnerstag (7. September) wird der federführende CULT-Ausschuss seine Positionen beschließen. Anschließend muss das EP sein Verhandlungsmandat insgesamt beschließen. Hierfür ist die erste Oktober-Sitzungswoche vorgesehen.
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Die hochumstrittene CSA-Verordnung soll unter anderem Betreiber zu stärkeren Aktivitäten gegen Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern verpflichten. Die Reichweite ist dabei einer der Hauptstreitpunkte: Welche Dienste sollen mit welchen Pflichten versehen werden? Sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch den MEPs sind die Diskussionen noch nicht abgeschlossen – dennoch soll der Trilog bald beginnen.
Zeitplan: Abstimmung im Rat am 28. September, Abstimmung im federführenden LIBE-Ausschuss geplant für den 9. Oktober.
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Mit dem überarbeiteten Rechtsakt zur digitalen Identität (eIDAS) soll die Nutzung digitaler Identitäten in der EU interoperabler werden. Die Verhandlungsführerin des Parlaments, Romana Jerković, hatte bereits im Juni mit der schwedischen Ratspräsidentschaft eine grundsätzliche Einigung erzielt. Allerdings sind nach wie vor viele, vordergründig technische Aspekte, nicht final entschieden.
Zeitplan: In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen abgeschlossen werden.
Die spanische Ratspräsidentschaft hat einen ersten Kompromissvorschlag in den Verhandlungen um die Revision des mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) vorgelegt. Das Papier enthält noch keine konkreten Zahlen, übernimmt aber inhaltlich weitgehend die Nachforderungen der EU-Kommission. Das sorgt laut Diplomaten für Unverständnis in Berlin und anderen Hauptstädten.
Die Kommission hatte Mitte Juni einen Nachschlag zur Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027 gefordert:
Die spanische Ratspräsidentschaft übernimmt die einzelnen Punkte in ihren Entwurf für die sogenannte Verhandlungsbox. Lediglich bei den Verwaltungskosten sieht sie als eine von zwei Formulierungsalternativen vor, dass die EU-Institutionen die gestiegenen Gehälter und Raumkosten durch Einsparungen und Umschichtungen aufbringen soll.
Der Vorschlag dürfte für Diskussionen sorgen beim informellen Treffen der Finanzminister am 15. und 16. September in Santiago de Compostela. Viele Regierungen sind angesichts der angespannten Haushaltslage nicht bereit, alle Wünsche aus Brüssel zu erfüllen.
Wie die meisten Mitgliedsstaaten stellt auch die Bundesregierung die Ukraine-Hilfe nicht infrage. Berlin vermisst aber Vorschläge der Kommission, wie die Verwaltungskosten und die gestiegenen Zinsen durch Umschichtungen im EU-Haushalt aufgebracht werden können. Bei anderen Punkten wie STEP sind sich die Koalitionspartner noch nicht einig – Wirtschaftsminister Robert Habeck hege dafür Sympathie, Finanzminister Christian Lindner sei skeptisch, heißt es in Berlin.
Das Europaparlament will hingegen noch über die Kommissionsvorschläge hinausgehen. Der Grünen-Haushälter Rasmus Andresen kritisierte, der spanische Vorschlag hinterlasse mehr Fragen als Antworten. So bleibe offen, ob die Zinskosten für das Wiederaufbauinstrument außerhalb der Obergrenzen des MFR platziert würden, um nicht die bereits verplanten Mittel zu gefährden.
Die anstehenden Verhandlungen über die Revision des MFR und den Haushalt für das kommende Jahr dürften also kompliziert werden. Die spanische Ratspräsidentschaft will daher vorsorgen, falls bis Jahresende keine Einigung zustande kommt: Sie schlägt für diesen Fall eine dreimonatige Brückenlösung vor, um die Finanzierung der Ukraine dennoch gewährleisten zu können. tho
Die Berichterstatter des Europaparlaments fordern, die geplante Investitionsplattform STEP enger mit anderen industriepolitischen Vorhaben zu verknüpfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Plattform “Strategic Technologies for Europe” im Juni vorgeschlagen, als Zwischenschritt zu einem Europäischen Souveränitätsfonds. STEP soll existierende Fonds wie den EU-Innovationsfonds oder InvestEU mit zehn Milliarden Euro zusätzlich ausstatten und den Zugang von Investoren in grüne oder digitale Technologien über ein gemeinsames Siegel erleichtern. Damit hofft von der Leyen eine Antwort etwa auf den Inflation Reduction Act der USA zu geben.
Die beiden zuständigen Europaabgeordneten José Manuel Fernandes und Christian Ehler (CDU) sprechen sich in ihrem Berichtsentwurf dafür aus, die Definition der förderfähigen Technologien mit anderen Vorhaben wie dem Net-Zero Industry Act (NZIA), dem Critical Raw Materials Act (CRMA) oder dem Programm Digitale Dekade zu synchronisieren. Zudem sollten Investitionsvorhaben, die unter NZIA oder CRMA als “strategische Projekte” eingestuft werden, auch direkten Zugang zu den STEP-Fördertöpfen erhalten. Der Entwurf ihres Berichts liegt Table.Media exklusiv vor.
Fernandes und Ehler fordern überdies, die Finanzierung über STEP auf Regionen mit spezialisierten Industrieclustern zu fokussieren. Ehler hatte sich bereits als NZIA-Berichterstatter dafür ausgesprochen, in den Mitgliedstaaten sogenannte Net-Zero industry valleys etwa für die Solar- oder die Windindustrie zu identifizieren, und dort beschleunigte Genehmigungsverfahren und bessere Fördermöglichkeiten zu schaffen. Die beiden Berichterstatter lehnen hingegen den Vorschlag der Kommission ab, fünf Milliarden Euro aus dem Innovationsfonds für Investitionen in wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten zu reservieren.
Zudem fordern die beiden Abgeordneten drei Milliarden Euro zusätzlich für STEP, wie bereits in den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. Um die Anlaufschwierigkeiten bei der Koordinierung der unterschiedlichen Töpfe zu mildern, soll die Kommission einen eigenen STEP-Ausschuss aus den jeweiligen Experten einsetzen. Diese sollen auch als Ansprechpartner für Projektentwickler dienen. tho
Margrethe Vestager zieht sich vorübergehend aus der Kommission zurück, um für den Vorsitz der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu kandidieren. Die Exekutiv-Vizepräsidentin habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über ihre offizielle Nominierung durch die dänische Regierung informiert und um eine unbezahlte Freistellung gebeten, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstagabend mit.
Für die Zeit der Abwesenheit soll Vizepräsidentin Věra Jourová von Vestager die Koordinierung des Ressorts “A Europe Fit for the digital age” übernehmen. Justizkommissar Didier Reynders erhält die Zuständigkeit für die Wettbewerbsaufsicht. Von der Leyen habe außerdem beschlossen, die Zuständigkeit für das Ressort Innovation und Forschung vorübergehend Vizepräsident Margaritis Schinas zu übertragen, bis die Nachfolgerin für die ehemalige Kommissarin Marija Gabriel ernannt ist.
In der Mitteilung hieß es auch, dass für Vestager weiter der Verhaltenskodex für Mitglieder der Kommission gelte. Vestagers schärfste Konkurrentin um den EIB-Vorsitz ist die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño. Eine Vorentscheidung könnte beim informellen Treffen der Finanzminister am 15. und 16. September im spanischen Santiago de Compostela fallen. Der bisherige Präsident Werner Hoyer geht zum Jahresende in den Ruhestand. lei/dpa

Gut zweieinhalb Stunden dauerte das “Bewerbungsgespräch”. Die Ausschüsse für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie für Kultur und Bildung (CULT) haben am Dienstag Iliana Ivanova für den Posten als EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend angehört. Ivanova habe gezeigt, “dass sie die Richtige für den Job ist“, sagte CULT-Vorsitzende Sabine Verheyen (CDU) im Anschluss. Ivanova habe ein tiefgreifendes Verständnis von den Bereichen Bildung, Kultur und Jugend und werde die unter ihrer Vorgängerin gestarteten Initiativen “engagiert voranbringen und ihre eigenen Akzente setzen”.
Die Neubesetzung so kurz vor dem Ende der Mandatsperiode war nötig geworden, weil die Vorgängerin im Amt, Marija Gabriel, zurückgetreten war, um in ihrem Heimatland Ministerpräsidentin zu werden. Heute ist Gabriel stellvertretende Ministerpräsidentin und Außenministerin Bulgariens.
Ivanova sagte, drei Punkte seien für sie zentral. Einmal die Schlüsselrolle der Forschung und Innovation für das EU-Wachstumsmodell. Dann die Frage, wie Europa am besten Bildung und Kompetenzen fördern könne. “Denn das Potenzial der Menschen auszubauen, ist die beste Investition in die Zukunft.” Und schließlich die Kohäsionsrolle der Kultur in unserer Gesellschaft. Forschung, Entwicklung und Innovation sehe sie als Vorbedingung für eine nachhaltige Zukunft.
Auf Deutsch sagte Ivanova, es sei höchste Zeit, dass die EU Horizont Europa auch als ein Werkzeug für den Vorsprung auf globaler Ebene nutze. Kooperation werde dabei immer ausschlaggebend sein. “Wir müssen die internationale Dimension von Horizont Europa stärken und die Assoziierung von Drittländern vorantreiben”, forderte Ivanova. Gleichzeitig müsse die EU die Reziprozität sicherstellen, so wie es die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorsehe. In der Anhörung sprach Ivanova außer Deutsch und ihrer Muttersprache Bulgarisch auch Englisch und Französisch.
Vor der Anhörung hatte Ivanova bereits schriftlich Fragen des Parlaments beantwortet. Nach der Anhörung bewertete die Konferenz der Ausschussvorsitzenden das Ergebnis der Anhörung und leitete ihre Schlussfolgerungen an die Konferenz der Präsidenten weiter. Diese wird heute die abschließende Bewertung vornehmen und entscheiden, ob das Anhörungsverfahren abgeschlossen ist.
Dann kann die Abstimmung auf der September-Plenartagung stattfinden. Die Abstimmung des Parlaments über einzelne Kandidaten erfolgt in geheimer Abstimmung und erfordert eine einfache Mehrheit. vis
Zur Eröffnung der internationalen Automobilmesse IAA Mobility in München versprach Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag, er werde in der EU “mit allem Nachdruck für Freihandelsabkommen werben”. Er sei zuversichtlich, dass man nach den Verhandlungsabschlüssen mit Neuseeland und Kenia bald auch “gute Nachrichten” aus den Verhandlungen mit Australien, dem Mercosur, Mexiko und Indonesien melden könne. Die dadurch entstehende Diversifizierung bei der Beschaffung von Rohstoffen sei die Antwort auf einseitige Abhängigkeiten.
Um den Hochlauf der Elektromobilität und die Transformation von Industrieprozessen voranzutreiben, will Scholz Bürokratie abbauen und Verwaltungsverfahren beschleunigen. Dabei schaue man auch nach Brüssel. “Gemeinsam mit den europäischen Partnern, insbesondere mit der französischen Regierung, wollen wir eine Initiative für Bürokratieentlastung, bessere Rechtssetzung und bessere Verwaltung ergreifen.”
Der Bürokratieabbau gelte laut Scholz besonders für die Ladeinfrastruktur. “Laden muss so einfach oder noch einfacher werden als tanken”, erklärte der Bundeskanzler. Er kündigte für “die nächsten Wochen” ein Gesetz an, mit dem die Betreiber von fast allen Tankstellen zur Bereitstellung von Schnelllademöglichkeiten für E-Autos von 150 Kilowatt verpflichtet werden. Zudem will Scholz durch günstigeren Strom dafür sorgen, dass sich E-Autos gegenüber Verbrennern schneller amortisieren. luk
Beim Treffen der 27 EU-Landwirtschaftsminister haben die Neuen Genomischen Techniken (NGT) ganz oben auf der Agenda gestanden. Das sagte der spanische Minister Luis Planas im Anschluss an das zweitägige informelle Treffen in Córdoba. Planas betonte, dass die spanische Präsidentschaft beabsichtige, bis zum Ende des Jahres – also bis zum Ende der spanischen Präsidentschaft – eine Einigung im Rat über den von der Europäischen Kommission am 5. Juli vorgelegten Vorschlag zu erzielen. Die spanische Ratspräsidentschaft hat die NGT zu einer ihrer Prioritäten gemacht und will die Zahl der “innovativen” NGT-Projekte bis 2027 durch den Einsatz von Mitteln aus der GAP und dem EU-Forschungsprogramm Horizon verdreifachen.
Für Madrid “sind die NGT wichtig, weil sie es ermöglichen, präzise Veränderungen in den Pflanzen vorzunehmen, die zu effizienten Pflanzen führen, die an die bestehenden Klimaszenarien angepasst sind”, sagte Planas. Dies trage dazu bei, die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems durch verbesserte Pflanzensorten zu erhöhen, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit, hohe Temperaturen und andere Extremsituationen sind oder weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel benötigen.
Ein weiteres heißes Thema auf der Tagesordnung der 27: die Verlängerung des Einfuhrverbots für vier ukrainische Produkte (Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne). Dieses Verbot soll offiziell am 15. September auslaufen. Die Ukraine hat der EU mit einer Klage vor der WTO gedroht, sollte sie das Verbot verlängern.
Das Thema solle auch am heutigen Mittwoch im Kollegium der Kommissare diskutiert werden, sagte der polnische Agrarkommissar Janusz Wojciechowski nach dem informellen Treffen. Am 31. August hatte Wojciechowski bei einer Anhörung im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, die vorübergehende Beschränkung für die vier Produkte aus der Ukraine für fünf osteuropäische Staaten (Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei) bis mindestens Ende des Jahres zu verlängern.
Außerdem forderte er die Bereitstellung von 600 Millionen Euro, um die Ausfuhr von ukrainischem Getreide in Drittländer zu erleichtern. Bisher ist die Position des Kommissars jedoch nur für ihn selbst bindend, da die Kommission keinen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. cst
Die Kommission will die EU-Regelung für gemeinsame Gaseinkäufe verstetigen. Das geht aus einem Dokument hervor, das Reuters einsehen konnte. Bei den ersten Ausschreibungen zum gemeinsamen Gaseinkauf hatte die Nachfrage die Erwartungen deutlich übertroffen.
Inzwischen sind zwar die Erdgasspeicher der EU wieder zu über 90 Prozent ihrer Kapazität aufgefüllt. In der Kommission gibt es aber weiter Sorgen vor unerwarteten Ereignissen. Das befristete Programm sollte eigentlich im Dezember auslaufen.
Nach dem Kommissionsvorschlag, der Reuters vorliegt, hätten die EU-Unternehmen dauerhaft die Möglichkeit, Brennstoff gemeinsam zu kaufen. Das Instrument soll im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung der EU-Gasmarktvorschriften dauerhaft eingeführt werden. Die Teilnahme wäre freiwillig, aber wenn es in der EU zu einer Versorgungskrise käme, wäre der gemeinsame Einkauf obligatorisch, um zu vermeiden, dass die EU-Länder um die gleichen knappen Mengen konkurrieren. “Es ist etabliert, es funktioniert, die Zahl der Unternehmen steigt”, sagte ein hoher EU-Beamter über den gemeinsamen Gaseinkauf.
Trotz der anfänglichen Skepsis seitens der Industrie, hat die EU bisher eine Nachfrage von mehr als 27 Milliarden Kubikmetern Gas verzeichnet – das Doppelte der Menge, die Brüssel veranschlagt hatte. Es ist jedoch nicht klar, wie viel von dieser Nachfrage in feste Verträge umgesetzt wurde. Die EU bringt Gaskäufer und -verkäufer zusammen, ist aber nicht an den anschließenden Handelsverhandlungen beteiligt. Der neue EU-Vorschlag sieht vor, dass die Unternehmen melden müssen, wenn sie im Rahmen des Systems Verträge unterzeichnen.
Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments werden den Vorschlag noch in diesem Monat erörtern. Sie wollen das Gesetz bis zum Ende des Jahres fertigstellen.
Strittig ist bei den Ländern noch, wie eine “Versorgungskrise” definiert werden soll, die einen verpflichtenden gemeinsamen Ankauf auslösen würde und ob der gemeinsame Ankauf auf andere Energierohstoffe wie Wasserstoff ausgedehnt werden soll, sagte der hochrangige EU-Beamte. Der Vorschlag sieht vor, das System auszuweiten, um die geplante Europäische Wasserstoffbank zu unterstützen, die im November an den Start gehen soll.
Die gemeinsamen Käufe machen nur einen Bruchteil des gesamten Gasbedarfs der EU von rund 360 Milliarden Kubikmetern aus, sollen aber den Ländern helfen, sich auf den Winter vorzubereiten, wenn der Gasbedarf für Heizzwecke in Europa seinen Höhepunkt erreicht.
Die EU hatte den gemeinsamen Gaseinkauf in diesem Jahr ins Leben gerufen, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Europa im Jahr 2022 gekürzt hatte und die europäischen Energiepreise als Reaktion darauf auf ein Rekordhoch gestiegen waren. rtr/lei
Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat eine Amnestie für alle Separatisten als Vorbedingung für Gespräche für eine Unterstützung bei der spanischen Regierungsbildung genannt. Er forderte zudem “Respekt für die demokratische Legitimität des Separatismus”. Seine Partei sei zu Verhandlungen über einen “historischen Kompromiss” bereit, bei dem alle Aspekte des Konflikts benannt und Garantien für Vereinbarungen gegeben werden müssten, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Brüssel. Nach der Parlamentswahl im Juli ist eine Bildung einer neuen Regierung in Spanien schwierig, Puigdemont gilt als Königsmacher.
Er wolle noch nicht die endgültigen Ziele der Verhandlungen über eine Regierungsbildung nennen, fügte Puigdemont hinzu. Ein neues Referendum über die Abspaltung Kataloniens von Spanien sprach Puigdemont zwar indirekt an, machte es aber nicht ausdrücklich zu einer Bedingung für Gespräche über die Regierungsbildung. Bei dem für illegal erklärten Referendum vom 1. Oktober 2017 hatte eine Mehrheit für die Unabhängigkeit gestimmt. Bald darauf war Puigdemont ins Ausland geflohen. Andere Separatistenführer waren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, sind nach einer Begnadigung aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Am Vortag hatte Arbeitsministerin Yolanda Díaz bereits mit Puigdemont in Brüssel gesprochen. Beide vereinbarten, man wolle “alle demokratischen Lösungen erkunden, um den politischen Konflikt (in Katalonien) zu entschärfen“, wie es im Kommuniqué hieß. Für Sánchez wäre vor allem eine Forderung Puigdemonts nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum nur schwer zu erfüllen, weil dies ihn im Rest des Landes viele Stimmen kosten könnte. dpa

Mit gut 24 Prozent am Endverbrauch hat die EU heute einen fast doppelt so hohen Anteil bei den Erneuerbaren Energien wie der weltweite Durchschnitt. Doch zuletzt ging es kaum noch voran, siehe Windkraft: Der weltweite Ausbau lag 2022 im Vergleich zu 2021 bei 17 Prozent, in der EU aber nur bei neun Prozent. Warum wird Europa langsamer?
Mit lange garantierten Einspeisevergütungen, auch für technisch überholte Solaranlagen, fehlt Innovationsdruck. Durch strenge Artenschutzvorgaben können kleine Haselmäuse große Windparks verhindern, beziehungsweise ewig lange Genehmigungsverfahren verursachen. Und wenn mancherorts viel Grünstrom produziert wird, wachsen Infrastruktur und Netze nicht mit, auch weil die Politik immer mehr Klageoptionen einräumt.
Spätestens mit dem Ukrainekrieg und den Verwerfungen der Energiemärkte hat sich die Lage zumindest in Brüssel verändert. Fast möchte man mit Blick auf mehr Energiesouveränität meinen, dass ein Ruck durch die EU-Institutionen gegangen ist. Am 13. September stimmt das EU-Parlament über die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie ab. Nennen wir es nicht Booster, aber dieses Gesetz ist ein Beleg dafür, dass Brüssel auch pragmatisch unbürokratisch sein kann.
Nicht nur, dass die Richtlinie das EU-Ausbauziel 2030 für den Energie-Endverbrauch von 30 auf 45 Prozent aus erneuerbaren Energien drastisch erhöht, nein, aus Brüssel kommt dieses Mal eben nicht nur “höher, schneller, weiter”, sondern auch, wie das günstiger und regulierungsärmer gelingen kann. Erstens wird der Ausbau der Erneuerbaren als überragendes öffentliches Interesse eingestuft. Dieser Status ist Garant für schnellere Genehmigungsverfahren, die für alle Anlagen und ihre Infrastrukturen gelten. Zudem können “Beschleunigungsgebiete” festgelegt werden, in denen es Ausnahmen von den Artenschutzvorgaben geben kann. Die einzelne Haselmaus muss dem Windpark oder der Biogasanlage weichen, wenn der Bestand der Haselmäuse europaweit gesichert ist. Mit dem wunderbaren Begriff “positive Stille” wird sichergestellt, dass Bauanträge automatisch als genehmigt gelten, wenn nach zwölf Monaten die Rückmeldung fehlt – also doch ein Booster.
Zweitens ist das Gesetz technologieoffen. Im Fokus sind Wind und Solar, aber auch Wasserkraft, Geothermie oder Gezeitenströme. Umstritten war die Einstufung der “holzbasierten Biomasse” als erneuerbar. Weil Bäume eben nachwachsen, gab es eine Mehrheit dafür. Sogar die Ampel hat – nachdem klar war, dass der schwarze Peter nicht nach Brüssel gehen konnte -das deutsche Heizungsgesetz angepasst.
Der dritte Türöffner ist die Einsicht, dass Importe entscheidend sind. Wärmepumpe, Elektroautos sowie grüner Strom und Wasserstoff in der Industrie erfordern bis zur Klimaneutralität mindestens das Fünffache an Grünstrom. 50 bis 70 Prozent davon muss Europa importieren. Deshalb ist es wichtig, dass die EU Importziele und entsprechende Strategien für die nationalen Energie- und Klimapläne vorschreibt.
Schließlich ist die Richtlinie ein Beschleuniger für Innovationen. Die Mitgliedsstaaten sind angehalten, fünf Prozent ihrer jährlichen Ausbauquoten über den Stand der Technik hinaus zu planen. Ausschreibungen und Marktprämien für Wind, Sonne und Biomasse, Pilotprojekte für schwimmenden Solarzellen, Winddrachen, Flusskraftwerke, Algenhäuser, Solarstraßen oder Wasserkraftwerke mit Energie von Meereswellen. Nichts ist unmöglich und fast alles hat Zukunft. Jede einschlägige Technologie hat ein Recht, erforscht zu werden. Viel zu lange verharrte etwa Deutschland in alten Denkmustern von Einspeisevergütungen, vernachlässigte Speichertechnologie, und verlieh veralteter Technik wirtschaftlichen Glanz.
Damit bietet die EU einen optimalen Rahmen für marktwirtschaftliche Lösungen zum Ausbau der Erneuerbaren. Flankieren muss Brüssel durch noch mehr Pragmatismus, weniger Bürokratie bei grenzüberschreitenden Netzprojekten und beihilferechtlichen Ausnahmen für Investitionen in die Wertschöpfungskette, ohne nerv- und projekttötende Notifizierungsverfahren. Wir brauchen zudem ein EU-Strommarktdesign, das Erneuerbare auch als Kapazitätsreserven attraktiv macht und dezentralen Speicherlösungen Raum gibt.
Alles entscheidend sind die Mitgliedsstaaten. Sie müssen die Bälle aus Brüssel unbürokratisch aufgreifen. Die schnelle Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ist ebenso entscheidend wie Lust auf technologieoffene Innovationen. Für eine steigende volatile Stromerzeugung braucht es mehr Netze, die intelligent zwischenspeichern, Spitzenlasten abfedern und über große Entfernungen liefern können. Es braucht die Erkenntnis, dass das meiste, aber eben nicht alles nur elektrisch geht. Wasserstoff muss die Zukunft bekommen, den er für die Energiewende verdient. Berlin muss das Pariser CO₂-Ziel in den Vordergrund stellen und die Vielfalt der Regenbogenfarben auch beim Wasserstoff akzeptieren.
Brüssel überlässt den Ländern, ob und zu welchen Anteilen Gas- und Wasserstoff gemischt in die Netze gelangen. Deutschland muss deshalb seinen einzigartigen Standortvorteil des weitverzweigten und speicherfähigen Gasnetzes ausspielen. Statt der Ampelpläne für ein Rückbaugebot der Gasnetze braucht es ein Rückbauverbot. Die Wahl, ob Elektrifizierung, Einsatz von Wasserstoff, Biogas oder Biomasse, muss jedem Unternehmen und Haushalt offenstehen. Mit den erwartbaren Fortschritten bei Ausbau und Import ist das mehr als Wunschdenken. Nur wenn Deutschland die neuen EU-Vorgaben aufgreift, kommen wir bei den Erneuerbaren Energien wieder auf die Überholspur. Und zwar zu vertretbaren Kosten.
nach fünf Jahren findet heute und morgen erstmals wieder die Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel statt. Die 16 Regierungschefs der Bundesländer treffen sich mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie mehreren Kommissaren. Am Donnerstag ist auch ein Mittagessen mit dem Ständigen Vertreter, Michael Clauß, geplant. Die wichtigsten Themen sind: Wie kann die Abwanderung der Industrie verhindert werden? Was tut die Kommission, um die illegale Migration in den Griff zu bekommen? Wann passiert etwas beim Bürokratieabbau?
Die Bundesländer sind ja nicht direkt in das EU-Gesetzgebungsverfahren eingebunden, sondern haben Mitwirkungsrechte über den Bundesrat. Das hält die MPs aber nicht davon ab, konkrete Forderungen zu stellen und deutlich Kritik zu üben. Etwa in der “Brüsseler Erklärung”, dem sieben Seiten langen Dokument der MPK in Brüssel.
So fordern die Länderchefs unabhängig von ihrer Partei einen “Brückenstrompreis für die energieintensive Industrie”. Der derzeitige Vorsitzende der MPK, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), dürfte von der Leyen an den Vorschlag seines Landes in der Sache aus dem April erinnern und darauf hinweisen, dass beihilferechtliche Probleme in den Griff zu bekommen wären.
Weils Stellvertreter, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), fordert “deutliche Vereinfachungen im Beihilfe- und Vergaberecht”. Wüst sagte Table.Media: “Wenn es um Verfahrensbeschleunigung geht, verweist die Bundesregierung (uns) allzu oft nach Brüssel und sagt: Das geht europarechtlich nicht.” Weil sich die Bundesregierung in Europa dann aber nicht für entsprechende Änderungen einsetze, wollten er und die anderen MPs diese Forderung nun direkt selbst bei der Kommission erheben. Mal sehen, ob sie Gehör finden.
In Deutschland stehen zudem die Haushaltsberatungen des Bundestages an. Und mit ihnen geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in dieser Woche in die zweite Hälfte. Wir von Table.Media fragen Sie in einer Umfrage: Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Wie bewerten Sie generell die bisherige Arbeit der Ampel und die Leistungen der Ministerinnen und Minister? Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen und bitten Sie um Ihre Einschätzungen. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse, die wir Ihnen natürlich auch gern zusenden.

Sechs Millionen Fahrzeuge erreichen in Europa jährlich das Ende ihrer Lebensdauer. Dann gelten sie als Altfahrzeuge – und bergen einen enormen Schatz an Materialien, von energieintensiven Grundstoffen wie Stahl und Aluminium über Edelmetalle bis hin zu Seltenen Erden.
Die EU-Altfahrzeugrichtlinie aus dem Jahr 2000, die in Deutschland durch die Altfahrzeug-Verordnung umgesetzt ist, legt Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Abfällen aus Altfahrzeugen und deren Bauteilen fest und stellt sicher, dass diese wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden.
Seit 2015 müssen mindestens 95 Prozent des Leergewichts aller Altfahrzeuge wiederverwendet oder verwertet werden. Davon müssen mindestens 85 Gewichtsprozent wiederverwendet oder recycelt werden. Die Mitgliedstaaten berichten jährlich über die Menge an Altfahrzeugen sowie die Wiederverwertungs- und Recyclingraten; diese sind bereits sehr hoch: Im EU-Durchschnitt beträgt die Wiederverwertungsrate knapp 95 Prozent, die Recyclingrate 89 Prozent. In Deutschland liegt sie nur knapp darunter, bei 94 Prozent Wiederverwertung und 87 Prozent Recycling.
Die EU-Kommission überarbeitet die Richtlinie nun und hat im Juli einen Entwurf für eine Verordnung vorgestellt. Denn trotz hoher Recyclingquoten stehen einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Automobilsektor einige Hindernisse im Weg: Nur geringe Mengen an Kunststoffen werden bislang recycelt und wiederverwendet, und die anfallenden Altmetalle sind von geringer Qualität. Zudem wird mit dem Übergang zur Elektromobilität und der zunehmenden Integration von Elektronik in Fahrzeugen die Nachfrage nach Kupfer und kritischen Rohstoffen steigen. Deshalb liegt der Fokus der Überarbeitung auf Zielen für den Einsatz von Rezyklat. Zudem adressiert sie das Problem des “unbekannten Verbleibs” von Altfahrzeugen.
Die Automobilindustrie gehört zu den größten Verbrauchern von Primärrohstoffen und setzt bisher nur wenig recycelte Materialien ein. Laut Angaben der EU-Kommission kommt der europäische Automobilsektor im Jahr auf:
Dazu kommen die Rohstoffe für Batterien, deren Bedarf mit dem Hochlauf der E-Mobilität immens steigen wird: Kobalt, Lithium, Nickel, Mangan und Graphit. Vorgaben zur Zirkularität der Batterierohstoffe werden in der Batterieverordnung reguliert, die Anfang 2024 in Kraft tritt.
Die Kommission geht zudem davon aus, “dass die Automobilindustrie in Europa zum größten Verbraucher kritischer Rohstoffe für Dauermagnete von Elektromotoren werden wird”. Hier besteht eine immense Abhängigkeit von China: Permanentmagnete werden zu 94 Prozent aus China importiert, die dafür benötigten Seltenen Erden zum Großteil in China abgebaut und verarbeitet.
Kupfer und Seltene Erden steht bereits auf der EU-Liste der Rohstoffe, die aufgrund der derzeitigen Abhängigkeiten von einzelnen Exportländern, ihrer Bedeutung für die Industrie und der rasant steigenden Nachfrage als strategisch gelten. Für sie sieht der derzeit im EU-Parlament verhandelte Critical Raw Materials Act größere Produktionskapazitäten innerhalb der EU, eine Importdiversifizierung und größere Recyclingkapazitäten vor. Bauxit, aus dem Aluminium hergestellt wird, steht auf der Liste kritischer Rohstoffe. Für sie gelten die Ziele, das Versorgungsrisiko zu überwachen und zu mindern sowie ihren freien Verkehr im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten. Laut dem Verhandlungsmandat des Rats sollen Bauxit, Aluminiumoxid und Aluminium als strategische Rohstoffe eingestuft werden.
Die Kommission will das Recycling und die Wiederverwertung dieser Rohstoffe im Automobilsektor fördern und deshalb in der neuen Verordnung Zielvorgaben für den Einsatz von Rezyklat in Fahrzeugen festlegen. Im Entwurf gibt es jedoch nur eine konkrete Zahl: 25 Prozent des Kunststoffs, der für den Bau eines neuen Fahrzeugs verwendet wird, müssen aus dem Recycling stammen. Davon wiederum müssen 25 Prozent aus Altfahrzeugen rezykliert werden. Für eine mögliche Festlegung von Zielvorgaben für den Recyclinganteil von Seltenen Erden, Aluminium und Magnesium sowie deren Legierungen soll die Kommission zunächst Machbarkeitsstudien durchführen.
Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) ist laut einem aktuellen Positionspapier zur Kreislaufwirtschaft “bestrebt, den Einsatz von Sekundärmaterialien zu erhöhen und somit weniger Neumaterialien aus fossilen Quellen und Erzen zu verwenden”. Bislang werden nur wenig Sekundärmaterialien eingesetzt; viele Vorhaben beziehen sich vor allem auf das Recycling der Batterien von E-Autos. Fahrzeuge der BMW Group bestehen laut eigenen Angaben aktuell aus “bis zu 30 Prozent recyceltem und wiederverwendetem Material”. Audi hat in diesem Jahr ein Projekt gestartet, um “den Anteil an eingesetzten Rezyklaten in der Audi-Flotte in den nächsten Jahren beständig zu erhöhen”.
Anders als im Gesetzesentwurf der EU-Kommission vorgesehen, sollte die Nutzung aller Materialquellen ermöglicht werden, sagt Michael Püschner, Leiter des Fachgebiets Umwelt und Nachhaltigkeit beim VDA. Der Kommissionsentwurf sehe zum Beispiel für Kunststoff lediglich einen Post-Consumer- sowie einen Closed-Loop-Ansatz vor, bei dem die Rezyklateinsatzquoten durch wiedergewonnene Materialien desselben Fahrzeugtyps erreicht werden müssen. Dies sei in der Praxis nicht umsetzbar. Deshalb sollte es mehr und branchenübergreifende Optionen für die Unternehmen geben, um vorgegebenen Quoten überhaupt ansatzweise erreichen zu können. Der VDA schlägt daher vor, die Höhe und Zusammensetzung der Rezyklateinsatzquote noch einmal grundsätzlich zu überdenken und an die tatsächlichen Marktgegebenheiten anzupassen.
Ein weiteres Hindernis für die Kreislaufwirtschaft: Etwa 78 Prozent der Altfahrzeuge werden exportiert und sind deshalb für eine Verwertung in Deutschland nicht mehr verfügbar. Laut einer neuen Publikation des Wuppertal Instituts und der nordrhein-westfälischen Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate ist dies zwar zunächst begrüßenswert, da durch die Weiternutzung im Ausland die Lebensdauer verlängert werde. Allerdings sei fraglich, was mit den Fahrzeugen im Ausland passiere.
Fast 90 Prozent der Altfahrzeuge aus Deutschland werden zwar in andere EU-Staaten exportiert. Anschließend folgt jedoch oft der Export ins außereuropäische Ausland, etwa nach Westafrika. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms (UNEP) wurden 42 Prozent der Gebrauchtfahrzeuge, die von 2015 bis 2020 in EU-Ländern gehandelt wurden, in Länder außerhalb der EU exportiert. “Grundsätzlich gehen mit diesen Exporten signifikante Mengen an Sekundärrohstoffen für eine Verwertung in Deutschland verloren, was den Bedarf nach energieintensiver Primärproduktion erhöht und gerade bei kritischen Rohstoffen zur Abhängigkeit von globalen Lieferketten beiträgt”, heißt es in der Analyse des Wuppertal Instituts.
Darüber hinaus werden in Deutschland jährlich rund 150.000 Altfahrzeuge überhaupt nicht erfasst. Laut der Analyse ist oft eine nicht anerkannte Demontage in illegalen Verwertungsbetrieben der Grund. Hier setzt auch der Vorschlag der EU-Kommission an: Durch mehr Inspektionen, eine digitale Verfolgung von Altfahrzeugen in der gesamten EU und höhere Geldbußen für Verstöße soll das Verschwinden von Fahrzeugen gestoppt werden. Die Ausfuhr nicht verkehrstauglicher Gebrauchtfahrzeuge soll zudem verboten werden.
Der Entwurf enthält darüber hinaus die folgenden Vorgaben:
Bis Ende Oktober läuft nun die öffentliche Konsultation zu dem Entwurf.
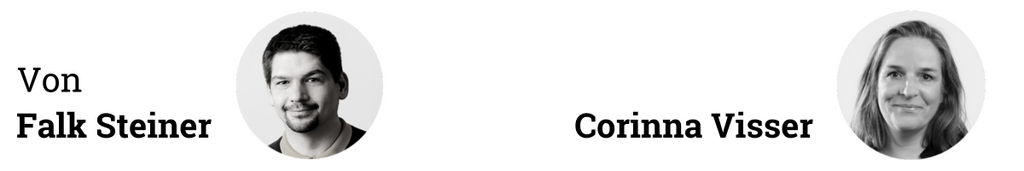
Das Ende der Mandatsperiode rückt näher und die EU-Politiker haben noch gut zu tun, um ihre Gesetzesvorhaben im Bereich des Digitalen abzuschließen. Die größte Aufmerksamkeit liegt dabei sicher auf dem KI-Gesetz (AI Act). Europa will den ersten umfassenden Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz weltweit vorlegen und hofft damit, einen Brussels Effect auszulösen. Doch die Verhandlungen sind noch lange nicht abgeschlossen – und es steht noch mehr auf dem Zettel.
Sogar noch neue Vorschläge der Kommission werden in dieser Mandatsperiode noch erwartet, zu:
Allerdings gibt es für diese Themen noch keinen Zeitplan. Folgende Themen stehen aber in diesem Herbst ganz sicher auf der Digitalagenda:
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Bereits seit Ende August treffen sich die Arbeitsgruppen wieder zweimal in der Woche jeweils vier Stunden zu den Verhandlungen. Dabei tasten sich die Verhandler langsam vor. Das derzeit am meisten diskutierte Thema, generative Künstliche Intelligenz, stand noch nicht auf der Agenda. Die Schwierigkeit ist, dass die Kommission diese Modelle in ihrem Entwurf gar nicht berücksichtigt hat und sie auch nicht in die Struktur des Gesetzes passen. Denn das Gesetz teilt KI-Anwendungen in Risikoklassen ein. KI, die für eine Vielzahl von Zwecken geschaffen ist, lassen sich dort eigentlich nicht eingruppieren.
Der Rat hatte dennoch etwas zu Allzweck-KI (General Purpos AI, kurz: GPAI) formuliert, das Parlament Foundation Models eingebracht. Über das Thema werden die Arbeitsgruppen voraussichtlich erst im Oktober diskutieren. Ebenso über die strittigen Themen Umweltauswirkungen, Grundrechte-Assessment und Ausnahmen für die Strafverfolgung.
Zeitplan: Die nächste Runde im Trilog ist für den 2. und 3. Oktober angesetzt, ein weiterer Termin Ende Oktober. Ziel ist es, noch unter spanischer Ratspräsidentschaft eine Einigung zu erreichen.
Akteure: federführend ist der JURI-Ausschuss, Berichterstatter Axel Voss (CDU)
Stand der Dinge: Der Entwurf der Kommission zu den Haftungsregeln für KI liegt vor. Das Parlament will die Beratung aber erst beginnen, wenn der AI Act abgeschlossen ist.
Zeitplan: offen
Akteure: Kommission
Stand der Dinge: Die Gesetze über digitale Dienste (DSA) und digitale Märkte (DMA) sind zwar in Kraft, doch jetzt geht es um die Anwendung. Der DSA ist bereits für 19 sehr große Onlineplattformen und Onlinesuchmaschinen rechtsverbindlich. Unternehmen wie X (Twitter), Facebook, Tiktok oder Instagram müssen Verpflichtungen zu Transparenz und Datenschutz einhalten sowie illegale Inhalte und Desinformation bekämpfen. Zalando und Amazon wehren sich jedoch auf dem Rechtsweg gegen ihre Einstufung als sehr große Onlineplattformen.
DMA: Das Gesetz soll unfaire und wettbewerbsverzerrende Praktiken sehr großer Technologieunternehmen eindämmen. Heute will die Kommission die Unternehmen benennen, die eine wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern bilden (Core Platform Services, kurz: CPS) und somit unter die Regulierung fallen. Sieben Gatekeeper – Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Alphabet (Google), Meta (Facebook) und Bytedance (Tiktok) – haben der EU-Kommission mitgeteilt, dass sie die Kriterien erfüllen. Ziel ist es, dass die großen Player ihre Technologie und Geschäftsmodelle anpassen, sodass kleinere, innovative Unternehmen eine Chance am Markt haben.
Auch hier sind Diskussionen zu erwarten, für wen die strengen Regeln gelten oder nicht, denn die Kommission hat einen gewissen Ermessensspielraum. Wie die Financial Times berichtet, wehren sich Apple und Microsoft dagegen, dass die Kommission ihre Dienste – die Chat-App iMessage und die Suchmaschine Bing – als Gatekeeper einstuft.
Andreas Schwab (CDU), Berichterstatter für den DMA und binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, hat zum Thema der Einstufung gerade an Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager geschrieben. Schwab weist darauf hin, dass auch Kartendienste wie Google Maps zur Onlinesuche verwendet und somit als Suchmaschine gewertet werden sollten. Zudem schlägt er vor, durch delegierte Rechtsakte die Verpflichtungen für Suchmaschinen auf andere CPS auszuweiten. Außerdem rät er, Unternehmen, die sowohl Social-Media- als auch Verkaufsplattform sind, als Marktplatz zu werten.
Zeitplan: Die Regeln des DSA gelten bereits für die sehr großen Anbieter, ab 24. Februar 2024 für alle. Die Verpflichtungen des DMA gelten ab März 2024.
Akteure: federführend ist der ITRE-Ausschuss, Berichterstatter ist Alin Mituța (Renew)
Stand der Dinge: Ohne digitale Infrastruktur gibt es keine Digitalisierung. Mit der im Februar 2023 vorgelegten Gigabit-Infrastrukturverordnung (einer Aktualisierung der Richtlinie zur Breitbandkostenreduktion) will die EU-Kommission einheitliche Bedingungen schaffen und die Kosten für den Netzausbau senken. Derzeit befindet sich der Parlamentsausschuss in der Phase der technischen Meetings. Plan des Rapporteurs war es, diese bis zur Sommerpause abzuschließen und anschließend rasch die Abstimmung anzusetzen.
Kontrovers diskutiert haben die Verhandler unter anderem die Fragen,
Zeitplan: noch offen
Akteure: Kommission
Stand der Dinge: Mit großer Spannung erwartet die Branche die Ergebnisse der Konsultation zur Zukunft der Kommunikationsnetze. Die Kommission betont dabei, dass es um eine sehr breit aufgestellte – ergebnisoffene – Umfrage zu der erwarteten technischen Entwicklung und den dafür benötigten Investitionen geht. Politisch brisanter Zankapfel ist dabei die Frage, ob sich die großen Technologiefirmen aus den USA, die riesigen Datenverkehr in Europa verursachen, an den Kosten der Netzbetreiber für den Ausbau ihrer Infrastruktur beteiligen sollen (Fair Share).
Zeitplan: noch offen. Die Ergebnisse der Konsultation sollen bald kommen.
Akteure: federführend ist der ITRE-Ausschuss, Berichterstatter Nicola Danti (Renew)
Stand der Dinge: Mit dem Rechtsakt will die EU die Cybersicherheit von Produkten verbessern, die miteinander oder mit dem Internet verbunden sind. Der Rat hat seine Position im Juli festgelegt. Der federführende ITRE-Ausschuss hat seine Positionierung im Juni beschlossen. Derzeit ist der CRA noch nicht auf der Tagesordnung des EP verankert.
Zeitplan: Nach dem EP-Mandat soll der Trilog schnellstmöglich beginnen, voraussichtlich noch im Oktober.
Akteure: federführend ist der CULT-Ausschuss, Berichterstatterin Sabine Verheyen (CDU)
Stand der Dinge: Das europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) will den Pluralismus und die Unabhängigkeit der Medien schützen – unter anderem gegen politische Einflussnahme und Überwachung. Gerade aus Deutschland, wo die Medienaufsicht Ländersache ist, kam viel Kritik. Ein Streitpunkt im Parlament ist Artikel 17, in dem es eine Ausnahme von der Moderationspflicht für Medien geben soll, die es im DSA nicht gibt.
Zeitplan: Der Rat hat seine Position im Juni festgelegt. Der Trilog soll schnellstmöglich beginnen. Am Donnerstag (7. September) wird der federführende CULT-Ausschuss seine Positionen beschließen. Anschließend muss das EP sein Verhandlungsmandat insgesamt beschließen. Hierfür ist die erste Oktober-Sitzungswoche vorgesehen.
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Die hochumstrittene CSA-Verordnung soll unter anderem Betreiber zu stärkeren Aktivitäten gegen Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern verpflichten. Die Reichweite ist dabei einer der Hauptstreitpunkte: Welche Dienste sollen mit welchen Pflichten versehen werden? Sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch den MEPs sind die Diskussionen noch nicht abgeschlossen – dennoch soll der Trilog bald beginnen.
Zeitplan: Abstimmung im Rat am 28. September, Abstimmung im federführenden LIBE-Ausschuss geplant für den 9. Oktober.
Akteure: Kommission, Rat und Parlament im Trilog
Stand der Dinge: Mit dem überarbeiteten Rechtsakt zur digitalen Identität (eIDAS) soll die Nutzung digitaler Identitäten in der EU interoperabler werden. Die Verhandlungsführerin des Parlaments, Romana Jerković, hatte bereits im Juni mit der schwedischen Ratspräsidentschaft eine grundsätzliche Einigung erzielt. Allerdings sind nach wie vor viele, vordergründig technische Aspekte, nicht final entschieden.
Zeitplan: In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen abgeschlossen werden.
Die spanische Ratspräsidentschaft hat einen ersten Kompromissvorschlag in den Verhandlungen um die Revision des mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) vorgelegt. Das Papier enthält noch keine konkreten Zahlen, übernimmt aber inhaltlich weitgehend die Nachforderungen der EU-Kommission. Das sorgt laut Diplomaten für Unverständnis in Berlin und anderen Hauptstädten.
Die Kommission hatte Mitte Juni einen Nachschlag zur Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027 gefordert:
Die spanische Ratspräsidentschaft übernimmt die einzelnen Punkte in ihren Entwurf für die sogenannte Verhandlungsbox. Lediglich bei den Verwaltungskosten sieht sie als eine von zwei Formulierungsalternativen vor, dass die EU-Institutionen die gestiegenen Gehälter und Raumkosten durch Einsparungen und Umschichtungen aufbringen soll.
Der Vorschlag dürfte für Diskussionen sorgen beim informellen Treffen der Finanzminister am 15. und 16. September in Santiago de Compostela. Viele Regierungen sind angesichts der angespannten Haushaltslage nicht bereit, alle Wünsche aus Brüssel zu erfüllen.
Wie die meisten Mitgliedsstaaten stellt auch die Bundesregierung die Ukraine-Hilfe nicht infrage. Berlin vermisst aber Vorschläge der Kommission, wie die Verwaltungskosten und die gestiegenen Zinsen durch Umschichtungen im EU-Haushalt aufgebracht werden können. Bei anderen Punkten wie STEP sind sich die Koalitionspartner noch nicht einig – Wirtschaftsminister Robert Habeck hege dafür Sympathie, Finanzminister Christian Lindner sei skeptisch, heißt es in Berlin.
Das Europaparlament will hingegen noch über die Kommissionsvorschläge hinausgehen. Der Grünen-Haushälter Rasmus Andresen kritisierte, der spanische Vorschlag hinterlasse mehr Fragen als Antworten. So bleibe offen, ob die Zinskosten für das Wiederaufbauinstrument außerhalb der Obergrenzen des MFR platziert würden, um nicht die bereits verplanten Mittel zu gefährden.
Die anstehenden Verhandlungen über die Revision des MFR und den Haushalt für das kommende Jahr dürften also kompliziert werden. Die spanische Ratspräsidentschaft will daher vorsorgen, falls bis Jahresende keine Einigung zustande kommt: Sie schlägt für diesen Fall eine dreimonatige Brückenlösung vor, um die Finanzierung der Ukraine dennoch gewährleisten zu können. tho
Die Berichterstatter des Europaparlaments fordern, die geplante Investitionsplattform STEP enger mit anderen industriepolitischen Vorhaben zu verknüpfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Plattform “Strategic Technologies for Europe” im Juni vorgeschlagen, als Zwischenschritt zu einem Europäischen Souveränitätsfonds. STEP soll existierende Fonds wie den EU-Innovationsfonds oder InvestEU mit zehn Milliarden Euro zusätzlich ausstatten und den Zugang von Investoren in grüne oder digitale Technologien über ein gemeinsames Siegel erleichtern. Damit hofft von der Leyen eine Antwort etwa auf den Inflation Reduction Act der USA zu geben.
Die beiden zuständigen Europaabgeordneten José Manuel Fernandes und Christian Ehler (CDU) sprechen sich in ihrem Berichtsentwurf dafür aus, die Definition der förderfähigen Technologien mit anderen Vorhaben wie dem Net-Zero Industry Act (NZIA), dem Critical Raw Materials Act (CRMA) oder dem Programm Digitale Dekade zu synchronisieren. Zudem sollten Investitionsvorhaben, die unter NZIA oder CRMA als “strategische Projekte” eingestuft werden, auch direkten Zugang zu den STEP-Fördertöpfen erhalten. Der Entwurf ihres Berichts liegt Table.Media exklusiv vor.
Fernandes und Ehler fordern überdies, die Finanzierung über STEP auf Regionen mit spezialisierten Industrieclustern zu fokussieren. Ehler hatte sich bereits als NZIA-Berichterstatter dafür ausgesprochen, in den Mitgliedstaaten sogenannte Net-Zero industry valleys etwa für die Solar- oder die Windindustrie zu identifizieren, und dort beschleunigte Genehmigungsverfahren und bessere Fördermöglichkeiten zu schaffen. Die beiden Berichterstatter lehnen hingegen den Vorschlag der Kommission ab, fünf Milliarden Euro aus dem Innovationsfonds für Investitionen in wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten zu reservieren.
Zudem fordern die beiden Abgeordneten drei Milliarden Euro zusätzlich für STEP, wie bereits in den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. Um die Anlaufschwierigkeiten bei der Koordinierung der unterschiedlichen Töpfe zu mildern, soll die Kommission einen eigenen STEP-Ausschuss aus den jeweiligen Experten einsetzen. Diese sollen auch als Ansprechpartner für Projektentwickler dienen. tho
Margrethe Vestager zieht sich vorübergehend aus der Kommission zurück, um für den Vorsitz der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu kandidieren. Die Exekutiv-Vizepräsidentin habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über ihre offizielle Nominierung durch die dänische Regierung informiert und um eine unbezahlte Freistellung gebeten, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstagabend mit.
Für die Zeit der Abwesenheit soll Vizepräsidentin Věra Jourová von Vestager die Koordinierung des Ressorts “A Europe Fit for the digital age” übernehmen. Justizkommissar Didier Reynders erhält die Zuständigkeit für die Wettbewerbsaufsicht. Von der Leyen habe außerdem beschlossen, die Zuständigkeit für das Ressort Innovation und Forschung vorübergehend Vizepräsident Margaritis Schinas zu übertragen, bis die Nachfolgerin für die ehemalige Kommissarin Marija Gabriel ernannt ist.
In der Mitteilung hieß es auch, dass für Vestager weiter der Verhaltenskodex für Mitglieder der Kommission gelte. Vestagers schärfste Konkurrentin um den EIB-Vorsitz ist die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño. Eine Vorentscheidung könnte beim informellen Treffen der Finanzminister am 15. und 16. September im spanischen Santiago de Compostela fallen. Der bisherige Präsident Werner Hoyer geht zum Jahresende in den Ruhestand. lei/dpa

Gut zweieinhalb Stunden dauerte das “Bewerbungsgespräch”. Die Ausschüsse für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie für Kultur und Bildung (CULT) haben am Dienstag Iliana Ivanova für den Posten als EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend angehört. Ivanova habe gezeigt, “dass sie die Richtige für den Job ist“, sagte CULT-Vorsitzende Sabine Verheyen (CDU) im Anschluss. Ivanova habe ein tiefgreifendes Verständnis von den Bereichen Bildung, Kultur und Jugend und werde die unter ihrer Vorgängerin gestarteten Initiativen “engagiert voranbringen und ihre eigenen Akzente setzen”.
Die Neubesetzung so kurz vor dem Ende der Mandatsperiode war nötig geworden, weil die Vorgängerin im Amt, Marija Gabriel, zurückgetreten war, um in ihrem Heimatland Ministerpräsidentin zu werden. Heute ist Gabriel stellvertretende Ministerpräsidentin und Außenministerin Bulgariens.
Ivanova sagte, drei Punkte seien für sie zentral. Einmal die Schlüsselrolle der Forschung und Innovation für das EU-Wachstumsmodell. Dann die Frage, wie Europa am besten Bildung und Kompetenzen fördern könne. “Denn das Potenzial der Menschen auszubauen, ist die beste Investition in die Zukunft.” Und schließlich die Kohäsionsrolle der Kultur in unserer Gesellschaft. Forschung, Entwicklung und Innovation sehe sie als Vorbedingung für eine nachhaltige Zukunft.
Auf Deutsch sagte Ivanova, es sei höchste Zeit, dass die EU Horizont Europa auch als ein Werkzeug für den Vorsprung auf globaler Ebene nutze. Kooperation werde dabei immer ausschlaggebend sein. “Wir müssen die internationale Dimension von Horizont Europa stärken und die Assoziierung von Drittländern vorantreiben”, forderte Ivanova. Gleichzeitig müsse die EU die Reziprozität sicherstellen, so wie es die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit vorsehe. In der Anhörung sprach Ivanova außer Deutsch und ihrer Muttersprache Bulgarisch auch Englisch und Französisch.
Vor der Anhörung hatte Ivanova bereits schriftlich Fragen des Parlaments beantwortet. Nach der Anhörung bewertete die Konferenz der Ausschussvorsitzenden das Ergebnis der Anhörung und leitete ihre Schlussfolgerungen an die Konferenz der Präsidenten weiter. Diese wird heute die abschließende Bewertung vornehmen und entscheiden, ob das Anhörungsverfahren abgeschlossen ist.
Dann kann die Abstimmung auf der September-Plenartagung stattfinden. Die Abstimmung des Parlaments über einzelne Kandidaten erfolgt in geheimer Abstimmung und erfordert eine einfache Mehrheit. vis
Zur Eröffnung der internationalen Automobilmesse IAA Mobility in München versprach Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag, er werde in der EU “mit allem Nachdruck für Freihandelsabkommen werben”. Er sei zuversichtlich, dass man nach den Verhandlungsabschlüssen mit Neuseeland und Kenia bald auch “gute Nachrichten” aus den Verhandlungen mit Australien, dem Mercosur, Mexiko und Indonesien melden könne. Die dadurch entstehende Diversifizierung bei der Beschaffung von Rohstoffen sei die Antwort auf einseitige Abhängigkeiten.
Um den Hochlauf der Elektromobilität und die Transformation von Industrieprozessen voranzutreiben, will Scholz Bürokratie abbauen und Verwaltungsverfahren beschleunigen. Dabei schaue man auch nach Brüssel. “Gemeinsam mit den europäischen Partnern, insbesondere mit der französischen Regierung, wollen wir eine Initiative für Bürokratieentlastung, bessere Rechtssetzung und bessere Verwaltung ergreifen.”
Der Bürokratieabbau gelte laut Scholz besonders für die Ladeinfrastruktur. “Laden muss so einfach oder noch einfacher werden als tanken”, erklärte der Bundeskanzler. Er kündigte für “die nächsten Wochen” ein Gesetz an, mit dem die Betreiber von fast allen Tankstellen zur Bereitstellung von Schnelllademöglichkeiten für E-Autos von 150 Kilowatt verpflichtet werden. Zudem will Scholz durch günstigeren Strom dafür sorgen, dass sich E-Autos gegenüber Verbrennern schneller amortisieren. luk
Beim Treffen der 27 EU-Landwirtschaftsminister haben die Neuen Genomischen Techniken (NGT) ganz oben auf der Agenda gestanden. Das sagte der spanische Minister Luis Planas im Anschluss an das zweitägige informelle Treffen in Córdoba. Planas betonte, dass die spanische Präsidentschaft beabsichtige, bis zum Ende des Jahres – also bis zum Ende der spanischen Präsidentschaft – eine Einigung im Rat über den von der Europäischen Kommission am 5. Juli vorgelegten Vorschlag zu erzielen. Die spanische Ratspräsidentschaft hat die NGT zu einer ihrer Prioritäten gemacht und will die Zahl der “innovativen” NGT-Projekte bis 2027 durch den Einsatz von Mitteln aus der GAP und dem EU-Forschungsprogramm Horizon verdreifachen.
Für Madrid “sind die NGT wichtig, weil sie es ermöglichen, präzise Veränderungen in den Pflanzen vorzunehmen, die zu effizienten Pflanzen führen, die an die bestehenden Klimaszenarien angepasst sind”, sagte Planas. Dies trage dazu bei, die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems durch verbesserte Pflanzensorten zu erhöhen, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit, hohe Temperaturen und andere Extremsituationen sind oder weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel benötigen.
Ein weiteres heißes Thema auf der Tagesordnung der 27: die Verlängerung des Einfuhrverbots für vier ukrainische Produkte (Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne). Dieses Verbot soll offiziell am 15. September auslaufen. Die Ukraine hat der EU mit einer Klage vor der WTO gedroht, sollte sie das Verbot verlängern.
Das Thema solle auch am heutigen Mittwoch im Kollegium der Kommissare diskutiert werden, sagte der polnische Agrarkommissar Janusz Wojciechowski nach dem informellen Treffen. Am 31. August hatte Wojciechowski bei einer Anhörung im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, die vorübergehende Beschränkung für die vier Produkte aus der Ukraine für fünf osteuropäische Staaten (Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei) bis mindestens Ende des Jahres zu verlängern.
Außerdem forderte er die Bereitstellung von 600 Millionen Euro, um die Ausfuhr von ukrainischem Getreide in Drittländer zu erleichtern. Bisher ist die Position des Kommissars jedoch nur für ihn selbst bindend, da die Kommission keinen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. cst
Die Kommission will die EU-Regelung für gemeinsame Gaseinkäufe verstetigen. Das geht aus einem Dokument hervor, das Reuters einsehen konnte. Bei den ersten Ausschreibungen zum gemeinsamen Gaseinkauf hatte die Nachfrage die Erwartungen deutlich übertroffen.
Inzwischen sind zwar die Erdgasspeicher der EU wieder zu über 90 Prozent ihrer Kapazität aufgefüllt. In der Kommission gibt es aber weiter Sorgen vor unerwarteten Ereignissen. Das befristete Programm sollte eigentlich im Dezember auslaufen.
Nach dem Kommissionsvorschlag, der Reuters vorliegt, hätten die EU-Unternehmen dauerhaft die Möglichkeit, Brennstoff gemeinsam zu kaufen. Das Instrument soll im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung der EU-Gasmarktvorschriften dauerhaft eingeführt werden. Die Teilnahme wäre freiwillig, aber wenn es in der EU zu einer Versorgungskrise käme, wäre der gemeinsame Einkauf obligatorisch, um zu vermeiden, dass die EU-Länder um die gleichen knappen Mengen konkurrieren. “Es ist etabliert, es funktioniert, die Zahl der Unternehmen steigt”, sagte ein hoher EU-Beamter über den gemeinsamen Gaseinkauf.
Trotz der anfänglichen Skepsis seitens der Industrie, hat die EU bisher eine Nachfrage von mehr als 27 Milliarden Kubikmetern Gas verzeichnet – das Doppelte der Menge, die Brüssel veranschlagt hatte. Es ist jedoch nicht klar, wie viel von dieser Nachfrage in feste Verträge umgesetzt wurde. Die EU bringt Gaskäufer und -verkäufer zusammen, ist aber nicht an den anschließenden Handelsverhandlungen beteiligt. Der neue EU-Vorschlag sieht vor, dass die Unternehmen melden müssen, wenn sie im Rahmen des Systems Verträge unterzeichnen.
Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments werden den Vorschlag noch in diesem Monat erörtern. Sie wollen das Gesetz bis zum Ende des Jahres fertigstellen.
Strittig ist bei den Ländern noch, wie eine “Versorgungskrise” definiert werden soll, die einen verpflichtenden gemeinsamen Ankauf auslösen würde und ob der gemeinsame Ankauf auf andere Energierohstoffe wie Wasserstoff ausgedehnt werden soll, sagte der hochrangige EU-Beamte. Der Vorschlag sieht vor, das System auszuweiten, um die geplante Europäische Wasserstoffbank zu unterstützen, die im November an den Start gehen soll.
Die gemeinsamen Käufe machen nur einen Bruchteil des gesamten Gasbedarfs der EU von rund 360 Milliarden Kubikmetern aus, sollen aber den Ländern helfen, sich auf den Winter vorzubereiten, wenn der Gasbedarf für Heizzwecke in Europa seinen Höhepunkt erreicht.
Die EU hatte den gemeinsamen Gaseinkauf in diesem Jahr ins Leben gerufen, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Europa im Jahr 2022 gekürzt hatte und die europäischen Energiepreise als Reaktion darauf auf ein Rekordhoch gestiegen waren. rtr/lei
Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat eine Amnestie für alle Separatisten als Vorbedingung für Gespräche für eine Unterstützung bei der spanischen Regierungsbildung genannt. Er forderte zudem “Respekt für die demokratische Legitimität des Separatismus”. Seine Partei sei zu Verhandlungen über einen “historischen Kompromiss” bereit, bei dem alle Aspekte des Konflikts benannt und Garantien für Vereinbarungen gegeben werden müssten, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Brüssel. Nach der Parlamentswahl im Juli ist eine Bildung einer neuen Regierung in Spanien schwierig, Puigdemont gilt als Königsmacher.
Er wolle noch nicht die endgültigen Ziele der Verhandlungen über eine Regierungsbildung nennen, fügte Puigdemont hinzu. Ein neues Referendum über die Abspaltung Kataloniens von Spanien sprach Puigdemont zwar indirekt an, machte es aber nicht ausdrücklich zu einer Bedingung für Gespräche über die Regierungsbildung. Bei dem für illegal erklärten Referendum vom 1. Oktober 2017 hatte eine Mehrheit für die Unabhängigkeit gestimmt. Bald darauf war Puigdemont ins Ausland geflohen. Andere Separatistenführer waren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, sind nach einer Begnadigung aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Am Vortag hatte Arbeitsministerin Yolanda Díaz bereits mit Puigdemont in Brüssel gesprochen. Beide vereinbarten, man wolle “alle demokratischen Lösungen erkunden, um den politischen Konflikt (in Katalonien) zu entschärfen“, wie es im Kommuniqué hieß. Für Sánchez wäre vor allem eine Forderung Puigdemonts nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum nur schwer zu erfüllen, weil dies ihn im Rest des Landes viele Stimmen kosten könnte. dpa

Mit gut 24 Prozent am Endverbrauch hat die EU heute einen fast doppelt so hohen Anteil bei den Erneuerbaren Energien wie der weltweite Durchschnitt. Doch zuletzt ging es kaum noch voran, siehe Windkraft: Der weltweite Ausbau lag 2022 im Vergleich zu 2021 bei 17 Prozent, in der EU aber nur bei neun Prozent. Warum wird Europa langsamer?
Mit lange garantierten Einspeisevergütungen, auch für technisch überholte Solaranlagen, fehlt Innovationsdruck. Durch strenge Artenschutzvorgaben können kleine Haselmäuse große Windparks verhindern, beziehungsweise ewig lange Genehmigungsverfahren verursachen. Und wenn mancherorts viel Grünstrom produziert wird, wachsen Infrastruktur und Netze nicht mit, auch weil die Politik immer mehr Klageoptionen einräumt.
Spätestens mit dem Ukrainekrieg und den Verwerfungen der Energiemärkte hat sich die Lage zumindest in Brüssel verändert. Fast möchte man mit Blick auf mehr Energiesouveränität meinen, dass ein Ruck durch die EU-Institutionen gegangen ist. Am 13. September stimmt das EU-Parlament über die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie ab. Nennen wir es nicht Booster, aber dieses Gesetz ist ein Beleg dafür, dass Brüssel auch pragmatisch unbürokratisch sein kann.
Nicht nur, dass die Richtlinie das EU-Ausbauziel 2030 für den Energie-Endverbrauch von 30 auf 45 Prozent aus erneuerbaren Energien drastisch erhöht, nein, aus Brüssel kommt dieses Mal eben nicht nur “höher, schneller, weiter”, sondern auch, wie das günstiger und regulierungsärmer gelingen kann. Erstens wird der Ausbau der Erneuerbaren als überragendes öffentliches Interesse eingestuft. Dieser Status ist Garant für schnellere Genehmigungsverfahren, die für alle Anlagen und ihre Infrastrukturen gelten. Zudem können “Beschleunigungsgebiete” festgelegt werden, in denen es Ausnahmen von den Artenschutzvorgaben geben kann. Die einzelne Haselmaus muss dem Windpark oder der Biogasanlage weichen, wenn der Bestand der Haselmäuse europaweit gesichert ist. Mit dem wunderbaren Begriff “positive Stille” wird sichergestellt, dass Bauanträge automatisch als genehmigt gelten, wenn nach zwölf Monaten die Rückmeldung fehlt – also doch ein Booster.
Zweitens ist das Gesetz technologieoffen. Im Fokus sind Wind und Solar, aber auch Wasserkraft, Geothermie oder Gezeitenströme. Umstritten war die Einstufung der “holzbasierten Biomasse” als erneuerbar. Weil Bäume eben nachwachsen, gab es eine Mehrheit dafür. Sogar die Ampel hat – nachdem klar war, dass der schwarze Peter nicht nach Brüssel gehen konnte -das deutsche Heizungsgesetz angepasst.
Der dritte Türöffner ist die Einsicht, dass Importe entscheidend sind. Wärmepumpe, Elektroautos sowie grüner Strom und Wasserstoff in der Industrie erfordern bis zur Klimaneutralität mindestens das Fünffache an Grünstrom. 50 bis 70 Prozent davon muss Europa importieren. Deshalb ist es wichtig, dass die EU Importziele und entsprechende Strategien für die nationalen Energie- und Klimapläne vorschreibt.
Schließlich ist die Richtlinie ein Beschleuniger für Innovationen. Die Mitgliedsstaaten sind angehalten, fünf Prozent ihrer jährlichen Ausbauquoten über den Stand der Technik hinaus zu planen. Ausschreibungen und Marktprämien für Wind, Sonne und Biomasse, Pilotprojekte für schwimmenden Solarzellen, Winddrachen, Flusskraftwerke, Algenhäuser, Solarstraßen oder Wasserkraftwerke mit Energie von Meereswellen. Nichts ist unmöglich und fast alles hat Zukunft. Jede einschlägige Technologie hat ein Recht, erforscht zu werden. Viel zu lange verharrte etwa Deutschland in alten Denkmustern von Einspeisevergütungen, vernachlässigte Speichertechnologie, und verlieh veralteter Technik wirtschaftlichen Glanz.
Damit bietet die EU einen optimalen Rahmen für marktwirtschaftliche Lösungen zum Ausbau der Erneuerbaren. Flankieren muss Brüssel durch noch mehr Pragmatismus, weniger Bürokratie bei grenzüberschreitenden Netzprojekten und beihilferechtlichen Ausnahmen für Investitionen in die Wertschöpfungskette, ohne nerv- und projekttötende Notifizierungsverfahren. Wir brauchen zudem ein EU-Strommarktdesign, das Erneuerbare auch als Kapazitätsreserven attraktiv macht und dezentralen Speicherlösungen Raum gibt.
Alles entscheidend sind die Mitgliedsstaaten. Sie müssen die Bälle aus Brüssel unbürokratisch aufgreifen. Die schnelle Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ist ebenso entscheidend wie Lust auf technologieoffene Innovationen. Für eine steigende volatile Stromerzeugung braucht es mehr Netze, die intelligent zwischenspeichern, Spitzenlasten abfedern und über große Entfernungen liefern können. Es braucht die Erkenntnis, dass das meiste, aber eben nicht alles nur elektrisch geht. Wasserstoff muss die Zukunft bekommen, den er für die Energiewende verdient. Berlin muss das Pariser CO₂-Ziel in den Vordergrund stellen und die Vielfalt der Regenbogenfarben auch beim Wasserstoff akzeptieren.
Brüssel überlässt den Ländern, ob und zu welchen Anteilen Gas- und Wasserstoff gemischt in die Netze gelangen. Deutschland muss deshalb seinen einzigartigen Standortvorteil des weitverzweigten und speicherfähigen Gasnetzes ausspielen. Statt der Ampelpläne für ein Rückbaugebot der Gasnetze braucht es ein Rückbauverbot. Die Wahl, ob Elektrifizierung, Einsatz von Wasserstoff, Biogas oder Biomasse, muss jedem Unternehmen und Haushalt offenstehen. Mit den erwartbaren Fortschritten bei Ausbau und Import ist das mehr als Wunschdenken. Nur wenn Deutschland die neuen EU-Vorgaben aufgreift, kommen wir bei den Erneuerbaren Energien wieder auf die Überholspur. Und zwar zu vertretbaren Kosten.
