seit Tagen wurde darüber spekuliert, am Sonntag geschah es: Joe Biden zieht sich aus dem US-Präsidentschaftsrennen zurück. Das sei im besten Interesse seiner Partei und des Landes, schrieb der 81 Jahre alte Demokrat in einem Brief, der in sozialen Medien veröffentlicht wurde. Er sprach sich dafür aus, Vize-Präsidentin Kamala Harris zur Kandidatin der Demokraten zu ernennen.
Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist der angekündigte Rückzug Bidens einerseits bitter: Sie hat ein exzellentes Verhältnis zum US-Präsidenten, der von der Leyen am Samstag noch telefonisch zur zweiten Amtszeit gratuliert hatte. Polens Ministerpräsident Donald Tusk und sein tschechischer Kollege Petr Fiala würdigten Biden für dessen Verdienste.
Allerdings war auch den Verantwortlichen in Brüssel klar, dass ein schwächelnder Biden im Wahlkampf wenig Erfolgschancen hätte gegen Donald Trump. Eine neue, jüngere Kandidatin könnte den Zusammenhalt der Demokraten stärken. Als wahrscheinlich gilt, dass die Partei Kamala Harris, 59, bei ihrer National Convention im August ernennt. Als mögliche Alternativen gehandelt wurden zuvor noch Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, oder ihr Kollege aus Pennsylvania, Josh Shapiro.
Dem neuen Kandidaten bleiben allerdings nur noch wenige Monate bis zur Wahl im November, um für sich zu werben. Kamala Harris war zuletzt bereits viel durch das Land gereist und hatte sich in Wahlkampfveranstaltungen auch schon auf den republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance eingeschossen. Praktischer Nebeneffekt einer Harris-Kandidatur: Die bisher für Biden gesammelten Spenden können einfacher auf Harris übertragen werden, da sie als Vizepräsidentin qua Amt die Nachfolgerin des Präsidenten ist.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

EU-Kommission und Mercosur-Staaten nehmen einen neuen Anlauf, um die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen abzuschließen. Unterhändler der EU und der beteiligten südamerikanischen Staaten werden sich vom 4. bis 6. September in Brasilia treffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf EU-Diplomaten. Es sind die ersten persönlichen Gespräche seit April. Diplomaten geben sich optimistisch, dass das Freihandelsabkommen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könnte.
Selbst wenn sich die Unterhändler bald auf einen Text einigen sollten: Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das Mercosur-Abkommen bald in Kraft treten wird. Der gewichtigste Grund ist Frankreich. Emmanuel Macron und seine Liberalen zeigten sich in den vergangenen Jahren bereits sehr skeptisch gegenüber dem Mercosur-Abkommen. Nun, da in den französischen Parlamentswahlen die linken und rechten Pole dazugewannen, die noch sehr viel freihandelskritischer sind, scheint die Zustimmung Frankreichs praktisch unmöglich. “Eine klare Mehrheit der Nationalversammlung ist gegen Freihandelsverträge, zumindest gegen solche, wie wir sie bisher kennen”, sagt der französische Wirtschaftsexperte Neil Makaroff, der den Think-Tank Strategic Perspectives leitet.
Die politische Situation in Paris wird in der deutschen Bundesregierung mit Sorge betrachtet. In Berlin macht man sich Gedanken, wie mit der absehbaren Blockade umzugehen ist. Wenn in diesem Jahr keine Einigung gelinge, sei das seit mehr 20 Jahren verhandelte Abkommen verloren, heißt es warnend in in der deutschen Hauptstadt. Dann würden die lateinamerikanischen Partner um Brasiliens Präsident Lula da Silva abspringen.
Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck drängen daher die EU-Kommission, die Gespräche mit dem Mercosur voranzutreiben. “Wir haben die Zuständigkeit für die Handelspolitik nicht an Europa gegeben, damit keine Abkommen mehr abgeschlossen werden”, sagte Scholz kürzlich bei einer Veranstaltung des BDI, “sondern damit mehr Abkommen zustande kommen”.
In Berlin wird nicht ausgeschlossen, das ausverhandelte Mercosur-Abkommen dann mit qualifizierter Mehrheit im Rat zu beschließen. Notfalls auch ohne die Zustimmung der kritischen Staaten, neben Frankreich auch die Niederlande und Österreich. Der exportorientierte Verband der Maschinenindustrie VDMA drängt, die Kommission müsse “endlich den Mut haben, die Freihandelsabkommen voranzutreiben” – notfalls auch gegen den Willen Frankreichs.
Ein solches Votum bei einem politisch aufgeladenen Thema wie dem Mercosur-Abkommen hätte aber Sprengkraft und wäre wohl Wasser auf die Mühlen der EU-Kritiker in den überstimmten Ländern. Die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini warnt: “Man kann den zweitgrößten Mitgliedstaat nicht einfach ignorieren”. Cavazzini sorgt sich, dass Deutschland und Frankreich aneinander vorbeireden: “Es sind zwei verschiedene wirtschaftspolitische Welten”, sagte sie Table.Briefings
Für die Zukunft sind sich viele handelspolitische Akteure einig, dass neue Abkommen schlanker ausgestaltet werden sollen. Scholz will sie so anlegen, dass sie nur von Rat und Europaparlament abgesegnet werden müssen. Solche “EU-only”-Abkommen könnten “jahrelange Verzögerungen durch die Ratifizierungsprozesse in den Mitgliedstaaten verhindern”, sagte er. Wirtschaftsminister Robert Habeck argumentiert ähnlich: Ihm sei “ein 80 Prozent gutes Handelsabkommen, das schnell geschlossen wird, [lieber], als ein 100- oder 120-prozentig perfektes Freihandelsabkommen, das nie geschlossen wird”.
Aber wie sollen Freihandelsabkommen verschlankt werden? Der VDMA argumentiert, man solle sich auf den reinen Handelsteil der Abkommen konzentrieren und die “Freihandelsabkommen nicht mit politischen Zielen aus anderen Politikbereichen überfrachten“. Gerade gewisse Nachhaltigkeitskriterien werden von Handelspartnern oft als einschränkend und souveränitätsverletzend empfunden.
Cavazzini sieht das anders: Angesichts der voranschreitenden Klimakrise könne man die Nachhaltigkeitskriterien nicht über Bord werfen. Zudem gehe es bei den Nachhaltigkeitskriterien auch um Arbeitsplätze in Europa, die nicht durch umweltschädliche und arbeiterfeindliche Praktiken in Drittstaaten gefährdet werden sollten. Sie findet, man solle die französische Forderung nach Spiegelklauseln ernst nehmen.
Die Grüne wirbt stattdessen für Freihandelsverträge, die nicht mehr zwingend alle Sektoren beinhalten. Vielmehr sollten sie sich auf die wesentlichen Sektoren fokussieren, bei denen die EU und Drittstaaten gemeinsame Interessen haben, zum Beispiel strategisch wichtige Rohstoffe.
Makaroff sieht das ähnlich. Das Ziel könne nicht mehr sein, einfach nur Handelsströme zu verstärken. Es brauche ausgewogene Partnerschaften, in denen bestimmte Sektoren gezielt gefördert werden. Im Gegenzug zur Marktöffnung und zur Akzeptanz europäischer Standards solle die EU Drittstaaten mit Investitionen unterstützen, sagt Makaroff zu Table.Briefings.
Investitionen sind Hauptanliegen vieler Drittstaaten. Sie wollen nicht nur teure europäische Maschinen einkaufen und im Gegenzug günstige Rohstoffe nach Europa schiffen, sondern suchen nach Kapital, um ihre eigene Industrie zu entwickeln. Die politischen Leitlinien, die Ursula von der Leyen vor ihrer kürzlichen Wiederwahl präsentierte, deuten auf eine Weiterentwicklung der EU-Handelspolitik in diese Richtung hin: Statt große neue Freihandelsabkommen zu versprechen, wirbt von der Leyen für “Clean Trade and Investment Partnerships”.
Mit dieser Entwicklung würde sich die EU auch einen weiteren kleinen Schritt von WTO-Prinzipien entfernen, die von den USA und China ohnehin nicht mehr eingehalten werden. Denn unter WTO-Recht sind bilaterale und regionale Handelsabkommen streng genommen nur dann zulässig, wenn “virtually all trade” – also fast alle Wirtschaftssektoren – liberalisiert werden. “Der WTO-Rahmen ist halt etwas aus der Zeit gefallen“, kommentiert Makaroff die Abweichung.
Kurz nachdem der Rohstoffkonzern Rio Tinto die Abbaulizenz für das serbische Jadar-Lithiumprojekt zurückerhalten hat, haben Deutschland und die EU-Kommission eine Partnerschaft mit Serbien vereinbart. Bundeskanzler Olaf Scholz und der Vizepräsident der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, reisten deshalb am Freitag nach Belgrad und trafen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić.
Nach einem bilateralen Gespräch zwischen Scholz und Vučić fand ein “Critical Raw Materials Summit” mit Vertretern der Industrie und der Finanzbranche statt. Serbien und die EU-Kommission unterzeichneten dabei eine Kooperationsvereinbarung für eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen.
Mit dem Ziel, sich strategische Rohstoffe für die Energiewende zu sichern und einseitige Abhängigkeiten von Ländern wie China zu reduzieren, schließt die EU zurzeit zahlreiche Rohstoffpartnerschaften ab – zuletzt mit Usbekistan und Australien. Das im Critical Raw Materials Act beschlossene Ziel lautet, bis 2030 nicht mehr als 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs aus einem einzigen Land zu beziehen. Serbien machen seine Lithiumvorkommen zum attraktiven Partner: Der multinationale Rohstoffkonzern Rio Tinto will im westserbischen Jadar-Tal bis zu 58.000 Tonnen Lithium pro Jahr fördern. 1,1 Millionen Elektroautos sollen sich damit bauen lassen.
Das Jadar-Projekt sei “gut für Serbien”, weil es wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Region und das Land mit sich bringe, sagte Scholz bei einer anschließenden Pressekonferenz. Die Partner würden zwei Prinzipien hochhalten. “Es geht darum, dass der Bergbau mit den höchsten heute möglichen Standards stattfindet, was Umweltschutz und Biodiversität betrifft”, erklärte er. “Wir werden das unterstützen und unseren Beitrag dazu leisten, dass es tatsächlich so kommen wird.” Gleichzeitig schaffe das Projekt Arbeitsplätze, Wohlstand und Wertschöpfung in Serbien.
In der deutschen Wirtschaft stieß die Kanzlerreise auf positive Resonanz: “Der Abschluss eines Rohstoff-Abkommens zwischen der EU und Serbien wäre sehr wichtig für die Diversifizierung der deutschen und europäischen Industrie”, sagte Matthias Wachter, BDI-Abteilungsleiter für Rohstoffe und Internationale Zusammenarbeit, im Vorfeld der Nachrichtenagentur Reuters. Es wäre auch ein wichtiger Schritt für die Heranführung Serbiens an die EU. Seit 2012 hat Serbien den Status eines Beitrittskandidaten.
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, sagte dem Handelsblatt, das Abkommen mit Serbien sei “ein wichtiges und richtiges Signal”. Um die Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sei die Versorgung mit Rohstoffen essenziell. Besonders die Automobilindustrie ist aufgrund der Umstellung auf Elektroautos auf Lithium für Batterien angewiesen. Die europäischen Hersteller Mercedes und Stellantis sind bereits in Gesprächen mit Präsident Vučić über Investitionen in die Lithiumverarbeitung und die Produktion von Elektroautobatterien, bestätigten beide Seiten in Medienberichten.
Doch auch an diesem Beispiel werden die Zielkonflikte der Rohstoffgewinnung deutlich: Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur – auch, wenn er der Energiewende und damit dem Klimaschutz dient. Viele Bürgerinnen in Serbien befürchten immense Umweltschäden, da beim Abbau von Lithium zum Beispiel Schwermetalle ins Grundwasser gelangen können.
Nach massiven Protesten gegen die Lithiummine hatte die serbische Regierung 2022 beschlossen, das Projekt auf Eis zu legen und Rio Tinto die Abbaulizenz zu entziehen. Vergangene Woche erklärte das serbische Verfassungsgericht diese Entscheidung jedoch für ungültig. Damit ist der Weg für den Lithiumabbau wieder frei, Rio Tinto erhielt die Lizenz zurück.
Die Rohstoffpartnerschaft zwischen Serbien und der EU solle den politischen und wirtschaftlichen Lobbys helfen, das Jadar-Projekt wiederzubeleben, kritisiert die serbische NGO Kreni-Promeni. In einem öffentlichen Brief forderte diese im Vorfeld der Reise Scholz und Šefčovič sowie die gerade wiedergewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, Bürgerrechte zu respektieren und die Perspektive der serbischen Bevölkerung einzubeziehen. Sie schlagen den Politikern auch ein Treffen vor, um ihnen zu erläutern, warum “die große Mehrheit der serbischen Bürger den Jadar-Vorschlag ablehnt”.
Die NGO ruft zudem die Chefinnen der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calviño, und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Odile Renaud-Basso, dazu auf, das Lithiumprojekt nicht mitzufinanzieren.
Dabei spielen nicht nur die Gefahren für die Umwelt eine Rolle: Kreni-Premeni kritisiert in dem Brief auch die deutsche Bundesregierung für ihre Bereitschaft, im Gegenzug für die Rohstoffkooperation “tiefgreifende rote Linien” wie Einschränkungen der Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu ignorieren.
Vučić steht in der Kritik, Serbien zunehmend autoritär zu regieren. Die vergangenen Parlamentswahlen im Dezember waren von erheblichen Protesten begleitet, die Opposition wirft ihm unfaire Wahlbedingungen aufgrund von Betrug und Bestechung vor. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steigt Serbien seit Jahren immer weiter ab; in diesem Jahr bis auf Platz 98.
Vučićs Nähe zu den Regimen in China und Russland scheint der geopolitische Grund für die EU zu sein, schnellstmöglich ein Rohstoffabkommen zu vereinbaren. Mit Erfolg: Auch China und Russland umwerben Serbien wegen des Lithiums. Dies bestätigte Vučić in einem Interview mit dem Handelsblatt – und versicherte: “Wir haben ihnen aber mitgeteilt, dass wir dieses Thema mit den Europäern diskutieren. Wir sind loyal zu Europa.”
Digitalindustrie und Wissenschaft begrüßen, dass sich die Kommission im neuen Mandat auf die Um- und Durchsetzung der neu geschaffenen Digitalgesetze konzentrieren will. So hatte es die neue gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihren politischen Leitlinien formuliert.
Die EU-Kommission habe unter ihrer Führung eine riesige Regulierungswelle erzeugt, kommentiert der Bitkom. Mit dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) habe das Internet praktisch ein neues Grundgesetz in der EU bekommen. Und mit dem AI Act einen Regulierungsrahmen für Künstliche Intelligenz. “Nachdem sich die EU in den vergangenen fünf Jahren schwerpunktmäßig mit den tatsächlichen und vermeintlichen Risiken der Digitalisierung beschäftigt hat, muss sie in den kommenden fünf Jahren die Chancen der Digitalisierung in den Fokus rücken”, findet der Bitkom.
So ähnlich sieht das auch Cara Schwarz-Schilling. Die Geschäftsführerin des WIK (Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste) nennt DSA, DMA, den Data und den AI Act “riesige experimentelle Projekte”. Es sei entscheidend, “dass jetzt Energie in die erfolgreiche Umsetzung gesteckt wird, bevor neue Initiativen gestartet werden”. Die Macht großer Technologieunternehmen zu kontrollieren, sei angesichts ihrer Netzwerkeffekte erforderlich. Aber ob dies mithilfe des DMA wirklich gelingen werde, sei noch nicht ausgemacht.
Nach Auffassung der Digitalwirtschaft sollte das Ziel sein, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der europäischen Digitalwirtschaft zu verbessern. “Wir brauchen einen Boost für unsere digitale Souveränität und für unsere digitale Resilienz”, fordert der Bitkom. Cara Schwarz-Schilling hat allerdings Bedenken, dass der von der Kommission geplante neue Ansatz in der Wettbewerbspolitik in die richtige Richtung geht.
Sie betrachtet den Versuch, europäische Champions im Telekommunikationsbereich zu formen, als riskant und potenziell kontraproduktiv. Daher sei es keine schlechte Nachricht, dass das Weißbuch zur Zukunft der Konnektivität, zu dem die Kommission gerade eine Konsultation beendet hat, keine Erwähnung in den Guidelines findet. Denn was Kommissar Thierry Breton zur Erleichterung der Fusionskontrolle vorschlägt, hält sie für problematisch. “Wettbewerbs- und Industriepolitik sollten nicht ausschließlich auf den Wettbewerb mit amerikanischen Unternehmen ausgerichtet sein.”
Die Schaffung großer europäischer Unternehmen durch staatliche Eingriffe führe zu künstlichen Marktverzerrungen. “Wettbewerb ist der beste Motor für Innovation. Und der Versuch, Unternehmen künstlich zu stärken, garantiert nicht, dass diese ihre Gewinne in innovative Aktivitäten investieren, die Europa voranbringen”, mahnt sie. Vergangene Versuche, große Unternehmen durch Industriepolitik zu schaffen, seien meist nicht erfolgreich gewesen. Bei Airbus sei das gelungen, das sei jedoch eine Ausnahme.
“Bereits etablierte Unternehmen haben oft Chancen verpasst, sich in neuen Technologiebereichen zu positionieren, wie zum Beispiel im Bereich der Cloud-Dienste”, kritisiert Schwarz-Schilling. “Die Erleichterung der Fusionskontrolle könnte den Wettbewerb weiter einschränken, anstatt ihn zu fördern. Diese Strategie könnte zu einer Konzentration der Marktmacht führen, die wiederum Innovationen behindert.” Um das innovative Potenzial Europas besser zu nutzen sei der in den Leitlinien vorgesehene Weg, Rechtsvorschriften für KMU zu vereinfachen, kleine innovative Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen und “die Kosten des Scheiterns zu senken” sicher der erfolgversprechendere Weg, meint Schwarz-Schilling.
Dass das Weißbuch, das der Vorbereitung eines künftigen Digital Networks Acts (DNA) dient, nicht explizit Erwähnung findet, bedeutet nicht, dass die Kommission dazu 2025 nicht doch einen Vorschlag machen wird. Der Schwerpunkt der Leitlinien liegt jedoch auf Künstlicher Intelligenz und Daten. Das begrüßt Schwarz-Schilling. Der Zugang zu Daten sei für viele Unternehmen eine große Herausforderung. “Unternehmen zögern, ihre Daten zu teilen, und es gibt erhebliche Schwierigkeiten bei der Strukturierung von Daten, sodass sie für andere nutzbar sind”, sagt Schwarz-Schilling. “Es müssen Standards entwickelt werden, um diese Herausforderungen zu bewältigen.”
Positiv bewertete Schwarz-Schilling auch den Vorschlag, einen Europäischen KI-Forschungsrat einzurichten. “Denn in diesem Bereich ist es wegen der Skaleneffekte in der Tat sinnvoll, Ressourcen zu bündeln, ähnlich wie beim CERN.” Zudem betont die Forscherin: “Es ist wichtig, dass auch kleinere KI-Player bezahlbaren Zugang zu Rechenkapazitäten erhalten.” Das wiederum will von der Leyen über die geplanten KI-Fabriken erreichen.
Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, übt deutliche Kritik an der aktuellen Tarifgestaltung für die Nutzung der Stromnetze. “Die Regionen, die modernisieren und Netze ausbauen, tragen bisher die Kosten”, sagte Messner zu Table.Briefings. “Und die, die das – insbesondere im Süden Deutschlands – nicht in dem nötigen Tempo angehen, sind fein raus.” Das sei klimapolitisch und aus Gerechtigkeitsperspektive wenig überzeugend.
Schon länger klagen die Ministerpräsidenten der deutschen Küstenländer, die kräftig in Windkraft und die dazu nötigen Netze investiert haben, über die aus ihrer Sicht zu hohen Netzentgelte, die wiederum zu höheren Strompreisen führen. Auch Messner hält das derzeitige Anreizsystem für falsch konstruiert: “Man müsste doch eigentlich die, die in die richtige Richtung gehen, entlasten und die, die nicht schnell genug sind, belasten.” Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall.
Nur bedingt zufrieden ist der UBA-Präsident mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Nach den jüngsten Zahlen ist der Ertrag aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2024 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch liegt inzwischen bei 57 Prozent. “Bei der Photovoltaik machen wir beachtliche Fortschritte”, sagte Messner, “da ist eine enorme Dynamik drin”. Nicht zuletzt, “weil die Menschen mit kleinen Balkonkraftwerken oder Anlagen auf dem Dach ‘Mitgestalter des Wandels’ sein” wollten. Zwar sei der Energiesektor der dynamischste bei der Emissionsreduzierung – doch es gebe auch Bereiche, in denen mehr Tempo nötig ist. “Wir kommen beim Ausbau der Windkraft nicht so schnell voran, wie wir uns vorgenommen haben”, so Messner.
Für falsch hält der UBA-Chef auch den von Bundesregierung und Parlament beschlossenen Wegfall der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Hier mehr Flexibilität zwischen den Sektoren zu schaffen, sei richtig. Aber die Vorstellung, Versäumnisse in einem Sektor könnten durch besondere Anstrengungen in anderen Sektoren per se ausgeglichen werden, sei irrig. “Wenn wir etwa im Mobilitätsbereich genauso weiter fahren bis 2035, muss die Kurve in Richtung 2045 so steil in Richtung Null abfallen, dass das physisch und ökonomisch nicht mehr möglich sein wird.” Horand Knaup
Wegen der Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gibt es Streit zwischen der FDP und CDU-Chef Friedrich Merz. Merz kritisierte am Freitag im Deutschlandfunk, dass die FDP-Europaabgeordneten nicht für die CDU-Politikerin von der Leyen gestimmt hatten. “Ich habe schon seit Monaten kaum noch Verständnis für die Haltung einer ganzen Reihe von FDP-Abgeordneten, sowohl im Europäischen Parlament als auch im Deutschen Bundestag”, sagte er.
Führende Vertreter der Freien Demokraten reagierten auf die Kritik: “Die Äußerungen des CDU-Chefs verwundern mich sehr”, erwiderte Fraktionschef Christian Dürr in der Bild am Sonntag. “Herr Merz bekennt sich damit klar zur grünen Agenda und stellt sich hinter von der Leyens Pläne für das Verbrenner-Aus, europäische Schulden und mehr Bürokratie aus Brüssel.” Für diese Politik stehe die FDP nicht zur Verfügung.
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai warf Merz vor, keine klare Strategie zu haben. “Er fordert Entlastung, solide Finanzen und Entbürokratisierung, biedert sich aber den Grünen an und unterstützt von der Leyens Politik der Stagnation und Schulden“. Das werde der CDU massiv schaden.
Merz sagte, wichtig sei, dass Ursula von der Leyen in der Mitte des EU-Parlaments eine stabile Mehrheit habe, mit der sie tun könne, was notwendig sei: “Weniger Regulierung, Abschaffung von überflüssiger Regulierung und Konzentration auf Verteidigung, Integration und vor allem Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Das geht auch ohne FDP.” dpa
Die EU plant Sonderzölle auf die Einfuhr von Biodiesel aus China. Die zusätzlichen Zölle sollen zwischen 12,8 Prozent und 36,4 Prozent des Warenwertes betragen, wie aus einem am Freitag veröffentlichten EU-Dokument hervorgeht. Gelten sollen die Zölle vorläufig ab Mitte August, die EU-Untersuchung wegen der Dumping-Preise ist bis Februar geplant. Dann könnten die Zölle endgültig für fünf Jahre festgelegt werden.
Europäische Hersteller hatten geklagt, dass Biodiesel in großem Umfang zu Dumping-Preisen in die EU eingeführt werde. 90 Prozent aller chinesischen Biodiesel-Ausfuhren gingen in die EU. Mehrere Firmen in Europa hatten daraufhin ihre Produktion gedrosselt oder eingestellt.
Und auch auf die Einfuhr von kalorienarmen Süßungsmitteln aus China hat die EU Antidumpingzölle eingeführt. Auf Waren des größten chinesischen Erythrit-Herstellers Sanyuan wird ab sofort ein Zusatzzollsatz in Höhe von 156,7 Prozent fällig. Für Exporte anderer Hersteller aus China gelten Sätze in Höhe von 31,9 bis zu 235,6 Prozent. Die Antidumpingzölle gelten erst einmal für die Dauer von sechs Monaten.
Beide Vorhaben reihen sich in das schärfere Vorgehen der EU gegen chinesischen Importe ein. Für erhebliche Debatten hatten die Zölle für E-Autos aus China gesorgt, die vorläufig seit Anfang Juli gelten. Im November könnten sie mit Billigung der Mitgliedsstaaten endgültig festgesetzt werden, wenn es bis dahin keine Einigung mit der chinesischen Seite gibt. rtr/flee
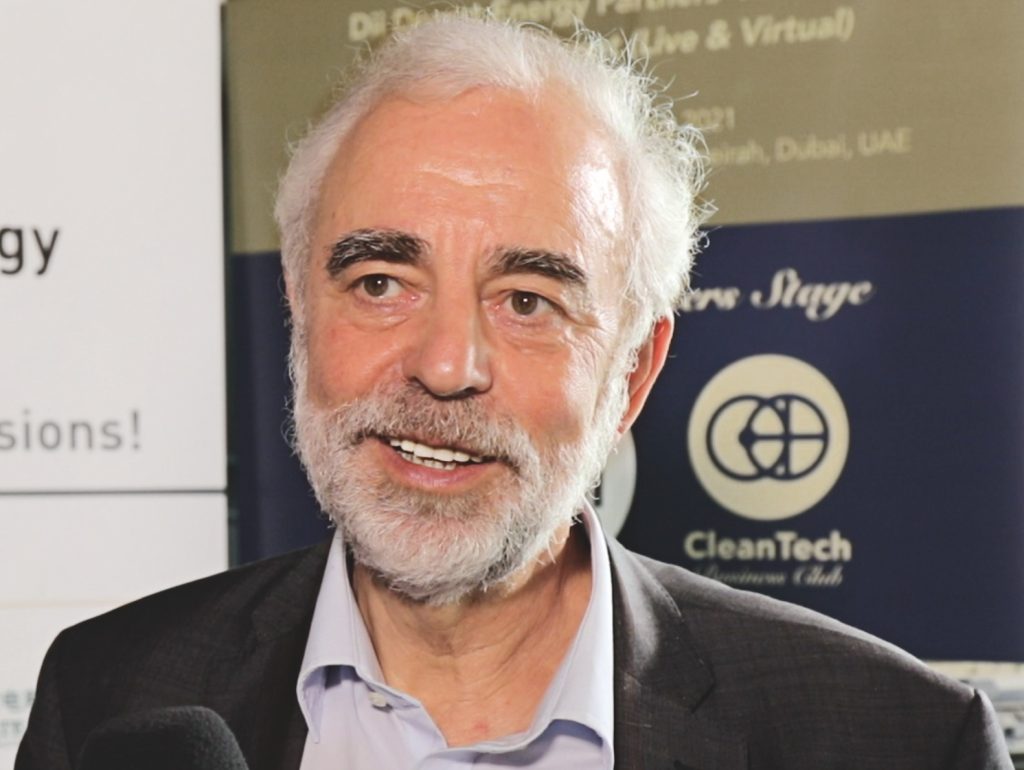
Es war eines der ambitioniertesten deutschen Industrieprojekte: Desertec sollte in großen Mengen Erneuerbare Energie in Nordafrika produzieren, die Stromnetze in Nordafrika miteinander verbinden und diese mit Europa. Desertec sollte bis zu 15 Prozent des Stroms in Europa produzieren. Dazu wären Investitionen gigantischen Ausmaßes von rund 400 Milliarden Euro notwendig gewesen. Doch das Projekt ist gescheitert.
Die gute Nachricht jedoch ist: Desertec lebt weiter. Und nicht nur das: Desertec ist heute größer als jemals zuvor. Paul van Son, der Niederländer, der die Desertec Industrial Initiative GmbH (DII) vorangetrieben hatte, ist dem Projekt treu geblieben. Allerdings hat sich Desertec grundlegend geändert. Unter neuem Namen ist Dii Desert Energy heute ein internationales Industrienetzwerk mit Sitz in Dubai.
Dort verfolgt van Son den Ursprungsgedanken von Desertec weiter, mit einem Unterschied: Dii ist heute mehr ein Thinktank, der Menschen, Länder und Märkte im Bereich saubere Energie miteinander verbinden will. Das Ziel ist immer noch: in den Wüsten emissionsfrei, verlässlich und kostengünstig Energie zu produzieren. Da sieht van Son Dii Desert Energy auf gutem Weg: “Die Länder der MENA-Region nutzen immer stärker ihr Potenzial für eine emissionsfreie Energieerzeugung”, sagt er.
Van Son hatte in Delft Engineering und Energiewirtschaft studiert und arbeitete dann für Siemens im Netzwerkbereich, anschließend für das Energieunternehmen Essent. Von 2009 an stand er der Desertec Industrial Initiative in München vor – bis diese fünf Jahre später auseinanderbrach, als viele Gesellschafter wie Siemens oder ABB ihr Engagement nicht verlängern wollten.
Doch RWE, das chinesische Unternehmen State Grid Corporation und Acwa Power aus Saudi-Arabien sind Dii Desert Energy auch nach Umbenennung und Umzug treu geblieben. Auch Thyssenkrupp ist bei dem Netzwerk in führender Rolle dabei. Zahlreiche Namen aus der deutschen Industrie sind dazugekommen oder haben sich der Initiative wieder angeschlossen: Eon, Bosch, Baywa, Siemens, Daimler Truck, Siemens Energy, Samson oder auch Roland Berger.
Vor allem ist Cornelius Matthes Paul van Son treu geblieben. Heute steht Matthes dem Netzwerk als CEO vor, van Son ist der Präsident. Matthes stand eine verheißungsvolle Karriere im Asset Management der Deutschen Bank in Aussicht. Doch die Chance, die Energiewende mitzugestalten, reizte ihn mehr als eine Karriere in der Bankenhierarchie. “Ohne grünen Wasserstoff aus den Wüstenländern würde die Energiewende hier nicht vorankommen”, meint denn auch Matthes.
Matthes ging den ganzen Weg mit allen Höhen und Tiefen an der Seite van Sons mit. So leitet er heute das Netzwerk in Dubai. Doch Paul van Son agiert in seiner Rolle als Präsident weiter – als Antreiber und als Visionär, der mit leiser Stimme, Freundlichkeit und Nachdruck immer wieder neue Ideen vorantreibt.
An diesem Wochenende, am 13. Juli, hat Dii Desert Energy sein fünfzehnjähriges Jubiläum gefeiert. “In unserer Gruppe wurden die ersten Diskussionen zum Projekt Neom Green Hydrogen geführt, das mit 8,4 Milliarden Dollar den Financial Close erreichte und nun gebaut wird”, sagte Matthes zu diesem Anlass. “Dabei wurden auch andere verrückte Ideen besprochen, von denen niemand gedacht hätte, dass sie jemals realisiert werden würden.”
Van Son und Matthes behaupten gar, dass Dii Desert Energy heute größer ist und größere Wirkung entfaltet hat, als es die Desertec Industrial Initiative jemals konnte. Matthes nennt nüchtern die Fakten: “Seit wir vor fünf Jahren die MENA Hydrogen Alliance ins Leben gerufen haben, hat die Industriegruppe und Denkfabrik Dii Desert Energy ein beeindruckendes Comeback erlebt: Von 20 Partnern im Jahr 2019 haben wir uns versechsfacht und sind nun auf mehr als 120 Partner aus 35 Ländern gewachsen.”
Allerdings legt Dii Desert Energy den Fokus neben Nordafrika stark auf den Nahen Osten. Und dennoch: Die alten Kooperationsländer von Desertec – Ägypten, Tunesien und Marokko – sind immer noch dabei. In wenigen Wochen wird van Son seinen 71. Geburtstag feiern. Doch in seiner Rolle als Präsident von Dii Desert Energy fühlt er sich offenbar weiterhin wohl. Es ist ein Leben für saubere Energie. Christian von Hiller
seit Tagen wurde darüber spekuliert, am Sonntag geschah es: Joe Biden zieht sich aus dem US-Präsidentschaftsrennen zurück. Das sei im besten Interesse seiner Partei und des Landes, schrieb der 81 Jahre alte Demokrat in einem Brief, der in sozialen Medien veröffentlicht wurde. Er sprach sich dafür aus, Vize-Präsidentin Kamala Harris zur Kandidatin der Demokraten zu ernennen.
Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist der angekündigte Rückzug Bidens einerseits bitter: Sie hat ein exzellentes Verhältnis zum US-Präsidenten, der von der Leyen am Samstag noch telefonisch zur zweiten Amtszeit gratuliert hatte. Polens Ministerpräsident Donald Tusk und sein tschechischer Kollege Petr Fiala würdigten Biden für dessen Verdienste.
Allerdings war auch den Verantwortlichen in Brüssel klar, dass ein schwächelnder Biden im Wahlkampf wenig Erfolgschancen hätte gegen Donald Trump. Eine neue, jüngere Kandidatin könnte den Zusammenhalt der Demokraten stärken. Als wahrscheinlich gilt, dass die Partei Kamala Harris, 59, bei ihrer National Convention im August ernennt. Als mögliche Alternativen gehandelt wurden zuvor noch Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, oder ihr Kollege aus Pennsylvania, Josh Shapiro.
Dem neuen Kandidaten bleiben allerdings nur noch wenige Monate bis zur Wahl im November, um für sich zu werben. Kamala Harris war zuletzt bereits viel durch das Land gereist und hatte sich in Wahlkampfveranstaltungen auch schon auf den republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance eingeschossen. Praktischer Nebeneffekt einer Harris-Kandidatur: Die bisher für Biden gesammelten Spenden können einfacher auf Harris übertragen werden, da sie als Vizepräsidentin qua Amt die Nachfolgerin des Präsidenten ist.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

EU-Kommission und Mercosur-Staaten nehmen einen neuen Anlauf, um die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen abzuschließen. Unterhändler der EU und der beteiligten südamerikanischen Staaten werden sich vom 4. bis 6. September in Brasilia treffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf EU-Diplomaten. Es sind die ersten persönlichen Gespräche seit April. Diplomaten geben sich optimistisch, dass das Freihandelsabkommen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könnte.
Selbst wenn sich die Unterhändler bald auf einen Text einigen sollten: Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das Mercosur-Abkommen bald in Kraft treten wird. Der gewichtigste Grund ist Frankreich. Emmanuel Macron und seine Liberalen zeigten sich in den vergangenen Jahren bereits sehr skeptisch gegenüber dem Mercosur-Abkommen. Nun, da in den französischen Parlamentswahlen die linken und rechten Pole dazugewannen, die noch sehr viel freihandelskritischer sind, scheint die Zustimmung Frankreichs praktisch unmöglich. “Eine klare Mehrheit der Nationalversammlung ist gegen Freihandelsverträge, zumindest gegen solche, wie wir sie bisher kennen”, sagt der französische Wirtschaftsexperte Neil Makaroff, der den Think-Tank Strategic Perspectives leitet.
Die politische Situation in Paris wird in der deutschen Bundesregierung mit Sorge betrachtet. In Berlin macht man sich Gedanken, wie mit der absehbaren Blockade umzugehen ist. Wenn in diesem Jahr keine Einigung gelinge, sei das seit mehr 20 Jahren verhandelte Abkommen verloren, heißt es warnend in in der deutschen Hauptstadt. Dann würden die lateinamerikanischen Partner um Brasiliens Präsident Lula da Silva abspringen.
Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck drängen daher die EU-Kommission, die Gespräche mit dem Mercosur voranzutreiben. “Wir haben die Zuständigkeit für die Handelspolitik nicht an Europa gegeben, damit keine Abkommen mehr abgeschlossen werden”, sagte Scholz kürzlich bei einer Veranstaltung des BDI, “sondern damit mehr Abkommen zustande kommen”.
In Berlin wird nicht ausgeschlossen, das ausverhandelte Mercosur-Abkommen dann mit qualifizierter Mehrheit im Rat zu beschließen. Notfalls auch ohne die Zustimmung der kritischen Staaten, neben Frankreich auch die Niederlande und Österreich. Der exportorientierte Verband der Maschinenindustrie VDMA drängt, die Kommission müsse “endlich den Mut haben, die Freihandelsabkommen voranzutreiben” – notfalls auch gegen den Willen Frankreichs.
Ein solches Votum bei einem politisch aufgeladenen Thema wie dem Mercosur-Abkommen hätte aber Sprengkraft und wäre wohl Wasser auf die Mühlen der EU-Kritiker in den überstimmten Ländern. Die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini warnt: “Man kann den zweitgrößten Mitgliedstaat nicht einfach ignorieren”. Cavazzini sorgt sich, dass Deutschland und Frankreich aneinander vorbeireden: “Es sind zwei verschiedene wirtschaftspolitische Welten”, sagte sie Table.Briefings
Für die Zukunft sind sich viele handelspolitische Akteure einig, dass neue Abkommen schlanker ausgestaltet werden sollen. Scholz will sie so anlegen, dass sie nur von Rat und Europaparlament abgesegnet werden müssen. Solche “EU-only”-Abkommen könnten “jahrelange Verzögerungen durch die Ratifizierungsprozesse in den Mitgliedstaaten verhindern”, sagte er. Wirtschaftsminister Robert Habeck argumentiert ähnlich: Ihm sei “ein 80 Prozent gutes Handelsabkommen, das schnell geschlossen wird, [lieber], als ein 100- oder 120-prozentig perfektes Freihandelsabkommen, das nie geschlossen wird”.
Aber wie sollen Freihandelsabkommen verschlankt werden? Der VDMA argumentiert, man solle sich auf den reinen Handelsteil der Abkommen konzentrieren und die “Freihandelsabkommen nicht mit politischen Zielen aus anderen Politikbereichen überfrachten“. Gerade gewisse Nachhaltigkeitskriterien werden von Handelspartnern oft als einschränkend und souveränitätsverletzend empfunden.
Cavazzini sieht das anders: Angesichts der voranschreitenden Klimakrise könne man die Nachhaltigkeitskriterien nicht über Bord werfen. Zudem gehe es bei den Nachhaltigkeitskriterien auch um Arbeitsplätze in Europa, die nicht durch umweltschädliche und arbeiterfeindliche Praktiken in Drittstaaten gefährdet werden sollten. Sie findet, man solle die französische Forderung nach Spiegelklauseln ernst nehmen.
Die Grüne wirbt stattdessen für Freihandelsverträge, die nicht mehr zwingend alle Sektoren beinhalten. Vielmehr sollten sie sich auf die wesentlichen Sektoren fokussieren, bei denen die EU und Drittstaaten gemeinsame Interessen haben, zum Beispiel strategisch wichtige Rohstoffe.
Makaroff sieht das ähnlich. Das Ziel könne nicht mehr sein, einfach nur Handelsströme zu verstärken. Es brauche ausgewogene Partnerschaften, in denen bestimmte Sektoren gezielt gefördert werden. Im Gegenzug zur Marktöffnung und zur Akzeptanz europäischer Standards solle die EU Drittstaaten mit Investitionen unterstützen, sagt Makaroff zu Table.Briefings.
Investitionen sind Hauptanliegen vieler Drittstaaten. Sie wollen nicht nur teure europäische Maschinen einkaufen und im Gegenzug günstige Rohstoffe nach Europa schiffen, sondern suchen nach Kapital, um ihre eigene Industrie zu entwickeln. Die politischen Leitlinien, die Ursula von der Leyen vor ihrer kürzlichen Wiederwahl präsentierte, deuten auf eine Weiterentwicklung der EU-Handelspolitik in diese Richtung hin: Statt große neue Freihandelsabkommen zu versprechen, wirbt von der Leyen für “Clean Trade and Investment Partnerships”.
Mit dieser Entwicklung würde sich die EU auch einen weiteren kleinen Schritt von WTO-Prinzipien entfernen, die von den USA und China ohnehin nicht mehr eingehalten werden. Denn unter WTO-Recht sind bilaterale und regionale Handelsabkommen streng genommen nur dann zulässig, wenn “virtually all trade” – also fast alle Wirtschaftssektoren – liberalisiert werden. “Der WTO-Rahmen ist halt etwas aus der Zeit gefallen“, kommentiert Makaroff die Abweichung.
Kurz nachdem der Rohstoffkonzern Rio Tinto die Abbaulizenz für das serbische Jadar-Lithiumprojekt zurückerhalten hat, haben Deutschland und die EU-Kommission eine Partnerschaft mit Serbien vereinbart. Bundeskanzler Olaf Scholz und der Vizepräsident der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, reisten deshalb am Freitag nach Belgrad und trafen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić.
Nach einem bilateralen Gespräch zwischen Scholz und Vučić fand ein “Critical Raw Materials Summit” mit Vertretern der Industrie und der Finanzbranche statt. Serbien und die EU-Kommission unterzeichneten dabei eine Kooperationsvereinbarung für eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen.
Mit dem Ziel, sich strategische Rohstoffe für die Energiewende zu sichern und einseitige Abhängigkeiten von Ländern wie China zu reduzieren, schließt die EU zurzeit zahlreiche Rohstoffpartnerschaften ab – zuletzt mit Usbekistan und Australien. Das im Critical Raw Materials Act beschlossene Ziel lautet, bis 2030 nicht mehr als 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs aus einem einzigen Land zu beziehen. Serbien machen seine Lithiumvorkommen zum attraktiven Partner: Der multinationale Rohstoffkonzern Rio Tinto will im westserbischen Jadar-Tal bis zu 58.000 Tonnen Lithium pro Jahr fördern. 1,1 Millionen Elektroautos sollen sich damit bauen lassen.
Das Jadar-Projekt sei “gut für Serbien”, weil es wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Region und das Land mit sich bringe, sagte Scholz bei einer anschließenden Pressekonferenz. Die Partner würden zwei Prinzipien hochhalten. “Es geht darum, dass der Bergbau mit den höchsten heute möglichen Standards stattfindet, was Umweltschutz und Biodiversität betrifft”, erklärte er. “Wir werden das unterstützen und unseren Beitrag dazu leisten, dass es tatsächlich so kommen wird.” Gleichzeitig schaffe das Projekt Arbeitsplätze, Wohlstand und Wertschöpfung in Serbien.
In der deutschen Wirtschaft stieß die Kanzlerreise auf positive Resonanz: “Der Abschluss eines Rohstoff-Abkommens zwischen der EU und Serbien wäre sehr wichtig für die Diversifizierung der deutschen und europäischen Industrie”, sagte Matthias Wachter, BDI-Abteilungsleiter für Rohstoffe und Internationale Zusammenarbeit, im Vorfeld der Nachrichtenagentur Reuters. Es wäre auch ein wichtiger Schritt für die Heranführung Serbiens an die EU. Seit 2012 hat Serbien den Status eines Beitrittskandidaten.
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, sagte dem Handelsblatt, das Abkommen mit Serbien sei “ein wichtiges und richtiges Signal”. Um die Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sei die Versorgung mit Rohstoffen essenziell. Besonders die Automobilindustrie ist aufgrund der Umstellung auf Elektroautos auf Lithium für Batterien angewiesen. Die europäischen Hersteller Mercedes und Stellantis sind bereits in Gesprächen mit Präsident Vučić über Investitionen in die Lithiumverarbeitung und die Produktion von Elektroautobatterien, bestätigten beide Seiten in Medienberichten.
Doch auch an diesem Beispiel werden die Zielkonflikte der Rohstoffgewinnung deutlich: Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur – auch, wenn er der Energiewende und damit dem Klimaschutz dient. Viele Bürgerinnen in Serbien befürchten immense Umweltschäden, da beim Abbau von Lithium zum Beispiel Schwermetalle ins Grundwasser gelangen können.
Nach massiven Protesten gegen die Lithiummine hatte die serbische Regierung 2022 beschlossen, das Projekt auf Eis zu legen und Rio Tinto die Abbaulizenz zu entziehen. Vergangene Woche erklärte das serbische Verfassungsgericht diese Entscheidung jedoch für ungültig. Damit ist der Weg für den Lithiumabbau wieder frei, Rio Tinto erhielt die Lizenz zurück.
Die Rohstoffpartnerschaft zwischen Serbien und der EU solle den politischen und wirtschaftlichen Lobbys helfen, das Jadar-Projekt wiederzubeleben, kritisiert die serbische NGO Kreni-Promeni. In einem öffentlichen Brief forderte diese im Vorfeld der Reise Scholz und Šefčovič sowie die gerade wiedergewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, Bürgerrechte zu respektieren und die Perspektive der serbischen Bevölkerung einzubeziehen. Sie schlagen den Politikern auch ein Treffen vor, um ihnen zu erläutern, warum “die große Mehrheit der serbischen Bürger den Jadar-Vorschlag ablehnt”.
Die NGO ruft zudem die Chefinnen der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calviño, und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Odile Renaud-Basso, dazu auf, das Lithiumprojekt nicht mitzufinanzieren.
Dabei spielen nicht nur die Gefahren für die Umwelt eine Rolle: Kreni-Premeni kritisiert in dem Brief auch die deutsche Bundesregierung für ihre Bereitschaft, im Gegenzug für die Rohstoffkooperation “tiefgreifende rote Linien” wie Einschränkungen der Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu ignorieren.
Vučić steht in der Kritik, Serbien zunehmend autoritär zu regieren. Die vergangenen Parlamentswahlen im Dezember waren von erheblichen Protesten begleitet, die Opposition wirft ihm unfaire Wahlbedingungen aufgrund von Betrug und Bestechung vor. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steigt Serbien seit Jahren immer weiter ab; in diesem Jahr bis auf Platz 98.
Vučićs Nähe zu den Regimen in China und Russland scheint der geopolitische Grund für die EU zu sein, schnellstmöglich ein Rohstoffabkommen zu vereinbaren. Mit Erfolg: Auch China und Russland umwerben Serbien wegen des Lithiums. Dies bestätigte Vučić in einem Interview mit dem Handelsblatt – und versicherte: “Wir haben ihnen aber mitgeteilt, dass wir dieses Thema mit den Europäern diskutieren. Wir sind loyal zu Europa.”
Digitalindustrie und Wissenschaft begrüßen, dass sich die Kommission im neuen Mandat auf die Um- und Durchsetzung der neu geschaffenen Digitalgesetze konzentrieren will. So hatte es die neue gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihren politischen Leitlinien formuliert.
Die EU-Kommission habe unter ihrer Führung eine riesige Regulierungswelle erzeugt, kommentiert der Bitkom. Mit dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) habe das Internet praktisch ein neues Grundgesetz in der EU bekommen. Und mit dem AI Act einen Regulierungsrahmen für Künstliche Intelligenz. “Nachdem sich die EU in den vergangenen fünf Jahren schwerpunktmäßig mit den tatsächlichen und vermeintlichen Risiken der Digitalisierung beschäftigt hat, muss sie in den kommenden fünf Jahren die Chancen der Digitalisierung in den Fokus rücken”, findet der Bitkom.
So ähnlich sieht das auch Cara Schwarz-Schilling. Die Geschäftsführerin des WIK (Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste) nennt DSA, DMA, den Data und den AI Act “riesige experimentelle Projekte”. Es sei entscheidend, “dass jetzt Energie in die erfolgreiche Umsetzung gesteckt wird, bevor neue Initiativen gestartet werden”. Die Macht großer Technologieunternehmen zu kontrollieren, sei angesichts ihrer Netzwerkeffekte erforderlich. Aber ob dies mithilfe des DMA wirklich gelingen werde, sei noch nicht ausgemacht.
Nach Auffassung der Digitalwirtschaft sollte das Ziel sein, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der europäischen Digitalwirtschaft zu verbessern. “Wir brauchen einen Boost für unsere digitale Souveränität und für unsere digitale Resilienz”, fordert der Bitkom. Cara Schwarz-Schilling hat allerdings Bedenken, dass der von der Kommission geplante neue Ansatz in der Wettbewerbspolitik in die richtige Richtung geht.
Sie betrachtet den Versuch, europäische Champions im Telekommunikationsbereich zu formen, als riskant und potenziell kontraproduktiv. Daher sei es keine schlechte Nachricht, dass das Weißbuch zur Zukunft der Konnektivität, zu dem die Kommission gerade eine Konsultation beendet hat, keine Erwähnung in den Guidelines findet. Denn was Kommissar Thierry Breton zur Erleichterung der Fusionskontrolle vorschlägt, hält sie für problematisch. “Wettbewerbs- und Industriepolitik sollten nicht ausschließlich auf den Wettbewerb mit amerikanischen Unternehmen ausgerichtet sein.”
Die Schaffung großer europäischer Unternehmen durch staatliche Eingriffe führe zu künstlichen Marktverzerrungen. “Wettbewerb ist der beste Motor für Innovation. Und der Versuch, Unternehmen künstlich zu stärken, garantiert nicht, dass diese ihre Gewinne in innovative Aktivitäten investieren, die Europa voranbringen”, mahnt sie. Vergangene Versuche, große Unternehmen durch Industriepolitik zu schaffen, seien meist nicht erfolgreich gewesen. Bei Airbus sei das gelungen, das sei jedoch eine Ausnahme.
“Bereits etablierte Unternehmen haben oft Chancen verpasst, sich in neuen Technologiebereichen zu positionieren, wie zum Beispiel im Bereich der Cloud-Dienste”, kritisiert Schwarz-Schilling. “Die Erleichterung der Fusionskontrolle könnte den Wettbewerb weiter einschränken, anstatt ihn zu fördern. Diese Strategie könnte zu einer Konzentration der Marktmacht führen, die wiederum Innovationen behindert.” Um das innovative Potenzial Europas besser zu nutzen sei der in den Leitlinien vorgesehene Weg, Rechtsvorschriften für KMU zu vereinfachen, kleine innovative Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen und “die Kosten des Scheiterns zu senken” sicher der erfolgversprechendere Weg, meint Schwarz-Schilling.
Dass das Weißbuch, das der Vorbereitung eines künftigen Digital Networks Acts (DNA) dient, nicht explizit Erwähnung findet, bedeutet nicht, dass die Kommission dazu 2025 nicht doch einen Vorschlag machen wird. Der Schwerpunkt der Leitlinien liegt jedoch auf Künstlicher Intelligenz und Daten. Das begrüßt Schwarz-Schilling. Der Zugang zu Daten sei für viele Unternehmen eine große Herausforderung. “Unternehmen zögern, ihre Daten zu teilen, und es gibt erhebliche Schwierigkeiten bei der Strukturierung von Daten, sodass sie für andere nutzbar sind”, sagt Schwarz-Schilling. “Es müssen Standards entwickelt werden, um diese Herausforderungen zu bewältigen.”
Positiv bewertete Schwarz-Schilling auch den Vorschlag, einen Europäischen KI-Forschungsrat einzurichten. “Denn in diesem Bereich ist es wegen der Skaleneffekte in der Tat sinnvoll, Ressourcen zu bündeln, ähnlich wie beim CERN.” Zudem betont die Forscherin: “Es ist wichtig, dass auch kleinere KI-Player bezahlbaren Zugang zu Rechenkapazitäten erhalten.” Das wiederum will von der Leyen über die geplanten KI-Fabriken erreichen.
Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, übt deutliche Kritik an der aktuellen Tarifgestaltung für die Nutzung der Stromnetze. “Die Regionen, die modernisieren und Netze ausbauen, tragen bisher die Kosten”, sagte Messner zu Table.Briefings. “Und die, die das – insbesondere im Süden Deutschlands – nicht in dem nötigen Tempo angehen, sind fein raus.” Das sei klimapolitisch und aus Gerechtigkeitsperspektive wenig überzeugend.
Schon länger klagen die Ministerpräsidenten der deutschen Küstenländer, die kräftig in Windkraft und die dazu nötigen Netze investiert haben, über die aus ihrer Sicht zu hohen Netzentgelte, die wiederum zu höheren Strompreisen führen. Auch Messner hält das derzeitige Anreizsystem für falsch konstruiert: “Man müsste doch eigentlich die, die in die richtige Richtung gehen, entlasten und die, die nicht schnell genug sind, belasten.” Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall.
Nur bedingt zufrieden ist der UBA-Präsident mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Nach den jüngsten Zahlen ist der Ertrag aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2024 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch liegt inzwischen bei 57 Prozent. “Bei der Photovoltaik machen wir beachtliche Fortschritte”, sagte Messner, “da ist eine enorme Dynamik drin”. Nicht zuletzt, “weil die Menschen mit kleinen Balkonkraftwerken oder Anlagen auf dem Dach ‘Mitgestalter des Wandels’ sein” wollten. Zwar sei der Energiesektor der dynamischste bei der Emissionsreduzierung – doch es gebe auch Bereiche, in denen mehr Tempo nötig ist. “Wir kommen beim Ausbau der Windkraft nicht so schnell voran, wie wir uns vorgenommen haben”, so Messner.
Für falsch hält der UBA-Chef auch den von Bundesregierung und Parlament beschlossenen Wegfall der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Hier mehr Flexibilität zwischen den Sektoren zu schaffen, sei richtig. Aber die Vorstellung, Versäumnisse in einem Sektor könnten durch besondere Anstrengungen in anderen Sektoren per se ausgeglichen werden, sei irrig. “Wenn wir etwa im Mobilitätsbereich genauso weiter fahren bis 2035, muss die Kurve in Richtung 2045 so steil in Richtung Null abfallen, dass das physisch und ökonomisch nicht mehr möglich sein wird.” Horand Knaup
Wegen der Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gibt es Streit zwischen der FDP und CDU-Chef Friedrich Merz. Merz kritisierte am Freitag im Deutschlandfunk, dass die FDP-Europaabgeordneten nicht für die CDU-Politikerin von der Leyen gestimmt hatten. “Ich habe schon seit Monaten kaum noch Verständnis für die Haltung einer ganzen Reihe von FDP-Abgeordneten, sowohl im Europäischen Parlament als auch im Deutschen Bundestag”, sagte er.
Führende Vertreter der Freien Demokraten reagierten auf die Kritik: “Die Äußerungen des CDU-Chefs verwundern mich sehr”, erwiderte Fraktionschef Christian Dürr in der Bild am Sonntag. “Herr Merz bekennt sich damit klar zur grünen Agenda und stellt sich hinter von der Leyens Pläne für das Verbrenner-Aus, europäische Schulden und mehr Bürokratie aus Brüssel.” Für diese Politik stehe die FDP nicht zur Verfügung.
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai warf Merz vor, keine klare Strategie zu haben. “Er fordert Entlastung, solide Finanzen und Entbürokratisierung, biedert sich aber den Grünen an und unterstützt von der Leyens Politik der Stagnation und Schulden“. Das werde der CDU massiv schaden.
Merz sagte, wichtig sei, dass Ursula von der Leyen in der Mitte des EU-Parlaments eine stabile Mehrheit habe, mit der sie tun könne, was notwendig sei: “Weniger Regulierung, Abschaffung von überflüssiger Regulierung und Konzentration auf Verteidigung, Integration und vor allem Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Das geht auch ohne FDP.” dpa
Die EU plant Sonderzölle auf die Einfuhr von Biodiesel aus China. Die zusätzlichen Zölle sollen zwischen 12,8 Prozent und 36,4 Prozent des Warenwertes betragen, wie aus einem am Freitag veröffentlichten EU-Dokument hervorgeht. Gelten sollen die Zölle vorläufig ab Mitte August, die EU-Untersuchung wegen der Dumping-Preise ist bis Februar geplant. Dann könnten die Zölle endgültig für fünf Jahre festgelegt werden.
Europäische Hersteller hatten geklagt, dass Biodiesel in großem Umfang zu Dumping-Preisen in die EU eingeführt werde. 90 Prozent aller chinesischen Biodiesel-Ausfuhren gingen in die EU. Mehrere Firmen in Europa hatten daraufhin ihre Produktion gedrosselt oder eingestellt.
Und auch auf die Einfuhr von kalorienarmen Süßungsmitteln aus China hat die EU Antidumpingzölle eingeführt. Auf Waren des größten chinesischen Erythrit-Herstellers Sanyuan wird ab sofort ein Zusatzzollsatz in Höhe von 156,7 Prozent fällig. Für Exporte anderer Hersteller aus China gelten Sätze in Höhe von 31,9 bis zu 235,6 Prozent. Die Antidumpingzölle gelten erst einmal für die Dauer von sechs Monaten.
Beide Vorhaben reihen sich in das schärfere Vorgehen der EU gegen chinesischen Importe ein. Für erhebliche Debatten hatten die Zölle für E-Autos aus China gesorgt, die vorläufig seit Anfang Juli gelten. Im November könnten sie mit Billigung der Mitgliedsstaaten endgültig festgesetzt werden, wenn es bis dahin keine Einigung mit der chinesischen Seite gibt. rtr/flee
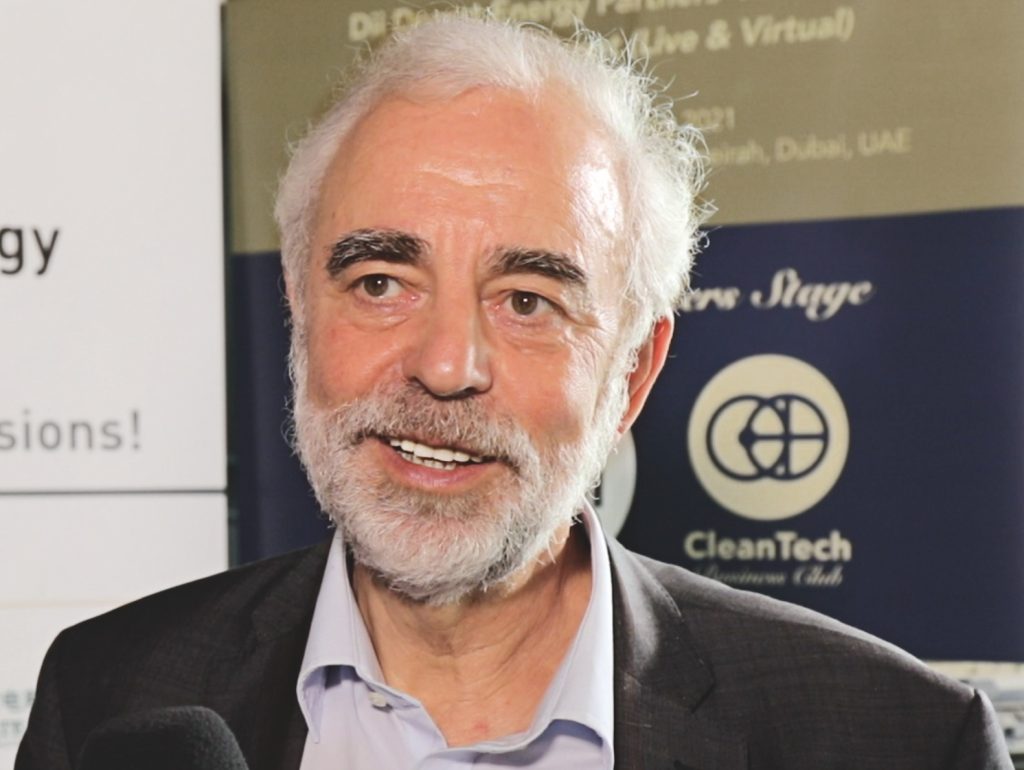
Es war eines der ambitioniertesten deutschen Industrieprojekte: Desertec sollte in großen Mengen Erneuerbare Energie in Nordafrika produzieren, die Stromnetze in Nordafrika miteinander verbinden und diese mit Europa. Desertec sollte bis zu 15 Prozent des Stroms in Europa produzieren. Dazu wären Investitionen gigantischen Ausmaßes von rund 400 Milliarden Euro notwendig gewesen. Doch das Projekt ist gescheitert.
Die gute Nachricht jedoch ist: Desertec lebt weiter. Und nicht nur das: Desertec ist heute größer als jemals zuvor. Paul van Son, der Niederländer, der die Desertec Industrial Initiative GmbH (DII) vorangetrieben hatte, ist dem Projekt treu geblieben. Allerdings hat sich Desertec grundlegend geändert. Unter neuem Namen ist Dii Desert Energy heute ein internationales Industrienetzwerk mit Sitz in Dubai.
Dort verfolgt van Son den Ursprungsgedanken von Desertec weiter, mit einem Unterschied: Dii ist heute mehr ein Thinktank, der Menschen, Länder und Märkte im Bereich saubere Energie miteinander verbinden will. Das Ziel ist immer noch: in den Wüsten emissionsfrei, verlässlich und kostengünstig Energie zu produzieren. Da sieht van Son Dii Desert Energy auf gutem Weg: “Die Länder der MENA-Region nutzen immer stärker ihr Potenzial für eine emissionsfreie Energieerzeugung”, sagt er.
Van Son hatte in Delft Engineering und Energiewirtschaft studiert und arbeitete dann für Siemens im Netzwerkbereich, anschließend für das Energieunternehmen Essent. Von 2009 an stand er der Desertec Industrial Initiative in München vor – bis diese fünf Jahre später auseinanderbrach, als viele Gesellschafter wie Siemens oder ABB ihr Engagement nicht verlängern wollten.
Doch RWE, das chinesische Unternehmen State Grid Corporation und Acwa Power aus Saudi-Arabien sind Dii Desert Energy auch nach Umbenennung und Umzug treu geblieben. Auch Thyssenkrupp ist bei dem Netzwerk in führender Rolle dabei. Zahlreiche Namen aus der deutschen Industrie sind dazugekommen oder haben sich der Initiative wieder angeschlossen: Eon, Bosch, Baywa, Siemens, Daimler Truck, Siemens Energy, Samson oder auch Roland Berger.
Vor allem ist Cornelius Matthes Paul van Son treu geblieben. Heute steht Matthes dem Netzwerk als CEO vor, van Son ist der Präsident. Matthes stand eine verheißungsvolle Karriere im Asset Management der Deutschen Bank in Aussicht. Doch die Chance, die Energiewende mitzugestalten, reizte ihn mehr als eine Karriere in der Bankenhierarchie. “Ohne grünen Wasserstoff aus den Wüstenländern würde die Energiewende hier nicht vorankommen”, meint denn auch Matthes.
Matthes ging den ganzen Weg mit allen Höhen und Tiefen an der Seite van Sons mit. So leitet er heute das Netzwerk in Dubai. Doch Paul van Son agiert in seiner Rolle als Präsident weiter – als Antreiber und als Visionär, der mit leiser Stimme, Freundlichkeit und Nachdruck immer wieder neue Ideen vorantreibt.
An diesem Wochenende, am 13. Juli, hat Dii Desert Energy sein fünfzehnjähriges Jubiläum gefeiert. “In unserer Gruppe wurden die ersten Diskussionen zum Projekt Neom Green Hydrogen geführt, das mit 8,4 Milliarden Dollar den Financial Close erreichte und nun gebaut wird”, sagte Matthes zu diesem Anlass. “Dabei wurden auch andere verrückte Ideen besprochen, von denen niemand gedacht hätte, dass sie jemals realisiert werden würden.”
Van Son und Matthes behaupten gar, dass Dii Desert Energy heute größer ist und größere Wirkung entfaltet hat, als es die Desertec Industrial Initiative jemals konnte. Matthes nennt nüchtern die Fakten: “Seit wir vor fünf Jahren die MENA Hydrogen Alliance ins Leben gerufen haben, hat die Industriegruppe und Denkfabrik Dii Desert Energy ein beeindruckendes Comeback erlebt: Von 20 Partnern im Jahr 2019 haben wir uns versechsfacht und sind nun auf mehr als 120 Partner aus 35 Ländern gewachsen.”
Allerdings legt Dii Desert Energy den Fokus neben Nordafrika stark auf den Nahen Osten. Und dennoch: Die alten Kooperationsländer von Desertec – Ägypten, Tunesien und Marokko – sind immer noch dabei. In wenigen Wochen wird van Son seinen 71. Geburtstag feiern. Doch in seiner Rolle als Präsident von Dii Desert Energy fühlt er sich offenbar weiterhin wohl. Es ist ein Leben für saubere Energie. Christian von Hiller
