bereits in der zweiten Woche der ungarischen Ratspräsidentschaft kommen heute und morgen in Budapest die EU-Umwelt- und Klimaminister zusammen. Wobei, von den Umweltministern kann kaum die Rede sein. Die Bundesregierung lässt sich durch Staatssekretäre aus dem Auswärtigen Amt und dem Bundesumweltministerium vertreten. Scheinbar besteht wenig Interesse an einem Austausch auf Ministerebene mit den Ungarn, womöglich auch wegen der geopolitischen Alleingänge von Viktor Orbán.
Dabei sind die Themen dieses informellen Umweltrates durchaus relevant, denn die Ratspräsidentschaft hat einen Austausch zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz in Baku (COP29) auf die Agenda gesetzt. Auch die aserbaidschanische COP-Präsidentschaft ist eingeladen, was zeigt, wie wichtig Ungarn die COP29 und das dort zu verhandelte Klimafinanzierungsziel ist.
Die eigenen Klimaziele der EU für 2035 und 2040 werden dagegen nicht in einem eigenen Agendapunkt besprochen. Die Bundesregierung und andere Mitgliedstaaten werden sich in ihren Wortbeiträgen dennoch für “wissenschaftsbasierte” Ziele einsetzen. Auch wenn es in Berlin noch keine geeinte Position für ein Prozentziel gibt, deutet dies auf mindestens 90 Prozent CO₂-Reduktion bis 2040 im Vergleich zu 1990 hin – der wissenschaftliche EU-Klimabeirat hatte 90 bis 95 Prozent empfohlen.
Des Weiteren soll in Budapest die Zukunft des Green Deals erörtert werden. Es sieht danach aus, dass er einen stärker industriepolitischen Fokus erhält und in der kommenden Legislatur in ein Maßnahmenpaket für eine grüne Wirtschaft umgewandelt wird. Dafür sprechen sich sowohl in Brüssel die Unterstützerfraktionen der neuen EU-Kommission als auch die Regierungen in vielen Hauptstädten aus. Beschlüsse hierzu wird es bei diesem informellen Treffen aber ohnehin nicht geben.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Am kommenden Montagabend spricht Christian Lindner in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Brüssel. Das Thema seiner Rede: die Zukunft der Kohäsionspolitik. Der Bundesfinanzminister will eine Studie vorstellen und zugleich eine klare Botschaft senden: Statt reflexhaft mehr Geld für den EU-Haushalt zu fordern, sollten die bestehenden Ausgabenprogramme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Das gilt vor allem für die europäische Regionalpolitik – mit 392 Milliarden Euro für sieben Jahre der größte Ausgabenblock im laufenden EU-Finanzrahmen.
Ähnliche Botschaften hat der FDP-Politiker gebetsmühlenartig in den Verhandlungen zum Bundeshaushalt wiederholt. Im kommenden Jahr beginnen nun die Gespräche über den neuen EU-Finanzrahmen, der die Jahre 2028 bis 2034 umfasst. Und Lindner will frühzeitig einen Pflock einschlagen. Aus seiner Sicht fordern andere Regierungen zu leichtfertig eine Ausdehnung des EU-Haushalts oder neue europäische Schuldenprogramme.
In der Kohäsionspolitik ließe sich aus Lindners Sicht Geld einsparen, um neue politische Prioritäten wie Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit zu finanzieren. Die Fakten dafür soll die Studie liefern. Die hat das Bundesfinanzministerium beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Experten aus anderen Staaten in Auftrag gegeben. Die Wissenschaftler um ZEW-Finanzexperte Friedrich Heinemann werden ihre rund 400 Seiten starke Untersuchung am Montagabend an die zuständigen Kommissare Elisa Ferreira (Kohäsion) und Johannes Hahn (Budget) übergeben.
Dem Vernehmen nach konstatiert die Studie eine getrübte Erfolgsbilanz der Kohäsionsfonds. Insbesondere mittel- und osteuropäische Regionen haben mithilfe der Gelder aus Brüssel zwar wirtschaftlich schnell aufgeholt. Aber in anderen Gegenden wie Süditalien habe die Förderung wenig bewirkt: Dysfunktionale Strukturen, eine wenig leistungsfähige Verwaltung sowie Korruption bremsen dort die Entwicklung aus.
In einem kürzlich vorgestellten Papier kritisierten ZEW-Forscher bereits, der Erfolg der Fördermaßnahmen werde nicht ausreichend transparent und unabhängig überprüft. Kritik an den Kontrollen äußerte gerade auch der Europäische Rechnungshof.
Die Diskussion über die Wirksamkeit der Strukturpolitik, die Lindner anschieben will, ist allerdings nicht neu. Immer wieder haben wohlhabendere Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahrzehnten die milliardenschweren Programme infrage gestellt, die zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und zur Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Regionen in der EU beitragen sollen. Und stets haben sie sich die Zähne ausgebissen am Widerstand der weniger entwickelten Staaten. Diese sehen die Zahlungen aus Brüssel als Interessenausgleich zum Binnenmarkt, der insbesondere exportstarken Unternehmen aus Ländern wie Deutschland nutzt.
In den deutschen Bundesländern, den hiesigen Profiteuren der Zahlungen aus Brüssel, wird Lindners Vorstoß daher gelassen gesehen. Für deutlich größere Unruhe sorgen dort die Pläne von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Strukturfonds nach dem Vorbild der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) aus der Corona-Pandemie neu auszurichten. So könne die Auszahlung an Bedingungen wie konkrete Reformen in den Empfängerländern geknüpft werden, sagte sie im Mai in einem Interview. Die Kombination aus Reformen und Investitionen habe Ländern wie Italien, Griechenland oder Portugal Wachstum gebracht.
Im Generalsekretariat der Kommission und in der Generaldirektion Budget wird bereits an konkreten Plänen dafür gearbeitet, wie es in informierten Kreisen heißt. Die für die Verwaltung der Strukturfonds zuständige DG Regio sei weitgehend außen vor.
In den Bundesländern schrillen deshalb die Alarmglocken. Sie befürchten, nicht mehr selbst entscheiden zu können, ob sie Radwege, Naturschutzgebiete oder einen Start-up Campus mithilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder mithilfe des Kohäsionsfonds finanzieren wollen. Bei einem Treffen im Juni warnten die Europaminister der Länder einhellig davor, die Förderinstrumente auf die nationale oder EU-Ebene zu verlagern.
Um Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität zu erhalten, mussten die nationalen Regierungen umfassende Maßnahmenpläne bei der Kommission einreichen und sich genehmigen lassen. Die Bundesländer seien dabei nur angehört, aber nicht ernsthaft eingebunden worden, kritisiert ein hochrangiger Vertreter eines Landes. Dieses Modell auf die Kohäsionsfonds zu übertragen, bedeute eine weitreichende Zentralisierung.
In Brüssel wird versucht, den Bedenken entgegenzukommen. So könnten die Regionen bei der Formulierung der Prioritäten stärker eingebunden werden als beim ARF geschehen, heißt es in EU-Kreisen.
In der Bundesregierung gibt es Sympathien dafür, sich am ARF-Ansatz zu orientieren. “Es hat echte Veränderungen bewirkt, die Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität an die Umsetzung von Reformen und Meilensteinen in den Mitgliedstaaten zu knüpfen”, sagt der Staatssekretär im zuständigen Bundeswirtschaftsministerium, Sven Giegold. “Wir sollten ernsthaft darüber diskutieren, dieses Prinzip auf die Kohäsionspolitik zu übertragen.” Dies bedeute keine Zentralisierung der Mittelvergabe.
Auch in Berlin gibt es aber große Bedenken, der Kommission eine ähnlich starke Rolle bei der Vergabe der Kohäsionsgelder einzuräumen wie beim ARF. Für völlig illusorisch hält man dort, dass die Behörde in Brüssel selbst über Tausende von Förderbescheiden entscheidet, was bislang Sache der Regionen und Kommunen ist. Wer daran rüttele, lege sich mit sämtlichen Städten und Regionen an, heißt es warnend in Berlin. Zudem lebt eine ganze Industrie aus Wirtschaftsförderern und Projektevaluierern von den EU-Fonds. Ob die Politik wirklich ernst macht mit einer Reform, muss sich daher erst zeigen.
Erste Umrisse der chinesischen Reaktion im Zollstreit mit der EU zeichnen sich ab. Am Mittwoch hat das chinesische Handelsministerium eine Untersuchung von Handelshemmnissen aufseiten der EU angekündigt. Die Untersuchung war schon länger geplant: Ende Juni bereits hat ein Sprecher des Ministeriums die Prüfung eines entsprechenden Antrags des chinesischen Verbands für Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten (CCCME) angekündigt.
Die Untersuchung folgt einem festgelegten Mechanismus, den die chinesische Regierung auch auf ihrer Homepage transparent macht. Bisher wurde dieser Mechanismus nur vier Mal angewandt – unter anderem gegen die USA und gegen Japan. Wenn die Prüfung ergibt, dass die EU ihren Markt in unangemessener Weise gegenüber China verschließt, hat das Handelsministerium demnach drei verschiedene Optionen:
Der dritte Punkt lässt alle Möglichkeiten offen – inklusive Gegenmaßnahmen und anderen unangenehmen Eskalationen. Die Ermittlung sei in Brüssel zur Kenntnis genommen worden, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit.
Die Untersuchung soll sechs Monate dauern. Die Ankündigung lässt grundsätzlich offen, um welche Branchen und Handelshemmnisse es geht. Klar, dass die E-Auto-Zölle gemeint sind. Es geht aber allgemein um “Handels- und Investitionshemmnisse im Zusammenhang mit den Praktiken der EU bei der Untersuchung chinesischer Unternehmen im Rahmen des Beschlusses zur Überprüfung ausländischer Subventionen”. In der Mitteilung des Ministeriums sind ausdrücklich auch genannt:
Auf den ersten Blick gelten hier keine allgemeinen Marktbarrieren. In der Solarbranche hat die EU zuletzt davon Abstand genommen, Zölle zu prüfen. Auch in der Windkraft hat die EU vorerst auf ein Verfahren verzichtet.
Doch zugleich ist ein Muster zu erkennen. Es handelt sich in allen Fällen um Branchen, in denen die EU eine Anti-Subventionsuntersuchung eingeleitet hat. Dieses Instrument besitzt sie seit fast genau einem Jahr, in Kraft trat die Foreign Subsidies Regulation (FSR) im Juli 2023. Es stört die chinesische Seite besonders, weil es wesentlich schneller und zupackender ist als die guten alten Anti-Dumping-Untersuchungen, die sich oft ewig hinzogen. Zu den Prüfungen chinesischer Anbieter auf unangemessene staatliche Subventionen gehörten:
Als Erstes will das Ministerium nun ermitteln, inwiefern die EU dabei eine Reihe von Regeln verletzt, die China in den Durchführungsbestimmungen selbst definiert hat. Dazu gehört beispielsweise der Bruch von Verträgen zwischen den Volkswirtschaften, aber auch wachsweiche Fälle wie beispielsweise: “Verursachung von Markteintrittsbarrieren” oder “Schaden für die Wettbewerbsfähigkeit [chinesischer] Firmen”. Sehr weit gefasst ist auch der Punkt: “[Die Handelsmaßnahme] könnte die Exportchancen für ein [chinesisches] Produkt behindern”.
Die Instrumente zur Prüfung des Sachverhalts auf chinesischen Seite sind:
Sie ähneln damit den Instrumenten, mit denen die EU die chinesische Fahrzeugindustrie zur Festlegung der E-Auto-Zölle unter die Lupe genommen hat.
China macht damit klar, dass es die EU-Zölle keineswegs klaglos als fair akzeptiert, wie Handelskommissar Valdis Dombrovskis gehofft hat. Es wird schon aus Prinzip eine handfeste Reaktion aus Peking geben, die sich nicht auf einzelne Produkte wie Cognac oder Schweinefleisch beschränkt. China will zeigen: Es lässt nicht alles mit sich machen.
Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es zu einer unkontrollierten Spirale immer höherer Zölle und anderer Barrieren kommt. Auch gegenüber den USA hat China in der Regel mit einer ungefähr gleichwertigen Handelsmaßnahme geantwortet, als erst Donald Trump, dann Joe Biden immer neue Zölle und Beschränkungen verhängt haben.
Peking ist auf den Export angewiesen und hat kein Interesse an geschlossenen Märkten, wie es selbst immer wieder betont hat. Auch gegenüber der EU wird China vermutlich nach dem Prinzip vorgehen: wie du mir, so ich dir.
12.07.2024 – 09:00-18:00 Uhr, Fiesole (Italien)
FSR, Conference 1st Florence Aviation Regulation Conference
The Florence School of Regulation (FSR) discusses current economic and regulatory policies relating to air transport and identifies regulatory challenges on the horizon. INFOS & REGISTRATION
12.07.2024 – 19:00-20:30 Uhr
DGAP, Podiumsdiskussion 20 Jahre EU-Osterweiterung: Chancen und Herausforderungen
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) blickt auf den Prozess der EU-Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Staaten zurück. INFOS & ANMELDUNG
15.07.2024 – 17:30-18:30 Uhr, online
DGAP, Diskussion Desinformation: Der Kampf um die Wahrheit
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, warum Desinformation derzeit so viele Abnehmer findet. INFOS & ANMELDUNG
16.07.-19.07.2024, Aspen, Colorado (USA)
AI Aspen Security Forum
The Aspen Institute (AI) explores new collaborations across government, private industry, and civil society to tackle global challenges. INFOS & REGISTRATION
16.07.2024 – 18:30-20:30 Uhr, Hamburg
KAS, Diskussion Moskaus Weg in die Abhängigkeit: Die russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet die chinesisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen und das Verhältnis zwischen China und dem Westen, das von zunehmenden Belastungen überschattet wird. INFOS & ANMELDUNG
EVP, S&D, Renew und Grüne haben sich auf eine Verteilung der Posten verständigt, die nach D’Hondt der rechtsradikalen Fraktion “Patrioten für Europa” zustehen würden. Nach jetzigem Verhandlungsstand soll der Vize-Präsidentenposten an die Sozialisten gehen, der Quästoren-Posten an Renew. Den Anspruch, den Vorsitz im Verkehrsausschuss (TRAN) zu stellen, ginge an die Christdemokraten. Hier ist der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke im Gespräch. Der Vorsitz im Kulturausschuss (CULT) soll an die Grüne-Fraktion gehen.
In der Woche ab 22. Juli konstituieren sich die Ausschüsse. EVP, S&D, Renew und Grüne haben verabredet, Kandidaten der “Patrioten” für die Posten nicht zu wählen und stattdessen gemeinsam eigene Kandidaten durchzubringen. Dieses Verfahren wird Cordon sanitaire genannt. Hier ist der derzeitige Verhandlungsstand abgebildet. Änderungen sind noch möglich.
Die Mehrheitsverhältnisse der Fraktionen am 4. Juli waren maßgeblich für die Verteilung der Posten durch die Verwaltung des Europaparlaments auf die sieben Fraktionen. Am 4. Juli hatte sich die Fraktion der “Patrioten” noch nicht gegründet. Entscheidend für den rechnerischen Anspruch der “Patrioten” waren die 58 Sitze der ID-Fraktion, die dann in den “Patrioten” aufgegangen ist.
Die Bildung der Fraktion “Europa der souveränen Nationen” am Mittwoch kam zu spät für die Postenverteilung im Europaparlament. Sie kommt bei den Ausschussvorsitzen und Posten für Vizepräsidenten nicht zum Zuge. mgr
Die am Mittwoch gegründete Fraktion “Europa der souveränen Nationen” hat 25 Mitglieder. 14 davon kommen von der AfD, die sich mit Wirrköpfen, Russlandfreunden und EU-Hassern zusammengetan haben. Maximilian Krah bleibt außen vor. Damit wird das Europaparlament in die neue Wahlperiode mit acht Fraktionen starten. Da die Frist für die Verteilung der Posten verstrichen ist, geht die zweite Rechtsaußenfraktion ohne Anspruch auf Ausschussvorsitze und andere Posten an den Start. Ihre Mitglieder haben lediglich je einen Sitz in einem Ausschuss. Die Fraktion wird geführt von René Aust (AfD).
In Kreisen der AfD-Zentrale in Berlin gibt es Kritik. Die Bildung einer Fraktion mit sehr kleinen Delegationen sei eine “Verzwergung”. Bisher hatte die AfD in Brüssel etwa mit Frankreichs Rassemblement National kooperiert. Jetzt bildet sie eine Fraktion mit Splittergruppen und Einzelkämpfern, deren politisches Profil vielfach wirr ist. Die Fraktion wird auch “Hooligan”-Truppe genannt. Damit werde dauerhaft die Brücke zu Fidesz und Marine Le Pen abgerissen.
Zur Fraktion gehören etwa drei Abgeordnete der polnischen Konfederacja. Die Partei setzt sich dafür ein, dass die Einkommensteuer abgeschafft wird. Sozialbeiträge sollen künftig nur auf freiwilliger Basis gezahlt werden. Homosexualität wird drastisch abgelehnt. Die Partei will die Todesstrafe in Polen für Kapitalverbrechen wieder einführen.
Drei Abgeordnete bringt zudem die bulgarische Wasraschdane ein. Der Parteiname bedeutet Wiedergeburt. Die Gruppierung ist prorussisch, sie kämpft gegen die Einführung des Euro in Bulgarien und ist gegen Covid-Impfen. Auf ihr Konto geht die versuchte Erstürmung des bulgarischen Parlaments 2022, Farbwürfe gegen eine EU-Vertretung und Störaktionen gegen einen Film über Homosexualität unter Jugendlichen. fak/mgr
Im Lager von Emmanuel Macron und Teilen der konservativen Partei Républicains gibt es Bestrebungen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. So wollen sie das Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) ausbooten, das aus den Parlamentswahlen als stärkste Kraft hervorgegangen ist. Diese Option wird vom ehemaligen Premierminister Edouard Philippe, Bruno Retailleau, Fraktionsvorsitzender der Républicains im Senat, und von Innenminister Gérald Darmanin unterstützt, der zum Macron-Lager gehört. Sollte diese Koalition zustande kommen, wird Gérald Darmanin als nächster Premierminister gehandelt.
Die Idee spaltet sowohl die konservative Partei Républicains als auch die Macronisten-Partei Ensemble. Mehrere Minister und Abgeordnete aus dem linken Ensemble-Lager haben bereits angekündigt, dass sie sich von der Partei abspalten würden, wenn es zu einem solchen Bündnis kommen sollte.
Der Vorsitzende der zentristischen MoDem-Fraktion, François Bayrou, befürwortet eine breitere Koalition. Er verlangt, dass Macron einen Premierminister ernennt, der “die Menschen zusammenbringen kann”. Auf der rechten Seite verteidigt Laurent Wauquiez, der Chef der Républicains-Fraktion wird, eine Linie “ohne Kompromisse” mit dem Lager von Präsident Macron.
Die Linke ihrerseits forderte Emmanuel Macron erneut auf, “das Ergebnis der Parlamentswahlen zu respektieren”, indem er einen Premierminister aus den Reihen der NFP ernennt. Die Verhandlungen zwischen den verschiedenen Parteien werden fortgesetzt, um sich auf einen Namen zu einigen. Das Lager von France Insoumise um Jean-Luc Mélenchon und die Parti Socialiste versuchen jeweils, das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Präsident Emmanuel Macron, der derzeit zum Nato-Gipfel in den USA ist, veröffentlichte am Mittwoch einen “Brief an die Franzosen”. Darin fordert er “alle politischen Kräfte, die sich zu den republikanischen Institutionen, dem Rechtsstaat, dem Parlamentarismus, einer europäischen Ausrichtung und der Verteidigung der französischen Unabhängigkeit bekennen, auf, einen aufrichtigen und loyalen Dialog zu führen”. Er macht die Ernennung eines Premierministers von der Schaffung einer “notwendigerweise pluralistischen” Mehrheit in der Nationalversammlung abhängig, was die Tür für eine breite Koalition offenlässt. cst
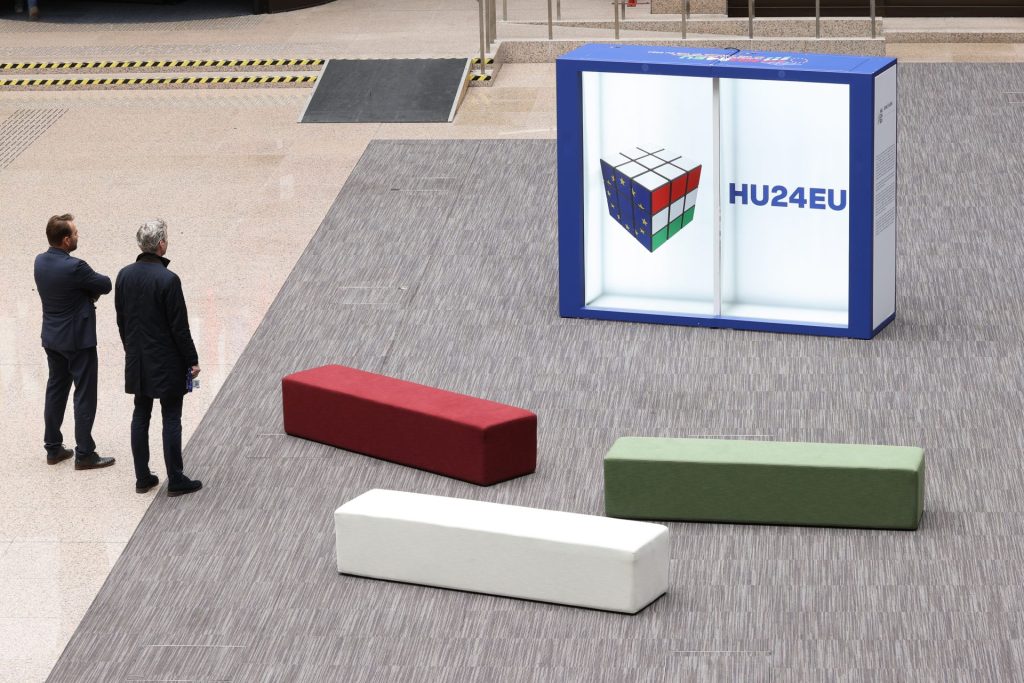
Der ungarische Premierminister Viktor Orbán sorgte mit seiner Reise nach Moskau und Peking für Unmut in Brüssel. An der Sitzung der Ständigen Vertreter (AStV) am gestrigen Mittwoch hob der polnische Botschafter deshalb das Verhalten der ungarischen Ratspräsidentschaft auf die Sitzungsagenda – nur zehn Tage nach Beginn der Präsidentschaft.
In einer zweieinhalbstündigen Diskussion kritisierten die ständigen Vertreter von 25 Mitgliedstaaten die Reise Orbáns. Neben Ungarn enthielt sich laut Brüsseler Quellen nur die Slowakei der Kritik am ungarischen Verhalten. Die EU-Diplomaten sprechen von einem tiefen Vertrauensbruch.
In der AStV-Sitzung argumentierte Ungarn, dass Orbáns Gespräche rein bilateraler Natur waren und dazu dienen sollten, die Machbarkeit eines Waffenstillstands zu eruieren. Ebenfalls am Mittwoch stellte sich der ungarische Minister für Europäische Angelegenheiten, János Bóka, den Medien und verteidigte Orbáns Vorgehen. Es gäbe keine Pflicht, die EU und die Mitgliedstaaten im Vorhinein über bilaterale Treffen zu informieren oder zu konsultieren, sagte er.
EU-Diplomaten widersprechen diesem Argument jedoch. Ungarn habe die Grenzen bewusst verwischt, unter anderem, indem Orbán in seinen Beiträgen über die Reise in den sozialen Medien die Hashtags und das Logo der ungarischen Ratspräsidentschaft benutzt habe. Mit seiner Reise handelte Orbán “gegen den Geist und den Text der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats”, sagte ein EU-Diplomat Table.Briefings.
Der Rechtsdienst des EU-Rats argumentierte in der AStV-Sitzung laut Brüsseler Quellen, dass Ungarn gegen das Loyalitätsgebot verstoßen habe. Dabei geht es nicht nur um Orbáns Verhalten in Moskau und Peking, sondern auch um seine Reise zum Treffen der Turkstaaten. Dort habe der ungarische Premier Positionen bezüglich Nordzypern vertreten, die nicht im Einklang mit EU-Positionen stehen und besonders Zypern und Griechenland verärgerten.
Bei seiner Pressekonferenz in Brüssel versuchte Europa-Minister Bóka, die ungarische Ratspräsidentschaft von der ungarischen Regierung zu unterscheiden. Die ungarische Regierung habe zwar einen sehr “charakteristischen” Stil, dies sei aber “nicht unversöhnlich” mit einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft.
Mit seiner Einschätzung dürfte Bóka in Brüssel zwar relativ allein dastehen, aber harte Maßnahmen gegen Ungarn sind aktuell dennoch nicht in Sicht. Trotz der Kritik im AStV wurde von keinem Botschafter vorgeschlagen, die ungarische Präsidentschaft vorzeitig abzubrechen. Vor dem Start der ungarischen Ratspräsidentschaft hätte eine superqualifizierte Mehrheit von 20 Mitgliedstaaten für so ein Vorgehen gereicht, nun ist es unklar.
Die Mitgliedstaaten überlegen sich deshalb niederschwellige Maßnahmen, zum Beispiel das Fernbleiben von informellen Ratstreffen. Diese finden traditionell im Mitgliedstaat statt, der die Ratspräsidentschaft innehat. Schon der informelle Wettbewerbsfähigkeitsrat in Budapest zu Beginn dieser Woche fand ohne Teilnahme des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck und des französischen Industrieministers Roland Lescure statt. jaa/sti
Nun ist es offiziell: Der rechtspopulistische Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever, soll die nächste Föderalregierung in Belgien bilden. Dies teilte König Philippe am Mittwoch nach einer kurzen Unterredung mit De Wever im Königspalast in Brüssel mit. Bis zum 24. Juli soll der flämische Nationalist seine Sondierungen beendet haben und dann erneut Bericht erstatten.
Wenn die Mission gelingt, wird De Wever eine Fünf-Parteien-Koalition führen, die bereits auf den Namen “Arizona” getauft wurde. Neben seiner flämischen Partei N-VA wären darin die flämischen Sozialdemokraten von Vooruit, die flämischen Christdemokraten der Cd&V sowie aus der Wallonie der liberale MR und die christdemokratische Partei Les Engagés vertreten.
Die letzte Hürde war am Dienstagabend gefallen, als die flämischen Sozialdemokraten sich zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen bereit erklärt hatten. Dies war umstritten, da ihre Genossen aus der Wallonie nicht in die Regierung eintreten wollen. De Wever habe die nötigen Garantien gegeben, hieß es bei Vooruit. Allerdings werde man an den sozialpolitischen Prioritäten festhalten.
Dass die Koalitionsverhandlungen zum Erfolg führen, ist nicht sicher. Vor allem die Parteien aus der französischsprachigen Wallonie haben noch Zweifel. Vor De Wever liege “noch ein langer Weg, er muss noch harte Arbeit leisten”, sagte MR-Chef Georges-Louis Bouchez. Allerdings sehe er keine unüberwindbaren Hürden. De Wever müsse zeigen, dass er bereit sei, für alle Belgier zu sprechen.
In der Vergangenheit war das nicht der Fall – im Gegenteil. Mit seiner N-VA hat De Wever jahrelang auf eine Schwächung der belgischen Föderation und auf eine weitgehende Autonomie seiner Region Flandern hingearbeitet. Auch bei der Wahl Anfang Juni hat die N-VA eine Staatsreform mit diesem Ziel versprochen. Als Premierminister wäre er hingegen ganz Belgien verpflichtet.
Die Tageszeitung “Le Soir” sieht noch ein weiteres Problem: De Wever müsse sich zwischen seinem bisherigen Amt als Bürgermeister von Antwerpen und dem möglichen neuen Job in der Rue de la Loi (dem Sitz des Premiers) entscheiden. Im Herbst sind in Belgien Kommunalwahlen. Wenn De Wever vorher die Regierungsgeschäfte übernimmt, könnte seine Partei Antwerpen an die Linke verlieren. ebo
Die Rückabwicklung des Green Deals verhindern und bereits beschlossene Klima- und Umweltgesetze umsetzen, das hat für Grünen-Fraktion im EU-Parlament oberste Priorität in der kommenden Legislaturperiode. Am Mittwoch beschlossen die Abgeordneten ein sechsseitiges Papier. Darin fordern sie:
Zur Frage, ob sie Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen werden, gaben sich die Grünen verhalten positiv. Die EVP-Kandidatin scheint sich in der rund zweieinhalbstündigen Sitzung mit den Grünen gut geschlagen zu haben. Ausschlaggebend werden aber die schriftlich festgelegten Prioritäten sein, die von der Leyen in der kommenden Woche präsentieren wird, meinten die grünen Fraktionsvorsitzenden Bas Eickhout und Terry Reintke nach der Sitzung.
In ihrem Positionspapier fordern die Grünen die Kommission zudem auf, den Artikel 7(2) der EU-Verträge gegen Ungarn anzuwenden und ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. EU-Gelder dürften “nicht in den Taschen von Autokraten und ihren Freunden verschwinden”.
Im Israel-Gaza-Konflikt fordern sie, dass sich Brüssel vermehrt für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt und den Friedensprozess vorantreibt. Um Frieden in der eigenen Nachbarschaft zu fördern, solle die EU mit dem Erweiterungsprozess voranschreiten. luk
Die CDU/CSU-Gruppe in der EVP möchte der europäischen Stahlindustrie unter die Arme greifen – und schlägt deswegen einen europäischen Stahlpakt als Teil eines neuen Industrial Deals vor. “Eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie in der EU ist essenziell für Wohlstand, die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten, Beschäftigung, wirtschaftliche Sicherheit und die grüne Transformation”, heißt es in dem Papier, das Industriepolitiker Christian Ehler und Arbeitsmarktexperte Dennis Radtke am Mittwoch vorstellten.
Auf der Nachfrageseite sieht das Konzept Folgendes vor: Als Sofortmaßnahme müssten bei öffentlich geförderten Projekten, einschließlich der European Hydrogen Bank, ein Mindestanteil ‘European Content’ vorgeschrieben werden. Der NZIA solle erweitert werden, sodass sich dort künftig “verbindliche Herkunftskriterien für Grundstoffe im Rahmen der öffentlichen Beschaffung und der Auktionen” finden. Das unter der Vorgabe, dass sich die Zielvorgaben der Beschaffung nicht signifikant verteuerten. Zudem soll es ein EU-weites Labeling geben, das die Differenzierung ermögliche.
Gerade in der öffentlichen Beschaffung gäbe es “Potenziale durch die Einführung einer Quotenregelung, solange diese praxistauglich und ökonomisch sinnvoll ist”, heißt es im Papier. Auch im Privatsektor könne bereits “durch eine geringe Quote ein internationaler Absatzmarkt geschaffen und gleichzeitig der CO₂-Fußabdruck von Endprodukten verringert werden”.
Auch an der Preisschraube für Energie wollen die Parlamentarier drehen. Und zwar insbesondere, in dem die Regeln für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff gelockert werden. Der bis 2030 vorgesehene Übergangszeitraum mit weniger strengen Anforderungen an die Zeitgleichheit der Grünstrom- und Wasserstoffproduktion solle bis mindestens 2035 verlängert werden. Gleichzeitig müsste der Einsatz von Wasserstoff in Europa praxistauglicher möglich sein und zwar unabhängig von der Farbe, heißt es in dem Papier.
Trotz internationaler Kritik an dem CO₂-Grenzausgleichsmechanismus der EU – am CBAM halten CDU/CSU fest. Der CBAM soll unter anderem in der Stahlbranche vor Carbon Leakage schützen, indem Stahl-Importeure in den Binnenmarkt schrittweise zur Abgabe des europäischen CO₂-Preises aufgefordert werden, während parallel die kostenlosen CO₂-Zertifikate für die europäischen Hersteller wegfallen.
Die Union fordert im Rahmen des europäischen Stahlpakts jedoch Verbesserungen, und zwar noch bevor Abgaben im Rahmen des CBAM 2026 fällig werden:
Sollten diese Anpassungen nicht kommen, wollen CDU/CSU das Abschmelzen der kostenlosen CO₂-Zertifikate pausieren. lei/luk
Die Kommission hat die Sexplattform XNXX nach dem Digital Services Act (DSA) als sehr große Online-Plattform (VLOP) benannt. XNXX ist eine Plattform für erwachsene Inhalte mit durchschnittlich mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern in der EU. Die Zahl der Nutzer, die XNXX der Kommission mitgeteilt hat, liegt damit über dem Schwellenwert für die Benennung als VLOP.
Inzwischen hat die Kommission 25 sehr große Plattformen und Suchmaschinen benannt. Sie müssen wie XNXX jetzt auch die strengsten Vorschriften des Gesetzes über digitale Dienste innerhalb von vier Monaten nach der Notifizierung (das heißt bis Mitte November 2024) einhalten. Zu diesen Verpflichtungen gehört unter anderem zu verhindern, dass Minderjährige Zugang zu pornografischen Online-Inhalten bekommen.
XNXX muss auch alle systemischen Risiken, die sich aus ihren Diensten ergeben, ordnungsgemäß bewerten und mindern. Dazu gehören etwa Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung illegaler Inhalte oder negative Auswirkungen auf das geistige und körperliche Wohlbefinden des Nutzers. Bis Mitte November 2024 muss XNXX seinen ersten Risikobewertungsbericht vorlegen.
Die Kommission hatte bereits im Dezember 2023 drei weitere Plattformen für erwachsene Inhalte benannt: Pornhub, Stripchat und Xvideos. Die Überwachung und Durchsetzung des DSA wird von der Kommission und den Koordinatoren für digitale Dienste geteilt, die von den Mitgliedstaaten bis zum 17. Februar 2024 benannt werden mussten. vis

Basierend auf Daten der Europäischen Kommission ist die EU derzeit bei mehr als 80 Prozent der digitalen Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Diese sich immer weiter verschärfenden einseitigen Abhängigkeiten von großen Tech-Konzernen – vorrangig aus den USA und China – müssen als klarer Handlungsaufruf für die neue EU-Kommission verstanden werden. Denn sie sind nicht nur alarmierend für Europa als Wirtschaftsstandort. Sie machen uns auch politisch verwundbar. Die Folgen einer solchen Abhängigkeit wurden uns bereits im Energiesektor vor Augen geführt.
Um Europas Digitale Souveränität zu sichern, brauchen wir eigene digitale Produkte “made in Europe”. Dafür sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) von zentraler Bedeutung, denn die Digitalwirtschaft in Europa ist mittelständisch geprägt. IT-Mittelstandsunternehmen stellen die Mehrzahl der Arbeitsplätze und Innovationen in Europa – es sind eben nicht IT-Konzerne. Die Unabhängigkeit, Freiheit und Wachstumschancen für diese Unternehmen müssen deshalb oberste Prioritäten einer europäischen Digitalpolitik sein, die zum Ziel hat, dass wir unsere digitale Zukunft selbstbestimmt gestalten.
Die Notwendigkeit für Digitale Souveränität hat die EU bereits erkannt. So taucht sie als Zielsetzung in diversen Strategien auf. Bei der Übersetzung in politische Maßnahmen wird dieses Ziel allerdings oft verfehlt. Warum? Weil sie sich zu sehr auf die Regulierung der Großkonzerne aus Übersee, zu wenig aber auf die Entfaltung der eigenen Potenziale konzentrieren.
So hat die Digitalpolitik der ablaufenden EU-Legislatur vor allem eine dramatische Ausweitung von Regulierungen im digitalen Bereich mit sich gebracht – darunter der AI Act, der Cyber Resilience Act oder die NIS2-Richtlinie. Diese sind oftmals mit bürokratischem Aufwand und Compliance-Kosten verbunden, die für die Großkonzerne, die sie vorrangig treffen sollen, leicht zu stemmen sind. Hart getroffen werden stattdessen KMU, für die die Kosten und Bürokratie echte Hürden sind. Damit wird also die Innovationskraft gerade jener Unternehmen eingeschränkt, die unerlässlich für Europas digitale Wertschöpfung und Unabhängigkeit sind.
Angesichts der digitalen Notlage Europas ist es nun höchste Zeit für ein Umdenken in der europäischen Digitalpolitik – höchste Zeit für einen Digital New Deal, der die Potenziale des IT-Mittelstands nutzt. Grundlage dafür ist eine Förderung digitaler Geschäftsmodelle unter anderem durch Regulierungsstopp und Bürokratieabbau, KMU brauchen mehr Freiheit für Innovation. Weiterhin müssen die Stärken des IT-Mittelstands, insbesondere für die Gestaltung von Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, gezielt genutzt werden, damit wir diese in Zukunft weiter mitgestalten können, statt in eine reine Anwenderrolle zu geraten.
Was die mittelständisch geprägte IT-Branche Europas von internationalen Tech-Konzernen abhebt, sind Spezialisierung und Nischenexpertise statt einer generalistischen Ausrichtung für einen möglichst breiten Anwenderkreis. Dieses Erfolgsmodell hat bereits zahlreiche europäische Mittelständler aus traditionellen Branchen, etwa der Industrie, in ihrer hochspezialisierten Ausrichtung zu weltweit bewunderten Nischen-Weltmarktführern gemacht und lässt sich durchaus auf digitale Geschäftsmodelle übertragen.
Digitalisierung “made in Europe” bedeutet daher gezielte und maßgeschneiderte IT-Lösungen, die auf branchenspezifische Bedürfnisse eingehen, anstatt alle Branchen abdecken zu wollen. So können wir an der Gestaltung von Zukunftstechnologien teilhaben, ohne Erfolge aus Silicon Valley nachbauen zu wollen, zum Beispiel mit der Förderung europäischer spezialisierter vertikaler KI-Modelle oder von Nischen wie europäischer Cybersecurity-Software.
Die Spezialisierung für IT-Lösungen kann auf vielen Nischen aufsetzen – sei es öffentliche Verwaltung, Medizin oder Buchhaltung -, bietet aber nach dem Best-of-Breed-Ansatz jeweils eine Lösung mit viel höherem Nutzen für den Kunden. So können wir weltmarktführende digitale Produkte entwickeln, die echte Probleme lösen, statt nur die nächste globale Plattform als vermeintliche All-in-One-Lösung auf den Markt zu bringen.
Neben mehr Freiheit für digitale Innovationen durch einen Regulierungsstopp und Bürokratieabbau sollte also in einem Digital New Deal ein neues Leitmotiv der maßgeschneiderten Digitalisierung in Branchen aufgenommen werden, um die Erfolgsgeschichte der klassischen KMU in das digitale Zeitalter zu projizieren. Den Blick in der Digitalpolitik ausschließlich auf die eigenen wenigen Big Player zu legen, in der Hoffnung auf ein eigenes Silicon Valley, wäre eine vertane Chance. Stattdessen muss sich Europa auf seine digitale DNA besinnen und Spezialisierung zum Standard machen.
Oliver Grün ist Gründer und Mehrheitsgesellschafter der GRÜN Group sowie Präsident des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. und Präsident des IT-Mittelstand-Europaverbandes European DIGITAL SME Alliance.
bereits in der zweiten Woche der ungarischen Ratspräsidentschaft kommen heute und morgen in Budapest die EU-Umwelt- und Klimaminister zusammen. Wobei, von den Umweltministern kann kaum die Rede sein. Die Bundesregierung lässt sich durch Staatssekretäre aus dem Auswärtigen Amt und dem Bundesumweltministerium vertreten. Scheinbar besteht wenig Interesse an einem Austausch auf Ministerebene mit den Ungarn, womöglich auch wegen der geopolitischen Alleingänge von Viktor Orbán.
Dabei sind die Themen dieses informellen Umweltrates durchaus relevant, denn die Ratspräsidentschaft hat einen Austausch zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz in Baku (COP29) auf die Agenda gesetzt. Auch die aserbaidschanische COP-Präsidentschaft ist eingeladen, was zeigt, wie wichtig Ungarn die COP29 und das dort zu verhandelte Klimafinanzierungsziel ist.
Die eigenen Klimaziele der EU für 2035 und 2040 werden dagegen nicht in einem eigenen Agendapunkt besprochen. Die Bundesregierung und andere Mitgliedstaaten werden sich in ihren Wortbeiträgen dennoch für “wissenschaftsbasierte” Ziele einsetzen. Auch wenn es in Berlin noch keine geeinte Position für ein Prozentziel gibt, deutet dies auf mindestens 90 Prozent CO₂-Reduktion bis 2040 im Vergleich zu 1990 hin – der wissenschaftliche EU-Klimabeirat hatte 90 bis 95 Prozent empfohlen.
Des Weiteren soll in Budapest die Zukunft des Green Deals erörtert werden. Es sieht danach aus, dass er einen stärker industriepolitischen Fokus erhält und in der kommenden Legislatur in ein Maßnahmenpaket für eine grüne Wirtschaft umgewandelt wird. Dafür sprechen sich sowohl in Brüssel die Unterstützerfraktionen der neuen EU-Kommission als auch die Regierungen in vielen Hauptstädten aus. Beschlüsse hierzu wird es bei diesem informellen Treffen aber ohnehin nicht geben.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Am kommenden Montagabend spricht Christian Lindner in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Brüssel. Das Thema seiner Rede: die Zukunft der Kohäsionspolitik. Der Bundesfinanzminister will eine Studie vorstellen und zugleich eine klare Botschaft senden: Statt reflexhaft mehr Geld für den EU-Haushalt zu fordern, sollten die bestehenden Ausgabenprogramme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Das gilt vor allem für die europäische Regionalpolitik – mit 392 Milliarden Euro für sieben Jahre der größte Ausgabenblock im laufenden EU-Finanzrahmen.
Ähnliche Botschaften hat der FDP-Politiker gebetsmühlenartig in den Verhandlungen zum Bundeshaushalt wiederholt. Im kommenden Jahr beginnen nun die Gespräche über den neuen EU-Finanzrahmen, der die Jahre 2028 bis 2034 umfasst. Und Lindner will frühzeitig einen Pflock einschlagen. Aus seiner Sicht fordern andere Regierungen zu leichtfertig eine Ausdehnung des EU-Haushalts oder neue europäische Schuldenprogramme.
In der Kohäsionspolitik ließe sich aus Lindners Sicht Geld einsparen, um neue politische Prioritäten wie Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit zu finanzieren. Die Fakten dafür soll die Studie liefern. Die hat das Bundesfinanzministerium beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Experten aus anderen Staaten in Auftrag gegeben. Die Wissenschaftler um ZEW-Finanzexperte Friedrich Heinemann werden ihre rund 400 Seiten starke Untersuchung am Montagabend an die zuständigen Kommissare Elisa Ferreira (Kohäsion) und Johannes Hahn (Budget) übergeben.
Dem Vernehmen nach konstatiert die Studie eine getrübte Erfolgsbilanz der Kohäsionsfonds. Insbesondere mittel- und osteuropäische Regionen haben mithilfe der Gelder aus Brüssel zwar wirtschaftlich schnell aufgeholt. Aber in anderen Gegenden wie Süditalien habe die Förderung wenig bewirkt: Dysfunktionale Strukturen, eine wenig leistungsfähige Verwaltung sowie Korruption bremsen dort die Entwicklung aus.
In einem kürzlich vorgestellten Papier kritisierten ZEW-Forscher bereits, der Erfolg der Fördermaßnahmen werde nicht ausreichend transparent und unabhängig überprüft. Kritik an den Kontrollen äußerte gerade auch der Europäische Rechnungshof.
Die Diskussion über die Wirksamkeit der Strukturpolitik, die Lindner anschieben will, ist allerdings nicht neu. Immer wieder haben wohlhabendere Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahrzehnten die milliardenschweren Programme infrage gestellt, die zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und zur Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Regionen in der EU beitragen sollen. Und stets haben sie sich die Zähne ausgebissen am Widerstand der weniger entwickelten Staaten. Diese sehen die Zahlungen aus Brüssel als Interessenausgleich zum Binnenmarkt, der insbesondere exportstarken Unternehmen aus Ländern wie Deutschland nutzt.
In den deutschen Bundesländern, den hiesigen Profiteuren der Zahlungen aus Brüssel, wird Lindners Vorstoß daher gelassen gesehen. Für deutlich größere Unruhe sorgen dort die Pläne von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Strukturfonds nach dem Vorbild der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) aus der Corona-Pandemie neu auszurichten. So könne die Auszahlung an Bedingungen wie konkrete Reformen in den Empfängerländern geknüpft werden, sagte sie im Mai in einem Interview. Die Kombination aus Reformen und Investitionen habe Ländern wie Italien, Griechenland oder Portugal Wachstum gebracht.
Im Generalsekretariat der Kommission und in der Generaldirektion Budget wird bereits an konkreten Plänen dafür gearbeitet, wie es in informierten Kreisen heißt. Die für die Verwaltung der Strukturfonds zuständige DG Regio sei weitgehend außen vor.
In den Bundesländern schrillen deshalb die Alarmglocken. Sie befürchten, nicht mehr selbst entscheiden zu können, ob sie Radwege, Naturschutzgebiete oder einen Start-up Campus mithilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder mithilfe des Kohäsionsfonds finanzieren wollen. Bei einem Treffen im Juni warnten die Europaminister der Länder einhellig davor, die Förderinstrumente auf die nationale oder EU-Ebene zu verlagern.
Um Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität zu erhalten, mussten die nationalen Regierungen umfassende Maßnahmenpläne bei der Kommission einreichen und sich genehmigen lassen. Die Bundesländer seien dabei nur angehört, aber nicht ernsthaft eingebunden worden, kritisiert ein hochrangiger Vertreter eines Landes. Dieses Modell auf die Kohäsionsfonds zu übertragen, bedeute eine weitreichende Zentralisierung.
In Brüssel wird versucht, den Bedenken entgegenzukommen. So könnten die Regionen bei der Formulierung der Prioritäten stärker eingebunden werden als beim ARF geschehen, heißt es in EU-Kreisen.
In der Bundesregierung gibt es Sympathien dafür, sich am ARF-Ansatz zu orientieren. “Es hat echte Veränderungen bewirkt, die Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität an die Umsetzung von Reformen und Meilensteinen in den Mitgliedstaaten zu knüpfen”, sagt der Staatssekretär im zuständigen Bundeswirtschaftsministerium, Sven Giegold. “Wir sollten ernsthaft darüber diskutieren, dieses Prinzip auf die Kohäsionspolitik zu übertragen.” Dies bedeute keine Zentralisierung der Mittelvergabe.
Auch in Berlin gibt es aber große Bedenken, der Kommission eine ähnlich starke Rolle bei der Vergabe der Kohäsionsgelder einzuräumen wie beim ARF. Für völlig illusorisch hält man dort, dass die Behörde in Brüssel selbst über Tausende von Förderbescheiden entscheidet, was bislang Sache der Regionen und Kommunen ist. Wer daran rüttele, lege sich mit sämtlichen Städten und Regionen an, heißt es warnend in Berlin. Zudem lebt eine ganze Industrie aus Wirtschaftsförderern und Projektevaluierern von den EU-Fonds. Ob die Politik wirklich ernst macht mit einer Reform, muss sich daher erst zeigen.
Erste Umrisse der chinesischen Reaktion im Zollstreit mit der EU zeichnen sich ab. Am Mittwoch hat das chinesische Handelsministerium eine Untersuchung von Handelshemmnissen aufseiten der EU angekündigt. Die Untersuchung war schon länger geplant: Ende Juni bereits hat ein Sprecher des Ministeriums die Prüfung eines entsprechenden Antrags des chinesischen Verbands für Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten (CCCME) angekündigt.
Die Untersuchung folgt einem festgelegten Mechanismus, den die chinesische Regierung auch auf ihrer Homepage transparent macht. Bisher wurde dieser Mechanismus nur vier Mal angewandt – unter anderem gegen die USA und gegen Japan. Wenn die Prüfung ergibt, dass die EU ihren Markt in unangemessener Weise gegenüber China verschließt, hat das Handelsministerium demnach drei verschiedene Optionen:
Der dritte Punkt lässt alle Möglichkeiten offen – inklusive Gegenmaßnahmen und anderen unangenehmen Eskalationen. Die Ermittlung sei in Brüssel zur Kenntnis genommen worden, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit.
Die Untersuchung soll sechs Monate dauern. Die Ankündigung lässt grundsätzlich offen, um welche Branchen und Handelshemmnisse es geht. Klar, dass die E-Auto-Zölle gemeint sind. Es geht aber allgemein um “Handels- und Investitionshemmnisse im Zusammenhang mit den Praktiken der EU bei der Untersuchung chinesischer Unternehmen im Rahmen des Beschlusses zur Überprüfung ausländischer Subventionen”. In der Mitteilung des Ministeriums sind ausdrücklich auch genannt:
Auf den ersten Blick gelten hier keine allgemeinen Marktbarrieren. In der Solarbranche hat die EU zuletzt davon Abstand genommen, Zölle zu prüfen. Auch in der Windkraft hat die EU vorerst auf ein Verfahren verzichtet.
Doch zugleich ist ein Muster zu erkennen. Es handelt sich in allen Fällen um Branchen, in denen die EU eine Anti-Subventionsuntersuchung eingeleitet hat. Dieses Instrument besitzt sie seit fast genau einem Jahr, in Kraft trat die Foreign Subsidies Regulation (FSR) im Juli 2023. Es stört die chinesische Seite besonders, weil es wesentlich schneller und zupackender ist als die guten alten Anti-Dumping-Untersuchungen, die sich oft ewig hinzogen. Zu den Prüfungen chinesischer Anbieter auf unangemessene staatliche Subventionen gehörten:
Als Erstes will das Ministerium nun ermitteln, inwiefern die EU dabei eine Reihe von Regeln verletzt, die China in den Durchführungsbestimmungen selbst definiert hat. Dazu gehört beispielsweise der Bruch von Verträgen zwischen den Volkswirtschaften, aber auch wachsweiche Fälle wie beispielsweise: “Verursachung von Markteintrittsbarrieren” oder “Schaden für die Wettbewerbsfähigkeit [chinesischer] Firmen”. Sehr weit gefasst ist auch der Punkt: “[Die Handelsmaßnahme] könnte die Exportchancen für ein [chinesisches] Produkt behindern”.
Die Instrumente zur Prüfung des Sachverhalts auf chinesischen Seite sind:
Sie ähneln damit den Instrumenten, mit denen die EU die chinesische Fahrzeugindustrie zur Festlegung der E-Auto-Zölle unter die Lupe genommen hat.
China macht damit klar, dass es die EU-Zölle keineswegs klaglos als fair akzeptiert, wie Handelskommissar Valdis Dombrovskis gehofft hat. Es wird schon aus Prinzip eine handfeste Reaktion aus Peking geben, die sich nicht auf einzelne Produkte wie Cognac oder Schweinefleisch beschränkt. China will zeigen: Es lässt nicht alles mit sich machen.
Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es zu einer unkontrollierten Spirale immer höherer Zölle und anderer Barrieren kommt. Auch gegenüber den USA hat China in der Regel mit einer ungefähr gleichwertigen Handelsmaßnahme geantwortet, als erst Donald Trump, dann Joe Biden immer neue Zölle und Beschränkungen verhängt haben.
Peking ist auf den Export angewiesen und hat kein Interesse an geschlossenen Märkten, wie es selbst immer wieder betont hat. Auch gegenüber der EU wird China vermutlich nach dem Prinzip vorgehen: wie du mir, so ich dir.
12.07.2024 – 09:00-18:00 Uhr, Fiesole (Italien)
FSR, Conference 1st Florence Aviation Regulation Conference
The Florence School of Regulation (FSR) discusses current economic and regulatory policies relating to air transport and identifies regulatory challenges on the horizon. INFOS & REGISTRATION
12.07.2024 – 19:00-20:30 Uhr
DGAP, Podiumsdiskussion 20 Jahre EU-Osterweiterung: Chancen und Herausforderungen
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) blickt auf den Prozess der EU-Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Staaten zurück. INFOS & ANMELDUNG
15.07.2024 – 17:30-18:30 Uhr, online
DGAP, Diskussion Desinformation: Der Kampf um die Wahrheit
Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) geht der Frage nach, warum Desinformation derzeit so viele Abnehmer findet. INFOS & ANMELDUNG
16.07.-19.07.2024, Aspen, Colorado (USA)
AI Aspen Security Forum
The Aspen Institute (AI) explores new collaborations across government, private industry, and civil society to tackle global challenges. INFOS & REGISTRATION
16.07.2024 – 18:30-20:30 Uhr, Hamburg
KAS, Diskussion Moskaus Weg in die Abhängigkeit: Die russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beleuchtet die chinesisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen und das Verhältnis zwischen China und dem Westen, das von zunehmenden Belastungen überschattet wird. INFOS & ANMELDUNG
EVP, S&D, Renew und Grüne haben sich auf eine Verteilung der Posten verständigt, die nach D’Hondt der rechtsradikalen Fraktion “Patrioten für Europa” zustehen würden. Nach jetzigem Verhandlungsstand soll der Vize-Präsidentenposten an die Sozialisten gehen, der Quästoren-Posten an Renew. Den Anspruch, den Vorsitz im Verkehrsausschuss (TRAN) zu stellen, ginge an die Christdemokraten. Hier ist der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke im Gespräch. Der Vorsitz im Kulturausschuss (CULT) soll an die Grüne-Fraktion gehen.
In der Woche ab 22. Juli konstituieren sich die Ausschüsse. EVP, S&D, Renew und Grüne haben verabredet, Kandidaten der “Patrioten” für die Posten nicht zu wählen und stattdessen gemeinsam eigene Kandidaten durchzubringen. Dieses Verfahren wird Cordon sanitaire genannt. Hier ist der derzeitige Verhandlungsstand abgebildet. Änderungen sind noch möglich.
Die Mehrheitsverhältnisse der Fraktionen am 4. Juli waren maßgeblich für die Verteilung der Posten durch die Verwaltung des Europaparlaments auf die sieben Fraktionen. Am 4. Juli hatte sich die Fraktion der “Patrioten” noch nicht gegründet. Entscheidend für den rechnerischen Anspruch der “Patrioten” waren die 58 Sitze der ID-Fraktion, die dann in den “Patrioten” aufgegangen ist.
Die Bildung der Fraktion “Europa der souveränen Nationen” am Mittwoch kam zu spät für die Postenverteilung im Europaparlament. Sie kommt bei den Ausschussvorsitzen und Posten für Vizepräsidenten nicht zum Zuge. mgr
Die am Mittwoch gegründete Fraktion “Europa der souveränen Nationen” hat 25 Mitglieder. 14 davon kommen von der AfD, die sich mit Wirrköpfen, Russlandfreunden und EU-Hassern zusammengetan haben. Maximilian Krah bleibt außen vor. Damit wird das Europaparlament in die neue Wahlperiode mit acht Fraktionen starten. Da die Frist für die Verteilung der Posten verstrichen ist, geht die zweite Rechtsaußenfraktion ohne Anspruch auf Ausschussvorsitze und andere Posten an den Start. Ihre Mitglieder haben lediglich je einen Sitz in einem Ausschuss. Die Fraktion wird geführt von René Aust (AfD).
In Kreisen der AfD-Zentrale in Berlin gibt es Kritik. Die Bildung einer Fraktion mit sehr kleinen Delegationen sei eine “Verzwergung”. Bisher hatte die AfD in Brüssel etwa mit Frankreichs Rassemblement National kooperiert. Jetzt bildet sie eine Fraktion mit Splittergruppen und Einzelkämpfern, deren politisches Profil vielfach wirr ist. Die Fraktion wird auch “Hooligan”-Truppe genannt. Damit werde dauerhaft die Brücke zu Fidesz und Marine Le Pen abgerissen.
Zur Fraktion gehören etwa drei Abgeordnete der polnischen Konfederacja. Die Partei setzt sich dafür ein, dass die Einkommensteuer abgeschafft wird. Sozialbeiträge sollen künftig nur auf freiwilliger Basis gezahlt werden. Homosexualität wird drastisch abgelehnt. Die Partei will die Todesstrafe in Polen für Kapitalverbrechen wieder einführen.
Drei Abgeordnete bringt zudem die bulgarische Wasraschdane ein. Der Parteiname bedeutet Wiedergeburt. Die Gruppierung ist prorussisch, sie kämpft gegen die Einführung des Euro in Bulgarien und ist gegen Covid-Impfen. Auf ihr Konto geht die versuchte Erstürmung des bulgarischen Parlaments 2022, Farbwürfe gegen eine EU-Vertretung und Störaktionen gegen einen Film über Homosexualität unter Jugendlichen. fak/mgr
Im Lager von Emmanuel Macron und Teilen der konservativen Partei Républicains gibt es Bestrebungen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. So wollen sie das Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) ausbooten, das aus den Parlamentswahlen als stärkste Kraft hervorgegangen ist. Diese Option wird vom ehemaligen Premierminister Edouard Philippe, Bruno Retailleau, Fraktionsvorsitzender der Républicains im Senat, und von Innenminister Gérald Darmanin unterstützt, der zum Macron-Lager gehört. Sollte diese Koalition zustande kommen, wird Gérald Darmanin als nächster Premierminister gehandelt.
Die Idee spaltet sowohl die konservative Partei Républicains als auch die Macronisten-Partei Ensemble. Mehrere Minister und Abgeordnete aus dem linken Ensemble-Lager haben bereits angekündigt, dass sie sich von der Partei abspalten würden, wenn es zu einem solchen Bündnis kommen sollte.
Der Vorsitzende der zentristischen MoDem-Fraktion, François Bayrou, befürwortet eine breitere Koalition. Er verlangt, dass Macron einen Premierminister ernennt, der “die Menschen zusammenbringen kann”. Auf der rechten Seite verteidigt Laurent Wauquiez, der Chef der Républicains-Fraktion wird, eine Linie “ohne Kompromisse” mit dem Lager von Präsident Macron.
Die Linke ihrerseits forderte Emmanuel Macron erneut auf, “das Ergebnis der Parlamentswahlen zu respektieren”, indem er einen Premierminister aus den Reihen der NFP ernennt. Die Verhandlungen zwischen den verschiedenen Parteien werden fortgesetzt, um sich auf einen Namen zu einigen. Das Lager von France Insoumise um Jean-Luc Mélenchon und die Parti Socialiste versuchen jeweils, das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Präsident Emmanuel Macron, der derzeit zum Nato-Gipfel in den USA ist, veröffentlichte am Mittwoch einen “Brief an die Franzosen”. Darin fordert er “alle politischen Kräfte, die sich zu den republikanischen Institutionen, dem Rechtsstaat, dem Parlamentarismus, einer europäischen Ausrichtung und der Verteidigung der französischen Unabhängigkeit bekennen, auf, einen aufrichtigen und loyalen Dialog zu führen”. Er macht die Ernennung eines Premierministers von der Schaffung einer “notwendigerweise pluralistischen” Mehrheit in der Nationalversammlung abhängig, was die Tür für eine breite Koalition offenlässt. cst
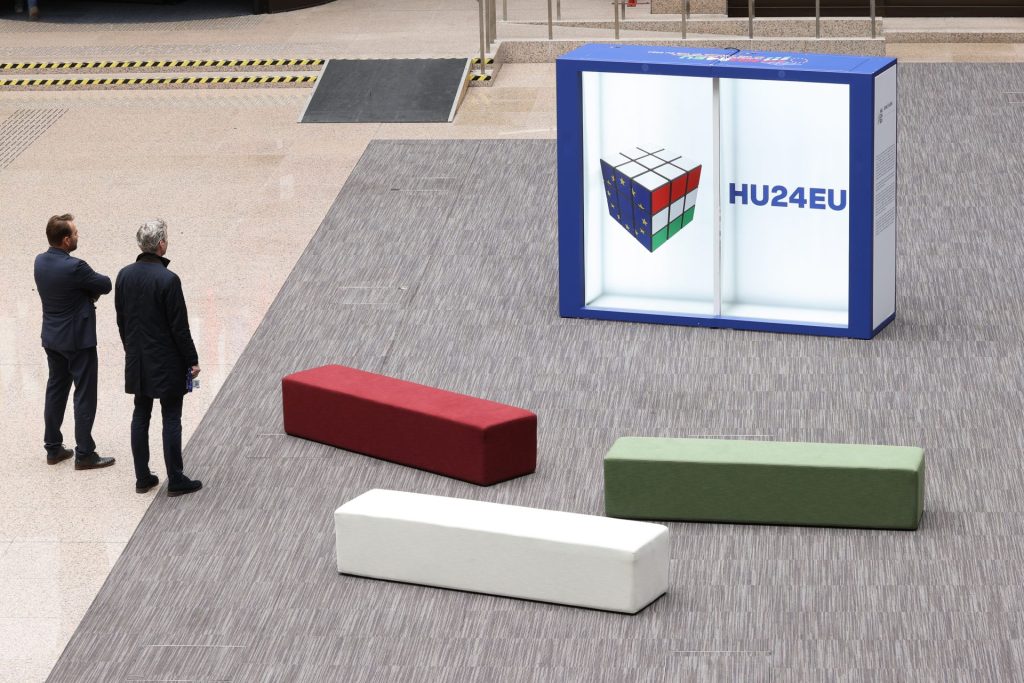
Der ungarische Premierminister Viktor Orbán sorgte mit seiner Reise nach Moskau und Peking für Unmut in Brüssel. An der Sitzung der Ständigen Vertreter (AStV) am gestrigen Mittwoch hob der polnische Botschafter deshalb das Verhalten der ungarischen Ratspräsidentschaft auf die Sitzungsagenda – nur zehn Tage nach Beginn der Präsidentschaft.
In einer zweieinhalbstündigen Diskussion kritisierten die ständigen Vertreter von 25 Mitgliedstaaten die Reise Orbáns. Neben Ungarn enthielt sich laut Brüsseler Quellen nur die Slowakei der Kritik am ungarischen Verhalten. Die EU-Diplomaten sprechen von einem tiefen Vertrauensbruch.
In der AStV-Sitzung argumentierte Ungarn, dass Orbáns Gespräche rein bilateraler Natur waren und dazu dienen sollten, die Machbarkeit eines Waffenstillstands zu eruieren. Ebenfalls am Mittwoch stellte sich der ungarische Minister für Europäische Angelegenheiten, János Bóka, den Medien und verteidigte Orbáns Vorgehen. Es gäbe keine Pflicht, die EU und die Mitgliedstaaten im Vorhinein über bilaterale Treffen zu informieren oder zu konsultieren, sagte er.
EU-Diplomaten widersprechen diesem Argument jedoch. Ungarn habe die Grenzen bewusst verwischt, unter anderem, indem Orbán in seinen Beiträgen über die Reise in den sozialen Medien die Hashtags und das Logo der ungarischen Ratspräsidentschaft benutzt habe. Mit seiner Reise handelte Orbán “gegen den Geist und den Text der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats”, sagte ein EU-Diplomat Table.Briefings.
Der Rechtsdienst des EU-Rats argumentierte in der AStV-Sitzung laut Brüsseler Quellen, dass Ungarn gegen das Loyalitätsgebot verstoßen habe. Dabei geht es nicht nur um Orbáns Verhalten in Moskau und Peking, sondern auch um seine Reise zum Treffen der Turkstaaten. Dort habe der ungarische Premier Positionen bezüglich Nordzypern vertreten, die nicht im Einklang mit EU-Positionen stehen und besonders Zypern und Griechenland verärgerten.
Bei seiner Pressekonferenz in Brüssel versuchte Europa-Minister Bóka, die ungarische Ratspräsidentschaft von der ungarischen Regierung zu unterscheiden. Die ungarische Regierung habe zwar einen sehr “charakteristischen” Stil, dies sei aber “nicht unversöhnlich” mit einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft.
Mit seiner Einschätzung dürfte Bóka in Brüssel zwar relativ allein dastehen, aber harte Maßnahmen gegen Ungarn sind aktuell dennoch nicht in Sicht. Trotz der Kritik im AStV wurde von keinem Botschafter vorgeschlagen, die ungarische Präsidentschaft vorzeitig abzubrechen. Vor dem Start der ungarischen Ratspräsidentschaft hätte eine superqualifizierte Mehrheit von 20 Mitgliedstaaten für so ein Vorgehen gereicht, nun ist es unklar.
Die Mitgliedstaaten überlegen sich deshalb niederschwellige Maßnahmen, zum Beispiel das Fernbleiben von informellen Ratstreffen. Diese finden traditionell im Mitgliedstaat statt, der die Ratspräsidentschaft innehat. Schon der informelle Wettbewerbsfähigkeitsrat in Budapest zu Beginn dieser Woche fand ohne Teilnahme des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck und des französischen Industrieministers Roland Lescure statt. jaa/sti
Nun ist es offiziell: Der rechtspopulistische Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever, soll die nächste Föderalregierung in Belgien bilden. Dies teilte König Philippe am Mittwoch nach einer kurzen Unterredung mit De Wever im Königspalast in Brüssel mit. Bis zum 24. Juli soll der flämische Nationalist seine Sondierungen beendet haben und dann erneut Bericht erstatten.
Wenn die Mission gelingt, wird De Wever eine Fünf-Parteien-Koalition führen, die bereits auf den Namen “Arizona” getauft wurde. Neben seiner flämischen Partei N-VA wären darin die flämischen Sozialdemokraten von Vooruit, die flämischen Christdemokraten der Cd&V sowie aus der Wallonie der liberale MR und die christdemokratische Partei Les Engagés vertreten.
Die letzte Hürde war am Dienstagabend gefallen, als die flämischen Sozialdemokraten sich zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen bereit erklärt hatten. Dies war umstritten, da ihre Genossen aus der Wallonie nicht in die Regierung eintreten wollen. De Wever habe die nötigen Garantien gegeben, hieß es bei Vooruit. Allerdings werde man an den sozialpolitischen Prioritäten festhalten.
Dass die Koalitionsverhandlungen zum Erfolg führen, ist nicht sicher. Vor allem die Parteien aus der französischsprachigen Wallonie haben noch Zweifel. Vor De Wever liege “noch ein langer Weg, er muss noch harte Arbeit leisten”, sagte MR-Chef Georges-Louis Bouchez. Allerdings sehe er keine unüberwindbaren Hürden. De Wever müsse zeigen, dass er bereit sei, für alle Belgier zu sprechen.
In der Vergangenheit war das nicht der Fall – im Gegenteil. Mit seiner N-VA hat De Wever jahrelang auf eine Schwächung der belgischen Föderation und auf eine weitgehende Autonomie seiner Region Flandern hingearbeitet. Auch bei der Wahl Anfang Juni hat die N-VA eine Staatsreform mit diesem Ziel versprochen. Als Premierminister wäre er hingegen ganz Belgien verpflichtet.
Die Tageszeitung “Le Soir” sieht noch ein weiteres Problem: De Wever müsse sich zwischen seinem bisherigen Amt als Bürgermeister von Antwerpen und dem möglichen neuen Job in der Rue de la Loi (dem Sitz des Premiers) entscheiden. Im Herbst sind in Belgien Kommunalwahlen. Wenn De Wever vorher die Regierungsgeschäfte übernimmt, könnte seine Partei Antwerpen an die Linke verlieren. ebo
Die Rückabwicklung des Green Deals verhindern und bereits beschlossene Klima- und Umweltgesetze umsetzen, das hat für Grünen-Fraktion im EU-Parlament oberste Priorität in der kommenden Legislaturperiode. Am Mittwoch beschlossen die Abgeordneten ein sechsseitiges Papier. Darin fordern sie:
Zur Frage, ob sie Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen werden, gaben sich die Grünen verhalten positiv. Die EVP-Kandidatin scheint sich in der rund zweieinhalbstündigen Sitzung mit den Grünen gut geschlagen zu haben. Ausschlaggebend werden aber die schriftlich festgelegten Prioritäten sein, die von der Leyen in der kommenden Woche präsentieren wird, meinten die grünen Fraktionsvorsitzenden Bas Eickhout und Terry Reintke nach der Sitzung.
In ihrem Positionspapier fordern die Grünen die Kommission zudem auf, den Artikel 7(2) der EU-Verträge gegen Ungarn anzuwenden und ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. EU-Gelder dürften “nicht in den Taschen von Autokraten und ihren Freunden verschwinden”.
Im Israel-Gaza-Konflikt fordern sie, dass sich Brüssel vermehrt für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt und den Friedensprozess vorantreibt. Um Frieden in der eigenen Nachbarschaft zu fördern, solle die EU mit dem Erweiterungsprozess voranschreiten. luk
Die CDU/CSU-Gruppe in der EVP möchte der europäischen Stahlindustrie unter die Arme greifen – und schlägt deswegen einen europäischen Stahlpakt als Teil eines neuen Industrial Deals vor. “Eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie in der EU ist essenziell für Wohlstand, die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten, Beschäftigung, wirtschaftliche Sicherheit und die grüne Transformation”, heißt es in dem Papier, das Industriepolitiker Christian Ehler und Arbeitsmarktexperte Dennis Radtke am Mittwoch vorstellten.
Auf der Nachfrageseite sieht das Konzept Folgendes vor: Als Sofortmaßnahme müssten bei öffentlich geförderten Projekten, einschließlich der European Hydrogen Bank, ein Mindestanteil ‘European Content’ vorgeschrieben werden. Der NZIA solle erweitert werden, sodass sich dort künftig “verbindliche Herkunftskriterien für Grundstoffe im Rahmen der öffentlichen Beschaffung und der Auktionen” finden. Das unter der Vorgabe, dass sich die Zielvorgaben der Beschaffung nicht signifikant verteuerten. Zudem soll es ein EU-weites Labeling geben, das die Differenzierung ermögliche.
Gerade in der öffentlichen Beschaffung gäbe es “Potenziale durch die Einführung einer Quotenregelung, solange diese praxistauglich und ökonomisch sinnvoll ist”, heißt es im Papier. Auch im Privatsektor könne bereits “durch eine geringe Quote ein internationaler Absatzmarkt geschaffen und gleichzeitig der CO₂-Fußabdruck von Endprodukten verringert werden”.
Auch an der Preisschraube für Energie wollen die Parlamentarier drehen. Und zwar insbesondere, in dem die Regeln für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff gelockert werden. Der bis 2030 vorgesehene Übergangszeitraum mit weniger strengen Anforderungen an die Zeitgleichheit der Grünstrom- und Wasserstoffproduktion solle bis mindestens 2035 verlängert werden. Gleichzeitig müsste der Einsatz von Wasserstoff in Europa praxistauglicher möglich sein und zwar unabhängig von der Farbe, heißt es in dem Papier.
Trotz internationaler Kritik an dem CO₂-Grenzausgleichsmechanismus der EU – am CBAM halten CDU/CSU fest. Der CBAM soll unter anderem in der Stahlbranche vor Carbon Leakage schützen, indem Stahl-Importeure in den Binnenmarkt schrittweise zur Abgabe des europäischen CO₂-Preises aufgefordert werden, während parallel die kostenlosen CO₂-Zertifikate für die europäischen Hersteller wegfallen.
Die Union fordert im Rahmen des europäischen Stahlpakts jedoch Verbesserungen, und zwar noch bevor Abgaben im Rahmen des CBAM 2026 fällig werden:
Sollten diese Anpassungen nicht kommen, wollen CDU/CSU das Abschmelzen der kostenlosen CO₂-Zertifikate pausieren. lei/luk
Die Kommission hat die Sexplattform XNXX nach dem Digital Services Act (DSA) als sehr große Online-Plattform (VLOP) benannt. XNXX ist eine Plattform für erwachsene Inhalte mit durchschnittlich mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern in der EU. Die Zahl der Nutzer, die XNXX der Kommission mitgeteilt hat, liegt damit über dem Schwellenwert für die Benennung als VLOP.
Inzwischen hat die Kommission 25 sehr große Plattformen und Suchmaschinen benannt. Sie müssen wie XNXX jetzt auch die strengsten Vorschriften des Gesetzes über digitale Dienste innerhalb von vier Monaten nach der Notifizierung (das heißt bis Mitte November 2024) einhalten. Zu diesen Verpflichtungen gehört unter anderem zu verhindern, dass Minderjährige Zugang zu pornografischen Online-Inhalten bekommen.
XNXX muss auch alle systemischen Risiken, die sich aus ihren Diensten ergeben, ordnungsgemäß bewerten und mindern. Dazu gehören etwa Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung illegaler Inhalte oder negative Auswirkungen auf das geistige und körperliche Wohlbefinden des Nutzers. Bis Mitte November 2024 muss XNXX seinen ersten Risikobewertungsbericht vorlegen.
Die Kommission hatte bereits im Dezember 2023 drei weitere Plattformen für erwachsene Inhalte benannt: Pornhub, Stripchat und Xvideos. Die Überwachung und Durchsetzung des DSA wird von der Kommission und den Koordinatoren für digitale Dienste geteilt, die von den Mitgliedstaaten bis zum 17. Februar 2024 benannt werden mussten. vis

Basierend auf Daten der Europäischen Kommission ist die EU derzeit bei mehr als 80 Prozent der digitalen Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Diese sich immer weiter verschärfenden einseitigen Abhängigkeiten von großen Tech-Konzernen – vorrangig aus den USA und China – müssen als klarer Handlungsaufruf für die neue EU-Kommission verstanden werden. Denn sie sind nicht nur alarmierend für Europa als Wirtschaftsstandort. Sie machen uns auch politisch verwundbar. Die Folgen einer solchen Abhängigkeit wurden uns bereits im Energiesektor vor Augen geführt.
Um Europas Digitale Souveränität zu sichern, brauchen wir eigene digitale Produkte “made in Europe”. Dafür sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) von zentraler Bedeutung, denn die Digitalwirtschaft in Europa ist mittelständisch geprägt. IT-Mittelstandsunternehmen stellen die Mehrzahl der Arbeitsplätze und Innovationen in Europa – es sind eben nicht IT-Konzerne. Die Unabhängigkeit, Freiheit und Wachstumschancen für diese Unternehmen müssen deshalb oberste Prioritäten einer europäischen Digitalpolitik sein, die zum Ziel hat, dass wir unsere digitale Zukunft selbstbestimmt gestalten.
Die Notwendigkeit für Digitale Souveränität hat die EU bereits erkannt. So taucht sie als Zielsetzung in diversen Strategien auf. Bei der Übersetzung in politische Maßnahmen wird dieses Ziel allerdings oft verfehlt. Warum? Weil sie sich zu sehr auf die Regulierung der Großkonzerne aus Übersee, zu wenig aber auf die Entfaltung der eigenen Potenziale konzentrieren.
So hat die Digitalpolitik der ablaufenden EU-Legislatur vor allem eine dramatische Ausweitung von Regulierungen im digitalen Bereich mit sich gebracht – darunter der AI Act, der Cyber Resilience Act oder die NIS2-Richtlinie. Diese sind oftmals mit bürokratischem Aufwand und Compliance-Kosten verbunden, die für die Großkonzerne, die sie vorrangig treffen sollen, leicht zu stemmen sind. Hart getroffen werden stattdessen KMU, für die die Kosten und Bürokratie echte Hürden sind. Damit wird also die Innovationskraft gerade jener Unternehmen eingeschränkt, die unerlässlich für Europas digitale Wertschöpfung und Unabhängigkeit sind.
Angesichts der digitalen Notlage Europas ist es nun höchste Zeit für ein Umdenken in der europäischen Digitalpolitik – höchste Zeit für einen Digital New Deal, der die Potenziale des IT-Mittelstands nutzt. Grundlage dafür ist eine Förderung digitaler Geschäftsmodelle unter anderem durch Regulierungsstopp und Bürokratieabbau, KMU brauchen mehr Freiheit für Innovation. Weiterhin müssen die Stärken des IT-Mittelstands, insbesondere für die Gestaltung von Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, gezielt genutzt werden, damit wir diese in Zukunft weiter mitgestalten können, statt in eine reine Anwenderrolle zu geraten.
Was die mittelständisch geprägte IT-Branche Europas von internationalen Tech-Konzernen abhebt, sind Spezialisierung und Nischenexpertise statt einer generalistischen Ausrichtung für einen möglichst breiten Anwenderkreis. Dieses Erfolgsmodell hat bereits zahlreiche europäische Mittelständler aus traditionellen Branchen, etwa der Industrie, in ihrer hochspezialisierten Ausrichtung zu weltweit bewunderten Nischen-Weltmarktführern gemacht und lässt sich durchaus auf digitale Geschäftsmodelle übertragen.
Digitalisierung “made in Europe” bedeutet daher gezielte und maßgeschneiderte IT-Lösungen, die auf branchenspezifische Bedürfnisse eingehen, anstatt alle Branchen abdecken zu wollen. So können wir an der Gestaltung von Zukunftstechnologien teilhaben, ohne Erfolge aus Silicon Valley nachbauen zu wollen, zum Beispiel mit der Förderung europäischer spezialisierter vertikaler KI-Modelle oder von Nischen wie europäischer Cybersecurity-Software.
Die Spezialisierung für IT-Lösungen kann auf vielen Nischen aufsetzen – sei es öffentliche Verwaltung, Medizin oder Buchhaltung -, bietet aber nach dem Best-of-Breed-Ansatz jeweils eine Lösung mit viel höherem Nutzen für den Kunden. So können wir weltmarktführende digitale Produkte entwickeln, die echte Probleme lösen, statt nur die nächste globale Plattform als vermeintliche All-in-One-Lösung auf den Markt zu bringen.
Neben mehr Freiheit für digitale Innovationen durch einen Regulierungsstopp und Bürokratieabbau sollte also in einem Digital New Deal ein neues Leitmotiv der maßgeschneiderten Digitalisierung in Branchen aufgenommen werden, um die Erfolgsgeschichte der klassischen KMU in das digitale Zeitalter zu projizieren. Den Blick in der Digitalpolitik ausschließlich auf die eigenen wenigen Big Player zu legen, in der Hoffnung auf ein eigenes Silicon Valley, wäre eine vertane Chance. Stattdessen muss sich Europa auf seine digitale DNA besinnen und Spezialisierung zum Standard machen.
Oliver Grün ist Gründer und Mehrheitsgesellschafter der GRÜN Group sowie Präsident des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. und Präsident des IT-Mittelstand-Europaverbandes European DIGITAL SME Alliance.
