bahnt sich da das nächste German Vote an? EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht zum Dienstag auf ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit geeinigt – ob die Ampel-Koalition die Einigung mitträgt, ist aber reichlich fraglich. Die FDP-Seite habe zuletzt politische Bedenken angemeldet, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Im Bundesfinanzministerium wird darauf verweisen, man wolle zunächst das Verhandlungsergebnis prüfen.
Die Minister der Freidemokraten hatten zuletzt bei einer ganzen Reihe von Dossiers eine Enthaltung der Bundesregierung erzwungen, das prominenteste ist die Lieferkettenrichtlinie CSDDD. Anders als dort oder auch bei der Plattformarbeit dürfte die Verordnung zur Zwangsarbeit aber auch ohne deutsche Zustimmung die nötige qualifizierte Mehrheit im Rat finden.
Noch offen ist, wie sich Berlin bei der Verpackungsverordnung positioniert, die ebenfalls am Montagabend ausverhandelt worden war. Im Vorfeld hatte die Bundesregierung die eigene Zustimmung an inhaltliche Forderungen geknüpft. Einige Punkte wurden nun berücksichtigt – so können sich mehrere Unternehmen zusammentun, um bestimmte Ziele gemeinsam zu erreichen. Die beteiligten Ministerien werteten gestern aber noch den im Trilog vereinbarten Text aus.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: In der zweiten Ausgabe von “Europa vor der Schicksalswahl – die Spitzenkandidaten im Gespräch” spreche ich am Donnerstagmittag mit Katarina Barley. Die Spitzenkandidatin der SPD und Vizepräsidentin des Europaparlaments diskutiert mit Professor Christian Calliess von der Freien Universität Berlin und mit Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, über die Frage, ob eine EU-Erweiterung ohne EU-(Vertrags-)Reform denkbar ist. Bei Interesse melden Sie sich gerne hier an.

“Wir haben nicht vor, im Berlaymont ein Waffendepot einzurichten“, sagte EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die flapsige Bemerkung sollte am Dienstag wohl die Erwartungen etwas zurechtrücken. Auch Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton gaben sich bei der Präsentation der Europäischen Strategie für die Rüstungsindustrie (EDIS) und dem parallelen Programm mit den finanziellen Anreizen (EDIP) defensiv. Man wolle nicht die Prärogative der Mitgliedstaaten bei der Verteidigungspolitik infrage stellen, sondern die industrielle Basis in Europa fördern.
Einzelne Elemente waren im Vergleich zu früheren Entwürfen entschärft. Die Möglichkeit, im Krisenfall Bestellungen zu priorisieren, soll nur freiwillig und in Absprache mit der Rüstungsindustrie erfolgen. Und ein europäischer Mechanismus nach dem Vorbild des US Foreign Military Sales Verfahren (FMS) soll jetzt nur als Pilotprojekt getestet werden.
Das Ziel ist, bis 2030 mindestens 40 Prozent der Rüstungsbeschaffungen gemeinsam zu tätigen. Und die Mitgliedstaaten werden ermutigt, bis Ende des Jahrzehnts mindestens die Hälfte ihrer Rüstungskäufe innerhalb des Binnenmarktes zu tätigen, im Gegensatz zu 80 Prozent außerhalb im vergangenen Jahr. Für diese Trendwende sollen vorerst 1,5 Milliarden Euro aus dem MFR für Anreize zur Verfügung stehen.
Experten sehen den Betrag als zu gering an, um angesichts der Kosten von Beschaffungsprogrammen einen Einfluss zu haben. Thierry Breton zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass in der nächsten Legislaturperiode zusätzliche Mittel gefunden würden.
Aus der Rüstungsindustrie und den Hauptstädten waren die ersten Reaktionen gemischt. “Es ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission versucht, die gemeinsame europäische Beschaffung zu fördern und mehr Planbarkeit für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu schaffen”, reagierte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien.
Die “Interventionslogik” dürfte jedoch in einigen europäischen Hauptstädten nicht gut ankommen, mahnte Atzpodien. Intransparente Planungs- und Eingriffsmöglichkeiten der Kommission könnten auch aus Sicht der Industrie am Ende zu “Wirrwarr” führen. An anderer Stelle gehe der Vorschlag zu wenig weit, etwa bei der Minimierung der bürokratischen Hürden für die Industrie.
Positiv war die erste Einschätzung von Jean Pie, Generalsekretär des europäischen Branchenverbandes Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) in Brüssel. Der Erfolg von EDIS und EDIP hänge jetzt von der Reaktion der Mitgliedstaaten ab. Geschwindigkeit und die finanziellen Ressourcen seien essenziell für die Umsetzung der Strategie.
Ein französischer Diplomat begrüßte die Strategie, zeigte sich aber skeptisch mit Blick auf die Umsetzung in Deutschland. Europäische Beschaffung sei spätestens seit dem Strategischen Kompass Kernelement in der EU. Zuletzt sei Bundeskanzler Olaf Scholz mit der European Sky Shield Initiative oder bei der Beschaffung des US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystems andere Wege gegangen.
In Berlin wird die Initiative zur Stärkung der europäischen Wehrhaftigkeit und Verteidigungsindustrie im BMWK “grundsätzlich begrüßt”. Im Detail müsse der Vorschlag aber noch analysiert und ausgewertet werden.
Die Initiative der EU-Kommission sei “ein Schritt in die richtige Richtung”, reagierte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament. Der russische Angriff auf die Ukraine und seine Folgen zeigten tagtäglich, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe.
Die EU brauche verstärkte Investitionen in den Verteidigungsbereich und mehr europäische Kooperation, um Ressourcen und Geld zu sparen und strategische Entscheidungen gemeinsam zu treffen, sagte Hannah Neumann, Grünen/EFA-Mitglied im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament. Rüstung dürfe jedoch nicht gegen Rente oder Klima ausgespielt werden. Für die anstehenden Investitionen brauche die EU zusätzliche Finanzmittel. Mitarbeit: Wilhelmine Preußen und Gabriel Bub
Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert, soll materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit zunächst nicht gesetzlich verankert werden.
Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen zukünftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Dabei sollen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
Die Kommission soll in einer Datenbank Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln und darin auch Berichte, etwa der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), berücksichtigen.
Die EU-Kommission hatte den Gesetzentwurf im September 2022 vorgestellt. Sie begründet die Initiative mit dem UN-Entwicklungsziel, Zwangsarbeit bis 2030 vollständig zu unterbinden. Nach Angaben der ILO wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. Der größte Teil von ihnen musste in der Privatwirtschaft arbeiten; 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang.
“Endlich keine Sklavenarbeit mehr in unseren Produkten”, kommentierte Anna Cavazzini (Grüne), Schattenberichterstatterin im Parlament, nach der Einigung. Laut einem 2021 von ihr beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden.
Das nach wie vor nicht abschließend abgestimmte EU-Lieferkettengesetz würde das Inverkehrbringen und die Bereitstellung solcher Produkte auf dem Binnenmarkt nicht abdecken. Zwar listet das Lieferkettengesetz Zwangsarbeit als Verletzung internationaler Abkommen und sieht Sanktionen für den Fall vor, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten nicht einhalten. Jedoch konzentriert es sich auf das unternehmerische Verhalten und enthält keine Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu verbieten.
Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.
Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament also ein Stück entgegen.
Mit der Forderung, auch die Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit gesetzlich zu verankern, konnte sich das Parlament hingegen nicht durchsetzen. Laut der Einigung sollen Unternehmen nur freiwillig Entschädigungszahlungen leisten. Die Einigung enthält zudem eine Überprüfungsklausel für die potenzielle Aufnahme einer Wiedergutmachungsregelung zu einem späteren Zeitpunkt.
Eine Reihe von Unternehmen und NGOs hatten im Februar in einer gemeinsamen Erklärung auf effektive Entschädigungen gedrängt. “Wiedergutmachung ist ein bedeutender Schritt in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht“, heißt es darin unter Bezug auf die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitfaden für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten.
Das Institut für Menschenrechte kritisiert die fehlende Wiedergutmachungsregelung. Dies “birgt die Gefahr, dass Unternehmen sich von problematischen Geschäftspartnern lösen, ohne dass eine Verbesserung für die Betroffene erfolgt”, erklärte der stellvertretende Direktor Michael Windfuhr. Wiedergutmachung könne je nach Situation zum Beispiel in der Rückgabe von zurückbehaltenen Ausweisdokumenten und Löhnen, der Befreiung aus Schuldknechtschaft und der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen liegen. Trotz der fehlenden Regelung bezeichnete Windfuhr die finale Einigung als “entscheidenden Schritt, damit der EU-Binnenmarkt kein Absatzmarkt für in Zwangsarbeit hergestellte Produkte ist”.
Jörgen Warborn, Schattenberichterstatter der EVP-Fraktion, lobte insbesondere die Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. “Dazu gehören spezifische Bestimmungen für KMU wie eine Hotline, die in ihrem eigenen Land ansässig ist und es ihnen ermöglicht, live Unterstützung bei der Einhaltung der Verordnung zu erhalten”, erklärte er.
Für die Umsetzung der Verordnung sollen die zuständigen Behörden drei Jahre Zeit bekommen, dann soll die Verordnung in Kraft treten. Zunächst müssen jedoch Rat und Parlament jeweils das Ergebnis der Trilogverhandlungen annehmen. Am 20. März werden zunächst die federführenden Ausschüsse für den Binnenmarkt und für internationalen Handel abstimmen.
Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist noch unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates bereits enthalten; Befürworter der Verordnung befürchten nun, eine erneute Enthaltung der Bundesregierung auf Druck der FDP könne das Vorhaben ähnlich wie beim EU-Lieferkettengesetz ins Wanken bringen. Nach jetzigem Stand würde aber wohl auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen. Im Bundesfinanzministerium hieß es, man müsse das Ergebnis erst noch bewerten.
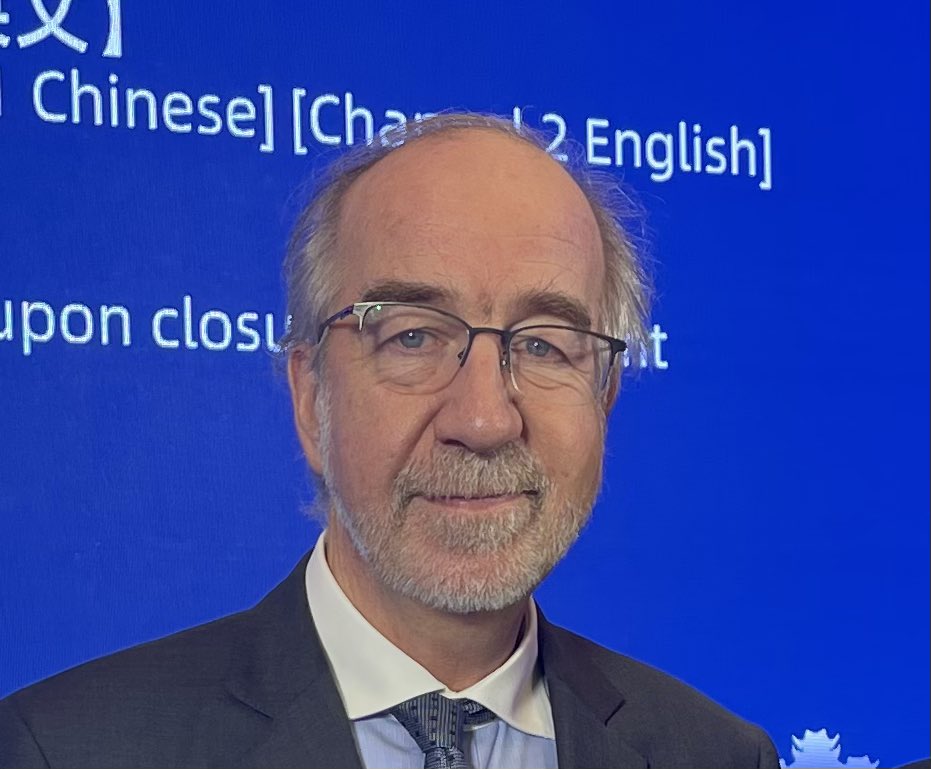
Freitagnacht ist die WTO-Ministerkonferenz ohne Ergebnis im Agrarbereich zu Ende gegangen. Zur Debatte stand unter anderem eine stärkere Einschränkung nationaler Subventionen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
John Clarke: Es gab nicht einmal eine Vereinbarung oder einen Text, der die WTO-Mitglieder zur Fortsetzung der Verhandlungen verpflichtet. Mehrere große Subventionsgeber wie die USA, China und Indien sind mit dem Status quo zufrieden und wollten keine Fortschritte sehen. Wir stehen also wieder ganz am Anfang.
Was heißt das für die Zukunft?
Es muss bei der WTO ein Umdenken geben. “Business as usual” funktioniert eindeutig nicht. Möglicherweise muss man sich darauf konzentrieren, welche Art von Agrarreform der globalen Ernährungssicherheit oder der Umwelt hilft.
Und vielleicht sollte man schrittweise vorgehen, erst einmal mit leichter zu erreichenden Zielen beginnen. Ein Beispiel: Statt darauf hinzuarbeiten, dass Länder wie Argentinien keine Ausfuhrbeschränkungen für Lebensmittel mehr verhängen, könnte man anstreben, dass zumindest die am wenigsten entwickelten Länder hiervon ausgenommen werden.
Vor allem aber muss wieder Vertrauen zwischen den WTO-Mitgliedern geschaffen werden. Das ist unerlässlich.
Wie gelingt das?
Das braucht Zeit. Zudem müssen die Botschafter wieder mehr Handlungsspielraum bekommen, statt dass nationale Minister die Verhandlungen “micromanagen” oder die Generaldirektion der WTO alles kontrollieren will. In der Vergangenheit hatte dieser Ansatz Erfolg.
Sollte die EU ihre Interessen im internationalen Handel stärker durch Spiegelklauseln durchsetzen, wie die protestierenden Bauern fordern?
Das ist komplex. Man muss die Rechtmäßigkeit von Spiegelklauseln von Fall zu Fall prüfen. Grundsätzlich kann man ein Produkt nicht verbieten, weil man damit, wie es hergestellt wurde, nicht einverstanden ist. Vorausgesetzt, die Herstellungsmethode hat keine Auswirkungen auf das importierte Produkt. Die WTO verbietet aus guten Gründen ein solches Vorgehen, das schnell in Protektionismus ausarten kann. Vergeltungsmaßnahmen kann sich die EU als größter und erfolgreichster Agrarexporteur der Welt nicht leisten.
Aber es gibt Ausnahmen.
Das EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten verbietet, Rindfleisch, Soja, Palmöl und mehr zu importieren, wenn für die Produktion Wald abgeholzt wird. Das geht, ohne gegen WTO-Recht zu verstoßen, weil Klimaschutz ein globales Gut ist. Auch der Einsatz von Antibiotika zur Wachstumsförderung ist verboten, weil er ein Risiko für die globale Gesundheit darstellt.
Für Schlachtung und Transport von Nutztieren gelten für importiertes Fleisch bereits gleichwertige Tierschutzstandards wie in der EU. Wenn die EU hoffentlich bald die Käfighaltung verbietet, müsste das entsprechend für die Herstellung importierter Ware gelten – nichts spricht dagegen.
Entscheidend ist hier, dass es um Praktiken geht, die in den Augen der europäischen Öffentlichkeit als Tierquälerei sind. Beruft sich die EU bei Importverboten entsprechend auf das WTO-Kriterium der “öffentlichen Moral”, muss sie das im Fall eines WTO-Verfahrens belegen können. Ein starker solcher Beleg wäre die Petition zum Ende der Käfighaltung, die eine Million Menschen unterschrieben haben.
Die EU-Kommission verbietet mittlerweile Rückstände zweier Insektizide in importierten Gütern und begründet es mit Artenschutz als globalem Gut. Ist damit ein Trend gesetzt?
Das ist möglich. Ich glaube aber nicht, dass ein solches Vorgehen in Bezug auf Pestizidrückstände oder das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel systematisch erfolgen kann, sondern nur in Einzelfällen. Jedes Mal müsste die Frage gestellt werden: Beeinträchtigt der Einsatz dieses verbotenen Pestizids im Ausland wirklich die Umwelt in Europa, und nicht nur zum Beispiel in Argentinien oder Ghana?
Aus meiner Sicht liegt das Verbot der beiden bienenschädlichen Insektizide schon nahe an der Grenze dessen, was rechtlich möglich ist.
Stimmen Sie der Kritik zu, dass Landwirte in der EU wegen gehobener Produktionsstandards auf internationalen Märkten benachteiligt sind?
Ich glaube nicht daran, dass es ein systematisches Problem des unlauteren Wettbewerbs gibt. Hier und da vielleicht, aber nicht strukturell. Andere Länder haben außerdem das Recht, andere Prioritäten zu setzen.
Die protestierenden Bauern in der EU zeichnen ein anderes Bild. Haben Sie Verständnis?
Wir sollten nicht vergessen, dass wir im Agrarbereich eine sehr erfolgreiche und wettbewerbsfähige Handelsmacht sind, und dass Importe ja ohnehin unsere Lebensmittelsicherheits-, Gesundheits- und teils Tierschutzstandards erfüllen müssen.
Trotzdem gibt es Fälle, in denen Erzeuger in anderen Ländern niedrigere Standards haben und dadurch einen Vorteil haben. Das ist aber nicht unbedingt von Nachteil.
Warum nicht?
In hohen Produktionsstandards liegt die Stärke der EU. Das ist ein fantastisches Instrument für die weltweite Vermarktung. Zudem glaube ich, dass Länder, die in die EU exportieren, um ihren Ruf besorgt sind und sich von sich aus bemühen, wenigstens auf dem europäischen Markt hohe Produktionsstandards einzuhalten.
Wie kann die EU ein “Level Playing Field” im internationalen Agrarhandel fördern?
Wir müssen zusammenarbeiten, um uns auf globale Standards zu einigen. Zugegeben: Das kann dauern. Aber wenn wir keine Handelskriege oder die Isolation Europas wollen, gibt es keine Alternative.
Außerdem können wir in einigen Bereichen Anreize für andere Länder schaffen, sich freiwillig an unsere Standards zu halten, die aufgrund der Größe unseres Marktes oft de facto ohnehin international Standard sind. Man nennt das den Brüssel-Effekt.
Ein Beispiel?
Das EU-interne Verbot zur Nutzung von Hormonen und Wachstumsbeschleunigern in der Tierhaltung gilt auch in vielen unserer Handelsabkommen. Die Handelspartner lassen sich darauf ein und setzen unsere Regeln um, weil sie nur so Zugang zum europäischen Markt bekommen.
Im Europäischen Parlament halten sexuelle und psychologische Belästigung an. Eine Umfrage unter Mitarbeitern und MEPs, die zwischen Juni und August 2023 von der Gruppe MeTooEP durchgeführt und nun vorgestellt wurde, zeigt, dass die Hälfte der der antwortenden Mitarbeiter mindestens einmal Mobbing mindestens einmal Mobbing (49,5 Prozent), acht Prozent mindestens einen Fall von körperlicher Gewalt und 15 Prozent sexuelle Belästigung erlebt haben. Fast die Hälfte der Befragten wurde Zeuge von Belästigungen (42,43 Prozent).
Der Fragebogen wurde an alle Mitarbeiter des Europaparlaments und die Europaparlamentarier geschickt. Alleine in der ersten Woche hätten ihn rund zehn Prozent aller angeschriebenen Personen ausgefüllt, teilte MeTooEP am Dienstag bei der Vorstellung der Daten mit. Insgesamt beteiligten sich 1.135 Personen an der Umfrage.
MeTooEP ist eine Gruppe von Mitarbeitern des Europäischen Parlaments, die gegen sexuelle Belästigung und alle Arten von Missbrauch im Parlament kämpfen. Das Bündnis gibt es seit 2018 und setzt sich für verpflichtende Anti-Belästigungsschulungen, externe und unabhängige Audits sowie für eine unabhängige Struktur ein, die sich mit allen Formen von Belästigung im Europäischen Parlament befasst. Außerdem fordern sie, sexuelle Belästigung als Straftatbestand zu betrachten und eine wirksame Unterstützung für die Opfer zu gewährleisten.
Die Gruppierung erklärt, dass die Umfrage verschiedene Reaktionen auf gemeldete sexuelle Belästigung ergeben habe. Entweder seien keine Maßnahmen ergriffen oder die Anschuldigungen im beruflichen Umfeld nicht ernst genommen worden, in einigen Fällen habe es eine Strafaktion seitens des Vorgesetzten gegeben.
Sexuelle Belästigung und Mobbing hielten an, weil “die Maßnahmen zum Schutz der Opfer nicht ausreichen”, erklärt Nathalie de Montigny, Anwältin für europäisches Zivilrecht, bei der Vorstellung der Umfrage. “Es gibt immer noch zu viele Barrieren“, die Opfer daran hindern, sich zu verteidigen, fährt Myrthe Bovendeaard fort, eine ehemalige parlamentarische Assistentin der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und Initiatorin eines neuen Netzwerks zur Unterstützung von Belästigung-Opfern “Harassment Support Network“.
Bovendeaard weist zum Beispiel auf die Schwierigkeiten hin, Beweise zu sammeln, oder auf den mangelnden Schutz der Opfer, während eine Untersuchung läuft. Die rechtlichen Wege, Belästiger zur Verantwortung zu ziehen, reichten nicht aus, ergänzt Nicholas Aiossa, Direktor of Transparency International und ehemaliger Assistent im Europäischen Parlament.
Die Veröffentlichung der Umfrage fand nur wenige Tage nach dem Rücktritt des Europaabgeordneten Malte Gallée (Grüne) statt, nachdem das Magazin Stern Anschuldigungen von einem Dutzend Assistentinnen und Praktikantinnen wegen sexueller Belästigung gegen ihn veröffentlicht hatte. Obwohl die Grünen den Kampf gegen sexuelle und psychische Belästigung ganz oben auf ihre politische Agenda gesetzt haben, wurde ihnen vorgeworfen, das Problem bestenfalls ignoriert zu haben, schlimmstenfalls verschleiert haben zu wollen.
“Die anonymen Berichte gehen mir sehr nahe und machen mich und uns betroffen. In der Grünen/EFA Fraktion eint uns das Ziel, dass wir Menschen im Arbeitsumfeld vor Belästigung und unangemessenem Verhalten schützen wollen”, schreibt Terry Reintke auf Anfrage von Table.Briefings. “Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird der Fraktionsvorstand bestehende Prozesse evaluieren und interne Verfahren stärken. Entsprechende Maßnahmen wird der Fraktionsvorstand vorlegen und dabei die Rückmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen”, erklärt Reintke weiter. cst
Um den Abgeordneten der EVP die Zustimmung zum AI Act etwas zu erleichtern, hat Axel Voss, Schattenberichterstatter der EVP für das KI-Gesetz, einen Zehn-Punkte-Fahrplan aufgestellt. Darin legt er dar, wie die Kommission die Schwachpunkte des AI Acts in ihrer Arbeit adressieren kann. Die finale Abstimmung im Plenum des Europaparlaments ist für den 13. März anberaumt.
Das KI-Gesetz sei ein komplexes und kompliziertes Gesetzeswerk, das die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen KI-Ökosystems gefährden könne, schreibt Voss. Daher müsse die Anwendung für Entwickler und Nutzer von KI einfacher werden. Unnötige Bürokratie müsse vermieden, rechtliche Unsicherheiten geklärt und Innovationen unterstützt werden. Daher fordert Voss die Kommission auf, eine gründliche Lückenanalyse durchzuführen und Widersprüche sowie Überschneidungen zwischen dem AI Act und anderen horizontalen oder sektorspezifischen Gesetzen zu identifizieren und zu klären.
Außerdem fordert Voss von der Kommission eine konkrete Strategie für Innovationen in KI. Die jüngste Kommunikation über KI-Start-ups und Innovation sei eher vage und verpasse die Gelegenheit, die wenigen Innovationsaspekte des KI-Gesetzes mit konkreten praktischen Maßnahmen zu verbinden. Daher solle die Kommission eine umfassende KI-Roadmap für die EU vorlegen. Diese solle auch konkrete Investitionssummen sowie Strategien zur Anziehung von mehr Risikokapital beinhalten.
Die bevorstehenden politischen Diskussionen über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sollten die neuen Ausgaben für das KI-Büro, regulatorische Testfelder und die HPC-Kapazitäten berücksichtigen, schreibt Voss. “Insbesondere muss das Budget des Programms Digitales Europa erheblich erhöht werden.” vis
Bei der Genehmigung von Kapazitätsmechanismen für den Strommarkt will die EU-Kommission die Versorgungssicherheit in der EU künftig differenzierter bewerten lassen. “Wir haben in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Risiken“, sagte Catharina Sikow-Magny, Direktorin aus der Generaldirektion Energie am Dienstag am Rande einer Solarkonferenz in Brüssel zu Table.Briefings. Eine Unterbrechung russischer Gaslieferungen beispielsweise sei im zentralen Szenario der europäischen Bewertung zur Angemessenheit der Ressourcen nicht berücksichtigt worden.
Von dieser Bewertung hängt maßgeblich ab, ob die Kommission Beihilfen für den Bau von Kraftwerken genehmigt, die für die Absicherung der Stromversorgung in Dunkelflauten oder Krisen vorgehalten werden. In Deutschland plant das Bundeswirtschaftsministerium den Neubau von Gaskraftwerken und ist auf Genehmigungen aus Brüssel angewiesen.
Mit der jüngsten Novelle der Strommarktverordnung wurde die europäische Regulierungsagentur ACER bereits verpflichtet, die Methodik für die Bewertung der Versorgungssicherheit zu überarbeiten. Laut Sikow-Magny arbeiten außerdem die Generaldirektionen für Energie und Wettbewerb daran, ihre internen Prozesse anzupassen, um die Genehmigung von Kapazitätsmechanismen zu beschleunigen. ber
Angesichts auslaufender Beihilfemöglichkeiten müssen die EU-Staaten nach Ansicht der Kommission rasch Entscheidungen zur Förderung der Solarindustrie und anderer grüner Produktionszweige treffen. “Für den befristeten Beihilferahmen TCTF nähert sich die Deadline, auch die Aufbau- und Resilienzfazilität läuft bald aus”, sagte Maive Rute, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Binnenmarkt am Dienstag bei einem Solarkongress in Brüssel.
Im Net-Zero Industry Act haben sich die EU-Staaten verpflichtet, die Produktionskapazitäten für Solartechnik bis 2030 massiv auszubauen. In einem Brief an die Mitgliedstaaten hatten die Kommissare Kadri Simson und Thierry Breton die nationalen Regierungen bereits dazu gedrängt, eigenes Geld in die Hand zu nehmen und die Möglichkeiten des TCTF für erhöhte Förderbeträge auszuschöpfen. Der Beihilferahmen ist bis Ende 2025 befristet. Die Möglichkeit, Investitionen mit EU-Mitteln aus der ARF zu fördern, läuft ein Jahr später aus.
Die Solarbranche stört sich allerdings daran, dass der TCTF keine Förderung für laufende Kosten ermöglicht. Banken würden Investitionen durch die längere Absicherung leichter finanzieren, so das Argument. Hinter vorgehaltener Hand gibt es auch Kritik daran, dass die höchsten Förderquoten nur für Projekte in benachteiligten Regionen möglich sind. “Wenn man abseits industrieller Zentren investieren soll, treibt das die Kosten für den Aufbau einer geschlossenen Lieferkette enorm in die Höhe“, sagte ein Solarmanager am Rande der Brüsseler Konferenz. ber
Deutschland und Frankreich wollen zusammen daran arbeiten, der Ukraine Munition auf dem Weltmarkt zu beschaffen. Das vereinbarten Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Ressortchef Stéphane Séjourné bei einem Treffen am Dienstag in Paris, wie es aus Delegationskreisen verlautete. Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, wie Deutschland und Frankreich “mit ganz konkreten Maßnahmen” die Ukraine unterstützen könnten, “zum Beispiel durch die weltweite Beschaffung von Munition”, hieß es weiter.
Die Ukraine klagt derzeit auch über den Mangel an Munition, weshalb den russischen Streitkräften wiederholt Geländegewinne vor allem an der Ostfront gelungen sind. In ihrem “guten und vertrauensvollen Gespräch” hätten Baerbock und Séjourné auch darüber gesprochen, wie Deutschland und Frankreich zum Friedensfonds der Europäischen Union für die Ukraine (European Peace Facility) beitragen könnten, hieß es in den Delegationskreisen weiter. Zudem sei beraten worden, wie beide Länder “Versuchen zur Destabilisierung Moldaus entgegenwirken” könnten.
Baerbock trat am Dienstagmorgen dem Eindruck entgegen, dass es eine ernsthafte Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gebe. “Tiefe Freundschaft, Verbundenheit drückt sich nicht darin aus, dass man immer einer Meinung ist“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Sarajevo. rtr
Die EU darf Biodiesel aus Malaysia künftig als erneuerbaren Biokraftstoffen ausschließen. Einen entsprechenden Sieg hat die Europäische Union am Dienstag bei der Welthandelsorganisation (WTO) errungen, als ein Schiedsgericht eine malaysische Beschwerde gegen eine EU-Entscheidung abwies.
In der ersten WTO-Entscheidung im Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern stimmte ein dreiköpfiges Gremium mit zwei zu eins Stimmen dafür, Malaysias inhaltliche Forderungen zurückzuweisen. Allerdings gaben sie Malaysia Recht in dessen Beschwerde über die Art und Weise, wie die Maßnahmen vorbereitet, veröffentlicht und verwaltet wurde. Indonesien, das ebenfalls geklagt hatte, ließ daraufhin seine Beschwerde fallen und beantragte die Aussetzung der Arbeit des Panels.
Hintergrund ist, dass künftig EU-weit ein Anteil von zehn Prozent an Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll, dazu zählen auch Biokraftstoffe auf pflanzlicher Basis. Die EU schließt Pflanzen aus, die auf abgeholzten Flächen angebaut werden oder bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie den Anbau von Nahrungsmitteln verdrängen, die dann auf gerodeten Flächen angebaut wurden. Daher hatte die EU hat festgelegt, dass Biokraftstoff auf Palmölbasis bis 2030 nicht mehr zu den erneuerbaren Energiequellen zählen soll. Malaysia und Indonesien, die beiden größten Palmölproduzenten der Welt, hatten daraufhin bei der WTO Klage gegen die Europäische Union eingereicht. rtr/lei

Mit jeder Vorwahl, die Donald Trump gewinnt, wird die dunkle Wolke über der Nato bedrohlicher. Werden sich die Europäer auch in Zukunft auf ihren stärksten Verbündeten verlassen können? Mit welcher politischen Taktik könnten sie sich am besten auf eine mögliche Rückkehr Trumps in das Weiße Haus vorbereiten?
Die Meinungen darüber gehen auseinander: Während die einen – darunter auch die Regierung in Berlin – hoffen, den unberechenbaren Trump mit steigenden Verteidigungsausgaben beeindrucken zu können, würden Erdoğan, Orbán und Fico dem Rechtspopulisten in Washington wohl freudig entgegeneilen. In Polen, im Baltikum sowie in Ost- und Nordeuropa ist man hingegen tief besorgt: Würde der ohnehin fragile Konsens zur Unterstützung der Ukraine mit Trump weiter halten?
Seine erste Begegnung mit Donald Trump hat das westliche Verteidigungsbündnis nur knapp überlebt. Mehrfach war dieser kurz davor, der in seinen Augen “obsoleten Nato” den Rücken zu kehren. Ex-Präsident Trump beschimpfte seine europäischen Partner regelmäßig als Trittbrettfahrer und behauptete, sie würden ihm Geld schulden. Seine groß angekündigten “Deals” mit Nordkorea und Russland sowie seine “Friedensinitiative” im Nahen Osten zog Trump im Alleingang durch.
Auch an dem mit den Taliban ausgehandelten Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan ließ er die europäischen Nato-Verbündeten unbeteiligt. Das Ergebnis war ein strategisches Desaster für den Westen. Nein, das Trumpsche Credo “Make America Great Again” ist der Nato nicht gut bekommen.
Mit dem ehemaligen niederländischen Regierungschef Mark Rutte, der wohl zum neuen Nato-Generalsekretär erkoren wird, hoffen nun einige Europäer, Trump irgendwie einfangen zu können. Man müsse ihm nur geduldig erklären, dass die europäischen Verbündeten in den letzten Jahren viel mehr Geld für ihre Verteidigung in die Hand genommen haben und bereit seien, künftig mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen, so Rutte.
Ob der Holländer, der auch als “Trump-Flüsterer” bezeichnet wird, diesen Punkt überzeugend rüberbringen kann, darf bezweifelt werden. Nachdem Rutte 2010 die Regierungsgeschäfte in Den Haag übernommen hatte, fuhren die niederländischen Verteidigungsausgaben jahrelang beständig in den Keller (2015 lagen sie bei 1,13 Prozent). Auch in den letzten beiden Jahren blieben sie deutlich unter zwei Prozent.
Mit einer Charmeoffensive werden die Europäer Trump wohl kaum davon abhalten können, die Nato unter Druck zu setzten und eventuell sogar nachhaltig zu beschädigen. Warum? Erstens ist und bleibt Trump ein Überzeugungstäter – ein außenpolitischer Isolationist, der multilateralen Organisationen grundsätzlich feindlich gegenübersteht. Er glaubt an “Dealmaking unter den Großen” und nicht an komplizierte “Konsensfindung zu 32”.
Zweitens haben sich Trump und seine Anhänger intensiv auf eine Rückkehr in das Weiße Haus vorbereitet, auch verteidigungspolitisch. Sein MAGA-Dunstkreis propagiert seit Längerem, dass Trump die Nato am liebsten “einschläfern” wolle. In Zukunft sollten die Europäer ihren Kontinent konventionell selbst verteidigen. Einzig den nuklearen Schutzschirm würden die USA in Europa erhalten.
Drittens hätte Trump etliche Möglichkeiten, der Nato konkret zu schaden. Sie reichen von der Reduzierung der amerikanischen Truppenstärke in Europa, dem “No show” der USA bei wichtigen Nato-Treffen, der Kürzung von Finanzmitteln für den militärischen und zivilen Haushalt der Nato, bis zu dem bewussten Säen öffentlicher Zweifel an der Bündnistreue der USA. Sind die Verbündeten auf solche Szenarien vorbereitet? Wohl kaum, denn im Nato-Hauptquartier wird darüber offiziell nicht geredet.
Die Nato wird sicher nicht über die künftige finanzielle Lastenteilung ins Trudeln geraten. Der Graben, der zwischen den Verbündeten immer tiefer wird, betrifft fundamentale strategische Themen: das Schicksal der Ukraine und den Umgang mit Russland. Trumps Ankündigung, nach einem Wahlsieg rasch einen “Deal” mit dem Mafiaregime in Moskau machen zu wollen, lässt nicht nur den Ukrainern das Blut in den Adern gefrieren, sondern auch den Briten, Balten, Polen, Skandinaviern und Ostmitteleuropäern: also all denjenigen, die der Konfrontation mit Russland nicht ausweichen wollen.
Das Bündnis “Trump proof” zu machen, heißt für diese Ländergruppe (zu denen ich Deutschland nicht zähle), die Reihen gegenüber Moskau eng geschlossen zu halten und sich auf alle Eventualitäten konkret vorzubereiten – notfalls auch ohne amerikanische Hilfe. Sie haben ihre wetterfeste Sturmjacke bereits griffbereit.
Dr. Stefanie Babst ist Beigeordnete Stellvertretende Nato-Generalsekretärin a.D.; Strategische Beraterin und Publizistin.
bahnt sich da das nächste German Vote an? EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht zum Dienstag auf ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit geeinigt – ob die Ampel-Koalition die Einigung mitträgt, ist aber reichlich fraglich. Die FDP-Seite habe zuletzt politische Bedenken angemeldet, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Im Bundesfinanzministerium wird darauf verweisen, man wolle zunächst das Verhandlungsergebnis prüfen.
Die Minister der Freidemokraten hatten zuletzt bei einer ganzen Reihe von Dossiers eine Enthaltung der Bundesregierung erzwungen, das prominenteste ist die Lieferkettenrichtlinie CSDDD. Anders als dort oder auch bei der Plattformarbeit dürfte die Verordnung zur Zwangsarbeit aber auch ohne deutsche Zustimmung die nötige qualifizierte Mehrheit im Rat finden.
Noch offen ist, wie sich Berlin bei der Verpackungsverordnung positioniert, die ebenfalls am Montagabend ausverhandelt worden war. Im Vorfeld hatte die Bundesregierung die eigene Zustimmung an inhaltliche Forderungen geknüpft. Einige Punkte wurden nun berücksichtigt – so können sich mehrere Unternehmen zusammentun, um bestimmte Ziele gemeinsam zu erreichen. Die beteiligten Ministerien werteten gestern aber noch den im Trilog vereinbarten Text aus.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: In der zweiten Ausgabe von “Europa vor der Schicksalswahl – die Spitzenkandidaten im Gespräch” spreche ich am Donnerstagmittag mit Katarina Barley. Die Spitzenkandidatin der SPD und Vizepräsidentin des Europaparlaments diskutiert mit Professor Christian Calliess von der Freien Universität Berlin und mit Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, über die Frage, ob eine EU-Erweiterung ohne EU-(Vertrags-)Reform denkbar ist. Bei Interesse melden Sie sich gerne hier an.

“Wir haben nicht vor, im Berlaymont ein Waffendepot einzurichten“, sagte EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die flapsige Bemerkung sollte am Dienstag wohl die Erwartungen etwas zurechtrücken. Auch Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton gaben sich bei der Präsentation der Europäischen Strategie für die Rüstungsindustrie (EDIS) und dem parallelen Programm mit den finanziellen Anreizen (EDIP) defensiv. Man wolle nicht die Prärogative der Mitgliedstaaten bei der Verteidigungspolitik infrage stellen, sondern die industrielle Basis in Europa fördern.
Einzelne Elemente waren im Vergleich zu früheren Entwürfen entschärft. Die Möglichkeit, im Krisenfall Bestellungen zu priorisieren, soll nur freiwillig und in Absprache mit der Rüstungsindustrie erfolgen. Und ein europäischer Mechanismus nach dem Vorbild des US Foreign Military Sales Verfahren (FMS) soll jetzt nur als Pilotprojekt getestet werden.
Das Ziel ist, bis 2030 mindestens 40 Prozent der Rüstungsbeschaffungen gemeinsam zu tätigen. Und die Mitgliedstaaten werden ermutigt, bis Ende des Jahrzehnts mindestens die Hälfte ihrer Rüstungskäufe innerhalb des Binnenmarktes zu tätigen, im Gegensatz zu 80 Prozent außerhalb im vergangenen Jahr. Für diese Trendwende sollen vorerst 1,5 Milliarden Euro aus dem MFR für Anreize zur Verfügung stehen.
Experten sehen den Betrag als zu gering an, um angesichts der Kosten von Beschaffungsprogrammen einen Einfluss zu haben. Thierry Breton zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass in der nächsten Legislaturperiode zusätzliche Mittel gefunden würden.
Aus der Rüstungsindustrie und den Hauptstädten waren die ersten Reaktionen gemischt. “Es ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission versucht, die gemeinsame europäische Beschaffung zu fördern und mehr Planbarkeit für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu schaffen”, reagierte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien.
Die “Interventionslogik” dürfte jedoch in einigen europäischen Hauptstädten nicht gut ankommen, mahnte Atzpodien. Intransparente Planungs- und Eingriffsmöglichkeiten der Kommission könnten auch aus Sicht der Industrie am Ende zu “Wirrwarr” führen. An anderer Stelle gehe der Vorschlag zu wenig weit, etwa bei der Minimierung der bürokratischen Hürden für die Industrie.
Positiv war die erste Einschätzung von Jean Pie, Generalsekretär des europäischen Branchenverbandes Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) in Brüssel. Der Erfolg von EDIS und EDIP hänge jetzt von der Reaktion der Mitgliedstaaten ab. Geschwindigkeit und die finanziellen Ressourcen seien essenziell für die Umsetzung der Strategie.
Ein französischer Diplomat begrüßte die Strategie, zeigte sich aber skeptisch mit Blick auf die Umsetzung in Deutschland. Europäische Beschaffung sei spätestens seit dem Strategischen Kompass Kernelement in der EU. Zuletzt sei Bundeskanzler Olaf Scholz mit der European Sky Shield Initiative oder bei der Beschaffung des US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystems andere Wege gegangen.
In Berlin wird die Initiative zur Stärkung der europäischen Wehrhaftigkeit und Verteidigungsindustrie im BMWK “grundsätzlich begrüßt”. Im Detail müsse der Vorschlag aber noch analysiert und ausgewertet werden.
Die Initiative der EU-Kommission sei “ein Schritt in die richtige Richtung”, reagierte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament. Der russische Angriff auf die Ukraine und seine Folgen zeigten tagtäglich, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe.
Die EU brauche verstärkte Investitionen in den Verteidigungsbereich und mehr europäische Kooperation, um Ressourcen und Geld zu sparen und strategische Entscheidungen gemeinsam zu treffen, sagte Hannah Neumann, Grünen/EFA-Mitglied im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament. Rüstung dürfe jedoch nicht gegen Rente oder Klima ausgespielt werden. Für die anstehenden Investitionen brauche die EU zusätzliche Finanzmittel. Mitarbeit: Wilhelmine Preußen und Gabriel Bub
Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht auf Dienstag über die neue Verordnung geeinigt. Anders als von Parlament und Zivilgesellschaft gefordert, soll materielle Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit zunächst nicht gesetzlich verankert werden.
Die EU-Kommission und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten sollen zukünftig Produkte ermitteln, in deren Lieferkette Menschen in Zwangsarbeit involviert sind. Dabei sollen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
Die Kommission soll in einer Datenbank Informationen über Zwangsarbeitsrisiken sammeln und darin auch Berichte, etwa der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), berücksichtigen.
Die EU-Kommission hatte den Gesetzentwurf im September 2022 vorgestellt. Sie begründet die Initiative mit dem UN-Entwicklungsziel, Zwangsarbeit bis 2030 vollständig zu unterbinden. Nach Angaben der ILO wurden im Jahr 2021 rund 27,6 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen – darunter etwa zwölf Prozent Kinder. Der größte Teil von ihnen musste in der Privatwirtschaft arbeiten; 3,9 Millionen waren Opfer staatlich verordneter Zwangsarbeit, wie mutmaßlich in der chinesischen Region Xinjiang.
“Endlich keine Sklavenarbeit mehr in unseren Produkten”, kommentierte Anna Cavazzini (Grüne), Schattenberichterstatterin im Parlament, nach der Einigung. Laut einem 2021 von ihr beauftragten Bericht profitieren mehr als 80 internationale Markenkonzerne direkt oder indirekt von Arbeit, zu der Uiguren in China gezwungen werden.
Das nach wie vor nicht abschließend abgestimmte EU-Lieferkettengesetz würde das Inverkehrbringen und die Bereitstellung solcher Produkte auf dem Binnenmarkt nicht abdecken. Zwar listet das Lieferkettengesetz Zwangsarbeit als Verletzung internationaler Abkommen und sieht Sanktionen für den Fall vor, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten nicht einhalten. Jedoch konzentriert es sich auf das unternehmerische Verhalten und enthält keine Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu verbieten.
Der Gesetzestext geht insbesondere auf staatlich initiierte Zwangsarbeit ein.
Das Parlament hatte ursprünglich gefordert, Hochrisikosektoren in Regionen mit überwiegend staatlich initiierter Zwangsarbeit zu bestimmen. Denn etwa in Xinjiang sei ein Sammeln der notwendigen Beweise in der Regel nicht möglich. Die jetzt gefundene Formulierung kommt dem Parlament also ein Stück entgegen.
Mit der Forderung, auch die Wiedergutmachung für die Opfer von Zwangsarbeit gesetzlich zu verankern, konnte sich das Parlament hingegen nicht durchsetzen. Laut der Einigung sollen Unternehmen nur freiwillig Entschädigungszahlungen leisten. Die Einigung enthält zudem eine Überprüfungsklausel für die potenzielle Aufnahme einer Wiedergutmachungsregelung zu einem späteren Zeitpunkt.
Eine Reihe von Unternehmen und NGOs hatten im Februar in einer gemeinsamen Erklärung auf effektive Entschädigungen gedrängt. “Wiedergutmachung ist ein bedeutender Schritt in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht“, heißt es darin unter Bezug auf die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitfaden für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten.
Das Institut für Menschenrechte kritisiert die fehlende Wiedergutmachungsregelung. Dies “birgt die Gefahr, dass Unternehmen sich von problematischen Geschäftspartnern lösen, ohne dass eine Verbesserung für die Betroffene erfolgt”, erklärte der stellvertretende Direktor Michael Windfuhr. Wiedergutmachung könne je nach Situation zum Beispiel in der Rückgabe von zurückbehaltenen Ausweisdokumenten und Löhnen, der Befreiung aus Schuldknechtschaft und der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen liegen. Trotz der fehlenden Regelung bezeichnete Windfuhr die finale Einigung als “entscheidenden Schritt, damit der EU-Binnenmarkt kein Absatzmarkt für in Zwangsarbeit hergestellte Produkte ist”.
Jörgen Warborn, Schattenberichterstatter der EVP-Fraktion, lobte insbesondere die Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen. “Dazu gehören spezifische Bestimmungen für KMU wie eine Hotline, die in ihrem eigenen Land ansässig ist und es ihnen ermöglicht, live Unterstützung bei der Einhaltung der Verordnung zu erhalten”, erklärte er.
Für die Umsetzung der Verordnung sollen die zuständigen Behörden drei Jahre Zeit bekommen, dann soll die Verordnung in Kraft treten. Zunächst müssen jedoch Rat und Parlament jeweils das Ergebnis der Trilogverhandlungen annehmen. Am 20. März werden zunächst die federführenden Ausschüsse für den Binnenmarkt und für internationalen Handel abstimmen.
Ob das Gesetz im Rat die nötige Mehrheit erhält, ist noch unklar. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung über das Verhandlungsmandat des Rates bereits enthalten; Befürworter der Verordnung befürchten nun, eine erneute Enthaltung der Bundesregierung auf Druck der FDP könne das Vorhaben ähnlich wie beim EU-Lieferkettengesetz ins Wanken bringen. Nach jetzigem Stand würde aber wohl auch ohne Deutschland eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen. Im Bundesfinanzministerium hieß es, man müsse das Ergebnis erst noch bewerten.
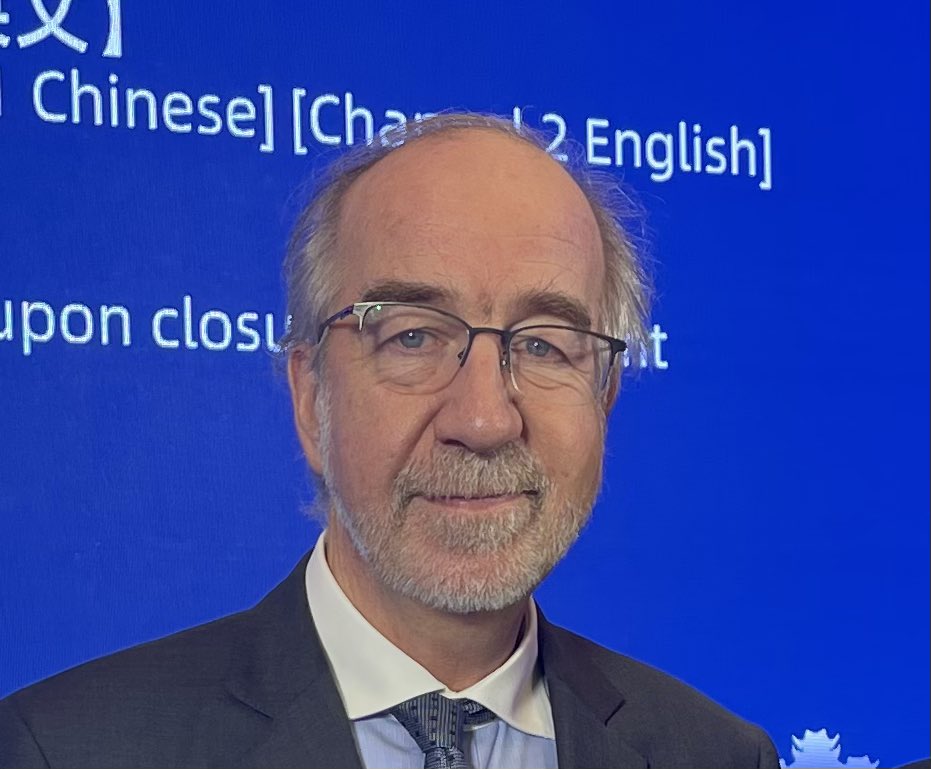
Freitagnacht ist die WTO-Ministerkonferenz ohne Ergebnis im Agrarbereich zu Ende gegangen. Zur Debatte stand unter anderem eine stärkere Einschränkung nationaler Subventionen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
John Clarke: Es gab nicht einmal eine Vereinbarung oder einen Text, der die WTO-Mitglieder zur Fortsetzung der Verhandlungen verpflichtet. Mehrere große Subventionsgeber wie die USA, China und Indien sind mit dem Status quo zufrieden und wollten keine Fortschritte sehen. Wir stehen also wieder ganz am Anfang.
Was heißt das für die Zukunft?
Es muss bei der WTO ein Umdenken geben. “Business as usual” funktioniert eindeutig nicht. Möglicherweise muss man sich darauf konzentrieren, welche Art von Agrarreform der globalen Ernährungssicherheit oder der Umwelt hilft.
Und vielleicht sollte man schrittweise vorgehen, erst einmal mit leichter zu erreichenden Zielen beginnen. Ein Beispiel: Statt darauf hinzuarbeiten, dass Länder wie Argentinien keine Ausfuhrbeschränkungen für Lebensmittel mehr verhängen, könnte man anstreben, dass zumindest die am wenigsten entwickelten Länder hiervon ausgenommen werden.
Vor allem aber muss wieder Vertrauen zwischen den WTO-Mitgliedern geschaffen werden. Das ist unerlässlich.
Wie gelingt das?
Das braucht Zeit. Zudem müssen die Botschafter wieder mehr Handlungsspielraum bekommen, statt dass nationale Minister die Verhandlungen “micromanagen” oder die Generaldirektion der WTO alles kontrollieren will. In der Vergangenheit hatte dieser Ansatz Erfolg.
Sollte die EU ihre Interessen im internationalen Handel stärker durch Spiegelklauseln durchsetzen, wie die protestierenden Bauern fordern?
Das ist komplex. Man muss die Rechtmäßigkeit von Spiegelklauseln von Fall zu Fall prüfen. Grundsätzlich kann man ein Produkt nicht verbieten, weil man damit, wie es hergestellt wurde, nicht einverstanden ist. Vorausgesetzt, die Herstellungsmethode hat keine Auswirkungen auf das importierte Produkt. Die WTO verbietet aus guten Gründen ein solches Vorgehen, das schnell in Protektionismus ausarten kann. Vergeltungsmaßnahmen kann sich die EU als größter und erfolgreichster Agrarexporteur der Welt nicht leisten.
Aber es gibt Ausnahmen.
Das EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten verbietet, Rindfleisch, Soja, Palmöl und mehr zu importieren, wenn für die Produktion Wald abgeholzt wird. Das geht, ohne gegen WTO-Recht zu verstoßen, weil Klimaschutz ein globales Gut ist. Auch der Einsatz von Antibiotika zur Wachstumsförderung ist verboten, weil er ein Risiko für die globale Gesundheit darstellt.
Für Schlachtung und Transport von Nutztieren gelten für importiertes Fleisch bereits gleichwertige Tierschutzstandards wie in der EU. Wenn die EU hoffentlich bald die Käfighaltung verbietet, müsste das entsprechend für die Herstellung importierter Ware gelten – nichts spricht dagegen.
Entscheidend ist hier, dass es um Praktiken geht, die in den Augen der europäischen Öffentlichkeit als Tierquälerei sind. Beruft sich die EU bei Importverboten entsprechend auf das WTO-Kriterium der “öffentlichen Moral”, muss sie das im Fall eines WTO-Verfahrens belegen können. Ein starker solcher Beleg wäre die Petition zum Ende der Käfighaltung, die eine Million Menschen unterschrieben haben.
Die EU-Kommission verbietet mittlerweile Rückstände zweier Insektizide in importierten Gütern und begründet es mit Artenschutz als globalem Gut. Ist damit ein Trend gesetzt?
Das ist möglich. Ich glaube aber nicht, dass ein solches Vorgehen in Bezug auf Pestizidrückstände oder das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel systematisch erfolgen kann, sondern nur in Einzelfällen. Jedes Mal müsste die Frage gestellt werden: Beeinträchtigt der Einsatz dieses verbotenen Pestizids im Ausland wirklich die Umwelt in Europa, und nicht nur zum Beispiel in Argentinien oder Ghana?
Aus meiner Sicht liegt das Verbot der beiden bienenschädlichen Insektizide schon nahe an der Grenze dessen, was rechtlich möglich ist.
Stimmen Sie der Kritik zu, dass Landwirte in der EU wegen gehobener Produktionsstandards auf internationalen Märkten benachteiligt sind?
Ich glaube nicht daran, dass es ein systematisches Problem des unlauteren Wettbewerbs gibt. Hier und da vielleicht, aber nicht strukturell. Andere Länder haben außerdem das Recht, andere Prioritäten zu setzen.
Die protestierenden Bauern in der EU zeichnen ein anderes Bild. Haben Sie Verständnis?
Wir sollten nicht vergessen, dass wir im Agrarbereich eine sehr erfolgreiche und wettbewerbsfähige Handelsmacht sind, und dass Importe ja ohnehin unsere Lebensmittelsicherheits-, Gesundheits- und teils Tierschutzstandards erfüllen müssen.
Trotzdem gibt es Fälle, in denen Erzeuger in anderen Ländern niedrigere Standards haben und dadurch einen Vorteil haben. Das ist aber nicht unbedingt von Nachteil.
Warum nicht?
In hohen Produktionsstandards liegt die Stärke der EU. Das ist ein fantastisches Instrument für die weltweite Vermarktung. Zudem glaube ich, dass Länder, die in die EU exportieren, um ihren Ruf besorgt sind und sich von sich aus bemühen, wenigstens auf dem europäischen Markt hohe Produktionsstandards einzuhalten.
Wie kann die EU ein “Level Playing Field” im internationalen Agrarhandel fördern?
Wir müssen zusammenarbeiten, um uns auf globale Standards zu einigen. Zugegeben: Das kann dauern. Aber wenn wir keine Handelskriege oder die Isolation Europas wollen, gibt es keine Alternative.
Außerdem können wir in einigen Bereichen Anreize für andere Länder schaffen, sich freiwillig an unsere Standards zu halten, die aufgrund der Größe unseres Marktes oft de facto ohnehin international Standard sind. Man nennt das den Brüssel-Effekt.
Ein Beispiel?
Das EU-interne Verbot zur Nutzung von Hormonen und Wachstumsbeschleunigern in der Tierhaltung gilt auch in vielen unserer Handelsabkommen. Die Handelspartner lassen sich darauf ein und setzen unsere Regeln um, weil sie nur so Zugang zum europäischen Markt bekommen.
Im Europäischen Parlament halten sexuelle und psychologische Belästigung an. Eine Umfrage unter Mitarbeitern und MEPs, die zwischen Juni und August 2023 von der Gruppe MeTooEP durchgeführt und nun vorgestellt wurde, zeigt, dass die Hälfte der der antwortenden Mitarbeiter mindestens einmal Mobbing mindestens einmal Mobbing (49,5 Prozent), acht Prozent mindestens einen Fall von körperlicher Gewalt und 15 Prozent sexuelle Belästigung erlebt haben. Fast die Hälfte der Befragten wurde Zeuge von Belästigungen (42,43 Prozent).
Der Fragebogen wurde an alle Mitarbeiter des Europaparlaments und die Europaparlamentarier geschickt. Alleine in der ersten Woche hätten ihn rund zehn Prozent aller angeschriebenen Personen ausgefüllt, teilte MeTooEP am Dienstag bei der Vorstellung der Daten mit. Insgesamt beteiligten sich 1.135 Personen an der Umfrage.
MeTooEP ist eine Gruppe von Mitarbeitern des Europäischen Parlaments, die gegen sexuelle Belästigung und alle Arten von Missbrauch im Parlament kämpfen. Das Bündnis gibt es seit 2018 und setzt sich für verpflichtende Anti-Belästigungsschulungen, externe und unabhängige Audits sowie für eine unabhängige Struktur ein, die sich mit allen Formen von Belästigung im Europäischen Parlament befasst. Außerdem fordern sie, sexuelle Belästigung als Straftatbestand zu betrachten und eine wirksame Unterstützung für die Opfer zu gewährleisten.
Die Gruppierung erklärt, dass die Umfrage verschiedene Reaktionen auf gemeldete sexuelle Belästigung ergeben habe. Entweder seien keine Maßnahmen ergriffen oder die Anschuldigungen im beruflichen Umfeld nicht ernst genommen worden, in einigen Fällen habe es eine Strafaktion seitens des Vorgesetzten gegeben.
Sexuelle Belästigung und Mobbing hielten an, weil “die Maßnahmen zum Schutz der Opfer nicht ausreichen”, erklärt Nathalie de Montigny, Anwältin für europäisches Zivilrecht, bei der Vorstellung der Umfrage. “Es gibt immer noch zu viele Barrieren“, die Opfer daran hindern, sich zu verteidigen, fährt Myrthe Bovendeaard fort, eine ehemalige parlamentarische Assistentin der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und Initiatorin eines neuen Netzwerks zur Unterstützung von Belästigung-Opfern “Harassment Support Network“.
Bovendeaard weist zum Beispiel auf die Schwierigkeiten hin, Beweise zu sammeln, oder auf den mangelnden Schutz der Opfer, während eine Untersuchung läuft. Die rechtlichen Wege, Belästiger zur Verantwortung zu ziehen, reichten nicht aus, ergänzt Nicholas Aiossa, Direktor of Transparency International und ehemaliger Assistent im Europäischen Parlament.
Die Veröffentlichung der Umfrage fand nur wenige Tage nach dem Rücktritt des Europaabgeordneten Malte Gallée (Grüne) statt, nachdem das Magazin Stern Anschuldigungen von einem Dutzend Assistentinnen und Praktikantinnen wegen sexueller Belästigung gegen ihn veröffentlicht hatte. Obwohl die Grünen den Kampf gegen sexuelle und psychische Belästigung ganz oben auf ihre politische Agenda gesetzt haben, wurde ihnen vorgeworfen, das Problem bestenfalls ignoriert zu haben, schlimmstenfalls verschleiert haben zu wollen.
“Die anonymen Berichte gehen mir sehr nahe und machen mich und uns betroffen. In der Grünen/EFA Fraktion eint uns das Ziel, dass wir Menschen im Arbeitsumfeld vor Belästigung und unangemessenem Verhalten schützen wollen”, schreibt Terry Reintke auf Anfrage von Table.Briefings. “Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird der Fraktionsvorstand bestehende Prozesse evaluieren und interne Verfahren stärken. Entsprechende Maßnahmen wird der Fraktionsvorstand vorlegen und dabei die Rückmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen”, erklärt Reintke weiter. cst
Um den Abgeordneten der EVP die Zustimmung zum AI Act etwas zu erleichtern, hat Axel Voss, Schattenberichterstatter der EVP für das KI-Gesetz, einen Zehn-Punkte-Fahrplan aufgestellt. Darin legt er dar, wie die Kommission die Schwachpunkte des AI Acts in ihrer Arbeit adressieren kann. Die finale Abstimmung im Plenum des Europaparlaments ist für den 13. März anberaumt.
Das KI-Gesetz sei ein komplexes und kompliziertes Gesetzeswerk, das die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen KI-Ökosystems gefährden könne, schreibt Voss. Daher müsse die Anwendung für Entwickler und Nutzer von KI einfacher werden. Unnötige Bürokratie müsse vermieden, rechtliche Unsicherheiten geklärt und Innovationen unterstützt werden. Daher fordert Voss die Kommission auf, eine gründliche Lückenanalyse durchzuführen und Widersprüche sowie Überschneidungen zwischen dem AI Act und anderen horizontalen oder sektorspezifischen Gesetzen zu identifizieren und zu klären.
Außerdem fordert Voss von der Kommission eine konkrete Strategie für Innovationen in KI. Die jüngste Kommunikation über KI-Start-ups und Innovation sei eher vage und verpasse die Gelegenheit, die wenigen Innovationsaspekte des KI-Gesetzes mit konkreten praktischen Maßnahmen zu verbinden. Daher solle die Kommission eine umfassende KI-Roadmap für die EU vorlegen. Diese solle auch konkrete Investitionssummen sowie Strategien zur Anziehung von mehr Risikokapital beinhalten.
Die bevorstehenden politischen Diskussionen über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sollten die neuen Ausgaben für das KI-Büro, regulatorische Testfelder und die HPC-Kapazitäten berücksichtigen, schreibt Voss. “Insbesondere muss das Budget des Programms Digitales Europa erheblich erhöht werden.” vis
Bei der Genehmigung von Kapazitätsmechanismen für den Strommarkt will die EU-Kommission die Versorgungssicherheit in der EU künftig differenzierter bewerten lassen. “Wir haben in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Risiken“, sagte Catharina Sikow-Magny, Direktorin aus der Generaldirektion Energie am Dienstag am Rande einer Solarkonferenz in Brüssel zu Table.Briefings. Eine Unterbrechung russischer Gaslieferungen beispielsweise sei im zentralen Szenario der europäischen Bewertung zur Angemessenheit der Ressourcen nicht berücksichtigt worden.
Von dieser Bewertung hängt maßgeblich ab, ob die Kommission Beihilfen für den Bau von Kraftwerken genehmigt, die für die Absicherung der Stromversorgung in Dunkelflauten oder Krisen vorgehalten werden. In Deutschland plant das Bundeswirtschaftsministerium den Neubau von Gaskraftwerken und ist auf Genehmigungen aus Brüssel angewiesen.
Mit der jüngsten Novelle der Strommarktverordnung wurde die europäische Regulierungsagentur ACER bereits verpflichtet, die Methodik für die Bewertung der Versorgungssicherheit zu überarbeiten. Laut Sikow-Magny arbeiten außerdem die Generaldirektionen für Energie und Wettbewerb daran, ihre internen Prozesse anzupassen, um die Genehmigung von Kapazitätsmechanismen zu beschleunigen. ber
Angesichts auslaufender Beihilfemöglichkeiten müssen die EU-Staaten nach Ansicht der Kommission rasch Entscheidungen zur Förderung der Solarindustrie und anderer grüner Produktionszweige treffen. “Für den befristeten Beihilferahmen TCTF nähert sich die Deadline, auch die Aufbau- und Resilienzfazilität läuft bald aus”, sagte Maive Rute, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Binnenmarkt am Dienstag bei einem Solarkongress in Brüssel.
Im Net-Zero Industry Act haben sich die EU-Staaten verpflichtet, die Produktionskapazitäten für Solartechnik bis 2030 massiv auszubauen. In einem Brief an die Mitgliedstaaten hatten die Kommissare Kadri Simson und Thierry Breton die nationalen Regierungen bereits dazu gedrängt, eigenes Geld in die Hand zu nehmen und die Möglichkeiten des TCTF für erhöhte Förderbeträge auszuschöpfen. Der Beihilferahmen ist bis Ende 2025 befristet. Die Möglichkeit, Investitionen mit EU-Mitteln aus der ARF zu fördern, läuft ein Jahr später aus.
Die Solarbranche stört sich allerdings daran, dass der TCTF keine Förderung für laufende Kosten ermöglicht. Banken würden Investitionen durch die längere Absicherung leichter finanzieren, so das Argument. Hinter vorgehaltener Hand gibt es auch Kritik daran, dass die höchsten Förderquoten nur für Projekte in benachteiligten Regionen möglich sind. “Wenn man abseits industrieller Zentren investieren soll, treibt das die Kosten für den Aufbau einer geschlossenen Lieferkette enorm in die Höhe“, sagte ein Solarmanager am Rande der Brüsseler Konferenz. ber
Deutschland und Frankreich wollen zusammen daran arbeiten, der Ukraine Munition auf dem Weltmarkt zu beschaffen. Das vereinbarten Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Ressortchef Stéphane Séjourné bei einem Treffen am Dienstag in Paris, wie es aus Delegationskreisen verlautete. Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, wie Deutschland und Frankreich “mit ganz konkreten Maßnahmen” die Ukraine unterstützen könnten, “zum Beispiel durch die weltweite Beschaffung von Munition”, hieß es weiter.
Die Ukraine klagt derzeit auch über den Mangel an Munition, weshalb den russischen Streitkräften wiederholt Geländegewinne vor allem an der Ostfront gelungen sind. In ihrem “guten und vertrauensvollen Gespräch” hätten Baerbock und Séjourné auch darüber gesprochen, wie Deutschland und Frankreich zum Friedensfonds der Europäischen Union für die Ukraine (European Peace Facility) beitragen könnten, hieß es in den Delegationskreisen weiter. Zudem sei beraten worden, wie beide Länder “Versuchen zur Destabilisierung Moldaus entgegenwirken” könnten.
Baerbock trat am Dienstagmorgen dem Eindruck entgegen, dass es eine ernsthafte Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gebe. “Tiefe Freundschaft, Verbundenheit drückt sich nicht darin aus, dass man immer einer Meinung ist“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Sarajevo. rtr
Die EU darf Biodiesel aus Malaysia künftig als erneuerbaren Biokraftstoffen ausschließen. Einen entsprechenden Sieg hat die Europäische Union am Dienstag bei der Welthandelsorganisation (WTO) errungen, als ein Schiedsgericht eine malaysische Beschwerde gegen eine EU-Entscheidung abwies.
In der ersten WTO-Entscheidung im Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern stimmte ein dreiköpfiges Gremium mit zwei zu eins Stimmen dafür, Malaysias inhaltliche Forderungen zurückzuweisen. Allerdings gaben sie Malaysia Recht in dessen Beschwerde über die Art und Weise, wie die Maßnahmen vorbereitet, veröffentlicht und verwaltet wurde. Indonesien, das ebenfalls geklagt hatte, ließ daraufhin seine Beschwerde fallen und beantragte die Aussetzung der Arbeit des Panels.
Hintergrund ist, dass künftig EU-weit ein Anteil von zehn Prozent an Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll, dazu zählen auch Biokraftstoffe auf pflanzlicher Basis. Die EU schließt Pflanzen aus, die auf abgeholzten Flächen angebaut werden oder bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie den Anbau von Nahrungsmitteln verdrängen, die dann auf gerodeten Flächen angebaut wurden. Daher hatte die EU hat festgelegt, dass Biokraftstoff auf Palmölbasis bis 2030 nicht mehr zu den erneuerbaren Energiequellen zählen soll. Malaysia und Indonesien, die beiden größten Palmölproduzenten der Welt, hatten daraufhin bei der WTO Klage gegen die Europäische Union eingereicht. rtr/lei

Mit jeder Vorwahl, die Donald Trump gewinnt, wird die dunkle Wolke über der Nato bedrohlicher. Werden sich die Europäer auch in Zukunft auf ihren stärksten Verbündeten verlassen können? Mit welcher politischen Taktik könnten sie sich am besten auf eine mögliche Rückkehr Trumps in das Weiße Haus vorbereiten?
Die Meinungen darüber gehen auseinander: Während die einen – darunter auch die Regierung in Berlin – hoffen, den unberechenbaren Trump mit steigenden Verteidigungsausgaben beeindrucken zu können, würden Erdoğan, Orbán und Fico dem Rechtspopulisten in Washington wohl freudig entgegeneilen. In Polen, im Baltikum sowie in Ost- und Nordeuropa ist man hingegen tief besorgt: Würde der ohnehin fragile Konsens zur Unterstützung der Ukraine mit Trump weiter halten?
Seine erste Begegnung mit Donald Trump hat das westliche Verteidigungsbündnis nur knapp überlebt. Mehrfach war dieser kurz davor, der in seinen Augen “obsoleten Nato” den Rücken zu kehren. Ex-Präsident Trump beschimpfte seine europäischen Partner regelmäßig als Trittbrettfahrer und behauptete, sie würden ihm Geld schulden. Seine groß angekündigten “Deals” mit Nordkorea und Russland sowie seine “Friedensinitiative” im Nahen Osten zog Trump im Alleingang durch.
Auch an dem mit den Taliban ausgehandelten Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan ließ er die europäischen Nato-Verbündeten unbeteiligt. Das Ergebnis war ein strategisches Desaster für den Westen. Nein, das Trumpsche Credo “Make America Great Again” ist der Nato nicht gut bekommen.
Mit dem ehemaligen niederländischen Regierungschef Mark Rutte, der wohl zum neuen Nato-Generalsekretär erkoren wird, hoffen nun einige Europäer, Trump irgendwie einfangen zu können. Man müsse ihm nur geduldig erklären, dass die europäischen Verbündeten in den letzten Jahren viel mehr Geld für ihre Verteidigung in die Hand genommen haben und bereit seien, künftig mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen, so Rutte.
Ob der Holländer, der auch als “Trump-Flüsterer” bezeichnet wird, diesen Punkt überzeugend rüberbringen kann, darf bezweifelt werden. Nachdem Rutte 2010 die Regierungsgeschäfte in Den Haag übernommen hatte, fuhren die niederländischen Verteidigungsausgaben jahrelang beständig in den Keller (2015 lagen sie bei 1,13 Prozent). Auch in den letzten beiden Jahren blieben sie deutlich unter zwei Prozent.
Mit einer Charmeoffensive werden die Europäer Trump wohl kaum davon abhalten können, die Nato unter Druck zu setzten und eventuell sogar nachhaltig zu beschädigen. Warum? Erstens ist und bleibt Trump ein Überzeugungstäter – ein außenpolitischer Isolationist, der multilateralen Organisationen grundsätzlich feindlich gegenübersteht. Er glaubt an “Dealmaking unter den Großen” und nicht an komplizierte “Konsensfindung zu 32”.
Zweitens haben sich Trump und seine Anhänger intensiv auf eine Rückkehr in das Weiße Haus vorbereitet, auch verteidigungspolitisch. Sein MAGA-Dunstkreis propagiert seit Längerem, dass Trump die Nato am liebsten “einschläfern” wolle. In Zukunft sollten die Europäer ihren Kontinent konventionell selbst verteidigen. Einzig den nuklearen Schutzschirm würden die USA in Europa erhalten.
Drittens hätte Trump etliche Möglichkeiten, der Nato konkret zu schaden. Sie reichen von der Reduzierung der amerikanischen Truppenstärke in Europa, dem “No show” der USA bei wichtigen Nato-Treffen, der Kürzung von Finanzmitteln für den militärischen und zivilen Haushalt der Nato, bis zu dem bewussten Säen öffentlicher Zweifel an der Bündnistreue der USA. Sind die Verbündeten auf solche Szenarien vorbereitet? Wohl kaum, denn im Nato-Hauptquartier wird darüber offiziell nicht geredet.
Die Nato wird sicher nicht über die künftige finanzielle Lastenteilung ins Trudeln geraten. Der Graben, der zwischen den Verbündeten immer tiefer wird, betrifft fundamentale strategische Themen: das Schicksal der Ukraine und den Umgang mit Russland. Trumps Ankündigung, nach einem Wahlsieg rasch einen “Deal” mit dem Mafiaregime in Moskau machen zu wollen, lässt nicht nur den Ukrainern das Blut in den Adern gefrieren, sondern auch den Briten, Balten, Polen, Skandinaviern und Ostmitteleuropäern: also all denjenigen, die der Konfrontation mit Russland nicht ausweichen wollen.
Das Bündnis “Trump proof” zu machen, heißt für diese Ländergruppe (zu denen ich Deutschland nicht zähle), die Reihen gegenüber Moskau eng geschlossen zu halten und sich auf alle Eventualitäten konkret vorzubereiten – notfalls auch ohne amerikanische Hilfe. Sie haben ihre wetterfeste Sturmjacke bereits griffbereit.
Dr. Stefanie Babst ist Beigeordnete Stellvertretende Nato-Generalsekretärin a.D.; Strategische Beraterin und Publizistin.
