die neuen EU-Kommissare haben am Sonntag ihr Amt angetreten, die Außenbeauftragte Kaja Kallas und der neue Ratspräsident António Costa setzten mit ihrer Reise nach Kiew auch gleich ein Ausrufezeichen. Teils noch unklar war zum Start hingegen, wie die Neuen ihre engsten Mitarbeiterstäbe besetzen.
Die Verzögerung liegt nicht allein am Gezerre im Europaparlament um die Bestätigung der 26 Kommissarinnen und Kommissare. Manche Personalie wartete noch auf die Zustimmung von Ursula von der Leyens Kabinettschef Björn Seibert. Dieser wollte sich am Wochenende damit beschäftigen.
Es zeichnet sich ab, dass deutsche EU-Beamte etliche der einflussreichen Posten in den Kabinetten besetzen werden. Mindestens vier deutsche Kabinettschefs dürfte es geben, neben Seibert noch Bernd Biervert (bei Handelskommissar Maroš Šefčovič) und Andreas Schwarz (Forschungskommissarin Ekaterina Sachariewa). Michael Hager leitet weiter das Kabinett von Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis, zwischenzeitlich hatte ein Wechsel im Raum gestanden.
Hinzu kommen mehrere Vize-Kabinettschefs mit deutschem Pass. Bei Vizepräsident Stéphane Séjourné wird es die Deutschfranzösin Estelle Göger, bei Roxana Mînzatu wohl der bisherige Referatsleiter Max Uebe, bei Justizkommissar Michael McGrath Joachim Herrmann, der schon dem Vorgänger Didier Reynders diente. Mit Julia Lemke wechselt nach unseren Informationen zudem eine deutsche EU-Beamtin ins Kabinett von Teresa Ribera, der für Klima und Wettbewerb verantwortlichen ersten Vizepräsidentin. Dort für die Klimapolitik zuständig sein wird die Spanierin Valvanera Ulargui.
Auch Costa holt mindestens einen Deutschen in sein Team: Albrecht Morgenstern, langjähriger Beamter im Bundeskanzleramt, wird stellvertretender wirtschaftspolitischer Berater und damit Vize des Dänen Jakob Wegener Friis.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

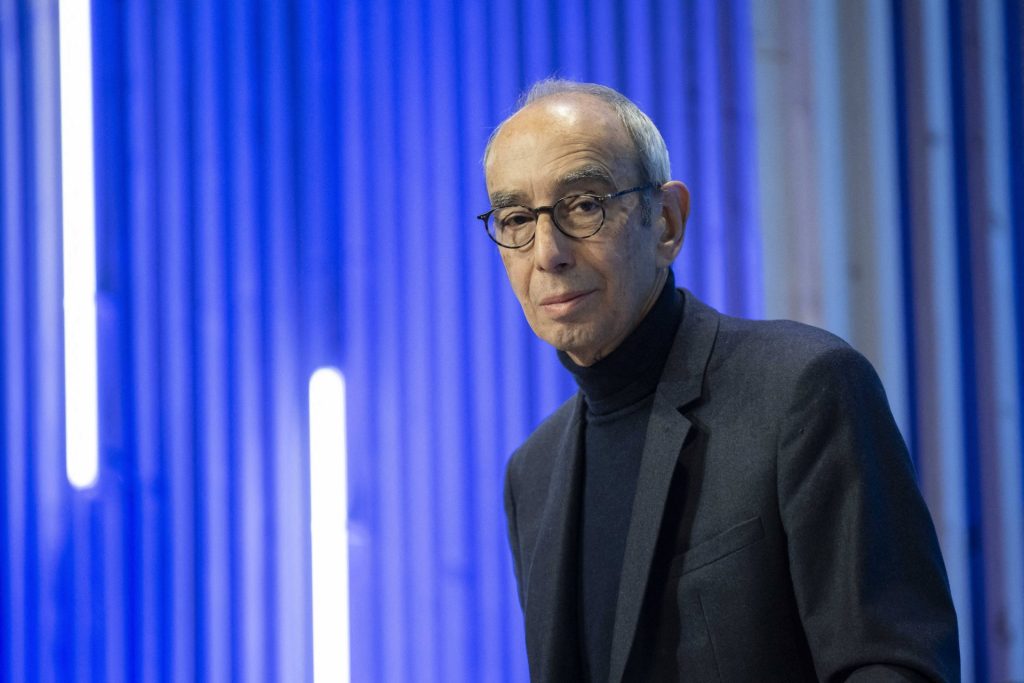
Herr Pisani-Ferry, der Haushaltsstreit in Frankreich beunruhigt die Finanzmärkte. Glauben Sie, dass er gelöst werden kann?
Absolut. Die Frage ist nur: zu welchem Preis? Die Zugeständnisse von Premierminister Barnier an Marine Le Pen summieren sich bereits auf mindestens drei Milliarden Euro. Die Frage ist: Wie hoch ist der Preis dafür, dass der Rassemblement National ein Misstrauensvotum nicht unterstützt? Wenn er zu hoch ist, dann ist es vielleicht nicht die bessere Lösung als der Sturz der jetzigen Regierung, der zu einer erneuten Ernennung Barniers mit einem anderen Kabinett führen könnte.
Wie besorgt sind Sie, dass es im Falle eines erfolgreichen Misstrauensvotums zu ernsthaften Marktturbulenzen kommen könnte?
Wir leben in gefährlichen Zeiten. Das Niveau der Anleiherenditen ist hoch …
Zuletzt sogar höher als die Renditen auf griechische Staatsanleihen …
Ja, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Sie sind immer noch viel niedriger als jene auf italienische Staatsanleihen. Die Krise steht nicht vor der Tür, aber wir sind in einer unbequemen Lage.
Könnte die Marktreaktion ein disziplinierender Faktor für die politischen Akteure, für Marine Le Pen, sein?
Ja, aber das geht in beide Richtungen. Wenn Barnier den Sturz seiner Regierung vermeiden will, muss er Marine Le Pen weitere Zugeständnisse machen. Aber der Markt würde zu viele Kompromisse als Bestätigung dafür interpretieren, dass es keinen Konsens für eine Haushaltskonsolidierung in Frankreich gibt und dass selbst die von der Regierung geplante begrenzte Konsolidierung nicht durchgesetzt werden kann.
Sind der Rassemblement National und Marine Le Pen Ihrer Meinung nach interessiert daran, einen Kompromiss zu finden, oder wollen sie die Regierung Barnier stürzen?
Ich denke, sie sind eher daran interessiert, einen Kompromiss zu finden, weil sie noch nicht bereit sind, zu regieren und in einer Präsidentschaftswahl zu kämpfen. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob Marine Le Pen überhaupt zur Wahl antreten darf. Aber sie brauchen Zugeständnisse von Barnier, um ihren Wählern zu zeigen, dass sie für sie kämpfen.
Der französische Haushalt könnte der erste wirkliche Test für die neuen Haushaltsregeln der EU sein. Was würden Sie der EU-Kommission raten?
Sie sollte eine Kombination aus Strenge, Durchsetzung der Regeln und Spielraum für Anpassungen verfolgen. Die Kommission hat den Haushaltsentwurf, wie er ursprünglich von Barnier vorgelegt wurde, im Wesentlichen gebilligt. Es könnte einige Spielräume für Steuersenkungen oder Ausgabenüberschreitungen geben, aber sie müssen begrenzt sein. Jeder spielt hier mit seiner Glaubwürdigkeit.
Wie blicken Sie auf die deutsche Debatte über die Schuldenbremse?
Deutschland kämpft mit der deutschen Regel, nicht mit den europäischen Regeln. Es wäre vernünftig zu versuchen, einige Flexibilitäten in der Schuldenbremse zu finden, um die Prioritäten anzugehen. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Soweit ich weiß, hat Friedrich Merz eine gewisse Offenheit für Änderungen an der Schuldenbremse signalisiert. Das wäre zu begrüßen, denn die Regeln waren zu streng und haben es Deutschland nicht ermöglicht, seine Verpflichtungen in Bezug auf Verteidigungsausgaben oder zusätzliche Investitionen in den grünen Wandel zu erfüllen. Aber die Anpassung muss in einer Weise erfolgen, die die disziplinierende Wirkung der Regeln im Wesentlichen bewahrt.
In einem neuen Bericht weisen Sie auf die großen Herausforderungen hin, Investitionen zu mobilisieren, um die EU-Klimaziele für 2030 zu erreichen. Lassen denn die EU-Schuldenregeln den Regierungen genügend Spielraum?
Wir werden bald mit einer doppelten Einschränkung konfrontiert sein: auf Seite der EU-Gelder, weil die Aufbau- und Resilienzfazilität 2026 ausläuft; und auf nationaler Ebene, wo die EU-Fiskalregeln in mehreren Ländern nicht genügend Spielraum für grüne Investitionen bieten. Wenn wir dieses Problem nicht angehen, besteht die Gefahr, dass die grüne Transformation scheitert.
Warum?
Der Umbau ist auch für die öffentlichen Haushalte kostspielig. Viele Haushalte oder KMU haben begrenzten finanziellen Spielraum. Sie brauchen eine gewisse Unterstützung durch die öffentliche Hand, um ihre Investitionen zu finanzieren. Wenn den Regierungen oder der EU kein zusätzlicher Spielraum eingeräumt wird, besteht das Risiko, dass die EU ihre Klimaziele für 2030 nicht erreichen wird. Wenn sich dadurch die Renovierung und Nachrüstung einiger privater Gebäude verzögert, ist das nicht so schlimm. Aber wenn die Investitionen in erneuerbare Energien dadurch ausgebremst werden oder die Einführung von Elektroautos verzögert, wäre das sehr nachteilig. Dann würden Produktionskapazitäten verschwendet.
Der Absatz von Elektroautos hat sich in fast ganz Europa verlangsamt, das Batterie-Start-up Northvolt hat Insolvenz angemeldet, der Stahlhersteller Thyssen-Krupp baut Tausende von Arbeitsplätzen ab. Wie viel Steuergeld sollte angesichts dieser Risiken überhaupt in die Transformation gesteckt werden?
Der Bedarf hängt von dem jeweiligen Land ab, aber im Großen und Ganzen liegt er zwischen 0,5 und ein Prozent des BIP pro Jahr. Und wir sprechen hier von einer mehrjährigen Investition. Es gibt immer Möglichkeiten, öffentliche Ausgaben durch Regulierung zu ersetzen, aber das bedeutet, dass die Last vom öffentlichen auf den privaten Sektor verlagert wird. Und die Frage ist, ob sich der private Sektor diese Investition tatsächlich leisten kann. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass der fehlende fiskalische Spielraum die Transformation scheitern lässt.
In Deutschland plädieren etwa CDU und FDP dafür, die Transformation weitgehend den Märkten zu überlassen und nur über den CO₂-Preis zu lenken.
Auch hier stellt sich die Frage: Sind die Unternehmen in der Lage, den CO₂-Preis zu zahlen oder nicht? Mein Eindruck ist, dass einige Unternehmen profitabel genug sind, um dies leisten können. Andere sind es nicht.
Was sollten die Regierungen Ihrer Meinung nach tun?
Das Wichtigste sind klare und verlässliche Ziele.
Also kein Rückzieher beim Verbrenner-Verbot bis 2035?
Ich glaube nicht, dass das klug wäre. Bestimmte Autohersteller können es sich leisten, weiterhin sowohl in Elektroautos als auch in Verbrennungsmotoren zu investieren, andere nicht. Die Entscheidung für das Verbrennerverbot wurde getroffen. Und die Unternehmen haben begonnen, ihre Investitionen von Verbrennern auf Elektroautos zu verlagern.
Aber sie steuern die Investitionen teils wieder um, weil die Verbraucher nicht im erwarteten Umfang E-Autos kaufen.
Die Verbraucher kaufen die Fahrzeuge nicht, weil sie zu teuer sind. In Frankreich entspricht der Kauf eines E-Autos oder die Umrüstung eines Hauses und dem Einbau einer Wärmepumpe dem Jahreseinkommen eines Mittelklasse-Haushalts. Das ist eine Menge. Und viele dieser Haushalte sind bereits verschuldet. Sie werden also nicht kaufen. Ich fürchte, das Risiko wächst immer mehr, dass die Transformation entgleist.
Die Regierungen sollen also den Kauf von Elektroautos oder Wärmepumpen fördern?
Für Haushalte, die es sich sonst nicht leisten können, ja. Aber in Frankreich setzt der Staatshaushalt Maßnahmen dieser Art enge Grenzen. In anderen Ländern sind es die europäischen Schuldenregeln. Ich denke, diese Beschränkungen sollten gelockert werden, um etwa den Markt für Elektroautos in Schwung zu bringen.
Wenn Sie in der Haut des neuen Haushaltskommissars Piotr Serafin stecken würden, wie würden Sie den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen gestalten?
Ich habe 2003 am Sapir-Bericht mitgewirkt, der den EU-Haushalt als historisches Relikt kritisiert hat. Seitdem hat sich nicht viel geändert. Die Lehren aus der Aufbau- und Resilienzfazilität sind, dass man viel erreichen kann, wenn man die Transfers an Leistungsindikatoren auf nationaler Ebene knüpft.
Das ist der Ansatz, den Ursula von der Leyen verfolgt.
Ich halte das für eine gute Idee.
Das Gipfeltreffen der fünf skandinavischen und drei baltischen Staaten – NB-8 genannt – war eine Premiere: Zu den Gesprächen über die Sicherheit im Ostseeraum und die langfristige Unterstützung der Ukraine, die am Mittwoch im schwedischen Harpsund stattfanden, wurde mit Donald Tusk zum ersten Mal in der NB-8-Geschichte auch ein polnischer Ministerpräsident eingeladen.
Der Pole nutzte das Forum, um in Anbetracht der russischen hybriden Kriegsführung gemeinsame Patrouillen in den baltischen Gewässern vorzuschlagen. “Es gibt Anzeichen dafür, dass die Russen zumindest an ernsthaften Sabotageaktivitäten in Polen beteiligt waren”, sagte Tusk. “Ich denke, es wird für uns alle besser sein, wenn wir die volle Kontrolle über unsere Hoheitsgewässer haben.” Sein Vorschlag stieß nach den Beschädigungen der Glasfaserkabel, mutmaßlich durch das chinesische Schiff Yi Peng 3, auf offene Ohren.
Die Einladung der nordischen Länder an den polnischen Ministerpräsidenten zeugt von der wachsenden Bedeutung Polens auf der internationalen Bühne. 35 Jahre nach der Wende wird das 37-Millionen-Einwohner-Land zu einem der wichtigsten außenpolitischen Akteure in Europa. Während Frankreich und Deutschland mit Regierungskrisen und wirtschaftlicher Stagnation zu kämpfen haben und international eine starke Führung vermissen lassen, stößt Polen in die Lücke vor und baut im Norden Europas neue Allianzen auf. Mit deren Hilfe könnte das Land, das am 1. Januar 2025 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, seine Agenda besser durchsetzen.
Die Annäherung an den Norden ist auch ein Ausdruck der Enttäuschung, die in Polen über Deutschland empfunden wird. Der zögerliche Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der militärischen Unterstützung der Ukraine, die Unfähigkeit, die Ausgaben für die Sicherheit deutlich zu steigern und die Rüstungsproduktion anzukurbeln, stoßen auf Kritik und Unverständnis.
Nach dem Besuch von Kanzler Scholz in Polen im Sommer haben sich die Beziehungen weiter abgekühlt. Tusk habe lange gehofft, dass Scholz die “Größe der Herausforderungen” verstehe, die sich aus der russischen Aggression für Europa ergebe, heißt es im Umfeld des Ministerpräsidenten. Er sei aber auf einen Buchhalter getroffen, der von Zeitenwende spricht, aber nicht viel tut.
Zuletzt stichelte Tusk gegen Deutschland im Hinblick auf den Verteidigungshaushalt: Zwei Prozent des BIP für die Verteidigung seien für jedes Land zumutbar. Polen hat seine Ausgaben für die Sicherheit seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auf 4,2 Prozent des BIP verdoppelt. Deutschland will dieses Jahr knapp die Zwei-Prozent-Marke erreichen.
Mit den baltischen und skandinavischen Ländern pflegt Polen ausgewogene Partnerschaften. Außerdem stimmen alle Länder der Region in den meisten politischen Fragen überein: Sie sehen Russland als existenzielle Bedrohung und wollen ihre Verteidigung und Sicherheit stärken. Sie treten für eine massive Einschränkung der Migration ein und sind – wie Finnland – bereit, das Asylrecht an ihren östlichen Grenzen außer Kraft zu setzen. Sie wollen unbedingt starke transatlantische Beziehungen aufrechterhalten, aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften verbessern.
Auch das Auseinanderdriften der drei Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die lange Zeit Eckpfeiler der polnischen Regionalpolitik waren, zwingt Polen zum Nord-Nordost-Kurs. Seitdem sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán als engster Verbündeter Wladimir Putins entpuppte und der slowakische Regierungschef Robert Fico die Unterstützung der Ukraine einstellte, ist der Dialog verstummt.
Natürlich spielt auch die Innenpolitik bei dem Kurswechsel eine Rolle – im Mai 2025 wird in Polen ein Präsident gewählt. Der Kandidat der Bürgerkoalition muss gewinnen, wenn Tusk seine Reformen durchsetzen will. Tusk, der von den Nationalpopulisten als “Berlins Agent” beschimpft wird, möchte wenig Angriffsfläche bieten.
In den meisten Ländern der EU wird Polens Aufstieg gewürdigt. Nicht so in Deutschland, wo noch bis vor Kurzem über polnische Autodiebe gescherzt wurde und “polnische Wirtschaft” als Synonym von Chaos gebraucht wird. “Polen fühlt sich in Deutschland unterschätzt”, sagt Janusz Reiter, Polens Ex-Botschafter in Deutschland.
Tusk will Polen einen Einfluss sichern, der dem Land, seinem Wirtschaftspotenzial und seiner Größe gerecht wird. Seit der russischen Invasion ist Polen ein Frontstaat, über den fast die gesamte militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine läuft. Diese geopolitische Lage macht Warschau zu einem wichtigen, sogar unverzichtbaren Partner in Europa. In Skandinavien und im Baltikum hat man das längst verstanden, in Deutschland vergisst man es immer wieder: Zum Abschiedsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin hatte Kanzler Scholz die Regierungschefs von Großbritannien und Frankreich eingeladen – Tusk musste zu Hause bleiben.
Die Kommission hat zu ihrem Amtsantritt am Sonntag überarbeitete Mission Letters veröffentlicht. Im Arbeitsauftrag für Klimakommissar Wopke Hoekstra hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Formulierung zum Auslaufen fossiler Subventionen abgeschwächt. Sollte Hoekstra in der Fassung vom September noch einen Rahmen für den Phase-out entwickeln, ist nun nur noch von einem Fahrplan die Rede – “auch im Zusammenhang mit dem nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen”. Mit “Rahmen” sind im EU-Kontext meist Gesetze gemeint.
Weicher formuliert hat von der Leyen außerdem die Sprache zur Klimaanpassung. Gestrichen wurde der Arbeitsauftrag an Hoekstra, eine neue Bewertung zur Notwendigkeit von Gesetzen zur Klimaanpassung und konkrete Optionen vorzulegen. Neue Gesetzgebung zur Resilienz gegenüber Klimaveränderungen wird allerdings weiter in Aussicht gestellt.
Im Arbeitsauftrag für Energiekommissar Dan Jørgensen sichert von der Leyen nun ein EU-Ziel für erneuerbare Energien für das Jahr 2040 zu. Offen bleibt allerdings, ob es verpflichtend oder nur freiwillig sein soll. Die Änderung gehört zu den Zusagen an die Grünen im Europaparlament vor der Bestätigung der Kommission. Jørgensen soll außerdem eine Analyse zu Spekulationen auf dem Immobilienmarkt vorlegen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen vorschlagen.
Im Mission Letter für Umweltkommissarin Jessika Roswall wird nun die Dringlichkeit betont, mit dem Paket für die Chemieindustrie “so schnell wie möglich” Klarheit über die Regulierung von Ewigkeitschemikalien (PFAS) zu schaffen. Für Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat von der Leyen klargestellt, dass er einen Legislativvorschlag für saubere Dienstwagenflotten vorlegen soll. Eine Reihe von Mission Letters blieb dagegen unverändert – etwa für Teresa Ribera, Stéphane Séjourné, Valdis Dombrovskis und Piotr Serafin. ber/mgr
Die Kommission treibt das einheitliche europäische Unternehmensrecht voran, bis Ende 2025 will sie ihre Initiative für das 28. Regime vorlegen. So steht es in einem zweiseitigen Zeitplan für das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2025, den Table.Briefings einsehen konnte. Das 28. Regime soll Start-ups eine einheitliche regulatorische Grundlage in der EU bieten.
Die Initiativen für die ersten 100 Tage sind bereits weitgehend bekannt. Das Arbeitsprogramm sieht für diesen Zeitraum außerdem die Vorstellung des European Competitiveness Fund vor. Darin will die Kommission die Forschungs- und Innovationsfonds – einschließlich des Europäischen Forschungsrats (ERC) und des Europäischen Innovationsrats (EIC) – in einem neuen Mega-Wettbewerbsfähigkeitsfonds bündeln. Dieser würde dann Bestandteil des neuen Mittelfristigen Finanzplans.
Außerdem steht die AI Factories Initiative bei Vizepräsidentin Henna Virkkunen auf dem Plan. Die Initiative soll vor allem Start-ups und KMU bei der Entwicklung vertrauenswürdiger KI unterstützen. Zudem will die Kommission einen Plan für die Cybersecurity von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern entwickeln.
Bis Juni sollen dann auch die Guidelines für den Schutz Minderjähriger unter dem Digital Services Act stehen. Hier geht es vor allem um die Entwicklung eines einheitlichen und verlässlichen Altersnachweises. Erst in der zweiten Jahreshälfte muss die neue Start-up-Kommissarin Ekatarina Sachariewa das European Start-up and Scale-up Forum auf die Beine stellen. Es soll die Rahmenbedingungen für Start-ups und Scale-ups in der EU verbessern helfen. Im November soll dann das erste Assessment des Digital Services Act erfolgen.
Für das Ende des Jahres kündigt die Kommission eine Studie an, um die Hindernisse für den Handel von Investmentanteilen von innovativen Wachstumsunternehmen zu identifizieren sowie eine Empfehlung für Mustervertragsklauseln für die gemeinsame Nutzung von Daten und Cloud Computing auszusprechen. Auf dem Programm steht dann auch ein neues Gesetz: eine Verordnung über die einheitliche digitale Buchung und Ausstellung von Fahrscheinen. Sie soll sicherzustellen, dass Reisende in der EU nur auf einer Plattform einen Fahrschein kaufen müssen, wobei ihre Fahrgastrechte für die gesamte Reise gesichert sind. ber/vis
Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält vorübergehende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland für eine Option, um ein schnelles Ende des Krieges zu erreichen. Das sagte er im Interview mit Table.Briefings. “Wenn die Waffenstillstandslinie bedeutet, dass Russland weiterhin alle besetzten Gebiete kontrolliert, heißt das nicht, dass die Ukraine das Gebiet für immer aufgeben muss”, sagte der künftige Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schloss am Sonntag eine Nato-Mitgliedschaft seines Landes ohne die russisch besetzten Gebiete aus. Erst im November aber hatte er Nato-Sicherheitsgarantien nur für die regierungskontrollierten Teile der Ukraine selbst ins Gespräch gebracht. Keith Kellog, designierter Ukraine-Gesandter des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, hatte zuletzt ähnliche Überlegungen skizziert.
“Es zeigt, dass wir alle ein Ende des Krieges wollen”, sagt Stoltenberg. Wichtig sei, dass die Regierung in Kiew im Gegenzug für vorübergehende Gebietsabtretungen Sicherheitsgarantien erhalte. Das könnte die Nato-Mitgliedschaft sein, so Stoltenberg, es gebe aber auch “andere Möglichkeiten, die Ukrainer zu bewaffnen und zu unterstützen.”
Er unterstützt Selenskyjs Forderung, bei einem Waffenstillstand keine Gebiete an Russland abzutreten, hält dies aber mit Blick auf die militärische Lage derzeit für wenig wahrscheinlich. “Wir brauchen eine Waffenstillstandslinie, und natürlich sollte diese Linie idealerweise alle Gebiete einschließen, die Russland derzeit kontrolliert. Wir sehen aber, dass das in naher Zukunft nicht unbedingt realistisch ist.” wp

Der neue EU-Ratspräsident António Costa hat der Ukraine zügige Fortschritte im EU-Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Gemeinsam werde man daran arbeiten, im ersten Halbjahr des nächsten Jahres mindestens zwei Bereiche der Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, sagte der frühere portugiesische Ministerpräsident am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Gemeinsam mit Chefdiplomatin Kaja Kallas und Erweiterungskommissarin Marta Kos ist Costa zu Beginn seiner Amtszeit in die Ukraine gereist.
In verschiedenen Politikbereichen, wie etwa beim Roaming zur kostengünstigen Handynutzung im Ausland, beginne bereits eine schrittweise Integration, sagte Costa. Zudem sicherte er der Ukraine weitere EU-Finanzhilfen und entschlossene Arbeiten am 15. Paket mit Russland-Sanktionen zu. Vom kommenden Jahr an wolle man aus Erlösen eingefrorener Vermögenswerte Russlands in der EU monatlich 1,5 Milliarden Euro an Unterstützung leisten, sagte er. Zudem werde man mit weiteren Sanktionen den Druck auf die russische Wirtschaft erhöhen und Russlands Fähigkeit, Krieg zu führen, schwächen.
Die Europäische Union hatte die Beitrittsverhandlungen mit der von Russland angegriffenen Ukraine offiziell Anfang des Sommers eröffnet. Wie lange sie dauern werden und ob sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können, ist offen.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas hält es für denkbar, dass irgendwann einmal Soldaten aus Mitgliedstaaten einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern. “Ich denke, wir sollten wirklich nichts ausschließen”, sagte die frühere estnische Ministerpräsidentin in Kiew. Das sei auch aus strategischen Gründen gut. Die Soldaten dafür könnten nach Einschätzung von Kallas zum Beispiel aus Ländern kommen, die sich bereits in der Vergangenheit offen für Gespräche über eine Truppenentsendung geäußert hatten. Dazu zählen zum Beispiel Frankreich oder die baltischen Staaten. dpa
Nach Auszählung von 90% der Stimmen liegen die regierenden Sozialdemokraten (PSD) bei 23,9% und führen vor der rechtsextremen Allianz für die Vereinigung Rumäniens (AUR), die 17,9% erreicht hat. Weitere Gruppierungen wie die rechtsextremen Parteien SOS (7,2%) und POT (5,8%) könnten erstmals ins Parlament einziehen. Die politische Landschaft zeigt sich stark zersplittert, was die Bildung einer stabilen Regierung erschweren dürfte.
Premierminister Marcel Ciolacu kündigte an, in den kommenden Tagen Koalitionsgespräche zu führen, wobei eine Zusammenarbeit mit extremen Parteien als unwahrscheinlich gilt. Differenzen über die dringend nötige Haushaltskonsolidierung könnten jedoch auch Verhandlungen mit moderaten Parteien erschweren. Politikwissenschaftler sprechen von der “fragmentiertesten politischen Landschaft seit 1990“.
Parallel entscheidet das Verfassungsgericht heute, Montag, ob die erste Runde der Präsidentschaftswahl aufgrund von Manipulationsvorwürfen wiederholt wird. Das Ergebnis dieser Wahl könnte die Regierungsbildung weiter beeinflussen, da der Präsident den Premierminister nominiert. Eine mögliche Neuwahl könnte am 15. Dezember stattfinden. jum
Nach der Parlamentswahl in Irland deuten Prognosen auf schwierige Mehrheitsverhältnisse zur Bildung einer stabilen Regierung hin. Die beiden großen Mitte-rechts-Parteien sind Hochrechnungen vom Samstag zufolge nach den Wahlen vom Freitag zwar auf bestem Weg, wieder an die Macht zu kommen. Sie werden aber wohl mindestens einen neuen, kleineren Partner brauchen. Themen im Wahlkampf waren die gestiegenen Lebenshaltungskosten, Migration, hohe Immobilienpreise und Wohnungsnot.
Die Regierungsparteien Fine Gael und Fianna Fáil kamen den aktuellen Erhebungen von Virgin Media News zufolge auf 20,5 beziehungsweise 21,9 Prozent der Erststimmen. Sinn Féin erhielt etwa 19,1 Prozent, beide Mitte-rechts-Parteien haben jedoch eine Allianz mit der linken Partei ausgeschlossen.
Für eine Mehrheit im Parlament sind 88 Sitze erforderlich. Auch bei einer Allianz werden Fina Gael und Fianna Fáil den Prognosen zufolge nicht an diese Marke herankommen. Die naheliegendsten Kandidaten für eine Koalition wären die Mitte-links-Parteien Labour und die Sozialdemokraten. Eine Allianz aus vier Partnern statt drei würde die Bildung einer Regierung komplizierter machen. Der derzeitige Junior-Koalitionspartner, die Grünen, könnte alle seine zwölf Sitze verlieren.
Fianna-Fáil-Chef Micheál Martin sagte dem Sender RTE am Samstagabend, es sei noch viel zu früh, um über mögliche Partner zu sprechen. Das gelte auch für die Frage, ob er der nächste Ministerpräsident werden könnte.
Die linke Sinn Féin schien noch vor gut einem Jahr auf dem besten Weg zu sein, die nächste Regierung anzuführen. Sie verlor im Verlauf aber an Zustimmung, was zum Teil auf eine Verärgerung bei potenziellen Wählern über eine relativ liberale Einwanderungspolitik zurückgeführt wurde.
Fine Gael und Fianna Fail, die seit der Gründung des Staates vor fast einem Jahrhundert jede Regierung angeführt haben, hatten sich während der vergangenen Regierungsperiode darauf geeinigt, des Amt des Ministerpräsidenten jeweils für die Hälfte der fünfjährigen Amtszeit der anderen Partei zuzugestehen. Eine ähnliche Vereinbarung scheint auch dieses Mal wahrscheinlich. rtr

Die geopolitischen Spannungen zum Start der neuen EU-Kommission sind unübersehbar: Russlands imperialistischer Krieg gegen die Ukraine, Chinas zunehmend aggressives Auftreten und die Unsicherheiten rund um die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus prägen die globale Agenda. In diesem Spannungsfeld müssen wir verhindern, dass die deutsche wirtschaftliche Schwäche zu einer sicherheitspolitischen Achillesferse für ganz Europa wird und unsere europäische Lebensart bedroht.
Drei Prioritäten sollten dabei im Mittelpunkt stehen:
Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands und Europas wird davon abhängen, wie entschlossen wir bürokratische Hürden abbauen. Fast 65 Prozent der Berichtspflichten haben ihren Ursprung in Brüssel – besonders zulasten kleiner und mittlerer Unternehmen. Ein verbindlicher Abbaupfad für Regulierungen ist längst überfällig, statt schlecht durchdachte Regulierungen wie die EU-Lieferkettenrichtlinie, die durch übermäßige bürokratische Last unsere Wettbewerbsfähigkeit schmälert.
Das ist genauso wenig regulatorische Effizienz wie geplante Regulierung zum Klimaschutz. Statt sektorspezifischer Regulierungen wie CO₂-Flottengrenzwerte, Energieeffizienzrichtlinie und Industrieemissionsrichtlinie brauchen wir einen funktionierenden europäischen Emissionshandel.
Zur Reduzierung der gefährlichen Abhängigkeiten von China müssen Freihandelsabkommen wie das mit den Mercosur-Staaten, aber auch mit Indien und Indonesien, endlich Realität werden. Dabei dürfen wir Drittstaaten nicht regulatorisch erdrücken und sollten moralische Belehrungen unterlassen. In der Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung sollten wir der EU-Kommission den Rücken für Verhandlungen stärken. Hier braucht es jetzt schnell proaktive Angebote. So können wir auch unsere Ziele erreichen, zum Beispiel sektorale Abkommen, etwa über Seltene Erden. Diese Art der Diversifizierung von China liegt auch im Interesse von Trump.
Durch finanzpolitische Stabilität bewahren wir uns Handlungsspielraum, um auf Schocks zu reagieren und unsere Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Der von Christian Lindner ausgehandelte reformierte Stabilitäts- und Wachstumspakt bietet dafür eine Blaupause, der von der neuen Kommission konsequent umgesetzt werden muss.
Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen 2028-2034 muss die Ausgaben unsere EU-Mittel auf Zukunftsinvestitionen ausrichten – auf das, was uns schützt und nützt. So sollten Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Sicherheit Priorität haben. Statt auf Eurobonds mit Vetospielern wie Ungarn am Tisch zu setzen, müssen wir ungenutzte Mittel aus bestehenden EU-Töpfen umschichten und den Dschungel der Förderprogramme entflechten. Der Schutz vor Missbrauch von EU-Geldern und das Einhalten rechtsstaatlicher Regeln müssen Bedingungen für die Auszahlung von EU-Geldern bleiben.
Für die Glaubwürdigkeit der europäischen Verteidigungsfähigkeit hat die neue Kommission bereits wichtige Signale gesetzt, etwa mit der Einrichtung der Europäischen Friedensfazilität zur Unterstützung der Ukraine oder der Ernennung eines Verteidigungskommissars. Weitere Investitionen in die Sicherheit ermöglichen wir auch durch die Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Investitionsbank. Mit einer angepassten EU-Taxonomie kann sie als Hebel zur Mobilisierung privaten Kapitals dienen.
Unsere Sicherheit hängt auch davon ab, dass wir neue Partner gewinnen. Dafür muss die neue Kommission im Beitrittsprozess verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Das bedeutet ehrliche Angebote und häufigere qualifizierte Mehrheitsentscheidungen, um neue Gesprächsphasen im Beitrittsprozess einzuleiten. Der leistungsorientierte Ansatz für eine Vollmitgliedschaft muss dabei beibehalten werden, denn eine EU-Mitgliedschaft gibt es nicht zum Rabatt. Die EU muss aber auch geostrategisch wichtigen Partnern wie der Ukraine und der Republik Moldau zeigen, was sie im Gegensatz zu den imperialen Bestrebungen aus Peking und Moskau zu bieten hat.
Letztendlich dürfen wir uns nicht selbst im Weg stehen, sondern die neue EU-Kommission muss Europa stärken, indem sie das Leben der Europäerinnen und Europäer freier, einfacher und sicherer macht. Das gelingt in der neuen geopolitischen Ausgangslage nur durch eine entschlossene Wirtschaftswende, einen treffsicheren Einsatz von EU-Mitteln und Investitionen in unsere Sicherheit.
die neuen EU-Kommissare haben am Sonntag ihr Amt angetreten, die Außenbeauftragte Kaja Kallas und der neue Ratspräsident António Costa setzten mit ihrer Reise nach Kiew auch gleich ein Ausrufezeichen. Teils noch unklar war zum Start hingegen, wie die Neuen ihre engsten Mitarbeiterstäbe besetzen.
Die Verzögerung liegt nicht allein am Gezerre im Europaparlament um die Bestätigung der 26 Kommissarinnen und Kommissare. Manche Personalie wartete noch auf die Zustimmung von Ursula von der Leyens Kabinettschef Björn Seibert. Dieser wollte sich am Wochenende damit beschäftigen.
Es zeichnet sich ab, dass deutsche EU-Beamte etliche der einflussreichen Posten in den Kabinetten besetzen werden. Mindestens vier deutsche Kabinettschefs dürfte es geben, neben Seibert noch Bernd Biervert (bei Handelskommissar Maroš Šefčovič) und Andreas Schwarz (Forschungskommissarin Ekaterina Sachariewa). Michael Hager leitet weiter das Kabinett von Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis, zwischenzeitlich hatte ein Wechsel im Raum gestanden.
Hinzu kommen mehrere Vize-Kabinettschefs mit deutschem Pass. Bei Vizepräsident Stéphane Séjourné wird es die Deutschfranzösin Estelle Göger, bei Roxana Mînzatu wohl der bisherige Referatsleiter Max Uebe, bei Justizkommissar Michael McGrath Joachim Herrmann, der schon dem Vorgänger Didier Reynders diente. Mit Julia Lemke wechselt nach unseren Informationen zudem eine deutsche EU-Beamtin ins Kabinett von Teresa Ribera, der für Klima und Wettbewerb verantwortlichen ersten Vizepräsidentin. Dort für die Klimapolitik zuständig sein wird die Spanierin Valvanera Ulargui.
Auch Costa holt mindestens einen Deutschen in sein Team: Albrecht Morgenstern, langjähriger Beamter im Bundeskanzleramt, wird stellvertretender wirtschaftspolitischer Berater und damit Vize des Dänen Jakob Wegener Friis.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

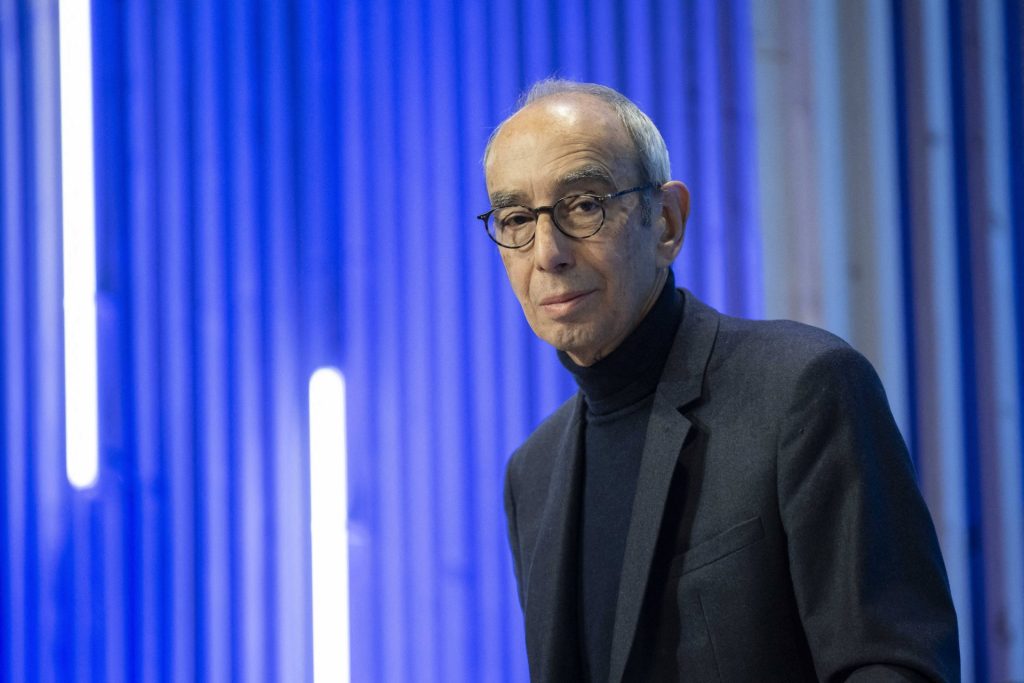
Herr Pisani-Ferry, der Haushaltsstreit in Frankreich beunruhigt die Finanzmärkte. Glauben Sie, dass er gelöst werden kann?
Absolut. Die Frage ist nur: zu welchem Preis? Die Zugeständnisse von Premierminister Barnier an Marine Le Pen summieren sich bereits auf mindestens drei Milliarden Euro. Die Frage ist: Wie hoch ist der Preis dafür, dass der Rassemblement National ein Misstrauensvotum nicht unterstützt? Wenn er zu hoch ist, dann ist es vielleicht nicht die bessere Lösung als der Sturz der jetzigen Regierung, der zu einer erneuten Ernennung Barniers mit einem anderen Kabinett führen könnte.
Wie besorgt sind Sie, dass es im Falle eines erfolgreichen Misstrauensvotums zu ernsthaften Marktturbulenzen kommen könnte?
Wir leben in gefährlichen Zeiten. Das Niveau der Anleiherenditen ist hoch …
Zuletzt sogar höher als die Renditen auf griechische Staatsanleihen …
Ja, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Sie sind immer noch viel niedriger als jene auf italienische Staatsanleihen. Die Krise steht nicht vor der Tür, aber wir sind in einer unbequemen Lage.
Könnte die Marktreaktion ein disziplinierender Faktor für die politischen Akteure, für Marine Le Pen, sein?
Ja, aber das geht in beide Richtungen. Wenn Barnier den Sturz seiner Regierung vermeiden will, muss er Marine Le Pen weitere Zugeständnisse machen. Aber der Markt würde zu viele Kompromisse als Bestätigung dafür interpretieren, dass es keinen Konsens für eine Haushaltskonsolidierung in Frankreich gibt und dass selbst die von der Regierung geplante begrenzte Konsolidierung nicht durchgesetzt werden kann.
Sind der Rassemblement National und Marine Le Pen Ihrer Meinung nach interessiert daran, einen Kompromiss zu finden, oder wollen sie die Regierung Barnier stürzen?
Ich denke, sie sind eher daran interessiert, einen Kompromiss zu finden, weil sie noch nicht bereit sind, zu regieren und in einer Präsidentschaftswahl zu kämpfen. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob Marine Le Pen überhaupt zur Wahl antreten darf. Aber sie brauchen Zugeständnisse von Barnier, um ihren Wählern zu zeigen, dass sie für sie kämpfen.
Der französische Haushalt könnte der erste wirkliche Test für die neuen Haushaltsregeln der EU sein. Was würden Sie der EU-Kommission raten?
Sie sollte eine Kombination aus Strenge, Durchsetzung der Regeln und Spielraum für Anpassungen verfolgen. Die Kommission hat den Haushaltsentwurf, wie er ursprünglich von Barnier vorgelegt wurde, im Wesentlichen gebilligt. Es könnte einige Spielräume für Steuersenkungen oder Ausgabenüberschreitungen geben, aber sie müssen begrenzt sein. Jeder spielt hier mit seiner Glaubwürdigkeit.
Wie blicken Sie auf die deutsche Debatte über die Schuldenbremse?
Deutschland kämpft mit der deutschen Regel, nicht mit den europäischen Regeln. Es wäre vernünftig zu versuchen, einige Flexibilitäten in der Schuldenbremse zu finden, um die Prioritäten anzugehen. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Soweit ich weiß, hat Friedrich Merz eine gewisse Offenheit für Änderungen an der Schuldenbremse signalisiert. Das wäre zu begrüßen, denn die Regeln waren zu streng und haben es Deutschland nicht ermöglicht, seine Verpflichtungen in Bezug auf Verteidigungsausgaben oder zusätzliche Investitionen in den grünen Wandel zu erfüllen. Aber die Anpassung muss in einer Weise erfolgen, die die disziplinierende Wirkung der Regeln im Wesentlichen bewahrt.
In einem neuen Bericht weisen Sie auf die großen Herausforderungen hin, Investitionen zu mobilisieren, um die EU-Klimaziele für 2030 zu erreichen. Lassen denn die EU-Schuldenregeln den Regierungen genügend Spielraum?
Wir werden bald mit einer doppelten Einschränkung konfrontiert sein: auf Seite der EU-Gelder, weil die Aufbau- und Resilienzfazilität 2026 ausläuft; und auf nationaler Ebene, wo die EU-Fiskalregeln in mehreren Ländern nicht genügend Spielraum für grüne Investitionen bieten. Wenn wir dieses Problem nicht angehen, besteht die Gefahr, dass die grüne Transformation scheitert.
Warum?
Der Umbau ist auch für die öffentlichen Haushalte kostspielig. Viele Haushalte oder KMU haben begrenzten finanziellen Spielraum. Sie brauchen eine gewisse Unterstützung durch die öffentliche Hand, um ihre Investitionen zu finanzieren. Wenn den Regierungen oder der EU kein zusätzlicher Spielraum eingeräumt wird, besteht das Risiko, dass die EU ihre Klimaziele für 2030 nicht erreichen wird. Wenn sich dadurch die Renovierung und Nachrüstung einiger privater Gebäude verzögert, ist das nicht so schlimm. Aber wenn die Investitionen in erneuerbare Energien dadurch ausgebremst werden oder die Einführung von Elektroautos verzögert, wäre das sehr nachteilig. Dann würden Produktionskapazitäten verschwendet.
Der Absatz von Elektroautos hat sich in fast ganz Europa verlangsamt, das Batterie-Start-up Northvolt hat Insolvenz angemeldet, der Stahlhersteller Thyssen-Krupp baut Tausende von Arbeitsplätzen ab. Wie viel Steuergeld sollte angesichts dieser Risiken überhaupt in die Transformation gesteckt werden?
Der Bedarf hängt von dem jeweiligen Land ab, aber im Großen und Ganzen liegt er zwischen 0,5 und ein Prozent des BIP pro Jahr. Und wir sprechen hier von einer mehrjährigen Investition. Es gibt immer Möglichkeiten, öffentliche Ausgaben durch Regulierung zu ersetzen, aber das bedeutet, dass die Last vom öffentlichen auf den privaten Sektor verlagert wird. Und die Frage ist, ob sich der private Sektor diese Investition tatsächlich leisten kann. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass der fehlende fiskalische Spielraum die Transformation scheitern lässt.
In Deutschland plädieren etwa CDU und FDP dafür, die Transformation weitgehend den Märkten zu überlassen und nur über den CO₂-Preis zu lenken.
Auch hier stellt sich die Frage: Sind die Unternehmen in der Lage, den CO₂-Preis zu zahlen oder nicht? Mein Eindruck ist, dass einige Unternehmen profitabel genug sind, um dies leisten können. Andere sind es nicht.
Was sollten die Regierungen Ihrer Meinung nach tun?
Das Wichtigste sind klare und verlässliche Ziele.
Also kein Rückzieher beim Verbrenner-Verbot bis 2035?
Ich glaube nicht, dass das klug wäre. Bestimmte Autohersteller können es sich leisten, weiterhin sowohl in Elektroautos als auch in Verbrennungsmotoren zu investieren, andere nicht. Die Entscheidung für das Verbrennerverbot wurde getroffen. Und die Unternehmen haben begonnen, ihre Investitionen von Verbrennern auf Elektroautos zu verlagern.
Aber sie steuern die Investitionen teils wieder um, weil die Verbraucher nicht im erwarteten Umfang E-Autos kaufen.
Die Verbraucher kaufen die Fahrzeuge nicht, weil sie zu teuer sind. In Frankreich entspricht der Kauf eines E-Autos oder die Umrüstung eines Hauses und dem Einbau einer Wärmepumpe dem Jahreseinkommen eines Mittelklasse-Haushalts. Das ist eine Menge. Und viele dieser Haushalte sind bereits verschuldet. Sie werden also nicht kaufen. Ich fürchte, das Risiko wächst immer mehr, dass die Transformation entgleist.
Die Regierungen sollen also den Kauf von Elektroautos oder Wärmepumpen fördern?
Für Haushalte, die es sich sonst nicht leisten können, ja. Aber in Frankreich setzt der Staatshaushalt Maßnahmen dieser Art enge Grenzen. In anderen Ländern sind es die europäischen Schuldenregeln. Ich denke, diese Beschränkungen sollten gelockert werden, um etwa den Markt für Elektroautos in Schwung zu bringen.
Wenn Sie in der Haut des neuen Haushaltskommissars Piotr Serafin stecken würden, wie würden Sie den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen gestalten?
Ich habe 2003 am Sapir-Bericht mitgewirkt, der den EU-Haushalt als historisches Relikt kritisiert hat. Seitdem hat sich nicht viel geändert. Die Lehren aus der Aufbau- und Resilienzfazilität sind, dass man viel erreichen kann, wenn man die Transfers an Leistungsindikatoren auf nationaler Ebene knüpft.
Das ist der Ansatz, den Ursula von der Leyen verfolgt.
Ich halte das für eine gute Idee.
Das Gipfeltreffen der fünf skandinavischen und drei baltischen Staaten – NB-8 genannt – war eine Premiere: Zu den Gesprächen über die Sicherheit im Ostseeraum und die langfristige Unterstützung der Ukraine, die am Mittwoch im schwedischen Harpsund stattfanden, wurde mit Donald Tusk zum ersten Mal in der NB-8-Geschichte auch ein polnischer Ministerpräsident eingeladen.
Der Pole nutzte das Forum, um in Anbetracht der russischen hybriden Kriegsführung gemeinsame Patrouillen in den baltischen Gewässern vorzuschlagen. “Es gibt Anzeichen dafür, dass die Russen zumindest an ernsthaften Sabotageaktivitäten in Polen beteiligt waren”, sagte Tusk. “Ich denke, es wird für uns alle besser sein, wenn wir die volle Kontrolle über unsere Hoheitsgewässer haben.” Sein Vorschlag stieß nach den Beschädigungen der Glasfaserkabel, mutmaßlich durch das chinesische Schiff Yi Peng 3, auf offene Ohren.
Die Einladung der nordischen Länder an den polnischen Ministerpräsidenten zeugt von der wachsenden Bedeutung Polens auf der internationalen Bühne. 35 Jahre nach der Wende wird das 37-Millionen-Einwohner-Land zu einem der wichtigsten außenpolitischen Akteure in Europa. Während Frankreich und Deutschland mit Regierungskrisen und wirtschaftlicher Stagnation zu kämpfen haben und international eine starke Führung vermissen lassen, stößt Polen in die Lücke vor und baut im Norden Europas neue Allianzen auf. Mit deren Hilfe könnte das Land, das am 1. Januar 2025 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, seine Agenda besser durchsetzen.
Die Annäherung an den Norden ist auch ein Ausdruck der Enttäuschung, die in Polen über Deutschland empfunden wird. Der zögerliche Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der militärischen Unterstützung der Ukraine, die Unfähigkeit, die Ausgaben für die Sicherheit deutlich zu steigern und die Rüstungsproduktion anzukurbeln, stoßen auf Kritik und Unverständnis.
Nach dem Besuch von Kanzler Scholz in Polen im Sommer haben sich die Beziehungen weiter abgekühlt. Tusk habe lange gehofft, dass Scholz die “Größe der Herausforderungen” verstehe, die sich aus der russischen Aggression für Europa ergebe, heißt es im Umfeld des Ministerpräsidenten. Er sei aber auf einen Buchhalter getroffen, der von Zeitenwende spricht, aber nicht viel tut.
Zuletzt stichelte Tusk gegen Deutschland im Hinblick auf den Verteidigungshaushalt: Zwei Prozent des BIP für die Verteidigung seien für jedes Land zumutbar. Polen hat seine Ausgaben für die Sicherheit seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auf 4,2 Prozent des BIP verdoppelt. Deutschland will dieses Jahr knapp die Zwei-Prozent-Marke erreichen.
Mit den baltischen und skandinavischen Ländern pflegt Polen ausgewogene Partnerschaften. Außerdem stimmen alle Länder der Region in den meisten politischen Fragen überein: Sie sehen Russland als existenzielle Bedrohung und wollen ihre Verteidigung und Sicherheit stärken. Sie treten für eine massive Einschränkung der Migration ein und sind – wie Finnland – bereit, das Asylrecht an ihren östlichen Grenzen außer Kraft zu setzen. Sie wollen unbedingt starke transatlantische Beziehungen aufrechterhalten, aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften verbessern.
Auch das Auseinanderdriften der drei Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die lange Zeit Eckpfeiler der polnischen Regionalpolitik waren, zwingt Polen zum Nord-Nordost-Kurs. Seitdem sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán als engster Verbündeter Wladimir Putins entpuppte und der slowakische Regierungschef Robert Fico die Unterstützung der Ukraine einstellte, ist der Dialog verstummt.
Natürlich spielt auch die Innenpolitik bei dem Kurswechsel eine Rolle – im Mai 2025 wird in Polen ein Präsident gewählt. Der Kandidat der Bürgerkoalition muss gewinnen, wenn Tusk seine Reformen durchsetzen will. Tusk, der von den Nationalpopulisten als “Berlins Agent” beschimpft wird, möchte wenig Angriffsfläche bieten.
In den meisten Ländern der EU wird Polens Aufstieg gewürdigt. Nicht so in Deutschland, wo noch bis vor Kurzem über polnische Autodiebe gescherzt wurde und “polnische Wirtschaft” als Synonym von Chaos gebraucht wird. “Polen fühlt sich in Deutschland unterschätzt”, sagt Janusz Reiter, Polens Ex-Botschafter in Deutschland.
Tusk will Polen einen Einfluss sichern, der dem Land, seinem Wirtschaftspotenzial und seiner Größe gerecht wird. Seit der russischen Invasion ist Polen ein Frontstaat, über den fast die gesamte militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine läuft. Diese geopolitische Lage macht Warschau zu einem wichtigen, sogar unverzichtbaren Partner in Europa. In Skandinavien und im Baltikum hat man das längst verstanden, in Deutschland vergisst man es immer wieder: Zum Abschiedsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin hatte Kanzler Scholz die Regierungschefs von Großbritannien und Frankreich eingeladen – Tusk musste zu Hause bleiben.
Die Kommission hat zu ihrem Amtsantritt am Sonntag überarbeitete Mission Letters veröffentlicht. Im Arbeitsauftrag für Klimakommissar Wopke Hoekstra hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Formulierung zum Auslaufen fossiler Subventionen abgeschwächt. Sollte Hoekstra in der Fassung vom September noch einen Rahmen für den Phase-out entwickeln, ist nun nur noch von einem Fahrplan die Rede – “auch im Zusammenhang mit dem nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen”. Mit “Rahmen” sind im EU-Kontext meist Gesetze gemeint.
Weicher formuliert hat von der Leyen außerdem die Sprache zur Klimaanpassung. Gestrichen wurde der Arbeitsauftrag an Hoekstra, eine neue Bewertung zur Notwendigkeit von Gesetzen zur Klimaanpassung und konkrete Optionen vorzulegen. Neue Gesetzgebung zur Resilienz gegenüber Klimaveränderungen wird allerdings weiter in Aussicht gestellt.
Im Arbeitsauftrag für Energiekommissar Dan Jørgensen sichert von der Leyen nun ein EU-Ziel für erneuerbare Energien für das Jahr 2040 zu. Offen bleibt allerdings, ob es verpflichtend oder nur freiwillig sein soll. Die Änderung gehört zu den Zusagen an die Grünen im Europaparlament vor der Bestätigung der Kommission. Jørgensen soll außerdem eine Analyse zu Spekulationen auf dem Immobilienmarkt vorlegen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen vorschlagen.
Im Mission Letter für Umweltkommissarin Jessika Roswall wird nun die Dringlichkeit betont, mit dem Paket für die Chemieindustrie “so schnell wie möglich” Klarheit über die Regulierung von Ewigkeitschemikalien (PFAS) zu schaffen. Für Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat von der Leyen klargestellt, dass er einen Legislativvorschlag für saubere Dienstwagenflotten vorlegen soll. Eine Reihe von Mission Letters blieb dagegen unverändert – etwa für Teresa Ribera, Stéphane Séjourné, Valdis Dombrovskis und Piotr Serafin. ber/mgr
Die Kommission treibt das einheitliche europäische Unternehmensrecht voran, bis Ende 2025 will sie ihre Initiative für das 28. Regime vorlegen. So steht es in einem zweiseitigen Zeitplan für das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2025, den Table.Briefings einsehen konnte. Das 28. Regime soll Start-ups eine einheitliche regulatorische Grundlage in der EU bieten.
Die Initiativen für die ersten 100 Tage sind bereits weitgehend bekannt. Das Arbeitsprogramm sieht für diesen Zeitraum außerdem die Vorstellung des European Competitiveness Fund vor. Darin will die Kommission die Forschungs- und Innovationsfonds – einschließlich des Europäischen Forschungsrats (ERC) und des Europäischen Innovationsrats (EIC) – in einem neuen Mega-Wettbewerbsfähigkeitsfonds bündeln. Dieser würde dann Bestandteil des neuen Mittelfristigen Finanzplans.
Außerdem steht die AI Factories Initiative bei Vizepräsidentin Henna Virkkunen auf dem Plan. Die Initiative soll vor allem Start-ups und KMU bei der Entwicklung vertrauenswürdiger KI unterstützen. Zudem will die Kommission einen Plan für die Cybersecurity von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern entwickeln.
Bis Juni sollen dann auch die Guidelines für den Schutz Minderjähriger unter dem Digital Services Act stehen. Hier geht es vor allem um die Entwicklung eines einheitlichen und verlässlichen Altersnachweises. Erst in der zweiten Jahreshälfte muss die neue Start-up-Kommissarin Ekatarina Sachariewa das European Start-up and Scale-up Forum auf die Beine stellen. Es soll die Rahmenbedingungen für Start-ups und Scale-ups in der EU verbessern helfen. Im November soll dann das erste Assessment des Digital Services Act erfolgen.
Für das Ende des Jahres kündigt die Kommission eine Studie an, um die Hindernisse für den Handel von Investmentanteilen von innovativen Wachstumsunternehmen zu identifizieren sowie eine Empfehlung für Mustervertragsklauseln für die gemeinsame Nutzung von Daten und Cloud Computing auszusprechen. Auf dem Programm steht dann auch ein neues Gesetz: eine Verordnung über die einheitliche digitale Buchung und Ausstellung von Fahrscheinen. Sie soll sicherzustellen, dass Reisende in der EU nur auf einer Plattform einen Fahrschein kaufen müssen, wobei ihre Fahrgastrechte für die gesamte Reise gesichert sind. ber/vis
Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält vorübergehende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland für eine Option, um ein schnelles Ende des Krieges zu erreichen. Das sagte er im Interview mit Table.Briefings. “Wenn die Waffenstillstandslinie bedeutet, dass Russland weiterhin alle besetzten Gebiete kontrolliert, heißt das nicht, dass die Ukraine das Gebiet für immer aufgeben muss”, sagte der künftige Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schloss am Sonntag eine Nato-Mitgliedschaft seines Landes ohne die russisch besetzten Gebiete aus. Erst im November aber hatte er Nato-Sicherheitsgarantien nur für die regierungskontrollierten Teile der Ukraine selbst ins Gespräch gebracht. Keith Kellog, designierter Ukraine-Gesandter des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, hatte zuletzt ähnliche Überlegungen skizziert.
“Es zeigt, dass wir alle ein Ende des Krieges wollen”, sagt Stoltenberg. Wichtig sei, dass die Regierung in Kiew im Gegenzug für vorübergehende Gebietsabtretungen Sicherheitsgarantien erhalte. Das könnte die Nato-Mitgliedschaft sein, so Stoltenberg, es gebe aber auch “andere Möglichkeiten, die Ukrainer zu bewaffnen und zu unterstützen.”
Er unterstützt Selenskyjs Forderung, bei einem Waffenstillstand keine Gebiete an Russland abzutreten, hält dies aber mit Blick auf die militärische Lage derzeit für wenig wahrscheinlich. “Wir brauchen eine Waffenstillstandslinie, und natürlich sollte diese Linie idealerweise alle Gebiete einschließen, die Russland derzeit kontrolliert. Wir sehen aber, dass das in naher Zukunft nicht unbedingt realistisch ist.” wp

Der neue EU-Ratspräsident António Costa hat der Ukraine zügige Fortschritte im EU-Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Gemeinsam werde man daran arbeiten, im ersten Halbjahr des nächsten Jahres mindestens zwei Bereiche der Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, sagte der frühere portugiesische Ministerpräsident am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Gemeinsam mit Chefdiplomatin Kaja Kallas und Erweiterungskommissarin Marta Kos ist Costa zu Beginn seiner Amtszeit in die Ukraine gereist.
In verschiedenen Politikbereichen, wie etwa beim Roaming zur kostengünstigen Handynutzung im Ausland, beginne bereits eine schrittweise Integration, sagte Costa. Zudem sicherte er der Ukraine weitere EU-Finanzhilfen und entschlossene Arbeiten am 15. Paket mit Russland-Sanktionen zu. Vom kommenden Jahr an wolle man aus Erlösen eingefrorener Vermögenswerte Russlands in der EU monatlich 1,5 Milliarden Euro an Unterstützung leisten, sagte er. Zudem werde man mit weiteren Sanktionen den Druck auf die russische Wirtschaft erhöhen und Russlands Fähigkeit, Krieg zu führen, schwächen.
Die Europäische Union hatte die Beitrittsverhandlungen mit der von Russland angegriffenen Ukraine offiziell Anfang des Sommers eröffnet. Wie lange sie dauern werden und ob sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können, ist offen.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas hält es für denkbar, dass irgendwann einmal Soldaten aus Mitgliedstaaten einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern. “Ich denke, wir sollten wirklich nichts ausschließen”, sagte die frühere estnische Ministerpräsidentin in Kiew. Das sei auch aus strategischen Gründen gut. Die Soldaten dafür könnten nach Einschätzung von Kallas zum Beispiel aus Ländern kommen, die sich bereits in der Vergangenheit offen für Gespräche über eine Truppenentsendung geäußert hatten. Dazu zählen zum Beispiel Frankreich oder die baltischen Staaten. dpa
Nach Auszählung von 90% der Stimmen liegen die regierenden Sozialdemokraten (PSD) bei 23,9% und führen vor der rechtsextremen Allianz für die Vereinigung Rumäniens (AUR), die 17,9% erreicht hat. Weitere Gruppierungen wie die rechtsextremen Parteien SOS (7,2%) und POT (5,8%) könnten erstmals ins Parlament einziehen. Die politische Landschaft zeigt sich stark zersplittert, was die Bildung einer stabilen Regierung erschweren dürfte.
Premierminister Marcel Ciolacu kündigte an, in den kommenden Tagen Koalitionsgespräche zu führen, wobei eine Zusammenarbeit mit extremen Parteien als unwahrscheinlich gilt. Differenzen über die dringend nötige Haushaltskonsolidierung könnten jedoch auch Verhandlungen mit moderaten Parteien erschweren. Politikwissenschaftler sprechen von der “fragmentiertesten politischen Landschaft seit 1990“.
Parallel entscheidet das Verfassungsgericht heute, Montag, ob die erste Runde der Präsidentschaftswahl aufgrund von Manipulationsvorwürfen wiederholt wird. Das Ergebnis dieser Wahl könnte die Regierungsbildung weiter beeinflussen, da der Präsident den Premierminister nominiert. Eine mögliche Neuwahl könnte am 15. Dezember stattfinden. jum
Nach der Parlamentswahl in Irland deuten Prognosen auf schwierige Mehrheitsverhältnisse zur Bildung einer stabilen Regierung hin. Die beiden großen Mitte-rechts-Parteien sind Hochrechnungen vom Samstag zufolge nach den Wahlen vom Freitag zwar auf bestem Weg, wieder an die Macht zu kommen. Sie werden aber wohl mindestens einen neuen, kleineren Partner brauchen. Themen im Wahlkampf waren die gestiegenen Lebenshaltungskosten, Migration, hohe Immobilienpreise und Wohnungsnot.
Die Regierungsparteien Fine Gael und Fianna Fáil kamen den aktuellen Erhebungen von Virgin Media News zufolge auf 20,5 beziehungsweise 21,9 Prozent der Erststimmen. Sinn Féin erhielt etwa 19,1 Prozent, beide Mitte-rechts-Parteien haben jedoch eine Allianz mit der linken Partei ausgeschlossen.
Für eine Mehrheit im Parlament sind 88 Sitze erforderlich. Auch bei einer Allianz werden Fina Gael und Fianna Fáil den Prognosen zufolge nicht an diese Marke herankommen. Die naheliegendsten Kandidaten für eine Koalition wären die Mitte-links-Parteien Labour und die Sozialdemokraten. Eine Allianz aus vier Partnern statt drei würde die Bildung einer Regierung komplizierter machen. Der derzeitige Junior-Koalitionspartner, die Grünen, könnte alle seine zwölf Sitze verlieren.
Fianna-Fáil-Chef Micheál Martin sagte dem Sender RTE am Samstagabend, es sei noch viel zu früh, um über mögliche Partner zu sprechen. Das gelte auch für die Frage, ob er der nächste Ministerpräsident werden könnte.
Die linke Sinn Féin schien noch vor gut einem Jahr auf dem besten Weg zu sein, die nächste Regierung anzuführen. Sie verlor im Verlauf aber an Zustimmung, was zum Teil auf eine Verärgerung bei potenziellen Wählern über eine relativ liberale Einwanderungspolitik zurückgeführt wurde.
Fine Gael und Fianna Fail, die seit der Gründung des Staates vor fast einem Jahrhundert jede Regierung angeführt haben, hatten sich während der vergangenen Regierungsperiode darauf geeinigt, des Amt des Ministerpräsidenten jeweils für die Hälfte der fünfjährigen Amtszeit der anderen Partei zuzugestehen. Eine ähnliche Vereinbarung scheint auch dieses Mal wahrscheinlich. rtr

Die geopolitischen Spannungen zum Start der neuen EU-Kommission sind unübersehbar: Russlands imperialistischer Krieg gegen die Ukraine, Chinas zunehmend aggressives Auftreten und die Unsicherheiten rund um die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus prägen die globale Agenda. In diesem Spannungsfeld müssen wir verhindern, dass die deutsche wirtschaftliche Schwäche zu einer sicherheitspolitischen Achillesferse für ganz Europa wird und unsere europäische Lebensart bedroht.
Drei Prioritäten sollten dabei im Mittelpunkt stehen:
Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands und Europas wird davon abhängen, wie entschlossen wir bürokratische Hürden abbauen. Fast 65 Prozent der Berichtspflichten haben ihren Ursprung in Brüssel – besonders zulasten kleiner und mittlerer Unternehmen. Ein verbindlicher Abbaupfad für Regulierungen ist längst überfällig, statt schlecht durchdachte Regulierungen wie die EU-Lieferkettenrichtlinie, die durch übermäßige bürokratische Last unsere Wettbewerbsfähigkeit schmälert.
Das ist genauso wenig regulatorische Effizienz wie geplante Regulierung zum Klimaschutz. Statt sektorspezifischer Regulierungen wie CO₂-Flottengrenzwerte, Energieeffizienzrichtlinie und Industrieemissionsrichtlinie brauchen wir einen funktionierenden europäischen Emissionshandel.
Zur Reduzierung der gefährlichen Abhängigkeiten von China müssen Freihandelsabkommen wie das mit den Mercosur-Staaten, aber auch mit Indien und Indonesien, endlich Realität werden. Dabei dürfen wir Drittstaaten nicht regulatorisch erdrücken und sollten moralische Belehrungen unterlassen. In der Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung sollten wir der EU-Kommission den Rücken für Verhandlungen stärken. Hier braucht es jetzt schnell proaktive Angebote. So können wir auch unsere Ziele erreichen, zum Beispiel sektorale Abkommen, etwa über Seltene Erden. Diese Art der Diversifizierung von China liegt auch im Interesse von Trump.
Durch finanzpolitische Stabilität bewahren wir uns Handlungsspielraum, um auf Schocks zu reagieren und unsere Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Der von Christian Lindner ausgehandelte reformierte Stabilitäts- und Wachstumspakt bietet dafür eine Blaupause, der von der neuen Kommission konsequent umgesetzt werden muss.
Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen 2028-2034 muss die Ausgaben unsere EU-Mittel auf Zukunftsinvestitionen ausrichten – auf das, was uns schützt und nützt. So sollten Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Sicherheit Priorität haben. Statt auf Eurobonds mit Vetospielern wie Ungarn am Tisch zu setzen, müssen wir ungenutzte Mittel aus bestehenden EU-Töpfen umschichten und den Dschungel der Förderprogramme entflechten. Der Schutz vor Missbrauch von EU-Geldern und das Einhalten rechtsstaatlicher Regeln müssen Bedingungen für die Auszahlung von EU-Geldern bleiben.
Für die Glaubwürdigkeit der europäischen Verteidigungsfähigkeit hat die neue Kommission bereits wichtige Signale gesetzt, etwa mit der Einrichtung der Europäischen Friedensfazilität zur Unterstützung der Ukraine oder der Ernennung eines Verteidigungskommissars. Weitere Investitionen in die Sicherheit ermöglichen wir auch durch die Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Investitionsbank. Mit einer angepassten EU-Taxonomie kann sie als Hebel zur Mobilisierung privaten Kapitals dienen.
Unsere Sicherheit hängt auch davon ab, dass wir neue Partner gewinnen. Dafür muss die neue Kommission im Beitrittsprozess verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Das bedeutet ehrliche Angebote und häufigere qualifizierte Mehrheitsentscheidungen, um neue Gesprächsphasen im Beitrittsprozess einzuleiten. Der leistungsorientierte Ansatz für eine Vollmitgliedschaft muss dabei beibehalten werden, denn eine EU-Mitgliedschaft gibt es nicht zum Rabatt. Die EU muss aber auch geostrategisch wichtigen Partnern wie der Ukraine und der Republik Moldau zeigen, was sie im Gegensatz zu den imperialen Bestrebungen aus Peking und Moskau zu bieten hat.
Letztendlich dürfen wir uns nicht selbst im Weg stehen, sondern die neue EU-Kommission muss Europa stärken, indem sie das Leben der Europäerinnen und Europäer freier, einfacher und sicherer macht. Das gelingt in der neuen geopolitischen Ausgangslage nur durch eine entschlossene Wirtschaftswende, einen treffsicheren Einsatz von EU-Mitteln und Investitionen in unsere Sicherheit.
