nach den Europawahlen 2024 war die EU-Kommission mit sich selbst zufrieden. Denn nach ihrer Ansicht hat es keine nennenswerten Desinformationskampagnen rund um die Wahlen gegeben. Anders bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien. Die Rumänen, so hieß es damals aus der EU-Kommission, hätten darauf verzichtet, sich gemeinsam mit der Behörde vorzubereiten und rechtzeitig die zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu benutzen, um die Integrität der Wahlen zu schützen.
Deutschland will das anders machen. Vielleicht ein bisschen spät, aber die wirklich heiße Phase des Bundestagswahlkampfs steht ja noch bevor. Bereits vor einer Woche lud die Bundesnetzagentur als Digital Services Coordinator (DSC) mit der Kommission zu einem runden Tisch nach Berlin. Gemeinsam mit den sehr großen Online-Plattformen und -Suchmaschinen besprachen sie die Verpflichtungen der Unternehmen nach dem Digital Services Act (DSA). Am Tisch saßen Vertreter von Youtube, Linkedin, Microsoft, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok und X sowie von nationalen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Heute nun folgt der Stresstest, der im EU-Jargon Tabletop Exercise heißt. In einer simulierten Krisenübung werden die Akteure vom runden Tisch durchspielen, wie sie auf eine hypothetische Bedrohung oder Krise reagieren würden. Ziel ist es, Schwachstellen in bestehenden Abläufen zu identifizieren, die Zusammenarbeit zwischen Beteiligten zu verbessern und Reaktionsmechanismen zu testen. Wie reagiere ich auf einen Angriff russischer Trollarmeen? Oder auf manipulierte Algorithmen, die zum Beispiel wie zuletzt in den USA auf das Stichwort “Demokraten” plötzlich nichts mehr anzeigen?
Dieser “Stresstest”, bei dem die Teilnehmenden unterschiedliche Szenarien durchspielen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Hoffentlich bringt es etwas.
Bleiben Sie zuversichtlich,

Der Fünf-Punkte-Plan zur Asyl- und Migrationspolitik, den CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz mit den Stimmen der FDP und der AfD durch den Bundestag gebracht hat, sorgt auch in Brüssel für lebhafte Diskussionen. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob der von Merz proklamierte nationale Alleingang vom Europarecht gedeckt ist – und ob er mit der 2024 beschlossenen Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vereinbar wäre.
Im Europaparlament, das der Reform nicht zuletzt in der Hoffnung zugestimmt hat, den Rechtspopulisten aus der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, gehen die Meinungen weit auseinander. Die EU-Kommission wollte sich weder zu Merz’ Initiative noch zur Rechtslage äußern; eine Anfrage von Table.Briefings blieb unbeantwortet. Im Rat sorgte die deutsche Debatte für Irritationen. Einige EU-Länder fühlen sich aber auch in ihrer Haltung bestätigt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen am Donnerstag in Warschau vor “gefährlichen nationalen Alleingängen”. Außerdem verwies sie auf die GEAS-Reform. “Oberste Priorität hat für uns nach wie vor die schnellstmögliche Umsetzung des gemeinsamen Asyl- und Migrationspakts”, betonte Faeser. Merz’ Vorstoß und die Abstimmung im Bundestag nannte sie unverantwortlich und geschichtsvergessen.
Auch Migrationskommissar Magnus Brunner (EVP) drängte auf rasche Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts. Darin seien schon viele Punkte enthalten, die nun in Berlin diskutiert werden. Zudem kündigte er eine EU-Novelle für mehr Abschiebungen an. “Wir wissen alle, dass die bisherigen Regeln nicht wirklich funktioniert haben“, erklärte der konservative Österreicher. Er äußerte “Verständnis, dass der Ruf da ist, die Regeln zu verändern”.
Österreichs Innenminister Gerhard Karner sprach sich in Warschau ebenfalls für mehr Abschiebungen aus. Demgegenüber mahnten Luxemburg und Spanien, im Schengen-Raum müssten die Grenzen grundsätzlich offen bleiben. “Wir sind gegen Kontrollen an den internen Grenzen der EU”, sagte Luxemburgs Innenminister Léon Gloden. Sollte Deutschland eine Verlängerung der bestehenden Kontrollen beantragen, werde Luxemburg bei der EU-Kommission Einspruch einlegen.
Die Brüsseler Behörde hielt sich bedeckt. Im Oktober hatte die damalige Innenkommissarin Ylva Johansson auf eine parlamentarische Anfrage noch erklärt, Asylanträge müssten auch an EU-Binnengrenzen angenommen werden, um festzustellen, welcher Mitgliedstaat für die Bearbeitung zuständig ist. Zudem betonte sie, dass Artikel 72 AEUV “eng auszulegen” sei. Er dürfe nicht als “Ermächtigung” verstanden werden, vom gemeinsamen Asylrecht abzuweichen.
Auf Nachfrage von Table.Briefings wollte die Kommission diese Haltung aber nicht bekräftigen. Johanssons Antwort widerspricht der Position von Merz – er beruft sich auf Artikel 72, um Asylbewerber auch ohne Prüfung an der Grenze abzuweisen. Dieser Artikel sichert den EU-Staaten die Zuständigkeit “für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit” zu. Seine Auslegung ist jedoch umstritten.
Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt, der die schriftliche Anfrage an die Kommission im Herbst gestellt hatte, reagierte verstimmt. “Von der Leyen macht ihren Job nicht”, kritisierte der Migrationsexperte. Dies gelte insbesondere für die Grenzkontrollen. “Die Schengen-Regeln werden seit Jahren nicht angewendet. Trotzdem reagiert die Kommission nicht – dabei ist Merz’ Forderung nach ständigen Grenzkontrollen ganz klar antieuropäisch.”
Ähnlich äußerte sich Birgit Sippel von der SPD. “Es ist schon peinlich, dass zwar die ehemalige Kanzlerin Merkel widerspricht, von der EU-Kommission und Frau von der Leyen aber nichts kommt. Sie traut sich wohl nicht, eine klare Ansage zu machen.” Dabei stelle der Fünf-Punkte Plan von Merz auch die GEAS-Reform infrage. Mit seinem Vorstoß habe der CDU-Chef die Axt an das Asylrecht, aber auch an den Grundkonsens der Demokraten gelegt.
Die Gegenposition bezieht die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont, die die GEAS-Reform mit ausgehandelt hat. “Wer behauptet, dass die Vorschläge von Merz die GEAS-Reform gefährden, hat Unrecht”, sagte sie Table.Briefings. Es sei von vornherein klargewesen, dass die Reform nicht alle Aspekte der Asylpolitik abdecken würde. Das gelte nicht nur für die externe Dimension, sondern in Teilen auch für die nationale. Deutschland könne daher allein handeln.
“Die Zurückweisung an der Binnengrenze und die Abschiebehaft können mit EU-Recht je nach Ausgestaltung vereinbar sein, es ist eine Abwägungsfrage”, so Düpont. Zugleich räumte sie ein, dass Merz’ Plan in den europa-rechtlich relevanten Punkten “nicht trivial” sei. Dabei gehe es aber nur einige wenige Aspekte. Diese ließen sich mit etwas gutem Willen durchaus im Einklang mit dem EU-Recht regeln. “Mein Plädoyer gilt immer wieder einer guten Kommunikation mit den Nachbarländern und der Kommission”, so Düpont abschließend.

Frau Rulf, der 2. Februar ist ein wichtiges Datum für künstliche Intelligenz in Europa, denn die ersten Bestimmungen des AI Acts treten in Kraft. Was bedeutet das?
Unternehmen und Behörden müssen unerlaubte Anwendungen, sogenannte “prohibited use cases”, in Europa abschalten beziehungsweise dürfen sie gar nicht erst in Betrieb nehmen. Das sind zum Beispiel KI-Anwendungen, die nicht mit unseren europäischen Werten in Einklang stehen, wie etwa Social Scoring. Eine viel weiterreichende Bestimmung ist zusätzlich die zu AI Literacy: Unternehmen und Behörden sind angehalten, ihre Mitarbeiter zumindest mit einem Basis-KI-Wissen auszustatten und über die Risiken zu informieren.
Passiert das auch?
Absolut. Der Run hin zu der Deadline war ein ziemlicher Sprint für viele Unternehmen. Er hat zu einem Boom von Schulungsprogrammen geführt. Es gibt in ganz Europa einen Mangel an KI-Talenten. Deshalb wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter selbst ausbilden.
War jedem Unternehmen klar, welche Anwendungen nun verboten sind?
Nein. Zuletzt sind so viele KI-Anwendungen aus dem Boden geschossen, da war es sehr schwer für viele Unternehmen herauszufinden, ob sie unerlaubte Anwendungsfälle haben. Ein global agierender Versicherer hat zum Beispiel fast ein halbes Jahr gebraucht, um sicherzugehen.
Wie viele Systeme sind überhaupt verboten, die vorher angewendet wurden?
Die Schätzung der EU-Kommission war ja immer, dass nur ungefähr fünf Prozent aller Systeme am Markt von dem Verbot betroffen sind. In der Praxis waren verbotene Systeme selten im Einsatz. Entweder gab es bereits andere Regulierungen, die die Entwicklung oder den Einsatz von vornherein verhindert haben, oder das eigene Wertesystem hat die Anwendung ohnehin nicht zugelassen. Das sieht bei Hochrisikosystemen deutlich anders aus.
Wissen die Unternehmen immer, welche Systeme ihre Mitarbeiter einsetzen?
Nicht immer. Schatten-IT ist oft ein Problem. Es gibt einfach Dinge, die praktisch sind, aber nicht offiziell erlaubt. Viele Mitarbeiter waren sehr motiviert, neue KI-Technologien zu benutzen, auch um ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Oft sind die Rechts- und Compliance-Abteilungen mit der Prüfung nicht schnell genug hinterhergekommen. Das ist tatsächlich oft gefährlich für Unternehmen.
Ist der AI Act in der Umsetzung das bürokratische Monster, von dem viele sprechen?
Er kann ein bürokratisches Monster sein, wenn man ihn dazu macht. Man kann ihn aber auch als das pragmatische Gesetz lesen, das er eigentlich sein will. Eine gute Zusammenarbeit unter den unterschiedlichen Fachleuten im Unternehmen herzustellen, die den AI Act umsetzen, ist schon eine neue Herausforderung. Wenn man das schafft, dann ist der AI Act eine perfekte Blaupause für ein sehr gutes Risikomanagementsystem. Aber viele Unternehmen tun sich sehr, sehr schwer damit, das Gesetz pragmatisch umzusetzen. Viele schieben es in die Rechtsabteilung und dann wird es leicht zu einem bürokratischen Monster.
Welche Hürden nehmen Sie sonst noch wahr?
Aus Sicht der Industrie sind die Hochrisikosysteme eigentlich die interessanteren Fälle. Um sie auf den Markt zu bringen, gibt es mit dem Konformitätsassessment auch einen sehr klaren Prozess. Aber hier fehlen für die Umsetzung noch die messbaren und für alle gleichen Kennziffern für Standards.
Woher müssen die Kennziffern für Standards kommen?
Auch das ist noch ein bisschen unklar. Das AI Office hat diese Standards bei der europäischen Standardisierungsbehörde Cen-Cenelec in Auftrag gegeben. Da können Unternehmen mitreden, was gut ist. Das Problem ist, dass dort vor allem die großen Tech-Unternehmen mit am Tisch sitzen, die die Ressourcen haben, solche langwierigen, intensiven und schwierigen Diskussionen zu führen. Sie schreiben also an den Regeln mit, KMU sind dagegen nur wenig vertreten. Wenn die Standards erst einmal da sind, brauchen wir auch die Leute, die die Einhaltung überwachen. Im Referentenentwurf der Bundesregierung ist die Bundesnetzagentur vorgesehen. Die muss erst einmal die nötigen Kapazitäten und Qualifikationen aufbauen.
Wie problematisch ist es, dass der Referentenentwurf dem Bruch der Ampel zum Opfer gefallen ist und dass da jetzt nichts vorangeht?
Aus Unternehmenssicht brauchen wir so schnell es geht Rechtsklarheit. Unsere Kunden sind global tätig. Sie können die KI-Entwicklung auch anderswo betreiben. Sie agieren nicht in einem unsicheren Rechtsrahmen, wenn sie das nicht müssen.
Jetzt, wo der AI Act in Europa seine Wirkung entfaltet, hat Präsident Donald Trump in den USA die KI-Regulierung auf Bundesebene vom Tisch gewischt. Aber es gibt eine Reihe von Bundesstaaten, die KI sehr wohl regulieren. Kommen wir jetzt in die Situation, dass wir in Europa einheitliche Regeln und in den USA einen Flickenteppich haben?
In jedem Fall stimmt das Narrativ nicht, dass Europa eine scharfe Regulierung hat und die USA unreguliert sind. Die Regulierungen in den einzelnen US-Staaten sind zum Teil sehr viel schärfer als der AI Act. Die zersplittern die Rechtslage sehr stark. Und: Die Executive Order ist ja bereits zu 80 Prozent ausgerollt, inklusive Aufbau von Behörden, von Kapazitäten, von verpflichtenden Vorgaben. Die Rücknahme der Order ist mehr ein symbolischer Akt, hat aber in der Praxis auf global tätige Unternehmen wahrscheinlich keinen großen Effekt. Das Signal ist: Wir deregulieren, Europa reguliert. Das hat natürlich eine große Sogwirkung im Markt. Die darf man nicht unterschätzen.
Die Ankündigung des Projekts Stargate entwickelt auch eine solche Sogwirkung. Gleichzeitig zeigt China mit Deepseek, dass man KI auch erfolgreich mit wenig Geld, mehr Kreativität und Open Source entwickeln kann. Wo sehen Sie einen möglichen europäischen Erfolgspfad?
Aus der Industrie höre ich, dass, platt gesagt, Rechenkapazitäten natürlich wichtig sind. Aber das KI-Rennen entscheidet sich nicht darüber, wer das größte Rechenzentrum hat, sondern wer aus dieser Technologie den größten unternehmerischen Wert schaffen kann. Und daran hakt es noch. Big Tech verspricht viel, aber auf unternehmerischer Seite ist dieser Wert bisher noch nicht messbar. Die entscheidende Komponente ist, was mache ich aus dieser Technologie? Habe ich besondere Daten? Habe ich besondere Geschäftsmodelle? Habe ich die Idee und auch den Mut, diese Technologie in meinen Unternehmen transformativ einzusetzen? Da sehe ich, dass Europa noch das Potenzial hat, weit vorn zu landen, denn wir haben viele innovative Wirtschaftszweige.
In einigen Tagen lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Regierungschefs zum AI Action Summit nach Paris ein. Was erwarten Sie von diesem Gipfel?
Ein starkes Signal für Europas KI-Entwicklung. Initiativen in Sachen Infrastruktur und Daten, die uns einen Sprung nach vorn bringen. Ich bin sehr gespannt, welche Unternehmen sich aus der Deckung wagen und mitmachen.
Was ist Ihre liebste KI-Anwendung?
Antigone, das ist ein Chatbot in einem CustomGPT, den ich selbst geschrieben und vielleicht etwas nerdig nach meiner Lieblings-Sagengestalt benannt habe. Antigone ist eine super Sparringspartnerin für mein Brainstorming. Sie fordert mich heraus, weil sie selbst so viel weiß. Sie bringt mich beim Brainstorming sofort auf eine andere Ebene.
Kirsten Rulf ist Partnerin und Associate Director der Boston Consulting Group in Berlin. Bevor sie zu BCG kam, war sie Senior Digital Policy Advisor der Bundeskanzler Angela Merkel und Olaf Scholz sowie Leiterin der Abteilung Digitales und Daten im Bundeskanzleramt. In dieser Funktion hat sie den AI Act, das Datenschutzgesetz und andere europäische Digitalvorschriften mitverhandelt.
03.02.2025
Informelles Treffen der EU-Führungsspitzen
Themen: Entwicklung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten, Zukunft der Finanzierung gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen, Stärkung und Vertiefung von Partnerschaften. Infos
03.02.-04.02.2025
Informelle Ministertagung Wettbewerbsfähigkeit und Handel
Themen: Diskussion über die Angleichung von Handels- und Industriepolitik, um das europäische industrielles Ökosystem und seine Position auf dem Weltmarkt zu stärken, Diskussion der vielversprechendsten Wertschöpfungsketten für die Integration der Kandidatenländer in den Binnenmarkt, Entwicklung einer gemeinsamen Haltung gegenüber den externen Partnern der EU. Infos
05.02.2025
Wöchentliche Kommissionssitzung
Themen: Mitteilung über die Bewältigung von Herausforderungen bei Plattformen für den elektronischen Handel. Vorläufige Tagesordnung
05.02.2025 – 14:30-16:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
Themen: Gedankenaustausche mit Thomas Hans Ossowski (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in der Türkei), mit Nicolas Berlanga (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in der Demokratischen Republik Kongo) und mit Lutz Guellner (neu ernannter Leiter des EU-Büros in Taiwan). Vorläufige Tagesordnung
Bereits am 5. März soll der Autodialog abgeschlossen sein. Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas soll an dem Tag den Aktionsplan für die Autobranche mit den Ergebnissen des Strategischen Dialogs zur Zukunft der Automobilindustrie vorlegen. Dieser Zeitplan mit dem schnellen Abschluss, den die Kommission noch während der Sitzung öffentlich gemacht hat, kam für die Teilnehmer überraschend. Es ist offenbar nur noch am 3. März eine Sitzung in der Formation geplant, wie sie gestern stattgefunden hat.
Bei der dreistündigen Auftaktsitzung gestern waren nur die Chefs der 22 eingeladenen Unternehmen der Branche, Gewerkschaften und NGOs im Saal. Mitarbeiter mussten in einem gesonderten Raum im Berlaymont warten. Die Chefs trugen ihre Positionen vor, zu einem Austausch über die Positionen kam es nicht.
Mercedes-Chef Ola Källenius, der turnusgemäß ACEA vorsteht, etwa forderte Technologieoffenheit bei den Flottengrenzwerten bis 2035 ein. Ein anderer OEM-CEO machte den Bedarf von Plug-in-Hybrides nach 2035 geltend, also die Aufhebung des Verbrenner-Aus 2035. In vier Arbeitsgruppen, die je von einem Kommissar geführt werden, sollen nun Ergebnisse erarbeitet werden zu den Themen:
Dem Vernehmen nach hat von der Leyen nicht durchblicken lassen, wie sie zu den Forderungen der Industrie steht. Es sei aber deutlich gewesen, dass die Kommissionspräsidentin verstanden habe, wie sehr die Industrie unter Druck ist und dass es Handlungsbedarf gebe. mgr

Eine Rekordsumme von 89 Milliarden Euro hat die Europäische Investitionsbank (EIB) im vergangenen Jahr investiert. Sechzig Prozent davon wurden in klimarelevante Projekte investiert. Das meldete die EIB gestern bei der Präsentation ihres Jahresberichts. Dual-Use-Finanzierungen im Bereich Sicherheit und Verteidigung wurden im vergangenen Jahr zwar verdoppelt, bleiben aber mit einer Milliarde Euro relativ niedrig.
EIB-Präsidentin Nadia Calviño sagte, dass sich der Betrag für Dual-Use-Finanzierungen 2025 verdoppeln dürfte. Der limitierende Faktor sei aber nicht die Zurückhaltung der EIB, sondern ein Mangel an Nachfrage für Dual-Use-Finanzierungen aus der Privatwirtschaft. Die EIB habe acht Milliarden Euro für Dual-Use zur Verfügung gestellt, wovon aber nur eine Milliarde benutzt wurde.
Im vergangenen Jahr habe die EIB eine Roadshow in den Mitgliedstaaten gemacht, um mehr Projekte im Dual-Use-Bereich zu ermutigen, sagte die EIB-Präsidentin. Fragen zu einer Erweiterung des EIB-Mandats auf Verteidigungsprojekte, die bisher nicht von der EIB finanziert werden können, wich Calviño aus. Sie erinnerte daran, dass sie um eine solide Finanzierung bemüht sei – eine Anspielung auf die Sorgen, dass eine Finanzierung von Verteidigungsinvestitionen das Kreditrating der Bank beeinträchtigen könnte. “Wir sind kein Verteidigungsministerium”, sagte Calviño.
Auch EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP) hatte am Mittwoch daran erinnert, dass die EIB nicht im Alleingang für die Aufrüstung Europas sorgen könne. Das Problem liege vor allem daran, dass die Rüstungsindustrie nicht genügend Bestellungen erhalte. Ohne gesicherte Nachfrage wolle die Industrie keine Investitionen tätigen. Wenn die Verteidigungsminister ihre Bestellmengen erhöhten, so würde die Industrie auch in Produktionskapazitäten investieren. Um diesen Finanzbedarf zu stemmen, hätten auch normale Geschäftsbanken genügend Liquidität, so Beer. jaa
Der Vorschlag der Europäischen Kommission, hohe Zölle auf Stickstoffdünger aus Russland und Belarus zu erheben, geht dem deutschen Düngemittelhersteller SKW Piesteritz nicht weit genug. Grundsätzlich begrüße man den Schritt, seine volle Wirkung entfalte er aber “viel zu spät”, teilt das Unternehmen Table.Briefings mit. Die Brüsseler Behörde will den Satz stufenweise anheben, bis 2028 schließlich prohibitive Zölle von zirka 100 Prozent des Preises anfallen.
Die EU müsse nachbessern und “sofort wirkende und eindeutige Maßnahmen ergreifen”, fordert SKW Piesteritz. Nur so könne die Kommission ihr erklärtes Ziel, vor dem Hintergrund des Angriffskriegs auf die Ukraine eine wichtige Finanzquelle Russlands stillzulegen, rasch erreichen. Anfang des Jahres hatte SKW Piesteritz vermeldet, die Düngemittelproduktion in Deutschland zu drosseln, und das auch mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs begründet. Zusätzlich zum Schritt der EU müsse die Bundesregierung die Industrie entlasten und etwa die Gasspeicherumlage streichen, fordert das Unternehmen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen neuer Zölle habe der Agrarsektor zu erleiden, warnt derweil der EU-Bauernverband Copa Cogeca. Zur nächsten Erntesaison könnten die Düngemittelpreise um mindestens 40 Euro pro Tonne steigen. Der Verband erkennt die geopolitischen Beweggründe der Kommission an, fordert aber Ausgleichsmaßnahmen. Etwa den Wegfall von Anti-Dumping-Zöllen für Düngeimporte aus den USA sowie Trinidad und Tobago.
Die Kommission argumentiert, die geplante Übergangsphase minimiere das Risiko eines Preisanstiegs. Denn so bleibe Zeit, die heimische Produktion aufzustocken und Importquellen zu finden. Der am Dienstag veröffentlichte Vorschlag sieht auch vor, Zölle auf russische und belarussische Agrargüter auszuweiten. Deren Einfuhren in die EU sind aber wirtschaftlich deutlich weniger bedeutsam als Düngeimporte. jd
Fleisch weiblicher Rinder aus Brasilien soll erst wieder in die EU importiert werden, wenn das Land seine Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit verbessert hat. Das bekräftigte die Europäische Kommission in dieser Woche. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme sieht sie Gesundheitsstandards bei Importen aus Brasilien als erfüllt. Laut einer Untersuchung der Brüsseler Behörde im vergangenen Jahr können die brasilianischen Behörden nicht ausschließen, dass bei der Zucht weiblicher Rinder für die Ausfuhr in die EU das Hormon Östradiol verabreicht wird. Brasilien hatte daraufhin die Exporte vorerst gestoppt.
Abgeordnete aus dem gesamten politischen Spektrum nahmen den Fall dagegen zum Anlass, das Mercosur-Abkommen infrage zu stellen. Unfaire Handelsbedingungen im Rahmen des Mercosur-Abkommens fürchtet etwa der Umweltsprecher der liberalen Renew-Fraktion, Pascal Canfin. Auch der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling meint: Der Bericht der Kommission zeige, dass Importe aus Brasilien nicht die gleichen Standards erfüllten wie hiesige Produkte.
Die Kommission hält dagegen: Brasilien habe einen überzeugenden Plan vorgelegt, um die Kontrollen innerhalb eines Jahres zu verbessern. Dessen Umsetzung werde man genau überprüfen, betont Maria Pilar Aguar Fernandez von der Kommissionsabteilung für Gesundheits- und Lebensmittelaudits, die am Dienstag von den Abgeordneten im Umweltausschuss befragt wurde. Unfaire Handelsbedingungen zwischen europäischen und brasilianischen Erzeugern schließt sie aus. Auch gebe es keine Hinweise, dass tatsächlich hormonbehandeltes Fleisch auf den europäischen Markt gelangt sei.
Agrarkommissar Christophe Hansen erklärte ebenfalls Anfang der Woche, das EU-System zur Überprüfung von Handelsstandards funktioniere. Dass man den Fall in Brasilien aufgedeckt habe, sei ein klarer Beleg dafür. Er räumte aber ein, das System müsse künftig “noch besser” werden. Der Luxemburger sieht dabei auch die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten in der Pflicht. Sie sind dafür zuständig, die Lebensmittelsicherheit von Produkten zu überprüfen, die auf den EU-Binnenmarkt gelangen. jd
Die Regierungskoalition in Norwegen ist im Streit über die Umsetzung von EU-Regulierungen zum Energiemarkt zerbrochen. Die bäuerliche Zentrumspartei als bisheriger Juniorpartner der Sozialdemokraten von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre tritt im Zuge der Unstimmigkeiten aus der Regierung aus, wie der Parteichef und bisherige Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum sowie Fraktionschefin Marit Arnstad am Donnerstag in Oslo verkündeten.
Das Aus der Koalition bedeutet, dass Støres Sozialdemokraten bis zur nächsten Wahl alleine weiterregieren. Sie müssen dafür aber acht Ministerposten neu besetzen, die bislang Politiker der Zentrumspartei innehatten. Die nächste Parlamentswahl soll im September stattfinden. Vorzeitige Neuwahlen sieht die norwegische Verfassung nicht vor.
Støres Sozialdemokraten und Vedums Zentrumspartei haben seit längerem über die Umsetzung eines 2019 verabschiedeten EU-Energiemarktpakets gestritten, das aus insgesamt acht Verordnungen und Richtlinien besteht. Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, muss EU-Binnenmarktregeln aber als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) dennoch übernehmen.
Die EU-skeptische Zentrumspartei lief gegen diese Umsetzung jedoch vehement Sturm. Während Støre zumindest drei weniger umstrittene Richtlinien des Pakets in norwegisches Recht gießen wollte, ging dies für die Zentrumspartei zu weit. Sie lehnte vor allem die Ausweitung der Befugnisse der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Acer) ab. Sie begründete diese Haltung damit, dass das Paket Norwegens nationale Kontrolle über den Energiesektor schwäche und eine engere Bindung an den EU-Energiemarkt zu höheren Strompreisen führen könne. dpa
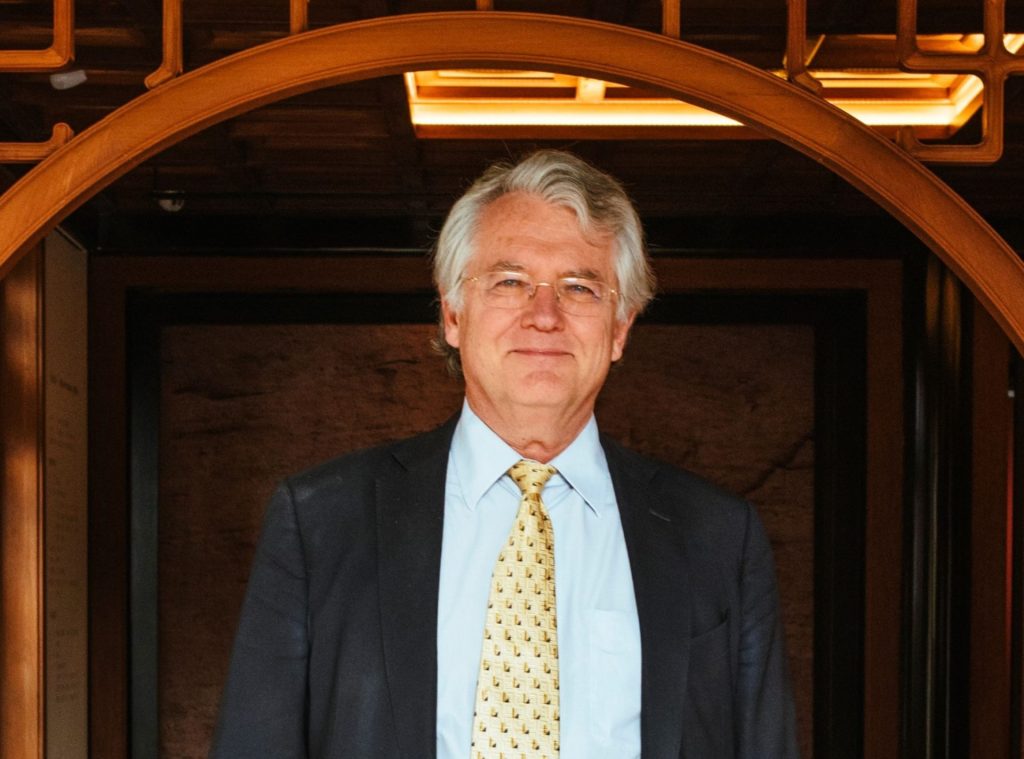
China erlebt gegenwärtig seinen Sputnik-Moment. So wie die Sowjetunion in den späten 1950er-Jahren die USA mit dem ersten Satelliten im All überraschte, so erscheint der chinesische Sputnik für Europa aktuell in Form von künstlicher Intelligenz, aber auch futuristischen, batteriebetriebenen Automobilen. Das chinesische KI-Start-up DeepSeek zeigt den amerikanischen Tech-Champions Google, Apple und Meta, dass KI “Made in China” Weltklasse ist. Das junge Unternehmen hat einen offenen Standard verhältnismäßig günstig entwickelt – weniger als sechs Millionen Euro soll R1 gekostet haben. Zugleich wird deutlich, dass die US-Sanktionen auf Chip-Exporte eher chinesische Innovation stimuliert haben, als das Land in der Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Technologie zu behindern. Ein Wake-up-Call – auch für Europa.
Als die chinesische Staatsführung vor zehn Jahren ihre Industriestrategie Made in China 2025 vorstellte, sorgte sie damit weltweit für Irritationen. Spätestens in diesem Moment war klar, dass Chinas Weg zur Industrie-Supermacht Friktionen und Rivalitäten mit dem westlichen, liberalen Wirtschaftssystem verursachen würde.
In Washington fand ein Umdenken statt: Statt von “konstruktivem Engagement” mit China sprachen die Strategen in der US-Regierung und in den einflussreichen Thinktanks nun plötzlich von “strategischem Wettbewerb” oder “strategischer Rivalität”. Mit dem von der Trump-Regierung 2018 begonnenen Handelskrieg hat der Stellenwert der Innovation noch an Bedeutung gewonnen.
Die aggressive Art und Weise, mit der die USA chinesische Firmen wie Huawei und ZTE angegriffen und vom Angebot an hochwertigen Halbleitern abgeschnitten haben, führte zu einer Verhärtung der Ansichten in Peking. Mit großen finanziellen Anstrengungen arbeitet China daran, seine Abhängigkeit von “unzuverlässigen” westlichen Partnern zu verringern. China fördert unter den Konzepten “Dual Circulation” und “Indigenous Innovation” die heimische Technologie unter zunehmendem Ausschluss ausländischer Unternehmen.
Europa hat weder die militärische und technologische Macht der USA. Noch kann und soll es das staatlich gelenkte Subventions- und zentralistische Planungsmodell der Volksrepublik China imitieren. Das Interesse der Europäischen Union ist es, das zu bewahren, was die Volkswirtschaften des Kontinents nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich gemacht hat: integrierte globale Wertschöpfungsketten mit gegenseitigen Abhängigkeiten.
Die Basis dafür bildeten Handelsbeziehungen, die liberal, multilateral, regelbasiert und durch einen verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus vor der Welthandelsorganisation WTO abgesichert waren. Der in Teilen der Welt beobachtete Anstieg von nationalem Protektionismus, Bilateralismus und dem Streben nach Autarkie stellt die EU vor eine Herausforderung, die sie meistern muss. Aber die Antwort Europas darauf sollte nicht sein, ebenfalls protektionistischer zu werden. Sondern die liberalen, offenen Werte zu wahren und für sie einzutreten. Was konkret zu tun ist?
Die Fragmentierung des europäischen VC-Markts ist einer der Gründe dafür, weshalb es in Europa insgesamt weniger “Einhörner” gibt als in China und den USA, also private Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Die nationalen VC-Märkte in Europa haben keinen einheitlichen Rechtsrahmen, was sowohl die Investitionstätigkeit als auch das Fundraising über die Grenzen hinweg behindert. Hürden für grenzüberschreitende Investitionen abzubauen, wäre ein wichtiger Schritt für eine effizientere Kapitalallokation und würde helfen, VC-Renditepotenziale zu realisieren.
Will Europa das Technologie-Rennen gegen China langfristig bestehen, dann muss es zudem seine Gangart beschleunigen. Um gegen China zu bestehen, gilt es, bessere Ideen und klügere Technologien zu entwickeln, statt durch Rückzug in die Isolation seine eigene Wirtschaft zu schützen.
Es besteht kein Zweifel, dass der wirtschaftliche und technologische Aufstieg Chinas sowie die wachsende Rivalität zwischen China und den USA in den kommenden Jahren die größte Herausforderung für Deutschland und Europa werden. China hat die Größe und unter der aktuellen Führung das politische Selbstvertrauen, ein unabhängiges, eigenständiges Wirtschaftssystem aufzubauen – ein System mit chinesischen Vorzeichen.
Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag (30.01.2025, 14.00 Uhr, MESZ) diskutieren Jörg Wuttke, Partner bei der DGA Group/Albright Stonebridge Group in Washington D.C. und Adam S. Posen, Präsident des Peterson Institute for International Economics, ebenfalls in Washington D.C., zum Thema “Wie wird Trump 2.0 die europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen umgestalten?” Das Webinar findet auf Englisch statt. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.
Hinweis der Redaktion: Über China zu diskutieren heißt heute mehr denn je: kontrovers debattieren. Wir möchten die Vielfalt der Standpunkte abbilden, damit Sie einen Einblick in die Breite der Debatte gewinnen können. Standpunkte spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
Juanma Moreno, Ministerpräsident der Region Andalusien, wird neuer Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen. Die EVP-Vertreter werden den konservativen Politiker heute offiziell vorschlagen. Im Rahmen einer Absprache mit den Sozialdemokraten wird die Vize-Bürgermeisterin von Budapest, Kata Tüttő, nach zweieinhalb Jahren den Posten übernehmen.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
nach den Europawahlen 2024 war die EU-Kommission mit sich selbst zufrieden. Denn nach ihrer Ansicht hat es keine nennenswerten Desinformationskampagnen rund um die Wahlen gegeben. Anders bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien. Die Rumänen, so hieß es damals aus der EU-Kommission, hätten darauf verzichtet, sich gemeinsam mit der Behörde vorzubereiten und rechtzeitig die zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu benutzen, um die Integrität der Wahlen zu schützen.
Deutschland will das anders machen. Vielleicht ein bisschen spät, aber die wirklich heiße Phase des Bundestagswahlkampfs steht ja noch bevor. Bereits vor einer Woche lud die Bundesnetzagentur als Digital Services Coordinator (DSC) mit der Kommission zu einem runden Tisch nach Berlin. Gemeinsam mit den sehr großen Online-Plattformen und -Suchmaschinen besprachen sie die Verpflichtungen der Unternehmen nach dem Digital Services Act (DSA). Am Tisch saßen Vertreter von Youtube, Linkedin, Microsoft, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok und X sowie von nationalen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Heute nun folgt der Stresstest, der im EU-Jargon Tabletop Exercise heißt. In einer simulierten Krisenübung werden die Akteure vom runden Tisch durchspielen, wie sie auf eine hypothetische Bedrohung oder Krise reagieren würden. Ziel ist es, Schwachstellen in bestehenden Abläufen zu identifizieren, die Zusammenarbeit zwischen Beteiligten zu verbessern und Reaktionsmechanismen zu testen. Wie reagiere ich auf einen Angriff russischer Trollarmeen? Oder auf manipulierte Algorithmen, die zum Beispiel wie zuletzt in den USA auf das Stichwort “Demokraten” plötzlich nichts mehr anzeigen?
Dieser “Stresstest”, bei dem die Teilnehmenden unterschiedliche Szenarien durchspielen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Hoffentlich bringt es etwas.
Bleiben Sie zuversichtlich,

Der Fünf-Punkte-Plan zur Asyl- und Migrationspolitik, den CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz mit den Stimmen der FDP und der AfD durch den Bundestag gebracht hat, sorgt auch in Brüssel für lebhafte Diskussionen. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob der von Merz proklamierte nationale Alleingang vom Europarecht gedeckt ist – und ob er mit der 2024 beschlossenen Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vereinbar wäre.
Im Europaparlament, das der Reform nicht zuletzt in der Hoffnung zugestimmt hat, den Rechtspopulisten aus der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, gehen die Meinungen weit auseinander. Die EU-Kommission wollte sich weder zu Merz’ Initiative noch zur Rechtslage äußern; eine Anfrage von Table.Briefings blieb unbeantwortet. Im Rat sorgte die deutsche Debatte für Irritationen. Einige EU-Länder fühlen sich aber auch in ihrer Haltung bestätigt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen am Donnerstag in Warschau vor “gefährlichen nationalen Alleingängen”. Außerdem verwies sie auf die GEAS-Reform. “Oberste Priorität hat für uns nach wie vor die schnellstmögliche Umsetzung des gemeinsamen Asyl- und Migrationspakts”, betonte Faeser. Merz’ Vorstoß und die Abstimmung im Bundestag nannte sie unverantwortlich und geschichtsvergessen.
Auch Migrationskommissar Magnus Brunner (EVP) drängte auf rasche Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts. Darin seien schon viele Punkte enthalten, die nun in Berlin diskutiert werden. Zudem kündigte er eine EU-Novelle für mehr Abschiebungen an. “Wir wissen alle, dass die bisherigen Regeln nicht wirklich funktioniert haben“, erklärte der konservative Österreicher. Er äußerte “Verständnis, dass der Ruf da ist, die Regeln zu verändern”.
Österreichs Innenminister Gerhard Karner sprach sich in Warschau ebenfalls für mehr Abschiebungen aus. Demgegenüber mahnten Luxemburg und Spanien, im Schengen-Raum müssten die Grenzen grundsätzlich offen bleiben. “Wir sind gegen Kontrollen an den internen Grenzen der EU”, sagte Luxemburgs Innenminister Léon Gloden. Sollte Deutschland eine Verlängerung der bestehenden Kontrollen beantragen, werde Luxemburg bei der EU-Kommission Einspruch einlegen.
Die Brüsseler Behörde hielt sich bedeckt. Im Oktober hatte die damalige Innenkommissarin Ylva Johansson auf eine parlamentarische Anfrage noch erklärt, Asylanträge müssten auch an EU-Binnengrenzen angenommen werden, um festzustellen, welcher Mitgliedstaat für die Bearbeitung zuständig ist. Zudem betonte sie, dass Artikel 72 AEUV “eng auszulegen” sei. Er dürfe nicht als “Ermächtigung” verstanden werden, vom gemeinsamen Asylrecht abzuweichen.
Auf Nachfrage von Table.Briefings wollte die Kommission diese Haltung aber nicht bekräftigen. Johanssons Antwort widerspricht der Position von Merz – er beruft sich auf Artikel 72, um Asylbewerber auch ohne Prüfung an der Grenze abzuweisen. Dieser Artikel sichert den EU-Staaten die Zuständigkeit “für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit” zu. Seine Auslegung ist jedoch umstritten.
Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt, der die schriftliche Anfrage an die Kommission im Herbst gestellt hatte, reagierte verstimmt. “Von der Leyen macht ihren Job nicht”, kritisierte der Migrationsexperte. Dies gelte insbesondere für die Grenzkontrollen. “Die Schengen-Regeln werden seit Jahren nicht angewendet. Trotzdem reagiert die Kommission nicht – dabei ist Merz’ Forderung nach ständigen Grenzkontrollen ganz klar antieuropäisch.”
Ähnlich äußerte sich Birgit Sippel von der SPD. “Es ist schon peinlich, dass zwar die ehemalige Kanzlerin Merkel widerspricht, von der EU-Kommission und Frau von der Leyen aber nichts kommt. Sie traut sich wohl nicht, eine klare Ansage zu machen.” Dabei stelle der Fünf-Punkte Plan von Merz auch die GEAS-Reform infrage. Mit seinem Vorstoß habe der CDU-Chef die Axt an das Asylrecht, aber auch an den Grundkonsens der Demokraten gelegt.
Die Gegenposition bezieht die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont, die die GEAS-Reform mit ausgehandelt hat. “Wer behauptet, dass die Vorschläge von Merz die GEAS-Reform gefährden, hat Unrecht”, sagte sie Table.Briefings. Es sei von vornherein klargewesen, dass die Reform nicht alle Aspekte der Asylpolitik abdecken würde. Das gelte nicht nur für die externe Dimension, sondern in Teilen auch für die nationale. Deutschland könne daher allein handeln.
“Die Zurückweisung an der Binnengrenze und die Abschiebehaft können mit EU-Recht je nach Ausgestaltung vereinbar sein, es ist eine Abwägungsfrage”, so Düpont. Zugleich räumte sie ein, dass Merz’ Plan in den europa-rechtlich relevanten Punkten “nicht trivial” sei. Dabei gehe es aber nur einige wenige Aspekte. Diese ließen sich mit etwas gutem Willen durchaus im Einklang mit dem EU-Recht regeln. “Mein Plädoyer gilt immer wieder einer guten Kommunikation mit den Nachbarländern und der Kommission”, so Düpont abschließend.

Frau Rulf, der 2. Februar ist ein wichtiges Datum für künstliche Intelligenz in Europa, denn die ersten Bestimmungen des AI Acts treten in Kraft. Was bedeutet das?
Unternehmen und Behörden müssen unerlaubte Anwendungen, sogenannte “prohibited use cases”, in Europa abschalten beziehungsweise dürfen sie gar nicht erst in Betrieb nehmen. Das sind zum Beispiel KI-Anwendungen, die nicht mit unseren europäischen Werten in Einklang stehen, wie etwa Social Scoring. Eine viel weiterreichende Bestimmung ist zusätzlich die zu AI Literacy: Unternehmen und Behörden sind angehalten, ihre Mitarbeiter zumindest mit einem Basis-KI-Wissen auszustatten und über die Risiken zu informieren.
Passiert das auch?
Absolut. Der Run hin zu der Deadline war ein ziemlicher Sprint für viele Unternehmen. Er hat zu einem Boom von Schulungsprogrammen geführt. Es gibt in ganz Europa einen Mangel an KI-Talenten. Deshalb wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter selbst ausbilden.
War jedem Unternehmen klar, welche Anwendungen nun verboten sind?
Nein. Zuletzt sind so viele KI-Anwendungen aus dem Boden geschossen, da war es sehr schwer für viele Unternehmen herauszufinden, ob sie unerlaubte Anwendungsfälle haben. Ein global agierender Versicherer hat zum Beispiel fast ein halbes Jahr gebraucht, um sicherzugehen.
Wie viele Systeme sind überhaupt verboten, die vorher angewendet wurden?
Die Schätzung der EU-Kommission war ja immer, dass nur ungefähr fünf Prozent aller Systeme am Markt von dem Verbot betroffen sind. In der Praxis waren verbotene Systeme selten im Einsatz. Entweder gab es bereits andere Regulierungen, die die Entwicklung oder den Einsatz von vornherein verhindert haben, oder das eigene Wertesystem hat die Anwendung ohnehin nicht zugelassen. Das sieht bei Hochrisikosystemen deutlich anders aus.
Wissen die Unternehmen immer, welche Systeme ihre Mitarbeiter einsetzen?
Nicht immer. Schatten-IT ist oft ein Problem. Es gibt einfach Dinge, die praktisch sind, aber nicht offiziell erlaubt. Viele Mitarbeiter waren sehr motiviert, neue KI-Technologien zu benutzen, auch um ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Oft sind die Rechts- und Compliance-Abteilungen mit der Prüfung nicht schnell genug hinterhergekommen. Das ist tatsächlich oft gefährlich für Unternehmen.
Ist der AI Act in der Umsetzung das bürokratische Monster, von dem viele sprechen?
Er kann ein bürokratisches Monster sein, wenn man ihn dazu macht. Man kann ihn aber auch als das pragmatische Gesetz lesen, das er eigentlich sein will. Eine gute Zusammenarbeit unter den unterschiedlichen Fachleuten im Unternehmen herzustellen, die den AI Act umsetzen, ist schon eine neue Herausforderung. Wenn man das schafft, dann ist der AI Act eine perfekte Blaupause für ein sehr gutes Risikomanagementsystem. Aber viele Unternehmen tun sich sehr, sehr schwer damit, das Gesetz pragmatisch umzusetzen. Viele schieben es in die Rechtsabteilung und dann wird es leicht zu einem bürokratischen Monster.
Welche Hürden nehmen Sie sonst noch wahr?
Aus Sicht der Industrie sind die Hochrisikosysteme eigentlich die interessanteren Fälle. Um sie auf den Markt zu bringen, gibt es mit dem Konformitätsassessment auch einen sehr klaren Prozess. Aber hier fehlen für die Umsetzung noch die messbaren und für alle gleichen Kennziffern für Standards.
Woher müssen die Kennziffern für Standards kommen?
Auch das ist noch ein bisschen unklar. Das AI Office hat diese Standards bei der europäischen Standardisierungsbehörde Cen-Cenelec in Auftrag gegeben. Da können Unternehmen mitreden, was gut ist. Das Problem ist, dass dort vor allem die großen Tech-Unternehmen mit am Tisch sitzen, die die Ressourcen haben, solche langwierigen, intensiven und schwierigen Diskussionen zu führen. Sie schreiben also an den Regeln mit, KMU sind dagegen nur wenig vertreten. Wenn die Standards erst einmal da sind, brauchen wir auch die Leute, die die Einhaltung überwachen. Im Referentenentwurf der Bundesregierung ist die Bundesnetzagentur vorgesehen. Die muss erst einmal die nötigen Kapazitäten und Qualifikationen aufbauen.
Wie problematisch ist es, dass der Referentenentwurf dem Bruch der Ampel zum Opfer gefallen ist und dass da jetzt nichts vorangeht?
Aus Unternehmenssicht brauchen wir so schnell es geht Rechtsklarheit. Unsere Kunden sind global tätig. Sie können die KI-Entwicklung auch anderswo betreiben. Sie agieren nicht in einem unsicheren Rechtsrahmen, wenn sie das nicht müssen.
Jetzt, wo der AI Act in Europa seine Wirkung entfaltet, hat Präsident Donald Trump in den USA die KI-Regulierung auf Bundesebene vom Tisch gewischt. Aber es gibt eine Reihe von Bundesstaaten, die KI sehr wohl regulieren. Kommen wir jetzt in die Situation, dass wir in Europa einheitliche Regeln und in den USA einen Flickenteppich haben?
In jedem Fall stimmt das Narrativ nicht, dass Europa eine scharfe Regulierung hat und die USA unreguliert sind. Die Regulierungen in den einzelnen US-Staaten sind zum Teil sehr viel schärfer als der AI Act. Die zersplittern die Rechtslage sehr stark. Und: Die Executive Order ist ja bereits zu 80 Prozent ausgerollt, inklusive Aufbau von Behörden, von Kapazitäten, von verpflichtenden Vorgaben. Die Rücknahme der Order ist mehr ein symbolischer Akt, hat aber in der Praxis auf global tätige Unternehmen wahrscheinlich keinen großen Effekt. Das Signal ist: Wir deregulieren, Europa reguliert. Das hat natürlich eine große Sogwirkung im Markt. Die darf man nicht unterschätzen.
Die Ankündigung des Projekts Stargate entwickelt auch eine solche Sogwirkung. Gleichzeitig zeigt China mit Deepseek, dass man KI auch erfolgreich mit wenig Geld, mehr Kreativität und Open Source entwickeln kann. Wo sehen Sie einen möglichen europäischen Erfolgspfad?
Aus der Industrie höre ich, dass, platt gesagt, Rechenkapazitäten natürlich wichtig sind. Aber das KI-Rennen entscheidet sich nicht darüber, wer das größte Rechenzentrum hat, sondern wer aus dieser Technologie den größten unternehmerischen Wert schaffen kann. Und daran hakt es noch. Big Tech verspricht viel, aber auf unternehmerischer Seite ist dieser Wert bisher noch nicht messbar. Die entscheidende Komponente ist, was mache ich aus dieser Technologie? Habe ich besondere Daten? Habe ich besondere Geschäftsmodelle? Habe ich die Idee und auch den Mut, diese Technologie in meinen Unternehmen transformativ einzusetzen? Da sehe ich, dass Europa noch das Potenzial hat, weit vorn zu landen, denn wir haben viele innovative Wirtschaftszweige.
In einigen Tagen lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Regierungschefs zum AI Action Summit nach Paris ein. Was erwarten Sie von diesem Gipfel?
Ein starkes Signal für Europas KI-Entwicklung. Initiativen in Sachen Infrastruktur und Daten, die uns einen Sprung nach vorn bringen. Ich bin sehr gespannt, welche Unternehmen sich aus der Deckung wagen und mitmachen.
Was ist Ihre liebste KI-Anwendung?
Antigone, das ist ein Chatbot in einem CustomGPT, den ich selbst geschrieben und vielleicht etwas nerdig nach meiner Lieblings-Sagengestalt benannt habe. Antigone ist eine super Sparringspartnerin für mein Brainstorming. Sie fordert mich heraus, weil sie selbst so viel weiß. Sie bringt mich beim Brainstorming sofort auf eine andere Ebene.
Kirsten Rulf ist Partnerin und Associate Director der Boston Consulting Group in Berlin. Bevor sie zu BCG kam, war sie Senior Digital Policy Advisor der Bundeskanzler Angela Merkel und Olaf Scholz sowie Leiterin der Abteilung Digitales und Daten im Bundeskanzleramt. In dieser Funktion hat sie den AI Act, das Datenschutzgesetz und andere europäische Digitalvorschriften mitverhandelt.
03.02.2025
Informelles Treffen der EU-Führungsspitzen
Themen: Entwicklung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten, Zukunft der Finanzierung gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen, Stärkung und Vertiefung von Partnerschaften. Infos
03.02.-04.02.2025
Informelle Ministertagung Wettbewerbsfähigkeit und Handel
Themen: Diskussion über die Angleichung von Handels- und Industriepolitik, um das europäische industrielles Ökosystem und seine Position auf dem Weltmarkt zu stärken, Diskussion der vielversprechendsten Wertschöpfungsketten für die Integration der Kandidatenländer in den Binnenmarkt, Entwicklung einer gemeinsamen Haltung gegenüber den externen Partnern der EU. Infos
05.02.2025
Wöchentliche Kommissionssitzung
Themen: Mitteilung über die Bewältigung von Herausforderungen bei Plattformen für den elektronischen Handel. Vorläufige Tagesordnung
05.02.2025 – 14:30-16:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
Themen: Gedankenaustausche mit Thomas Hans Ossowski (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in der Türkei), mit Nicolas Berlanga (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in der Demokratischen Republik Kongo) und mit Lutz Guellner (neu ernannter Leiter des EU-Büros in Taiwan). Vorläufige Tagesordnung
Bereits am 5. März soll der Autodialog abgeschlossen sein. Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas soll an dem Tag den Aktionsplan für die Autobranche mit den Ergebnissen des Strategischen Dialogs zur Zukunft der Automobilindustrie vorlegen. Dieser Zeitplan mit dem schnellen Abschluss, den die Kommission noch während der Sitzung öffentlich gemacht hat, kam für die Teilnehmer überraschend. Es ist offenbar nur noch am 3. März eine Sitzung in der Formation geplant, wie sie gestern stattgefunden hat.
Bei der dreistündigen Auftaktsitzung gestern waren nur die Chefs der 22 eingeladenen Unternehmen der Branche, Gewerkschaften und NGOs im Saal. Mitarbeiter mussten in einem gesonderten Raum im Berlaymont warten. Die Chefs trugen ihre Positionen vor, zu einem Austausch über die Positionen kam es nicht.
Mercedes-Chef Ola Källenius, der turnusgemäß ACEA vorsteht, etwa forderte Technologieoffenheit bei den Flottengrenzwerten bis 2035 ein. Ein anderer OEM-CEO machte den Bedarf von Plug-in-Hybrides nach 2035 geltend, also die Aufhebung des Verbrenner-Aus 2035. In vier Arbeitsgruppen, die je von einem Kommissar geführt werden, sollen nun Ergebnisse erarbeitet werden zu den Themen:
Dem Vernehmen nach hat von der Leyen nicht durchblicken lassen, wie sie zu den Forderungen der Industrie steht. Es sei aber deutlich gewesen, dass die Kommissionspräsidentin verstanden habe, wie sehr die Industrie unter Druck ist und dass es Handlungsbedarf gebe. mgr

Eine Rekordsumme von 89 Milliarden Euro hat die Europäische Investitionsbank (EIB) im vergangenen Jahr investiert. Sechzig Prozent davon wurden in klimarelevante Projekte investiert. Das meldete die EIB gestern bei der Präsentation ihres Jahresberichts. Dual-Use-Finanzierungen im Bereich Sicherheit und Verteidigung wurden im vergangenen Jahr zwar verdoppelt, bleiben aber mit einer Milliarde Euro relativ niedrig.
EIB-Präsidentin Nadia Calviño sagte, dass sich der Betrag für Dual-Use-Finanzierungen 2025 verdoppeln dürfte. Der limitierende Faktor sei aber nicht die Zurückhaltung der EIB, sondern ein Mangel an Nachfrage für Dual-Use-Finanzierungen aus der Privatwirtschaft. Die EIB habe acht Milliarden Euro für Dual-Use zur Verfügung gestellt, wovon aber nur eine Milliarde benutzt wurde.
Im vergangenen Jahr habe die EIB eine Roadshow in den Mitgliedstaaten gemacht, um mehr Projekte im Dual-Use-Bereich zu ermutigen, sagte die EIB-Präsidentin. Fragen zu einer Erweiterung des EIB-Mandats auf Verteidigungsprojekte, die bisher nicht von der EIB finanziert werden können, wich Calviño aus. Sie erinnerte daran, dass sie um eine solide Finanzierung bemüht sei – eine Anspielung auf die Sorgen, dass eine Finanzierung von Verteidigungsinvestitionen das Kreditrating der Bank beeinträchtigen könnte. “Wir sind kein Verteidigungsministerium”, sagte Calviño.
Auch EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP) hatte am Mittwoch daran erinnert, dass die EIB nicht im Alleingang für die Aufrüstung Europas sorgen könne. Das Problem liege vor allem daran, dass die Rüstungsindustrie nicht genügend Bestellungen erhalte. Ohne gesicherte Nachfrage wolle die Industrie keine Investitionen tätigen. Wenn die Verteidigungsminister ihre Bestellmengen erhöhten, so würde die Industrie auch in Produktionskapazitäten investieren. Um diesen Finanzbedarf zu stemmen, hätten auch normale Geschäftsbanken genügend Liquidität, so Beer. jaa
Der Vorschlag der Europäischen Kommission, hohe Zölle auf Stickstoffdünger aus Russland und Belarus zu erheben, geht dem deutschen Düngemittelhersteller SKW Piesteritz nicht weit genug. Grundsätzlich begrüße man den Schritt, seine volle Wirkung entfalte er aber “viel zu spät”, teilt das Unternehmen Table.Briefings mit. Die Brüsseler Behörde will den Satz stufenweise anheben, bis 2028 schließlich prohibitive Zölle von zirka 100 Prozent des Preises anfallen.
Die EU müsse nachbessern und “sofort wirkende und eindeutige Maßnahmen ergreifen”, fordert SKW Piesteritz. Nur so könne die Kommission ihr erklärtes Ziel, vor dem Hintergrund des Angriffskriegs auf die Ukraine eine wichtige Finanzquelle Russlands stillzulegen, rasch erreichen. Anfang des Jahres hatte SKW Piesteritz vermeldet, die Düngemittelproduktion in Deutschland zu drosseln, und das auch mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs begründet. Zusätzlich zum Schritt der EU müsse die Bundesregierung die Industrie entlasten und etwa die Gasspeicherumlage streichen, fordert das Unternehmen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen neuer Zölle habe der Agrarsektor zu erleiden, warnt derweil der EU-Bauernverband Copa Cogeca. Zur nächsten Erntesaison könnten die Düngemittelpreise um mindestens 40 Euro pro Tonne steigen. Der Verband erkennt die geopolitischen Beweggründe der Kommission an, fordert aber Ausgleichsmaßnahmen. Etwa den Wegfall von Anti-Dumping-Zöllen für Düngeimporte aus den USA sowie Trinidad und Tobago.
Die Kommission argumentiert, die geplante Übergangsphase minimiere das Risiko eines Preisanstiegs. Denn so bleibe Zeit, die heimische Produktion aufzustocken und Importquellen zu finden. Der am Dienstag veröffentlichte Vorschlag sieht auch vor, Zölle auf russische und belarussische Agrargüter auszuweiten. Deren Einfuhren in die EU sind aber wirtschaftlich deutlich weniger bedeutsam als Düngeimporte. jd
Fleisch weiblicher Rinder aus Brasilien soll erst wieder in die EU importiert werden, wenn das Land seine Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit verbessert hat. Das bekräftigte die Europäische Kommission in dieser Woche. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme sieht sie Gesundheitsstandards bei Importen aus Brasilien als erfüllt. Laut einer Untersuchung der Brüsseler Behörde im vergangenen Jahr können die brasilianischen Behörden nicht ausschließen, dass bei der Zucht weiblicher Rinder für die Ausfuhr in die EU das Hormon Östradiol verabreicht wird. Brasilien hatte daraufhin die Exporte vorerst gestoppt.
Abgeordnete aus dem gesamten politischen Spektrum nahmen den Fall dagegen zum Anlass, das Mercosur-Abkommen infrage zu stellen. Unfaire Handelsbedingungen im Rahmen des Mercosur-Abkommens fürchtet etwa der Umweltsprecher der liberalen Renew-Fraktion, Pascal Canfin. Auch der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling meint: Der Bericht der Kommission zeige, dass Importe aus Brasilien nicht die gleichen Standards erfüllten wie hiesige Produkte.
Die Kommission hält dagegen: Brasilien habe einen überzeugenden Plan vorgelegt, um die Kontrollen innerhalb eines Jahres zu verbessern. Dessen Umsetzung werde man genau überprüfen, betont Maria Pilar Aguar Fernandez von der Kommissionsabteilung für Gesundheits- und Lebensmittelaudits, die am Dienstag von den Abgeordneten im Umweltausschuss befragt wurde. Unfaire Handelsbedingungen zwischen europäischen und brasilianischen Erzeugern schließt sie aus. Auch gebe es keine Hinweise, dass tatsächlich hormonbehandeltes Fleisch auf den europäischen Markt gelangt sei.
Agrarkommissar Christophe Hansen erklärte ebenfalls Anfang der Woche, das EU-System zur Überprüfung von Handelsstandards funktioniere. Dass man den Fall in Brasilien aufgedeckt habe, sei ein klarer Beleg dafür. Er räumte aber ein, das System müsse künftig “noch besser” werden. Der Luxemburger sieht dabei auch die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten in der Pflicht. Sie sind dafür zuständig, die Lebensmittelsicherheit von Produkten zu überprüfen, die auf den EU-Binnenmarkt gelangen. jd
Die Regierungskoalition in Norwegen ist im Streit über die Umsetzung von EU-Regulierungen zum Energiemarkt zerbrochen. Die bäuerliche Zentrumspartei als bisheriger Juniorpartner der Sozialdemokraten von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre tritt im Zuge der Unstimmigkeiten aus der Regierung aus, wie der Parteichef und bisherige Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum sowie Fraktionschefin Marit Arnstad am Donnerstag in Oslo verkündeten.
Das Aus der Koalition bedeutet, dass Støres Sozialdemokraten bis zur nächsten Wahl alleine weiterregieren. Sie müssen dafür aber acht Ministerposten neu besetzen, die bislang Politiker der Zentrumspartei innehatten. Die nächste Parlamentswahl soll im September stattfinden. Vorzeitige Neuwahlen sieht die norwegische Verfassung nicht vor.
Støres Sozialdemokraten und Vedums Zentrumspartei haben seit längerem über die Umsetzung eines 2019 verabschiedeten EU-Energiemarktpakets gestritten, das aus insgesamt acht Verordnungen und Richtlinien besteht. Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, muss EU-Binnenmarktregeln aber als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) dennoch übernehmen.
Die EU-skeptische Zentrumspartei lief gegen diese Umsetzung jedoch vehement Sturm. Während Støre zumindest drei weniger umstrittene Richtlinien des Pakets in norwegisches Recht gießen wollte, ging dies für die Zentrumspartei zu weit. Sie lehnte vor allem die Ausweitung der Befugnisse der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Acer) ab. Sie begründete diese Haltung damit, dass das Paket Norwegens nationale Kontrolle über den Energiesektor schwäche und eine engere Bindung an den EU-Energiemarkt zu höheren Strompreisen führen könne. dpa
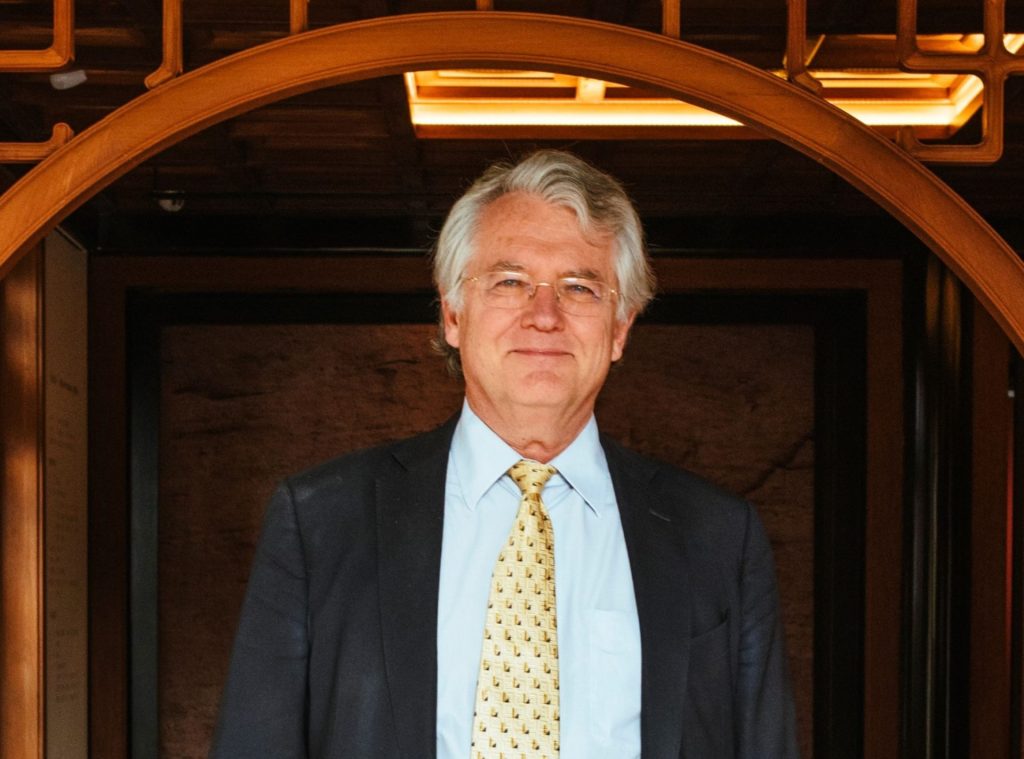
China erlebt gegenwärtig seinen Sputnik-Moment. So wie die Sowjetunion in den späten 1950er-Jahren die USA mit dem ersten Satelliten im All überraschte, so erscheint der chinesische Sputnik für Europa aktuell in Form von künstlicher Intelligenz, aber auch futuristischen, batteriebetriebenen Automobilen. Das chinesische KI-Start-up DeepSeek zeigt den amerikanischen Tech-Champions Google, Apple und Meta, dass KI “Made in China” Weltklasse ist. Das junge Unternehmen hat einen offenen Standard verhältnismäßig günstig entwickelt – weniger als sechs Millionen Euro soll R1 gekostet haben. Zugleich wird deutlich, dass die US-Sanktionen auf Chip-Exporte eher chinesische Innovation stimuliert haben, als das Land in der Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Technologie zu behindern. Ein Wake-up-Call – auch für Europa.
Als die chinesische Staatsführung vor zehn Jahren ihre Industriestrategie Made in China 2025 vorstellte, sorgte sie damit weltweit für Irritationen. Spätestens in diesem Moment war klar, dass Chinas Weg zur Industrie-Supermacht Friktionen und Rivalitäten mit dem westlichen, liberalen Wirtschaftssystem verursachen würde.
In Washington fand ein Umdenken statt: Statt von “konstruktivem Engagement” mit China sprachen die Strategen in der US-Regierung und in den einflussreichen Thinktanks nun plötzlich von “strategischem Wettbewerb” oder “strategischer Rivalität”. Mit dem von der Trump-Regierung 2018 begonnenen Handelskrieg hat der Stellenwert der Innovation noch an Bedeutung gewonnen.
Die aggressive Art und Weise, mit der die USA chinesische Firmen wie Huawei und ZTE angegriffen und vom Angebot an hochwertigen Halbleitern abgeschnitten haben, führte zu einer Verhärtung der Ansichten in Peking. Mit großen finanziellen Anstrengungen arbeitet China daran, seine Abhängigkeit von “unzuverlässigen” westlichen Partnern zu verringern. China fördert unter den Konzepten “Dual Circulation” und “Indigenous Innovation” die heimische Technologie unter zunehmendem Ausschluss ausländischer Unternehmen.
Europa hat weder die militärische und technologische Macht der USA. Noch kann und soll es das staatlich gelenkte Subventions- und zentralistische Planungsmodell der Volksrepublik China imitieren. Das Interesse der Europäischen Union ist es, das zu bewahren, was die Volkswirtschaften des Kontinents nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich gemacht hat: integrierte globale Wertschöpfungsketten mit gegenseitigen Abhängigkeiten.
Die Basis dafür bildeten Handelsbeziehungen, die liberal, multilateral, regelbasiert und durch einen verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus vor der Welthandelsorganisation WTO abgesichert waren. Der in Teilen der Welt beobachtete Anstieg von nationalem Protektionismus, Bilateralismus und dem Streben nach Autarkie stellt die EU vor eine Herausforderung, die sie meistern muss. Aber die Antwort Europas darauf sollte nicht sein, ebenfalls protektionistischer zu werden. Sondern die liberalen, offenen Werte zu wahren und für sie einzutreten. Was konkret zu tun ist?
Die Fragmentierung des europäischen VC-Markts ist einer der Gründe dafür, weshalb es in Europa insgesamt weniger “Einhörner” gibt als in China und den USA, also private Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Die nationalen VC-Märkte in Europa haben keinen einheitlichen Rechtsrahmen, was sowohl die Investitionstätigkeit als auch das Fundraising über die Grenzen hinweg behindert. Hürden für grenzüberschreitende Investitionen abzubauen, wäre ein wichtiger Schritt für eine effizientere Kapitalallokation und würde helfen, VC-Renditepotenziale zu realisieren.
Will Europa das Technologie-Rennen gegen China langfristig bestehen, dann muss es zudem seine Gangart beschleunigen. Um gegen China zu bestehen, gilt es, bessere Ideen und klügere Technologien zu entwickeln, statt durch Rückzug in die Isolation seine eigene Wirtschaft zu schützen.
Es besteht kein Zweifel, dass der wirtschaftliche und technologische Aufstieg Chinas sowie die wachsende Rivalität zwischen China und den USA in den kommenden Jahren die größte Herausforderung für Deutschland und Europa werden. China hat die Größe und unter der aktuellen Führung das politische Selbstvertrauen, ein unabhängiges, eigenständiges Wirtschaftssystem aufzubauen – ein System mit chinesischen Vorzeichen.
Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag (30.01.2025, 14.00 Uhr, MESZ) diskutieren Jörg Wuttke, Partner bei der DGA Group/Albright Stonebridge Group in Washington D.C. und Adam S. Posen, Präsident des Peterson Institute for International Economics, ebenfalls in Washington D.C., zum Thema “Wie wird Trump 2.0 die europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen umgestalten?” Das Webinar findet auf Englisch statt. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.
Hinweis der Redaktion: Über China zu diskutieren heißt heute mehr denn je: kontrovers debattieren. Wir möchten die Vielfalt der Standpunkte abbilden, damit Sie einen Einblick in die Breite der Debatte gewinnen können. Standpunkte spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
Juanma Moreno, Ministerpräsident der Region Andalusien, wird neuer Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen. Die EVP-Vertreter werden den konservativen Politiker heute offiziell vorschlagen. Im Rahmen einer Absprache mit den Sozialdemokraten wird die Vize-Bürgermeisterin von Budapest, Kata Tüttő, nach zweieinhalb Jahren den Posten übernehmen.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
