hat Mario Draghi noch etwas vor? Der ehemalige EZB-Chef, italienische Ministerpräsident einer Technokratenregierung sowie Chef der italienischen Nationalbank sondiere, ob er seinen Hut für einen der EU-Topjobs in den Ring wirft. Das hört man in Brüssel und jenseits der Alpen. Draghi ist zwar schon 76. Er traue sich aber immer noch eine der vielen Führungsaufgaben zu, die die Staats- und Regierungschefs möglicherweise nach der Europawahl im Paket entscheiden.
So wie Ursula von der Leyen 2019 könnte Super-Mario plötzlich eine Rolle im großen Personalpoker spielen. Und zwar gepusht von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie ist auch die Chefin der konservativen Parteienfamilie EKR, versteht sich bestens mit Draghi und könnte ihn als Kommissionspräsident vorschlagen.
Es sei bereits im Élysée dezent nachgefragt worden, und Emmanuel Macron habe zumindest nicht “Non” gesagt. Auch der griechische Ministerpräsident könnte der Berufung etwas abgewinnen: Kyriakos Mitsotakis strebe die Nachfolge von Charles Michel an der Spitze des Rates an. Wenn der parteilose Draghi komme, sei für den Christdemokraten Mitsotakis der Weg in den Rat nicht verbaut.
An diese Personalspekulation ist eine inhaltliche Position geknüpft. Die südlichen Mitgliedstaaten – und Frankreich gehört dazu – fordern bereits ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm im nächsten Mandat. Draghi sei derjenige, der diesen Wunsch zu seinem Programm machen könnte.
Für Deutschland wäre ein Kommissionspräsident, der noch einmal Schulden machen will in Europa, jedoch eine schlechte Nachricht: Das Bundesverfassungsgericht hatte schon den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds nur unter der Voraussetzung durchgewunken, dass es eine einmalige Ausnahme bleibe.
Und was wäre mit Ursula von der Leyen? Zum einen hat sie bis heute nicht erklärt, dass sie wieder antritt. Zum anderen ist nicht ausgeschlossen, dass sie im Sommer, wenn das Ergebnis der Europawahl vorliegt, von US-Präsident Joe Biden zur Nato gerufen wird. Ob sie den Ruf, die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsbündnisses zu werden, ablehnen würde?

Die Bundesregierung hat Vorbehalte gegen Anti-Dumping-Zölle der EU auf E-Autos aus China. “Ausgleichszölle der EU könnten die EU-Industrie schützen, aber auch negativ treffen”, heißt es in der als vertraulich eingestuften Stellungnahme der Bundesregierung zum Arbeitsprogramm 2024 der EU-Kommission, die Table.Media vorliegt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte eine Antisubventionsuntersuchung für batterieelektrische Autos aus China angekündigt. Gleichzeitig hatte sie nahegelegt, dass es Hinweise für eine unzulässige Subventionierung gebe. Damit gilt es als eine Frage der Zeit, dass die Kommission Anti-Dumping-Zölle auf E-Autos aus China erhebt.
Die Bundesregierung befürchtet negative Folgen durch die Zölle für die deutschen Hersteller. Ohne die deutschen Konzerne direkt zu erwähnen, warnt die Stellungnahme vor negativen Folgen “zum einen direkt (bei EU-Herstellern in China, die in die EU exportieren) sowie indirekt (bei etwaigen Vergeltungsmaßnahme(n) Chinas).”
Hintergrund ist, dass die deutschen Marken wie Mercedes, BMW und VW bis zu 40 Prozent ihres Absatzes in China machen sowie große Produktionskapazitäten in China selbst aufgebaut haben. Die französischen Hersteller dagegen sind nicht auf dem chinesischen Markt aktiv, fordern aber seit Langem EU-Zölle auf E-Autos aus China, weil chinesische Marken in der EU massiv mit E-Autos der französischen Hersteller konkurrieren und ihnen Marktanteile streitig machen.
Die Bundesregierung mahnt eine “regelkonforme und ergebnisoffene Untersuchung” im Zuge des Antisubventionierungsverfahrens an sowie, “dass die jeweiligen Interessen im Rahmen des Unionsinteresses berücksichtigt werden.” Die Mitgliedstaaten seien “angesichts der politischen Sensibilität in das Verfahren eng einzubinden”. Das Schreiben enthält auch eine deutliche Kritik an der Kommission: Die Antisubventionsuntersuchung habe nämlich die “Besonderheit, dass sie ex officio und damit nicht auf Basis eines Antrags eines EU-Herstellers eingeleitet wurde”. Die Botschaft der Bundesregierung lautet also, dass die Kommission sich von der französischen Regierung habe drängen lassen.
Beim Green Deal zeigt sich die Bundesregierung enttäuscht. “Die Bundesregierung bedauert jedoch sehr, dass die Kommission wichtige Vorhaben der Farm-to-Fork-Strategie aktuell nicht weiterverfolgt”, heißt es weiter in dem Papier. Anders als in den vergangenen Arbeitsprogrammen sei die “umfassende Überarbeitung des europäischen Tierschutzrechts und die Schaffung eines Rechtsrahmens für nachhaltige Ernährungssysteme (FSFS)” nicht mehr vorgesehen. Entsprechende Initiativen seien aber dringend erforderlich, um die gesellschaftlichen Erwartungen für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme hin zu mehr Tierschutz und Nachhaltigkeit voranzubringen.
Die Bundesregierung bemängelt auch, dass die Kommission erneut die Lebensmittelkennzeichnungsvorhaben aus der Farm-to-Fork-Strategie nicht im Arbeitsprogramm aufführt. Für die Bundesregierung hätten die von der Kommission bereits für Ende 2022 angekündigten Legislativvorschläge zur erweiterten Nährwertkennzeichnung, zur Herkunftskennzeichnung, zu Datumsmarkierungen, Nährwertprofile und zur Kennzeichnung alkoholischer Getränke “sehr hohe Priorität”. Obwohl auch eine Überarbeitung des EU-Rechts zu Lebensmittelkontaktmaterialien längst im Zuge der Farm-to-Fork-Strategie angekündigt war, habe die Kommission immer noch nicht geliefert, rügt das Papier aus dem Kanzleramt.
Auch in der Industriepolitik macht die Bundesregierung Vorbehalte geltend. Sie will im Gegensatz zur Kommission weiter auf die Subventionierung für die Dekarbonisierung der Industrie setzen. Die entsprechenden Kapitel im befristeten Beihilferahmen TCTF will sie bis Ende 2027 verlängern. Derzeit sind die Abschnitte 2.5, 2.6. und 2.8 bis 2025 befristet. Die Kommission hatte sich erst vor wenigen Wochen dagegen entschieden, sie auszudehnen. Nur die Möglichkeit für Beihilfen zu gestiegenen Energiekosten wurde um ein halbes Jahr bis Mitte 2024 verlängert.
Unklar ist, ob die Antwort der Bundesregierung zu diesem Thema vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen Klima- und Transformationsfonds (KTF) formuliert wurde oder ob die Bundesregierung auf eine Entspannung der Haushaltslage nach 2025 spekuliert. Mitarbeit Manuel Berkel
Es soll ein “strategischer” Gipfel werden, mit wegweisenden Beschlüssen zur Ukraine und zur Finanzierung der EU. Doch zwei Wochen vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel kämpft Ratspräsident Charles Michel mit unerwarteten Problemen. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán droht mit einem Veto gegen neue Finanzhilfen für die Ukraine. Außerdem will er sich bei dem Gipfel Mitte Dezember gegen eine Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine aussprechen. “Wir haben es mit einem völlig verfrühten Vorschlag zu tun”, sagte der Stabschef von Orbán, Gergely Gulyas, am Donnerstag.
Ein Besuch in Budapest hat keine Annäherung gebracht. Mehr als zwei Stunden unterhielten sich Orbán und Michel, um die Blockade zu lösen. Orbán sprach hinterher von einem “nützlichen Treffen” – was in Diplomatensprache nichts anderes bedeutet, als dass man seine Meinungen ausgetauscht hat, ohne sich anzunähern. Michel hielt sich bedeckt, von ihm gab es nicht mal einen Tweet.
Man bleibe in Kontakt, sagte eine EU-Sprecherin nach dem Krisentreffen. Michel braucht Orbáns Zustimmung, um die von der EU-Kommission empfohlenen Beitrittsverhandlungen eröffnen zu können. Orbán droht jedoch mit einem Nein und fordert, zunächst eine strategische Debatte über den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland und die Fortschritte bei der EU-Integration zu führen.
Eine solche, grundsätzliche Aussprache hat es zwar schon öfter gegeben – vom Sondergipfel in Versailles im März 2022 bis zum Spitzentreffen in Granada im Oktober 2023. Orbán verweist jedoch auf die neue Lage, die durch das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive entstanden sei. Auch die Sanktionen hätten ihr Ziel verfehlt – während Deutschlands Wirtschaft kriselt, wächst Russland wieder.
Orbán spreche wichtige Fragen an, heißt es im Rat. Seine demonstrative Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin – beide hatten sich beim Seidenstraßen-Gipfel im Oktober in Peking getroffen – lasse jedoch an seiner Unvoreingenommenheit zweifeln. Sein wahres Motiv sei es wohl, die Freigabe von 13 Milliarden Euro aus dem EU-Budget zu erzwingen, vermuten EU-Diplomaten.
Die EU-Kommission hatte die Gelder wegen Rechtsstaatsproblemen in Ungarn eingefroren. In der vergangenen Woche gab sie dann überraschend 900 Millionen Euro frei. Weiteres Geld könnte bald folgen, hieß es am Donnerstag in Brüssel. In den Verhandlungen mit der EU-Kommission habe es “signifikante Fortschritte” gegeben, sagte eine EU-Quelle, die namentlich nicht genannt werden wollte. Denkbar wäre eine Auszahlung von bis zu 10 Milliarden Euro.
Allerdings ist unklar, ob weitere EU-Mittel noch rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember fließen – und ob sich Orbán damit zufriedengibt. Bisher nutzt er den Streit ums Geld als Hebel, um Gipfelchef Michel unter Druck zu setzen. Dabei kommt ihm zugute, dass sich die Stimmung in einigen EU-Ländern gegen die Ukraine dreht – und dass die Gipfelagenda noch andere Probleme birgt.
Robert Fico aus der Slowakei und Geert Wilders aus den Niederlanden teilen Orbáns Vorbehalte gegen Michels Ukraine-Kurs. Einige andere Regierungschefs stehen auf der Bremse, weil sie fürchten, übervorteilt zu werden. Mit grünem Licht für Beitrittsgespräche wären nämlich auch neue, milliardenschwere EU-Finanzspritzen für Kiew verbunden. Für andere Aufgaben hingegen ist kein Geld da.
Zum Stolperstein könnte ausgerechnet Deutschland werden. Das größte EU-Land befürwortet zwar sowohl den Start von Beitrittsgesprächen als auch neue Finanzhilfen für die Ukraine. Es unterstützt also Michels Gipfelagenda. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ukraine-Hilfe in seiner jüngsten Regierungserklärung sogar als “existenziell” bezeichnet und dauerhafte Finanzzusagen angedeutet.
Berlin will aber nur für die Ukraine zahlen – und nicht für die gemeinsame Asylpolitik oder den Schuldendienst des Corona-Aufbaufonds, wie dies Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat. Eine Aufstockung des laufenden Sieben-Jahre-Budgets um 66 Milliarden Euro lehnt Berlin ab und fordert, Haushaltsreserven zu nutzen: Die deutsche Budgetkrise lasse keine Extrawürste zu.
Dies wiederum ruft Länder wie Italien auf den Plan, die zwar ebenso wenig wie Deutschland mit Orbáns Veto-Drohung anfangen können, allerdings auch nicht den Kürzeren ziehen wollen. Mehrere Kompromissvorschläge des spanischen EU-Vorsitzes konnten den Streit bisher nicht lösen. Beim EU-Gipfel im Dezember könnten die Interessen hart aufeinander prallen.
In Brüssel kursieren bereits wilde Gerüchte und Schuldzuweisungen. Von der Leyen habe einen strategischen Fehler begangen, indem sie die Ukraine-Hilfe mit einer Aufstockung des EU-Budgets verknüpft habe, schreibt der Europa-Chef der Consultingfirma Eurasia Group, Mujtaba Rahman auf X (ehemals Twitter). Dieser Fehler könne sie sogar eine zweite Amtszeit an der EU-Spitze kosten.
Andere zweifeln am Verhandlungsgeschick von Gipfelchef Michel. Aber auch Kanzler Scholz muss sich Kritik anhören. Die EU-Politik drohe zum Kollateralschaden der hausgemachten deutschen Haushaltsprobleme zu werden. Dass Scholz es nicht einmal schaffte, das heimische Publikum in Berlin zu überzeugen und einen Weg nach vorn zu weisen, trägt weiter zur Verunsicherung in Brüssel bei.
Wie geht es nun weiter? Michel wird, wenn nicht alles täuscht, umdisponieren müssen. Zwar gebe es keinen Anlass für “Schwarzmalerei”, sagt ein EU-Diplomat. Es sei jedoch durchaus denkbar, dass im Dezember noch kein Beschluss zur Eröffnung von Beitrittsgesprächen fällt. Wegen des Widerstands aus Ungarn, aber auch wegen noch ausstehender Reformen in der Ukraine könnte man sich mit einem unverbindlichen positiven Signal zufriedengeben.
Die EU-Kommission will erst im März über noch ausstehende Reformen berichten. Dazu zählt die Stärkung der Minderheitenrechte, die auch die Venedig-Kommission des Europarats fordert – und die Ungarn lautstark angemahnt hat. Zudem fehlt für den Start von Beitrittsverhandlungen noch der sogenannte Verhandlungsrahmen, der die Leitlinien und Grundsätze für die Gespräche mit Kiew festlegt. Beides könnte die Staats- und Regierungschefs dazu bewegen, einen formellen Beschluss zu vertagen.
Auch die umstrittene Aufstockung des EU-Budgets könnte auf die lange Bank geschoben werden. Denn Deutschland ist mit seinen Bedenken nicht allein. Auch mehrere nord- und osteuropäische Länder halten die Brieftasche zu. Derweil fordern Länder wie Italien oder Griechenland mehr Geld für die gemeinsame Flüchtlingspolitik. Die EU-Staaten könnten einander blockieren.
Orbán hat in ein Wespennest gestochen – und seit Langem schwelende Widersprüche und Konflikte in der EU-Politik offen gelegt. Michel bleibt nicht mehr viel Zeit, den Schaden zu begrenzen und seine Gipfelagenda zu retten.
04.12.-05.12.2023
Rat der EU: Justiz und Inneres
Themen: Sachstand zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine (Bekämpfung der
Straflosigkeit), Billigung der europäischen Strategie für die E-Justiz 2024-2028, Fortschrittsbericht zum Migrations- und Asylpaket. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie (Verkehr)
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Verordnung über die Erfassung der Treibhausgasemissionen
von Verkehrsdiensten, aktuelle Gesetzgebungsvorschläge – unter anderem der AI Act, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-19:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT)
Themen: Gedankenaustausch mit Kommissarin Ivanova, Entwurf einer Stellungnahme zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2022, Meinungsaustausch über kohäsionspolitische Mittel zur Förderung von Kultur und Bildung. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)
Themen: Entscheidung des Rates mit der Aufforderung an die Mitgliedstaaten, die Konvention gegen Gewalt und Belästigung zu ratifizieren, Treffen des interparlamentarischen Ausschusses zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am Wahlprozess. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)
Themen: Berichtsentwurf zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, Entwurf einer Stellungnahme zu standardessentiellen Patenten, Europäische grenzüberschreitende Verbände. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:15 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)
Themen: Berichtsentwurf zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, Präsentation des Projekts “Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Prüfung von EU-Fonds”. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-17:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
Themen: Gedankenaustausch mit Andrea Ammon (Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten), STOA-Studie “Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und Förderung der pharmazeutischen Innovation”, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen (Bekämpfung des Arzneimittelmangels in der EU). Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:30-18:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)
Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zum Business in Europe (Rahmen für die Einkommensbesteuerung), Berichtsentwurf zur rascheren und sichereren Entlastung von zu viel erhobenen Quellensteuern. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:30-17:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
Themen: Meinungsaustausch mit Gert Jan Koopman (Generaldirektor für Nachbarschafts- und Erweiterungsverhandlungen) über die Ergebnisse der Überprüfung der EU-Finanzhilfe für die Palästinenser. Vorläufige Tagesordnung
05.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie (Telekommunikation)
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des
Ausbaus von Gigabit-Netzen für die elektronische Kommunikation, Fortschrittsbericht zur Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union für die Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen (Cybersolidaritätsgesetz), Informationen der Kommission zu europäischen Datenportalen als Schlüsselelement der EU-Ministererklärung für die digitale Dekade (Fortschrittsbericht und Zeitplan für künftige Etappen). Vorläufige Tagesordnung
06.12.2023
Wöchentliche Kommissionssitzung
Themen: Bürgerpaket (Konsularischer Schutz – Überprüfung der EU-Vorschriften, Staatsbürgerschaftsbericht 2023), Kein Platz für Hass (ein geeintes Europa gegen Hass), Tierschutzpaket (Schutz von Tieren beim Transport – Überarbeitung der EU-Gesetzgebung, Verordnung über den Schutz von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit, Reaktion auf die europäische Bürgerinitiative “Pelzfreies Europa”). Vorläufige Tagesordnung
06.12.2023
Trilog: AI Act
Themen: Nach dem ursprünglichen Plan sollte dies der abschließende Trilog zur weltweit ersten umfassenden Regulierung von Künstlicher Intelligenz sein. Doch ob das gelingt ist fraglich, da die Positionen von Rat und Parlament vor allem in Bezug auf Foundation Models, biometrischer Identifizierung in Echtzeit und der Strafverfolgung weit auseinander liegen.
07.12-08.12.2023
EU-China-Gipfel
Themen: Die Staatsspitze Chinas und die Spitzen der EU kommen zu Beratungen zusammen. Infos
07.12-08.12.2023
Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit
Themen: Fortschrittsbericht zur Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten
Produkten auf dem Unionsmarkt, Informationen der Kommission zur Mitteilung der Kommission über die Stärkung des europäischen Verwaltungsraums, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung
07.12.2023
Trilog: Gebäuderichtlinie
Themen: Im wohl abschließenden Trilog müssen die Verhandler noch klären, wie viel Energie der Gebäudesektor bis 2030 und 2035 insgesamt einsparen muss. Strittig sind auch noch die Vorgaben für Nichtwohngebäude und Ladeinfrastruktur.
07.12.2023
Euro-Gruppe
Themen: Bewertung der Haushaltsplanentwürfe der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes sowie der Haushaltslage und -aussichten des Euro-Währungsgebiets, Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet für 2024: Vorstellung durch die Kommission, Funktionsweise des WKM II. Vorläufige Tagesordnung
07.12.2023 – 09:00-12:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)
Themen: Stellungnahme zur Umsetzung und zu den Ergebnissen der Kohäsionspolitik 2014-2020 in den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch mit der Kommission über gemeinsame Anstrengungen und gemeinsame Ziele der GAP-Strategiepläne 2023-2027. Vorläufige Tagesordnung
08.12.2023
Trilog: Gasmarktverordnung
Themen: Nachdem Rat und Parlament vor einer Woche keine Einigung gelungen ist, müssen die Verhandler sich nun über die Verordnung einig werden, damit das Gaspaket aus Verordnung und Richtlinie vor den Wahlen beschlossen werden kann. Noch offen ist die Schaffung eines Europäischen Netzwerks der Wasserstoffnetzbetreiber (ENNOH), aber auch der Umgang mit russischen Gasimporten.
08.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung, Fortschrittsbericht zum Paket zur einheitlichen Währung, Gedankenaustausch zu den wirtschaftlichen und finanzielle Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Vorläufige Tagesordnung
10.12.-11.12.2023
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
Themen: Gedankenaustausch zur Marktlage, insbesondere nach der Invasion in die Ukraine, Gedankenaustausch zur Bilanz des ersten Jahres der Umsetzung der GAP-Strategiepläne, Fortschrittsbericht zur Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Vorläufige Tagesordnung
Es könnte nach der Europawahl der nächste große Integrationsschub sein: EU-Ratspräsident Charles Michel hat seinen Auftritt bei der jährlichen Konferenz der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) genutzt, um weitere Schritte hin zu einer Sicherheits- und Verteidigungsunion zu fordern. Mehr sei nötig, das “Europäische Erwachen” nach Russlands Überfall auf die Ukraine nehme erst langsam Konturen an.
Charles Michel dürfte auch ein mögliches Comeback von Donald Trump vor Augen haben: Europa müsse ein klares Signal setzen, die eigene Sicherheit ernster zu nehmen als bisher. Der EU-Ratspräsident plädierte für ein stärkeres europäisches Militär, für mehr gemeinsame Rüstungsbeschaffung und eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die Verteidigungsagentur soll zu einem “mächtigen Europäischen Verteidigungsdepartement” werden. In Brüssel ist die Rede davon, dass die nächste EU-Kommission einen Kommissar speziell für den Bereich Sicherheit und Verteidigung haben könnte.
Neutrale Mitgliedstaaten wie Österreich oder Irland dürften dies allerdings kritisch sehen. Laut Charles Michel könnte dieses Europäische Verteidigungsdepartement gemeinsame Beschaffungen oder auch die Pesco-Projekte der militärischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten koordinieren. “Wir sollten auch die Idee von Europäischen Verteidigungsbonds in Betracht ziehen“, sagte der Ratspräsident. Dies, um Europas technologische und industrielle Basis zu stärken. Auch hier ist Widerstand in den Mitgliedstaaten programmiert.
Wie sehr gemeinsame Anstrengungen nötig sein könnten, wurde am Donnerstag bei einer Präsentation des Branchenverbands der Europäischen Luftfahrt, Sicherheit und Verteidigungsindustrien (ASD) deutlich. Russlands Überfall auf die Ukraine sei ein Weckruf für Europas Verteidigungsindustrie und für die EU-Staaten gewesen, sagte Micael Johansson, CEO von Saab und Vice-Chairman des Branchenverbandes. Die Industrie habe inzwischen massiv investiert, aber es brauche eine bessere Risikoverteilung. Die Industrie habe nicht die langfristigen Verträge, die es für die Planungssicherheit brauche.
Die Regierungen signalisierten zwar, dass es “von allem mehr” brauche, sagte Micael Johansson. Doch das Ziel bleibe unklar. Mit Blick auf die schleppende Munitionsproduktion für die Ukraine heißt es beim Branchenverband, ein ganzes System von Zulieferern müsse erst wieder aufgebaut werden. Bei Rohstoffen sei Europa zudem vielfach abhängig von Ländern in Asien. Die Ukraine brauche 2,4 Millionen Artilleriegeschosse im Jahr, doch in Europa seien die Kapazitäten derzeit bei 200.000 bis 300.000.
Die EU-Kommission will die Kapazitäten bis nächstes Jahr auf eine Million hochfahren und bis Ende März 2024 der Ukraine ebenfalls eine Million Munition vom Kaliber 155 Millimeter liefern, dürfte aber beide Ziele deutlich verpassen. Generell brauche es mehr souveräne Kapazitäten in Europa, meinte Micael Johansson. Die europäischen Staaten kauften derzeit 78 Prozent ihrer Rüstungsgüter außerhalb der EU, mehrheitlich in den USA. Dies sei kein guter Zustand und auch nicht im Interesse der europäischen Steuerzahler.
Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der EDA-Jahreskonferenz: Noch immer würden weniger als 20 Prozent der Investitionen gemeinsam getätigt, weit unter dem EU-Ziel von 35 Prozent. Ein Großteil der zusätzlichen Mittel landeten zudem bei Rüstungskonzernen außerhalb der EU. Dies gehe zulasten der Wettbewerbsfähigkeit der EU und der gemeinsamen Sicherheit. sti
Der für Budgetfragen zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn führte in Brüssel vor einer Gruppe internationaler Journalisten aus, die EU-Kommission halte an ihrem Vorschlag fest. Der sieht vor, für die zweite Hälfte des siebenjährigen EU-Budgets zusätzlich 66 Milliarden Euro einzufordern, um die bestehenden Herausforderungen der Gemeinschaft zu meistern. Dazu zählt Hahn die Hilfen an die Ukraine, Aufwendungen im Zusammenhang mit Migration, Investitionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie höhere Kosten bei Verwaltung und Zinslast der EU-Anleihen.
Zahlreiche Mitgliedstaaten sind allerdings nicht bereit, die von der Kommission geforderten Gelder nach Brüssel zu überweisen. Lediglich hinsichtlich der Finanzhilfen an die Ukraine – insgesamt 50 Milliarden Euro, davon 17 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt – bestehe Konsens, die Unterstützung an Kiew fortzuführen, stellte Hahn fest. Dies gelte auch für Deutschland, das ansonsten in informellen Gesprächen über eine Lösung der Review wegen der eigenen Haushaltsprobleme nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht präsent sei.
Hahn unterstrich, die konsequente Unterstützung der Ukraine durch Europa sei von enormer Bedeutung auch in Richtung der internationalen Partner. Der EU-Kommissar forderte die spanische Ratspräsidentschaft auf, einen eigenen Vorschlag seitens der Mitgliedstaaten vorzulegen, um auf dem kommenden EU-Gipfel am 14. Dezember eine Verhandlungsgrundlage zu haben. “Wir brauchen eine Richtung, in die sich die Mitgliedstaaten bewegen wollen. Diese fehlt bislang.” In informierten Kreisen hieß es, Madrid zeige derzeit jedoch keine Neigung, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten.
Ohne Vorschlag könne es aber keine Verhandlungen beim Europäischen Rat geben. Madrid hatte erst Anfang dieser Woche drei Optionen für die Review vorgeschlagen: Danach könnten Mittel aus anderen Programmen in Höhe von 8,1 Milliarden, 13,1 Milliarden oder 23,1 Milliarden Euro umgewidmet werden, um zusätzliche Gelder für die Ukraine, das Migrationsmanagement oder das Förderprogramm STEP zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aufzubringen. Dieser Ansatz war aber unter den Partnerstaaten nicht konsensfähig.
Hahn machte in Brüssel noch einmal deutlich, alle Beteiligten an der Review stünden unter hohem Zeitdruck. Hintergrund ist, dass das Europäische Parlament die Haushaltsüberprüfung bestätigen muss. Wegen der anstehenden Europawahl in 2024 ist die Volksvertretung allerdings nur noch bis April beschlussfähig. Mit Blick auf ein drohendes Veto des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán für die Ukraine-Hilfen auf dem Dezember-Gipfel sagte Hahn, Orbán habe in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Blockaden gedroht, sei aber am Ende immer auf die Gipfellinie eingeschwenkt.
Skeptisch äußerte sich Hahn zu einem Vorstoß des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, die technologische und industrielle Basis für militärische Güter in Europa durch die Auflegung von EU-Bonds zu stärken. Diese Anleihen könnten Michel zufolge eine eigene neue Assetklasse bilden, auch für Engagements von Kleinanlegern. Hahn machte deutlich, die Schaffung von EU-Verteidigungsbonds werde vermutlich nicht ohne eine Änderung des EU-Vertrags möglich sein. Mit dem Programm Next Generation EU infolge der Corona-Pandemie hat die Kommission erstmals EU-Bonds aufgelegt. Das Programm ist allerdings zeitlich strikt befristet und einmalig. cr
Die Grünen sind die erste Parteienfamilie, die Bewerber für die Spitzenkandidatur bei den Europawahlen nominiert. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist gibt es zwei Spitzenkandidaten, wobei mindestens eine von beiden weiblich sein muss. Es treten an:
Die Kandidaten stellen sich am Samstag bei einer Parteiversammlung vor. Danach beginnt der parteiinterne Wahlkampf. Bei dem Parteitag der Grünen Anfang Februar in Lyon wird das Spitzenkandidatenduo dann gewählt. mgr
Mit einem strategisch wichtigen Erfolg hat die Präsidentschaft der COP28 am ersten Tag die Konferenz eröffnet. Überraschend beschloss das Auftaktplenum am Donnerstagnachmittag die langen umstrittenen Details für den Loss and Damage Fund (LDF). Gleichzeitig erklärten mehrere Länder, angeführt von den VAE und Deutschland, ihre Bereitschaft, den LDF mit bislang etwa insgesamt 400 Millionen Dollar zu füllen.
Über den “Doppelwums” der Präsidentschaft waren schon am Vortag erste Gerüchte kursiert. Von Teilnehmern hieß es, dass besonders der Beschluss zum LDF und zu seiner Finanzierung erst am Vorabend und am Morgen der Konferenz gefallen sei. “Da wurde viel herumtelefoniert, ehe alles klar war”, hieß es. Vorbereitet wurde der Deal auch durch einen Besuch des Entwicklungs-Staatssekretärs Jochen Flasbarth in Abu Dhabi im Oktober.
Dabei, so heißt es aus der Delegation, sei klar geworden, dass Deutschland und die VAE jeweils großes Interesse an einer guten Nachricht zu Beginn haben. Die VAE wollten einen positiven Start für ihre prestigeträchtige Konferenz. Deutschland hatte großes Interesse daran, dass die VAE, die nach UN-Kriterien als Nicht-Industrieland gelten, das erste Land in der Geschichte der UN-Klimakonvention ist, dass in einen UN-Topf dafür einzahlt. Bisher galt die strikte Auffassung, das sei nur Sache der Industriestaaten.
Deshalb wurde die erste Vollversammlung der COP28 auch gleich noch zu einer kleinen Geberrunde für den LDF. Der Fonds, der bei der Weltbank angesiedelt wird, braucht mindestens 200 Millionen Dollar als Startkapital. Bis Donnerstagabend versprachen:
Eine Untersuchung der Energie-Denkfabrik Ember kommt zu dem Schluss, dass die nationalen Energie- und Klimapläne der EU-Mitgliedstaaten (NECPs) zusammenaddiert zu einem Erneuerbaren-Anteil von 66 Prozent im Jahr 2030 führen würden. Die Länder verfehlen demnach das Ziel des EU-Plans zur Abkehr von russischen Gaslieferungen, Repower-EU, von 69 Prozent bis 2030.
Die Analyse berücksichtigt die Ziele aus den 22 bislang eingereichten NECP-Entwürfen sowie weiterer angekündigter Maßnahmen aus Belgien, Bulgarien, Irland, Lettland und Polen, die noch keine aktualisierten NECP vorgelegt haben. “Da die EU auf der COP28 auf eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien drängt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Block sein eigenes Haus in Ordnung bringt, indem er ehrgeizige nationale Energie- und Klimapläne vorlegt“, fordert Ember-Analyst Chris Rosslowe.
Positiv bewerten die Ember-Experten, dass fast alle Mitgliedstaaten Erneuerbaren eine größere Rolle im Vergleich zu den Zielen von 2019 einräumen. So soll bis 2030 eine Kapazität von bis zu 672 Gigawatt an Solarenergie und 450 GW an Windenergie installiert werden. Dies sei jedoch immer noch zu wenig für die 740 GW Solar- und 500 GW Windkraft aus dem Repower-EU-Plan.
Deutschland gehört laut Ember zu den Ländern mit den ehrgeizigsten Zielen für Solarenergie. Die Bundesregierung hatte das Ausbauziel für das Jahr 2030 um 93 GW auf insgesamt 215 GW angehoben. Europaweit seien jedoch noch ehrgeizigere Ziele erforderlich, um das Stromsystem Mitte der 2030er Jahre überwiegend kohlenstofffrei zu machen, wie es die globalen Klimaschutzverpflichtungen verlangen, mahnen die Autoren. luk
Die Verhandler von Parlament und Rat haben sich kurz vor Mitternacht auf einen Kompromiss beim Cyber Resilience Act (CRA) geeinigt. Mit der Verordnung werden vernetzte Geräte wie Webcams, Waschmaschinen und Wasserkocher verschärften Pflichten bei der Cybersicherheit unterliegen.
Umstritten war unter anderem, welche Geräte als “Digitale Produkte” dabei welchen Prüf- und Updatepflichten unterliegen sollen. Grundsätzlich soll nun von einer Lebensdauer von fünf Jahren ausgegangen werden, in begründeten Einzelfällen soll sie aber auch darunter liegen können. Für diese Erwartungshorizonte werden Anbieter damit dazu verpflichtet, zeitnah notwendige Sicherheitsupdates für die Produkte anzubieten.
Aber auch die Übergangszeit der Verordnung war lange strittig. Hier haben sich die Verhandler jetzt auf eine Übergangsfrist von drei Jahren ab Inkrafttreten geeinigt. Ab dann sollen die ersten neuen Produkte den neuen Cybersicherheitsvorschriften unterfallen.
Eine aus Sicht der Mitgliedstaaten wesentliche Änderung betrifft dabei das Meldewesen für bislang unbekannte Sicherheitslücken, sogenannte Zero-Day-Exploits, die bereits aktiv ausgenutzt werden. Diese sollen jetzt doch nicht der europäischen Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA, sondern den jeweils zuständigen nationalen Behörden gemeldet werden.
EU-Digital- und Binnenmarktkommissar Thierry Breton freute sich über das Ergebnis als “Cybersicherheit ‘by design’” sowohl für Verbraucher als auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Der spanische Minister für Digitale Transformation erklärte, dass der CRA ein Mindestniveau bei der Cybersicherheit für alle vernetzten Produkte, die in Europa verkauft werden, sicherstellen könne. fst

Die europäische Karawane macht sich auf den Weg nach Dubai zur COP28. “Es ist die größte COP aller Zeiten, es werden insgesamt rund 70.000 Teilnehmer erwartet, das ist riesig”, sagt ein Veteran der UN-Klimaverhandlungen. Und unter diesen 70.000 Teilnehmern wird auch die EU stark vertreten sein: das Parlament, der Rat und die Kommission.
Nicht weniger als sechs Kommissare werden teilnehmen, zusätzlich zum neuen Klimakommissar, dem Niederländer Wopke Hoekstra. Die Kommissionspräsidentin ist bereits vor Ort und bleibt bis morgen dort. Eine Delegation von 14 Abgeordneten des Europäischen Parlaments unter der Leitung des CDU-Politikers Peter Liese wird ebenfalls dabei sein. Der Rat wird von der spanischen Umweltministerin, Teresa Ribera, vertreten. Schließlich wird die Europäische Union auch ihre Soft Power mit einem Pavillon pflegen, in dem rund 100 Veranstaltungen stattfinden werden.
Klimakommissar Hoekstra wird ab dem 6. Dezember in Dubai erwartet. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, an dem die Verhandlungen in die heiße Phase gehen. Denn das ist der Zeitpunkt, an dem die Minister eintreffen und die Diplomaten ablösen, um über die strittigsten Punkte der Umsetzung des Pariser Abkommens zu verhandeln. Auf die europäische Ebene heruntergebrochen ist dies das Äquivalent zum politischen Trilog, der auf den technischen Trilog folgt. Eine erste Verhandlungsrunde auf Ministerebene ist für den 8. Dezember geplant.
Nun, wenn es eine Sache gibt, die die Europäer gut können, dann ist es verhandeln. Alles wird in Brüssel verhandelt, zu jeder Zeit und überall. Wie wir wissen, sind die Triloge nur der sichtbare Teil eines aufwendigen Prozesses, der schon Wochen vorher in Gang gesetzt wurde. Verhandlungen mit 27 Mitgliedstaaten sind anstrengend. Diese Erfahrungen der EU-Vertreter sind in Dubai von Nutzen. Denn dort verhandeln ganze 199 Parteien. (Im Jargon der Vereinten Nationen spricht man nicht von Ländern oder Staaten, sondern von Parteien. Das Akronym COP steht für “Conference of the Parties”).
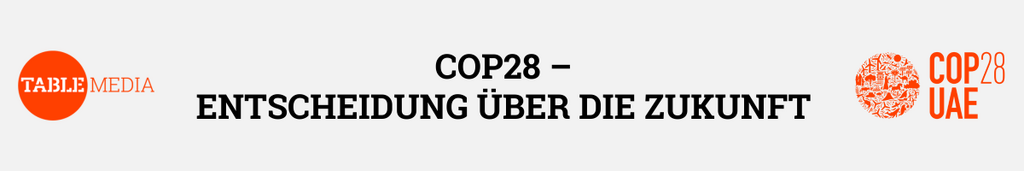
Die EU wird daher von ihren außereuropäischen Partnern gebraucht, um bei der Suche nach Kompromissen zu helfen. Es gilt Kompromisse zu finden zwischen den Ländern der südlichen und der nördlichen Hemisphäre und zwischen den Interessen der USA und Chinas. Easy-peasy. Nur fragen sich einige in der Klima-Bubble, ob der neue EU-Klimakommissar die Verhandlungen gut führen wird. Schließlich ist er erst seit knapp zwei Monaten im Amt und hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem charismatischen und umstrittenen Frans Timmermans, keine Erfahrung mit internationalen Klimaverhandlungen, so die Kritik.
Timmermans hatte ein umfassendes Netzwerk, er war so sehr in die internationalen Verhandlungen involviert, dass ganz klar gewesen sei, dass er die Verhandlungen im Namen Europas führte, sagte der niederländische Europaabgeordnete Bas Eickhout (Grüne). Dies bedeute, dass Hoekstra sich mehr auf die ministerielle Seite verlassen müsse – und das sei keine schlechte Sache, findet Eickhout.
Als ehemaliger Außen- und Finanzminister kennt er sich gut mit dem Rat aus. “Seine Erfahrung als Finanzminister in den Niederlanden kann bei den Diskussionen um die technischen Fragen zum Loss and Damage Fund von Vorteil sein”, sagt Linda Kalcher, Exekutivdirektorin der Denkfabrik Strategic Perspectives in Brüssel.
“Hoekstra ist kein Neuling“, sagt der oben zitierte COP-Veteran. Im Gegenteil, er wird ein schönes Tandem bilden mit der spanischen Umweltministerin Teresa Ribera. Diese wird nämlich die Europäische Union auf der COP28 vertreten, da sie den turnusmäßigen Vorsitz im Ministerrat innehat. Teresa Ribera ist mit internationalen Klimaverhandlungen vertraut. Sie hat den Ruf, eine extrem gut vernetzte und angesehene Verhandlerin zu sein. Die europäische diplomatische Klimamaschine läuft also. Jetzt muss sie liefern.
Alle bisher erschienen Texte zur COP28 lesen Sie hier.
Fühlen Sie sich manchmal auch erdrückt von den vielen Krisen und Katastrophen, die uns umgeben? Angefangen beim Klimawandel über die Pandemie bis zu den Kriegen in der Ukraine und Nahost? Im Regen stehen gelassen, angegriffen von Cyberterroristen, erschüttert von Hatespeech und Desinformation, belastet durch hohe Energiepreise – und dann gibt es wieder kein WLAN im Zug? All das sind große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Wirklich? Aber nein, vielleicht ist da doch ein Mann in Brüssel – nicht allzu groß, dafür charmant, galant und eloquent, unermüdlich und einfach unglaublich erfolgreich – der sich aller unserer Sorgen und Nöte annimmt. Mehr noch, diese Lichtgestalt löst alle unsere Probleme im Alleingang. Na ja fast. Aber auf jeden Fall ist er einer, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern immer mal wieder mit beeindruckend selbstbewussten Auftritten auf den sozialen Kanälen auffällt: Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Seien wir ehrlich, er ist Europas Superpower.
Bretons Team hat das in einem Videorückblick auf vier Jahre harte und – natürlich – überaus erfolgreiche Arbeit des Kommissars noch einmal klargestellt. Und das Video über die Plattform X verbreitet. Die europäische Industrie gestärkt für Wachstum und Beschäftigung in der EU, die Munitionsproduktion gesteigert für die Sicherheit der EU und der Ukraine und natürlich die Digitalgesetze durchgesetzt für eine gesunde europäische Demokratie – all das hat Breton erreicht. Und nebenbei noch 100 Milliarden Euro für dringend benötigte Chips locker gemacht. Wow! Dass der ebenfalls erwähnte AI Act noch gar nicht steht, Schwamm drüber. Macht Breton schon noch.
Das Video – unterlegt mit Amy Steinbergs Track “Power” (die damit nicht Breton, sondern die Liebe meint) – zeigt den Franzosen fröhlich parlierend mit Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño oder EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Beim “La bise” mit Senegals Präsident Macky Sall oder im ernsten Zwiegespräch mit Meta-CEO Mark Zuckerberg. Der Kommissar glänzt auf jeder Bühne und ist überall auf der Welt willkommen. Dabei bleibt er bodenständig. Statt zu Golfen spielt er Tischfußball, erfreut sich an Fast Food im Auto, klimpert auf einem Keyboard statt auf einem Bechstein.
Fazit: Vier Jahre – alles nur für uns. Und so wie es aussieht, kann es noch vier Jahre weiter so gehen. Das ist doch der Zweck der Übung. Oder, Monsieur Breton? vis
hat Mario Draghi noch etwas vor? Der ehemalige EZB-Chef, italienische Ministerpräsident einer Technokratenregierung sowie Chef der italienischen Nationalbank sondiere, ob er seinen Hut für einen der EU-Topjobs in den Ring wirft. Das hört man in Brüssel und jenseits der Alpen. Draghi ist zwar schon 76. Er traue sich aber immer noch eine der vielen Führungsaufgaben zu, die die Staats- und Regierungschefs möglicherweise nach der Europawahl im Paket entscheiden.
So wie Ursula von der Leyen 2019 könnte Super-Mario plötzlich eine Rolle im großen Personalpoker spielen. Und zwar gepusht von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie ist auch die Chefin der konservativen Parteienfamilie EKR, versteht sich bestens mit Draghi und könnte ihn als Kommissionspräsident vorschlagen.
Es sei bereits im Élysée dezent nachgefragt worden, und Emmanuel Macron habe zumindest nicht “Non” gesagt. Auch der griechische Ministerpräsident könnte der Berufung etwas abgewinnen: Kyriakos Mitsotakis strebe die Nachfolge von Charles Michel an der Spitze des Rates an. Wenn der parteilose Draghi komme, sei für den Christdemokraten Mitsotakis der Weg in den Rat nicht verbaut.
An diese Personalspekulation ist eine inhaltliche Position geknüpft. Die südlichen Mitgliedstaaten – und Frankreich gehört dazu – fordern bereits ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm im nächsten Mandat. Draghi sei derjenige, der diesen Wunsch zu seinem Programm machen könnte.
Für Deutschland wäre ein Kommissionspräsident, der noch einmal Schulden machen will in Europa, jedoch eine schlechte Nachricht: Das Bundesverfassungsgericht hatte schon den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds nur unter der Voraussetzung durchgewunken, dass es eine einmalige Ausnahme bleibe.
Und was wäre mit Ursula von der Leyen? Zum einen hat sie bis heute nicht erklärt, dass sie wieder antritt. Zum anderen ist nicht ausgeschlossen, dass sie im Sommer, wenn das Ergebnis der Europawahl vorliegt, von US-Präsident Joe Biden zur Nato gerufen wird. Ob sie den Ruf, die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsbündnisses zu werden, ablehnen würde?

Die Bundesregierung hat Vorbehalte gegen Anti-Dumping-Zölle der EU auf E-Autos aus China. “Ausgleichszölle der EU könnten die EU-Industrie schützen, aber auch negativ treffen”, heißt es in der als vertraulich eingestuften Stellungnahme der Bundesregierung zum Arbeitsprogramm 2024 der EU-Kommission, die Table.Media vorliegt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte eine Antisubventionsuntersuchung für batterieelektrische Autos aus China angekündigt. Gleichzeitig hatte sie nahegelegt, dass es Hinweise für eine unzulässige Subventionierung gebe. Damit gilt es als eine Frage der Zeit, dass die Kommission Anti-Dumping-Zölle auf E-Autos aus China erhebt.
Die Bundesregierung befürchtet negative Folgen durch die Zölle für die deutschen Hersteller. Ohne die deutschen Konzerne direkt zu erwähnen, warnt die Stellungnahme vor negativen Folgen “zum einen direkt (bei EU-Herstellern in China, die in die EU exportieren) sowie indirekt (bei etwaigen Vergeltungsmaßnahme(n) Chinas).”
Hintergrund ist, dass die deutschen Marken wie Mercedes, BMW und VW bis zu 40 Prozent ihres Absatzes in China machen sowie große Produktionskapazitäten in China selbst aufgebaut haben. Die französischen Hersteller dagegen sind nicht auf dem chinesischen Markt aktiv, fordern aber seit Langem EU-Zölle auf E-Autos aus China, weil chinesische Marken in der EU massiv mit E-Autos der französischen Hersteller konkurrieren und ihnen Marktanteile streitig machen.
Die Bundesregierung mahnt eine “regelkonforme und ergebnisoffene Untersuchung” im Zuge des Antisubventionierungsverfahrens an sowie, “dass die jeweiligen Interessen im Rahmen des Unionsinteresses berücksichtigt werden.” Die Mitgliedstaaten seien “angesichts der politischen Sensibilität in das Verfahren eng einzubinden”. Das Schreiben enthält auch eine deutliche Kritik an der Kommission: Die Antisubventionsuntersuchung habe nämlich die “Besonderheit, dass sie ex officio und damit nicht auf Basis eines Antrags eines EU-Herstellers eingeleitet wurde”. Die Botschaft der Bundesregierung lautet also, dass die Kommission sich von der französischen Regierung habe drängen lassen.
Beim Green Deal zeigt sich die Bundesregierung enttäuscht. “Die Bundesregierung bedauert jedoch sehr, dass die Kommission wichtige Vorhaben der Farm-to-Fork-Strategie aktuell nicht weiterverfolgt”, heißt es weiter in dem Papier. Anders als in den vergangenen Arbeitsprogrammen sei die “umfassende Überarbeitung des europäischen Tierschutzrechts und die Schaffung eines Rechtsrahmens für nachhaltige Ernährungssysteme (FSFS)” nicht mehr vorgesehen. Entsprechende Initiativen seien aber dringend erforderlich, um die gesellschaftlichen Erwartungen für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme hin zu mehr Tierschutz und Nachhaltigkeit voranzubringen.
Die Bundesregierung bemängelt auch, dass die Kommission erneut die Lebensmittelkennzeichnungsvorhaben aus der Farm-to-Fork-Strategie nicht im Arbeitsprogramm aufführt. Für die Bundesregierung hätten die von der Kommission bereits für Ende 2022 angekündigten Legislativvorschläge zur erweiterten Nährwertkennzeichnung, zur Herkunftskennzeichnung, zu Datumsmarkierungen, Nährwertprofile und zur Kennzeichnung alkoholischer Getränke “sehr hohe Priorität”. Obwohl auch eine Überarbeitung des EU-Rechts zu Lebensmittelkontaktmaterialien längst im Zuge der Farm-to-Fork-Strategie angekündigt war, habe die Kommission immer noch nicht geliefert, rügt das Papier aus dem Kanzleramt.
Auch in der Industriepolitik macht die Bundesregierung Vorbehalte geltend. Sie will im Gegensatz zur Kommission weiter auf die Subventionierung für die Dekarbonisierung der Industrie setzen. Die entsprechenden Kapitel im befristeten Beihilferahmen TCTF will sie bis Ende 2027 verlängern. Derzeit sind die Abschnitte 2.5, 2.6. und 2.8 bis 2025 befristet. Die Kommission hatte sich erst vor wenigen Wochen dagegen entschieden, sie auszudehnen. Nur die Möglichkeit für Beihilfen zu gestiegenen Energiekosten wurde um ein halbes Jahr bis Mitte 2024 verlängert.
Unklar ist, ob die Antwort der Bundesregierung zu diesem Thema vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen Klima- und Transformationsfonds (KTF) formuliert wurde oder ob die Bundesregierung auf eine Entspannung der Haushaltslage nach 2025 spekuliert. Mitarbeit Manuel Berkel
Es soll ein “strategischer” Gipfel werden, mit wegweisenden Beschlüssen zur Ukraine und zur Finanzierung der EU. Doch zwei Wochen vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel kämpft Ratspräsident Charles Michel mit unerwarteten Problemen. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán droht mit einem Veto gegen neue Finanzhilfen für die Ukraine. Außerdem will er sich bei dem Gipfel Mitte Dezember gegen eine Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine aussprechen. “Wir haben es mit einem völlig verfrühten Vorschlag zu tun”, sagte der Stabschef von Orbán, Gergely Gulyas, am Donnerstag.
Ein Besuch in Budapest hat keine Annäherung gebracht. Mehr als zwei Stunden unterhielten sich Orbán und Michel, um die Blockade zu lösen. Orbán sprach hinterher von einem “nützlichen Treffen” – was in Diplomatensprache nichts anderes bedeutet, als dass man seine Meinungen ausgetauscht hat, ohne sich anzunähern. Michel hielt sich bedeckt, von ihm gab es nicht mal einen Tweet.
Man bleibe in Kontakt, sagte eine EU-Sprecherin nach dem Krisentreffen. Michel braucht Orbáns Zustimmung, um die von der EU-Kommission empfohlenen Beitrittsverhandlungen eröffnen zu können. Orbán droht jedoch mit einem Nein und fordert, zunächst eine strategische Debatte über den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland und die Fortschritte bei der EU-Integration zu führen.
Eine solche, grundsätzliche Aussprache hat es zwar schon öfter gegeben – vom Sondergipfel in Versailles im März 2022 bis zum Spitzentreffen in Granada im Oktober 2023. Orbán verweist jedoch auf die neue Lage, die durch das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive entstanden sei. Auch die Sanktionen hätten ihr Ziel verfehlt – während Deutschlands Wirtschaft kriselt, wächst Russland wieder.
Orbán spreche wichtige Fragen an, heißt es im Rat. Seine demonstrative Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin – beide hatten sich beim Seidenstraßen-Gipfel im Oktober in Peking getroffen – lasse jedoch an seiner Unvoreingenommenheit zweifeln. Sein wahres Motiv sei es wohl, die Freigabe von 13 Milliarden Euro aus dem EU-Budget zu erzwingen, vermuten EU-Diplomaten.
Die EU-Kommission hatte die Gelder wegen Rechtsstaatsproblemen in Ungarn eingefroren. In der vergangenen Woche gab sie dann überraschend 900 Millionen Euro frei. Weiteres Geld könnte bald folgen, hieß es am Donnerstag in Brüssel. In den Verhandlungen mit der EU-Kommission habe es “signifikante Fortschritte” gegeben, sagte eine EU-Quelle, die namentlich nicht genannt werden wollte. Denkbar wäre eine Auszahlung von bis zu 10 Milliarden Euro.
Allerdings ist unklar, ob weitere EU-Mittel noch rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember fließen – und ob sich Orbán damit zufriedengibt. Bisher nutzt er den Streit ums Geld als Hebel, um Gipfelchef Michel unter Druck zu setzen. Dabei kommt ihm zugute, dass sich die Stimmung in einigen EU-Ländern gegen die Ukraine dreht – und dass die Gipfelagenda noch andere Probleme birgt.
Robert Fico aus der Slowakei und Geert Wilders aus den Niederlanden teilen Orbáns Vorbehalte gegen Michels Ukraine-Kurs. Einige andere Regierungschefs stehen auf der Bremse, weil sie fürchten, übervorteilt zu werden. Mit grünem Licht für Beitrittsgespräche wären nämlich auch neue, milliardenschwere EU-Finanzspritzen für Kiew verbunden. Für andere Aufgaben hingegen ist kein Geld da.
Zum Stolperstein könnte ausgerechnet Deutschland werden. Das größte EU-Land befürwortet zwar sowohl den Start von Beitrittsgesprächen als auch neue Finanzhilfen für die Ukraine. Es unterstützt also Michels Gipfelagenda. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ukraine-Hilfe in seiner jüngsten Regierungserklärung sogar als “existenziell” bezeichnet und dauerhafte Finanzzusagen angedeutet.
Berlin will aber nur für die Ukraine zahlen – und nicht für die gemeinsame Asylpolitik oder den Schuldendienst des Corona-Aufbaufonds, wie dies Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat. Eine Aufstockung des laufenden Sieben-Jahre-Budgets um 66 Milliarden Euro lehnt Berlin ab und fordert, Haushaltsreserven zu nutzen: Die deutsche Budgetkrise lasse keine Extrawürste zu.
Dies wiederum ruft Länder wie Italien auf den Plan, die zwar ebenso wenig wie Deutschland mit Orbáns Veto-Drohung anfangen können, allerdings auch nicht den Kürzeren ziehen wollen. Mehrere Kompromissvorschläge des spanischen EU-Vorsitzes konnten den Streit bisher nicht lösen. Beim EU-Gipfel im Dezember könnten die Interessen hart aufeinander prallen.
In Brüssel kursieren bereits wilde Gerüchte und Schuldzuweisungen. Von der Leyen habe einen strategischen Fehler begangen, indem sie die Ukraine-Hilfe mit einer Aufstockung des EU-Budgets verknüpft habe, schreibt der Europa-Chef der Consultingfirma Eurasia Group, Mujtaba Rahman auf X (ehemals Twitter). Dieser Fehler könne sie sogar eine zweite Amtszeit an der EU-Spitze kosten.
Andere zweifeln am Verhandlungsgeschick von Gipfelchef Michel. Aber auch Kanzler Scholz muss sich Kritik anhören. Die EU-Politik drohe zum Kollateralschaden der hausgemachten deutschen Haushaltsprobleme zu werden. Dass Scholz es nicht einmal schaffte, das heimische Publikum in Berlin zu überzeugen und einen Weg nach vorn zu weisen, trägt weiter zur Verunsicherung in Brüssel bei.
Wie geht es nun weiter? Michel wird, wenn nicht alles täuscht, umdisponieren müssen. Zwar gebe es keinen Anlass für “Schwarzmalerei”, sagt ein EU-Diplomat. Es sei jedoch durchaus denkbar, dass im Dezember noch kein Beschluss zur Eröffnung von Beitrittsgesprächen fällt. Wegen des Widerstands aus Ungarn, aber auch wegen noch ausstehender Reformen in der Ukraine könnte man sich mit einem unverbindlichen positiven Signal zufriedengeben.
Die EU-Kommission will erst im März über noch ausstehende Reformen berichten. Dazu zählt die Stärkung der Minderheitenrechte, die auch die Venedig-Kommission des Europarats fordert – und die Ungarn lautstark angemahnt hat. Zudem fehlt für den Start von Beitrittsverhandlungen noch der sogenannte Verhandlungsrahmen, der die Leitlinien und Grundsätze für die Gespräche mit Kiew festlegt. Beides könnte die Staats- und Regierungschefs dazu bewegen, einen formellen Beschluss zu vertagen.
Auch die umstrittene Aufstockung des EU-Budgets könnte auf die lange Bank geschoben werden. Denn Deutschland ist mit seinen Bedenken nicht allein. Auch mehrere nord- und osteuropäische Länder halten die Brieftasche zu. Derweil fordern Länder wie Italien oder Griechenland mehr Geld für die gemeinsame Flüchtlingspolitik. Die EU-Staaten könnten einander blockieren.
Orbán hat in ein Wespennest gestochen – und seit Langem schwelende Widersprüche und Konflikte in der EU-Politik offen gelegt. Michel bleibt nicht mehr viel Zeit, den Schaden zu begrenzen und seine Gipfelagenda zu retten.
04.12.-05.12.2023
Rat der EU: Justiz und Inneres
Themen: Sachstand zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine (Bekämpfung der
Straflosigkeit), Billigung der europäischen Strategie für die E-Justiz 2024-2028, Fortschrittsbericht zum Migrations- und Asylpaket. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie (Verkehr)
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Verordnung über die Erfassung der Treibhausgasemissionen
von Verkehrsdiensten, aktuelle Gesetzgebungsvorschläge – unter anderem der AI Act, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-19:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT)
Themen: Gedankenaustausch mit Kommissarin Ivanova, Entwurf einer Stellungnahme zur Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2022, Meinungsaustausch über kohäsionspolitische Mittel zur Förderung von Kultur und Bildung. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)
Themen: Entscheidung des Rates mit der Aufforderung an die Mitgliedstaaten, die Konvention gegen Gewalt und Belästigung zu ratifizieren, Treffen des interparlamentarischen Ausschusses zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am Wahlprozess. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)
Themen: Berichtsentwurf zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, Entwurf einer Stellungnahme zu standardessentiellen Patenten, Europäische grenzüberschreitende Verbände. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-18:15 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)
Themen: Berichtsentwurf zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, Präsentation des Projekts “Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Prüfung von EU-Fonds”. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:00-17:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
Themen: Gedankenaustausch mit Andrea Ammon (Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten), STOA-Studie “Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und Förderung der pharmazeutischen Innovation”, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen (Bekämpfung des Arzneimittelmangels in der EU). Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:30-18:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)
Themen: Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zum Business in Europe (Rahmen für die Einkommensbesteuerung), Berichtsentwurf zur rascheren und sichereren Entlastung von zu viel erhobenen Quellensteuern. Vorläufige Tagesordnung
04.12.2023 – 15:30-17:00 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)
Themen: Meinungsaustausch mit Gert Jan Koopman (Generaldirektor für Nachbarschafts- und Erweiterungsverhandlungen) über die Ergebnisse der Überprüfung der EU-Finanzhilfe für die Palästinenser. Vorläufige Tagesordnung
05.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Verkehr, Telekommunikation und Energie (Telekommunikation)
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des
Ausbaus von Gigabit-Netzen für die elektronische Kommunikation, Fortschrittsbericht zur Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union für die Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen (Cybersolidaritätsgesetz), Informationen der Kommission zu europäischen Datenportalen als Schlüsselelement der EU-Ministererklärung für die digitale Dekade (Fortschrittsbericht und Zeitplan für künftige Etappen). Vorläufige Tagesordnung
06.12.2023
Wöchentliche Kommissionssitzung
Themen: Bürgerpaket (Konsularischer Schutz – Überprüfung der EU-Vorschriften, Staatsbürgerschaftsbericht 2023), Kein Platz für Hass (ein geeintes Europa gegen Hass), Tierschutzpaket (Schutz von Tieren beim Transport – Überarbeitung der EU-Gesetzgebung, Verordnung über den Schutz von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit, Reaktion auf die europäische Bürgerinitiative “Pelzfreies Europa”). Vorläufige Tagesordnung
06.12.2023
Trilog: AI Act
Themen: Nach dem ursprünglichen Plan sollte dies der abschließende Trilog zur weltweit ersten umfassenden Regulierung von Künstlicher Intelligenz sein. Doch ob das gelingt ist fraglich, da die Positionen von Rat und Parlament vor allem in Bezug auf Foundation Models, biometrischer Identifizierung in Echtzeit und der Strafverfolgung weit auseinander liegen.
07.12-08.12.2023
EU-China-Gipfel
Themen: Die Staatsspitze Chinas und die Spitzen der EU kommen zu Beratungen zusammen. Infos
07.12-08.12.2023
Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit
Themen: Fortschrittsbericht zur Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten
Produkten auf dem Unionsmarkt, Informationen der Kommission zur Mitteilung der Kommission über die Stärkung des europäischen Verwaltungsraums, Informationen der belgischen Delegation zum Arbeitsprogramm des kommenden Vorsitzes. Vorläufige Tagesordnung
07.12.2023
Trilog: Gebäuderichtlinie
Themen: Im wohl abschließenden Trilog müssen die Verhandler noch klären, wie viel Energie der Gebäudesektor bis 2030 und 2035 insgesamt einsparen muss. Strittig sind auch noch die Vorgaben für Nichtwohngebäude und Ladeinfrastruktur.
07.12.2023
Euro-Gruppe
Themen: Bewertung der Haushaltsplanentwürfe der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes sowie der Haushaltslage und -aussichten des Euro-Währungsgebiets, Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet für 2024: Vorstellung durch die Kommission, Funktionsweise des WKM II. Vorläufige Tagesordnung
07.12.2023 – 09:00-12:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)
Themen: Stellungnahme zur Umsetzung und zu den Ergebnissen der Kohäsionspolitik 2014-2020 in den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch mit der Kommission über gemeinsame Anstrengungen und gemeinsame Ziele der GAP-Strategiepläne 2023-2027. Vorläufige Tagesordnung
08.12.2023
Trilog: Gasmarktverordnung
Themen: Nachdem Rat und Parlament vor einer Woche keine Einigung gelungen ist, müssen die Verhandler sich nun über die Verordnung einig werden, damit das Gaspaket aus Verordnung und Richtlinie vor den Wahlen beschlossen werden kann. Noch offen ist die Schaffung eines Europäischen Netzwerks der Wasserstoffnetzbetreiber (ENNOH), aber auch der Umgang mit russischen Gasimporten.
08.12.2023 – 10:00 Uhr
Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen
Themen: Allgemeine Ausrichtung der Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung, Fortschrittsbericht zum Paket zur einheitlichen Währung, Gedankenaustausch zu den wirtschaftlichen und finanzielle Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Vorläufige Tagesordnung
10.12.-11.12.2023
Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei
Themen: Gedankenaustausch zur Marktlage, insbesondere nach der Invasion in die Ukraine, Gedankenaustausch zur Bilanz des ersten Jahres der Umsetzung der GAP-Strategiepläne, Fortschrittsbericht zur Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Vorläufige Tagesordnung
Es könnte nach der Europawahl der nächste große Integrationsschub sein: EU-Ratspräsident Charles Michel hat seinen Auftritt bei der jährlichen Konferenz der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) genutzt, um weitere Schritte hin zu einer Sicherheits- und Verteidigungsunion zu fordern. Mehr sei nötig, das “Europäische Erwachen” nach Russlands Überfall auf die Ukraine nehme erst langsam Konturen an.
Charles Michel dürfte auch ein mögliches Comeback von Donald Trump vor Augen haben: Europa müsse ein klares Signal setzen, die eigene Sicherheit ernster zu nehmen als bisher. Der EU-Ratspräsident plädierte für ein stärkeres europäisches Militär, für mehr gemeinsame Rüstungsbeschaffung und eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die Verteidigungsagentur soll zu einem “mächtigen Europäischen Verteidigungsdepartement” werden. In Brüssel ist die Rede davon, dass die nächste EU-Kommission einen Kommissar speziell für den Bereich Sicherheit und Verteidigung haben könnte.
Neutrale Mitgliedstaaten wie Österreich oder Irland dürften dies allerdings kritisch sehen. Laut Charles Michel könnte dieses Europäische Verteidigungsdepartement gemeinsame Beschaffungen oder auch die Pesco-Projekte der militärischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten koordinieren. “Wir sollten auch die Idee von Europäischen Verteidigungsbonds in Betracht ziehen“, sagte der Ratspräsident. Dies, um Europas technologische und industrielle Basis zu stärken. Auch hier ist Widerstand in den Mitgliedstaaten programmiert.
Wie sehr gemeinsame Anstrengungen nötig sein könnten, wurde am Donnerstag bei einer Präsentation des Branchenverbands der Europäischen Luftfahrt, Sicherheit und Verteidigungsindustrien (ASD) deutlich. Russlands Überfall auf die Ukraine sei ein Weckruf für Europas Verteidigungsindustrie und für die EU-Staaten gewesen, sagte Micael Johansson, CEO von Saab und Vice-Chairman des Branchenverbandes. Die Industrie habe inzwischen massiv investiert, aber es brauche eine bessere Risikoverteilung. Die Industrie habe nicht die langfristigen Verträge, die es für die Planungssicherheit brauche.
Die Regierungen signalisierten zwar, dass es “von allem mehr” brauche, sagte Micael Johansson. Doch das Ziel bleibe unklar. Mit Blick auf die schleppende Munitionsproduktion für die Ukraine heißt es beim Branchenverband, ein ganzes System von Zulieferern müsse erst wieder aufgebaut werden. Bei Rohstoffen sei Europa zudem vielfach abhängig von Ländern in Asien. Die Ukraine brauche 2,4 Millionen Artilleriegeschosse im Jahr, doch in Europa seien die Kapazitäten derzeit bei 200.000 bis 300.000.
Die EU-Kommission will die Kapazitäten bis nächstes Jahr auf eine Million hochfahren und bis Ende März 2024 der Ukraine ebenfalls eine Million Munition vom Kaliber 155 Millimeter liefern, dürfte aber beide Ziele deutlich verpassen. Generell brauche es mehr souveräne Kapazitäten in Europa, meinte Micael Johansson. Die europäischen Staaten kauften derzeit 78 Prozent ihrer Rüstungsgüter außerhalb der EU, mehrheitlich in den USA. Dies sei kein guter Zustand und auch nicht im Interesse der europäischen Steuerzahler.
Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der EDA-Jahreskonferenz: Noch immer würden weniger als 20 Prozent der Investitionen gemeinsam getätigt, weit unter dem EU-Ziel von 35 Prozent. Ein Großteil der zusätzlichen Mittel landeten zudem bei Rüstungskonzernen außerhalb der EU. Dies gehe zulasten der Wettbewerbsfähigkeit der EU und der gemeinsamen Sicherheit. sti
Der für Budgetfragen zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn führte in Brüssel vor einer Gruppe internationaler Journalisten aus, die EU-Kommission halte an ihrem Vorschlag fest. Der sieht vor, für die zweite Hälfte des siebenjährigen EU-Budgets zusätzlich 66 Milliarden Euro einzufordern, um die bestehenden Herausforderungen der Gemeinschaft zu meistern. Dazu zählt Hahn die Hilfen an die Ukraine, Aufwendungen im Zusammenhang mit Migration, Investitionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie höhere Kosten bei Verwaltung und Zinslast der EU-Anleihen.
Zahlreiche Mitgliedstaaten sind allerdings nicht bereit, die von der Kommission geforderten Gelder nach Brüssel zu überweisen. Lediglich hinsichtlich der Finanzhilfen an die Ukraine – insgesamt 50 Milliarden Euro, davon 17 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt – bestehe Konsens, die Unterstützung an Kiew fortzuführen, stellte Hahn fest. Dies gelte auch für Deutschland, das ansonsten in informellen Gesprächen über eine Lösung der Review wegen der eigenen Haushaltsprobleme nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht präsent sei.
Hahn unterstrich, die konsequente Unterstützung der Ukraine durch Europa sei von enormer Bedeutung auch in Richtung der internationalen Partner. Der EU-Kommissar forderte die spanische Ratspräsidentschaft auf, einen eigenen Vorschlag seitens der Mitgliedstaaten vorzulegen, um auf dem kommenden EU-Gipfel am 14. Dezember eine Verhandlungsgrundlage zu haben. “Wir brauchen eine Richtung, in die sich die Mitgliedstaaten bewegen wollen. Diese fehlt bislang.” In informierten Kreisen hieß es, Madrid zeige derzeit jedoch keine Neigung, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten.
Ohne Vorschlag könne es aber keine Verhandlungen beim Europäischen Rat geben. Madrid hatte erst Anfang dieser Woche drei Optionen für die Review vorgeschlagen: Danach könnten Mittel aus anderen Programmen in Höhe von 8,1 Milliarden, 13,1 Milliarden oder 23,1 Milliarden Euro umgewidmet werden, um zusätzliche Gelder für die Ukraine, das Migrationsmanagement oder das Förderprogramm STEP zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aufzubringen. Dieser Ansatz war aber unter den Partnerstaaten nicht konsensfähig.
Hahn machte in Brüssel noch einmal deutlich, alle Beteiligten an der Review stünden unter hohem Zeitdruck. Hintergrund ist, dass das Europäische Parlament die Haushaltsüberprüfung bestätigen muss. Wegen der anstehenden Europawahl in 2024 ist die Volksvertretung allerdings nur noch bis April beschlussfähig. Mit Blick auf ein drohendes Veto des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán für die Ukraine-Hilfen auf dem Dezember-Gipfel sagte Hahn, Orbán habe in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Blockaden gedroht, sei aber am Ende immer auf die Gipfellinie eingeschwenkt.
Skeptisch äußerte sich Hahn zu einem Vorstoß des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, die technologische und industrielle Basis für militärische Güter in Europa durch die Auflegung von EU-Bonds zu stärken. Diese Anleihen könnten Michel zufolge eine eigene neue Assetklasse bilden, auch für Engagements von Kleinanlegern. Hahn machte deutlich, die Schaffung von EU-Verteidigungsbonds werde vermutlich nicht ohne eine Änderung des EU-Vertrags möglich sein. Mit dem Programm Next Generation EU infolge der Corona-Pandemie hat die Kommission erstmals EU-Bonds aufgelegt. Das Programm ist allerdings zeitlich strikt befristet und einmalig. cr
Die Grünen sind die erste Parteienfamilie, die Bewerber für die Spitzenkandidatur bei den Europawahlen nominiert. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist gibt es zwei Spitzenkandidaten, wobei mindestens eine von beiden weiblich sein muss. Es treten an:
Die Kandidaten stellen sich am Samstag bei einer Parteiversammlung vor. Danach beginnt der parteiinterne Wahlkampf. Bei dem Parteitag der Grünen Anfang Februar in Lyon wird das Spitzenkandidatenduo dann gewählt. mgr
Mit einem strategisch wichtigen Erfolg hat die Präsidentschaft der COP28 am ersten Tag die Konferenz eröffnet. Überraschend beschloss das Auftaktplenum am Donnerstagnachmittag die langen umstrittenen Details für den Loss and Damage Fund (LDF). Gleichzeitig erklärten mehrere Länder, angeführt von den VAE und Deutschland, ihre Bereitschaft, den LDF mit bislang etwa insgesamt 400 Millionen Dollar zu füllen.
Über den “Doppelwums” der Präsidentschaft waren schon am Vortag erste Gerüchte kursiert. Von Teilnehmern hieß es, dass besonders der Beschluss zum LDF und zu seiner Finanzierung erst am Vorabend und am Morgen der Konferenz gefallen sei. “Da wurde viel herumtelefoniert, ehe alles klar war”, hieß es. Vorbereitet wurde der Deal auch durch einen Besuch des Entwicklungs-Staatssekretärs Jochen Flasbarth in Abu Dhabi im Oktober.
Dabei, so heißt es aus der Delegation, sei klar geworden, dass Deutschland und die VAE jeweils großes Interesse an einer guten Nachricht zu Beginn haben. Die VAE wollten einen positiven Start für ihre prestigeträchtige Konferenz. Deutschland hatte großes Interesse daran, dass die VAE, die nach UN-Kriterien als Nicht-Industrieland gelten, das erste Land in der Geschichte der UN-Klimakonvention ist, dass in einen UN-Topf dafür einzahlt. Bisher galt die strikte Auffassung, das sei nur Sache der Industriestaaten.
Deshalb wurde die erste Vollversammlung der COP28 auch gleich noch zu einer kleinen Geberrunde für den LDF. Der Fonds, der bei der Weltbank angesiedelt wird, braucht mindestens 200 Millionen Dollar als Startkapital. Bis Donnerstagabend versprachen:
Eine Untersuchung der Energie-Denkfabrik Ember kommt zu dem Schluss, dass die nationalen Energie- und Klimapläne der EU-Mitgliedstaaten (NECPs) zusammenaddiert zu einem Erneuerbaren-Anteil von 66 Prozent im Jahr 2030 führen würden. Die Länder verfehlen demnach das Ziel des EU-Plans zur Abkehr von russischen Gaslieferungen, Repower-EU, von 69 Prozent bis 2030.
Die Analyse berücksichtigt die Ziele aus den 22 bislang eingereichten NECP-Entwürfen sowie weiterer angekündigter Maßnahmen aus Belgien, Bulgarien, Irland, Lettland und Polen, die noch keine aktualisierten NECP vorgelegt haben. “Da die EU auf der COP28 auf eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien drängt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Block sein eigenes Haus in Ordnung bringt, indem er ehrgeizige nationale Energie- und Klimapläne vorlegt“, fordert Ember-Analyst Chris Rosslowe.
Positiv bewerten die Ember-Experten, dass fast alle Mitgliedstaaten Erneuerbaren eine größere Rolle im Vergleich zu den Zielen von 2019 einräumen. So soll bis 2030 eine Kapazität von bis zu 672 Gigawatt an Solarenergie und 450 GW an Windenergie installiert werden. Dies sei jedoch immer noch zu wenig für die 740 GW Solar- und 500 GW Windkraft aus dem Repower-EU-Plan.
Deutschland gehört laut Ember zu den Ländern mit den ehrgeizigsten Zielen für Solarenergie. Die Bundesregierung hatte das Ausbauziel für das Jahr 2030 um 93 GW auf insgesamt 215 GW angehoben. Europaweit seien jedoch noch ehrgeizigere Ziele erforderlich, um das Stromsystem Mitte der 2030er Jahre überwiegend kohlenstofffrei zu machen, wie es die globalen Klimaschutzverpflichtungen verlangen, mahnen die Autoren. luk
Die Verhandler von Parlament und Rat haben sich kurz vor Mitternacht auf einen Kompromiss beim Cyber Resilience Act (CRA) geeinigt. Mit der Verordnung werden vernetzte Geräte wie Webcams, Waschmaschinen und Wasserkocher verschärften Pflichten bei der Cybersicherheit unterliegen.
Umstritten war unter anderem, welche Geräte als “Digitale Produkte” dabei welchen Prüf- und Updatepflichten unterliegen sollen. Grundsätzlich soll nun von einer Lebensdauer von fünf Jahren ausgegangen werden, in begründeten Einzelfällen soll sie aber auch darunter liegen können. Für diese Erwartungshorizonte werden Anbieter damit dazu verpflichtet, zeitnah notwendige Sicherheitsupdates für die Produkte anzubieten.
Aber auch die Übergangszeit der Verordnung war lange strittig. Hier haben sich die Verhandler jetzt auf eine Übergangsfrist von drei Jahren ab Inkrafttreten geeinigt. Ab dann sollen die ersten neuen Produkte den neuen Cybersicherheitsvorschriften unterfallen.
Eine aus Sicht der Mitgliedstaaten wesentliche Änderung betrifft dabei das Meldewesen für bislang unbekannte Sicherheitslücken, sogenannte Zero-Day-Exploits, die bereits aktiv ausgenutzt werden. Diese sollen jetzt doch nicht der europäischen Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA, sondern den jeweils zuständigen nationalen Behörden gemeldet werden.
EU-Digital- und Binnenmarktkommissar Thierry Breton freute sich über das Ergebnis als “Cybersicherheit ‘by design’” sowohl für Verbraucher als auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Der spanische Minister für Digitale Transformation erklärte, dass der CRA ein Mindestniveau bei der Cybersicherheit für alle vernetzten Produkte, die in Europa verkauft werden, sicherstellen könne. fst

Die europäische Karawane macht sich auf den Weg nach Dubai zur COP28. “Es ist die größte COP aller Zeiten, es werden insgesamt rund 70.000 Teilnehmer erwartet, das ist riesig”, sagt ein Veteran der UN-Klimaverhandlungen. Und unter diesen 70.000 Teilnehmern wird auch die EU stark vertreten sein: das Parlament, der Rat und die Kommission.
Nicht weniger als sechs Kommissare werden teilnehmen, zusätzlich zum neuen Klimakommissar, dem Niederländer Wopke Hoekstra. Die Kommissionspräsidentin ist bereits vor Ort und bleibt bis morgen dort. Eine Delegation von 14 Abgeordneten des Europäischen Parlaments unter der Leitung des CDU-Politikers Peter Liese wird ebenfalls dabei sein. Der Rat wird von der spanischen Umweltministerin, Teresa Ribera, vertreten. Schließlich wird die Europäische Union auch ihre Soft Power mit einem Pavillon pflegen, in dem rund 100 Veranstaltungen stattfinden werden.
Klimakommissar Hoekstra wird ab dem 6. Dezember in Dubai erwartet. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, an dem die Verhandlungen in die heiße Phase gehen. Denn das ist der Zeitpunkt, an dem die Minister eintreffen und die Diplomaten ablösen, um über die strittigsten Punkte der Umsetzung des Pariser Abkommens zu verhandeln. Auf die europäische Ebene heruntergebrochen ist dies das Äquivalent zum politischen Trilog, der auf den technischen Trilog folgt. Eine erste Verhandlungsrunde auf Ministerebene ist für den 8. Dezember geplant.
Nun, wenn es eine Sache gibt, die die Europäer gut können, dann ist es verhandeln. Alles wird in Brüssel verhandelt, zu jeder Zeit und überall. Wie wir wissen, sind die Triloge nur der sichtbare Teil eines aufwendigen Prozesses, der schon Wochen vorher in Gang gesetzt wurde. Verhandlungen mit 27 Mitgliedstaaten sind anstrengend. Diese Erfahrungen der EU-Vertreter sind in Dubai von Nutzen. Denn dort verhandeln ganze 199 Parteien. (Im Jargon der Vereinten Nationen spricht man nicht von Ländern oder Staaten, sondern von Parteien. Das Akronym COP steht für “Conference of the Parties”).
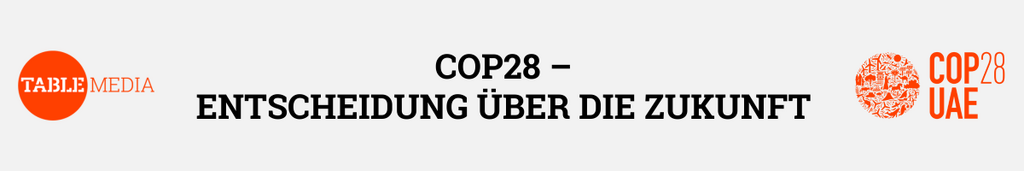
Die EU wird daher von ihren außereuropäischen Partnern gebraucht, um bei der Suche nach Kompromissen zu helfen. Es gilt Kompromisse zu finden zwischen den Ländern der südlichen und der nördlichen Hemisphäre und zwischen den Interessen der USA und Chinas. Easy-peasy. Nur fragen sich einige in der Klima-Bubble, ob der neue EU-Klimakommissar die Verhandlungen gut führen wird. Schließlich ist er erst seit knapp zwei Monaten im Amt und hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem charismatischen und umstrittenen Frans Timmermans, keine Erfahrung mit internationalen Klimaverhandlungen, so die Kritik.
Timmermans hatte ein umfassendes Netzwerk, er war so sehr in die internationalen Verhandlungen involviert, dass ganz klar gewesen sei, dass er die Verhandlungen im Namen Europas führte, sagte der niederländische Europaabgeordnete Bas Eickhout (Grüne). Dies bedeute, dass Hoekstra sich mehr auf die ministerielle Seite verlassen müsse – und das sei keine schlechte Sache, findet Eickhout.
Als ehemaliger Außen- und Finanzminister kennt er sich gut mit dem Rat aus. “Seine Erfahrung als Finanzminister in den Niederlanden kann bei den Diskussionen um die technischen Fragen zum Loss and Damage Fund von Vorteil sein”, sagt Linda Kalcher, Exekutivdirektorin der Denkfabrik Strategic Perspectives in Brüssel.
“Hoekstra ist kein Neuling“, sagt der oben zitierte COP-Veteran. Im Gegenteil, er wird ein schönes Tandem bilden mit der spanischen Umweltministerin Teresa Ribera. Diese wird nämlich die Europäische Union auf der COP28 vertreten, da sie den turnusmäßigen Vorsitz im Ministerrat innehat. Teresa Ribera ist mit internationalen Klimaverhandlungen vertraut. Sie hat den Ruf, eine extrem gut vernetzte und angesehene Verhandlerin zu sein. Die europäische diplomatische Klimamaschine läuft also. Jetzt muss sie liefern.
Alle bisher erschienen Texte zur COP28 lesen Sie hier.
Fühlen Sie sich manchmal auch erdrückt von den vielen Krisen und Katastrophen, die uns umgeben? Angefangen beim Klimawandel über die Pandemie bis zu den Kriegen in der Ukraine und Nahost? Im Regen stehen gelassen, angegriffen von Cyberterroristen, erschüttert von Hatespeech und Desinformation, belastet durch hohe Energiepreise – und dann gibt es wieder kein WLAN im Zug? All das sind große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Wirklich? Aber nein, vielleicht ist da doch ein Mann in Brüssel – nicht allzu groß, dafür charmant, galant und eloquent, unermüdlich und einfach unglaublich erfolgreich – der sich aller unserer Sorgen und Nöte annimmt. Mehr noch, diese Lichtgestalt löst alle unsere Probleme im Alleingang. Na ja fast. Aber auf jeden Fall ist er einer, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern immer mal wieder mit beeindruckend selbstbewussten Auftritten auf den sozialen Kanälen auffällt: Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Seien wir ehrlich, er ist Europas Superpower.
Bretons Team hat das in einem Videorückblick auf vier Jahre harte und – natürlich – überaus erfolgreiche Arbeit des Kommissars noch einmal klargestellt. Und das Video über die Plattform X verbreitet. Die europäische Industrie gestärkt für Wachstum und Beschäftigung in der EU, die Munitionsproduktion gesteigert für die Sicherheit der EU und der Ukraine und natürlich die Digitalgesetze durchgesetzt für eine gesunde europäische Demokratie – all das hat Breton erreicht. Und nebenbei noch 100 Milliarden Euro für dringend benötigte Chips locker gemacht. Wow! Dass der ebenfalls erwähnte AI Act noch gar nicht steht, Schwamm drüber. Macht Breton schon noch.
Das Video – unterlegt mit Amy Steinbergs Track “Power” (die damit nicht Breton, sondern die Liebe meint) – zeigt den Franzosen fröhlich parlierend mit Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño oder EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Beim “La bise” mit Senegals Präsident Macky Sall oder im ernsten Zwiegespräch mit Meta-CEO Mark Zuckerberg. Der Kommissar glänzt auf jeder Bühne und ist überall auf der Welt willkommen. Dabei bleibt er bodenständig. Statt zu Golfen spielt er Tischfußball, erfreut sich an Fast Food im Auto, klimpert auf einem Keyboard statt auf einem Bechstein.
Fazit: Vier Jahre – alles nur für uns. Und so wie es aussieht, kann es noch vier Jahre weiter so gehen. Das ist doch der Zweck der Übung. Oder, Monsieur Breton? vis
