es gibt sie noch, die guten Nachrichten. EU-Diplomaten zeigen sich zuversichtlich, dass die Außenminister heute beim Treffen in Luxemburg den Weg frei machen können, damit die Ukraine endlich frisches Geld bekommt für dringend benötigte Rüstungskäufe. Es geht um windfall profits auf eingefrorene russische Zentralbankgelder. Man habe einen Weg gefunden, Ungarns Veto hier zu umgehen, sagten Diplomaten. Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis bestätigte, dass die Ukraine noch vor der Sommerpause eine erste Tranche von 1,5 Milliarden Euro erhalten dürfte. Bis Ende des Jahres sollen der Ukraine insgesamt drei Milliarden Euro aus den windfall profits zufließen.
Das war es dann aber schon mit den positiven Entwicklungen. Ungarn blockiert nach wie vor sieben Milliarden Euro aus der Friedensfazilität. Mit dem Geld sollten die europäischen Partner für bereits erfolgte Lieferungen von Waffen und Munition entschädigt werden. Es gibt vage Hoffnungen, dass die Regierung in Budapest die Blockade aufgibt, bevor Ungarn am 1. Juli von Belgien den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Der belgische Ratsvorsitz arbeite hart an einer Lösung. Bei der Friedensfazilität führt kein Weg an der Einstimmigkeit vorbei. Das ungarische Veto trifft dabei pikanterweise nicht die Ukraine, sondern die europäischen Partner, die vergeblich auf Rückerstattung warten.
Auf der Agenda ist auch das Nahost-Thema. Der Außenbeauftragter Josep Borrell wartet nach wie vor auf eine Antwort, ob Israels Außenminister Israel Katz die Einladung zu einem Treffen des EU-Israel-Assoziierungsrates annimmt. Laut Diplomaten gibt es Signale, dass Außenminister Katz zu einem Treffen unter dem “proisraelischen” Ratsvorsitz Ungarns bereit sein könnte. Die Außenminister machen den Auftakt für eine intensive Woche, mit dem formellen Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau am Dienstag. Bevor dann Donnerstag und Freitag die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel zusammen kommen, um im zweiten Anlauf hoffentlich das Personalpaket für die Spitzenposten zu beschließen. Die Zeit drängt. Am Sonntag steht in Frankreich der erste Wahlgang der Parlamentswahlen an, der mit dem prognostizierten guten Abschneiden von rechten und linken Extremisten neue Unsicherheit bringen dürfte. Starten Sie gut in die Woche!

Nach dem Eklat zwischen ÖVP und Grünen, den beiden Koalitionspartnern in Österreich, um das “Ja” zum Renaturierungsgesetz in Brüssel, haben die Konservativen rechtliche Schritte angekündigt. Ziel ist es, die Zustimmung der EU im Ministerrat rückgängig zu machen und die zuständige Ministerin Lenore Gewessler einzuschüchtern. Die grüne Umweltministerin hatte gegen den Willen ihres Regierungspartners sowie im Widerspruch zu einem Beschluss der österreichischen Bundesländer dem Gesetzgebungsverfahren am Montag zugestimmt.
Das sind die Schritte, die gegen Gewessler geplant sind:
Experten sind zurückhaltend, ob die ÖVP-Strategie aufgehen könnte. Man betrete hier “juristisches Neuland”, sagt Walter Obwexer, Experte für Europäisches Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck. Zur Nichtigkeitsklage gebe es unterschiedliche Ansichten unter Juristen. Mit einer Entscheidung sei frühestens in eineinhalb Jahren zu rechnen. Von einem Amtsmissbrauch sei nicht auszugehen, erklärt Robert Kert, Jurist an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Grünen sehen den rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Sie verweisen darauf, dass die ÖVP selbst im Laufe der Koalition immer wieder politische Alleingänge hingelegt habe.
Nehammer will nun nur noch “notwendige und wichtige Maßnahmen” umsetzen, sagte er zur Austria Presse Agentur (APA). Nachdem die ÖVP bereits einige eigene Termine abgesagt hatte, hielt sie den Ministerrat diese Woche nicht in Präsenz, sondern im Umlaufverfahren ab. Am 21. Juni boykottierten zudem alle fünf von der ÖVP gestellten Energielandesräte ein Treffen mit Leonore Gewessler. Ihnen missfällt der Alleingang der Umweltministerin, es fehle das Vertrauen.
Nach dem Coup der Grünen-Ministerin hatte die ÖVP vor Wut geschäumt. Am Abend des Tages war Nehammer vor die Kameras getreten: Gewessler habe “rechtswidrig” gehandelt und einen “mehr als schweren Vertrauensbruch” begangen. Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt und des ÖVP-geführten Landwirtschaftsministeriums würden dies belegen.
Gewessler wiederum stützt sich auf vier private Rechtsgutachten (siehe hier, hier, hier und hier). Diese bescheinigen ihr mehr oder weniger freies Stimmrecht. So sei etwa die einheitlich ablehnende Stellungnahme der Bundesländer nicht mehr gültig, da sich diese auf eine veraltete Version des Gesetzes beziehe. Zudem habe mittlerweile das SPÖ-regierte Bundesland Wien die Zustimmung zum Gesetz beschlossen. Auch das SPÖ-regierte Kärnten hat diesen Schritt vor. Naturschutz ist in Österreich zwar Ländersache. Gewessler kann aber laut Verfassung aus “zwingenden integrations- und außenpolitischen Gründen” von einer einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer abweichen.
Dem Getöse zum Trotz will die Koalition weitermachen. Neuwahlen werde es keine geben, erklären ÖVP und Grüne. Am 29. September wird in Österreich ohnehin gewählt. Die ÖVP liegt in Umfragen hinter der rechtspopulistischen FPÖ und gleichauf mit der SPÖ bei rund 22 Prozent. Ihre Chancen, auch wieder den nächsten Kanzler zu stellen, sind also begrenzt. Zudem stehen für die ÖVP in den nächsten Wochen wichtige Gesetze zur Abstimmung – etwa zur Asylberatung, zur Handysicherstellung und im Justizbereich. Die Verabschiedung will man nicht gefährden. Auch die Grünen würden bei Neuwahlen an Macht einbüßen.
Die Vertrauenskrise in Österreich sitzt tief. Misstrauen zu säen sei politische Strategie geworden, werfen Kritiker den konservativen und rechten Parteien vor. Seit Monaten verbreiteten EVP und ÖVP Falschinformationen zum Renaturierungsgesetz, wie etwa 6.000 Forschende in einem Offenen Brief bemängelten. Einige der Vorwürfe:
Auch zu anderen Themen verbreitet die ÖVP Desinformation, frisierte Umfragen, und erstellte Rechnungen, die sich später als nicht seriös erwiesen. “Flooding the zone with shit” nennt sich diese PR-Strategie. So wird Desinformation salonfähig. Die ÖVP erzielt kurzfristige Erfolge, schadet aber langfristig der Demokratie. Laut Vertrauensindex der APA gibt es nur vier Bundespolitiker, denen die Bürger mehr Vertrauen attestieren als Misstrauen. Gewessler und Nehammer schneiden besonders schlecht ab.
Auch das Vertrauen von Jugendlichen in die Politik sinkt, die Wissenschaftsskepsis ist weiter stark ausgeprägt. 38 Prozent der Befragten verlassen sich lieber auf ihren gesunden Menschenverstand, nur 58 Prozent vertrauen der Ökologie- und Klimaforschung, zeigt das Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Von dieser Skepsis lebt die FPÖ, die seit mehr als einem Jahr alle Umfragen anführt.
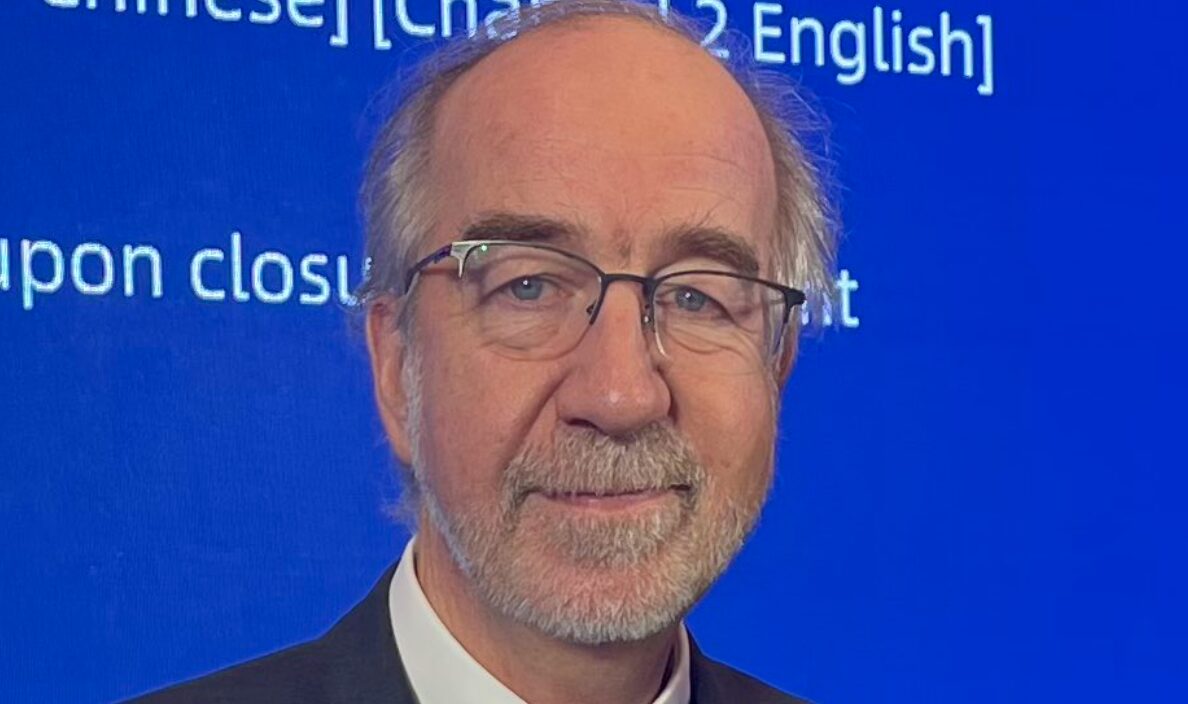
Herr Clarke, warum hat Peking speziell die Schweinefleischindustrie ins Visier genommen? Welche Strategie steckt dahinter?
Peking will ein klares Signal, eine Warnung, senden, dass China Antidumpingzölle auf Schweinefleisch erheben wird, wenn die EU nicht über die Zölle auf Elektrofahrzeuge verhandelt. China hat sich für Schweinefleisch entschieden, weil es der größte landwirtschaftliche Exportartikel der EU nach China ist. Auch wenn die Landwirtschaft nur einen sehr kleinen Teil der Exporte der EU nach China ausmacht, ist sie in der EU politisch sehr sichtbar und lenkt daher die Aufmerksamkeit auf das Problem. Zuvor hatte Peking auch gedroht, möglicherweise Milchprodukte, Wein und sogar Airbus ins Visier zu nehmen.
Warum hat China das nun erstmal nicht gemacht?
Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass China nicht Wein ins Visier genommen hat. Denn ein Großteil des Weins kommt aus Frankreich. Und Frankreich stand hinter der Untersuchung mit den Elektrofahrzeugen und hat sie vorangetrieben. Aber vielleicht war der Sektor zu offensichtlich, und es läuft bereits eine Untersuchung zu hauptsächlich französischen Spirituosen. Was Milchprodukte betrifft, exportiert die EU nicht so viel nach China. Sie exportiert allerdings Säuglingsnahrung wie Milchpulver, das die Chinesen wirklich brauchen. Schweinefleisch ist also eine recht praktische Überlegung. Wir sprechen von Exporten im Wert von drei Milliarden Euro. Das wird die Welt nicht verändern und meiner Meinung nach steuert das auch nicht auf einen Handelskrieg hin. China hat sich entschieden, diesen Sektor zu untersuchen, weil das zwar Schaden verursachen und drei oder vier Mitgliedstaaten auf die Elektroauto-Angelegenheit aufmerksam machen, aber keine massiven Schäden, oder zu einem Handelskrieg führen kann. Der Sektor wurde also sehr sorgfältig gewählt.
Halten Sie das für eine gute Strategie der chinesischen Seite?
Ich habe dazu gemischte Gefühle. Ich denke, es ist eine gute Strategie, wenn das Signal lautet: “Wir wollen verhandeln”, was meiner Meinung nach die Absicht ist. Es geht nicht um Rache.
Und wird das funktionieren?
Vielleicht. Die davon betroffenen Länder wären Spanien, die Niederlande und Dänemark als die drei großen Schweinefleisch-Exporteure. Keiner von ihnen scheint besonders starke Eigeninteressen in der Elektroauto-Frage zu haben. Wenn ihre Schweinefleischexporte ins Visier geraten, könnten sie geneigt sein, der Kommission zu sagen, sie solle bitte über Elektroautos verhandeln, aber das wird keine dramatischen Auswirkungen auf den Fall haben. Das Land, das am meisten auf Zölle auf Elektrofahrzeuge gedrängt hat, ist Frankreich. Wenn Peking Vergeltung üben oder bei künftigen Verhandlungen den größtmöglichen Einfluss ausüben will, wäre es besser gewesen, Produkte aus Frankreich oder Deutschland ins Visier zu nehmen, die in der EU im Grunde die Entscheidungen treffen. In dieser Hinsicht ist es also keine brillante Strategie.
Peking schafft sich damit also eher selbst Probleme?
Ich sehe zwei Punkte: Erstens ist es auf lange Sicht nicht sehr klug, Zölle auf Lebensmittel zu erheben. Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ist es ein ziemlich gefährlicher Ansatz, die eigenen Versorgungsquellen zu reduzieren. Zweitens: Diese von China eingeleitete Antidumpinguntersuchung wurde eindeutig aus politischen Gründen durchgeführt. Es gibt kein glaubwürdiges Dumping bei Schweinefleisch, das nach China geht. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit Chinas, wenn es zugleich vorgibt, sich dem Multilateralismus verpflichtet zu fühlen und die WTO-Regeln gewissenhaft zu befolgen. Die Tatsache, dass China diese Untersuchung aus politischen Gründen einleitet, untergräbt seine Darstellung vollständig. Es schaden sich langfristig selbst, auch seinem Ruf.
Sie haben gesagt, dass der Schweinefleischsektor sorgfältig ausgewählt wurde, um Verhandlungen anzustoßen, anstatt zu eskalieren. Beide Seiten haben sich am Samstag darauf geeinigt, Verhandlungen über die E-Fahrzeuge aufzunehmen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieser Konflikt durch die Verhandlungen gelöst wird?
Die EU-Verordnung und -Politik in Bezug auf Antisubventionen bieten einen gewissen Verhandlungsspielraum. Wenn die chinesischen Unternehmen bei der Untersuchung kooperieren, kann das zu einem deutlich niedrigeren Antisubventionszoll führen. Und wenn die chinesische Regierung kooperiert und erklärt, was die Subventionen sind und was nicht, wäre das ebenfalls hilfreich.
Die EU kann sich auch dafür entscheiden, das breitere öffentliche Interesse zu berücksichtigen – die EU-Handelsschutzgesetzgebung enthält einen Test auf öffentliches Interesse. Liegt es in unserem Interesse als europäische Gesellschaft oder Wirtschaft, eine Steuer auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben – ja oder nein? Und wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten am Ende des Tages entscheiden, dass wir erschwingliche chinesische grüne Technologie brauchen, um das Netto-Null-Ziel und die grüne Transformation zu unterstützen, können sie beschließen, diese Importe nicht so hoch zu besteuern. Es gibt also erheblichen Verhandlungsspielraum. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Schweinefleisch im Wert von drei Milliarden Euro in einem Handelskrieg befinden. Jedenfalls handelt es sich derzeit nur um eine Untersuchung durch China und noch nicht um die Verhängung von Zöllen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass auf die Untersuchung tatsächlich Maßnahmen wie Zölle auf Schweinefleisch folgen?
Das wird von den Gesprächen zum Thema Elektrofahrzeuge abhängen. Wenn es keinen Verhandlungsspielraum mit China gibt oder wenn die chinesischen Unternehmen bei der EU-Untersuchung nicht kooperieren, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Chinesen Zölle auf Schweinefleisch erheben werden. Peking hat eine sehr vage Behauptung aufgestellt – für die es bisher keine Beweise gibt -, dass es in Europa illegale Subventionen für den Schweinefleischsektor gibt. Die Chinesen könnten also ebenfalls versuchen, Ausgleichszölle auf die Subventionen zu erheben. Ich bin sicher, dass sie das tun werden, wenn sie mit dem Ergebnis bei den Elektrofahrzeugen nicht zufrieden sind. Und sei es nur, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden.
Welche Auswirkungen hätten die Schweinefleischzölle auf den EU-Markt? Und welche auf China? Sie haben bereits erwähnt, dass es dort schwierig ist, einige landwirtschaftliche Lebensmittel zu beschaffen.
Kurz- bis mittelfristig wird es Auswirkungen auf den chinesischen Markt haben, weil China diese Produkte braucht. Viele der europäischen Exporte, Dinge wie Köpfe, Füße und Hufe, werden in Europa nicht verwendet, aber die Chinesen kaufen sie. Das bedeutet auch, dass man, um diese Produkte anzubeiten, ein ganzes Schwein produzieren muss. Und China hat möglicherweise nicht die Verbraucherkapazität, um das gesamte Fleisch aufzunehmen, wenn es im Inland produziert wird.
Es bedeutet auch, dass es in Europa vorübergehend Überkapazitäten geben wird, wenn der chinesische Markt für europäische Exporte geschlossen ist. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schweinefleischindustrie durchaus in der Lage ist, ihren Handel umzulenken und ihre Märkte zu diversifizieren. Das war die Erfahrung der letzten Jahre, beispielsweise nachdem Deutschland aufgrund der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vom chinesischen Markt ausgeschlossen war. Nach ein paar Monaten konnte es das Schweinefleisch tatsächlich an neue Bestimmungsorte liefern.
Könnte die EU bei der Welthandelsorganisation Berufung einlegen? Die WTO wirkt derzeit ein wenig zahnlos.
Wenn die EU feststellt, dass Chinas Antidumpingmaßnahmen mit Chinas WTO-Verpflichtungen unvereinbar sind, könnte die EU China natürlich vor die WTO bringen. Die EU wird darüber anhand einer Reihe von Kriterien entscheiden. Erstens: Geht es um viel Geld? Zweitens: Gibt es ein systemisches Problem, das wir lösen müssen? Und drittens: Werden wir den Fall wahrscheinlich gewinnen? Wenn die EU davon überzeugt ist, dass sie den Fall gewinnen kann, und wenn es sich entweder um einen systemischen Fall handelt, oder wenn er erhebliche kommerzielle Auswirkungen hat, könnte sie durchaus das Streitschlichtungssystem der WTO nutzen. Aber dieses funktioniert sehr langsam. Zwischen der Einleitung eines Verfahrens und seinem Abschluss vergehen ein paar Jahre. In der Zwischenzeit bleiben die Zölle in Kraft. Das ist nicht die ideale Lösung. In solchen Situationen kommt es häufig vor, dass ein WTO-Mitglied mit einer Streitschlichtungsvereinbarung droht und Konsultationen mit dem anderen Land aufnimmt. Dadurch kann man sehen, ob ein Kompromiss gefunden werden kann, der die Notwendigkeit, den ganzen Weg zu gehen und ein Verfahren einzuleiten, überflüssig macht. Und in dieser Situation wäre es wahrscheinlich im Interesse Chinas, wenn seine Antidumpinggesetzgebung nicht systematisch als mit den WTO-Regeln unvereinbar eingestuft würde.
John Clarke war bis Oktober 2023 Direktor für internationale Beziehungen in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Zuvor war er Leiter der EU-Delegation bei der WTO und den Vereinten Nationen in Genf. 1993 kam er als Unterhändler für Handel zur Europäischen Kommission.
Während seiner Chinareise konnte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Erfolg verbuchen: China und die EU-Kommission sagten zu, Verhandlungen über den Umgang mit den Zusatzzöllen aufzunehmen, die die EU auf chinesische E-Autos erheben könnte. Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte das am Samstagnachmittag in einem Videogespräch mit Handelsminister Wang Wentao ausgemacht.
Habeck trat mit einer Mischung aus Bescheidenheit und Stolz vor die Presse, nachdem China den Verhandlungen zugestimmt hatte. Er habe als deutscher Handelsminister getan, was er konnte, um zur Aufnahme der Gespräche beizutragen. Es habe sich aber um eine koordinierte gemeinsame Leistung mit der EU gehandelt. Die Aufnahme von Verhandlungen sei zwar ein wichtiger erster Schritt, aber keine Garantie dafür, dass es auch zu einer Einigung kommt.
Die Verhandlungen sind Teil des Beschlusses der EU zu den Zusatzöllen: Die EU wird die Einfuhrbelastung ab dem 4. Juli zunächst vorläufig erheben. Bis November müssen die Importeure nichts zahlen, erst dann werden die Beträge abgebucht. So lange läuft auch die Frist, um zu einer Verhandlungslösung mit China zu kommen. Dass beide Seiten jetzt reden wollen, gilt als positives Signal.
Die deutsche Autoindustrie wird nicht müde, ihre Ablehnung der zusätzlichen Zölle zu betonen. Auch Habeck sagte gemäß seiner Rolle als Vertreter der deutschen Wirtschaft, er wünsche sich vor allem offene Märkte und freie Exporte. Chinas Subventionen hätten das Handeln der EU nötig gemacht. Diese Position vertrat er offensiv. Er trat nicht als Bittsteller auf, sondern als verärgerter Handelspartner, der die Gründe für seinen Unmut deutlich macht. fin
Sieben Abgeordnete der tschechischen Bewegung ANO des Rechtspopulisten Andrej Babiš verlassen die liberale Renew-Fraktion im Europaparlament. Damit sinkt die Zahl der Renew-Abgeordneten auf 74. Renew bleibt damit viertstärkste Fraktion nach der EKR mit 83 Sitzen.
Babiš, der bis 2021 Regierungschef war, erklärte, dass ANO in der Renew-Fraktion ihre politischen Ziele nicht verfolgen könne: gegen illegale Migration, für radikale Änderungen des Green Deals und für Bürokratieabbau. Er werde in den nächsten 14 Tagen mitteilen, in welcher Fraktion ANO am 16. Juli ins Europaparlament einziehe. 4. Juli ist Cut-off-day. Bis dahin muss die Bildung der Fraktionen abgeschlossen sein. Auf der Basis des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen den Fraktionen richtet sich der Anspruch der Fraktionen an Posten wie Vize-Präsidenten und Ausschussvorsitze. Renew-Fraktionschefin Valérie Hayer sagte: “Dies war eine Scheidung, die längst überfällig war. Die ANO hat einen populistischen Weg gewählt, der mit unseren Werten und unserer Identität unvereinbar ist.”
Die sieben ANO-Abgeordnete unter der Führung von Klára Dostálová werden sich nicht der EKR-Fraktion anschließen. In der EKR sind bereits die Abgeordneten der tschechischem ODS von Ministerpräsident Petr Fiala vertreten. Es wird über die Bildung einer neuen Fraktion spekuliert: Die Babiš-Abgeordneten könnten sich mit den zehn bislang fraktionslosen Abgeordneten des ungarischen Fidesz zusammentun. Babiš und Orbán gelten politisch als Verbündete. Womöglich kommen auch noch die 30 Abgeordneten des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen dazu. Um eine Fraktion zu bilden, bedarf es mindestens 23 Abgeordneten aus sieben Mitgliedstaaten.
Inzwischen ist klar, dass sich Orbáns Ankündigungen, der EKR beizutreten, zerschlagen haben. Die EKR hatte am Mittwoch die rumänische Partei AUR (Allianz für die Vereinigung der Rumänen) aufgenommen. Für Orbán war das ein Affront, weil die AUR offensiv gegen seine Pläne für ein Großungarn antritt. In der EKR-Fraktion ist die polnische PiS die zweitstärkste Delegation nach den italienischen Fratelli von Giorgia Meloni. Mateusz Morawiecki, ehemaliger polnischer Ministerpräsident der PiS, hatte angekündigt, die PiS werde aus der EKR austreten, sollte der Fidesz nicht aufgenommen werden. Seitdem klar ist, dass Orbáns Fidesz nicht Mitglied in der EKR-Fraktion wird, hat es keine Reaktion seitens der PiS darauf gegeben. mgr
Der portugiesische Abgeordnete João Fernando Cotrim de Figueiredo fordert die Fraktionsvorsitzende der Renew-Fraktion im Europaparlament, Valérie Hayer, heraus. Bei der Wahl des oder der Fraktionsvorsitzenden am Dienstag ist er ihr Gegenkandidat. Cotrim de Figueiredo ist Kandidat der europäischen Parteienfamilie Alde, die neben der Macron-Bewegung Renaissance Abgeordnete der Renew-Fraktion stellt. Große Chancen werden ihm nicht gegeben. Hayer weiß auch Alde-Mitgliedsparteien hinter sich. Die deutschen FDP-Abgeordneten etwa sind Mitglied in der Alde. mgr
Anders als am Freitag im Europe.Table berichtet, leitet Marie-Agnes Strack-Zimmermann die deutsche Delegation in der Renew-Fraktion. Sie übernimmt von Moritz Körner, der das Amt in der vergangenen Wahlperiode ausgeübt hat. Zur deutschen Delegation gehören fünf Abgeordnete. mgr
Gerne hätte die belgische Ratspräsidentschaft am vergangenen Freitag ein weiteres Dossier abgeschlossen: das Reformpaket, das das Mehrwertsteuersystem in der EU digitalisieren und für die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft wappnen soll. Das Reformpaket wurde im Dezember 2022 von der Kommission vorgeschlagen und enthält ein digitales Reporting-System mit einem Standard für elektronische Rechnungen, einen “One Stop Shop”. Über den “Open Stop Shop” sollen Unternehmen mit einer einzigen Mehrwertsteuer-Registrierung überall in der EU aktiv sein können. Außerdem enthält es Regeln für Online-Plattformen. Insgesamt sollen die Regeln die Betrugsbekämpfung vereinfachen und den administrativen Aufwand für Unternehmen senken.
Die Kommission wollte Online-Plattformen für temporäre Unterkünfte (wie Airbnb) und für Passagiertransport (Uber, Bolt) für die Mehrwertsteuern verantwortlich machen, die für die vermittelten Dienstleistungen fällig sind. Im EU-Rat schwächten die Finanzminister diesen Teil des Kommissionsvorschlags ab. Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit für ein “Opt-out” haben und Plattformen von dieser Verantwortung ausnehmen können.
Für Estland geht diese Abschwächung jedoch nicht weit genug. Schon im Mai hatte Estland sein Veto gegen die Reform eingelegt. Die Textanpassungen, die seit Mai vorgenommen wurden, hätten an den Bedenken Estlands jedoch nichts geändert, sagte der estnische Finanzminister Mart Võrklaev beim Finanzministerrat am Freitag in Luxemburg. Er kritisierte, dass durch die Mehrwertsteuererhebung auf Plattformen auch Kleinunternehmen Mehrwertsteuern zahlen müssen, die sonst nicht mehrwertsteuerpflichtig wären. “Wir sind dagegen, Dienstleistungserbringer zu besteuern, nur weil sie ihre Dienstleistungen über Online-Plattformen anbieten.”
Weil Steuerdossiers in der EU auf Einstimmigkeit basieren, blockiert Estland mit seinem Einwand das gesamte Mehrwertsteuerpaket. In Brüssel wird Estland verdächtigt, mit dieser Position vor allem die Interessen der estnischen Online-Plattform Bolt zu verteidigen, die in ganz Europa aktiv ist. Die estnische Regierung dementiert diesen Vorwurf.
Mehrere Finanzminister äußerten sich enttäuscht über die Blockade Estlands. Staatssekretär Heiko Thoms, der Finanzminister Lindner in Luxemburg vertrat, betonte die Wichtigkeit der Mehrwertsteuerreform, weil sie den Unternehmen “erhebliche Erleichterungen” bringen würde. “Es ist im Interesse der europäischen Wirtschaft ganz dringend notwendig, dass wir einem einheitlichen europäischen Regelwerk folgen”, sagte Thoms.
Das Dossier wird nun von der belgischen Ratspräsidentschaft unvollendet an die ungarische Ratspräsidentschaft weitergegeben. “Wir haben das Ziel, eine Einigung zu finden”, sagte der ungarische Finanzminister Mihály Varga, der im Rat der Finanzminister Juli bis Dezember turnusgemäß den Vorsitz hat. jaa
Die Kommission erlaubt Deutschland, rund drei Milliarden Euro in seine Wasserstoff-Infrastruktur zu investieren. Damit würden Fernleitungen errichtet, mit denen die Nutzung von klimafreundlichem Wasserstoff durch Industrie und Verkehr hochgefahren werden soll. Das teilte die Kommission Freitag mit. Die positiven Auswirkungen der Beihilfen seien größer als der potenzielle Schaden, der etwa durch Wettbewerbsverzerrungen entstehen könne.
Wenn der Staat ein Unternehmen mit Geld oder Steuervorteilen unterstützen will, gelten in der EU dafür sehr strenge Regeln. Damit soll sichergestellt werden, dass der Wettbewerb zwischen Konkurrenten nicht vom Staat verzerrt wird. Die Kommission überwacht, ob diese Regeln eingehalten werden. Vor allem auf Basis erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne hergestellter grüner Wasserstoff soll in Zukunft eine tragende Rolle spielen. Damit sollen fossile Brennstoffe wie Diesel für Lkw oder Kohle in Hochöfen ersetzt werden.
Die erste große Leitung soll 2025 in Betrieb genommen werden. Ein vollständiges Kernnetz soll 2032 fertig sein. Konkret sollen Unternehmen mit staatlichen Garantien unterstützt werden, durch die sie günstige Darlehen erhalten können. Damit könnten Verluste, mit denen zu Beginn des Projekts gerechnet wird, gedeckt werden.
Die staatliche Förderbank KfW soll Darlehen gewähren, deren Zinsen unter den Marktsätzen liegen. “Die Darlehen sind bis 2055 zurückzuzahlen, wobei Höhe und Zeitpunkt der Rückzahlungen angepasst werden an den erwarteten allmählichen Anstieg der Nachfrage nach Wasserstoff”, so die EU-Kommission. dpa

Sie mag das Klischee der “Eisernen Lady”. Darauf angesprochen, lächelt Kaja Kallas sehr fein und antwortet in perfektem Englisch: War die britische Premierministerin Maggie Thatcher nicht eine erfolgreiche Frau? Kallas schafft es, diese rhetorische Erwiderung nicht arrogant klingen zu lassen, sondern selbstbewusst. Und der Erfolg könnte ihr recht geben. Ihre Chancen, bald EU-Außenbeauftragte zu werden, stehen nicht schlecht.
Auch ohne dieses Amt gehört die liberale Regierungschefin des kleinen Estlands zu den erfolgreichen nordischen Politikerinnen. Wie die finnische Außenministerin Elina Valtonen oder die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen repräsentiert sie eine neue Frauengeneration in der Politik: klug, weltgewandt und machtbewusst. Statt in dezenten dunklen Anzügen treten sie in bunten Kleidern auf die große Bühne der Politik. Mit Aussagen, die vor allem bei Kallas gern sehr deutlich sind.
Schon vor dem Angriff Russland auf die Ukraine im Februar 2022 warnte sie vor einem Überfall und forderte mehr Waffenlieferungen. “Russland ist die größte Bedrohung für uns Europäer.” Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2023 setzte sie auf offener Bühne Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck und forderte, europaweit Munition für die Ukraine zu organisieren. Sie erhöhte nicht nur die Verteidigungsausgaben ihres eigenen Landes, sie forderte vor allem die anderen Europäer auf, mehr in ihre Sicherheit zu investieren. Die – vor allem in Deutschland verbreitete – Angst vor einem russischen Atomschlag hält sie für abwegig: “Das Ziel ist Einschüchterung, und das funktioniert in einigen Ländern.”
Aus Kallas spricht das neue Selbstbewusstsein der kleinen nordischen Staaten. Auch gegenüber dem großen Deutschland. “Ich habe das Gefühl, wir sind in den vergangenen Jahren mehr gehört worden als jemals zuvor.” Im Gespräch mit Table.Briefings erklärte sie, dass man lange einen ganz anderen Eindruck gehabt habe. “Über die 50 Jahre, die wir besetzt waren, wissen die Deutschen recht wenig. Sie haben uns nicht vermisst, aber wir sie schon! Darüber müssen wir reden.”
Das tut sie. Sehr deutlich auch, wenn sie mit Deutschen spricht. Und sie erwähnt dabei immer wieder, dass man in Estland nicht vergessen habe, welche Politik Deutschland gegenüber Russland lange verfolgt habe. Ihre Kritik verpackt die Regierungschefin eines Staates mit 1,3 Millionen Einwohnern dann mit einem süffisanten Lächeln: “Wir wissen, wie Russland operiert und wohin das führen kann.”
Ihre drastischen Worte scheinen den russischen Machthaber zumindest zu ärgern. Im Februar setzte das russische Innenministerium die estnische Regierungschefin auf eine Fahndungsliste. Kallas Regierung hatte die Demontage ehemaliger sowjetischer Denkmäler veranlasst. “Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass ich das Richtige tue”, schrieb sie daraufhin unerschrocken auf X. Man darf gespannt sein, wie sie als potenzielle EU-Außenbeauftragte mit dem Russland-Freund Viktor Orbán umgehen wird.
Als die Juristin und dreifache Mutter als erste Frau 2021 Premierministerin wird, zählte sie zu den beliebtesten Politikerinnen. So populär sie heute auf der europäischen Bühne ist, so sehr hat ihr Image im eigenen Land jedoch gelitten. Eine Affäre um ihren Ehemann, der auch nach dem Februar 2022 mit einem Logistikunternehmen Geschäfte mit Russland gemacht hat, schadete ihr nachhaltig.
Bei der Wiederwahl 2023 gelang Kaja Kallas mit der liberalen Reformpartei zwar ein knapper Sieg. Aber ihre Zustimmungswerte sanken rapide, auch weil gestiegene Energiepreise und unpopuläre Sparmaßnahmen die Esten verärgern. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ihre Kandidatur für ein europäisches Amt in Estland breit unterstützt wird.
Längst macht Kallas keinen Hehl mehr aus ihren Karriereplänen. Und man läge wohl nicht falsch mit der Behauptung, die 47-Jährige sehe ihre Zukunft eher in Brüssel denn in Tallinn. “Estland ist zu klein für sie”, urteilt denn auch Elisabeth Bauer, lange für die Konrad-Adenauer-Stiftung in den nordischen Ländern unterwegs: “Sie ist eine leidenschaftliche Europäerin”. Und auch eine mit Erfahrung: Die ehemalige Europaabgeordnete – zwischen 2014 und 2018 – weiß, wie Brüssel tickt.
Ihre Kandidatur für das Amt der EU-Außenbeauftragten kann man durchaus auch als Signal lesen. Eines, das der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni gar nicht gefällt. Mit Kallas gewinnt der Norden an Einfluss, nicht nur in der EU, auch in der Nato: Für den Posten des Nato-Generalsekretärs war sie übrigens auch mal im Gespräch. Nana Brink
es gibt sie noch, die guten Nachrichten. EU-Diplomaten zeigen sich zuversichtlich, dass die Außenminister heute beim Treffen in Luxemburg den Weg frei machen können, damit die Ukraine endlich frisches Geld bekommt für dringend benötigte Rüstungskäufe. Es geht um windfall profits auf eingefrorene russische Zentralbankgelder. Man habe einen Weg gefunden, Ungarns Veto hier zu umgehen, sagten Diplomaten. Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis bestätigte, dass die Ukraine noch vor der Sommerpause eine erste Tranche von 1,5 Milliarden Euro erhalten dürfte. Bis Ende des Jahres sollen der Ukraine insgesamt drei Milliarden Euro aus den windfall profits zufließen.
Das war es dann aber schon mit den positiven Entwicklungen. Ungarn blockiert nach wie vor sieben Milliarden Euro aus der Friedensfazilität. Mit dem Geld sollten die europäischen Partner für bereits erfolgte Lieferungen von Waffen und Munition entschädigt werden. Es gibt vage Hoffnungen, dass die Regierung in Budapest die Blockade aufgibt, bevor Ungarn am 1. Juli von Belgien den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Der belgische Ratsvorsitz arbeite hart an einer Lösung. Bei der Friedensfazilität führt kein Weg an der Einstimmigkeit vorbei. Das ungarische Veto trifft dabei pikanterweise nicht die Ukraine, sondern die europäischen Partner, die vergeblich auf Rückerstattung warten.
Auf der Agenda ist auch das Nahost-Thema. Der Außenbeauftragter Josep Borrell wartet nach wie vor auf eine Antwort, ob Israels Außenminister Israel Katz die Einladung zu einem Treffen des EU-Israel-Assoziierungsrates annimmt. Laut Diplomaten gibt es Signale, dass Außenminister Katz zu einem Treffen unter dem “proisraelischen” Ratsvorsitz Ungarns bereit sein könnte. Die Außenminister machen den Auftakt für eine intensive Woche, mit dem formellen Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau am Dienstag. Bevor dann Donnerstag und Freitag die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel zusammen kommen, um im zweiten Anlauf hoffentlich das Personalpaket für die Spitzenposten zu beschließen. Die Zeit drängt. Am Sonntag steht in Frankreich der erste Wahlgang der Parlamentswahlen an, der mit dem prognostizierten guten Abschneiden von rechten und linken Extremisten neue Unsicherheit bringen dürfte. Starten Sie gut in die Woche!

Nach dem Eklat zwischen ÖVP und Grünen, den beiden Koalitionspartnern in Österreich, um das “Ja” zum Renaturierungsgesetz in Brüssel, haben die Konservativen rechtliche Schritte angekündigt. Ziel ist es, die Zustimmung der EU im Ministerrat rückgängig zu machen und die zuständige Ministerin Lenore Gewessler einzuschüchtern. Die grüne Umweltministerin hatte gegen den Willen ihres Regierungspartners sowie im Widerspruch zu einem Beschluss der österreichischen Bundesländer dem Gesetzgebungsverfahren am Montag zugestimmt.
Das sind die Schritte, die gegen Gewessler geplant sind:
Experten sind zurückhaltend, ob die ÖVP-Strategie aufgehen könnte. Man betrete hier “juristisches Neuland”, sagt Walter Obwexer, Experte für Europäisches Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck. Zur Nichtigkeitsklage gebe es unterschiedliche Ansichten unter Juristen. Mit einer Entscheidung sei frühestens in eineinhalb Jahren zu rechnen. Von einem Amtsmissbrauch sei nicht auszugehen, erklärt Robert Kert, Jurist an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Grünen sehen den rechtlichen Schritten gelassen entgegen. Sie verweisen darauf, dass die ÖVP selbst im Laufe der Koalition immer wieder politische Alleingänge hingelegt habe.
Nehammer will nun nur noch “notwendige und wichtige Maßnahmen” umsetzen, sagte er zur Austria Presse Agentur (APA). Nachdem die ÖVP bereits einige eigene Termine abgesagt hatte, hielt sie den Ministerrat diese Woche nicht in Präsenz, sondern im Umlaufverfahren ab. Am 21. Juni boykottierten zudem alle fünf von der ÖVP gestellten Energielandesräte ein Treffen mit Leonore Gewessler. Ihnen missfällt der Alleingang der Umweltministerin, es fehle das Vertrauen.
Nach dem Coup der Grünen-Ministerin hatte die ÖVP vor Wut geschäumt. Am Abend des Tages war Nehammer vor die Kameras getreten: Gewessler habe “rechtswidrig” gehandelt und einen “mehr als schweren Vertrauensbruch” begangen. Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt und des ÖVP-geführten Landwirtschaftsministeriums würden dies belegen.
Gewessler wiederum stützt sich auf vier private Rechtsgutachten (siehe hier, hier, hier und hier). Diese bescheinigen ihr mehr oder weniger freies Stimmrecht. So sei etwa die einheitlich ablehnende Stellungnahme der Bundesländer nicht mehr gültig, da sich diese auf eine veraltete Version des Gesetzes beziehe. Zudem habe mittlerweile das SPÖ-regierte Bundesland Wien die Zustimmung zum Gesetz beschlossen. Auch das SPÖ-regierte Kärnten hat diesen Schritt vor. Naturschutz ist in Österreich zwar Ländersache. Gewessler kann aber laut Verfassung aus “zwingenden integrations- und außenpolitischen Gründen” von einer einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer abweichen.
Dem Getöse zum Trotz will die Koalition weitermachen. Neuwahlen werde es keine geben, erklären ÖVP und Grüne. Am 29. September wird in Österreich ohnehin gewählt. Die ÖVP liegt in Umfragen hinter der rechtspopulistischen FPÖ und gleichauf mit der SPÖ bei rund 22 Prozent. Ihre Chancen, auch wieder den nächsten Kanzler zu stellen, sind also begrenzt. Zudem stehen für die ÖVP in den nächsten Wochen wichtige Gesetze zur Abstimmung – etwa zur Asylberatung, zur Handysicherstellung und im Justizbereich. Die Verabschiedung will man nicht gefährden. Auch die Grünen würden bei Neuwahlen an Macht einbüßen.
Die Vertrauenskrise in Österreich sitzt tief. Misstrauen zu säen sei politische Strategie geworden, werfen Kritiker den konservativen und rechten Parteien vor. Seit Monaten verbreiteten EVP und ÖVP Falschinformationen zum Renaturierungsgesetz, wie etwa 6.000 Forschende in einem Offenen Brief bemängelten. Einige der Vorwürfe:
Auch zu anderen Themen verbreitet die ÖVP Desinformation, frisierte Umfragen, und erstellte Rechnungen, die sich später als nicht seriös erwiesen. “Flooding the zone with shit” nennt sich diese PR-Strategie. So wird Desinformation salonfähig. Die ÖVP erzielt kurzfristige Erfolge, schadet aber langfristig der Demokratie. Laut Vertrauensindex der APA gibt es nur vier Bundespolitiker, denen die Bürger mehr Vertrauen attestieren als Misstrauen. Gewessler und Nehammer schneiden besonders schlecht ab.
Auch das Vertrauen von Jugendlichen in die Politik sinkt, die Wissenschaftsskepsis ist weiter stark ausgeprägt. 38 Prozent der Befragten verlassen sich lieber auf ihren gesunden Menschenverstand, nur 58 Prozent vertrauen der Ökologie- und Klimaforschung, zeigt das Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Von dieser Skepsis lebt die FPÖ, die seit mehr als einem Jahr alle Umfragen anführt.
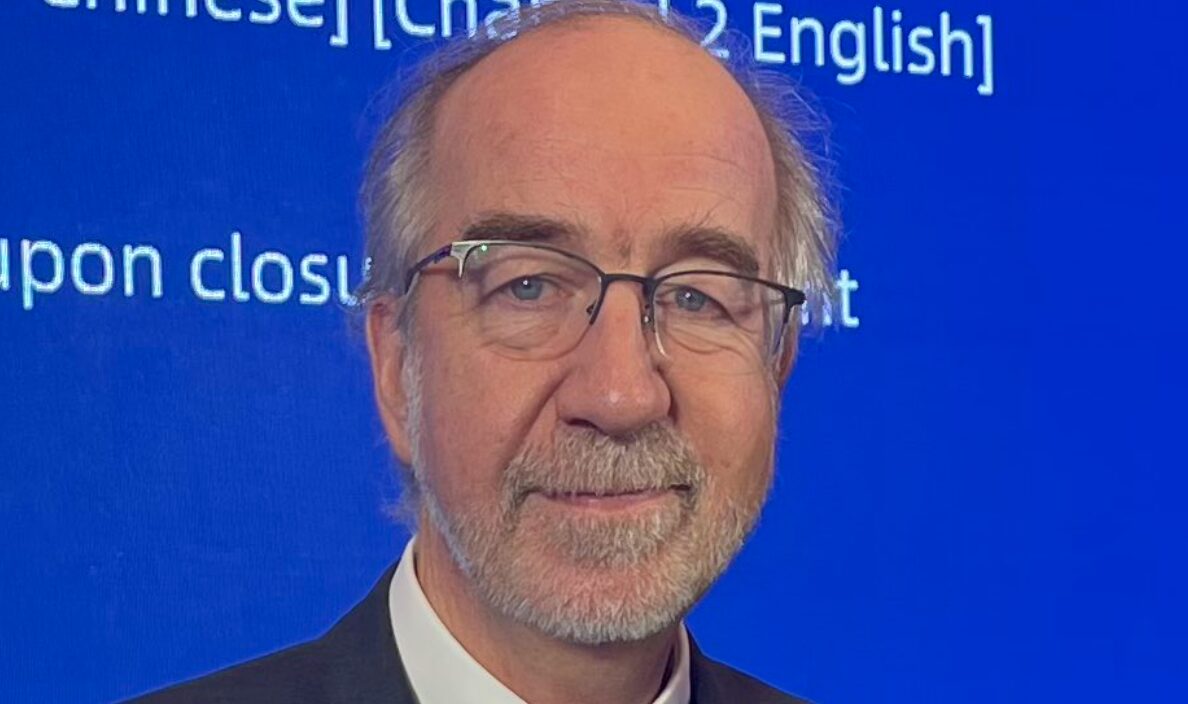
Herr Clarke, warum hat Peking speziell die Schweinefleischindustrie ins Visier genommen? Welche Strategie steckt dahinter?
Peking will ein klares Signal, eine Warnung, senden, dass China Antidumpingzölle auf Schweinefleisch erheben wird, wenn die EU nicht über die Zölle auf Elektrofahrzeuge verhandelt. China hat sich für Schweinefleisch entschieden, weil es der größte landwirtschaftliche Exportartikel der EU nach China ist. Auch wenn die Landwirtschaft nur einen sehr kleinen Teil der Exporte der EU nach China ausmacht, ist sie in der EU politisch sehr sichtbar und lenkt daher die Aufmerksamkeit auf das Problem. Zuvor hatte Peking auch gedroht, möglicherweise Milchprodukte, Wein und sogar Airbus ins Visier zu nehmen.
Warum hat China das nun erstmal nicht gemacht?
Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass China nicht Wein ins Visier genommen hat. Denn ein Großteil des Weins kommt aus Frankreich. Und Frankreich stand hinter der Untersuchung mit den Elektrofahrzeugen und hat sie vorangetrieben. Aber vielleicht war der Sektor zu offensichtlich, und es läuft bereits eine Untersuchung zu hauptsächlich französischen Spirituosen. Was Milchprodukte betrifft, exportiert die EU nicht so viel nach China. Sie exportiert allerdings Säuglingsnahrung wie Milchpulver, das die Chinesen wirklich brauchen. Schweinefleisch ist also eine recht praktische Überlegung. Wir sprechen von Exporten im Wert von drei Milliarden Euro. Das wird die Welt nicht verändern und meiner Meinung nach steuert das auch nicht auf einen Handelskrieg hin. China hat sich entschieden, diesen Sektor zu untersuchen, weil das zwar Schaden verursachen und drei oder vier Mitgliedstaaten auf die Elektroauto-Angelegenheit aufmerksam machen, aber keine massiven Schäden, oder zu einem Handelskrieg führen kann. Der Sektor wurde also sehr sorgfältig gewählt.
Halten Sie das für eine gute Strategie der chinesischen Seite?
Ich habe dazu gemischte Gefühle. Ich denke, es ist eine gute Strategie, wenn das Signal lautet: “Wir wollen verhandeln”, was meiner Meinung nach die Absicht ist. Es geht nicht um Rache.
Und wird das funktionieren?
Vielleicht. Die davon betroffenen Länder wären Spanien, die Niederlande und Dänemark als die drei großen Schweinefleisch-Exporteure. Keiner von ihnen scheint besonders starke Eigeninteressen in der Elektroauto-Frage zu haben. Wenn ihre Schweinefleischexporte ins Visier geraten, könnten sie geneigt sein, der Kommission zu sagen, sie solle bitte über Elektroautos verhandeln, aber das wird keine dramatischen Auswirkungen auf den Fall haben. Das Land, das am meisten auf Zölle auf Elektrofahrzeuge gedrängt hat, ist Frankreich. Wenn Peking Vergeltung üben oder bei künftigen Verhandlungen den größtmöglichen Einfluss ausüben will, wäre es besser gewesen, Produkte aus Frankreich oder Deutschland ins Visier zu nehmen, die in der EU im Grunde die Entscheidungen treffen. In dieser Hinsicht ist es also keine brillante Strategie.
Peking schafft sich damit also eher selbst Probleme?
Ich sehe zwei Punkte: Erstens ist es auf lange Sicht nicht sehr klug, Zölle auf Lebensmittel zu erheben. Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ist es ein ziemlich gefährlicher Ansatz, die eigenen Versorgungsquellen zu reduzieren. Zweitens: Diese von China eingeleitete Antidumpinguntersuchung wurde eindeutig aus politischen Gründen durchgeführt. Es gibt kein glaubwürdiges Dumping bei Schweinefleisch, das nach China geht. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit Chinas, wenn es zugleich vorgibt, sich dem Multilateralismus verpflichtet zu fühlen und die WTO-Regeln gewissenhaft zu befolgen. Die Tatsache, dass China diese Untersuchung aus politischen Gründen einleitet, untergräbt seine Darstellung vollständig. Es schaden sich langfristig selbst, auch seinem Ruf.
Sie haben gesagt, dass der Schweinefleischsektor sorgfältig ausgewählt wurde, um Verhandlungen anzustoßen, anstatt zu eskalieren. Beide Seiten haben sich am Samstag darauf geeinigt, Verhandlungen über die E-Fahrzeuge aufzunehmen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieser Konflikt durch die Verhandlungen gelöst wird?
Die EU-Verordnung und -Politik in Bezug auf Antisubventionen bieten einen gewissen Verhandlungsspielraum. Wenn die chinesischen Unternehmen bei der Untersuchung kooperieren, kann das zu einem deutlich niedrigeren Antisubventionszoll führen. Und wenn die chinesische Regierung kooperiert und erklärt, was die Subventionen sind und was nicht, wäre das ebenfalls hilfreich.
Die EU kann sich auch dafür entscheiden, das breitere öffentliche Interesse zu berücksichtigen – die EU-Handelsschutzgesetzgebung enthält einen Test auf öffentliches Interesse. Liegt es in unserem Interesse als europäische Gesellschaft oder Wirtschaft, eine Steuer auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben – ja oder nein? Und wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten am Ende des Tages entscheiden, dass wir erschwingliche chinesische grüne Technologie brauchen, um das Netto-Null-Ziel und die grüne Transformation zu unterstützen, können sie beschließen, diese Importe nicht so hoch zu besteuern. Es gibt also erheblichen Verhandlungsspielraum. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Schweinefleisch im Wert von drei Milliarden Euro in einem Handelskrieg befinden. Jedenfalls handelt es sich derzeit nur um eine Untersuchung durch China und noch nicht um die Verhängung von Zöllen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass auf die Untersuchung tatsächlich Maßnahmen wie Zölle auf Schweinefleisch folgen?
Das wird von den Gesprächen zum Thema Elektrofahrzeuge abhängen. Wenn es keinen Verhandlungsspielraum mit China gibt oder wenn die chinesischen Unternehmen bei der EU-Untersuchung nicht kooperieren, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Chinesen Zölle auf Schweinefleisch erheben werden. Peking hat eine sehr vage Behauptung aufgestellt – für die es bisher keine Beweise gibt -, dass es in Europa illegale Subventionen für den Schweinefleischsektor gibt. Die Chinesen könnten also ebenfalls versuchen, Ausgleichszölle auf die Subventionen zu erheben. Ich bin sicher, dass sie das tun werden, wenn sie mit dem Ergebnis bei den Elektrofahrzeugen nicht zufrieden sind. Und sei es nur, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden.
Welche Auswirkungen hätten die Schweinefleischzölle auf den EU-Markt? Und welche auf China? Sie haben bereits erwähnt, dass es dort schwierig ist, einige landwirtschaftliche Lebensmittel zu beschaffen.
Kurz- bis mittelfristig wird es Auswirkungen auf den chinesischen Markt haben, weil China diese Produkte braucht. Viele der europäischen Exporte, Dinge wie Köpfe, Füße und Hufe, werden in Europa nicht verwendet, aber die Chinesen kaufen sie. Das bedeutet auch, dass man, um diese Produkte anzubeiten, ein ganzes Schwein produzieren muss. Und China hat möglicherweise nicht die Verbraucherkapazität, um das gesamte Fleisch aufzunehmen, wenn es im Inland produziert wird.
Es bedeutet auch, dass es in Europa vorübergehend Überkapazitäten geben wird, wenn der chinesische Markt für europäische Exporte geschlossen ist. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schweinefleischindustrie durchaus in der Lage ist, ihren Handel umzulenken und ihre Märkte zu diversifizieren. Das war die Erfahrung der letzten Jahre, beispielsweise nachdem Deutschland aufgrund der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vom chinesischen Markt ausgeschlossen war. Nach ein paar Monaten konnte es das Schweinefleisch tatsächlich an neue Bestimmungsorte liefern.
Könnte die EU bei der Welthandelsorganisation Berufung einlegen? Die WTO wirkt derzeit ein wenig zahnlos.
Wenn die EU feststellt, dass Chinas Antidumpingmaßnahmen mit Chinas WTO-Verpflichtungen unvereinbar sind, könnte die EU China natürlich vor die WTO bringen. Die EU wird darüber anhand einer Reihe von Kriterien entscheiden. Erstens: Geht es um viel Geld? Zweitens: Gibt es ein systemisches Problem, das wir lösen müssen? Und drittens: Werden wir den Fall wahrscheinlich gewinnen? Wenn die EU davon überzeugt ist, dass sie den Fall gewinnen kann, und wenn es sich entweder um einen systemischen Fall handelt, oder wenn er erhebliche kommerzielle Auswirkungen hat, könnte sie durchaus das Streitschlichtungssystem der WTO nutzen. Aber dieses funktioniert sehr langsam. Zwischen der Einleitung eines Verfahrens und seinem Abschluss vergehen ein paar Jahre. In der Zwischenzeit bleiben die Zölle in Kraft. Das ist nicht die ideale Lösung. In solchen Situationen kommt es häufig vor, dass ein WTO-Mitglied mit einer Streitschlichtungsvereinbarung droht und Konsultationen mit dem anderen Land aufnimmt. Dadurch kann man sehen, ob ein Kompromiss gefunden werden kann, der die Notwendigkeit, den ganzen Weg zu gehen und ein Verfahren einzuleiten, überflüssig macht. Und in dieser Situation wäre es wahrscheinlich im Interesse Chinas, wenn seine Antidumpinggesetzgebung nicht systematisch als mit den WTO-Regeln unvereinbar eingestuft würde.
John Clarke war bis Oktober 2023 Direktor für internationale Beziehungen in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Zuvor war er Leiter der EU-Delegation bei der WTO und den Vereinten Nationen in Genf. 1993 kam er als Unterhändler für Handel zur Europäischen Kommission.
Während seiner Chinareise konnte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Erfolg verbuchen: China und die EU-Kommission sagten zu, Verhandlungen über den Umgang mit den Zusatzzöllen aufzunehmen, die die EU auf chinesische E-Autos erheben könnte. Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte das am Samstagnachmittag in einem Videogespräch mit Handelsminister Wang Wentao ausgemacht.
Habeck trat mit einer Mischung aus Bescheidenheit und Stolz vor die Presse, nachdem China den Verhandlungen zugestimmt hatte. Er habe als deutscher Handelsminister getan, was er konnte, um zur Aufnahme der Gespräche beizutragen. Es habe sich aber um eine koordinierte gemeinsame Leistung mit der EU gehandelt. Die Aufnahme von Verhandlungen sei zwar ein wichtiger erster Schritt, aber keine Garantie dafür, dass es auch zu einer Einigung kommt.
Die Verhandlungen sind Teil des Beschlusses der EU zu den Zusatzöllen: Die EU wird die Einfuhrbelastung ab dem 4. Juli zunächst vorläufig erheben. Bis November müssen die Importeure nichts zahlen, erst dann werden die Beträge abgebucht. So lange läuft auch die Frist, um zu einer Verhandlungslösung mit China zu kommen. Dass beide Seiten jetzt reden wollen, gilt als positives Signal.
Die deutsche Autoindustrie wird nicht müde, ihre Ablehnung der zusätzlichen Zölle zu betonen. Auch Habeck sagte gemäß seiner Rolle als Vertreter der deutschen Wirtschaft, er wünsche sich vor allem offene Märkte und freie Exporte. Chinas Subventionen hätten das Handeln der EU nötig gemacht. Diese Position vertrat er offensiv. Er trat nicht als Bittsteller auf, sondern als verärgerter Handelspartner, der die Gründe für seinen Unmut deutlich macht. fin
Sieben Abgeordnete der tschechischen Bewegung ANO des Rechtspopulisten Andrej Babiš verlassen die liberale Renew-Fraktion im Europaparlament. Damit sinkt die Zahl der Renew-Abgeordneten auf 74. Renew bleibt damit viertstärkste Fraktion nach der EKR mit 83 Sitzen.
Babiš, der bis 2021 Regierungschef war, erklärte, dass ANO in der Renew-Fraktion ihre politischen Ziele nicht verfolgen könne: gegen illegale Migration, für radikale Änderungen des Green Deals und für Bürokratieabbau. Er werde in den nächsten 14 Tagen mitteilen, in welcher Fraktion ANO am 16. Juli ins Europaparlament einziehe. 4. Juli ist Cut-off-day. Bis dahin muss die Bildung der Fraktionen abgeschlossen sein. Auf der Basis des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen den Fraktionen richtet sich der Anspruch der Fraktionen an Posten wie Vize-Präsidenten und Ausschussvorsitze. Renew-Fraktionschefin Valérie Hayer sagte: “Dies war eine Scheidung, die längst überfällig war. Die ANO hat einen populistischen Weg gewählt, der mit unseren Werten und unserer Identität unvereinbar ist.”
Die sieben ANO-Abgeordnete unter der Führung von Klára Dostálová werden sich nicht der EKR-Fraktion anschließen. In der EKR sind bereits die Abgeordneten der tschechischem ODS von Ministerpräsident Petr Fiala vertreten. Es wird über die Bildung einer neuen Fraktion spekuliert: Die Babiš-Abgeordneten könnten sich mit den zehn bislang fraktionslosen Abgeordneten des ungarischen Fidesz zusammentun. Babiš und Orbán gelten politisch als Verbündete. Womöglich kommen auch noch die 30 Abgeordneten des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen dazu. Um eine Fraktion zu bilden, bedarf es mindestens 23 Abgeordneten aus sieben Mitgliedstaaten.
Inzwischen ist klar, dass sich Orbáns Ankündigungen, der EKR beizutreten, zerschlagen haben. Die EKR hatte am Mittwoch die rumänische Partei AUR (Allianz für die Vereinigung der Rumänen) aufgenommen. Für Orbán war das ein Affront, weil die AUR offensiv gegen seine Pläne für ein Großungarn antritt. In der EKR-Fraktion ist die polnische PiS die zweitstärkste Delegation nach den italienischen Fratelli von Giorgia Meloni. Mateusz Morawiecki, ehemaliger polnischer Ministerpräsident der PiS, hatte angekündigt, die PiS werde aus der EKR austreten, sollte der Fidesz nicht aufgenommen werden. Seitdem klar ist, dass Orbáns Fidesz nicht Mitglied in der EKR-Fraktion wird, hat es keine Reaktion seitens der PiS darauf gegeben. mgr
Der portugiesische Abgeordnete João Fernando Cotrim de Figueiredo fordert die Fraktionsvorsitzende der Renew-Fraktion im Europaparlament, Valérie Hayer, heraus. Bei der Wahl des oder der Fraktionsvorsitzenden am Dienstag ist er ihr Gegenkandidat. Cotrim de Figueiredo ist Kandidat der europäischen Parteienfamilie Alde, die neben der Macron-Bewegung Renaissance Abgeordnete der Renew-Fraktion stellt. Große Chancen werden ihm nicht gegeben. Hayer weiß auch Alde-Mitgliedsparteien hinter sich. Die deutschen FDP-Abgeordneten etwa sind Mitglied in der Alde. mgr
Anders als am Freitag im Europe.Table berichtet, leitet Marie-Agnes Strack-Zimmermann die deutsche Delegation in der Renew-Fraktion. Sie übernimmt von Moritz Körner, der das Amt in der vergangenen Wahlperiode ausgeübt hat. Zur deutschen Delegation gehören fünf Abgeordnete. mgr
Gerne hätte die belgische Ratspräsidentschaft am vergangenen Freitag ein weiteres Dossier abgeschlossen: das Reformpaket, das das Mehrwertsteuersystem in der EU digitalisieren und für die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft wappnen soll. Das Reformpaket wurde im Dezember 2022 von der Kommission vorgeschlagen und enthält ein digitales Reporting-System mit einem Standard für elektronische Rechnungen, einen “One Stop Shop”. Über den “Open Stop Shop” sollen Unternehmen mit einer einzigen Mehrwertsteuer-Registrierung überall in der EU aktiv sein können. Außerdem enthält es Regeln für Online-Plattformen. Insgesamt sollen die Regeln die Betrugsbekämpfung vereinfachen und den administrativen Aufwand für Unternehmen senken.
Die Kommission wollte Online-Plattformen für temporäre Unterkünfte (wie Airbnb) und für Passagiertransport (Uber, Bolt) für die Mehrwertsteuern verantwortlich machen, die für die vermittelten Dienstleistungen fällig sind. Im EU-Rat schwächten die Finanzminister diesen Teil des Kommissionsvorschlags ab. Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit für ein “Opt-out” haben und Plattformen von dieser Verantwortung ausnehmen können.
Für Estland geht diese Abschwächung jedoch nicht weit genug. Schon im Mai hatte Estland sein Veto gegen die Reform eingelegt. Die Textanpassungen, die seit Mai vorgenommen wurden, hätten an den Bedenken Estlands jedoch nichts geändert, sagte der estnische Finanzminister Mart Võrklaev beim Finanzministerrat am Freitag in Luxemburg. Er kritisierte, dass durch die Mehrwertsteuererhebung auf Plattformen auch Kleinunternehmen Mehrwertsteuern zahlen müssen, die sonst nicht mehrwertsteuerpflichtig wären. “Wir sind dagegen, Dienstleistungserbringer zu besteuern, nur weil sie ihre Dienstleistungen über Online-Plattformen anbieten.”
Weil Steuerdossiers in der EU auf Einstimmigkeit basieren, blockiert Estland mit seinem Einwand das gesamte Mehrwertsteuerpaket. In Brüssel wird Estland verdächtigt, mit dieser Position vor allem die Interessen der estnischen Online-Plattform Bolt zu verteidigen, die in ganz Europa aktiv ist. Die estnische Regierung dementiert diesen Vorwurf.
Mehrere Finanzminister äußerten sich enttäuscht über die Blockade Estlands. Staatssekretär Heiko Thoms, der Finanzminister Lindner in Luxemburg vertrat, betonte die Wichtigkeit der Mehrwertsteuerreform, weil sie den Unternehmen “erhebliche Erleichterungen” bringen würde. “Es ist im Interesse der europäischen Wirtschaft ganz dringend notwendig, dass wir einem einheitlichen europäischen Regelwerk folgen”, sagte Thoms.
Das Dossier wird nun von der belgischen Ratspräsidentschaft unvollendet an die ungarische Ratspräsidentschaft weitergegeben. “Wir haben das Ziel, eine Einigung zu finden”, sagte der ungarische Finanzminister Mihály Varga, der im Rat der Finanzminister Juli bis Dezember turnusgemäß den Vorsitz hat. jaa
Die Kommission erlaubt Deutschland, rund drei Milliarden Euro in seine Wasserstoff-Infrastruktur zu investieren. Damit würden Fernleitungen errichtet, mit denen die Nutzung von klimafreundlichem Wasserstoff durch Industrie und Verkehr hochgefahren werden soll. Das teilte die Kommission Freitag mit. Die positiven Auswirkungen der Beihilfen seien größer als der potenzielle Schaden, der etwa durch Wettbewerbsverzerrungen entstehen könne.
Wenn der Staat ein Unternehmen mit Geld oder Steuervorteilen unterstützen will, gelten in der EU dafür sehr strenge Regeln. Damit soll sichergestellt werden, dass der Wettbewerb zwischen Konkurrenten nicht vom Staat verzerrt wird. Die Kommission überwacht, ob diese Regeln eingehalten werden. Vor allem auf Basis erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne hergestellter grüner Wasserstoff soll in Zukunft eine tragende Rolle spielen. Damit sollen fossile Brennstoffe wie Diesel für Lkw oder Kohle in Hochöfen ersetzt werden.
Die erste große Leitung soll 2025 in Betrieb genommen werden. Ein vollständiges Kernnetz soll 2032 fertig sein. Konkret sollen Unternehmen mit staatlichen Garantien unterstützt werden, durch die sie günstige Darlehen erhalten können. Damit könnten Verluste, mit denen zu Beginn des Projekts gerechnet wird, gedeckt werden.
Die staatliche Förderbank KfW soll Darlehen gewähren, deren Zinsen unter den Marktsätzen liegen. “Die Darlehen sind bis 2055 zurückzuzahlen, wobei Höhe und Zeitpunkt der Rückzahlungen angepasst werden an den erwarteten allmählichen Anstieg der Nachfrage nach Wasserstoff”, so die EU-Kommission. dpa

Sie mag das Klischee der “Eisernen Lady”. Darauf angesprochen, lächelt Kaja Kallas sehr fein und antwortet in perfektem Englisch: War die britische Premierministerin Maggie Thatcher nicht eine erfolgreiche Frau? Kallas schafft es, diese rhetorische Erwiderung nicht arrogant klingen zu lassen, sondern selbstbewusst. Und der Erfolg könnte ihr recht geben. Ihre Chancen, bald EU-Außenbeauftragte zu werden, stehen nicht schlecht.
Auch ohne dieses Amt gehört die liberale Regierungschefin des kleinen Estlands zu den erfolgreichen nordischen Politikerinnen. Wie die finnische Außenministerin Elina Valtonen oder die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen repräsentiert sie eine neue Frauengeneration in der Politik: klug, weltgewandt und machtbewusst. Statt in dezenten dunklen Anzügen treten sie in bunten Kleidern auf die große Bühne der Politik. Mit Aussagen, die vor allem bei Kallas gern sehr deutlich sind.
Schon vor dem Angriff Russland auf die Ukraine im Februar 2022 warnte sie vor einem Überfall und forderte mehr Waffenlieferungen. “Russland ist die größte Bedrohung für uns Europäer.” Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2023 setzte sie auf offener Bühne Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck und forderte, europaweit Munition für die Ukraine zu organisieren. Sie erhöhte nicht nur die Verteidigungsausgaben ihres eigenen Landes, sie forderte vor allem die anderen Europäer auf, mehr in ihre Sicherheit zu investieren. Die – vor allem in Deutschland verbreitete – Angst vor einem russischen Atomschlag hält sie für abwegig: “Das Ziel ist Einschüchterung, und das funktioniert in einigen Ländern.”
Aus Kallas spricht das neue Selbstbewusstsein der kleinen nordischen Staaten. Auch gegenüber dem großen Deutschland. “Ich habe das Gefühl, wir sind in den vergangenen Jahren mehr gehört worden als jemals zuvor.” Im Gespräch mit Table.Briefings erklärte sie, dass man lange einen ganz anderen Eindruck gehabt habe. “Über die 50 Jahre, die wir besetzt waren, wissen die Deutschen recht wenig. Sie haben uns nicht vermisst, aber wir sie schon! Darüber müssen wir reden.”
Das tut sie. Sehr deutlich auch, wenn sie mit Deutschen spricht. Und sie erwähnt dabei immer wieder, dass man in Estland nicht vergessen habe, welche Politik Deutschland gegenüber Russland lange verfolgt habe. Ihre Kritik verpackt die Regierungschefin eines Staates mit 1,3 Millionen Einwohnern dann mit einem süffisanten Lächeln: “Wir wissen, wie Russland operiert und wohin das führen kann.”
Ihre drastischen Worte scheinen den russischen Machthaber zumindest zu ärgern. Im Februar setzte das russische Innenministerium die estnische Regierungschefin auf eine Fahndungsliste. Kallas Regierung hatte die Demontage ehemaliger sowjetischer Denkmäler veranlasst. “Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass ich das Richtige tue”, schrieb sie daraufhin unerschrocken auf X. Man darf gespannt sein, wie sie als potenzielle EU-Außenbeauftragte mit dem Russland-Freund Viktor Orbán umgehen wird.
Als die Juristin und dreifache Mutter als erste Frau 2021 Premierministerin wird, zählte sie zu den beliebtesten Politikerinnen. So populär sie heute auf der europäischen Bühne ist, so sehr hat ihr Image im eigenen Land jedoch gelitten. Eine Affäre um ihren Ehemann, der auch nach dem Februar 2022 mit einem Logistikunternehmen Geschäfte mit Russland gemacht hat, schadete ihr nachhaltig.
Bei der Wiederwahl 2023 gelang Kaja Kallas mit der liberalen Reformpartei zwar ein knapper Sieg. Aber ihre Zustimmungswerte sanken rapide, auch weil gestiegene Energiepreise und unpopuläre Sparmaßnahmen die Esten verärgern. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ihre Kandidatur für ein europäisches Amt in Estland breit unterstützt wird.
Längst macht Kallas keinen Hehl mehr aus ihren Karriereplänen. Und man läge wohl nicht falsch mit der Behauptung, die 47-Jährige sehe ihre Zukunft eher in Brüssel denn in Tallinn. “Estland ist zu klein für sie”, urteilt denn auch Elisabeth Bauer, lange für die Konrad-Adenauer-Stiftung in den nordischen Ländern unterwegs: “Sie ist eine leidenschaftliche Europäerin”. Und auch eine mit Erfahrung: Die ehemalige Europaabgeordnete – zwischen 2014 und 2018 – weiß, wie Brüssel tickt.
Ihre Kandidatur für das Amt der EU-Außenbeauftragten kann man durchaus auch als Signal lesen. Eines, das der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni gar nicht gefällt. Mit Kallas gewinnt der Norden an Einfluss, nicht nur in der EU, auch in der Nato: Für den Posten des Nato-Generalsekretärs war sie übrigens auch mal im Gespräch. Nana Brink
