überzeugte Europäer und Demokraten kann nur beunruhigen, was am Wochenende bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg zu hören war. Spitzenkandidat Maximilian Krah schwadronierte über Familienalben und Volkszugehörigkeit, Co-Parteichefin Alice Weidel will Europa in eine “Festung” verwandeln. Mehrere erfolgreiche Kandidaten auf den Spitzenplätzen waren vom Rechtsaußen-Lager der Partei unterstützt worden.
Dessen Galionsfigur Björn Höcke provozierte mit der Aussage: “Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.” Angeblich will er einen neuen europäischen Staatenbund. Noch nicht vom Tisch ist außerdem die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Union. Bis in den Januar könnte sich die Verabschiedung des Wahlprogramms hinziehen, diesen Freitag sollen jedenfalls weitere Kandidaten aufgestellt werden.
Das spalterische Potenzial zeigt sich auch beim Blick auf die Vorbilder der AfD. Die Partei präsentiere sich als Sprachrohr Putins, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber. Krah wird wegen seiner Nähe zu China kritisiert und mehrere Bewerber nannten als Vorbild den Rechtspopulisten Orban.
In den kommenden Monaten wird es auch darauf ankommen, zu entlarven, wessen Sprache sich AfD-Politiker bedienen, wenn sie von “Globalisten” oder “Remigration” reden. Auch Falschaussagen dürften bis zum Wahltermin zunehmen, wie es sich in Madgeburg bereits zeigte: Sei es zur imaginierten “Bargeldabschaffung” oder zu falsch dargestellten Quoten aus dem Asylkompromiss. Gefragt sind also wache Augen und Ohren und ein klarer europäischer Kurs.

Überall auf der Welt befassen sich Regierungen mit der Frage, wie sie die Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser mächtigen Technologie minimieren können. Deutschland verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, im Gespräch mit Table.Media.
Auch das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) sieht keinen Anlass, in Deutschland eigene Wege zu gehen. “Wir wollen Entwicklern von KI in unserem Land den Rücken stärken, indem wir den Zugang zu Daten vereinfachen und Klarheit über künftige Standards schaffen”, sagt ein Sprecher des BMDV. “Rein nationalstaatliche Regeln sind hier kontraproduktiv.“
Daher beteiligt sich die Bundesregierung an verschiedenen internationalen Regulierungsprozessen – mit verteilten Verantwortlichkeiten. Während das Wirtschafts- und das Justizministerium bei den Verhandlungen zum AI Act in der EU federführend sind, ist es das Digitalministerium beim G7-Hiroshima-Prozess zu generativer KI. Als Exportnation setze sich Deutschland für möglichst internationale Standards ein, “damit Entwicklungen aus Deutschland anschlussfähig sind und umgekehrt”, sagt der Sprecher des BMDV. Dort legt man Wert darauf, Entwicklungen nicht auszubremsen, “indem wir zu viele, komplizierte Regeln aufstellen”. Darum werbe Deutschland auf G7-Ebene “für klare Transparenzregeln, die Freiräume für Innovationen lassen”.
Auch Christmann sagt: “Wir dürfen in diesem frühen Stadium die Entwicklung nicht abwürgen. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa unattraktiv wird für die Entwickler von KI.” Klar sei aber auch, dass wir Leitplanken für KI brauchen, die die Grundrechte betreffen. “So etwas wie Social Scoring oder eine anlasslose biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum hat in einer Demokratie nichts zu suchen.”
Christmann ist gerade von einer US-Reise zurückgekehrt, bei der sie in Kalifornien unter anderem KI-Forscher und -Unternehmer getroffen hat. “In den USA gibt es kein Verständnis dafür, diese innovative Technologie so hart zu regulieren”, sagt sie. “Wir müssen Regulierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung ins Gleichgewicht bringen.” Dabei sei auch wichtig zu bedenken, dass KI-Unternehmen in Europa gerade erst entstehen und Europa daher andere Voraussetzungen habe als etwa die USA. Dennoch: “Wir dürfen nicht immer nur neidisch auf die USA schauen. Unsere Start-up-Szene wird immer besser.”
Dass die Amerikaner jetzt nicht abgewartet haben bis sich die G7 oder die EU auf Leitplanken oder Regeln für KI geeinigt haben, sondern ihre Unternehmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gebracht haben, sieht Christmann sportlich. “Es ist wichtig, mit den großen Technologieunternehmen im Austausch zu sein, gerade um Bias zu vermeiden.” Und es sei richtig, die Modelle, die bereits da sind, auf eine vernünftige Basis zu stellen. “Aber die Ansicht, dass eine Selbstverpflichtung allein ausreichend ist, teile ich nicht“, betont sie.
Nach der Sommerpause in Brüssel treten die Trilog-Verhandlungen in die heiße Phase ein. Ziel ist es, diese noch unter spanischer Ratspräsidentschaft abzuschließen. Auch Christmann hält es für wichtig ist, die Verhandlungen zum AI Act zeitnah abzuschließen, um eine verlässliche Regulierung zu haben. “Solange unklar ist, was kommt, halten sich die Investoren zurück. Das ist keine gute Situation.” Das Gesetz müsse vor den Europawahlen fertig sein.
Deutschland hatte zur allgemeinen Ausrichtung des Rates einige Anmerkungen gemacht und unter anderem gefordert, dass nur relevante und verhältnismäßige Anforderungen für Allzweck-KI-Systeme (GPAI) gelten sollten. Und verwies darauf, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich war dies noch bevor die Diskussion über ChatGPT die Öffentlichkeit erreichte.
Das bedeutet, die Diskussionen – auch im Rat – sind noch nicht beendet. “Wir müssen uns die Frage stellen, ob die Regulierung ihren Zweck erfüllt, die Technologie zum Wohle der Menschen zu gestalten oder ob sie die Entwicklung abwürgt“, mahnt Christmann. Es sei richtig, die Regulierung auf Hochrisikoanwendungen zu beschränken. Im Moment gehe es in Europa jedoch um immer mehr Detailregulierung. “Das führt zu erschwerten Bedingungen, gerade für junge KI-Unternehmen, wie wir sie in Europa haben.”

Beispiel: “Ich kann nicht einsehen, warum es Unternehmen auferlegt werden soll, zusätzlich eine Grundrechtsfolgenabschätzung zu machen, wie es das EU-Parlament vorschlägt” kritisiert Christmann. Denn das sei aufwändig bis unmöglich, gerade für junge Unternehmen. Allerdings war es die Fraktion der Grünen/EFA, die das Fundamental Rights Assessment in den Gesetzesvorschlag eingebracht haben.
Was in den kommenden Verhandlungen für Deutschland noch wichtig ist? “Gute Entwicklungsbedingungen für KMU und Start-ups zu schaffen”, sagt Christmann. “Wir brauchen Experimentierfelder. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren, bevor die volle Regulierung greift.” Deswegen lege die deutsche Seite Wert auf die Etablierung von Reallaboren und dass es zeitliche Ausnahmen für KMU gibt.
Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von Ausnahmen innerhalb der Hochrisikobereiche. Sodass etwa für Putzroboter im Krankenhaus nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten wie zum Beispiel für Patientenakten. “Hier arbeiten wir an Lösungen, die Diskussion läuft noch”, sagte Christmann.
Da der Rat seine Allgemeine Ausrichtung bereits beschlossen hatte, bevor die Diskussion über Gründungsmodelle (Foundation Models) oder generative KI (wie ChatGPT) an Dynamik gewann, hatten die Mitgliedstaaten das Thema kaum beleuchtet. “Es ist richtig, dass das EU-Parlament Foundation Models aufgegriffen hat”, meint Christmann. Doch welche Regulierung dafür angemessen sei, dazu führe die Bundesregierung noch Gespräche. Die Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Beschluss der Ratsposition viel stärker verändert als sonst. Daher sei der Bedarf, an konkreten Lösungen zu arbeiten, größer.
Digitalminister Wissing hat dazu in der FAZ schon mal einen Vorschlag gemacht: Er stellt sich für generative KI eine verpflichtende Selbstregulierung vor. Allerdings warnt auch er davor, die Formulierung allein den großen US-Tech-Firmen zu überlassen. Zudem müsse es bereits nach zwei Jahren eine Überprüfung geben. Dann könne man einschätzen, ob ein Code of Conduct für generative KI als Ergänzung zum AI Act ausreiche – oder ob es doch einer harten Regulierung und der Integration in das Gesetz bedarf.
Derweil hat die Diskussion über die Umsetzung des AI Acts noch nicht begonnen. Eines kann Christmann aber bereits dazu sagen: “Wir wollen aber die Fehler der DSGVO vermeiden und es nicht wieder zu 16 verschiedenen Auslegungen der Regeln kommen lassen.” Die Lösung könnte eine zentrale Stelle sein, ein AI Office – etwa so, wie es das EU-Parlament vorgeschlagen hat. Aber auch da gibt es Klärungsbedarf. “Ein europäisches AI Office darf nicht zum Nadelöhr für die KI-Zulassung in ganz Europa werden”, warnt Christmann.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
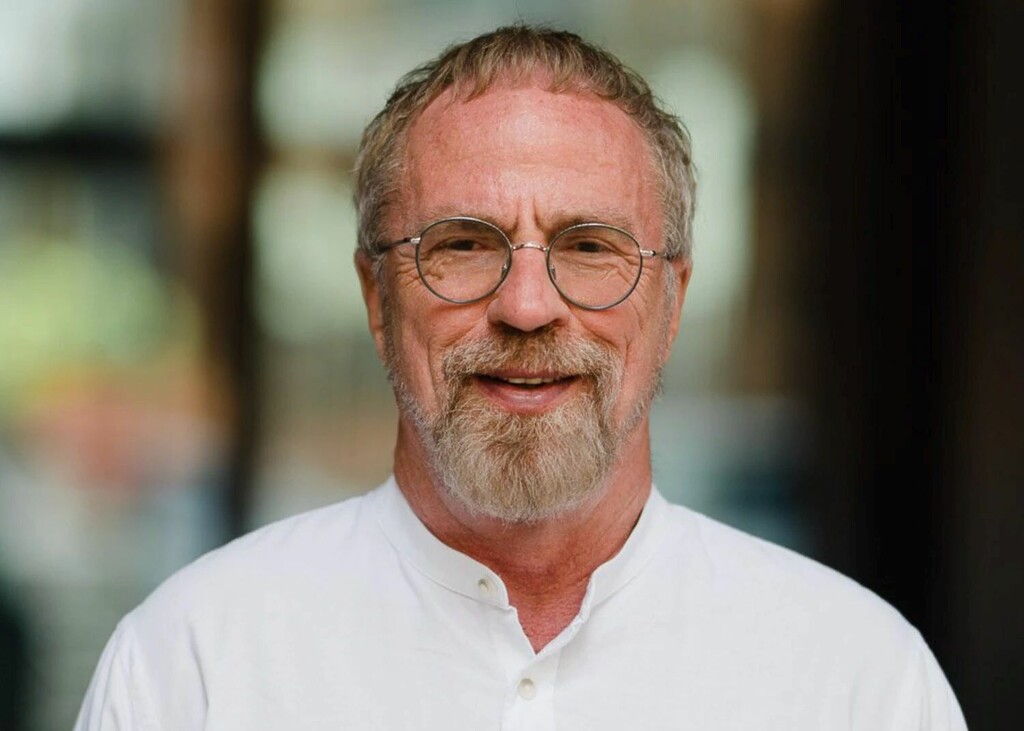
Herr Professor Uszkoreit, Sie haben gerade ein deutsches ChatGPT-Start-up gegründet, das auch einen Standort in China hat. Worum geht es dabei?
Wir haben das Start-up Nyonic in Berlin gegründet. In Shanghai haben wir ein Forschungsteam. Wir wollen zwei Schwächen von ChatGPT angehen. Die heutigen Sprachmodelle sind zu stark auf das Englische und vielleicht noch auf das Chinesische zentriert. Das wollen wir ändern. Und wir wollen ChatGPT für bestimmte Branchen zu einem verlässlichen Arbeitstool machen, was es heute noch nicht ist.
Warum die verschiedenen Sprachen? Englisch ist doch Weltsprache und Chinesisch auf dem Weg dorthin.
Weil viel europäisches Wissen noch gar nicht in Englisch vorliegt, sondern nur in den jeweiligen europäischen Sprachen. Zudem sollen die KI-Systeme für Anwender in aller Welt den gleichen Nutzen bringen. Die Sprachpluralität ist ein Riesenschritt für ChatGPT und wichtig für eine multipolare Welt. Die Mehrheit der Welt ist multilingual. Die USA können es sich leisten, anglozentrische Technologie zu haben. China kann es sich leisten, China-Technologie zu machen. Aber die Mehrheit der Welt, Südostasien, Afrika und eben Europa sind darauf angewiesen, dass viele Sprachen und Kulturen abgedeckt werden.
Warum machen Sie sich die Mühe? Sie sind ja mit 73 Jahren doch schon im Pensionsalter. Sie sind und bleiben ein Pionier der europäischen KI. Sie könnten die Füße hochlegen.
Alle in unserem Team, unabhängig vom Alter, wollen natürlich die größte Revolution in der KI zu unseren Lebzeiten mitgestalten. Hinzu kommt unser Wunsch, dass Europa sich diesmal nicht von den USA und China abhängen lässt. Wir haben sehr viele kluge Leute und viele Innovationen kamen aus Europa. Doch dann haben wir es immer wieder vermasselt. In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT. In der EU gerade mal drei. In Deutschland gibt es erst eines, das bis jetzt auch noch nicht zu den besten zählt. Das wollen wir ändern.
Das Thema künstliche Intelligenz ist ja nicht neu. Sie beschäftigen sich seit mehr als 30 Jahren damit. Was ist denn neu mit ChatGPT, dass es nun die große Aufregung gibt?
Das System hat nun etwas erreicht, was wir beim Menschen Verständnis nennen. Es ist zwar bei der Maschine anders definiert, denn die Maschine hat nicht unser holistisches Weltbild und passt auch ihr Wissen nicht an Aussagen der Benutzer an. Aber die Wirkung ist die gleiche: Die Maschine benimmt sich in ihren Antworten so, als würde sie die Eingaben tatsächlich verstehen.
Wo liegen die Schwächen von ChatGPT?
ChatGPT ist zwar superschlau, hat aber auch erstaunliche Wissenslücken, die es manchmal durch Fantasie ausfüllt. Man kann sich noch nicht voll auf seine Kenntnisse und sein Urteil verlassen.
In der nächsten Version wird das doch sicher behoben?
Das wird Sie überraschen: Es gibt leider noch keine verlässliche Methode, nach der ich die Maschine ausbilden kann, um das zu bekommen, was ich möchte. Das ist alles noch Trial-and-Error. Mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Es gibt kein Curriculum, sondern ich füttere einfach Daten in Riesenschläuche ein und warte was passiert. Wir wissen nicht wirklich, was die Maschine dabei macht. Wenn das Ergebnis kommt, sagen wir: Schön gelernt, aber liebe Maschine, du sollst nicht alles glauben, was du gelesen hast. Und sag nicht alles, was du glaubst. Dann füttern wir gezielt Daten, um das Verhalten der Maschine zu korrigieren oder zu verbessern und schauen wieder, was herauskommt.
Böse Menschen können KI missbrauchen. Das muss man doch verhindern.
Ja, wir brauchen Regeln, insbesondere Regeln, für die speziellen kritischen Einsatzgebiete der KI. Aber diejenigen, die diese Regeln entwerfen, sollten der Versuchung widerstehen, eine solch komplexe Technologie wie die KI als Ganzes regulieren zu können. Bis das Gesetz Gültigkeit erlangt, hat sich die KI schon wieder weiterentwickelt. Ich habe derzeit mehr Sorge vor maßloser Regulierung, als vor bösen KI-Systemen. Diese Gefahr ist in Europa viel größer als in den USA oder China.
Was ist die Folge?
Selbst Forschung, die eine immer mächtigere KI durch geeignete Kontrolltechnologien zähmen und kontrollierbar machen will, könnte durch eine zu strenge Regulierung behindert werden. Am gefährlichsten sind immer die Meta-Regulierer, die Regeln wollen, die für alles gelten.
Aber Deutschland hat ja auch eine Verfassung, ein Grundgesetz.
Aber es ergibt keinen Sinn, für eine neue Technologie, die sich sehr schnell weiterentwickelt, zuerst eine Art Grundgesetz zu erfinden, wenn man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Viel sinnvoller ist, die KI für den jeweiligen Anwendungsbereich zu regulieren. Also KI fürs Autofahren, KI für die Pharmaindustrie, für die Luftfahrt oder die Schule. Das macht nicht nur Sinn, das ist auch wichtig. Und jedes Gebiet hat ganz andere Anwendungsbedingungen. So machen es auch die Chinesen. Und dann kann man aus der Schnittmenge dieser einzelnen Regulierungen in ferner Zukunft eine Art KI-Verfassung destillieren.

Die KI wird die Welt so nachhaltig verändern wie die Erfindung der Elektrizität. Wenn ich sage, wir brauchen zentrale Regelungen für die Nutzung von Elektrizität, dann merkt man sofort, das ist Quatsch. Oder die Dampfmaschine. Wenn ich die in einer Fabrik benutze, dann braucht sie andere Regeln, als wenn ich sie in einer Lokomotive einsetze. Die KI ist und bleibt erstmal ein Werkzeug des Menschen und ist nicht etwa ein Wettbewerber des Menschen.
Warum ist diese Angst, im Vergleich zu Asien und den USA in Europa, besonders in Deutschland und Frankreich so stark ausgeprägt?
Das ist eine gute Frage. Und wichtig dabei ist, anzuerkennen, dass es so ist. Vielleicht ist es ein hilfloser Versuch der Europäer, ihren schwindenden Einfluss in der Welt zu kompensieren, indem sie versuchen, mit ihren Regeln die Metaebene zu besetzen. Die stärkere Regulierungssehnsucht ist in dem Maße gewachsen, in der sie keine Weltmächte mehr haben. In Europa, besonders in Deutschland sind Medikamente verschreibungspflichtig, die es in den USA einfach im Supermarkt zu kaufen gibt. In Europa orientiert man sich auch eher an unwahrscheinlichen Ausnahmen, als an der täglichen Realität. Es scheint fast eine große Lust, sich um Risiken zu sorgen, als die Technologie mit Können und vollem Einsatz zum Erfolg zu bringen.
In den USA und China konzentriert man sich pragmatischer auf die wahrscheinlichsten Varianten.
In der EU hat die politische Aufgabenteilung zwischen Mitgliedstaaten und zentralisierter Regulierung zu einer ganz speziellen Entwicklung geführt. Anstatt eine zeitgemäße flexible Kombination von kodifiziertem Recht und Fallrecht anzustreben, die der Dynamik und Vielfalt unseres Kontinents gerecht wird, treibt diese Machtverteilung das europäisch kontinentale Rechtssystem der Kodifizierung mit einem Mammutaufwand ins Extrem.
Diese Tendenz trifft zusammen mit der Hoffnung, dass man über Gesetzgebung die Welt vom Übel befreien kann, dass man durch Regulierung der ganzen Welt seine eigene Ethik aufzwingt. Das bremst uns nun, und die Welt, die Brics-Staaten voran, hat keine Lust mehr, die Regeln zu übernehmen. Hinzu kommt noch, dass in Deutschland die Angst stärker geschürt wird als in anderen Ländern. Inzwischen ist ein eigener Berufszweig von selbsternannten AI-Ethikern, AI-Juristen und Algorithmen-Jägern entstanden. Die leben gut davon, Angst zu schüren. Das sind Menschen, die sich genau genommen gar nicht richtig mit KI auskennen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es die besten Juristen und Sozialwissenschaftler sind, die sich in diesem Feld tummeln.
Das andere Extrem wäre auch nicht günstig: Jede Anwendung muss gesondert zertifiziert werden, weil nur wenig zentral geregelt wird.
Das ist die Befürchtung des Mittelstands und besonders des Handwerks und der Kleinbetriebe. Wenn sie alles gesondert zertifizieren müssen, dann dauert das so lange und wird so teuer, dass der Mittelstand sagt: Das lohnt sich für uns nicht. Wir müssen also mehr denn je die Zertifizierungsanforderungen auf die wirklich kritischen Bereiche beschränken und den Produzenten sowie den Anwendern eine Beweislast nur dort aufbrummen, wo es tatsächlich Sonderfälle und Grund zur Besorgnis gibt. Und mithilfe der Technologie kostengünstige Testverfahren bereitstellen. Vor allem müssen wir schauen: Was ist im Alltag praktikabel. Ich bin nun sehr gespannt, ob Deutschland und die EU das diesmal hinbekommen oder wieder so handeln, als könnten sie noch die Regeln der Welt bestimmen.
Hans Uszkoreit, 73, hat in Deutschland, aber auch lange in den USA und in China gearbeitet – als Universitätsprofessor, Forschungsmanager, Industrieberater und Mitgründer mehrerer Start-ups. Er gilt als einer der führenden europäischen KI-Forscher. Uszkoreit ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er hat deutsche und internationale Forschungsverbünde initiiert und koordiniert, leitete mehrere der bekanntesten europäischen Projekte. Uszkoreit ist Autor von mehr als 250 internationalen Publikationen. Jüngst hat er das Berliner ChatGPT-ähnliche Start-up Nyonic gegründet – zusammen mit einem Forschungsteam in Shanghai. Seine Gattin Xu Feiyu ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
*Das vollständige Interview finden Sie bei China.Table.
Die EU-Kommission will Spielzeug besser vor schädlichen Chemikalien schützen und den Online-Handel wirksamer regulieren. Das sieht eine am Freitag vorgestellte Verordnung vor, welche die Spielzeug-Richtlinie von 2009 ersetzen soll. Mit dem Vorschlag werde unlauterer Wettbewerb beseitigt und noch mehr für die Sicherheit von Kindern getan, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Künftig werde es beispielsweise verboten sein, Chemikalien in Spielzeug zu verwenden, die das Hormon- oder das Atmungssystem beeinträchtigen oder für ein bestimmtes Organ toxisch sind, teilte die Kommission mit. Bereits verboten sind Stoffe, die krebserregend, erbgutverändernd oder schädlich für die Fortpflanzungsfähigkeit sind.
Ein neuer digitaler Produktpass soll es vor allem ermöglichen, unsicheres Spielzeug an den Außengrenzen leichter aufzuspüren. Ein neues IT-System soll Sendungen ermitteln, die eingehende Zollkontrollen erfordern. Für Kontrollen bleiben die Mitgliedstaaten zuständig. Die Kommission kann künftig allerdings verlangen, dass Spielzeug vom Markt genommen wird, dessen Risiken in der Verordnung nicht eindeutig geregelt sind.
“Wenn dies Gesetz wird, wäre es weltweit das erste Mal, dass sowohl bekannte als auch vermutete hormonschädigende Chemikalien aus einer ganzen Produktgruppe verbannt werden“, teilte der Verbraucherdachverband BEUC mit. Derlei Chemikalien könnten Unfruchtbarkeit, eine verfrühte Pubertät oder Adipositas zur Folge haben. Kritisch sind vor allem Spielzeuge, die Babys in den Mund nehmen.
Auch Europaabgeordnete begrüßten die geplanten Verschärfungen. Näher untersucht werden müsse, ob allein der digitale Produktpass ausreiche, um unsicheres Spielzeug aus dem Verkehr zu ziehen, sagte Schattenberichterstatterin Marion Walsmann (CDU). Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, teilte mit, Spyware in Smart Toys gehöre nicht ins Kinderzimmer. ber
Die italienische Regierung kann auf eine Zahlung von weiteren 18,5 Milliarden Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) hoffen. Die Kommission befürwortete am Freitag vorläufig 54 Etappenziele und Zielvorgaben aus Italiens drittem Zahlungsantrag. Vor der endgültigen Freigabe der Mittel aus dem Corona-Aufbauinstrument NextGenerationEU müssen noch die Vertreter der Mitgliedstaaten im Wirtschafts- und Finanzausschuss zustimmen.
“Italien hat große Fortschritte bei der Umsetzung wichtiger Reformen und Investitionen gemacht, die in seinem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehen sind”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie nannte die Reform des Gesundheits-, Justiz- und Steuersystems sowie Investitionen in digitale öffentliche Dienste und in einen nachhaltigeren öffentlichen Verkehr. In den vergangenen beiden Jahren hatte Italien bereits zweistellige Milliardenbeträge aus der ARF erhalten.
Die Kommission brachte am Freitag außerdem die vierte Tranche einen Schritt voran. Sie stimmte Änderungen des Aufbau- und Resilienzplans zu, die Italien beantragt hatte. Darunter die Förderung von beschleunigten Investitionen in Energieeffizienz sowie in Forschung und Entwicklung in der Industrie. Den Änderungen muss noch der Rat zustimmen. ber
Nach der Auszählung von Auslandsstimmen der Parlamentswahl in Spanien vergrößert die konservative Volkspartei (PP) ihren Vorsprung vor den bisher regierenden Sozialisten (PSOE). Gegenüber dem bisherigen Zwischenergebnis verliert die PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez ein Mandat in der Hauptstadt Madrid an die PP des Herausforderers Alberto Núñez Feijóo, wie die Wahlkommission und beide Parteien am Samstag mitteilten. Das folge aus der Auszählung der Stimmen von mehr als 233.000 Spaniern, die im Ausland leben.
Damit wird es für Sánchez noch schwieriger, eine Mehrheit im Parlament zu finden, während Feijóo unverändert geringe Aussichten auf hinreichende Unterstützung hat. Für eine absolute Mehrheit ist der Rückhalt von mindestens 176 der 350 Abgeordneten erforderlich. Zuletzt waren den Sozialisten und ihren möglichen Verbündeten 172 Mandate zugerechnet worden, während die Volkspartei und ihre möglichen Partner auf 170 Sitze kamen. Nach der Auszählung der Auslandsstimmen liegen nun beide Gruppen gleichauf bei jeweils 171 Abgeordneten, darunter auf der einen Seite 137 der Volkspartei und auf der anderen Seite 121 der Sozialisten. rtr
Frankreich will einen besseren Zugang zum chinesischen Markt und eine “ausgewogenere” Handelsbeziehung – nicht aber eine Entkopplung von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das betonte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag. Er wolle nicht auf gesetzgeberische oder andere Hürden beim Zugang zu den chinesischen Märkten stoßen, sagte Le Maire bei einer Pressekonferenz in Peking. Am Samstag habe er Vizepremier He Lifeng zu “konstruktiven” Handelsgesprächen getroffen, sagte der französische Minister.
Le Maire sprach sich gegen ein deutliches Decoupling aus und relativierte in Sachen De-Risking: “Der Risikoabbau bedeutet nicht, dass China ein Risiko darstellt”, sagte Le Maire. “De-Risking bedeutet, dass wir unabhängiger sein wollen und dass wir in unseren Lieferketten keinem Risiko ausgesetzt sein wollen, wenn es zu einer neuen Krise wie der Covid-Krise mit dem völligen Zusammenbruch einiger Wertschöpfungsketten kommen würde.”
Beim Treffen mit He Lifeng sei der Marktzugang Kern der Gespräche gewesen, erläuterte Le Maire. Der Minister erklärte, Frankreich sei auf dem richtigen Weg und ebne den Weg für einen besseren Zugang für französische Kosmetika zum chinesischen Markt. Dem Minister zufolge hoffe China, dass Frankreich den Ton in den Beziehungen zwischen der EU und China “stabilisieren” könne. Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Paris in einigen Bereichen zu vertiefen.
China ist Frankreichs drittgrößter Handelspartner. Auf die Befürchtungen einiger europäischer Autohersteller angesprochen, dass billige chinesische Elektrofahrzeuge den europäischen Markt überschwemmen könnten, sagte Le Maire, Frankreich wolle die französischen und europäischen Subventionen für Elektrofahrzeuge besser bündeln und so die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auch eine Zusammenarbeit mit China schloss er nicht aus: “Wir sind bereit, chinesische Investitionen in der Automobilindustrie in Frankreich und in Europa zu haben.” rtr/ari
Nach dem Militärputsch in Niger droht Frankreich mit einem Eingreifen, wenn eigene Interessen verletzt würden. Gegen die Botschaft in Niamey flogen am Sonntag Steine. Die Regierung in Paris verurteilte den Gewaltausbruch. Jeglicher Angriff auf französische Staatsangehörige oder Interessen in Niger werde eine unverzügliche und strikte Reaktion Frankreichs nach sich ziehen, erklärte das Präsidialamt. Das Außenministerium forderte die Machthaber in Niger auf, die französische Botschaft nach internationalem Recht zu schützen.
Die EU hatte am Samstag Hilfen für Niger gestoppt. “Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt”, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Niger war bislang Empfänger umfangreicher westlicher Hilfen und Partner der EU bei der Eindämmung der Migration aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die EU hatte im Haushalt 503 Millionen Euro Fördermittel für die Zeitspanne 2021 bis 2024 bereitgestellt.
Am Sonntag verhängten auch die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) Sanktionen gegen Niger. Bei einem Krisengipfel in Nigeria drohten sie zudem mit einem gewaltsamen Einschreiten. Der Ecowas gehören 15 Staaten an. Ähnliche Sanktionen nach Staatsstreichen in anderen Ländern blieben allerdings ohne große Wirkung. rtr

Die EU-Kommission will eine europäische Satellitenkonstellation aufbauen. Das Programm IRIS2 – Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites – steht dafür, Europas Souveränität zu sichern. Zwischen 2025 und 2027 sollen bis zu 170 LEO-Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit) gebracht werden. Mehr als drei Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln stellen Brüssel und die Europäische Weltraumagentur ESA zur Verfügung.
Ausschließlich europäische Firmen sollen am Programm beteiligt sein. Das Ziel ist, im Krisenfall autonom handlungsfähig zu sein. Der verantwortliche Binnenmarktkommissar Thierry Breton, betonte 2022: “This is historic! After Galileo and Copernicus, we are adding a third constellation to our European portfolio of strategic space infrastructures! […] IRIS² will be a New Space constellation … integrating the know-how of the major European space industries-but also the dynamism of our start-ups, who will build 30% of the infrastructure!”
Als Start-up, das innovative Dual-Use-Satelliten baut, hat sich Reflex Aerospace viel von IRIS² versprochen. Doch bereits im EU-Gesetzgebungsprozess kam die Sorge auf, das Programm diene vor allem Frankreichs Interessen und seinen gut aufgestellten Raumfahrtkonzernen. Deutschland – als größter Beitragszahler sowohl der EU als auch der ESA – setzte sich dagegen von Anfang an für eine Beteiligung von KMU (kleine und mittlere Unternehmen) sowie Firmen aus dem schnell wachsenden New Space Ökosystem ein.
Dieses umfasst junge Unternehmen mit frischen Ideen, die dank ihrer optimierten Prozesse und verbesserten Produkte die traditionellen Akteure der Raumfahrt herausfordern. In Europa sind das meist (halb-) staatliche Großunternehmen. Gerade in Deutschland hat sich eine strukturell bedeutsame New-Space-Branche herausgebildet. Die ist mittels Micro-Launchern, eigenem Satellitenbau und Laserkommunikation in der Lage, eine eigene Konstellation aufzubauen!
Dabei war es ausdrücklich vorgesehen, KMU sowie New Space Firmen bei IRIS² einzubinden. So jedenfalls steht es in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 15. März 2023 (EU 2023/588): “Das Programm [IRIS² sollte] die Nutzung innovativer und disruptiver Technologien sowie neuartiger Geschäftsmodelle, die durch das europäische Weltraumökosystem – einschließlich New Space – entwickelt wurden, maximieren, insbesondere durch KMU, Midcap-Unternehmen und Start-ups …”. Bei Unteraufträgen im Wert von mehr als zehn Millionen Euro sei anzustreben, “dass mindestens 30 Prozent des Vertragswerts mittels Ausschreibungen auf verschiedenen Ebenen als Unteraufträge an Unternehmen vergeben werden, die nicht zum Konzern des Hauptbieters gehören …”!
Soweit die Theorie. Direkt bewerben konnten sich “die Kleinen” im Bieterprozess um den Hauptteil der Konstellation leider nicht. Der Prozess startete am 23. März 2023 und die EU-Kommission hatte für die Teilnahme unter anderem einen Mindestjahresumsatz von 500 Millionen Euro vorausgesetzt. Bereits am 2. Mai 2023 gaben die etablierten Raumfahrtkonzerne Europas – darunter Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, OHB, SES, Telespazio und Thales Alenia Space – die Bildung eines “offenen” Konsortiums bekannt. Diese Konzentration auf die althergebrachten Raumfahrtunternehmen – ohne den Wettbewerb durch ein zweites Konsortium sowie unter Ausschluss von New Space – ist gefährlich für Europas Innovationskraft!
Die Konzerne sind heute im Rahmen von IRIS² in der Lage, unliebsame Wettbewerber bei entsprechenden Unteraufträgen zu übergehen und kleinzuhalten. Selbst Zulieferungen von New Space Firmen oder KMU bleiben optional. Die Maßgabe, 30 Prozent der Unteraufträge an Start-ups und Kleinunternehmen zu vergeben, ist keine zwingende Voraussetzung der EU-Ausschreibung.
Gleichzeitig sorgt die von Brüssel gewünschte Bündelung von Forschungsaufgaben bei wenigen Konzernen dafür, dass sich KMU oder aufstrebende Start-ups gar keine Kompetenzen in so wichtigen Bereichen wie etwa der Krypto-Kommunikation aneignen beziehungsweise sich überhaupt weiterentwickeln können. In Deutschland verfolgen die Start-ups besorgt, ob sich die gewünschte “Impulswirkung” von IRIS² für die europäische Raumfahrtwirtschaft entfaltet oder der “Spillover-Effekt” insbesondere auf das New Space Ökosystem in der jetzigen Konstellation gänzlich ausbleibt.
Reflex Aerospace schafft es zum Beispiel, das Design und die Produktion eines Satelliten in unter einem Jahr umzusetzen – während etablierte Hersteller für Entwicklung und Fertigung von Satelliten bis zu vier Jahre kalkulieren. Als reiner Zulieferer wird Reflex Aerospace mit seinem disruptiven Ansatz wohl kaum zum Einsatz kommen. Welches Mitglied eines Konsortiums beauftragt seinen direkten Wettbewerber, der mithilfe von agiler Produktentwicklung und additiver Fertigung deutlich schneller und billiger am Markt agiert, wenn dieser Konzern seine eigenen Produkte im Rahmen von IRIS² garantiert teurer verkaufen kann?
Im All zeigt sich, dass schnelle Entwicklung und günstige Reproduktion wichtig sind, um eine Satellitenkonstellation technologisch auf dem neuesten Stand zu halten. Satelliten werden heute etwa alle fünf Jahre erneuert. Optimierte Fertigungszeit bedeutet auch, in der Lage zu sein, verbesserte Technologien schneller einzusetzen und noch sichererer über Satelliten zu kommunizieren. Leider schöpft IRIS² sein Innovationspotenzial hier nicht aus.
Insbesondere für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Eine wichtige Zukunftsindustrie, die bereits Hightech-Arbeitsplätze schafft, wird von öffentlichen Großaufträgen wissentlich ausgeschlossen. Die europäische Konstellation profitiert nicht. Sie bindet sich auf Jahre an die traditionellen Konzerne – mitsamt ihres Business as usual und allen Kosten, die das Großkonsortium mit sich bringt!
Noch ist es nicht zu spät, das New Space Ökosystem, bei IRIS² einzubinden:
Wir benötigen aktive Politik in Berlin und Brüssel, um den Raumfahrtstandort Deutschland zu stärken und weiter auszubauen.
Dennis Moore ist Vice President of Sales & Business Development bei Reflex Aerospace.
überzeugte Europäer und Demokraten kann nur beunruhigen, was am Wochenende bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg zu hören war. Spitzenkandidat Maximilian Krah schwadronierte über Familienalben und Volkszugehörigkeit, Co-Parteichefin Alice Weidel will Europa in eine “Festung” verwandeln. Mehrere erfolgreiche Kandidaten auf den Spitzenplätzen waren vom Rechtsaußen-Lager der Partei unterstützt worden.
Dessen Galionsfigur Björn Höcke provozierte mit der Aussage: “Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.” Angeblich will er einen neuen europäischen Staatenbund. Noch nicht vom Tisch ist außerdem die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Union. Bis in den Januar könnte sich die Verabschiedung des Wahlprogramms hinziehen, diesen Freitag sollen jedenfalls weitere Kandidaten aufgestellt werden.
Das spalterische Potenzial zeigt sich auch beim Blick auf die Vorbilder der AfD. Die Partei präsentiere sich als Sprachrohr Putins, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber. Krah wird wegen seiner Nähe zu China kritisiert und mehrere Bewerber nannten als Vorbild den Rechtspopulisten Orban.
In den kommenden Monaten wird es auch darauf ankommen, zu entlarven, wessen Sprache sich AfD-Politiker bedienen, wenn sie von “Globalisten” oder “Remigration” reden. Auch Falschaussagen dürften bis zum Wahltermin zunehmen, wie es sich in Madgeburg bereits zeigte: Sei es zur imaginierten “Bargeldabschaffung” oder zu falsch dargestellten Quoten aus dem Asylkompromiss. Gefragt sind also wache Augen und Ohren und ein klarer europäischer Kurs.

Überall auf der Welt befassen sich Regierungen mit der Frage, wie sie die Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser mächtigen Technologie minimieren können. Deutschland verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. “Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, im Gespräch mit Table.Media.
Auch das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) sieht keinen Anlass, in Deutschland eigene Wege zu gehen. “Wir wollen Entwicklern von KI in unserem Land den Rücken stärken, indem wir den Zugang zu Daten vereinfachen und Klarheit über künftige Standards schaffen”, sagt ein Sprecher des BMDV. “Rein nationalstaatliche Regeln sind hier kontraproduktiv.“
Daher beteiligt sich die Bundesregierung an verschiedenen internationalen Regulierungsprozessen – mit verteilten Verantwortlichkeiten. Während das Wirtschafts- und das Justizministerium bei den Verhandlungen zum AI Act in der EU federführend sind, ist es das Digitalministerium beim G7-Hiroshima-Prozess zu generativer KI. Als Exportnation setze sich Deutschland für möglichst internationale Standards ein, “damit Entwicklungen aus Deutschland anschlussfähig sind und umgekehrt”, sagt der Sprecher des BMDV. Dort legt man Wert darauf, Entwicklungen nicht auszubremsen, “indem wir zu viele, komplizierte Regeln aufstellen”. Darum werbe Deutschland auf G7-Ebene “für klare Transparenzregeln, die Freiräume für Innovationen lassen”.
Auch Christmann sagt: “Wir dürfen in diesem frühen Stadium die Entwicklung nicht abwürgen. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa unattraktiv wird für die Entwickler von KI.” Klar sei aber auch, dass wir Leitplanken für KI brauchen, die die Grundrechte betreffen. “So etwas wie Social Scoring oder eine anlasslose biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum hat in einer Demokratie nichts zu suchen.”
Christmann ist gerade von einer US-Reise zurückgekehrt, bei der sie in Kalifornien unter anderem KI-Forscher und -Unternehmer getroffen hat. “In den USA gibt es kein Verständnis dafür, diese innovative Technologie so hart zu regulieren”, sagt sie. “Wir müssen Regulierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung ins Gleichgewicht bringen.” Dabei sei auch wichtig zu bedenken, dass KI-Unternehmen in Europa gerade erst entstehen und Europa daher andere Voraussetzungen habe als etwa die USA. Dennoch: “Wir dürfen nicht immer nur neidisch auf die USA schauen. Unsere Start-up-Szene wird immer besser.”
Dass die Amerikaner jetzt nicht abgewartet haben bis sich die G7 oder die EU auf Leitplanken oder Regeln für KI geeinigt haben, sondern ihre Unternehmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gebracht haben, sieht Christmann sportlich. “Es ist wichtig, mit den großen Technologieunternehmen im Austausch zu sein, gerade um Bias zu vermeiden.” Und es sei richtig, die Modelle, die bereits da sind, auf eine vernünftige Basis zu stellen. “Aber die Ansicht, dass eine Selbstverpflichtung allein ausreichend ist, teile ich nicht“, betont sie.
Nach der Sommerpause in Brüssel treten die Trilog-Verhandlungen in die heiße Phase ein. Ziel ist es, diese noch unter spanischer Ratspräsidentschaft abzuschließen. Auch Christmann hält es für wichtig ist, die Verhandlungen zum AI Act zeitnah abzuschließen, um eine verlässliche Regulierung zu haben. “Solange unklar ist, was kommt, halten sich die Investoren zurück. Das ist keine gute Situation.” Das Gesetz müsse vor den Europawahlen fertig sein.
Deutschland hatte zur allgemeinen Ausrichtung des Rates einige Anmerkungen gemacht und unter anderem gefordert, dass nur relevante und verhältnismäßige Anforderungen für Allzweck-KI-Systeme (GPAI) gelten sollten. Und verwies darauf, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich war dies noch bevor die Diskussion über ChatGPT die Öffentlichkeit erreichte.
Das bedeutet, die Diskussionen – auch im Rat – sind noch nicht beendet. “Wir müssen uns die Frage stellen, ob die Regulierung ihren Zweck erfüllt, die Technologie zum Wohle der Menschen zu gestalten oder ob sie die Entwicklung abwürgt“, mahnt Christmann. Es sei richtig, die Regulierung auf Hochrisikoanwendungen zu beschränken. Im Moment gehe es in Europa jedoch um immer mehr Detailregulierung. “Das führt zu erschwerten Bedingungen, gerade für junge KI-Unternehmen, wie wir sie in Europa haben.”

Beispiel: “Ich kann nicht einsehen, warum es Unternehmen auferlegt werden soll, zusätzlich eine Grundrechtsfolgenabschätzung zu machen, wie es das EU-Parlament vorschlägt” kritisiert Christmann. Denn das sei aufwändig bis unmöglich, gerade für junge Unternehmen. Allerdings war es die Fraktion der Grünen/EFA, die das Fundamental Rights Assessment in den Gesetzesvorschlag eingebracht haben.
Was in den kommenden Verhandlungen für Deutschland noch wichtig ist? “Gute Entwicklungsbedingungen für KMU und Start-ups zu schaffen”, sagt Christmann. “Wir brauchen Experimentierfelder. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren, bevor die volle Regulierung greift.” Deswegen lege die deutsche Seite Wert auf die Etablierung von Reallaboren und dass es zeitliche Ausnahmen für KMU gibt.
Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von Ausnahmen innerhalb der Hochrisikobereiche. Sodass etwa für Putzroboter im Krankenhaus nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten wie zum Beispiel für Patientenakten. “Hier arbeiten wir an Lösungen, die Diskussion läuft noch”, sagte Christmann.
Da der Rat seine Allgemeine Ausrichtung bereits beschlossen hatte, bevor die Diskussion über Gründungsmodelle (Foundation Models) oder generative KI (wie ChatGPT) an Dynamik gewann, hatten die Mitgliedstaaten das Thema kaum beleuchtet. “Es ist richtig, dass das EU-Parlament Foundation Models aufgegriffen hat”, meint Christmann. Doch welche Regulierung dafür angemessen sei, dazu führe die Bundesregierung noch Gespräche. Die Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Beschluss der Ratsposition viel stärker verändert als sonst. Daher sei der Bedarf, an konkreten Lösungen zu arbeiten, größer.
Digitalminister Wissing hat dazu in der FAZ schon mal einen Vorschlag gemacht: Er stellt sich für generative KI eine verpflichtende Selbstregulierung vor. Allerdings warnt auch er davor, die Formulierung allein den großen US-Tech-Firmen zu überlassen. Zudem müsse es bereits nach zwei Jahren eine Überprüfung geben. Dann könne man einschätzen, ob ein Code of Conduct für generative KI als Ergänzung zum AI Act ausreiche – oder ob es doch einer harten Regulierung und der Integration in das Gesetz bedarf.
Derweil hat die Diskussion über die Umsetzung des AI Acts noch nicht begonnen. Eines kann Christmann aber bereits dazu sagen: “Wir wollen aber die Fehler der DSGVO vermeiden und es nicht wieder zu 16 verschiedenen Auslegungen der Regeln kommen lassen.” Die Lösung könnte eine zentrale Stelle sein, ein AI Office – etwa so, wie es das EU-Parlament vorgeschlagen hat. Aber auch da gibt es Klärungsbedarf. “Ein europäisches AI Office darf nicht zum Nadelöhr für die KI-Zulassung in ganz Europa werden”, warnt Christmann.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
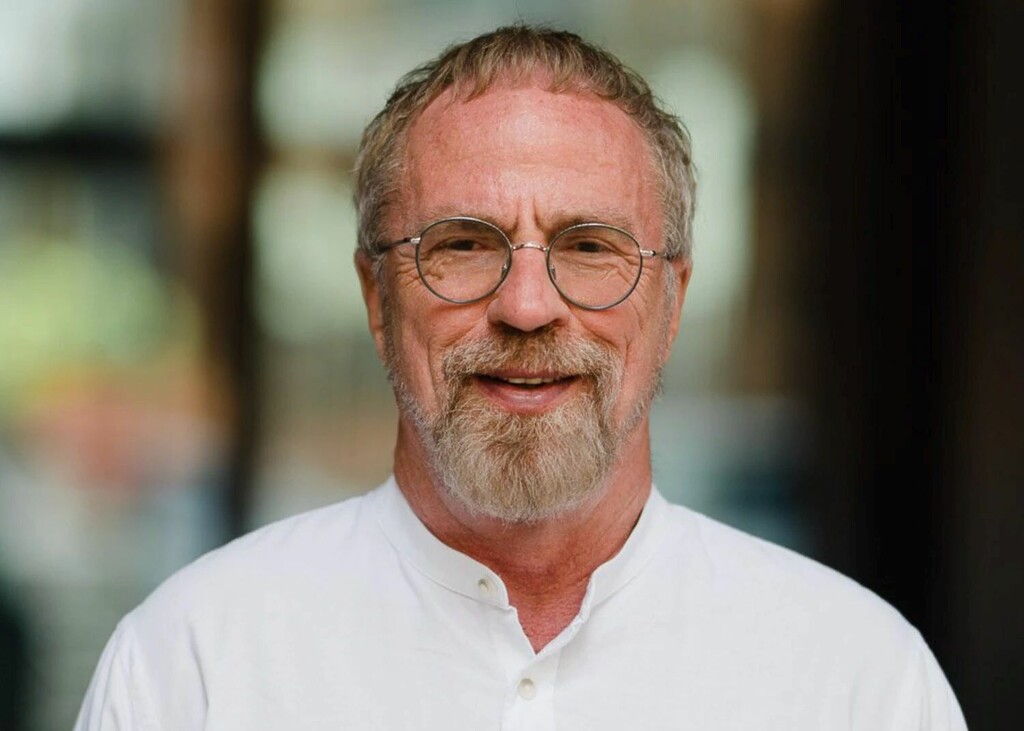
Herr Professor Uszkoreit, Sie haben gerade ein deutsches ChatGPT-Start-up gegründet, das auch einen Standort in China hat. Worum geht es dabei?
Wir haben das Start-up Nyonic in Berlin gegründet. In Shanghai haben wir ein Forschungsteam. Wir wollen zwei Schwächen von ChatGPT angehen. Die heutigen Sprachmodelle sind zu stark auf das Englische und vielleicht noch auf das Chinesische zentriert. Das wollen wir ändern. Und wir wollen ChatGPT für bestimmte Branchen zu einem verlässlichen Arbeitstool machen, was es heute noch nicht ist.
Warum die verschiedenen Sprachen? Englisch ist doch Weltsprache und Chinesisch auf dem Weg dorthin.
Weil viel europäisches Wissen noch gar nicht in Englisch vorliegt, sondern nur in den jeweiligen europäischen Sprachen. Zudem sollen die KI-Systeme für Anwender in aller Welt den gleichen Nutzen bringen. Die Sprachpluralität ist ein Riesenschritt für ChatGPT und wichtig für eine multipolare Welt. Die Mehrheit der Welt ist multilingual. Die USA können es sich leisten, anglozentrische Technologie zu haben. China kann es sich leisten, China-Technologie zu machen. Aber die Mehrheit der Welt, Südostasien, Afrika und eben Europa sind darauf angewiesen, dass viele Sprachen und Kulturen abgedeckt werden.
Warum machen Sie sich die Mühe? Sie sind ja mit 73 Jahren doch schon im Pensionsalter. Sie sind und bleiben ein Pionier der europäischen KI. Sie könnten die Füße hochlegen.
Alle in unserem Team, unabhängig vom Alter, wollen natürlich die größte Revolution in der KI zu unseren Lebzeiten mitgestalten. Hinzu kommt unser Wunsch, dass Europa sich diesmal nicht von den USA und China abhängen lässt. Wir haben sehr viele kluge Leute und viele Innovationen kamen aus Europa. Doch dann haben wir es immer wieder vermasselt. In China gibt es bereits mehr als 80 Sprachmodelle von der Größe von ChatGPT. In der EU gerade mal drei. In Deutschland gibt es erst eines, das bis jetzt auch noch nicht zu den besten zählt. Das wollen wir ändern.
Das Thema künstliche Intelligenz ist ja nicht neu. Sie beschäftigen sich seit mehr als 30 Jahren damit. Was ist denn neu mit ChatGPT, dass es nun die große Aufregung gibt?
Das System hat nun etwas erreicht, was wir beim Menschen Verständnis nennen. Es ist zwar bei der Maschine anders definiert, denn die Maschine hat nicht unser holistisches Weltbild und passt auch ihr Wissen nicht an Aussagen der Benutzer an. Aber die Wirkung ist die gleiche: Die Maschine benimmt sich in ihren Antworten so, als würde sie die Eingaben tatsächlich verstehen.
Wo liegen die Schwächen von ChatGPT?
ChatGPT ist zwar superschlau, hat aber auch erstaunliche Wissenslücken, die es manchmal durch Fantasie ausfüllt. Man kann sich noch nicht voll auf seine Kenntnisse und sein Urteil verlassen.
In der nächsten Version wird das doch sicher behoben?
Das wird Sie überraschen: Es gibt leider noch keine verlässliche Methode, nach der ich die Maschine ausbilden kann, um das zu bekommen, was ich möchte. Das ist alles noch Trial-and-Error. Mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Es gibt kein Curriculum, sondern ich füttere einfach Daten in Riesenschläuche ein und warte was passiert. Wir wissen nicht wirklich, was die Maschine dabei macht. Wenn das Ergebnis kommt, sagen wir: Schön gelernt, aber liebe Maschine, du sollst nicht alles glauben, was du gelesen hast. Und sag nicht alles, was du glaubst. Dann füttern wir gezielt Daten, um das Verhalten der Maschine zu korrigieren oder zu verbessern und schauen wieder, was herauskommt.
Böse Menschen können KI missbrauchen. Das muss man doch verhindern.
Ja, wir brauchen Regeln, insbesondere Regeln, für die speziellen kritischen Einsatzgebiete der KI. Aber diejenigen, die diese Regeln entwerfen, sollten der Versuchung widerstehen, eine solch komplexe Technologie wie die KI als Ganzes regulieren zu können. Bis das Gesetz Gültigkeit erlangt, hat sich die KI schon wieder weiterentwickelt. Ich habe derzeit mehr Sorge vor maßloser Regulierung, als vor bösen KI-Systemen. Diese Gefahr ist in Europa viel größer als in den USA oder China.
Was ist die Folge?
Selbst Forschung, die eine immer mächtigere KI durch geeignete Kontrolltechnologien zähmen und kontrollierbar machen will, könnte durch eine zu strenge Regulierung behindert werden. Am gefährlichsten sind immer die Meta-Regulierer, die Regeln wollen, die für alles gelten.
Aber Deutschland hat ja auch eine Verfassung, ein Grundgesetz.
Aber es ergibt keinen Sinn, für eine neue Technologie, die sich sehr schnell weiterentwickelt, zuerst eine Art Grundgesetz zu erfinden, wenn man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Viel sinnvoller ist, die KI für den jeweiligen Anwendungsbereich zu regulieren. Also KI fürs Autofahren, KI für die Pharmaindustrie, für die Luftfahrt oder die Schule. Das macht nicht nur Sinn, das ist auch wichtig. Und jedes Gebiet hat ganz andere Anwendungsbedingungen. So machen es auch die Chinesen. Und dann kann man aus der Schnittmenge dieser einzelnen Regulierungen in ferner Zukunft eine Art KI-Verfassung destillieren.

Die KI wird die Welt so nachhaltig verändern wie die Erfindung der Elektrizität. Wenn ich sage, wir brauchen zentrale Regelungen für die Nutzung von Elektrizität, dann merkt man sofort, das ist Quatsch. Oder die Dampfmaschine. Wenn ich die in einer Fabrik benutze, dann braucht sie andere Regeln, als wenn ich sie in einer Lokomotive einsetze. Die KI ist und bleibt erstmal ein Werkzeug des Menschen und ist nicht etwa ein Wettbewerber des Menschen.
Warum ist diese Angst, im Vergleich zu Asien und den USA in Europa, besonders in Deutschland und Frankreich so stark ausgeprägt?
Das ist eine gute Frage. Und wichtig dabei ist, anzuerkennen, dass es so ist. Vielleicht ist es ein hilfloser Versuch der Europäer, ihren schwindenden Einfluss in der Welt zu kompensieren, indem sie versuchen, mit ihren Regeln die Metaebene zu besetzen. Die stärkere Regulierungssehnsucht ist in dem Maße gewachsen, in der sie keine Weltmächte mehr haben. In Europa, besonders in Deutschland sind Medikamente verschreibungspflichtig, die es in den USA einfach im Supermarkt zu kaufen gibt. In Europa orientiert man sich auch eher an unwahrscheinlichen Ausnahmen, als an der täglichen Realität. Es scheint fast eine große Lust, sich um Risiken zu sorgen, als die Technologie mit Können und vollem Einsatz zum Erfolg zu bringen.
In den USA und China konzentriert man sich pragmatischer auf die wahrscheinlichsten Varianten.
In der EU hat die politische Aufgabenteilung zwischen Mitgliedstaaten und zentralisierter Regulierung zu einer ganz speziellen Entwicklung geführt. Anstatt eine zeitgemäße flexible Kombination von kodifiziertem Recht und Fallrecht anzustreben, die der Dynamik und Vielfalt unseres Kontinents gerecht wird, treibt diese Machtverteilung das europäisch kontinentale Rechtssystem der Kodifizierung mit einem Mammutaufwand ins Extrem.
Diese Tendenz trifft zusammen mit der Hoffnung, dass man über Gesetzgebung die Welt vom Übel befreien kann, dass man durch Regulierung der ganzen Welt seine eigene Ethik aufzwingt. Das bremst uns nun, und die Welt, die Brics-Staaten voran, hat keine Lust mehr, die Regeln zu übernehmen. Hinzu kommt noch, dass in Deutschland die Angst stärker geschürt wird als in anderen Ländern. Inzwischen ist ein eigener Berufszweig von selbsternannten AI-Ethikern, AI-Juristen und Algorithmen-Jägern entstanden. Die leben gut davon, Angst zu schüren. Das sind Menschen, die sich genau genommen gar nicht richtig mit KI auskennen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es die besten Juristen und Sozialwissenschaftler sind, die sich in diesem Feld tummeln.
Das andere Extrem wäre auch nicht günstig: Jede Anwendung muss gesondert zertifiziert werden, weil nur wenig zentral geregelt wird.
Das ist die Befürchtung des Mittelstands und besonders des Handwerks und der Kleinbetriebe. Wenn sie alles gesondert zertifizieren müssen, dann dauert das so lange und wird so teuer, dass der Mittelstand sagt: Das lohnt sich für uns nicht. Wir müssen also mehr denn je die Zertifizierungsanforderungen auf die wirklich kritischen Bereiche beschränken und den Produzenten sowie den Anwendern eine Beweislast nur dort aufbrummen, wo es tatsächlich Sonderfälle und Grund zur Besorgnis gibt. Und mithilfe der Technologie kostengünstige Testverfahren bereitstellen. Vor allem müssen wir schauen: Was ist im Alltag praktikabel. Ich bin nun sehr gespannt, ob Deutschland und die EU das diesmal hinbekommen oder wieder so handeln, als könnten sie noch die Regeln der Welt bestimmen.
Hans Uszkoreit, 73, hat in Deutschland, aber auch lange in den USA und in China gearbeitet – als Universitätsprofessor, Forschungsmanager, Industrieberater und Mitgründer mehrerer Start-ups. Er gilt als einer der führenden europäischen KI-Forscher. Uszkoreit ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er hat deutsche und internationale Forschungsverbünde initiiert und koordiniert, leitete mehrere der bekanntesten europäischen Projekte. Uszkoreit ist Autor von mehr als 250 internationalen Publikationen. Jüngst hat er das Berliner ChatGPT-ähnliche Start-up Nyonic gegründet – zusammen mit einem Forschungsteam in Shanghai. Seine Gattin Xu Feiyu ist ebenfalls profilierte KI-Forscherin und war zuletzt KI-Chefin von SAP.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
*Das vollständige Interview finden Sie bei China.Table.
Die EU-Kommission will Spielzeug besser vor schädlichen Chemikalien schützen und den Online-Handel wirksamer regulieren. Das sieht eine am Freitag vorgestellte Verordnung vor, welche die Spielzeug-Richtlinie von 2009 ersetzen soll. Mit dem Vorschlag werde unlauterer Wettbewerb beseitigt und noch mehr für die Sicherheit von Kindern getan, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Künftig werde es beispielsweise verboten sein, Chemikalien in Spielzeug zu verwenden, die das Hormon- oder das Atmungssystem beeinträchtigen oder für ein bestimmtes Organ toxisch sind, teilte die Kommission mit. Bereits verboten sind Stoffe, die krebserregend, erbgutverändernd oder schädlich für die Fortpflanzungsfähigkeit sind.
Ein neuer digitaler Produktpass soll es vor allem ermöglichen, unsicheres Spielzeug an den Außengrenzen leichter aufzuspüren. Ein neues IT-System soll Sendungen ermitteln, die eingehende Zollkontrollen erfordern. Für Kontrollen bleiben die Mitgliedstaaten zuständig. Die Kommission kann künftig allerdings verlangen, dass Spielzeug vom Markt genommen wird, dessen Risiken in der Verordnung nicht eindeutig geregelt sind.
“Wenn dies Gesetz wird, wäre es weltweit das erste Mal, dass sowohl bekannte als auch vermutete hormonschädigende Chemikalien aus einer ganzen Produktgruppe verbannt werden“, teilte der Verbraucherdachverband BEUC mit. Derlei Chemikalien könnten Unfruchtbarkeit, eine verfrühte Pubertät oder Adipositas zur Folge haben. Kritisch sind vor allem Spielzeuge, die Babys in den Mund nehmen.
Auch Europaabgeordnete begrüßten die geplanten Verschärfungen. Näher untersucht werden müsse, ob allein der digitale Produktpass ausreiche, um unsicheres Spielzeug aus dem Verkehr zu ziehen, sagte Schattenberichterstatterin Marion Walsmann (CDU). Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, teilte mit, Spyware in Smart Toys gehöre nicht ins Kinderzimmer. ber
Die italienische Regierung kann auf eine Zahlung von weiteren 18,5 Milliarden Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) hoffen. Die Kommission befürwortete am Freitag vorläufig 54 Etappenziele und Zielvorgaben aus Italiens drittem Zahlungsantrag. Vor der endgültigen Freigabe der Mittel aus dem Corona-Aufbauinstrument NextGenerationEU müssen noch die Vertreter der Mitgliedstaaten im Wirtschafts- und Finanzausschuss zustimmen.
“Italien hat große Fortschritte bei der Umsetzung wichtiger Reformen und Investitionen gemacht, die in seinem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehen sind”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie nannte die Reform des Gesundheits-, Justiz- und Steuersystems sowie Investitionen in digitale öffentliche Dienste und in einen nachhaltigeren öffentlichen Verkehr. In den vergangenen beiden Jahren hatte Italien bereits zweistellige Milliardenbeträge aus der ARF erhalten.
Die Kommission brachte am Freitag außerdem die vierte Tranche einen Schritt voran. Sie stimmte Änderungen des Aufbau- und Resilienzplans zu, die Italien beantragt hatte. Darunter die Förderung von beschleunigten Investitionen in Energieeffizienz sowie in Forschung und Entwicklung in der Industrie. Den Änderungen muss noch der Rat zustimmen. ber
Nach der Auszählung von Auslandsstimmen der Parlamentswahl in Spanien vergrößert die konservative Volkspartei (PP) ihren Vorsprung vor den bisher regierenden Sozialisten (PSOE). Gegenüber dem bisherigen Zwischenergebnis verliert die PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez ein Mandat in der Hauptstadt Madrid an die PP des Herausforderers Alberto Núñez Feijóo, wie die Wahlkommission und beide Parteien am Samstag mitteilten. Das folge aus der Auszählung der Stimmen von mehr als 233.000 Spaniern, die im Ausland leben.
Damit wird es für Sánchez noch schwieriger, eine Mehrheit im Parlament zu finden, während Feijóo unverändert geringe Aussichten auf hinreichende Unterstützung hat. Für eine absolute Mehrheit ist der Rückhalt von mindestens 176 der 350 Abgeordneten erforderlich. Zuletzt waren den Sozialisten und ihren möglichen Verbündeten 172 Mandate zugerechnet worden, während die Volkspartei und ihre möglichen Partner auf 170 Sitze kamen. Nach der Auszählung der Auslandsstimmen liegen nun beide Gruppen gleichauf bei jeweils 171 Abgeordneten, darunter auf der einen Seite 137 der Volkspartei und auf der anderen Seite 121 der Sozialisten. rtr
Frankreich will einen besseren Zugang zum chinesischen Markt und eine “ausgewogenere” Handelsbeziehung – nicht aber eine Entkopplung von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das betonte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag. Er wolle nicht auf gesetzgeberische oder andere Hürden beim Zugang zu den chinesischen Märkten stoßen, sagte Le Maire bei einer Pressekonferenz in Peking. Am Samstag habe er Vizepremier He Lifeng zu “konstruktiven” Handelsgesprächen getroffen, sagte der französische Minister.
Le Maire sprach sich gegen ein deutliches Decoupling aus und relativierte in Sachen De-Risking: “Der Risikoabbau bedeutet nicht, dass China ein Risiko darstellt”, sagte Le Maire. “De-Risking bedeutet, dass wir unabhängiger sein wollen und dass wir in unseren Lieferketten keinem Risiko ausgesetzt sein wollen, wenn es zu einer neuen Krise wie der Covid-Krise mit dem völligen Zusammenbruch einiger Wertschöpfungsketten kommen würde.”
Beim Treffen mit He Lifeng sei der Marktzugang Kern der Gespräche gewesen, erläuterte Le Maire. Der Minister erklärte, Frankreich sei auf dem richtigen Weg und ebne den Weg für einen besseren Zugang für französische Kosmetika zum chinesischen Markt. Dem Minister zufolge hoffe China, dass Frankreich den Ton in den Beziehungen zwischen der EU und China “stabilisieren” könne. Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Paris in einigen Bereichen zu vertiefen.
China ist Frankreichs drittgrößter Handelspartner. Auf die Befürchtungen einiger europäischer Autohersteller angesprochen, dass billige chinesische Elektrofahrzeuge den europäischen Markt überschwemmen könnten, sagte Le Maire, Frankreich wolle die französischen und europäischen Subventionen für Elektrofahrzeuge besser bündeln und so die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Auch eine Zusammenarbeit mit China schloss er nicht aus: “Wir sind bereit, chinesische Investitionen in der Automobilindustrie in Frankreich und in Europa zu haben.” rtr/ari
Nach dem Militärputsch in Niger droht Frankreich mit einem Eingreifen, wenn eigene Interessen verletzt würden. Gegen die Botschaft in Niamey flogen am Sonntag Steine. Die Regierung in Paris verurteilte den Gewaltausbruch. Jeglicher Angriff auf französische Staatsangehörige oder Interessen in Niger werde eine unverzügliche und strikte Reaktion Frankreichs nach sich ziehen, erklärte das Präsidialamt. Das Außenministerium forderte die Machthaber in Niger auf, die französische Botschaft nach internationalem Recht zu schützen.
Die EU hatte am Samstag Hilfen für Niger gestoppt. “Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt”, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Niger war bislang Empfänger umfangreicher westlicher Hilfen und Partner der EU bei der Eindämmung der Migration aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die EU hatte im Haushalt 503 Millionen Euro Fördermittel für die Zeitspanne 2021 bis 2024 bereitgestellt.
Am Sonntag verhängten auch die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) Sanktionen gegen Niger. Bei einem Krisengipfel in Nigeria drohten sie zudem mit einem gewaltsamen Einschreiten. Der Ecowas gehören 15 Staaten an. Ähnliche Sanktionen nach Staatsstreichen in anderen Ländern blieben allerdings ohne große Wirkung. rtr

Die EU-Kommission will eine europäische Satellitenkonstellation aufbauen. Das Programm IRIS2 – Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites – steht dafür, Europas Souveränität zu sichern. Zwischen 2025 und 2027 sollen bis zu 170 LEO-Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit) gebracht werden. Mehr als drei Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln stellen Brüssel und die Europäische Weltraumagentur ESA zur Verfügung.
Ausschließlich europäische Firmen sollen am Programm beteiligt sein. Das Ziel ist, im Krisenfall autonom handlungsfähig zu sein. Der verantwortliche Binnenmarktkommissar Thierry Breton, betonte 2022: “This is historic! After Galileo and Copernicus, we are adding a third constellation to our European portfolio of strategic space infrastructures! […] IRIS² will be a New Space constellation … integrating the know-how of the major European space industries-but also the dynamism of our start-ups, who will build 30% of the infrastructure!”
Als Start-up, das innovative Dual-Use-Satelliten baut, hat sich Reflex Aerospace viel von IRIS² versprochen. Doch bereits im EU-Gesetzgebungsprozess kam die Sorge auf, das Programm diene vor allem Frankreichs Interessen und seinen gut aufgestellten Raumfahrtkonzernen. Deutschland – als größter Beitragszahler sowohl der EU als auch der ESA – setzte sich dagegen von Anfang an für eine Beteiligung von KMU (kleine und mittlere Unternehmen) sowie Firmen aus dem schnell wachsenden New Space Ökosystem ein.
Dieses umfasst junge Unternehmen mit frischen Ideen, die dank ihrer optimierten Prozesse und verbesserten Produkte die traditionellen Akteure der Raumfahrt herausfordern. In Europa sind das meist (halb-) staatliche Großunternehmen. Gerade in Deutschland hat sich eine strukturell bedeutsame New-Space-Branche herausgebildet. Die ist mittels Micro-Launchern, eigenem Satellitenbau und Laserkommunikation in der Lage, eine eigene Konstellation aufzubauen!
Dabei war es ausdrücklich vorgesehen, KMU sowie New Space Firmen bei IRIS² einzubinden. So jedenfalls steht es in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 15. März 2023 (EU 2023/588): “Das Programm [IRIS² sollte] die Nutzung innovativer und disruptiver Technologien sowie neuartiger Geschäftsmodelle, die durch das europäische Weltraumökosystem – einschließlich New Space – entwickelt wurden, maximieren, insbesondere durch KMU, Midcap-Unternehmen und Start-ups …”. Bei Unteraufträgen im Wert von mehr als zehn Millionen Euro sei anzustreben, “dass mindestens 30 Prozent des Vertragswerts mittels Ausschreibungen auf verschiedenen Ebenen als Unteraufträge an Unternehmen vergeben werden, die nicht zum Konzern des Hauptbieters gehören …”!
Soweit die Theorie. Direkt bewerben konnten sich “die Kleinen” im Bieterprozess um den Hauptteil der Konstellation leider nicht. Der Prozess startete am 23. März 2023 und die EU-Kommission hatte für die Teilnahme unter anderem einen Mindestjahresumsatz von 500 Millionen Euro vorausgesetzt. Bereits am 2. Mai 2023 gaben die etablierten Raumfahrtkonzerne Europas – darunter Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, OHB, SES, Telespazio und Thales Alenia Space – die Bildung eines “offenen” Konsortiums bekannt. Diese Konzentration auf die althergebrachten Raumfahrtunternehmen – ohne den Wettbewerb durch ein zweites Konsortium sowie unter Ausschluss von New Space – ist gefährlich für Europas Innovationskraft!
Die Konzerne sind heute im Rahmen von IRIS² in der Lage, unliebsame Wettbewerber bei entsprechenden Unteraufträgen zu übergehen und kleinzuhalten. Selbst Zulieferungen von New Space Firmen oder KMU bleiben optional. Die Maßgabe, 30 Prozent der Unteraufträge an Start-ups und Kleinunternehmen zu vergeben, ist keine zwingende Voraussetzung der EU-Ausschreibung.
Gleichzeitig sorgt die von Brüssel gewünschte Bündelung von Forschungsaufgaben bei wenigen Konzernen dafür, dass sich KMU oder aufstrebende Start-ups gar keine Kompetenzen in so wichtigen Bereichen wie etwa der Krypto-Kommunikation aneignen beziehungsweise sich überhaupt weiterentwickeln können. In Deutschland verfolgen die Start-ups besorgt, ob sich die gewünschte “Impulswirkung” von IRIS² für die europäische Raumfahrtwirtschaft entfaltet oder der “Spillover-Effekt” insbesondere auf das New Space Ökosystem in der jetzigen Konstellation gänzlich ausbleibt.
Reflex Aerospace schafft es zum Beispiel, das Design und die Produktion eines Satelliten in unter einem Jahr umzusetzen – während etablierte Hersteller für Entwicklung und Fertigung von Satelliten bis zu vier Jahre kalkulieren. Als reiner Zulieferer wird Reflex Aerospace mit seinem disruptiven Ansatz wohl kaum zum Einsatz kommen. Welches Mitglied eines Konsortiums beauftragt seinen direkten Wettbewerber, der mithilfe von agiler Produktentwicklung und additiver Fertigung deutlich schneller und billiger am Markt agiert, wenn dieser Konzern seine eigenen Produkte im Rahmen von IRIS² garantiert teurer verkaufen kann?
Im All zeigt sich, dass schnelle Entwicklung und günstige Reproduktion wichtig sind, um eine Satellitenkonstellation technologisch auf dem neuesten Stand zu halten. Satelliten werden heute etwa alle fünf Jahre erneuert. Optimierte Fertigungszeit bedeutet auch, in der Lage zu sein, verbesserte Technologien schneller einzusetzen und noch sichererer über Satelliten zu kommunizieren. Leider schöpft IRIS² sein Innovationspotenzial hier nicht aus.
Insbesondere für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Eine wichtige Zukunftsindustrie, die bereits Hightech-Arbeitsplätze schafft, wird von öffentlichen Großaufträgen wissentlich ausgeschlossen. Die europäische Konstellation profitiert nicht. Sie bindet sich auf Jahre an die traditionellen Konzerne – mitsamt ihres Business as usual und allen Kosten, die das Großkonsortium mit sich bringt!
Noch ist es nicht zu spät, das New Space Ökosystem, bei IRIS² einzubinden:
Wir benötigen aktive Politik in Berlin und Brüssel, um den Raumfahrtstandort Deutschland zu stärken und weiter auszubauen.
Dennis Moore ist Vice President of Sales & Business Development bei Reflex Aerospace.
