als “linksradikalen Müll” bezeichnet Donald Trump den Begriff ESG. Für den voraussichtlichen US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ist die Auseinandersetzung darüber Teil des Kulturkampfs, mit dem er die Wahl erneut gewinnen will. Eine solche Einordnung hätte der Schweizer Finanzfachmann Ivo Knoepfel wohl nicht erwartet, als er 2004 das Konzept erfand, um die finanziellen Risiken nicht nachhaltiger Unternehmensstrategien zu bemessen.
Seitdem hat sich ESG zu einem erfolgreichen Konzept entwickelt, mit dem Finanzinstitute nach Nachhaltigkeitskriterien Kapital anlegen. Substanzielle Kritik daran zielt vor allem auf die oft wenig transparenten und unambitionierten ESG-Kriterien. Trump hingegen geht ESG viel zu weit. Unser US-Korrespondent Laurin Meyer geht der Frage nach, wie es mit ESG-Kapitalanlagen weitergehen wird, falls Donald Trump erneut Präsident wird.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums leidet die deutsche Klimabewegung unter schwindender Aufmerksamkeit. Zum Klimastreik am 1. März will sie nun wieder auf die Straße gehen. Im Hintergrund diskutieren die Aktivisten von Fridays for Future und der “Letzten Generation” unterschiedliche Strategien, um wieder mehr Anklang zu finden. Lisa Kuner berichtet.
Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich die deutsche Stahlbranche währenddessen nicht beklagen, gehört sie doch zu den zentralen CO₂-Emittenten im Land. Die Branche muss gerade einen großen Wandel stemmen – weg vom braunen hin zum grünen Stahl. Kerstin Maria Rippel gestaltet diese Transformation als neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl mit. Nils Wischmeyer hat sie porträtiert.

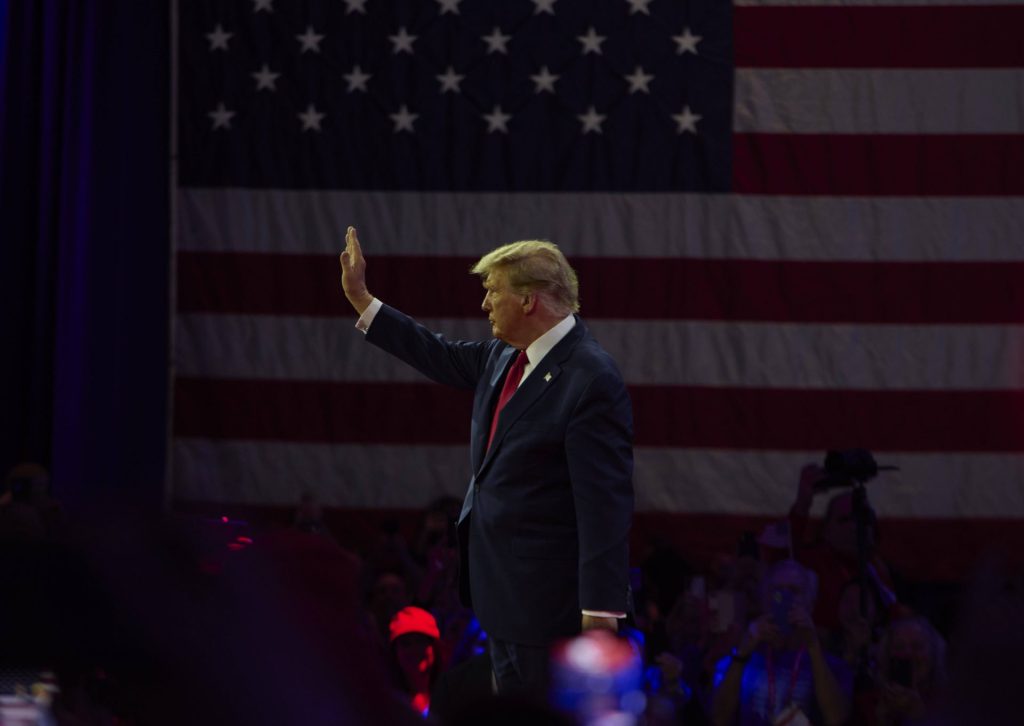
Donald Trumps Antworten auf den Umgang mit ESG-Kriterien könnten kaum einfacher klingen: Als “schlecht funktionierende Finanzbetrügereien” und “linksradikalen Müll” bezeichnet der wahrscheinliche US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner das Investieren nach ethischen und nachhaltigen Kriterien. “Es zerstört unser Land”, behauptet Trump in einem Wahlwerbespot.
Während Trump noch mit simplen Lösungen um die Gunst der Wähler buhlt, arbeiten Hunderte erzkonservative Republikaner bereits an einem detaillierten Playbook für seine mögliche Amtsführung – darunter auch an einem konkreten Vorgehen gegen ESG-Standards. Im sogenannten “Project 2025” haben sich mehr als 80 Organisationen unter der Leitung der Heritage Foundation, einer nationalkonservativen Denkfabrik aus Washington, zusammengeschlossen und ein 920 Seiten langes Regierungsprogramm ausgearbeitet. Auf knapp 14 Seiten davon befassen sich die Autoren mit der Zukunft grüner und sozialer Investitionsstandards. Sollten ihre Pläne umgesetzt werden, könnte der öffentlichkeitswirksame ESG-Fokus zu einem kostspieligen Risiko werden. Über ihre Bemühungen dürften Investoren und Unternehmen deshalb fortan deutlich häufiger schweigen, erwarten Experten.
Die Autoren des Programms bezeichnen ESG-Standards grundsätzlich als “ideologisch geprägte Politik”, die massiv Arbeitsplätze kosten und die amerikanische Energiesicherheit aufs Spiel setzen würde. Bislang bekamen vor allem die Manager von US-Pensionsfonds die Anti-ESG-Ausrichtung der Konservativen zu spüren. Einige republikanisch regierte Bundesstaaten haben bereits ihren milliardenschweren öffentlichen Pensionsfonds teils verboten, Geld nach ESG-Kriterien anzulegen. “Die Regierung sollte dem Beispiel mehrerer Bundesstaaten folgen und ihre Pensionsfonds nicht mehr von Managern wie BlackRock und State Street Global Advisers verwalten lassen, sondern einen wettbewerbsfähigen privaten Manager beauftragen, der seinen treuhänderischen Pflichten nachkommt”, heißt es im Programm.
Doch weitreichende Konsequenzen würden Finanzunternehmen fortan auch bei ihren privaten Geschäften drohen, sollten sie ESG-Standards weiter in den Mittelpunkt stellen. Der Vorwurf der Rechtskonservativen: Das grüne und soziale Engagement diene den Firmen als Reputationswäsche, mit der sie auf eine günstige Behandlung durch staatliche Akteure hoffen würden – so etwa bei der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Deshalb solle die nächste US-Administration den Kongress dazu aufrufen, die “ESG-Praktiken auf wettbewerbsfeindliche Aktivitäten und mögliche unfaire Handelspraktiken” zu untersuchen. Außerdem fordern die Autoren, unter der FTC eine eigene Task Force für ESG-Absprachen einzurichten. Diese solle dann prüfen, ob Firmen “diese Praktiken als Mittel zur Erreichung von Zielen, zur Festsetzung von Preisen oder zur Verringerung der Produktion einsetzen”, heißt es im Konzept.
Zuletzt zogen sich bereits einige Größen der Finanzwelt, darunter JPMorgan, State Street und Pimco, aus der Gruppe der sogenannten Climate Action 100+ zurück – einer internationalen Koalition von Vermögensverwaltern, die große Unternehmen dazu bewegen will, sich mit Klimaproblemen auseinanderzusetzen. Zudem hat BlackRock sein Engagement in der Gruppe zurückgefahren. Denn schon ohne eine republikanische US-Regierung fürchteten manche Ex-Mitglieder beim gemeinsamen Handeln kartellrechtliche Risiken oder Probleme wegen mangelnder Unabhängigkeit bei der Stimmrechtsvertretung.
Solche Risiken würden nur extremer werden, sollte Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen triumphieren, sagte Mark Campanale, Direktor der Denkfabrik Carbon Tracker, jüngst dem Medienunternehmen Bloomberg. Die langfristige Reaktion könnte eine sein, die Experten als “Greenhushing” bezeichnen. Damit ist gemeint, dass Akteure absichtlich wenig über ihre ESG-Bemühungen sprechen – aus Sorge vor der rechtskonservativen Gegenbewegung. Die Anti-ESG-Lobby habe Investoren “das Fürchten gelehrt”, sagte Campanale. “Institutionen werden sich weiterhin um Nachhaltigkeit bemühen, aber sie werden es tun, ohne sich dabei zur Schau zu stellen”, ist er überzeugt. Schließlich blieben Klimarisiken für die Unternehmen bestehen. Außerdem dürften Beschäftigte weiter auf eine nachhaltige und soziale Unternehmensführung drängen.
Die aufkommende Zurückhaltung lässt sich nicht nur in der Finanzwelt messen, sondern über alle Wirtschaftszweige hinweg. Die Führungskräfteberatung Teneo hat im Dezember weltweit rund 260 CEOs großer Unternehmen befragt, wie sie derzeit mit der fortschreitenden Politisierung des ESG-Begriffs umgehen. Fast die Hälfte behauptete demnach, ihre Bemühungen aufrechtzuerhalten, aber diese seltener nach außen zu kommunizieren. Acht Prozent der Befragten gaben an, wegen des sich verschärfenden Kulturkampfes ihre ESG-Bemühungen herunterzufahren.
Im ersten Quartal des vergangenen Jahres haben sich die S&P-500-Unternehmen bei ihren Bilanzkonferenzen (Earnings Calls) außerdem schon so selten zu ESG-Kriterien geäußert wie zuletzt im Sommer 2020. Insgesamt 74-mal soll der Begriff bei den Ergebnispräsentationen gefallen sein, wie das US-Finanzdatenunternehmen FactSet gezählt haben will. Ein Jahr zuvor sprachen die Unternehmen noch etwa doppelt so häufig explizit über die drei Buchstaben. Und gelegentlich zeigt sich der veränderte Umgang auch nur im Detail. Veröffentlichte Coca-Cola im Jahr 2022 noch einen “Business & ESG”-Report, hieß dieser im vergangenen Jahr bereits “Business & Sustainability”-Report.
Welche Programmpunkte aus dem Project 2025 Donald Trump im Falle eines Wahlsiegs umsetzen wird, bleibt abzuwarten. An einer Sache lässt er allerdings keinen Zweifel: Sollte er ins Weiße Haus zurückkehren, so sagt er, werde er gegen ESG ankämpfen. Laurin Meyer, New York

Am 1. März will Fridays for Future (FFF) zusammen mit der Gewerkschaft Verdi für Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr demonstrieren. Dieses Bündnis wurde bereits erprobt, ist aktuell aber auch der Versuch, wieder mehr Menschen zu erreichen und Sympathien zurückzugewinnen. Anders geht die Gruppe Letzte Generation vor: Sie hat für den 16. März zu “ungehorsamen Versammlungen” in verschiedenen deutschen Städten aufgerufen. Die unterschiedlichen Termine und verschiedenen Ansätze zeigen: Die deutsche Klimabewegung ist sich uneinig – und sucht nach neuen Strategien.
Im vergangenen Jahr mussten die Aktivistinnen und Aktivisten Niederlagen einstecken:
Auch wenn viele der Aktivistinnen und Aktivisten das nicht offen zugeben: Die meisten spüren den Wandel. Und innerhalb der verschiedenen Bewegungen gibt es Strategie- und Personalwechsel.
Wie keine andere Klimagruppierung hat die Initiative “Letzte Generation” im vergangenen Jahr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun bröckelt es hinter der nach außen so entschlossenen Fassade: Im Januar gaben die Aktivistinnen und Aktivisten bekannt, dass sie sich in Zukunft nicht mehr auf die Straße kleben werden. Anfang Februar verkündete die Sprecherin der Bewegung dann überraschend, dass die Bewegung für das Europaparlament kandidieren möchte. Mit Lina Johnsen und Theo Schnarr stellt die Bewegung zwei eher unbekannte Gesichter dafür auf.
Für Maria-Christina Nimmerfroh, die als Psychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Letzte Generation intensiv beobachtet hat, ist die Gruppierung klar in einer Krise: “Solche Bewegungen zerlegen sich immer von innen”, sagt sie zu Table.Media. Nicht der mediale Druck und auch nicht die harten Gerichtsverfahren brächten die Aktivisten aus dem Konzept, sondern interne Unstimmigkeiten und Streit.
Zuletzt habe sich gezeigt, dass die Organisationsstruktur der “funktionalen Hierarchie”, mit der die Gruppe Entscheidungen trifft, an ihre Grenzen stoße. Außerdem habe die Letzte Generation massive Nachwuchsprobleme. Es sei ihr bisher nicht gelungen, in größerem Maß junge Menschen für den Aktivismus zu rekrutieren. Das liege auch daran, dass die Organisation sehr hohe Ansprüche stelle – am besten sollte man sich in Vollzeit engagieren. Simon Teune, Protestforscher an der FU Berlin, fügt hinzu, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten “frustriert und ausgepowert” sind.
Das Gegenbeispiel bleibt Fridays for Future. Darya Sotoodeh, Sprecherin von FFF, betont im Gespräch mit Table.Media: “Unsere Stärke ist, dass wir für viele Menschen anschlussfähig sind”. Dazu gehören Demonstrationen mit breiten Bündnissen wie mit den Gewerkschaften am 1. März. Auch die Beteiligung an der Organisation der großen Demonstrationen gegen rechts Anfang des Jahres sei ein Teil dieser Strategie. Teune sagt, es sei klar geworden, dass “eine autoritäre, möglicherweise sogar faschistische Politik das Ende einer wirksamen Klimapolitik wäre”.
Aus Sicht von Nimmerfroh ist die Klimabewegung damit aber nicht nach links gerückt – im Gegenteil. Die “Letzte Generation” habe beispielsweise sogar “bürgerlich” wirken wollen und sich vom klaren linken Spektrum abgegrenzt. Grundsätzlich strebten die meisten Klimagerechtigkeitsbewegungen Überparteilichkeit an. “Die Wahrnehmung von Klimaschutzthemen als links kommt eher durch die politische Besetzung der Themen durch die Grünen und die Verbindung von einem nachhaltigen Lebensstil mit linken Assoziationen der Nonkonformität und des Konsumverzichts”, meint Nimmerfroh. Zum rechten Rand gibt es aber eine klare Abgrenzung: FFF will sich besonders auf die “Mobilisierung von jungen Menschen, insbesondere anlässlich der Wahlen in Europa und Sachsen, Thüringen und Brandenburg” konzentrieren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
Mit breiten Bündnissen versuche FFF zudem Menschen zu erreichen, die sich bisher noch nicht fürs Klima engagieren. Das zeigt auch die aktuelle Kampagne “Wir fahren zusammen” in der FFF, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs an der Seite der Dienstleistungsgesellschaft Verdi unterstützt.
Für Protestforscher Dieter Rucht ist das “im Prinzip” eine erfolgversprechende Strategie. “Die Bewegung gewinnt an Breite”, sagt er dazu. “Damit entsteht aber auch die Gefahr, dass die Bewegung an Profil verliert und es zu internen Konflikten kommt”.
“Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint auch Sotoodeh zur Allianz mit Verdi. Zum einen sei die Verkehrswende ein wichtiges Thema. Der bessere Ausbau vom Nahverkehr sowie bezahlbare Preise für Bus und Bahn sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten seien zum anderen Themen, hinter denen eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung stehe. Die Kampagne sei auch wichtig, weil sie zeige, dass sich soziale Verbesserungen nicht gegen Klimaschutz ausspielen ließen. Außerdem sei sie greifbar und habe somit das Potenzial, viele Menschen zu erreichen.
Finanziert werden soll der Ausbau des ÖPNV aus Sicht von FFF über ein 100-Milliarden-Sondervermögen für eine sozial-gerechte Transformation. “Nicht das Geld für sozial gerechten Klimaschutz fehlt, sondern der politische Wille, es dafür einzusetzen”, fügt die Aktivistin hinzu. Zudem habe ein Streik von Arbeitskräften noch einmal mehr Macht als ein Schulstreik.
Wie erfolgreich FFF mit dieser Strategie die Klimaagenda nach vorne bringt, ist aber noch offen: Simon Teune denkt, es brauche “ein Nachdenken darüber, welche Hebel mit den begrenzten Ressourcen in Bewegung gesetzt werden können”. Möglicherweise dienten erst neue Extremwetterereignisse oder noch höhere Temperaturen als “Augenöffner”, um wieder Menschen zu aktivieren.
Auch die Expertin für soziale Bewegungen Nimmerfroh hat das Gefühl, dass die Klimabewegung aktuell kaum gehört wird. Protestforscher Rucht sieht die Probleme, von einer Krise der Klimabewegung will er aber nicht sprechen. Stattdessen sagt er, sie befinde sich in einer “Phase der Neuorientierung“. Klar sei aber, dass “es so nicht weiter geht”. Weder der breite, freundliche Ansatz von FFF noch die auffälligen Aktionen der “Letzten Generation” brächten signifikante politische Erfolge.
Das geplante Bundestariftreuegesetz sei für die FDP “untrennbar mit einer unbürokratischen Vergabereform verbunden”, sagte Carl-Julius Cronenberg, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Mittelstand, zu Table.Media. Da das Gesetz “unweigerlich mit neuer Bürokratie” einhergehen würde, sei es wichtig, “jegliche zusätzliche Belastung durch eine gleichzeitige Entlastung bei der Vergabereform mehr als auszugleichen”.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plante ursprünglich, das Gesetz vor der Sommerpause 2023 vorzulegen. Doch die “regierungsinternen Gespräche zum Bundestariftreuegesetz dauern an”, teilte eine Ministeriumsprecherin mit. Das Gesetz soll Unternehmen verpflichten, bei öffentlichen Aufträgen des Bundes ab einem bestimmten Wert Tarifverträge einzuhalten.
Ob sich die Erarbeitung des Bundestariftreuegesetzes verzögert, weil die Ressorts es zusammen mit dem Vergabetransformationspaket verhandeln, wollte das Arbeitsministerium nicht kommentieren. Die Vergaberechtsreform wird aktuell im Wirtschaftsministerium erarbeitet. Sie soll öffentliche Vergaben vereinfachen und beschleunigen, sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlicher machen. Beide Vorhaben sollen im ersten Halbjahr dieses Jahres durch das Kabinett gehen.
Die Nachfragemacht der öffentlichen Hand von mehreren hundert Milliarden Euro pro Jahr wird von Fachleuten als Hebel gesehen, um ökologischen und sozialen Wandel voranzubringen – wie Klimaschutz oder angemessene Löhne. Auch daher gibt es die Forderung, die inzwischen stark gesunkene Tarifbindung in Deutschland durch Tariftreueregelungen zu stärken.
“Das lange angekündigte Bundestariftreuegesetz muss nun schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden”, sagte Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Dies würde die Tarifbindung stärken, wie es die neue EU-Mindestlohnrichtlinie vorsehe, die bis Ende dieses Jahres in nationales Recht umgesetzt werden müsse. “Alles, was die Wirksamkeit des Bundestariftreuegesetzes konterkariert und unterhöhlt, lehnen wir strikt ab”, betont Körzell. nh
Sieben Thüringer Universitäten und Hochschulen haben sich zum Projekt “Thüringen Lehrt und Lernt Nachhaltig” (ThüLeNa) zusammengeschlossen. Ziel der Kooperation sei es, “Nachhaltigkeit als zentrales Element in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen zu verankern und so die Studierenden optimal auf die Herausforderungen einer sich rasant verändernden Welt vorzubereiten”, heißt es in einer Mitteilung der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena. An der EAH laufen künftig die Fäden des Programms zusammen.
Für Frank Pothen, Wirtschaftsprofessor an der EAH und Koordinator von ThüLeNa, ist das Projekt “ein wegweisender Schritt für den Bildungsstandort Thüringen”. Es unterstreiche das Engagement der beteiligten Hochschulen für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Bildung und führe zu einer Stärkung der Ingenieurausbildung im Freistaat, meint Pothen.
Neben der EAH sind die Bauhaus-Universität Weimar, die Fachhochschule Erfurt, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Hochschule Nordhausen, die Hochschule Schmalkalden und die Technische Universität Ilmenau beteiligt.
Gemeinsam wollen sie in den nächsten Jahren digitale Module zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen entwickeln, die “idealerweise zu einem hochschulübergreifenden Zertifikatsprogramm kombiniert werden können, das Studierenden eine Zusatzqualifikation im Bereich Nachhaltigkeit bietet”, heißt es.
Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt das Projekt in den kommenden drei Jahren mit insgesamt 2,5 Millionen Euro. “Damit technische Entwicklungen auch Nachhaltigkeitsaspekten genügen, benötigen wir Fachkräfte, die sowohl über profundes Fachwissen als auch Nachhaltigkeitskompetenzen verfügen”, begründet Geschäftsführer Felix Streiter das Engagement.
Die Carl-Zeiss-Stiftung mit Sitz in Jena ist eine der ältesten und größten privaten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland. Sie ist alleinige Eigentümerin der Carl Zeiss AG und der SCHOTT AG. Ihre Projekte werden aus den Dividendenausschüttungen der beiden Stiftungsunternehmen finanziert. ch
Die stellvertretenden Botschafter der EU-Mitgliedstaaten haben am Mittwoch über einen neuen Kompromissvorschlag der belgischen Ratspräsidentschaft zur EU-Verpackungsverordnung beraten. Laut dem Entwurf, den die französische Nachrichtenplattform Contexte Anfang der Woche veröffentlichte, hält die Ratspräsidentschaft an Maßnahmen fest, die Verpackungsmüll vermeiden sollen, darunter auch die Ziele für Mehrwegsysteme.
Die Ratspräsidentschaft sieht laut dem Kompromissvorschlag Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsabfällen als ein entscheidendes Element der Verordnung. Die EU-Vorgaben würden den Mitgliedstaaten die notwendigen Instrumente zur Abfallverringerung verleihen (Artikel 38). Daher sehe die Ratspräsidentschaft in den Verhandlungen “eine sehr begrenzte Flexibilität bei der Beschränkung auf bestimmte Verpackungsformate“. Das Parlament fordert dazu eine Reihe von Streichungen und Ausnahmeregeln.
Dennoch will die Ratspräsidentschaft “eine gewisse Offenheit gegenüber dem Parlament” zeigen und schlägt ein Kompromisspaket vor: Demnach könnte die Frist zur Umsetzung in den Mitgliedstaaten verschoben und zusätzliche Ausnahmen hinsichtlich der Verbote für unnötige Verpackungsformate geschaffen werden (Anhang V). Die Ratspräsidentschaft erwarte hier “großen Druck” vonseiten des Parlaments.
Zum Kompromissvorschlag gehört auch eine Überarbeitung der Mehrwegziele (Artikel 26). Verschiedene Formen von Verpackungen und Ausnahmen sollen klarer zusammengefasst werden. Die Ratspräsidentschaft werde darauf bestehen, dass Mehrwegziele für Speisen und Getränke zum Mitnehmen erhalten bleiben; für alkoholische und nicht-alkoholische Getränke sollen allgemeinere Formulierungen verwendet werden.
Am kommenden Montag beginnt der zweite Trilog und wird voraussichtlich sehr lang dauern, da die Verhandelnden aus Rat, Parlament und Kommission eine Einigung anstreben. Bereits geeinigt hatten sich Rat und Parlament beim ersten politischen Trilog am 5. Februar unter anderem über die Ziele für den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen und die Bestimmungen über biobasierten Kunststoff (Artikel 7).
Die Berichterstatterin für die Verpackungsverordnung im EU-Parlament, Frédérique Ries (Renew), hingegen schlug gestern eine Ausnahmeregelung für die Verbote für Einwegverpackungen sowie für die Mehrwegpflichten vor. Das entsprechende Dokument veröffentlichte ebenfalls Contexte. Sie will damit “Ländern wie Italien oder Finnland, die über ein effizientes Recyclingsystem verfügen und nicht auf das Wiederverwendungssystem umstellen wollen” entgegenkommen, zumindest in Bezug auf den Gastronomiesektor.
Konkret formuliert sie folgende Vorschläge:
Mehr als 50 Prozent der Beschäftigten von Mercedes-Benz in Vance, Alabama, haben Unterstützerkarten für die Gründung einer Gewerkschaft unterschrieben. Das teilte die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft UAW diese Woche mit.
Damit wäre Mercedes nach Volkswagen der zweite deutsche Automobilhersteller in den USA, bei dem sich innerhalb weniger Wochen eine Mehrheit der Belegschaft für eine Interessenvertretung ausgesprochen hat. Eine Zustimmung von 30 Prozent hätte ausgereicht, um Gewerkschaftswahlen bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Die selbst gesetzte Schwelle der UAW liegt jedoch bei 70 Prozent.
Das 1995 errichtete Mercedes-Werk war der erste große Pkw-Produktionsstandort des Stuttgarter Automobilherstellers außerhalb Deutschlands und beschäftigt heute rund 6.100 Mitarbeiter. In Vance werden SUV für den nordamerikanischen und den Weltmarkt gebaut.
Nach den erfolgreichen Tarifverhandlungen bei den drei großen US-Autobauern Ford, General Motors und Stellantis im vergangenen Herbst hat die UAW eine groß angelegte Organizing-Kampagne angekündigt. Wie sie kürzlich mitteilte, will sie dafür in den nächsten zwei Jahren 40 Millionen US-Dollar einsetzen. Die Gewerkschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als ein Dutzend Automobilwerke ohne Gewerkschaftsvertretung zu organisieren, unter anderem bei VW, Mercedes und BMW. Deren US-Werke befinden sich in den traditionell gewerkschaftsfeindlichen Südstaaten Alabama (Mercedes), Tennessee (VW) und South Carolina (BMW). ch
Erweiterte Regeln zu Subventionen für Fischerei und Landwirtschaft dominieren die Verhandlungen bei der Konferenz der Welthandelsorganisation in Abu Dhabi. Die bis gestern terminierte Konferenz ging bei Redaktionsschluss in eine Verlängerung.
Das letzte erfolgreich abgeschlossene Abkommen der WTO war ein Fischereisubventionsabkommen vor zwei Jahren. Es schränkt Beihilfen ein für illegale und unregulierte Fischerei und in Gebieten mit kritisch niedrigen Fischbeständen. Es war das erste WTO-Abkommen, das Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Mittelpunkt stellt. Bislang haben 70 Mitgliedsstaaten das Abkommen ratifiziert, 40 weitere müssen sich noch anschließen, damit das Abkommen in Kraft tritt.
Die in Abu Dhabi nun verhandelte Erweiterung soll:
Um die letzten beiden Punkte gibt es Uneinigkeit bei den Verhandlungen: Entwicklungsländer reklamieren, dass sie Nachhaltigkeits-Berichterstattung nicht leisten könnten und ihre kleinen Fischereibetriebe schützen müssten.
Der indische Handelsminister Piyush Goyal kritisierte generell die Vermischung von Umwelt- und Handelsthemen: “Das sind zwei separate Themen”, sagte er der Financial Times. Die Einbettung von Nachhaltigkeitsthemen in Handelsabkommen durch reiche Länder sei “voreingenommen”.
Der stellvertretende Premierminister von Fiji sagte hingegen gegenüber Reuters, das Fischereiabkommen gehe nicht weit genug. “Wir möchten, dass die großen subventionierenden Länder eine Obergrenze für die derzeitige Höhe der Subventionen festlegen”, so Manoa Seru Kamikamica.
Eine Studie der NGO Environmental Justice Foundation (EJF) zeigt währenddessen, welche Folgen die Grundschleppnetzfischerei für die Fischpopulationen vor Thailands Küste hat. Laut der Organisation ist der wirtschaftliche und ökologische Schaden so immens, dass “weite Teile der thailändischen Fischgründe” ihren Wert zu verlieren drohen.
“Die unkontrollierte Fischerei mit Gespannschleppnetzen zerstört wertvolle Meeresökosysteme, die die Lebensgrundlage und Ernährungssicherheit in ganz Thailand sichern”, sagt Steve Trent, Geschäftsführer und Gründer von EJF. Ein Instrument, diese Art der zerstörerischen Fischerei zu verhindern, sei der Abbau der Steuerbefreiung für “green oil”. Dieser Treibstoff, der nur jenseits der 12-Meilen-Zone verkauft werden darf, begünstigt vor allem große Schiffe. Für 2021 beziffert EJF die Subvention auf 115 Millionen US-Dollar. av
Jedes vierte Unternehmen in Europa macht bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie deutliche Fortschritte, in Deutschland sind es 33 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer Studie des IBM Institute for Business Value. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte aus 22 Branchen in 22 Ländern.
Das Thema Nachhaltigkeit sei tief in den Betriebsabläufen verankert und dies zahle sich aus, heißt es. Dass nachhaltig agierende Unternehmen höhere Gewinne erzielen, sei wahrscheinlich. Aber: Nach Ansicht der Studienautoren deuten die Ergebnisse auch darauf hin, dass sich viele Unternehmen vor allem mit der Erfüllung ihrer Berichtspflichten beschäftigen. Das Gewinnpotenzial bleibt oft ungenutzt, da es an gezielten Investitionen fehlt. So überstiegen die Ausgaben für Nachhaltigkeitsberichte diejenigen für entsprechende Innovationen um 47 Prozent.
Fast die Hälfte der Befragten hätten Schwierigkeiten, die entsprechenden Investitionen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu finanzieren. “Sechs von Zehn sagten aus, dass sie zwischen finanziellen Ergebnissen und nachhaltigen Resultaten Kompromisse eingehen müssten”. 72 Prozent der Befragten seien sich einig, dass generative KI für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen wichtig sein werde. cd
Climate Investors Warn the Right Is Winning the War on ESG – BNN Bloomberg
Wenn die globale Erwärmung politisiert wird, können professionelle Investoren ihren Job nicht mehr richtig machen. Das ist die zentrale Botschaft von Climate Action 100+, der weltweit größten Investorenkoalition für den Klimaschutz, nachdem einige ihrer wichtigsten Mitglieder die Gruppe diesen Monat verlassen haben, berichtet Alastair Marsh. Zum Artikel
Scientists Are Freaking Out About Ocean Temperatures – New York Times
Die Weltmeere waren im vergangenen Jahr deutlich wärmer als üblich. Der vergangene Monat war der wärmste Januar, der jemals in den Weltmeeren gemessen wurde. Seitdem sind die Temperaturen weiter gestiegen. Besonders ausgeprägt war die Hitzewelle im Nordatlantik. Die Wissenschaftler sind alarmiert, schreibt David Gelles. Zum Artikel
Europa baut die grüne Festung – Spiegel
Michael Sauga kritisiert in einer Kolumne eine unausgesprochene Allianz aus Umweltschützern und Bauernvertretern, die gemeinsam internationale Freihandelsabkommen verhindern. Aktuelles Beispiel: Mercosur. Dabei könne die EU ein Vorreiter für Nachhaltigkeit sein, müsse dafür aber auf “sogenannte Nachhaltigkeitskapitel” verzichten, “die den Regierungen der Partnerstaaten bis ins Detail vorschreiben, wie sie ihre Umwelt- und Klimapolitik zu gestalten haben”. Zum Artikel
Die EU macht sich erpressbar – Süddeutsche Zeitung
Mit Blick auf die Reaktionen der Brüsseler Politik auf die Proteste der Landwirte kommentiert Josef Kelnberger, “fatal ist der Eindruck, die europäische Politik sei erpressbar”. Falsch sei es auch, wenn Klimaschutz der EU als eine “Art Brüsseler Schönwetterpolitik” erscheine, “die man in Krisenzeiten schnell abwickeln kann”. Zum Artikel
“59 Euro für eine Jeans aus Mönchengladbach ist doch supergut” – Süddeutsche Zeitung
Klare Worte findet die neue C&A-Chefin Giny Boer im Interview mit Michael Kläsgen dafür, warum sich die Textilindustrie ändern müsse: Die “Industrie ist einer der größten Umweltverschmutzer und ungenutzte Kleidung wird vernichtet”. Es gehe ihr darum, geringere Mengen zielgerichteter zu produzieren: “Wer weniger Kleidung vertreibt, handelt automatisch nachhaltiger”. Zum Artikel
Blue Jeans ohne Gift: Forschende entwickeln neues Verfahren – Basler Zeitung
Die Umweltbelastung beim Färben von Denim ist enorm. Joachim Laukenmann berichtet, dass Forschende aus Dänemark und Island ein nachhaltiges Verfahren entwickelt haben. Das könnte dazu führen, dass die Industrie einen Teil ihrer Produktion in westliche Länder zurückverlagert. Zum Artikel
“Verbrenner bleiben bis 2035 im Programm” – Automobil Industrie
Überboten sich die Hersteller bis vor kurzem noch mit möglichst kurzen Laufzeiten bis zum Ende des Verbrennungsmotors, kommt jetzt die Gegenwelle. Zum Beispiel Skoda. CEO Klaus Zellmer stellt klar, dass man bis zum gesetzlichen Ende des Verbrennungsmotors Benzin und Diesel liefern will, wie Andreas Grimm berichtet. Zum Artikel
African leaders call for equity over minerals used for clean energy – Guardian
Auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi hat eine Gruppe von überwiegend afrikanischen Staaten eine Resolution vorgestellt. Sie fordert einen Strukturwandel, damit Staaten, die Rohstoffe für die Energiewende abbauen, stärker an der Wertschöpfung partizipieren. Bislang würden die Rohstoffe direkt nach dem Abbau exportiert, wodurch viele Potenziale verloren gingen. Zum Artikel

Kerstin Maria Rippel konnte ihren Job offenbar kaum erwarten. Schon Monate, bevor sie die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl wurde, setzte sie sich ins Auto und fuhr zu Stahlproduktionen in ganz Deutschland. “Man kann viel lesen, viel reden, aber ich wollte die Industrie erleben, anschauen und auch riechen”, sagt Rippel. Was ihr früh dabei auffiel: Die Menschen vor Ort hätten eine hohe Identifikation mit ihrer Arbeit, seien wahnsinnig stolz auf den Stahl, den sie dort produzieren.
Nur: Die Stahlindustrie steckt bis zum Hals in der Krise und muss gerade parallel noch einen großen Wandel stemmen. Die CO₂-Emissionen müssen runter und dafür müssen die Stahlgiganten auf grünen Strom und grünen Wasserstoff umrüsten. Das wiederum ist teuer und für die Industrie enorm anstrengend.
Rippel ist es nun, die in diesem heiklen Terrain kommunikativ navigieren muss. Sie muss die Politik überzeugen, dass die Stahlbranche überlebensnotwendig für den Standort Deutschland ist. Sie muss die Unternehmen zusammenbringen, um einheitlich auftreten zu können. Sie muss den Verband modernisieren – und dann müssen die Stahlarbeiter vor Ort noch bei Laune gehalten werden, damit die Stimmung nicht kippt. All das ist eine riesige Herausforderung, der sich Rippel jetzt stellen muss.
Über sich selbst sagt die 51-Jährige, dass sie eine Newcomerin in der Branche ist, und das passt. Studiert hat Rippel schließlich Jura in Saarbrücken und Stuttgart, hat später noch eine journalistische Ausbildung absolviert und sich ihre ersten Sporen beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft verdient. Dort arbeitete sie als Pressesprecherin, bevor sie 2013 zum Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz wechselte, wo sie einen rasanten Aufstieg hinlegte. Von der Teamleiterin für Energiepolitik schaffte sie es in nicht einmal sechs Jahren zur Prokuristin, bevor 2023 dann der Ruf aus der Stahlbranche kam: Frau Rippel, wollen Sie nicht mal etwas ganz Neues machen und unsere Wirtschaftsvereinigung führen?
Rippel erinnert sich noch gut an die Anfrage. Stahl? Damit hatte sie nichts am Hut, kannte wie die meisten Menschen nur die archaischen Bilder von den Hochöfen. Doch sie erkannte damals, dass die Branche vor einer gigantischen Transformation steht – nicht nur, weil die Unternehmen wollen, sondern weil sie sich verändern müssen. Rippel fand das spannend, sagte zu und begann die große Tour durch die Stahlwerke in Deutschland.
Solange ihr Vertrag bei 50Hertz noch lief, fuhr sie dort an den Wochenenden hin, las nebenbei dicke Wälzer über die Stahlindustrie, die Technologie dahinter, die Historie. Heute kann die selbsternannte Newcomerin mit Fachbegriffen nur so um sich schmeißen – jeder Stahl-Nerd würde dahinschmelzen.
Nach ihrem Start krempelte sie einiges um, stellte die Kommunikation des Lobbyverbands neu auf: Rippel ist, anders als ihre Vorgänger, bei LinkedIn aktiv, tritt offener auf, gibt Interviews, will präsent in der Öffentlichkeit sein, um die große Story der Stahlindustrie zu erzählen: “Wir verursachen aktuell ein Drittel der Industrieemissionen, wollen das ändern – und dabei gleichzeitig die Wirtschaftskraft Deutschlands erhalten”, sagt Rippel. Mit grünem Stahl Made in Germany gelinge beides. “Wie wir das schaffen können und was wir dazu brauchen, das kommunizieren wir ganz offen, das ist doch eine spannende Geschichte.”
Dass die Geschichte bei der Politik, aber auch den Mitarbeitern in der Industrie verfängt, ist wichtig. Denn die sind besorgt. Wie soll diese Transformation aussehen? Was bedeutet das für den eigenen Arbeitsplatz, für die eigene Zukunft? Solche Sorgen lassen sich am einfachsten mit Förder-Milliarden beseitigen, das weiß auch Rippel.
Sowieso sei der Umbau ohne Geld aus der Politik nicht zu stemmen, glaubt die Lobbyisten: “Die Stahlindustrie muss sich von ihrem alten Businesscase verabschieden, um grünen Stahl zu produzieren.” Gleichzeitig gebe es für grünen Stahl im Wettbewerb heute noch keinen Businesscase – auch weil die Preise für Wasserstoff oder Strom viel zu hoch seien, führt Rippel aus. “Die Phase dazwischen sollen Fördermittel überbrücken, die wir brauchen, um ein erstes Angebot an grünem Stahl anzuregen.” Zuletzt durfte die Stahlindustrie sich über große Förderzusagen freuen, ein paar Milliarden hier, ein paar Milliarden da. Da konnte Rippel sich mit ihrer Überzeugung offenbar durchsetzen.
Im Mai ist sie ein Jahr im Amt, bisher scheint es gut zu laufen. Die Förderzusagen sind da, aus der Industrie gibt es bisher keine Unkenrufe und auch sie selbst sagt: “Ich bin zufrieden mit dem, was wir als Team schon geschafft haben.” Danach gefragt, gibt sie sich die Schulnote “Gut”, weil sie viel angestoßen habe. Ein “Sehr gut” wollte sie sich nicht geben. Es gebe ja noch genug zu tun. Nils Wischmeyer
Tilman Altenburg wurde von der Bundesregierung in den Nationalen Wasserstoffrat berufen. Das Expertengremium berät die Regierung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie. Altenburg ist Leiter des Forschungsprogramms “Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme” am German Institute of Development and Sustainability (IDOS) in Bonn.
Anna Herrhausen schließt sich dem Vorstand der Phineo an. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft in Berlin analysiert und berät zu strategischem gesellschaftlichen Engagement. Herrhausen war seit 2016 Geschäftsführerin der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, die zum Jahresende 2023 aufgelöst wurde.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Clima.Table – Österreich: Klimaforschung erhöht Druck im Regierungsstreit um Klimaplan: Gegen Österreich läuft aktuell ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, weil das Land seinen Nationalen Energie- und Klimaplan (NCEP) noch immer nicht eingereicht hat. Führende Klimaforschende haben nun vorgestellt, wie sich Österreichs Klimaziel doch noch erreichen lässt. Zum Artikel
Research.Table – Hohe Nachfrage bei Telefon-Hotline für bedrohte Wissenschaftler: Seit der Corona-Pandemie haben Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich zugenommen. Weil die Einrichtungen in den Hochschulen nicht immer kompetente Beratung anbieten konnten, wurde im Juli 2023 für kommunizierende Forschende die Anlaufstelle Scicomm-Support geschaffen. Zum Artikel
China.Table – Chinesische Autohersteller kämpfen mit Vertriebsproblemen: Um den Export zu stabilisieren, will China den Handel mit Elektroautos noch stärker staatlich unterstützen. Das dürfte bei der EU-Kommission für noch mehr Ärger sorgen. Zum Artikel
als “linksradikalen Müll” bezeichnet Donald Trump den Begriff ESG. Für den voraussichtlichen US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ist die Auseinandersetzung darüber Teil des Kulturkampfs, mit dem er die Wahl erneut gewinnen will. Eine solche Einordnung hätte der Schweizer Finanzfachmann Ivo Knoepfel wohl nicht erwartet, als er 2004 das Konzept erfand, um die finanziellen Risiken nicht nachhaltiger Unternehmensstrategien zu bemessen.
Seitdem hat sich ESG zu einem erfolgreichen Konzept entwickelt, mit dem Finanzinstitute nach Nachhaltigkeitskriterien Kapital anlegen. Substanzielle Kritik daran zielt vor allem auf die oft wenig transparenten und unambitionierten ESG-Kriterien. Trump hingegen geht ESG viel zu weit. Unser US-Korrespondent Laurin Meyer geht der Frage nach, wie es mit ESG-Kapitalanlagen weitergehen wird, falls Donald Trump erneut Präsident wird.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums leidet die deutsche Klimabewegung unter schwindender Aufmerksamkeit. Zum Klimastreik am 1. März will sie nun wieder auf die Straße gehen. Im Hintergrund diskutieren die Aktivisten von Fridays for Future und der “Letzten Generation” unterschiedliche Strategien, um wieder mehr Anklang zu finden. Lisa Kuner berichtet.
Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich die deutsche Stahlbranche währenddessen nicht beklagen, gehört sie doch zu den zentralen CO₂-Emittenten im Land. Die Branche muss gerade einen großen Wandel stemmen – weg vom braunen hin zum grünen Stahl. Kerstin Maria Rippel gestaltet diese Transformation als neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl mit. Nils Wischmeyer hat sie porträtiert.

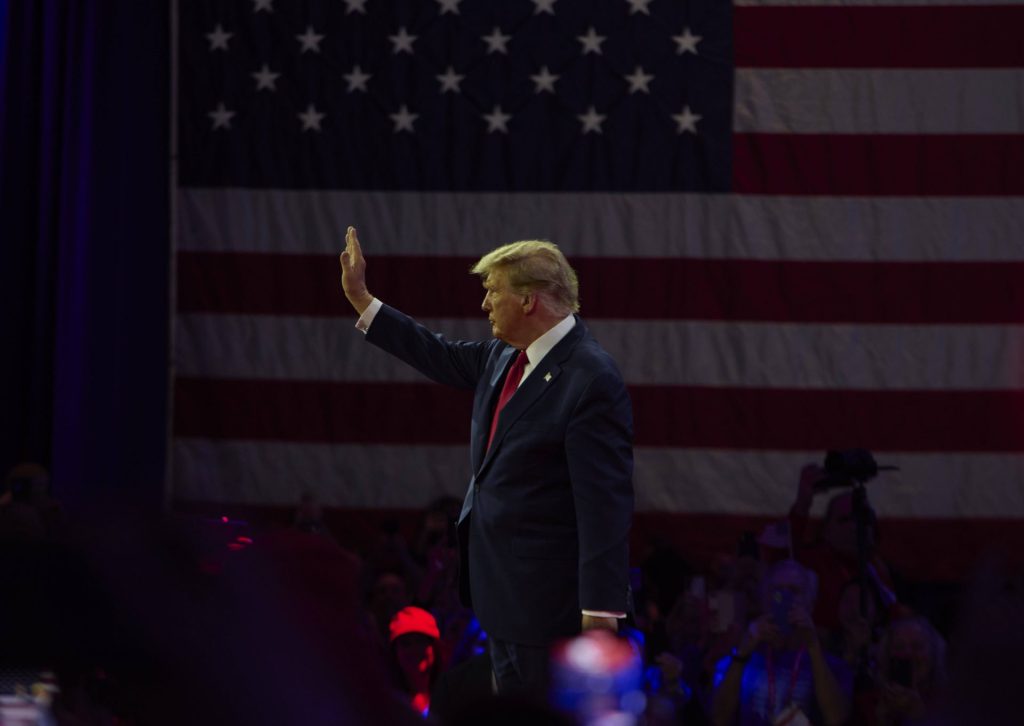
Donald Trumps Antworten auf den Umgang mit ESG-Kriterien könnten kaum einfacher klingen: Als “schlecht funktionierende Finanzbetrügereien” und “linksradikalen Müll” bezeichnet der wahrscheinliche US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner das Investieren nach ethischen und nachhaltigen Kriterien. “Es zerstört unser Land”, behauptet Trump in einem Wahlwerbespot.
Während Trump noch mit simplen Lösungen um die Gunst der Wähler buhlt, arbeiten Hunderte erzkonservative Republikaner bereits an einem detaillierten Playbook für seine mögliche Amtsführung – darunter auch an einem konkreten Vorgehen gegen ESG-Standards. Im sogenannten “Project 2025” haben sich mehr als 80 Organisationen unter der Leitung der Heritage Foundation, einer nationalkonservativen Denkfabrik aus Washington, zusammengeschlossen und ein 920 Seiten langes Regierungsprogramm ausgearbeitet. Auf knapp 14 Seiten davon befassen sich die Autoren mit der Zukunft grüner und sozialer Investitionsstandards. Sollten ihre Pläne umgesetzt werden, könnte der öffentlichkeitswirksame ESG-Fokus zu einem kostspieligen Risiko werden. Über ihre Bemühungen dürften Investoren und Unternehmen deshalb fortan deutlich häufiger schweigen, erwarten Experten.
Die Autoren des Programms bezeichnen ESG-Standards grundsätzlich als “ideologisch geprägte Politik”, die massiv Arbeitsplätze kosten und die amerikanische Energiesicherheit aufs Spiel setzen würde. Bislang bekamen vor allem die Manager von US-Pensionsfonds die Anti-ESG-Ausrichtung der Konservativen zu spüren. Einige republikanisch regierte Bundesstaaten haben bereits ihren milliardenschweren öffentlichen Pensionsfonds teils verboten, Geld nach ESG-Kriterien anzulegen. “Die Regierung sollte dem Beispiel mehrerer Bundesstaaten folgen und ihre Pensionsfonds nicht mehr von Managern wie BlackRock und State Street Global Advisers verwalten lassen, sondern einen wettbewerbsfähigen privaten Manager beauftragen, der seinen treuhänderischen Pflichten nachkommt”, heißt es im Programm.
Doch weitreichende Konsequenzen würden Finanzunternehmen fortan auch bei ihren privaten Geschäften drohen, sollten sie ESG-Standards weiter in den Mittelpunkt stellen. Der Vorwurf der Rechtskonservativen: Das grüne und soziale Engagement diene den Firmen als Reputationswäsche, mit der sie auf eine günstige Behandlung durch staatliche Akteure hoffen würden – so etwa bei der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Deshalb solle die nächste US-Administration den Kongress dazu aufrufen, die “ESG-Praktiken auf wettbewerbsfeindliche Aktivitäten und mögliche unfaire Handelspraktiken” zu untersuchen. Außerdem fordern die Autoren, unter der FTC eine eigene Task Force für ESG-Absprachen einzurichten. Diese solle dann prüfen, ob Firmen “diese Praktiken als Mittel zur Erreichung von Zielen, zur Festsetzung von Preisen oder zur Verringerung der Produktion einsetzen”, heißt es im Konzept.
Zuletzt zogen sich bereits einige Größen der Finanzwelt, darunter JPMorgan, State Street und Pimco, aus der Gruppe der sogenannten Climate Action 100+ zurück – einer internationalen Koalition von Vermögensverwaltern, die große Unternehmen dazu bewegen will, sich mit Klimaproblemen auseinanderzusetzen. Zudem hat BlackRock sein Engagement in der Gruppe zurückgefahren. Denn schon ohne eine republikanische US-Regierung fürchteten manche Ex-Mitglieder beim gemeinsamen Handeln kartellrechtliche Risiken oder Probleme wegen mangelnder Unabhängigkeit bei der Stimmrechtsvertretung.
Solche Risiken würden nur extremer werden, sollte Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen triumphieren, sagte Mark Campanale, Direktor der Denkfabrik Carbon Tracker, jüngst dem Medienunternehmen Bloomberg. Die langfristige Reaktion könnte eine sein, die Experten als “Greenhushing” bezeichnen. Damit ist gemeint, dass Akteure absichtlich wenig über ihre ESG-Bemühungen sprechen – aus Sorge vor der rechtskonservativen Gegenbewegung. Die Anti-ESG-Lobby habe Investoren “das Fürchten gelehrt”, sagte Campanale. “Institutionen werden sich weiterhin um Nachhaltigkeit bemühen, aber sie werden es tun, ohne sich dabei zur Schau zu stellen”, ist er überzeugt. Schließlich blieben Klimarisiken für die Unternehmen bestehen. Außerdem dürften Beschäftigte weiter auf eine nachhaltige und soziale Unternehmensführung drängen.
Die aufkommende Zurückhaltung lässt sich nicht nur in der Finanzwelt messen, sondern über alle Wirtschaftszweige hinweg. Die Führungskräfteberatung Teneo hat im Dezember weltweit rund 260 CEOs großer Unternehmen befragt, wie sie derzeit mit der fortschreitenden Politisierung des ESG-Begriffs umgehen. Fast die Hälfte behauptete demnach, ihre Bemühungen aufrechtzuerhalten, aber diese seltener nach außen zu kommunizieren. Acht Prozent der Befragten gaben an, wegen des sich verschärfenden Kulturkampfes ihre ESG-Bemühungen herunterzufahren.
Im ersten Quartal des vergangenen Jahres haben sich die S&P-500-Unternehmen bei ihren Bilanzkonferenzen (Earnings Calls) außerdem schon so selten zu ESG-Kriterien geäußert wie zuletzt im Sommer 2020. Insgesamt 74-mal soll der Begriff bei den Ergebnispräsentationen gefallen sein, wie das US-Finanzdatenunternehmen FactSet gezählt haben will. Ein Jahr zuvor sprachen die Unternehmen noch etwa doppelt so häufig explizit über die drei Buchstaben. Und gelegentlich zeigt sich der veränderte Umgang auch nur im Detail. Veröffentlichte Coca-Cola im Jahr 2022 noch einen “Business & ESG”-Report, hieß dieser im vergangenen Jahr bereits “Business & Sustainability”-Report.
Welche Programmpunkte aus dem Project 2025 Donald Trump im Falle eines Wahlsiegs umsetzen wird, bleibt abzuwarten. An einer Sache lässt er allerdings keinen Zweifel: Sollte er ins Weiße Haus zurückkehren, so sagt er, werde er gegen ESG ankämpfen. Laurin Meyer, New York

Am 1. März will Fridays for Future (FFF) zusammen mit der Gewerkschaft Verdi für Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr demonstrieren. Dieses Bündnis wurde bereits erprobt, ist aktuell aber auch der Versuch, wieder mehr Menschen zu erreichen und Sympathien zurückzugewinnen. Anders geht die Gruppe Letzte Generation vor: Sie hat für den 16. März zu “ungehorsamen Versammlungen” in verschiedenen deutschen Städten aufgerufen. Die unterschiedlichen Termine und verschiedenen Ansätze zeigen: Die deutsche Klimabewegung ist sich uneinig – und sucht nach neuen Strategien.
Im vergangenen Jahr mussten die Aktivistinnen und Aktivisten Niederlagen einstecken:
Auch wenn viele der Aktivistinnen und Aktivisten das nicht offen zugeben: Die meisten spüren den Wandel. Und innerhalb der verschiedenen Bewegungen gibt es Strategie- und Personalwechsel.
Wie keine andere Klimagruppierung hat die Initiative “Letzte Generation” im vergangenen Jahr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun bröckelt es hinter der nach außen so entschlossenen Fassade: Im Januar gaben die Aktivistinnen und Aktivisten bekannt, dass sie sich in Zukunft nicht mehr auf die Straße kleben werden. Anfang Februar verkündete die Sprecherin der Bewegung dann überraschend, dass die Bewegung für das Europaparlament kandidieren möchte. Mit Lina Johnsen und Theo Schnarr stellt die Bewegung zwei eher unbekannte Gesichter dafür auf.
Für Maria-Christina Nimmerfroh, die als Psychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Letzte Generation intensiv beobachtet hat, ist die Gruppierung klar in einer Krise: “Solche Bewegungen zerlegen sich immer von innen”, sagt sie zu Table.Media. Nicht der mediale Druck und auch nicht die harten Gerichtsverfahren brächten die Aktivisten aus dem Konzept, sondern interne Unstimmigkeiten und Streit.
Zuletzt habe sich gezeigt, dass die Organisationsstruktur der “funktionalen Hierarchie”, mit der die Gruppe Entscheidungen trifft, an ihre Grenzen stoße. Außerdem habe die Letzte Generation massive Nachwuchsprobleme. Es sei ihr bisher nicht gelungen, in größerem Maß junge Menschen für den Aktivismus zu rekrutieren. Das liege auch daran, dass die Organisation sehr hohe Ansprüche stelle – am besten sollte man sich in Vollzeit engagieren. Simon Teune, Protestforscher an der FU Berlin, fügt hinzu, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten “frustriert und ausgepowert” sind.
Das Gegenbeispiel bleibt Fridays for Future. Darya Sotoodeh, Sprecherin von FFF, betont im Gespräch mit Table.Media: “Unsere Stärke ist, dass wir für viele Menschen anschlussfähig sind”. Dazu gehören Demonstrationen mit breiten Bündnissen wie mit den Gewerkschaften am 1. März. Auch die Beteiligung an der Organisation der großen Demonstrationen gegen rechts Anfang des Jahres sei ein Teil dieser Strategie. Teune sagt, es sei klar geworden, dass “eine autoritäre, möglicherweise sogar faschistische Politik das Ende einer wirksamen Klimapolitik wäre”.
Aus Sicht von Nimmerfroh ist die Klimabewegung damit aber nicht nach links gerückt – im Gegenteil. Die “Letzte Generation” habe beispielsweise sogar “bürgerlich” wirken wollen und sich vom klaren linken Spektrum abgegrenzt. Grundsätzlich strebten die meisten Klimagerechtigkeitsbewegungen Überparteilichkeit an. “Die Wahrnehmung von Klimaschutzthemen als links kommt eher durch die politische Besetzung der Themen durch die Grünen und die Verbindung von einem nachhaltigen Lebensstil mit linken Assoziationen der Nonkonformität und des Konsumverzichts”, meint Nimmerfroh. Zum rechten Rand gibt es aber eine klare Abgrenzung: FFF will sich besonders auf die “Mobilisierung von jungen Menschen, insbesondere anlässlich der Wahlen in Europa und Sachsen, Thüringen und Brandenburg” konzentrieren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
Mit breiten Bündnissen versuche FFF zudem Menschen zu erreichen, die sich bisher noch nicht fürs Klima engagieren. Das zeigt auch die aktuelle Kampagne “Wir fahren zusammen” in der FFF, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs an der Seite der Dienstleistungsgesellschaft Verdi unterstützt.
Für Protestforscher Dieter Rucht ist das “im Prinzip” eine erfolgversprechende Strategie. “Die Bewegung gewinnt an Breite”, sagt er dazu. “Damit entsteht aber auch die Gefahr, dass die Bewegung an Profil verliert und es zu internen Konflikten kommt”.
“Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint auch Sotoodeh zur Allianz mit Verdi. Zum einen sei die Verkehrswende ein wichtiges Thema. Der bessere Ausbau vom Nahverkehr sowie bezahlbare Preise für Bus und Bahn sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten seien zum anderen Themen, hinter denen eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung stehe. Die Kampagne sei auch wichtig, weil sie zeige, dass sich soziale Verbesserungen nicht gegen Klimaschutz ausspielen ließen. Außerdem sei sie greifbar und habe somit das Potenzial, viele Menschen zu erreichen.
Finanziert werden soll der Ausbau des ÖPNV aus Sicht von FFF über ein 100-Milliarden-Sondervermögen für eine sozial-gerechte Transformation. “Nicht das Geld für sozial gerechten Klimaschutz fehlt, sondern der politische Wille, es dafür einzusetzen”, fügt die Aktivistin hinzu. Zudem habe ein Streik von Arbeitskräften noch einmal mehr Macht als ein Schulstreik.
Wie erfolgreich FFF mit dieser Strategie die Klimaagenda nach vorne bringt, ist aber noch offen: Simon Teune denkt, es brauche “ein Nachdenken darüber, welche Hebel mit den begrenzten Ressourcen in Bewegung gesetzt werden können”. Möglicherweise dienten erst neue Extremwetterereignisse oder noch höhere Temperaturen als “Augenöffner”, um wieder Menschen zu aktivieren.
Auch die Expertin für soziale Bewegungen Nimmerfroh hat das Gefühl, dass die Klimabewegung aktuell kaum gehört wird. Protestforscher Rucht sieht die Probleme, von einer Krise der Klimabewegung will er aber nicht sprechen. Stattdessen sagt er, sie befinde sich in einer “Phase der Neuorientierung“. Klar sei aber, dass “es so nicht weiter geht”. Weder der breite, freundliche Ansatz von FFF noch die auffälligen Aktionen der “Letzten Generation” brächten signifikante politische Erfolge.
Das geplante Bundestariftreuegesetz sei für die FDP “untrennbar mit einer unbürokratischen Vergabereform verbunden”, sagte Carl-Julius Cronenberg, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Mittelstand, zu Table.Media. Da das Gesetz “unweigerlich mit neuer Bürokratie” einhergehen würde, sei es wichtig, “jegliche zusätzliche Belastung durch eine gleichzeitige Entlastung bei der Vergabereform mehr als auszugleichen”.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plante ursprünglich, das Gesetz vor der Sommerpause 2023 vorzulegen. Doch die “regierungsinternen Gespräche zum Bundestariftreuegesetz dauern an”, teilte eine Ministeriumsprecherin mit. Das Gesetz soll Unternehmen verpflichten, bei öffentlichen Aufträgen des Bundes ab einem bestimmten Wert Tarifverträge einzuhalten.
Ob sich die Erarbeitung des Bundestariftreuegesetzes verzögert, weil die Ressorts es zusammen mit dem Vergabetransformationspaket verhandeln, wollte das Arbeitsministerium nicht kommentieren. Die Vergaberechtsreform wird aktuell im Wirtschaftsministerium erarbeitet. Sie soll öffentliche Vergaben vereinfachen und beschleunigen, sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlicher machen. Beide Vorhaben sollen im ersten Halbjahr dieses Jahres durch das Kabinett gehen.
Die Nachfragemacht der öffentlichen Hand von mehreren hundert Milliarden Euro pro Jahr wird von Fachleuten als Hebel gesehen, um ökologischen und sozialen Wandel voranzubringen – wie Klimaschutz oder angemessene Löhne. Auch daher gibt es die Forderung, die inzwischen stark gesunkene Tarifbindung in Deutschland durch Tariftreueregelungen zu stärken.
“Das lange angekündigte Bundestariftreuegesetz muss nun schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden”, sagte Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Dies würde die Tarifbindung stärken, wie es die neue EU-Mindestlohnrichtlinie vorsehe, die bis Ende dieses Jahres in nationales Recht umgesetzt werden müsse. “Alles, was die Wirksamkeit des Bundestariftreuegesetzes konterkariert und unterhöhlt, lehnen wir strikt ab”, betont Körzell. nh
Sieben Thüringer Universitäten und Hochschulen haben sich zum Projekt “Thüringen Lehrt und Lernt Nachhaltig” (ThüLeNa) zusammengeschlossen. Ziel der Kooperation sei es, “Nachhaltigkeit als zentrales Element in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen zu verankern und so die Studierenden optimal auf die Herausforderungen einer sich rasant verändernden Welt vorzubereiten”, heißt es in einer Mitteilung der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in Jena. An der EAH laufen künftig die Fäden des Programms zusammen.
Für Frank Pothen, Wirtschaftsprofessor an der EAH und Koordinator von ThüLeNa, ist das Projekt “ein wegweisender Schritt für den Bildungsstandort Thüringen”. Es unterstreiche das Engagement der beteiligten Hochschulen für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Bildung und führe zu einer Stärkung der Ingenieurausbildung im Freistaat, meint Pothen.
Neben der EAH sind die Bauhaus-Universität Weimar, die Fachhochschule Erfurt, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Hochschule Nordhausen, die Hochschule Schmalkalden und die Technische Universität Ilmenau beteiligt.
Gemeinsam wollen sie in den nächsten Jahren digitale Module zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen entwickeln, die “idealerweise zu einem hochschulübergreifenden Zertifikatsprogramm kombiniert werden können, das Studierenden eine Zusatzqualifikation im Bereich Nachhaltigkeit bietet”, heißt es.
Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt das Projekt in den kommenden drei Jahren mit insgesamt 2,5 Millionen Euro. “Damit technische Entwicklungen auch Nachhaltigkeitsaspekten genügen, benötigen wir Fachkräfte, die sowohl über profundes Fachwissen als auch Nachhaltigkeitskompetenzen verfügen”, begründet Geschäftsführer Felix Streiter das Engagement.
Die Carl-Zeiss-Stiftung mit Sitz in Jena ist eine der ältesten und größten privaten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland. Sie ist alleinige Eigentümerin der Carl Zeiss AG und der SCHOTT AG. Ihre Projekte werden aus den Dividendenausschüttungen der beiden Stiftungsunternehmen finanziert. ch
Die stellvertretenden Botschafter der EU-Mitgliedstaaten haben am Mittwoch über einen neuen Kompromissvorschlag der belgischen Ratspräsidentschaft zur EU-Verpackungsverordnung beraten. Laut dem Entwurf, den die französische Nachrichtenplattform Contexte Anfang der Woche veröffentlichte, hält die Ratspräsidentschaft an Maßnahmen fest, die Verpackungsmüll vermeiden sollen, darunter auch die Ziele für Mehrwegsysteme.
Die Ratspräsidentschaft sieht laut dem Kompromissvorschlag Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungsabfällen als ein entscheidendes Element der Verordnung. Die EU-Vorgaben würden den Mitgliedstaaten die notwendigen Instrumente zur Abfallverringerung verleihen (Artikel 38). Daher sehe die Ratspräsidentschaft in den Verhandlungen “eine sehr begrenzte Flexibilität bei der Beschränkung auf bestimmte Verpackungsformate“. Das Parlament fordert dazu eine Reihe von Streichungen und Ausnahmeregeln.
Dennoch will die Ratspräsidentschaft “eine gewisse Offenheit gegenüber dem Parlament” zeigen und schlägt ein Kompromisspaket vor: Demnach könnte die Frist zur Umsetzung in den Mitgliedstaaten verschoben und zusätzliche Ausnahmen hinsichtlich der Verbote für unnötige Verpackungsformate geschaffen werden (Anhang V). Die Ratspräsidentschaft erwarte hier “großen Druck” vonseiten des Parlaments.
Zum Kompromissvorschlag gehört auch eine Überarbeitung der Mehrwegziele (Artikel 26). Verschiedene Formen von Verpackungen und Ausnahmen sollen klarer zusammengefasst werden. Die Ratspräsidentschaft werde darauf bestehen, dass Mehrwegziele für Speisen und Getränke zum Mitnehmen erhalten bleiben; für alkoholische und nicht-alkoholische Getränke sollen allgemeinere Formulierungen verwendet werden.
Am kommenden Montag beginnt der zweite Trilog und wird voraussichtlich sehr lang dauern, da die Verhandelnden aus Rat, Parlament und Kommission eine Einigung anstreben. Bereits geeinigt hatten sich Rat und Parlament beim ersten politischen Trilog am 5. Februar unter anderem über die Ziele für den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen und die Bestimmungen über biobasierten Kunststoff (Artikel 7).
Die Berichterstatterin für die Verpackungsverordnung im EU-Parlament, Frédérique Ries (Renew), hingegen schlug gestern eine Ausnahmeregelung für die Verbote für Einwegverpackungen sowie für die Mehrwegpflichten vor. Das entsprechende Dokument veröffentlichte ebenfalls Contexte. Sie will damit “Ländern wie Italien oder Finnland, die über ein effizientes Recyclingsystem verfügen und nicht auf das Wiederverwendungssystem umstellen wollen” entgegenkommen, zumindest in Bezug auf den Gastronomiesektor.
Konkret formuliert sie folgende Vorschläge:
Mehr als 50 Prozent der Beschäftigten von Mercedes-Benz in Vance, Alabama, haben Unterstützerkarten für die Gründung einer Gewerkschaft unterschrieben. Das teilte die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft UAW diese Woche mit.
Damit wäre Mercedes nach Volkswagen der zweite deutsche Automobilhersteller in den USA, bei dem sich innerhalb weniger Wochen eine Mehrheit der Belegschaft für eine Interessenvertretung ausgesprochen hat. Eine Zustimmung von 30 Prozent hätte ausgereicht, um Gewerkschaftswahlen bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Die selbst gesetzte Schwelle der UAW liegt jedoch bei 70 Prozent.
Das 1995 errichtete Mercedes-Werk war der erste große Pkw-Produktionsstandort des Stuttgarter Automobilherstellers außerhalb Deutschlands und beschäftigt heute rund 6.100 Mitarbeiter. In Vance werden SUV für den nordamerikanischen und den Weltmarkt gebaut.
Nach den erfolgreichen Tarifverhandlungen bei den drei großen US-Autobauern Ford, General Motors und Stellantis im vergangenen Herbst hat die UAW eine groß angelegte Organizing-Kampagne angekündigt. Wie sie kürzlich mitteilte, will sie dafür in den nächsten zwei Jahren 40 Millionen US-Dollar einsetzen. Die Gewerkschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als ein Dutzend Automobilwerke ohne Gewerkschaftsvertretung zu organisieren, unter anderem bei VW, Mercedes und BMW. Deren US-Werke befinden sich in den traditionell gewerkschaftsfeindlichen Südstaaten Alabama (Mercedes), Tennessee (VW) und South Carolina (BMW). ch
Erweiterte Regeln zu Subventionen für Fischerei und Landwirtschaft dominieren die Verhandlungen bei der Konferenz der Welthandelsorganisation in Abu Dhabi. Die bis gestern terminierte Konferenz ging bei Redaktionsschluss in eine Verlängerung.
Das letzte erfolgreich abgeschlossene Abkommen der WTO war ein Fischereisubventionsabkommen vor zwei Jahren. Es schränkt Beihilfen ein für illegale und unregulierte Fischerei und in Gebieten mit kritisch niedrigen Fischbeständen. Es war das erste WTO-Abkommen, das Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Mittelpunkt stellt. Bislang haben 70 Mitgliedsstaaten das Abkommen ratifiziert, 40 weitere müssen sich noch anschließen, damit das Abkommen in Kraft tritt.
Die in Abu Dhabi nun verhandelte Erweiterung soll:
Um die letzten beiden Punkte gibt es Uneinigkeit bei den Verhandlungen: Entwicklungsländer reklamieren, dass sie Nachhaltigkeits-Berichterstattung nicht leisten könnten und ihre kleinen Fischereibetriebe schützen müssten.
Der indische Handelsminister Piyush Goyal kritisierte generell die Vermischung von Umwelt- und Handelsthemen: “Das sind zwei separate Themen”, sagte er der Financial Times. Die Einbettung von Nachhaltigkeitsthemen in Handelsabkommen durch reiche Länder sei “voreingenommen”.
Der stellvertretende Premierminister von Fiji sagte hingegen gegenüber Reuters, das Fischereiabkommen gehe nicht weit genug. “Wir möchten, dass die großen subventionierenden Länder eine Obergrenze für die derzeitige Höhe der Subventionen festlegen”, so Manoa Seru Kamikamica.
Eine Studie der NGO Environmental Justice Foundation (EJF) zeigt währenddessen, welche Folgen die Grundschleppnetzfischerei für die Fischpopulationen vor Thailands Küste hat. Laut der Organisation ist der wirtschaftliche und ökologische Schaden so immens, dass “weite Teile der thailändischen Fischgründe” ihren Wert zu verlieren drohen.
“Die unkontrollierte Fischerei mit Gespannschleppnetzen zerstört wertvolle Meeresökosysteme, die die Lebensgrundlage und Ernährungssicherheit in ganz Thailand sichern”, sagt Steve Trent, Geschäftsführer und Gründer von EJF. Ein Instrument, diese Art der zerstörerischen Fischerei zu verhindern, sei der Abbau der Steuerbefreiung für “green oil”. Dieser Treibstoff, der nur jenseits der 12-Meilen-Zone verkauft werden darf, begünstigt vor allem große Schiffe. Für 2021 beziffert EJF die Subvention auf 115 Millionen US-Dollar. av
Jedes vierte Unternehmen in Europa macht bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie deutliche Fortschritte, in Deutschland sind es 33 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer Studie des IBM Institute for Business Value. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte aus 22 Branchen in 22 Ländern.
Das Thema Nachhaltigkeit sei tief in den Betriebsabläufen verankert und dies zahle sich aus, heißt es. Dass nachhaltig agierende Unternehmen höhere Gewinne erzielen, sei wahrscheinlich. Aber: Nach Ansicht der Studienautoren deuten die Ergebnisse auch darauf hin, dass sich viele Unternehmen vor allem mit der Erfüllung ihrer Berichtspflichten beschäftigen. Das Gewinnpotenzial bleibt oft ungenutzt, da es an gezielten Investitionen fehlt. So überstiegen die Ausgaben für Nachhaltigkeitsberichte diejenigen für entsprechende Innovationen um 47 Prozent.
Fast die Hälfte der Befragten hätten Schwierigkeiten, die entsprechenden Investitionen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu finanzieren. “Sechs von Zehn sagten aus, dass sie zwischen finanziellen Ergebnissen und nachhaltigen Resultaten Kompromisse eingehen müssten”. 72 Prozent der Befragten seien sich einig, dass generative KI für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen wichtig sein werde. cd
Climate Investors Warn the Right Is Winning the War on ESG – BNN Bloomberg
Wenn die globale Erwärmung politisiert wird, können professionelle Investoren ihren Job nicht mehr richtig machen. Das ist die zentrale Botschaft von Climate Action 100+, der weltweit größten Investorenkoalition für den Klimaschutz, nachdem einige ihrer wichtigsten Mitglieder die Gruppe diesen Monat verlassen haben, berichtet Alastair Marsh. Zum Artikel
Scientists Are Freaking Out About Ocean Temperatures – New York Times
Die Weltmeere waren im vergangenen Jahr deutlich wärmer als üblich. Der vergangene Monat war der wärmste Januar, der jemals in den Weltmeeren gemessen wurde. Seitdem sind die Temperaturen weiter gestiegen. Besonders ausgeprägt war die Hitzewelle im Nordatlantik. Die Wissenschaftler sind alarmiert, schreibt David Gelles. Zum Artikel
Europa baut die grüne Festung – Spiegel
Michael Sauga kritisiert in einer Kolumne eine unausgesprochene Allianz aus Umweltschützern und Bauernvertretern, die gemeinsam internationale Freihandelsabkommen verhindern. Aktuelles Beispiel: Mercosur. Dabei könne die EU ein Vorreiter für Nachhaltigkeit sein, müsse dafür aber auf “sogenannte Nachhaltigkeitskapitel” verzichten, “die den Regierungen der Partnerstaaten bis ins Detail vorschreiben, wie sie ihre Umwelt- und Klimapolitik zu gestalten haben”. Zum Artikel
Die EU macht sich erpressbar – Süddeutsche Zeitung
Mit Blick auf die Reaktionen der Brüsseler Politik auf die Proteste der Landwirte kommentiert Josef Kelnberger, “fatal ist der Eindruck, die europäische Politik sei erpressbar”. Falsch sei es auch, wenn Klimaschutz der EU als eine “Art Brüsseler Schönwetterpolitik” erscheine, “die man in Krisenzeiten schnell abwickeln kann”. Zum Artikel
“59 Euro für eine Jeans aus Mönchengladbach ist doch supergut” – Süddeutsche Zeitung
Klare Worte findet die neue C&A-Chefin Giny Boer im Interview mit Michael Kläsgen dafür, warum sich die Textilindustrie ändern müsse: Die “Industrie ist einer der größten Umweltverschmutzer und ungenutzte Kleidung wird vernichtet”. Es gehe ihr darum, geringere Mengen zielgerichteter zu produzieren: “Wer weniger Kleidung vertreibt, handelt automatisch nachhaltiger”. Zum Artikel
Blue Jeans ohne Gift: Forschende entwickeln neues Verfahren – Basler Zeitung
Die Umweltbelastung beim Färben von Denim ist enorm. Joachim Laukenmann berichtet, dass Forschende aus Dänemark und Island ein nachhaltiges Verfahren entwickelt haben. Das könnte dazu führen, dass die Industrie einen Teil ihrer Produktion in westliche Länder zurückverlagert. Zum Artikel
“Verbrenner bleiben bis 2035 im Programm” – Automobil Industrie
Überboten sich die Hersteller bis vor kurzem noch mit möglichst kurzen Laufzeiten bis zum Ende des Verbrennungsmotors, kommt jetzt die Gegenwelle. Zum Beispiel Skoda. CEO Klaus Zellmer stellt klar, dass man bis zum gesetzlichen Ende des Verbrennungsmotors Benzin und Diesel liefern will, wie Andreas Grimm berichtet. Zum Artikel
African leaders call for equity over minerals used for clean energy – Guardian
Auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi hat eine Gruppe von überwiegend afrikanischen Staaten eine Resolution vorgestellt. Sie fordert einen Strukturwandel, damit Staaten, die Rohstoffe für die Energiewende abbauen, stärker an der Wertschöpfung partizipieren. Bislang würden die Rohstoffe direkt nach dem Abbau exportiert, wodurch viele Potenziale verloren gingen. Zum Artikel

Kerstin Maria Rippel konnte ihren Job offenbar kaum erwarten. Schon Monate, bevor sie die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl wurde, setzte sie sich ins Auto und fuhr zu Stahlproduktionen in ganz Deutschland. “Man kann viel lesen, viel reden, aber ich wollte die Industrie erleben, anschauen und auch riechen”, sagt Rippel. Was ihr früh dabei auffiel: Die Menschen vor Ort hätten eine hohe Identifikation mit ihrer Arbeit, seien wahnsinnig stolz auf den Stahl, den sie dort produzieren.
Nur: Die Stahlindustrie steckt bis zum Hals in der Krise und muss gerade parallel noch einen großen Wandel stemmen. Die CO₂-Emissionen müssen runter und dafür müssen die Stahlgiganten auf grünen Strom und grünen Wasserstoff umrüsten. Das wiederum ist teuer und für die Industrie enorm anstrengend.
Rippel ist es nun, die in diesem heiklen Terrain kommunikativ navigieren muss. Sie muss die Politik überzeugen, dass die Stahlbranche überlebensnotwendig für den Standort Deutschland ist. Sie muss die Unternehmen zusammenbringen, um einheitlich auftreten zu können. Sie muss den Verband modernisieren – und dann müssen die Stahlarbeiter vor Ort noch bei Laune gehalten werden, damit die Stimmung nicht kippt. All das ist eine riesige Herausforderung, der sich Rippel jetzt stellen muss.
Über sich selbst sagt die 51-Jährige, dass sie eine Newcomerin in der Branche ist, und das passt. Studiert hat Rippel schließlich Jura in Saarbrücken und Stuttgart, hat später noch eine journalistische Ausbildung absolviert und sich ihre ersten Sporen beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft verdient. Dort arbeitete sie als Pressesprecherin, bevor sie 2013 zum Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz wechselte, wo sie einen rasanten Aufstieg hinlegte. Von der Teamleiterin für Energiepolitik schaffte sie es in nicht einmal sechs Jahren zur Prokuristin, bevor 2023 dann der Ruf aus der Stahlbranche kam: Frau Rippel, wollen Sie nicht mal etwas ganz Neues machen und unsere Wirtschaftsvereinigung führen?
Rippel erinnert sich noch gut an die Anfrage. Stahl? Damit hatte sie nichts am Hut, kannte wie die meisten Menschen nur die archaischen Bilder von den Hochöfen. Doch sie erkannte damals, dass die Branche vor einer gigantischen Transformation steht – nicht nur, weil die Unternehmen wollen, sondern weil sie sich verändern müssen. Rippel fand das spannend, sagte zu und begann die große Tour durch die Stahlwerke in Deutschland.
Solange ihr Vertrag bei 50Hertz noch lief, fuhr sie dort an den Wochenenden hin, las nebenbei dicke Wälzer über die Stahlindustrie, die Technologie dahinter, die Historie. Heute kann die selbsternannte Newcomerin mit Fachbegriffen nur so um sich schmeißen – jeder Stahl-Nerd würde dahinschmelzen.
Nach ihrem Start krempelte sie einiges um, stellte die Kommunikation des Lobbyverbands neu auf: Rippel ist, anders als ihre Vorgänger, bei LinkedIn aktiv, tritt offener auf, gibt Interviews, will präsent in der Öffentlichkeit sein, um die große Story der Stahlindustrie zu erzählen: “Wir verursachen aktuell ein Drittel der Industrieemissionen, wollen das ändern – und dabei gleichzeitig die Wirtschaftskraft Deutschlands erhalten”, sagt Rippel. Mit grünem Stahl Made in Germany gelinge beides. “Wie wir das schaffen können und was wir dazu brauchen, das kommunizieren wir ganz offen, das ist doch eine spannende Geschichte.”
Dass die Geschichte bei der Politik, aber auch den Mitarbeitern in der Industrie verfängt, ist wichtig. Denn die sind besorgt. Wie soll diese Transformation aussehen? Was bedeutet das für den eigenen Arbeitsplatz, für die eigene Zukunft? Solche Sorgen lassen sich am einfachsten mit Förder-Milliarden beseitigen, das weiß auch Rippel.
Sowieso sei der Umbau ohne Geld aus der Politik nicht zu stemmen, glaubt die Lobbyisten: “Die Stahlindustrie muss sich von ihrem alten Businesscase verabschieden, um grünen Stahl zu produzieren.” Gleichzeitig gebe es für grünen Stahl im Wettbewerb heute noch keinen Businesscase – auch weil die Preise für Wasserstoff oder Strom viel zu hoch seien, führt Rippel aus. “Die Phase dazwischen sollen Fördermittel überbrücken, die wir brauchen, um ein erstes Angebot an grünem Stahl anzuregen.” Zuletzt durfte die Stahlindustrie sich über große Förderzusagen freuen, ein paar Milliarden hier, ein paar Milliarden da. Da konnte Rippel sich mit ihrer Überzeugung offenbar durchsetzen.
Im Mai ist sie ein Jahr im Amt, bisher scheint es gut zu laufen. Die Förderzusagen sind da, aus der Industrie gibt es bisher keine Unkenrufe und auch sie selbst sagt: “Ich bin zufrieden mit dem, was wir als Team schon geschafft haben.” Danach gefragt, gibt sie sich die Schulnote “Gut”, weil sie viel angestoßen habe. Ein “Sehr gut” wollte sie sich nicht geben. Es gebe ja noch genug zu tun. Nils Wischmeyer
Tilman Altenburg wurde von der Bundesregierung in den Nationalen Wasserstoffrat berufen. Das Expertengremium berät die Regierung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie. Altenburg ist Leiter des Forschungsprogramms “Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme” am German Institute of Development and Sustainability (IDOS) in Bonn.
Anna Herrhausen schließt sich dem Vorstand der Phineo an. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft in Berlin analysiert und berät zu strategischem gesellschaftlichen Engagement. Herrhausen war seit 2016 Geschäftsführerin der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, die zum Jahresende 2023 aufgelöst wurde.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!
Clima.Table – Österreich: Klimaforschung erhöht Druck im Regierungsstreit um Klimaplan: Gegen Österreich läuft aktuell ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, weil das Land seinen Nationalen Energie- und Klimaplan (NCEP) noch immer nicht eingereicht hat. Führende Klimaforschende haben nun vorgestellt, wie sich Österreichs Klimaziel doch noch erreichen lässt. Zum Artikel
Research.Table – Hohe Nachfrage bei Telefon-Hotline für bedrohte Wissenschaftler: Seit der Corona-Pandemie haben Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich zugenommen. Weil die Einrichtungen in den Hochschulen nicht immer kompetente Beratung anbieten konnten, wurde im Juli 2023 für kommunizierende Forschende die Anlaufstelle Scicomm-Support geschaffen. Zum Artikel
China.Table – Chinesische Autohersteller kämpfen mit Vertriebsproblemen: Um den Export zu stabilisieren, will China den Handel mit Elektroautos noch stärker staatlich unterstützen. Das dürfte bei der EU-Kommission für noch mehr Ärger sorgen. Zum Artikel
