erinnern Sie sich noch an das Bedingungslose Grundeinkommen? Es ist ein paar Jahre her, dass diese Idee die Gedanken vieler Menschen beflügelte. Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn jeder 1000 Euro im Monat bekäme und nicht gezwungen wäre, seine Existenz durch eine selbstständige oder abhängige Beschäftigung zu sichern? Es wurden Initiativen gestartet, Artikel und Bücher geschrieben und Debatten geführt – inzwischen aber hört man vom Grundeinkommen nichts mehr.
Momentan gibt es ein neues Thema, das für Aufregung sorgt. Diesmal geht es um die Viertagewoche. Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn jeder nur noch 32 Stunden arbeiten müsste, womöglich sogar bei vollem Lohnausgleich? So lautet diesmal die Frage. Und wieder werden leidenschaftliche Diskussionen geführt: Top-Manager sehen den Untergang Deutschlands bevorstehen, Befürworter weisen auf den krankmachenden Stress hin, den Arbeit verursacht, und dass so ein Modell auch für Umwelt und Klima Vorteile hätte. Wer liegt richtig?
Die Antwort darauf werden wir frühestens in einem Jahr bekommen. Dann nämlich, wenn die Auswertung eines kommenden Pilotversuchs auf dem Tisch liegt, den wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen und für den noch experimentierfreudige Unternehmen als Teilnehmer gesucht werden. Ein Jahr – das ist nach heutigen Maßstäben natürlich noch ewig lange hin. Bis dahin kann die Viertagewoche schon so tot sein wie das Grundeinkommen.
Andererseits: Die Versachlichung eines so wichtigen Themas und die Unterfütterung mit Daten und Fakten braucht einfach Zeit. Wäre schön, wenn alle Diskutanten abwarten würden, was aus diesem ersten Experiment herausgekommen ist.

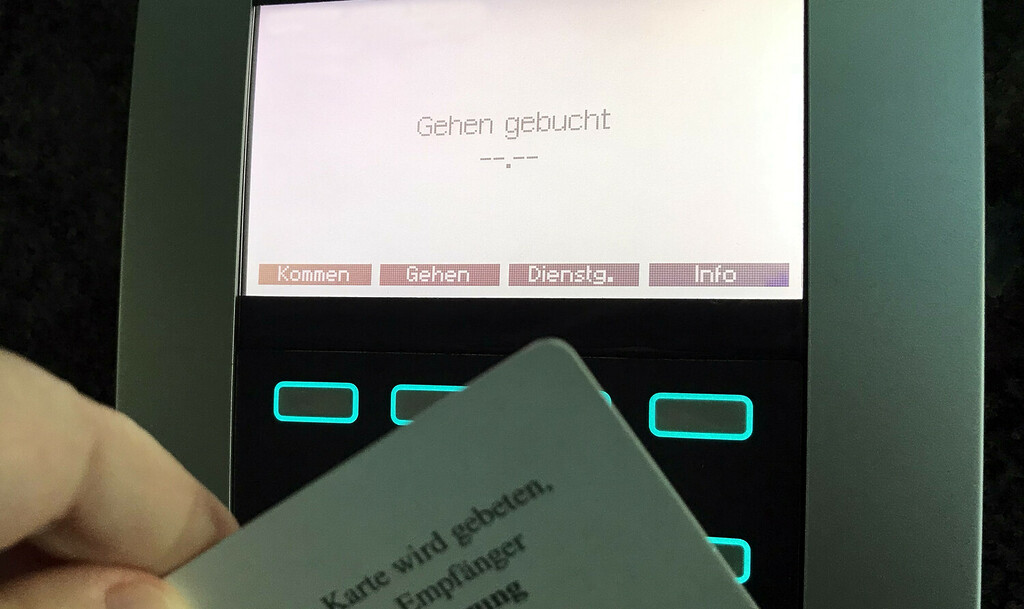
Arbeit strukturiert den Tag, sichert die Existenz und bringt Anerkennung. Sie setzt aber auch unter Stress, führt zu psychischen Problemen und macht krank. Wäre es also ratsam, die Zeit im Büro oder auf der Baustelle zu reduzieren, um die positiven Aspekte zu erhalten und die negativen zu eliminieren?
Für eine neue Studie haben sich die Berliner Agentur Intraprenör, die internationale Organisation 4 Day Week Global und der Lehrstuhl für Transformation der Arbeitswelt der Universität Münster zusammengeschlossen, um genau diese Frage zu untersuchen. Sie wollen wissen, ob sich die Viertagewoche im Alltag bewährt und welche Nachteile daraus entstehen.
Unternehmen in ganz Deutschland, die an dem Versuch teilnehmen wollen, können sich bis Ende November bewerben. Die Praxisphase läuft von Februar bis August 2024, anschließend erfolgt die wissenschaftliche Auswertung.
Vier Tage arbeiten und fünf Tage lang bezahlt werden – darüber ist in den vergangenen Monaten vielfach diskutiert worden, zum Teil vehement. Vor allem Top-Manager meldeten sich mit markigen Worten. Telekom-Chef Tim Höttges sagte, “Wohlfühlthemen” wie die Viertagewoche seien “absurd angesichts der zurückgehenden Produktivität”. Für BMW-Chef Oliver Zipse ist die Debatte ein “irritierendes Signal”, VW-Chef Oliver Blume erklärte, Diskussionen um mehr Work-Life-Balance oder eine Viertagewoche bei gleicher Bezahlung gingen “in die falsche Richtung”. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hält den Vorschlag “wirtschaftlich für eine Milchmädchenrechnung”, Stihl-Chef Michael Traub sieht darin gar “das Ende des Industriestandorts Deutschland”. Er droht: “Wir können auch anderswo produzieren.”
Kritiker argumentieren, dass Deutschland es sich vor allem derzeit nicht leisten könne, solche Experimente zu riskieren. Corona, der Krieg, steigende Kosten und einbrechende Gewinne hätten den finanziellen Spielraum stark eingeengt. Die Wirtschaft krankt, Projekte werden aufgeschoben, nicht mal für dringend benötigte Wohnungen ist genügend Geld da, wie der kürzlich verkündete Baustopp von 60.000 Einheiten bei Vonovia zeigt. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften.
Befürworter halten dagegen, dass die Arbeit so, wie sie momentan organisiert ist, nachweislich spürbare Konsequenzen habe. Die Verdichtung der Arbeit, etwa durch die Digitalisierung, habe zugenommen, Corona habe zusätzlich gezeigt, unter wie viel Druck viele Menschen stehen. Die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen sind gestiegen.
Und dann ist da noch die junge Generation, die gerade ins Berufsleben startet. Sie legt mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Job und Freizeit als vorige Generationen und sieht seltener eine Erfüllung darin, das Privatleben für die Karriere aufzugeben. Weniger als 40,4 Stunden pro Woche zu arbeiten, wie es die Deutschen im Schnitt machen, das ist für nicht wenige eine verlockende Aussicht.
Warum genau Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, dazu hat die Hans-Böckler-Stiftung kürzlich die Deutschen befragt. Demnach wünschen sich die Befürworter eine Viertagewoche, weil
Gefragt wurde auch nach den Gründen, die gegen eine Viertagewoche sprechen. Demnach sagten die Gegner des Konzepts, dass
Die Initiatoren der geplanten Studie im kommenden Jahr beobachten, dass die Auseinandersetzungen bislang überwiegend meinungsgetrieben und anekdotisch geführt werden. Carsten Meier hat in der von ihm gegründeten Agentur Intraprenör schon vor sieben Jahren die Viertagewoche eingeführt und berät Unternehmen bei Change-Prozessen wie der Arbeitszeitverkürzung. Von der Wucht, die das Thema in letzter Zeit bekommen hat, ist er überrascht worden, sagt er. “Die starken Emotionen in der Debatte zeigen, dass an einer Konvention gerüttelt wird, die wir alle lange nicht mehr hinterfragt haben.”
Mit der Studie will er zu einer Versachlichung beitragen. Andere Länder sind bei der Erhebung von Daten schon weiter – in England beispielsweise nahmen 2022 fast 3000 Mitarbeitende in 61 Unternehmen an einem ähnlichen Versuch teil und lieferten neue Erkenntnisse. Eine ähnliche Zahl von Teilnehmern strebt Meier auch für Deutschland an. Wer mitmachen will, muss je nach Größe zwischen 500 Euro (weniger als 10 Mitarbeitende) und 15.200 Euro (mehr als 1000) zahlen, wird aber auch umfangreich betreut, so das Versprechen.
Unterstützung kommt von Mentoren, die den Prozess selbst schon mal durchlaufen haben, und dem wissenschaftlichen Team der Uni Münster. Zudem werde man mit teilnehmenden Unternehmen verknüpft. Sollten die Mitarbeitenden dazu bereit sein, kann auch ihr individuelles Wohlbefinden in die Analyse einfließen; digitale Tracker würden dann den Schlaf und die Herzfrequenz überwachen.
Carsten Meier sagt, dass Firmen im Vorfeld ein paar Fragen für sich klären sollten, etwa die, wie sich der temporäre Viertageversuch mit dem jeweils gültigen Tarifvertrag vereinbaren lässt. “Im Zweifel haben wir ein Netzwerk von Arbeitsrechtsexperten, die dazu beraten können.”
Zudem weist er darauf hin, dass es für die Umsetzung verschiedene Optionen gäbe. Von montags bis donnerstags arbeiten und freitags bleiben alle zu Hause: Das sei lediglich ein Modell unter vielen. Für die Studie gehe es darum, das jeweils passende zu finden. Außerdem müsse nicht ein gesamtes Unternehmen mitmachen. Das Experiment lasse sich auf einzelne Abteilungen oder Tochterfirmen begrenzen. Sollte im Idealfall zusätzlich eine Kontrollgruppe zur Verfügung stehen, die – anders als ihre Kollegen – nicht in den Genuss von mehr freier Zeit kämen, könne er dabei helfen, den Kulturbruch zu moderieren.
Bei Studien in anderen Ländern hat sich laut der Organisation 4 Day Week Global gezeigt, dass die Zahl der Krankmeldungen und Burn-Out-Fälle sank, die Umwelt und das Klima profitierten, weil weniger Menschen zwischen Arbeit und Wohnung pendeln mussten, und dass die Produktivität dank einer veränderten Organisation der Arbeit gleich blieb. In England erklärten mehr als 90 Prozent der Firmen nach Ablauf des Tests, an dem Modell festzuhalten.
Zugleich räumen die Initiatoren ein, dass es noch an Langzeituntersuchungen und Daten aus großen Unternehmen fehlt. Bislang waren es vor allem kleine und mittlere Firmen, die das Experiment eingingen. Vielleicht ändert sich das in Deutschland bald, auch ohne Studie. Die IG Metall will in der bevorstehenden Tarifrunde der Stahlindustrie nicht nur 8,5 Prozent mehr Gehalt und Altersteilzeit durchsetzen, sondern auch eine 32-Stunden-Woche. So einschneidend, wie der Schritt klingt, wäre er im Übrigen gar nicht. Die Arbeitszeit wurde in der Vergangenheit schon reduziert – auf aktuell 35 Stunden pro Woche.

Die Sustainable-Finance-Regulierung der EU ist nicht ausreichend auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgerichtet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Zusammenarbeit mit Eurochambres und SME United. Befragt wurden rund 2.200 KMU.
Knapp 60 Prozent der Unternehmen gaben an, in ihre Transformation zu investieren und dem Thema Nachhaltigkeit eine größere Bedeutung beizumessen. Das ist dringend notwendig, denn um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es einer gigantischen Summe an Investitionen. Die EU-Kommission schätzt die zusätzlichen jährlichen Investitionen, die zum Erreichen der Ziele des Green Deals notwendig sind, auf über 620 Milliarden Euro. Für Deutschland schätzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Bedarf von mehr als 190 Milliarden Euro pro Jahr bis 2045. KMU spielen dabei eine wichtige Rolle, schließlich macht ihre Wertschöpfung die Hälfte des europäischen Bruttoinlandsprodukts aus.
Allerdings zeigt die Umfrage, dass nur 35 Prozent dieser Investitionen extern finanziert werden, also mit Kapital, welches die Unternehmen über den Kredit- oder Kapitalmarkt erhalten. Dieser Anteil sei “zu niedrig, um die riesigen Investitionsvolumina der Transformation zu stemmen”, schreiben die Studienautoren. Ein weiteres Problem: Nur 16 Prozent dieser verwendeten externen Finanzierung könne als Sustainable Finance klassifiziert werden.
Den größten Teil der Investitionen bringen die Betriebe aus eigenen Mitteln auf, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Danach komme die für den Mittelstand typische Hausbankfinanzierung. Während große Unternehmen an den Kapitalmärkten “grüne” Finanzierungen erhalten könnten, hätten KMU der Studie zufolge kaum Zugang zu entsprechenden Mitteln.
Das Sustainable-Finance-Regelwerk der EU besteht aus drei zentralen Gesetzen, die von weiteren Instrumenten umringt sind: die Taxonomie, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zur Berichterstattung über die Nachhaltigkeit der Unternehmen, und die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) für Finanzinstitutionen. Die Vorgaben samt der umfangreichen Berichtspflichten sind auf große Unternehmen ausgerichtet, die sich über den Kapitalmarkt bei Investoren finanzieren.
Auch börsennotierte KMU müssen ab 2026 berichten, haben jedoch bis 2028 noch die Möglichkeit zu einem Opt-out. Dabei handelt es sich allerdings nur um sehr wenige Unternehmen, erklärt Stefan Müller, Professor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen an der Universität Hamburg. Das viel größere Problem entstehe für die übrigen KMU: “Da 85 Prozent der deutschen Unternehmen Teil der Wertschöpfungsketten großer, berichtspflichtiger Unternehmen sind, sind indirekt doch fast alle betroffen.”
Die Studie der DIHK beschreibt dies als “Trickle-Down-Effekt”: Über verschiedene Kanäle werden die Berichtspflichten auf die kleineren Unternehmen übertragen. Dies führe zu hohen Kosten für KMU, ohne Vorteile wie einen besseren Zugang zu Finanzierungsinstrumenten zu bieten.
Kleine Unternehmen wie die Fleischerei um die Ecke sähen sich auf einmal mit Anforderungen konfrontiert, die bisher nicht Teil der Rechnungslegung waren und auf die sie nicht vorbereitet sind, sagt Müller. Durch die fehlende Standardisierung sei zudem nicht klar, wie sie bestimmte Informationen, etwa Kennzahlen zu den Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer im Ausland, in Erfahrung bringen und dokumentieren sollen.
Darüber hinaus gebe es für nachhaltige KMU-Kreditfinanzierungen keine Standards, bemängeln viele Unternehmen. Banken seien aufgrund möglicher Greenwashing-Vorwürfe sehr zögerlich bei ESG-Finanzierungen. Förderprogramme würden häufig als zu umständlich und die Genehmigungsphasen als zu lang beschrieben.
Für KMU sollte die Sustainable-Finance-Regulierung deshalb laut der Studie einfacher und individueller werden. Eine mögliche Lösung sei ein angepasster Berichtsstandard für KMU, die größer als Kleinstunternehmen sind. Dieser sollte dazu dienen, die Transformation der KMU effektiv zu steuern und den Trickle-Down-Effekt innerhalb der Wertschöpfungskette zu begrenzen.
Die von der EU-Kommission beauftragte European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) erarbeitet bereits einen freiwilligen KMU-Standard für nicht-kapitalmarktorientierte KMU und will diesen demnächst zur Konsultation veröffentlichen.
Die Studienautoren empfehlen darüber hinaus aufsichtsrechtliche Standards für grüne KMU-Kredite sowie einfachere, schnellere und effizientere staatliche Förderprogramme. Die Kapazität von Banken, grüne Finanzierungen durch Förderungen und KMU-orientierte Regulierungen zu vergeben, müsse massiv erhöht werden. Auf Unternehmensebene bedürfe es KMU-Finanzierungen in Form von Krediten, die an ESG-Kriterien gebunden sind (“ESG-linked loans”).

Knapp 30.000 Windräder drehten sich 2022 in Deutschland. Sie erzeugten 25,9 Prozent des deutschen Stroms und sollen als Teil der Energiewende künftig einen noch größeren Beitrag leisten. Je mehr Anlagen allerdings hinzukommen und je älter die bestehenden werden, desto stärker gerät die Frage des Recyclings in den Fokus. “Aktuell sind die Mengen, die zurückgebaut werden müssen, noch so gering, dass wir eigentlich immer noch vor der ganz großen Welle sind und Zeit haben, technische Lösungen weiterzuentwickeln”, sagt Steffen Czichon, Abteilungsleiter Rotorblätter beim Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme. Andererseits: Das Umweltbundesamt erwartet in den kommenden 20 Jahren knapp 400.000 Tonnen Abfälle, alleine durch die Rotorblätter.
Beim Recycling von Windenergieanlagen sind das Fundament und der Turm das kleinere Problem. Sie werden im Wesentlichen aus Stahl und Beton gefertigt, für die es etablierte Recyclingverfahren gibt. Die Rotorblätter hingegen, die häufig 50, 60 Meter lang sind und mehr als 20 Tonnen wiegen können, bestehen neben Holz, Metall und Klebstoff vor allem aus Faserverbundkunststoffen. Bei älteren Modellen ist das meistens glasfaserverstärkter, bei neueren kohlenstofffaserverstärker Kunststoff – und in beiden Fällen lassen sich die einzelnen Komponenten nur schwer voneinander trennen. Forscher und Unternehmen arbeiten deshalb daran, Lösungen zu finden.
Das Bremer Unternehmen Neowa hat Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bis zum letzten Jahr mittels Co-Processing recycelt. Bei dem Verfahren wird das Material geschreddert und zu einem Granulat verarbeitet, das als Ersatzbrennstoff in der Zement-Industrie eingesetzt wird. Gleichzeitig ersetzt der Glasanteil einen Teil des Sandes, der in der Zement-Herstellung verwendet wird.
Doch letztes Jahr wurde der Betrieb eingestellt, sagt Geschäftsführer Mika Lange, weil die Zahl der Rotorblätter stark zurückgegangen war. Der Grund: Die Windkraftanlagen werden teilweise länger betrieben als die geplanten 20 Jahre, da sie technisch in Ordnung sind; dank der gestiegenen Energiepreise sind sie auch dann noch rentabel, wenn die staatliche Förderung nach 20 Jahren ausläuft. Andere Standorte warten noch auf die Genehmigung, die alten Windräder durch größere und leistungsfähigere Anlagen auszutauschen und bauen sie noch nicht ab.
Irgendwann müssen aber auch diese Rotorblätter recycelt werden. Das dänische Unternehmen Continuum plant deshalb gerade den Bau mehrerer Recycling-Fabriken. Dort sollen die Rotorblätter geschreddert werden, um daraus Verbundwerkstoff für Küchenarbeitsplatten oder Platten für die Bauindustrie herstellen zu können. Die fertigen Paneele bestehen laut Angaben des Unternehmens zu 92 Prozent aus recyceltem Material.
Zudem habe das Verfahren den Vorteil, dass es den CO₂-Ausstoß, der bei der derzeit angewandten Verbrennung und Verarbeitung der Rotorblätterreste in Zementfabriken entsteht, drastisch reduzieren soll. Wie genau, das möchte Continuum nicht erklären. Anfang 2024 soll die erste Fabrik fertig werden, fünf sind europaweit geplant, eine davon in Deutschland. Die Fabriken sollen mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden und jeweils rund 36.000 Tonnen GFK im Jahr verarbeiten.
Auch die Firma Novotech in Aschersleben in Sachsen-Anhalt recycelt GFK-Abfälle mittels mechanischen Recyclings: Die Flügel werden zu einem groben Pulver zerkleinert, das mit Holzspänen und weiteren Zusatzstoffen bei 170 Grad zu Terrassendielen geformt wird, die bis zu 30 Prozent aus einem Rotorblatt gefertigt werden.
Um das Recycling künftig zu vereinfachen, ist es wichtig, die letzten Schritte schon beim Design-Prozess des Produkts mitzuplanen und Rotorblätter so zu gestalten, dass sich ihre Ausgangsmaterialien leichter trennen lassen als bisher. Siemens Gamesa hat etwa das “RecyclableBlade” entwickelt, bei dem ein neues Harz zum Einsatz kommt, dessen chemische Struktur die Trennung der unterschiedlichen Bestandteile ermöglicht. Mit einer milden Säurelösung lassen sich Harz, Glasfasern und Holz voneinander lösen und dann in der Bauwirtschaft, für Konsumgüter oder in der Automobilindustrie wiederverwenden.
Das deutsche Start-up Voodin Blades entwickelt zusammen mit einem finnischen Holzwerkstoff-Produzenten leichtere Rotorblätter aus Furnierschichtholz. Derzeit testen sie ein 20-Meter-Blatt, ein 80-Meter-Rotorblatt ist als nächstes geplant.
Aber: Die aktuellen Recycling-Ansätze führen noch zu keiner echten Kreislaufwirtschaft. Bisher werden die Materialien weiterverwendet, das daraus entstehende Produkt ist in der Regel jedoch minderwertiger – ein klassisches Downcycling. Wie sich die existierenden Konzepte verbessern lassen, sodass höhere Materialwerte erzielt werden und der Energieverbrauch reduziert wird, daran wird noch geforscht.
Und auch die Politik ist gefragt. Denn ein RecyclableBlade sei noch lange kein “blade that will be recycled”, sagt Steffen Czichon vom Fraunhofer-Institut. “Ich vergleiche das immer mit Kaffeebechern. Schön, wenn die kompostierbar sind. Wenn ich sie dann aber verbrenne, bringt das nichts. Und so ist es auch bei den recyclebaren Rotorblättern.”
Deswegen sei es sehr wichtig, an einer geschlossenen Verwertungskette zu arbeiten, indem zum Beispiel zentrale Annahmestellen für alte Rotorblätter eingerichtet werden. Dazu bräuchte es aber noch klarere politische Rahmenbedingungen – und die fehlen bislang. Doch der Ausbau der Windenergie steht im Vergleich zum Recycling auf der Prioritätenliste weiter oben. Sarah Kröger
Mittwoch, 27.09.2023, 10:10-11:00 Uhr
Mündliche Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Thema Land Governance – Traditionelle vs. formalisierte Landrechtssysteme und die Rolle der deutschen EZ (in Verbindung mit einem Gespräch mit Roman Herre, FIAN) Info
Mittwoch, 27.09.2023, 11:00-13:00 Uhr
Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften Info
Mittwoch, 27.09.2023, 11:00-13:00 Uhr
Öffentliche Anhörung zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Luftqualität und saubere Luft für Europa” Info
Mittwoch, 27.09.2023, 17:00-18:30 Uhr
Öffentliche Beratung 47. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung Info
Donnerstag, 28.09.2023, 15:25 Uhr
Erste Beratung des Antrags der Fraktion CDU/CSU “Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten” Info
Donnerstag, 28.09.2023, 16:55 Uhr
Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU “Energiespeicher jetzt ausbauen” Info
Donnerstag, 28.09.2023, 19:10 Uhr
Beratung über die Verordnung des BMUV über die Abgabesätze und das Punktesystem des Einwegkunststofffonds (EWKFondsV) Info
Freitag, 29.09.2023, 9:00 Uhr
Erste Beratung Erste Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen Info
Die Unternehmensberatung PwC hat ihre Untersuchung “Zwischen Transparenz und Nachhaltigkeit – Die ESG Säule III Offenlegungsstudie” vorgelegt. Sie befasst sich mit der Frage, wie Kreditinstitute in Europa die Standards der European Banking Authority (EBA) zur Offenlegung von ESG-Risiken gemäß Artikel 449a der Capital Requirements Regulation (CRR) erstmals in ihren Berichten umgesetzt haben.
Dabei zeigt sich, dass viele Banken ihre ESG-Risiken nur unzureichend offenlegen. “Die bereitgestellten Informationen, vor allem für Risiken bei Soziales und Unternehmensführung, bieten keine ausreichende Tiefe, um ein umfassendes Verständnis der potenziellen Risiken zu erhalten”, so eine der Schlussfolgerungen der Studie.
Investoren sind auf genaue und vergleichbare Angaben angewiesen. “Eine transparente und detaillierte Offenlegung von ESG-Risiken ermöglicht es Finanzmarktteilnehmern, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und die ESG-Performance der Institute besser zu beurteilen”, sagt Christoph Schellhas, Partner und Financial Services Sustainability Lead bei PwC Deutschland.
Die Standards der “ESG Säule III Offenlegung” sollen sicherstellen, dass der Finanzsektor einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leistet und der EU Green Deal als Maßnahmenpaket für ein klimaneutrales Europa bis 2050 erfolgreich umgesetzt wird. Gleichzeitig sollen sie die Qualität und Vergleichbarkeit der Berichte erhöhen.
Im Rahmen der Studie wurden die Nachhaltigkeitsberichte von 25 Kreditinstituten in Europa untersucht, darunter 14 aus Deutschland. Alle Institute berichteten erstmals zum 31. Dezember 2022 über ihre ESG-Risiken. Ab 2023 erfolgt die Berichterstattung halbjährlich. Zukünftig wird sie zudem weiter ausgebaut. ch
Die globalen Öl- und Gaskonzerne können sich weiterhin auf die Unterstützung der größten Banken verlassen – und die Deutsche Bank zählt zu ihren wichtigsten Finanziers. Zu diesem Ergebnis sind zwei Rechercheteams aus den Niederlanden und 12 internationale Medien gekommen. Für ihre gemeinsame Arbeit haben sie die Anleihen untersucht, die die Kreditinstitute für Konzerne wie BP, Petrobras, Petroleum Mexicanos, Shell oder Occidental Petroleum Corp. seit dem Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens 2016 für neue Rohstoffförderungen am Markt platziert haben. Bis zum Juni 2023 kamen sie auf weltweit 1666 Anleihen mit einem Volumen von 1,01 Billionen Euro. Die Deutsche Bank war an Deals beteiligt, deren Volumen zusammen 432 Milliarden Euro betrug.
Zu den weiteren emittierenden Banken zählen JP Morgan, Citi, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas und Crédit Agricole. Letztere hat sich, wie auch die Deutsche Bank, öffentlich zur Bekämpfung des Klimawandels bekannt, untergräbt mit den fossilen Anleihen allerdings die eigenen Bemühungen. Die Geschäfte bleiben in der Regel unerkannt, da der Handel nicht über die Börse organisiert ist. Schon in den vergangenen Jahren sind die Großbanken für ihre Geschäfte mit dem fossilen Sektor kritisiert worden, unter anderem von der NGO Urgewald. maw
Das EU-Parlament wird seine Position zur Green Claims-Richtlinie laut dem neuen Zeitplan des Binnenmarktausschusses im März 2024 festlegen. Die Verhandlungen mit dem Rat müssen dementsprechend wahrscheinlich nach den Europawahlen fortgeführt werden.
Aufgrund eines Kompetenzkonflikts zwischen den Ausschüssen hatte sich der Zeitplan verschoben. Der Umweltausschuss (ENVI) hatte die Zuweisung des Textes an den Binnenmarktausschuss (IMCO) angefochten. Mit Erfolg: Beide Ausschüsse müssen nun nach dem Gemeinsamen Ausschussverfahren (Artikel 58) einen gemeinsamen Berichtsentwurf verfassen.
Vergangene Woche war der Zeitplan veröffentlicht worden. Laut diesem soll der von den Berichterstattern Andrus Ansip (Renew, für IMCO) und Cyrus Engerer (S&D, für ENVI) gemeinsam verfasste Berichtsentwurf am 6. oder 7. November in den Ausschüssen vorgestellt werden. Mitte Februar sollen die Ausschüsse abstimmen, im März das Plenum. Wie die Nachrichtenplattform Contexte berichtet, haben die Verhandlungen mit dem EU-Rat keine Chance, vor den Europawahlen Anfang Juni abgeschlossen zu werden, sondern müssen in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder aufgenommen werden.
Die Kommission hatte im März einen Entwurf für die Green Claims-Richtlinie vorgestellt. Diese soll einen Rahmen für Umweltangaben von Unternehmen schaffen. leo
Der Vorschlag der EU-Kommission, die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat um zehn Jahre zu verlängern, stößt politisch auf geteiltes Echo. Bei einer Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) der EU habe sich Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg eingesetzt. Die Genehmigung in der EU müsse enden, solange Schäden für die Biodiversität nicht ausgeschlossen werden können. In Frankreich hingegen sieht die Einschätzung anders aus. “Wir vertrauen der Wissenschaft und Studien, die besagen, dass Glyphosat kein krebserregendes Problem darstellt”, sagte Landwirtschaftsminister Marc Fesneau.
Gegenüber Table.Media kritisierten Ökologen derweil den Plan der EU-Kommission. Der österreichische Wissenschaftler Johann Zeller von der Wiener Universität für Bodenkultur warf der EU-Kommission das “systematische Leugnen” des Rückgangs der Biodiversität und eine “Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften” vor. Maria Finckh, Leiterin des Fachgebiets Ökologischer Pflanzenschutz von der Uni Kassel, erklärte, dass die vorgeschlagenen Auflagen für die künftige Verwendung des Mittels EU-weit betrachtet eine Verbesserung bringen würden. Zugleich aber unterlaufe die EU-Kommission unter anderem ihre eigenen Absichten, eine permanente Bodenbedeckung und Begrünung zu fördern, um die Kohlenstoffspeicherung in den Böden zu erhöhen.
Horst-Henning Steinmann von der Georg-August-Universität Göttingen sagte: “Glyphosat ist zwar von den Risiken her gesehen ein Leichtgewicht, aber es ist ein großer Treiber bei den ausgebrachten Mengen.” Deshalb schlug er vor: “Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob ein System einer Mengendecklung machbar ist.” Die aktuelle Zulassung für Glyphosat läuft am 15. Dezember aus. maw
Die zahlreichen Krisen und die tiefgreifende Transformation der Wirtschaft führen zu einem sich rasch wandelnden Unternehmensumfeld. Um dem gerecht zu werden, müssen sich Führungsstrukturen und Geschäftsstrategien ändern. Die Studie “Krisenmanagement und Führungskultur” des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Expense Reduction Analysts legt jedoch nahe, dass dies häufig nicht der Fall ist.
“Die Studie zeigt, dass nach einer überstandenen Krise mehrheitlich nach den angestammten Mustern weitergearbeitet wird”, sagt Matthias Droste, Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Expense Reduction Analysts. “Nur jedes zweite befragte Unternehmen hat aus den Krisen wirklich schon Lehren gezogen und daraus Maßnahmen abgeleitet.”
Die Untersuchung basiert auf Antworten von 189 Unternehmen. Dort beschreibt das Top-Management die aktuelle Situation zwar als herausfordernd und 72 Prozent der Führungskräfte der zweiten Ebene berichten von Überforderung bei Entscheidungen unter Zeitdruck. Doch “weder bei der Führungskultur noch bei den genutzten Managementtools haben sich bisher dringend notwendige Veränderungen flächendeckend etabliert”, heißt es in der Studie.
Laut Droste haben noch immer 50 Prozent der Unternehmen kein belastbares Krisenmanagementsystem etabliert. Nur ein Drittel hält die Lehren aus Krisen in Richtlinien und Handbüchern fest. Zudem sei das Krisenmanagement bei mehr als der Hälfte der Firmen noch nicht in der Unternehmensstrategie verankert. ch
Die deutschen Fintechs Evergreen und Forget Finance wollten wissen, worauf die sogenannten Millennials, also die Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 40, bei ihren Finanzen Wert legen. Ihre bei dem Meinungsforscher Yougov beauftragte, repräsentative Umfrage zeigt, dass regelmäßiges Sparen und Investieren für sie eine hohe Priorität hat. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Zwar kennen 24 Prozent den Begriff “nachhaltige Geldanlage” gar nicht und weitere 16 Prozent wissen nicht genau, was er bedeutet. Dennoch ist es 48 Prozent wichtig, dass ihr Finanzdienstleister nachhaltig agiert. 36 Prozent ist es hingegen egal.
Von den Befragten, die altersbedingt zunehmend finanzkräftiger werden und in die Führungsetagen von Wirtschaft und Gesellschaft hineinwachsen, antworteten zudem 43 Prozent, dass sie in eine lebenswerte Zukunft investieren wollen. 15 Prozent erhoffen sich eine höhere Rendite. Frauen, die nachhaltig investieren, tun dies zudem aus deutlich altruistischeren Motiven als Männer. Mehr als die Hälfte von ihnen gibt als Grund an, in eine lebenswerte Zukunft investieren zu wollen. Bei den Männern ist es nur ein Drittel. ch
Verwirrung statt Klarheit beim ESG-Reporting – Finance Magazin
Das International Sustainability Standards Board will international einheitliche Regeln für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchsetzen. Doch Günter Heismann befürchtet einen Wettlauf mit den Standards der EU und der USA. Zum Artikel
Bis zu 180.000 Euro Gehalt: Das müssen ESG-Manager wirklich können – Handelsblatt
ESG-Manager werden dringend gesucht. Viele Bewerber aber haben ein verklärtes Bild von dem Beruf. Was Sie wirklich brauchen, um den Job zu meistern, weiß Julia Beil. Zum Artikel
California cracks down on Carbon – Economist
Kalifornien, eine der weltgrößten Volkswirtschaften, nimmt nicht-nachhaltige Konzerne von gleich zwei Seiten in die Zange: Zum einen verklagt der Staat große fossile Energieunternehmen, weil sie zu wenig gegen den von ihnen mitverursachten Klimawandel getan haben. Zum anderen wird eine neue, härtere Regulierung angestrebt. Das kann Folgen für die gesamten USA haben. Zum Artikel
Das sind die zehn größten Zulieferer der Autoindustrie – Automobil Produktion
Die Transformation der Autoindustrie sorgt auch im Ranking der wichtigsten Zulieferer für Fluktuation. Unter den Top 10 sind noch drei deutsche Firmen. Vor allem der chinesische Batteriehersteller CATL macht im Vergleich zum Vorjahr einen großen Sprung, berichtet Timo Gilgen. Zum Artikel
Nachhaltigkeitsstandard für Werkzeuge – Maschinenmarkt
Der Werkzeughersteller Ceratizit führt den ersten Nachhaltigkeitsstandard für Werkzeuge ein. Der Standard ermögliche es Industriekunden, den CO₂-Fußabdruck für die in der Fertigung eingesetzten Werkzeuge aus Primärdaten zu berechnen und auf dieser Basis eine Strategie zur Senkung der Emissionen im Werkzeugeinsatz zu entwickeln. Zum Artikel
Inside Big Oil’s Tech Portfolio – Sifted
Freya Pratty hat analysiert, in welche Tech-Start-ups die großen fossilen Öl- und Gaskonzerne ihr Geld investieren. Ergebnis: Es geht mehrheitlich nicht in junge Unternehmen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, etwas zur Energiewende beizutragen. Zum Artikel
Batterie der Zukunft – Produktion
Forschende der RWTH Aachen wagen einen Blick in die Zukunft, aus welchen Materialien die Batterien von morgen bestehen. Das Fazit von Autor Dietmar Polls Überblick: Es werde nicht eine Batterie der Zukunft geben, die sich am Markt durchsetze, dazu seien die Interessen und Anwendungen zu verschieden. Zum Artikel
Surveillance Tech helps Indigenous Groups protect the Amazon – Bloomberg
In Ecuador setzen Indigene moderne Technologien ein, um unliebsame Eindringlinge zu vertreiben, die ihren heimischen Regenwald zum Jagen und Roden ausbeuten wollen. Sie lassen Drohnen steigen, die mit Kameras ausgerüstet sind, und nutzen GPS-Tracker. Und wie Laura Millan erfahren hat, zeigt die digitale Selbstverteidigung Wirkung. Zum Artikel
Grüner Wasserstoff aus methanolhaltigem Abwasser – Process
Für die Herstellung grünen Wasserstoffs werden erhebliche Mengen an Wasser benötigt. Laut dem Fraunhofer Institut könnten aber auch methanolhaltige Abwässer aus der Stahlproduktion genutzt werden. Damit stünde die Erzeugung grünen Wasserstoffs nicht in Konkurrenz zu Trinkwassergewinnung und Bewässerung. Erste Versuchsreihen verliefen erfolgreich. Nun folge die praktische Umsetzung. Zum Artikel
E-Mobilität: Wo Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China und die USA bei der E-Wende stehen – Der Standard
Großbritannien verschiebt das Aus für Verbrenner nach hinten, und die Autokonzerne üben daran Kritik. Wie steht es um die Wende zur E-Mobilität? Ein Überblick von Sebastian Borger, Stefan Brändle, Regina Bruckner, Joseph Gepp und Alicia Prager. Zum Artikel
Meet the Climate-Defying Fruits and Vegetables in Your Future – The New York Times
Kim Severson hat sich klimaresistente Früchte und das Gemüse der Zukunft angesehen: Heißwetter-Kirschen, dürreresistente Melonen und sechs weitere Pflanzen, die unsere Ernährung in einer sich schnell erwärmenden Welt verändern könnten. Zum Artikel
As disasters spike, superpowers face mounting calls to forge climate deal – The Washington Post
Im Vorfeld der COP28 haben führende Vertreter einiger der wichtigsten Klimainstitutionen der Welt den Druck auf die USA und China erhöht, ein Abkommen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zu schließen. Laut Timothy Puko befürchten sie, dass die angespannten Beziehungen zwischen beiden Supermächten die Fortschritte bei den Verhandlungen zunichte machen könnten. Zum Artikel
BlackRock, State Street Among Money Managers Closing ESG Funds – Bloomberg
BlackRock Inc. und andere Vermögensverwalter haben jahrelang nachhaltige Fonds aufgelegt, um vom steigenden Interesse an ESG-Investitionen zu profitieren. Jetzt geben sie eine wachsende Zahl dieser Produkte in den USA angesichts der politischen Gegenreaktion und der kritischen Prüfung durch die Anleger auf, schreibt Silla Brush. Zum Artikel

Als die Corona-Pandemie 2020 die Welt heimsuchte und der erste Lockdown ausgerufen wurde, waren die damit verbundenen Einschränkungen ein einschneidendes Ereignis. Die bis dahin gewohnte Normalität war plötzlich verschwunden, Reisen unmöglich geworden. Auch die Philosophin Eva von Redecker konnte lange geplanten beruflichen Einladungen nach Kalifornien nicht nachkommen und sah sich gezwungen, in ihrer Landkommune zu bleiben.
Bis dahin kreiste ihre Arbeit unter anderem darum, der Klimabewegung eine philosophische Grundlage zu geben und nach einem Verhältnis zur Welt zu suchen, das in letzter Minute Wege eröffnen könnte, einer sich abzeichnenden “Klimahölle” (UN-Generalsekretär António Guterres) zu entgehen. “Revolution für das Leben” war das Buch, in dem sie eine “Philosophie der neuen Protestformen” entwarf und auch der Entstehung des gegenwärtigen Eigentumsbegriffs nachspürte, den sie als willkürliche “Sachherrschaft” bezeichnet und ins Zentrum ihrer Kritik am gegenwärtigen Umgang mit dem Planeten stellt.
Das Verständnis und die Konzeption von Freiheit war auch dort schon ein zentrales Thema. Aber die plötzliche Unmöglichkeit, bürgerliche Grundrechte wie Reisefreiheit auszuüben, brachte sie neu zum Nachdenken. Vielen ging es damals so: Die rasante Vollbremsung unseres beschleunigten Lebens war einerseits ein Schock und auf der anderen Seite eine neue Erfahrung von Entschleunigung – und eben von Freiheit.
Für Eva von Redecker war es die Freiheit, bleiben zu dürfen. Eine voraussetzungsvolle Freiheit, wie sie schnell bemerkte, denn sie setzt eine ökologisch und sozial halbwegs intakte Welt voraus, in der man sich gut und gerne aufhalten kann. Eine Freiheit, die vielen Menschen nicht zur Verfügung steht und die sich auch wegen der Klimakrise als Ausgangspunkt für einen Essay über “Bleibefreiheit” anbot. Es wurde ein Buch daraus, das im Sommer unter eben diesem Titel erschienen ist.
Im pointierten Titel klingt das oft ebenso pointierte Sprechen der Denkerin an, die an der Cambridge University und der New School for Social Research in New York sowie zehn Jahre an der Humboldt-Universität in Berlin tätig war, unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Philosophin Rahel Jaeggi. Blankes Unverständnis, dass im Angesicht des drohenden Verlusts der Bewohnbarkeit des Planeten zu wenig unternommen wird, ist ihr beim Sprechen anzumerken.
Ihr Konzept von Freiheit setzt der Freiheit im Raum, die nicht nur auf Bewegung, sondern vor allem auf stetige Expansion gerichtet ist, ein zeitlich basiertes Verständnis von Freiheit entgegen, das auch die beschränkte menschliche Lebenszeit in den Blick nimmt und an die Stelle eines rasenden Hamsterrades eine “Fülle erfüllter Zeit” setzt.
Es macht ihr erkennbar Spaß, sich Grundannahmen des Liberalismus vorzunehmen und diese vor dem Hintergrund der planetarischen ökologischen Krise zu sezieren: Eigentum? Will sie nicht etwa abschaffen, erinnert aber an das verbriefte Recht, eben dieses nach Gutdünken und ohne Grund auch zerstören zu dürfen. Warum also kein Konzept von Eigentum, das nicht an willkürliche Verfügung sondern vielmehr an Verantwortung und Lebenszeit gebunden ist? Der Mensch ist frei geboren? Er könne im Laufe seines Lebens frei werden, antwortet von Redecker, nicht Selbsteigentum sei Freiheit, sondern Selbstwirksamkeit. Gegenwärtig werde aber vor allem daran gearbeitet, die Freiheit künftiger Generationen drastisch einzuschränken.
Manchmal scheint ihre Kritik am Neoliberalismus reflexhaft und zu sehr fokussiert auf ein verkürztes Verständnis der “liberalen Tradition”, wenn “ein paar Jahrzehnte Privatisierung, Effizienzsteigerung und Finanzialisierung” Schuld sein sollen, dass “plötzlich alles marode” geworden sei, wie sie schreibt. Waren linke Modelle ökonomischer Entwicklung in der Vergangenheit nicht ebenso auf Verwertung fossiler Rohstoffe gebaut? Ging der Freiheitsbegriff des klassischen Liberalismus wirklich nur von Freiheit der Bewegung und Besitzmehrung aus?
Präzise und überzeugend ist ihr Blick dennoch und vor allem dort, wo es um die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge menschlichen Lebens mit und in einer bedrohten Natur geht. Das beginnt bei den offensichtlichen Zwängen von Millionen, die aufgrund von Klimafolgeschäden nicht dort bleiben können, wo sie leben. Doch es geht um mehr, es geht um die Bewohnbarkeit des Planeten und den Erhalt des Ökosystems mit seinen unendlichen wechselseitigen Abhängigkeiten. Von Redecker nimmt Ankunft und Flug der Schwalben als Metapher, um eindringlich zu erinnern, was es zu erhalten gilt: Eine Welt, in der Menschen leben, die sich jedes Jahr aufs Neue freuen, wenn die Schwalben kommen. Der Klimawandel bedroht deren Lebensräume und Flugrouten. Ihr Verlust wäre nicht nur schmerzlich für die Umwelt. “Es wäre einfach weniger schön”, sagt Eva von Redecker. Lukas Franke
China.Table: EU-Handelschef zeigt in Peking klare Kante. Ukraine-Krieg, EU-Untersuchung bei E-Autos oder Anti-Spionagegesetz – EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis arbeitet sich in Peking an vielen schwierigen Themen ab. Auf konkretes Entgegenkommen seitens China wartete er allerdings vergebens. Mehr
Europe.Table: Jutta Paulus: Einigung vor COP28 “von großer Bedeutung”. EU-Berichterstatterin Jutta Paulus (Grüne) über die Notwendigkeit, eine Einigung über die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor vor dem COP28 in Dubai zu erreichen Mehr
Climate.Table: UN-Gipfel: Die Klimaschutz-Vorreiter machen sich Mut. Ausgewählte Klima-Champions durften beim UN-Gipfel in New York ihre Ziele und Erfolge erläutern, António Guterres wollte so die Macht der Progressiven gegenüber den Bremsern vergrößern. Aber der grünen Front fehlt es an Schlagkraft. Mehr
In Frankreich ist es bereits soweit: Zehntausende Menschen in rund 200 Kommunen mussten in diesem Sommer mit Trinkwasser aus Tankwagen versorgt werden, Winzer fürchten eine katastrophale Weinlese, die Bewässerung von Gärten und Parks wurde drastisch eingeschränkt. In Deutschland läuft bislang noch alles wie gewohnt, nur Experten schlagen immer öfter Alarm, die Grundwasserspiegel würden sich trotz ergiebiger Regenfälle nicht mehr erholen. Als Folge der globalen Klimaveränderung droht Wasserknappheit in Mitteleuropa zu einem ernsten und wachsenden Problem zu werden.
In ihrem neuen Buch “Durstiges Land” haben sich die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres des Themas angenommen. In jeweils sechs Geschichten schildern sie, wie sich die Lebensbedingungen Mitte der Vierziger Jahre verändert haben könnten, wenn es weiter geht wie bisher. Die Szenarien fallen reichlich dystopisch aus. Pandemien sind Normalität, Waldbrände haben ganze Regionen vernichtet und Flüsse sich in giftige Kloaken verwandelt. Das Leben ist zum Überlebenskampf geworden, wer es sich leisten kann, lebt in martialisch gesicherten “gated communities”.
Den apokalyptisch anmutenden Geschichten stellen sie jeweils eine Variante gegenüber, wie eine Zukunft aussehen kann, in der die sozial-ökologische Transformation gelungen ist. In allen Geschichten wird deutlich: Die Weichen stellen wir jetzt. Susanne Götze und Annika Joeres wissen, worüber sie schreiben, beide arbeiten seit Jahren zu Folgen des Klimawandels, sie sind als Autorinnen für den “Spiegel” oder die “Zeit” tätig, ihr letztes Buch “Klima außer Kontrolle” wurde mit dem Sachbuchpreis des NDR ausgezeichnet. “Durstiges Land” ist kenntnis- und faktenreich geschrieben – und zeigt, dass die vor uns liegenden Aufgaben zwar groß sind, aber bewältigt werden können. Wenn das Notwendige geschieht. Lukas Franke
erinnern Sie sich noch an das Bedingungslose Grundeinkommen? Es ist ein paar Jahre her, dass diese Idee die Gedanken vieler Menschen beflügelte. Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn jeder 1000 Euro im Monat bekäme und nicht gezwungen wäre, seine Existenz durch eine selbstständige oder abhängige Beschäftigung zu sichern? Es wurden Initiativen gestartet, Artikel und Bücher geschrieben und Debatten geführt – inzwischen aber hört man vom Grundeinkommen nichts mehr.
Momentan gibt es ein neues Thema, das für Aufregung sorgt. Diesmal geht es um die Viertagewoche. Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn jeder nur noch 32 Stunden arbeiten müsste, womöglich sogar bei vollem Lohnausgleich? So lautet diesmal die Frage. Und wieder werden leidenschaftliche Diskussionen geführt: Top-Manager sehen den Untergang Deutschlands bevorstehen, Befürworter weisen auf den krankmachenden Stress hin, den Arbeit verursacht, und dass so ein Modell auch für Umwelt und Klima Vorteile hätte. Wer liegt richtig?
Die Antwort darauf werden wir frühestens in einem Jahr bekommen. Dann nämlich, wenn die Auswertung eines kommenden Pilotversuchs auf dem Tisch liegt, den wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen und für den noch experimentierfreudige Unternehmen als Teilnehmer gesucht werden. Ein Jahr – das ist nach heutigen Maßstäben natürlich noch ewig lange hin. Bis dahin kann die Viertagewoche schon so tot sein wie das Grundeinkommen.
Andererseits: Die Versachlichung eines so wichtigen Themas und die Unterfütterung mit Daten und Fakten braucht einfach Zeit. Wäre schön, wenn alle Diskutanten abwarten würden, was aus diesem ersten Experiment herausgekommen ist.

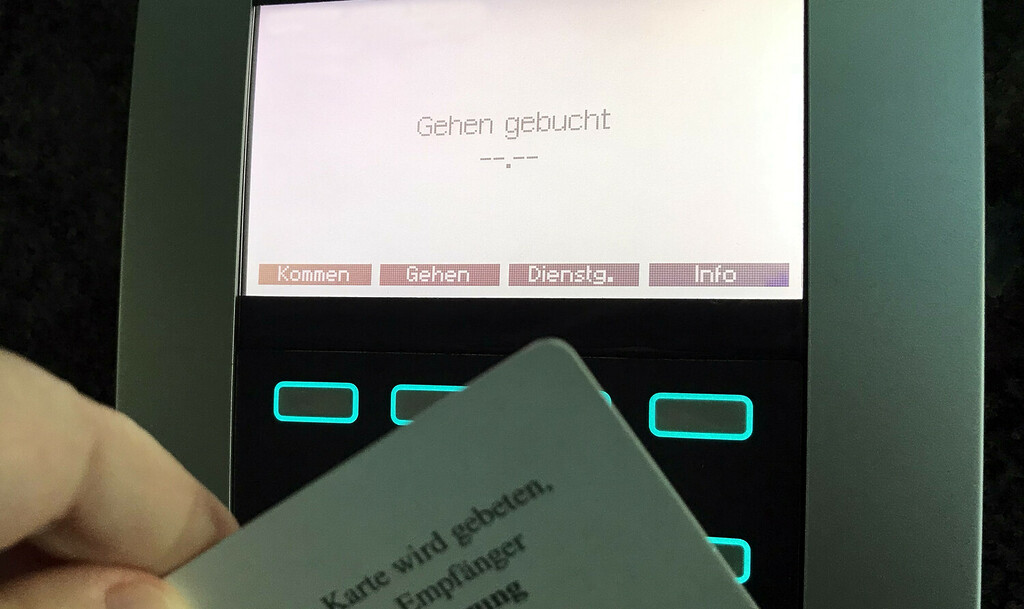
Arbeit strukturiert den Tag, sichert die Existenz und bringt Anerkennung. Sie setzt aber auch unter Stress, führt zu psychischen Problemen und macht krank. Wäre es also ratsam, die Zeit im Büro oder auf der Baustelle zu reduzieren, um die positiven Aspekte zu erhalten und die negativen zu eliminieren?
Für eine neue Studie haben sich die Berliner Agentur Intraprenör, die internationale Organisation 4 Day Week Global und der Lehrstuhl für Transformation der Arbeitswelt der Universität Münster zusammengeschlossen, um genau diese Frage zu untersuchen. Sie wollen wissen, ob sich die Viertagewoche im Alltag bewährt und welche Nachteile daraus entstehen.
Unternehmen in ganz Deutschland, die an dem Versuch teilnehmen wollen, können sich bis Ende November bewerben. Die Praxisphase läuft von Februar bis August 2024, anschließend erfolgt die wissenschaftliche Auswertung.
Vier Tage arbeiten und fünf Tage lang bezahlt werden – darüber ist in den vergangenen Monaten vielfach diskutiert worden, zum Teil vehement. Vor allem Top-Manager meldeten sich mit markigen Worten. Telekom-Chef Tim Höttges sagte, “Wohlfühlthemen” wie die Viertagewoche seien “absurd angesichts der zurückgehenden Produktivität”. Für BMW-Chef Oliver Zipse ist die Debatte ein “irritierendes Signal”, VW-Chef Oliver Blume erklärte, Diskussionen um mehr Work-Life-Balance oder eine Viertagewoche bei gleicher Bezahlung gingen “in die falsche Richtung”. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hält den Vorschlag “wirtschaftlich für eine Milchmädchenrechnung”, Stihl-Chef Michael Traub sieht darin gar “das Ende des Industriestandorts Deutschland”. Er droht: “Wir können auch anderswo produzieren.”
Kritiker argumentieren, dass Deutschland es sich vor allem derzeit nicht leisten könne, solche Experimente zu riskieren. Corona, der Krieg, steigende Kosten und einbrechende Gewinne hätten den finanziellen Spielraum stark eingeengt. Die Wirtschaft krankt, Projekte werden aufgeschoben, nicht mal für dringend benötigte Wohnungen ist genügend Geld da, wie der kürzlich verkündete Baustopp von 60.000 Einheiten bei Vonovia zeigt. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften.
Befürworter halten dagegen, dass die Arbeit so, wie sie momentan organisiert ist, nachweislich spürbare Konsequenzen habe. Die Verdichtung der Arbeit, etwa durch die Digitalisierung, habe zugenommen, Corona habe zusätzlich gezeigt, unter wie viel Druck viele Menschen stehen. Die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen sind gestiegen.
Und dann ist da noch die junge Generation, die gerade ins Berufsleben startet. Sie legt mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Job und Freizeit als vorige Generationen und sieht seltener eine Erfüllung darin, das Privatleben für die Karriere aufzugeben. Weniger als 40,4 Stunden pro Woche zu arbeiten, wie es die Deutschen im Schnitt machen, das ist für nicht wenige eine verlockende Aussicht.
Warum genau Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, dazu hat die Hans-Böckler-Stiftung kürzlich die Deutschen befragt. Demnach wünschen sich die Befürworter eine Viertagewoche, weil
Gefragt wurde auch nach den Gründen, die gegen eine Viertagewoche sprechen. Demnach sagten die Gegner des Konzepts, dass
Die Initiatoren der geplanten Studie im kommenden Jahr beobachten, dass die Auseinandersetzungen bislang überwiegend meinungsgetrieben und anekdotisch geführt werden. Carsten Meier hat in der von ihm gegründeten Agentur Intraprenör schon vor sieben Jahren die Viertagewoche eingeführt und berät Unternehmen bei Change-Prozessen wie der Arbeitszeitverkürzung. Von der Wucht, die das Thema in letzter Zeit bekommen hat, ist er überrascht worden, sagt er. “Die starken Emotionen in der Debatte zeigen, dass an einer Konvention gerüttelt wird, die wir alle lange nicht mehr hinterfragt haben.”
Mit der Studie will er zu einer Versachlichung beitragen. Andere Länder sind bei der Erhebung von Daten schon weiter – in England beispielsweise nahmen 2022 fast 3000 Mitarbeitende in 61 Unternehmen an einem ähnlichen Versuch teil und lieferten neue Erkenntnisse. Eine ähnliche Zahl von Teilnehmern strebt Meier auch für Deutschland an. Wer mitmachen will, muss je nach Größe zwischen 500 Euro (weniger als 10 Mitarbeitende) und 15.200 Euro (mehr als 1000) zahlen, wird aber auch umfangreich betreut, so das Versprechen.
Unterstützung kommt von Mentoren, die den Prozess selbst schon mal durchlaufen haben, und dem wissenschaftlichen Team der Uni Münster. Zudem werde man mit teilnehmenden Unternehmen verknüpft. Sollten die Mitarbeitenden dazu bereit sein, kann auch ihr individuelles Wohlbefinden in die Analyse einfließen; digitale Tracker würden dann den Schlaf und die Herzfrequenz überwachen.
Carsten Meier sagt, dass Firmen im Vorfeld ein paar Fragen für sich klären sollten, etwa die, wie sich der temporäre Viertageversuch mit dem jeweils gültigen Tarifvertrag vereinbaren lässt. “Im Zweifel haben wir ein Netzwerk von Arbeitsrechtsexperten, die dazu beraten können.”
Zudem weist er darauf hin, dass es für die Umsetzung verschiedene Optionen gäbe. Von montags bis donnerstags arbeiten und freitags bleiben alle zu Hause: Das sei lediglich ein Modell unter vielen. Für die Studie gehe es darum, das jeweils passende zu finden. Außerdem müsse nicht ein gesamtes Unternehmen mitmachen. Das Experiment lasse sich auf einzelne Abteilungen oder Tochterfirmen begrenzen. Sollte im Idealfall zusätzlich eine Kontrollgruppe zur Verfügung stehen, die – anders als ihre Kollegen – nicht in den Genuss von mehr freier Zeit kämen, könne er dabei helfen, den Kulturbruch zu moderieren.
Bei Studien in anderen Ländern hat sich laut der Organisation 4 Day Week Global gezeigt, dass die Zahl der Krankmeldungen und Burn-Out-Fälle sank, die Umwelt und das Klima profitierten, weil weniger Menschen zwischen Arbeit und Wohnung pendeln mussten, und dass die Produktivität dank einer veränderten Organisation der Arbeit gleich blieb. In England erklärten mehr als 90 Prozent der Firmen nach Ablauf des Tests, an dem Modell festzuhalten.
Zugleich räumen die Initiatoren ein, dass es noch an Langzeituntersuchungen und Daten aus großen Unternehmen fehlt. Bislang waren es vor allem kleine und mittlere Firmen, die das Experiment eingingen. Vielleicht ändert sich das in Deutschland bald, auch ohne Studie. Die IG Metall will in der bevorstehenden Tarifrunde der Stahlindustrie nicht nur 8,5 Prozent mehr Gehalt und Altersteilzeit durchsetzen, sondern auch eine 32-Stunden-Woche. So einschneidend, wie der Schritt klingt, wäre er im Übrigen gar nicht. Die Arbeitszeit wurde in der Vergangenheit schon reduziert – auf aktuell 35 Stunden pro Woche.

Die Sustainable-Finance-Regulierung der EU ist nicht ausreichend auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgerichtet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Zusammenarbeit mit Eurochambres und SME United. Befragt wurden rund 2.200 KMU.
Knapp 60 Prozent der Unternehmen gaben an, in ihre Transformation zu investieren und dem Thema Nachhaltigkeit eine größere Bedeutung beizumessen. Das ist dringend notwendig, denn um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es einer gigantischen Summe an Investitionen. Die EU-Kommission schätzt die zusätzlichen jährlichen Investitionen, die zum Erreichen der Ziele des Green Deals notwendig sind, auf über 620 Milliarden Euro. Für Deutschland schätzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Bedarf von mehr als 190 Milliarden Euro pro Jahr bis 2045. KMU spielen dabei eine wichtige Rolle, schließlich macht ihre Wertschöpfung die Hälfte des europäischen Bruttoinlandsprodukts aus.
Allerdings zeigt die Umfrage, dass nur 35 Prozent dieser Investitionen extern finanziert werden, also mit Kapital, welches die Unternehmen über den Kredit- oder Kapitalmarkt erhalten. Dieser Anteil sei “zu niedrig, um die riesigen Investitionsvolumina der Transformation zu stemmen”, schreiben die Studienautoren. Ein weiteres Problem: Nur 16 Prozent dieser verwendeten externen Finanzierung könne als Sustainable Finance klassifiziert werden.
Den größten Teil der Investitionen bringen die Betriebe aus eigenen Mitteln auf, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Danach komme die für den Mittelstand typische Hausbankfinanzierung. Während große Unternehmen an den Kapitalmärkten “grüne” Finanzierungen erhalten könnten, hätten KMU der Studie zufolge kaum Zugang zu entsprechenden Mitteln.
Das Sustainable-Finance-Regelwerk der EU besteht aus drei zentralen Gesetzen, die von weiteren Instrumenten umringt sind: die Taxonomie, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zur Berichterstattung über die Nachhaltigkeit der Unternehmen, und die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) für Finanzinstitutionen. Die Vorgaben samt der umfangreichen Berichtspflichten sind auf große Unternehmen ausgerichtet, die sich über den Kapitalmarkt bei Investoren finanzieren.
Auch börsennotierte KMU müssen ab 2026 berichten, haben jedoch bis 2028 noch die Möglichkeit zu einem Opt-out. Dabei handelt es sich allerdings nur um sehr wenige Unternehmen, erklärt Stefan Müller, Professor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfungswesen an der Universität Hamburg. Das viel größere Problem entstehe für die übrigen KMU: “Da 85 Prozent der deutschen Unternehmen Teil der Wertschöpfungsketten großer, berichtspflichtiger Unternehmen sind, sind indirekt doch fast alle betroffen.”
Die Studie der DIHK beschreibt dies als “Trickle-Down-Effekt”: Über verschiedene Kanäle werden die Berichtspflichten auf die kleineren Unternehmen übertragen. Dies führe zu hohen Kosten für KMU, ohne Vorteile wie einen besseren Zugang zu Finanzierungsinstrumenten zu bieten.
Kleine Unternehmen wie die Fleischerei um die Ecke sähen sich auf einmal mit Anforderungen konfrontiert, die bisher nicht Teil der Rechnungslegung waren und auf die sie nicht vorbereitet sind, sagt Müller. Durch die fehlende Standardisierung sei zudem nicht klar, wie sie bestimmte Informationen, etwa Kennzahlen zu den Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer im Ausland, in Erfahrung bringen und dokumentieren sollen.
Darüber hinaus gebe es für nachhaltige KMU-Kreditfinanzierungen keine Standards, bemängeln viele Unternehmen. Banken seien aufgrund möglicher Greenwashing-Vorwürfe sehr zögerlich bei ESG-Finanzierungen. Förderprogramme würden häufig als zu umständlich und die Genehmigungsphasen als zu lang beschrieben.
Für KMU sollte die Sustainable-Finance-Regulierung deshalb laut der Studie einfacher und individueller werden. Eine mögliche Lösung sei ein angepasster Berichtsstandard für KMU, die größer als Kleinstunternehmen sind. Dieser sollte dazu dienen, die Transformation der KMU effektiv zu steuern und den Trickle-Down-Effekt innerhalb der Wertschöpfungskette zu begrenzen.
Die von der EU-Kommission beauftragte European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) erarbeitet bereits einen freiwilligen KMU-Standard für nicht-kapitalmarktorientierte KMU und will diesen demnächst zur Konsultation veröffentlichen.
Die Studienautoren empfehlen darüber hinaus aufsichtsrechtliche Standards für grüne KMU-Kredite sowie einfachere, schnellere und effizientere staatliche Förderprogramme. Die Kapazität von Banken, grüne Finanzierungen durch Förderungen und KMU-orientierte Regulierungen zu vergeben, müsse massiv erhöht werden. Auf Unternehmensebene bedürfe es KMU-Finanzierungen in Form von Krediten, die an ESG-Kriterien gebunden sind (“ESG-linked loans”).

Knapp 30.000 Windräder drehten sich 2022 in Deutschland. Sie erzeugten 25,9 Prozent des deutschen Stroms und sollen als Teil der Energiewende künftig einen noch größeren Beitrag leisten. Je mehr Anlagen allerdings hinzukommen und je älter die bestehenden werden, desto stärker gerät die Frage des Recyclings in den Fokus. “Aktuell sind die Mengen, die zurückgebaut werden müssen, noch so gering, dass wir eigentlich immer noch vor der ganz großen Welle sind und Zeit haben, technische Lösungen weiterzuentwickeln”, sagt Steffen Czichon, Abteilungsleiter Rotorblätter beim Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme. Andererseits: Das Umweltbundesamt erwartet in den kommenden 20 Jahren knapp 400.000 Tonnen Abfälle, alleine durch die Rotorblätter.
Beim Recycling von Windenergieanlagen sind das Fundament und der Turm das kleinere Problem. Sie werden im Wesentlichen aus Stahl und Beton gefertigt, für die es etablierte Recyclingverfahren gibt. Die Rotorblätter hingegen, die häufig 50, 60 Meter lang sind und mehr als 20 Tonnen wiegen können, bestehen neben Holz, Metall und Klebstoff vor allem aus Faserverbundkunststoffen. Bei älteren Modellen ist das meistens glasfaserverstärkter, bei neueren kohlenstofffaserverstärker Kunststoff – und in beiden Fällen lassen sich die einzelnen Komponenten nur schwer voneinander trennen. Forscher und Unternehmen arbeiten deshalb daran, Lösungen zu finden.
Das Bremer Unternehmen Neowa hat Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bis zum letzten Jahr mittels Co-Processing recycelt. Bei dem Verfahren wird das Material geschreddert und zu einem Granulat verarbeitet, das als Ersatzbrennstoff in der Zement-Industrie eingesetzt wird. Gleichzeitig ersetzt der Glasanteil einen Teil des Sandes, der in der Zement-Herstellung verwendet wird.
Doch letztes Jahr wurde der Betrieb eingestellt, sagt Geschäftsführer Mika Lange, weil die Zahl der Rotorblätter stark zurückgegangen war. Der Grund: Die Windkraftanlagen werden teilweise länger betrieben als die geplanten 20 Jahre, da sie technisch in Ordnung sind; dank der gestiegenen Energiepreise sind sie auch dann noch rentabel, wenn die staatliche Förderung nach 20 Jahren ausläuft. Andere Standorte warten noch auf die Genehmigung, die alten Windräder durch größere und leistungsfähigere Anlagen auszutauschen und bauen sie noch nicht ab.
Irgendwann müssen aber auch diese Rotorblätter recycelt werden. Das dänische Unternehmen Continuum plant deshalb gerade den Bau mehrerer Recycling-Fabriken. Dort sollen die Rotorblätter geschreddert werden, um daraus Verbundwerkstoff für Küchenarbeitsplatten oder Platten für die Bauindustrie herstellen zu können. Die fertigen Paneele bestehen laut Angaben des Unternehmens zu 92 Prozent aus recyceltem Material.
Zudem habe das Verfahren den Vorteil, dass es den CO₂-Ausstoß, der bei der derzeit angewandten Verbrennung und Verarbeitung der Rotorblätterreste in Zementfabriken entsteht, drastisch reduzieren soll. Wie genau, das möchte Continuum nicht erklären. Anfang 2024 soll die erste Fabrik fertig werden, fünf sind europaweit geplant, eine davon in Deutschland. Die Fabriken sollen mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden und jeweils rund 36.000 Tonnen GFK im Jahr verarbeiten.
Auch die Firma Novotech in Aschersleben in Sachsen-Anhalt recycelt GFK-Abfälle mittels mechanischen Recyclings: Die Flügel werden zu einem groben Pulver zerkleinert, das mit Holzspänen und weiteren Zusatzstoffen bei 170 Grad zu Terrassendielen geformt wird, die bis zu 30 Prozent aus einem Rotorblatt gefertigt werden.
Um das Recycling künftig zu vereinfachen, ist es wichtig, die letzten Schritte schon beim Design-Prozess des Produkts mitzuplanen und Rotorblätter so zu gestalten, dass sich ihre Ausgangsmaterialien leichter trennen lassen als bisher. Siemens Gamesa hat etwa das “RecyclableBlade” entwickelt, bei dem ein neues Harz zum Einsatz kommt, dessen chemische Struktur die Trennung der unterschiedlichen Bestandteile ermöglicht. Mit einer milden Säurelösung lassen sich Harz, Glasfasern und Holz voneinander lösen und dann in der Bauwirtschaft, für Konsumgüter oder in der Automobilindustrie wiederverwenden.
Das deutsche Start-up Voodin Blades entwickelt zusammen mit einem finnischen Holzwerkstoff-Produzenten leichtere Rotorblätter aus Furnierschichtholz. Derzeit testen sie ein 20-Meter-Blatt, ein 80-Meter-Rotorblatt ist als nächstes geplant.
Aber: Die aktuellen Recycling-Ansätze führen noch zu keiner echten Kreislaufwirtschaft. Bisher werden die Materialien weiterverwendet, das daraus entstehende Produkt ist in der Regel jedoch minderwertiger – ein klassisches Downcycling. Wie sich die existierenden Konzepte verbessern lassen, sodass höhere Materialwerte erzielt werden und der Energieverbrauch reduziert wird, daran wird noch geforscht.
Und auch die Politik ist gefragt. Denn ein RecyclableBlade sei noch lange kein “blade that will be recycled”, sagt Steffen Czichon vom Fraunhofer-Institut. “Ich vergleiche das immer mit Kaffeebechern. Schön, wenn die kompostierbar sind. Wenn ich sie dann aber verbrenne, bringt das nichts. Und so ist es auch bei den recyclebaren Rotorblättern.”
Deswegen sei es sehr wichtig, an einer geschlossenen Verwertungskette zu arbeiten, indem zum Beispiel zentrale Annahmestellen für alte Rotorblätter eingerichtet werden. Dazu bräuchte es aber noch klarere politische Rahmenbedingungen – und die fehlen bislang. Doch der Ausbau der Windenergie steht im Vergleich zum Recycling auf der Prioritätenliste weiter oben. Sarah Kröger
Mittwoch, 27.09.2023, 10:10-11:00 Uhr
Mündliche Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Thema Land Governance – Traditionelle vs. formalisierte Landrechtssysteme und die Rolle der deutschen EZ (in Verbindung mit einem Gespräch mit Roman Herre, FIAN) Info
Mittwoch, 27.09.2023, 11:00-13:00 Uhr
Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften Info
Mittwoch, 27.09.2023, 11:00-13:00 Uhr
Öffentliche Anhörung zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Luftqualität und saubere Luft für Europa” Info
Mittwoch, 27.09.2023, 17:00-18:30 Uhr
Öffentliche Beratung 47. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung Info
Donnerstag, 28.09.2023, 15:25 Uhr
Erste Beratung des Antrags der Fraktion CDU/CSU “Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten” Info
Donnerstag, 28.09.2023, 16:55 Uhr
Erste Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU “Energiespeicher jetzt ausbauen” Info
Donnerstag, 28.09.2023, 19:10 Uhr
Beratung über die Verordnung des BMUV über die Abgabesätze und das Punktesystem des Einwegkunststofffonds (EWKFondsV) Info
Freitag, 29.09.2023, 9:00 Uhr
Erste Beratung Erste Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen Info
Die Unternehmensberatung PwC hat ihre Untersuchung “Zwischen Transparenz und Nachhaltigkeit – Die ESG Säule III Offenlegungsstudie” vorgelegt. Sie befasst sich mit der Frage, wie Kreditinstitute in Europa die Standards der European Banking Authority (EBA) zur Offenlegung von ESG-Risiken gemäß Artikel 449a der Capital Requirements Regulation (CRR) erstmals in ihren Berichten umgesetzt haben.
Dabei zeigt sich, dass viele Banken ihre ESG-Risiken nur unzureichend offenlegen. “Die bereitgestellten Informationen, vor allem für Risiken bei Soziales und Unternehmensführung, bieten keine ausreichende Tiefe, um ein umfassendes Verständnis der potenziellen Risiken zu erhalten”, so eine der Schlussfolgerungen der Studie.
Investoren sind auf genaue und vergleichbare Angaben angewiesen. “Eine transparente und detaillierte Offenlegung von ESG-Risiken ermöglicht es Finanzmarktteilnehmern, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und die ESG-Performance der Institute besser zu beurteilen”, sagt Christoph Schellhas, Partner und Financial Services Sustainability Lead bei PwC Deutschland.
Die Standards der “ESG Säule III Offenlegung” sollen sicherstellen, dass der Finanzsektor einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leistet und der EU Green Deal als Maßnahmenpaket für ein klimaneutrales Europa bis 2050 erfolgreich umgesetzt wird. Gleichzeitig sollen sie die Qualität und Vergleichbarkeit der Berichte erhöhen.
Im Rahmen der Studie wurden die Nachhaltigkeitsberichte von 25 Kreditinstituten in Europa untersucht, darunter 14 aus Deutschland. Alle Institute berichteten erstmals zum 31. Dezember 2022 über ihre ESG-Risiken. Ab 2023 erfolgt die Berichterstattung halbjährlich. Zukünftig wird sie zudem weiter ausgebaut. ch
Die globalen Öl- und Gaskonzerne können sich weiterhin auf die Unterstützung der größten Banken verlassen – und die Deutsche Bank zählt zu ihren wichtigsten Finanziers. Zu diesem Ergebnis sind zwei Rechercheteams aus den Niederlanden und 12 internationale Medien gekommen. Für ihre gemeinsame Arbeit haben sie die Anleihen untersucht, die die Kreditinstitute für Konzerne wie BP, Petrobras, Petroleum Mexicanos, Shell oder Occidental Petroleum Corp. seit dem Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens 2016 für neue Rohstoffförderungen am Markt platziert haben. Bis zum Juni 2023 kamen sie auf weltweit 1666 Anleihen mit einem Volumen von 1,01 Billionen Euro. Die Deutsche Bank war an Deals beteiligt, deren Volumen zusammen 432 Milliarden Euro betrug.
Zu den weiteren emittierenden Banken zählen JP Morgan, Citi, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas und Crédit Agricole. Letztere hat sich, wie auch die Deutsche Bank, öffentlich zur Bekämpfung des Klimawandels bekannt, untergräbt mit den fossilen Anleihen allerdings die eigenen Bemühungen. Die Geschäfte bleiben in der Regel unerkannt, da der Handel nicht über die Börse organisiert ist. Schon in den vergangenen Jahren sind die Großbanken für ihre Geschäfte mit dem fossilen Sektor kritisiert worden, unter anderem von der NGO Urgewald. maw
Das EU-Parlament wird seine Position zur Green Claims-Richtlinie laut dem neuen Zeitplan des Binnenmarktausschusses im März 2024 festlegen. Die Verhandlungen mit dem Rat müssen dementsprechend wahrscheinlich nach den Europawahlen fortgeführt werden.
Aufgrund eines Kompetenzkonflikts zwischen den Ausschüssen hatte sich der Zeitplan verschoben. Der Umweltausschuss (ENVI) hatte die Zuweisung des Textes an den Binnenmarktausschuss (IMCO) angefochten. Mit Erfolg: Beide Ausschüsse müssen nun nach dem Gemeinsamen Ausschussverfahren (Artikel 58) einen gemeinsamen Berichtsentwurf verfassen.
Vergangene Woche war der Zeitplan veröffentlicht worden. Laut diesem soll der von den Berichterstattern Andrus Ansip (Renew, für IMCO) und Cyrus Engerer (S&D, für ENVI) gemeinsam verfasste Berichtsentwurf am 6. oder 7. November in den Ausschüssen vorgestellt werden. Mitte Februar sollen die Ausschüsse abstimmen, im März das Plenum. Wie die Nachrichtenplattform Contexte berichtet, haben die Verhandlungen mit dem EU-Rat keine Chance, vor den Europawahlen Anfang Juni abgeschlossen zu werden, sondern müssen in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder aufgenommen werden.
Die Kommission hatte im März einen Entwurf für die Green Claims-Richtlinie vorgestellt. Diese soll einen Rahmen für Umweltangaben von Unternehmen schaffen. leo
Der Vorschlag der EU-Kommission, die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat um zehn Jahre zu verlängern, stößt politisch auf geteiltes Echo. Bei einer Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) der EU habe sich Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg eingesetzt. Die Genehmigung in der EU müsse enden, solange Schäden für die Biodiversität nicht ausgeschlossen werden können. In Frankreich hingegen sieht die Einschätzung anders aus. “Wir vertrauen der Wissenschaft und Studien, die besagen, dass Glyphosat kein krebserregendes Problem darstellt”, sagte Landwirtschaftsminister Marc Fesneau.
Gegenüber Table.Media kritisierten Ökologen derweil den Plan der EU-Kommission. Der österreichische Wissenschaftler Johann Zeller von der Wiener Universität für Bodenkultur warf der EU-Kommission das “systematische Leugnen” des Rückgangs der Biodiversität und eine “Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften” vor. Maria Finckh, Leiterin des Fachgebiets Ökologischer Pflanzenschutz von der Uni Kassel, erklärte, dass die vorgeschlagenen Auflagen für die künftige Verwendung des Mittels EU-weit betrachtet eine Verbesserung bringen würden. Zugleich aber unterlaufe die EU-Kommission unter anderem ihre eigenen Absichten, eine permanente Bodenbedeckung und Begrünung zu fördern, um die Kohlenstoffspeicherung in den Böden zu erhöhen.
Horst-Henning Steinmann von der Georg-August-Universität Göttingen sagte: “Glyphosat ist zwar von den Risiken her gesehen ein Leichtgewicht, aber es ist ein großer Treiber bei den ausgebrachten Mengen.” Deshalb schlug er vor: “Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob ein System einer Mengendecklung machbar ist.” Die aktuelle Zulassung für Glyphosat läuft am 15. Dezember aus. maw
Die zahlreichen Krisen und die tiefgreifende Transformation der Wirtschaft führen zu einem sich rasch wandelnden Unternehmensumfeld. Um dem gerecht zu werden, müssen sich Führungsstrukturen und Geschäftsstrategien ändern. Die Studie “Krisenmanagement und Führungskultur” des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Expense Reduction Analysts legt jedoch nahe, dass dies häufig nicht der Fall ist.
“Die Studie zeigt, dass nach einer überstandenen Krise mehrheitlich nach den angestammten Mustern weitergearbeitet wird”, sagt Matthias Droste, Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Expense Reduction Analysts. “Nur jedes zweite befragte Unternehmen hat aus den Krisen wirklich schon Lehren gezogen und daraus Maßnahmen abgeleitet.”
Die Untersuchung basiert auf Antworten von 189 Unternehmen. Dort beschreibt das Top-Management die aktuelle Situation zwar als herausfordernd und 72 Prozent der Führungskräfte der zweiten Ebene berichten von Überforderung bei Entscheidungen unter Zeitdruck. Doch “weder bei der Führungskultur noch bei den genutzten Managementtools haben sich bisher dringend notwendige Veränderungen flächendeckend etabliert”, heißt es in der Studie.
Laut Droste haben noch immer 50 Prozent der Unternehmen kein belastbares Krisenmanagementsystem etabliert. Nur ein Drittel hält die Lehren aus Krisen in Richtlinien und Handbüchern fest. Zudem sei das Krisenmanagement bei mehr als der Hälfte der Firmen noch nicht in der Unternehmensstrategie verankert. ch
Die deutschen Fintechs Evergreen und Forget Finance wollten wissen, worauf die sogenannten Millennials, also die Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 40, bei ihren Finanzen Wert legen. Ihre bei dem Meinungsforscher Yougov beauftragte, repräsentative Umfrage zeigt, dass regelmäßiges Sparen und Investieren für sie eine hohe Priorität hat. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Zwar kennen 24 Prozent den Begriff “nachhaltige Geldanlage” gar nicht und weitere 16 Prozent wissen nicht genau, was er bedeutet. Dennoch ist es 48 Prozent wichtig, dass ihr Finanzdienstleister nachhaltig agiert. 36 Prozent ist es hingegen egal.
Von den Befragten, die altersbedingt zunehmend finanzkräftiger werden und in die Führungsetagen von Wirtschaft und Gesellschaft hineinwachsen, antworteten zudem 43 Prozent, dass sie in eine lebenswerte Zukunft investieren wollen. 15 Prozent erhoffen sich eine höhere Rendite. Frauen, die nachhaltig investieren, tun dies zudem aus deutlich altruistischeren Motiven als Männer. Mehr als die Hälfte von ihnen gibt als Grund an, in eine lebenswerte Zukunft investieren zu wollen. Bei den Männern ist es nur ein Drittel. ch
Verwirrung statt Klarheit beim ESG-Reporting – Finance Magazin
Das International Sustainability Standards Board will international einheitliche Regeln für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchsetzen. Doch Günter Heismann befürchtet einen Wettlauf mit den Standards der EU und der USA. Zum Artikel
Bis zu 180.000 Euro Gehalt: Das müssen ESG-Manager wirklich können – Handelsblatt
ESG-Manager werden dringend gesucht. Viele Bewerber aber haben ein verklärtes Bild von dem Beruf. Was Sie wirklich brauchen, um den Job zu meistern, weiß Julia Beil. Zum Artikel
California cracks down on Carbon – Economist
Kalifornien, eine der weltgrößten Volkswirtschaften, nimmt nicht-nachhaltige Konzerne von gleich zwei Seiten in die Zange: Zum einen verklagt der Staat große fossile Energieunternehmen, weil sie zu wenig gegen den von ihnen mitverursachten Klimawandel getan haben. Zum anderen wird eine neue, härtere Regulierung angestrebt. Das kann Folgen für die gesamten USA haben. Zum Artikel
Das sind die zehn größten Zulieferer der Autoindustrie – Automobil Produktion
Die Transformation der Autoindustrie sorgt auch im Ranking der wichtigsten Zulieferer für Fluktuation. Unter den Top 10 sind noch drei deutsche Firmen. Vor allem der chinesische Batteriehersteller CATL macht im Vergleich zum Vorjahr einen großen Sprung, berichtet Timo Gilgen. Zum Artikel
Nachhaltigkeitsstandard für Werkzeuge – Maschinenmarkt
Der Werkzeughersteller Ceratizit führt den ersten Nachhaltigkeitsstandard für Werkzeuge ein. Der Standard ermögliche es Industriekunden, den CO₂-Fußabdruck für die in der Fertigung eingesetzten Werkzeuge aus Primärdaten zu berechnen und auf dieser Basis eine Strategie zur Senkung der Emissionen im Werkzeugeinsatz zu entwickeln. Zum Artikel
Inside Big Oil’s Tech Portfolio – Sifted
Freya Pratty hat analysiert, in welche Tech-Start-ups die großen fossilen Öl- und Gaskonzerne ihr Geld investieren. Ergebnis: Es geht mehrheitlich nicht in junge Unternehmen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, etwas zur Energiewende beizutragen. Zum Artikel
Batterie der Zukunft – Produktion
Forschende der RWTH Aachen wagen einen Blick in die Zukunft, aus welchen Materialien die Batterien von morgen bestehen. Das Fazit von Autor Dietmar Polls Überblick: Es werde nicht eine Batterie der Zukunft geben, die sich am Markt durchsetze, dazu seien die Interessen und Anwendungen zu verschieden. Zum Artikel
Surveillance Tech helps Indigenous Groups protect the Amazon – Bloomberg
In Ecuador setzen Indigene moderne Technologien ein, um unliebsame Eindringlinge zu vertreiben, die ihren heimischen Regenwald zum Jagen und Roden ausbeuten wollen. Sie lassen Drohnen steigen, die mit Kameras ausgerüstet sind, und nutzen GPS-Tracker. Und wie Laura Millan erfahren hat, zeigt die digitale Selbstverteidigung Wirkung. Zum Artikel
Grüner Wasserstoff aus methanolhaltigem Abwasser – Process
Für die Herstellung grünen Wasserstoffs werden erhebliche Mengen an Wasser benötigt. Laut dem Fraunhofer Institut könnten aber auch methanolhaltige Abwässer aus der Stahlproduktion genutzt werden. Damit stünde die Erzeugung grünen Wasserstoffs nicht in Konkurrenz zu Trinkwassergewinnung und Bewässerung. Erste Versuchsreihen verliefen erfolgreich. Nun folge die praktische Umsetzung. Zum Artikel
E-Mobilität: Wo Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China und die USA bei der E-Wende stehen – Der Standard
Großbritannien verschiebt das Aus für Verbrenner nach hinten, und die Autokonzerne üben daran Kritik. Wie steht es um die Wende zur E-Mobilität? Ein Überblick von Sebastian Borger, Stefan Brändle, Regina Bruckner, Joseph Gepp und Alicia Prager. Zum Artikel
Meet the Climate-Defying Fruits and Vegetables in Your Future – The New York Times
Kim Severson hat sich klimaresistente Früchte und das Gemüse der Zukunft angesehen: Heißwetter-Kirschen, dürreresistente Melonen und sechs weitere Pflanzen, die unsere Ernährung in einer sich schnell erwärmenden Welt verändern könnten. Zum Artikel
As disasters spike, superpowers face mounting calls to forge climate deal – The Washington Post
Im Vorfeld der COP28 haben führende Vertreter einiger der wichtigsten Klimainstitutionen der Welt den Druck auf die USA und China erhöht, ein Abkommen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zu schließen. Laut Timothy Puko befürchten sie, dass die angespannten Beziehungen zwischen beiden Supermächten die Fortschritte bei den Verhandlungen zunichte machen könnten. Zum Artikel
BlackRock, State Street Among Money Managers Closing ESG Funds – Bloomberg
BlackRock Inc. und andere Vermögensverwalter haben jahrelang nachhaltige Fonds aufgelegt, um vom steigenden Interesse an ESG-Investitionen zu profitieren. Jetzt geben sie eine wachsende Zahl dieser Produkte in den USA angesichts der politischen Gegenreaktion und der kritischen Prüfung durch die Anleger auf, schreibt Silla Brush. Zum Artikel

Als die Corona-Pandemie 2020 die Welt heimsuchte und der erste Lockdown ausgerufen wurde, waren die damit verbundenen Einschränkungen ein einschneidendes Ereignis. Die bis dahin gewohnte Normalität war plötzlich verschwunden, Reisen unmöglich geworden. Auch die Philosophin Eva von Redecker konnte lange geplanten beruflichen Einladungen nach Kalifornien nicht nachkommen und sah sich gezwungen, in ihrer Landkommune zu bleiben.
Bis dahin kreiste ihre Arbeit unter anderem darum, der Klimabewegung eine philosophische Grundlage zu geben und nach einem Verhältnis zur Welt zu suchen, das in letzter Minute Wege eröffnen könnte, einer sich abzeichnenden “Klimahölle” (UN-Generalsekretär António Guterres) zu entgehen. “Revolution für das Leben” war das Buch, in dem sie eine “Philosophie der neuen Protestformen” entwarf und auch der Entstehung des gegenwärtigen Eigentumsbegriffs nachspürte, den sie als willkürliche “Sachherrschaft” bezeichnet und ins Zentrum ihrer Kritik am gegenwärtigen Umgang mit dem Planeten stellt.
Das Verständnis und die Konzeption von Freiheit war auch dort schon ein zentrales Thema. Aber die plötzliche Unmöglichkeit, bürgerliche Grundrechte wie Reisefreiheit auszuüben, brachte sie neu zum Nachdenken. Vielen ging es damals so: Die rasante Vollbremsung unseres beschleunigten Lebens war einerseits ein Schock und auf der anderen Seite eine neue Erfahrung von Entschleunigung – und eben von Freiheit.
Für Eva von Redecker war es die Freiheit, bleiben zu dürfen. Eine voraussetzungsvolle Freiheit, wie sie schnell bemerkte, denn sie setzt eine ökologisch und sozial halbwegs intakte Welt voraus, in der man sich gut und gerne aufhalten kann. Eine Freiheit, die vielen Menschen nicht zur Verfügung steht und die sich auch wegen der Klimakrise als Ausgangspunkt für einen Essay über “Bleibefreiheit” anbot. Es wurde ein Buch daraus, das im Sommer unter eben diesem Titel erschienen ist.
Im pointierten Titel klingt das oft ebenso pointierte Sprechen der Denkerin an, die an der Cambridge University und der New School for Social Research in New York sowie zehn Jahre an der Humboldt-Universität in Berlin tätig war, unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Philosophin Rahel Jaeggi. Blankes Unverständnis, dass im Angesicht des drohenden Verlusts der Bewohnbarkeit des Planeten zu wenig unternommen wird, ist ihr beim Sprechen anzumerken.
Ihr Konzept von Freiheit setzt der Freiheit im Raum, die nicht nur auf Bewegung, sondern vor allem auf stetige Expansion gerichtet ist, ein zeitlich basiertes Verständnis von Freiheit entgegen, das auch die beschränkte menschliche Lebenszeit in den Blick nimmt und an die Stelle eines rasenden Hamsterrades eine “Fülle erfüllter Zeit” setzt.
Es macht ihr erkennbar Spaß, sich Grundannahmen des Liberalismus vorzunehmen und diese vor dem Hintergrund der planetarischen ökologischen Krise zu sezieren: Eigentum? Will sie nicht etwa abschaffen, erinnert aber an das verbriefte Recht, eben dieses nach Gutdünken und ohne Grund auch zerstören zu dürfen. Warum also kein Konzept von Eigentum, das nicht an willkürliche Verfügung sondern vielmehr an Verantwortung und Lebenszeit gebunden ist? Der Mensch ist frei geboren? Er könne im Laufe seines Lebens frei werden, antwortet von Redecker, nicht Selbsteigentum sei Freiheit, sondern Selbstwirksamkeit. Gegenwärtig werde aber vor allem daran gearbeitet, die Freiheit künftiger Generationen drastisch einzuschränken.
Manchmal scheint ihre Kritik am Neoliberalismus reflexhaft und zu sehr fokussiert auf ein verkürztes Verständnis der “liberalen Tradition”, wenn “ein paar Jahrzehnte Privatisierung, Effizienzsteigerung und Finanzialisierung” Schuld sein sollen, dass “plötzlich alles marode” geworden sei, wie sie schreibt. Waren linke Modelle ökonomischer Entwicklung in der Vergangenheit nicht ebenso auf Verwertung fossiler Rohstoffe gebaut? Ging der Freiheitsbegriff des klassischen Liberalismus wirklich nur von Freiheit der Bewegung und Besitzmehrung aus?
Präzise und überzeugend ist ihr Blick dennoch und vor allem dort, wo es um die vielfältigen und komplexen Zusammenhänge menschlichen Lebens mit und in einer bedrohten Natur geht. Das beginnt bei den offensichtlichen Zwängen von Millionen, die aufgrund von Klimafolgeschäden nicht dort bleiben können, wo sie leben. Doch es geht um mehr, es geht um die Bewohnbarkeit des Planeten und den Erhalt des Ökosystems mit seinen unendlichen wechselseitigen Abhängigkeiten. Von Redecker nimmt Ankunft und Flug der Schwalben als Metapher, um eindringlich zu erinnern, was es zu erhalten gilt: Eine Welt, in der Menschen leben, die sich jedes Jahr aufs Neue freuen, wenn die Schwalben kommen. Der Klimawandel bedroht deren Lebensräume und Flugrouten. Ihr Verlust wäre nicht nur schmerzlich für die Umwelt. “Es wäre einfach weniger schön”, sagt Eva von Redecker. Lukas Franke
China.Table: EU-Handelschef zeigt in Peking klare Kante. Ukraine-Krieg, EU-Untersuchung bei E-Autos oder Anti-Spionagegesetz – EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis arbeitet sich in Peking an vielen schwierigen Themen ab. Auf konkretes Entgegenkommen seitens China wartete er allerdings vergebens. Mehr
Europe.Table: Jutta Paulus: Einigung vor COP28 “von großer Bedeutung”. EU-Berichterstatterin Jutta Paulus (Grüne) über die Notwendigkeit, eine Einigung über die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor vor dem COP28 in Dubai zu erreichen Mehr
Climate.Table: UN-Gipfel: Die Klimaschutz-Vorreiter machen sich Mut. Ausgewählte Klima-Champions durften beim UN-Gipfel in New York ihre Ziele und Erfolge erläutern, António Guterres wollte so die Macht der Progressiven gegenüber den Bremsern vergrößern. Aber der grünen Front fehlt es an Schlagkraft. Mehr
In Frankreich ist es bereits soweit: Zehntausende Menschen in rund 200 Kommunen mussten in diesem Sommer mit Trinkwasser aus Tankwagen versorgt werden, Winzer fürchten eine katastrophale Weinlese, die Bewässerung von Gärten und Parks wurde drastisch eingeschränkt. In Deutschland läuft bislang noch alles wie gewohnt, nur Experten schlagen immer öfter Alarm, die Grundwasserspiegel würden sich trotz ergiebiger Regenfälle nicht mehr erholen. Als Folge der globalen Klimaveränderung droht Wasserknappheit in Mitteleuropa zu einem ernsten und wachsenden Problem zu werden.
In ihrem neuen Buch “Durstiges Land” haben sich die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres des Themas angenommen. In jeweils sechs Geschichten schildern sie, wie sich die Lebensbedingungen Mitte der Vierziger Jahre verändert haben könnten, wenn es weiter geht wie bisher. Die Szenarien fallen reichlich dystopisch aus. Pandemien sind Normalität, Waldbrände haben ganze Regionen vernichtet und Flüsse sich in giftige Kloaken verwandelt. Das Leben ist zum Überlebenskampf geworden, wer es sich leisten kann, lebt in martialisch gesicherten “gated communities”.
Den apokalyptisch anmutenden Geschichten stellen sie jeweils eine Variante gegenüber, wie eine Zukunft aussehen kann, in der die sozial-ökologische Transformation gelungen ist. In allen Geschichten wird deutlich: Die Weichen stellen wir jetzt. Susanne Götze und Annika Joeres wissen, worüber sie schreiben, beide arbeiten seit Jahren zu Folgen des Klimawandels, sie sind als Autorinnen für den “Spiegel” oder die “Zeit” tätig, ihr letztes Buch “Klima außer Kontrolle” wurde mit dem Sachbuchpreis des NDR ausgezeichnet. “Durstiges Land” ist kenntnis- und faktenreich geschrieben – und zeigt, dass die vor uns liegenden Aufgaben zwar groß sind, aber bewältigt werden können. Wenn das Notwendige geschieht. Lukas Franke
