Bundesumweltministerin Steffi Lemke unterzeichnete am Dienstag einen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft mit China. Dann ging es direkt weiter zur “Our Ocean Conference” in Athen. Thema: Meeresschutz. Sonntag und Montag ist Lemke im kanadischen Ottawa, wo am Dienstag die Verhandlungen für ein UN-Abkommen gegen Plastikmüll weitergehen.
Beobachter sind gespannt, ob es gelingt, sich auf effektive Regeln für den ganzen Lebenszyklus von Kunststoffen zu einigen. Einige Staaten mit starker Fossil-Industrie setzen sich für einen Fokus auf Sammlung und Recycling ein. Über ein Beispiel für neue Recyclingverfahren berichtet Petra Hoffknecht. Sie hat sich angesehen, wie Covestro den Schaumstoff von alten Matratzen verarbeitet.
Auch ein wichtiges Thema in Steffi Lemkes Ressort ist der natürliche Klimaschutz. Doch vergangenes Jahr wurde für Maßnahmen wie Wiederaufforstung nur ein kleiner Teil des Geldes aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) ausgegeben. Weil insgesamt lediglich rund die Hälfte des Geldes aus dem KTF ausgegeben wurde, fordert nun das Forum Ökosoziale Marktwirtschaft Konsequenzen. Malte Kreutzfeldt hat die Details.
Am Sonntag beginnt die Welt-Kakao-Konferenz in Brüssel, wo sich viele treffen, die an der Wertschöpfung beteiligt sind. Friedel Hütz-Adams, Experte für verantwortungsvolles Wirtschaften vom Südwind-Institut erklärt im Standpunkt, warum aus seiner Sicht aktuell ein guter Zeitpunkt ist, um die sozialen Missstände in dem Sektor anzugehen – und wie dies gelingen könnte.
Ich wünsche eine anregende Lektüre.


Pro Jahr fallen in Europa 40 Millionen ausrangierte Matratzen an. Die meisten werden verbrannt oder landen auf Mülldeponien. “Dieser lineare Ansatz belastet die Ressourcen, erhöht die Emissionen und birgt Umweltrisiken”, sagt Henning Wilts, Abteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut.
Das börsennotierte Chemieunternehmen Covestro aus Leverkusen arbeitet an Verfahren, um aus Kunststoffabfällen wieder gefragte Rohstoffe herzustellen. Dadurch sollen Produkte mit niedrigerem CO₂-Fußabdruck entstehen und die Recyclingquote soll gesteigert werden. Seit 2019 verfolgt das Unternehmen, das vier Jahre zuvor aus der Kunststoffsparte der Bayer AG hervorging, eine Kreislaufwirtschaftsstrategie mit dem Ziel der Minimierung fossiler Rohstoffe. Das Potenzial ist enorm: Covestro geht davon aus, dass 60 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion bis 2050 durch recycelte Rohstoffe erfolgen kann.
Ein Vorzeigeprojekt der Leverkusener ist ein Verfahren zum Wiederverwerten von gebrauchten Matratzen. Das Augenmerk liegt hier insbesondere auf dem weichen Schaumstoff unter dem Überzug. Dieser besteht aus Polyurethan – einem Material, das elastisch und fest zugleich ist.
Durch herkömmliche Methoden wie Kleinhacken und Einschmelzen lässt sich dieser Werkstoff nicht recyceln. Zwar kann klein geschredderter Matratzenschaum einmalig als Unterlage von Teppichen verwendet werden, damit sie nicht rutschen. Auch die Dämmung von Autos ist möglich. Ein neues Leben als Matratze gab es für Polyurethan-Schaum bislang aber nicht.
Covestro setzt nun darauf, die chemischen Bausteine aus dem Matratzenschaum zurückzugewinnen. Diese lassen sich dann als Rohstoffe wieder einsetzen, um neuen Schaum und damit neue Matratzen herzustellen. Und zwar “beliebig oft” und “ohne Qualitätsverlust”, wie Karin Clauberg betont. Die studierte Maschinenbauerin befasst sich in leitender Funktion mit den Prozessen für chemisches Recycling im Covestro-Matratzenprojekt.
Insgesamt hat Covestro mehr als 20 Projekte gestartet, um neue Methoden im Grundstoffrecycling zu etablieren. “Wir verändern unsere komplette Rohstoffbasis – weg von petrochemischen Rohstoffen und hin zu nachhaltigen Rohstoffquellen wie Biomasse, CO₂ und Abfall”, sagt Clauberg. Schrittweise möchte das Unternehmen fossile Rohstoffe zur Herstellung der Covestro-Vorprodukte ersetzen. Die Vorprodukte lassen sich dann beispielsweise zu hartem Schaumstoff für die Dämmung von Gebäuden oder zu weichem Schaumstoff für die Möbelindustrie weiterverarbeiten.
2021 baute die Firma eine Pilotanlage zum Matratzenrecycling. Noch in diesem Jahrzehnt möchte Covestro eine größere Anlage realisieren, aus der dann kommerzielle Produkte verkauft werden können. Matratzenschaum sei aber erst der Anfang: Die Technologie lässt sich den Angaben des Unternehmens zufolge noch weiter hochskalieren. Auch für das Recyceln von Autositzen und Sofas aus Polyurethan-Weichschaum komme das Verfahren infrage.
Von der Politik wünscht sich Covestro eine verbindliche Festschreibung von Rezyklat-Mindestanteilen in Kunststoffanwendungen. Hilfreich wären außerdem Matratzensammelstellen. Denn um effizient recyceln zu können, benötigt das Unternehmen den möglichst günstigen Zugang zu vielen Millionen Matratzen.
Chemisches Recycling wird kontrovers diskutiert. Denn es ist energieintensiver und technisch aufwändiger als Verfahren, bei denen sortierte Wertstoffe kleingehackt und eingeschmolzen werden. Zudem ist es nur mithilfe chemischer Prozesse möglich.
“Noch fehlen Transparenz und Beweise, dass diese Methode Treibhausgasemissionen tatsächlich reduziert und Ressourcen schont”, argumentiert Tom Ohlendorf, Senior Manager für Circular Economy bei der Umweltschutzorganisation WWF. Bislang gebe es nur Pilotanlagen, daher seien die offenen Fragen noch nicht eindeutig zu beantworten.
Einig sind sich die Experten Ohlendorf und Wilts darin, dass chemisches Recycling ein sinnvolles Zusatzverfahren für Kunststoffe ist, die sich nicht anders recyceln lassen, wie der Matratzenschaum. Wo jedoch mechanische Verfahren möglich sind, so Wilts, sollte ihnen wegen der besseren Ökobilanz Vorrang eingeräumt werden. Dem stimmt die Praktikerin Clauberg von Covestro zu: “Unsere Methode wird bestehende Verfahren nur ergänzen, nicht verdrängen.”
Experten wie Wilts und Ohlendorf befürchten jedoch, dass eines Tages in großen Anlagen für chemisches Recycling auch Stoffe verarbeitet werden, bei denen eine mechanische Aufbereitung eigentlich möglich wäre. Denn Großanlagen sind profitabler, wenn sie ausgelastet sind. Diese neuen, größeren Anlagen wird es geben. Die Plastikhersteller haben angekündigt, bis 2030 in der Europäischen Union sieben Milliarden Euro in chemisches Recycling zu investieren. Petra Hoffknecht

Die Kürzungen, die aufgrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts im Klima- und Transformationsfonds erforderlich sind, haben in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen. Eher unterbelichtet blieb dagegen ein mindestens ebenso wichtiges Problem bei der Klimaschutz-Finanzierung: Nur gut die Hälfte der eingeplanten Gelder wurde in den vergangenen beiden Jahren tatsächlich ausgegeben. 2022 waren es 49 Prozent, 2023 etwa 56 Prozent.
Diese Zahlen ergeben sich aus dem noch unveröffentlichten 13. KTF-Bericht des Bundesfinanzministeriums, über den Table.Briefings bereits berichtet hatte. In dieser Woche warnte nun der Expertenrat für Klimafragen, dass der schlechte Mittelabfluss das Erreichen der Klimaziele gefährde. Der Thinktank Forum Ökosoziale Marktwirtschaft (FÖS) veröffentlichte am Donnerstag zudem eine Analyse des Mittelabflusses, die Table.Briefings vorab vorlag – und fordert von der Bundesregierung Konsequenzen.
Der jüngste KTF-Bericht hatte gezeigt, dass von den vorgesehenen 36 Milliarden Euro nur rund 20 Milliarden Euro ausgegeben wurden. Das habe “Auswirkungen auf die im Klimaschutzprogramm unterstellte THG-Minderungswirkung”, schrieb der Expertenrat in seinem am Montag veröffentlichten Prüfbericht zur deutschen Klimabilanz 2023. “Diese kann auf jeden Fall nicht mehr im damals angegebenen Zeitrahmen und nicht mehr in vollem Umfang erwartet werden.” Eine Abschätzung, wie stark die Abweichung sein wird, wollte Brigitte Knopf als stellvertretende Vorsitzende des Gremiums auf Nachfragen von Table.Briefings nicht abgeben. Es sei aber klar, dass der Gesamteffekt geringer ausfalle, als in der Prognose des Umweltbundesamts unterstellt.
Auch das FÖS warnt in seiner neuen Studie vor den Folgen des schlechten Mittelabflusses. “Klimaschutzprojekte verschieben sich so mindestens in die Zukunft”, schreiben die Studienautoren. Die nicht ausgegebenen Gelder fließen zwar als Rücklage zurück in den KTF; in Folgejahren könnten sie aber für andere Programme genutzt werden. “Diese haben dann möglicherweise keine positive Klimaschutzwirkung oder sind Ausgleichsmaßnahmen für die energieintensive Industrie.”
Tatsächlich nehmen die KTF-Ausgaben für Programme ohne direkte zusätzliche Klimawirkung zu:
Die Studie zeigt zudem, dass es beim Mittelabfluss große Unterschiede zwischen verschiedenen Bereichen gibt. Programme, die sich auf Gebäude beziehen, wurden zu 64 Prozent ausgeschöpft; bei Förderprogrammen für den Individualverkehr waren es 67 Prozent, beim öffentlichen Personennahverkehr dagegen nur 48 Prozent. Industrieprogramme, bei denen es um Ausgleichszahlungen ging, hatten eine Abrufquote von 66 Prozent, beim Thema Wasserstoff waren es 48 Prozent, beim direkten Klimaschutz in der Industrie dagegen nur 19 Prozent.
Vergleichsweise besonders schlecht abgeschnitten hat der sogenannte natürliche Klimaschutz, zu dem etwa die Wiedervernässung von Mooren, die Wiederaufforstung und der klimagerechte Umbau der Wälder gezählt werden. Insgesamt wurden dort nach FÖS-Berechnungen im Jahr 2023 weniger als 20 Prozent der Gelder ausgegeben; beim größten Programm, den “Maßnahmen zum Natürlichen Klimaschutz” (ANK), das vom BMUV betreut wird, waren es sogar nur gut zwei Prozent.
Zur Begründung schreibt das Haus von Steffi Lemke, es hätten zunächst “Strukturen für die Umsetzung des ANK entwickelt und aufgebaut” werden müssen. Zudem habe die “Entwicklung von Fördermaßnahmen” länger gedauert als geplant, weil dabei “nicht auf etablierte und optimal abgestimmte Verfahrensweisen zwischen
den zu beteiligenden Akteuren zurückgegriffen werden” konnte. Wirklich überzeugend klingen diese Gründe nicht, weil die Probleme nicht überraschend gewesen sein dürften.
Daneben gab es aber offenbar auch Konflikte innerhalb der Koalition. Darauf deutet im Bericht der Hinweis hin, dass auch die “Abstimmung innerhalb der Bundesregierung” zu “langwierigen Prozessen” geführt habe. Offenbar hat das Finanzministerium zwischenzeitig infrage gestellt, ob der Bund überhaupt die Kompetenz für die entsprechende Förderung hatte. Darauf deutet hin, dass die Koalitionsfraktionen in einem Entschließungsantrag zum Klimaschutzgesetz nach Informationen von Table.Briefings folgende Klarstellung aufnehmen wollen: “Der Bundestag begrüßt, dass die Bundesregierung Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes fördert.”
Für dieses Jahr erwartet das BMUV einen deutlich höheren Mittelabfluss. Mittlerweile seien 21 von 50 Programmen gestartet, der Rest solle bis zum Jahresende folgen, teilte eine Sprecherin mit. Und: “Die Programme werden stark nachgefragt.”
Um die Ausgabequote insgesamt zu verbessern, müsse die Regierung ihre Abläufe aber generell überprüfen, fordert Holger Bär, einer der Autoren der FÖS-Studie. “Förderbedingungen sollten möglichst früh veröffentlicht werden”, sagte er Table.Briefings. Notwendig seien zudem “niedrigschwellige Informationen und zielgruppengerechte Zugänge”. In einem ersten Schritt sei zudem mehr Transparenz bezüglich der Ausgaben und eine bessere Evaluation erforderlich.
Die Kommunen in Deutschland rechnen mit steigenden Ausgaben für Klimaschutz und Klimaanpassung. Um die Maßnahmen langfristig abzusichern, hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland in einer Machbarkeitsstudie zwei Finanzierungsmöglichkeiten untersucht. Das Ergebnis: Eine im Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz ist einer Umverteilung von Umsatzsteuereinnahmen eindeutig vorzuziehen.
Die Autoren der Studie argumentieren, dass die Finanzmittel im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe effizient und flexibel dort eingesetzt werden könnten, wo Investitionen in den Klimaschutz notwendig sind und die größte Wirkung erzielen. Zudem sei es einfacher, finanzschwache Kommunen gezielt zu unterstützen. Die Umsatzsteuer würde dagegen nach starren Quoten verteilt und damit eher dem Gießkannenprinzip folgen.
“Es gilt, die Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden und die größte Klimaschutzwirkung erzielen”, erklärt Carsten Kühl, Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik und Co-Autor der Studie. Die Gemeinschaftsaufgabe sei daher der beste Weg, wie Bund, Länder und Kommunen Klimaschutz gemeinsam vor Ort umsetzen können.
Eine im Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe wäre zudem mit einem symbolträchtigen Bekenntnis zum ebenen-übergreifenden Klimaschutz verbunden. Sie könne perspektivisch zu einem neuen Ankerpunkt der föderalen Klimaschutzfinanzierung werden, heißt es in der Studie. Denn eine Vielzahl bestehender Förderprogramme könne sukzessive in den neuen Rahmen überführt werden.
“Wir planen und setzen die Wärme- und Verkehrswende um. Wir machen uns auf den Weg und gestalten die Zukunft, aber durch Mangel an Geld und Personal kommen wir nicht schnell genug voran”, kritisiert Andreas Wolter, Bürgermeister der Stadt Köln und Vorsitzender des Klima-Bündnisses, dem mit fast 2.000 Mitgliedskommunen größten europäischen Städtenetzwerk für Klimaschutz. “Deswegen unterstützen wir die Forderung nach einer Gemeinschaftsaufgabe – denn Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe”, betont Wolter. ch
Dem Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) fehlt im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung aktuell eine eindeutige Rechtsgrundlage zum Erlass von Empfehlungen und zur Vertretung Deutschlands in internationalen Standardisierungsgremien. Dies ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das die Kanzleien Günther und Simanovski im Auftrag der NGOs Germanwatch und NABU erstellt haben.
Das DRSC trägt durch einen Auftrag des Bundesjustizministeriums (BMJ) die Verantwortung für die Rechnungslegung in Deutschland und vertritt die Bundesrepublik auch nach außen. Im Rahmen der EU-Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), die bis Juli in deutsches Recht umgesetzt werden muss, und der Erarbeitung von europäischen Standards für die Berichterstattung hat das DRSC auch diesen Aufgabenbereich übernommen.
Eine Gruppe von NGOs um Germanwatch und NABU kritisiert, dass im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung des DRSC kein einziges Mitglied aus dem Umweltbereich komme. In einem offenen Brief an Bundesjustizminister Buschmann forderten sie mehr Kompetenz und Transparenz sowie die Einbindung verschiedener Stakeholder in dem zuständigen Gremium.
“Unsere Kritik am DRSC wurde nun auch aus juristischer Sicht untermauert”, sagte Lutz Weischer, Leiter des Berliner Büros von Germanwatch. Auch bei Gremien für die Standardisierung von Nachhaltigkeitsberichterstattung müsse die Form ihrer Funktion folgen. “Um effizient Standards zu entwickeln, die der komplexen gesellschaftlichen Herausforderung der sozial-ökologischen Transformation gerecht werden, braucht es ein Gremium, in dem diverse Perspektiven und Kompetenzen abgebildet sind”, erklärte Weischer. Interessenkonflikte innerhalb des Gremiums müssten verhindert werden.
Am heutigen Freitag endet die Verbändeanhörung des BMJ zur Umsetzung der CSRD. Laut dem Entwurf des BMJ soll auch das Handelsgesetzbuch angepasst werden. Unter anderem regelt dieses den Auftrag des DSRC. Das Gutachten mache jedoch deutlich, dass sich aus dem Mandat für die Rechnungslegung nicht automatisch das Mandat für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ergebe. Germanwatch fordert deshalb, die Gesamtstruktur des DSRC zu überdenken und “ein neues Mandat eines Beratungsgremiums für Nachhaltigkeitsberichterstattung an den Bedarfen einer zügigen Transformation auszurichten.” leo
Am Rande der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF in Washington beginnt eines der ehrgeizigsten Projekte der internationalen Klimafinanzierung: Mit der “Taskforce für internationale Besteuerung” will eine Gruppe von Industrie- und Entwicklungsländern die Optionen für globale Klimaabgaben erkunden und Allianzen für dieses Vorhaben ausloten.
Auf der COP30 in Brasilien, so die Pläne von Frankreich, Barbados, Kenia, Antigua und Barbuda und Spanien, soll das fertige Konzept für eine weltweite Klimasteuer verabschiedet werden. Jetzt zeichnet sich ab, welche neuen Abgaben dafür infrage kommen: Gesucht werden vor allem Maßnahmen, mit denen jeweils mindestens 0,1 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz aufgebracht werden kann – also jeweils mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
Ins Leben gerufen wurde diese Taskforce auf der COP28 in Dubai im Dezember 2023, nach Vorbereitungen auf dem Finanzgipfel von Paris im Juni 2023 und dem afrikanischen Klima-Gipfel im September 2023. Die Taskforce soll Pläne vorlegen, wie dringend benötigtes Kapital für den Klimaschutz vor allem in den Entwicklungsländern zusammenkommen kann. Sie soll “Steuerinstrumente entwickeln, die sicherstellen, dass alle Sektoren der Wirtschaft, besonders die momentan schwach besteuerten, ihren fairen Anteil dazu beitragen, in Übereinstimmung mit ihrer Wirkung in Bezug auf Treibhausgasemissionen.”
Den Finanzbedarf für wirksame CO₂-Minderung und Anpassung vor allem in den Ländern des Globalen Südens (ohne China) schätzt eine Expertengruppe im UN-Auftrag auf eine Billion US-Dollar im Jahr 2025 – und auf bereits 2,4 Billionen in 2030. Insgesamt haben die Industriestaaten aber bisher nur versprochen, bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar als Klimahilfen für den Globalen Süden zu mobilisieren.
Mögliche Quellen für Klima- und Entwicklungsabgaben könnten sein:
Das Sekretariat der Taskforce, angesiedelt bei der “European Climate Foundation”, will bis zur COP30 fertige Vorschläge vorlegen. Im Idealfall soll nicht nur klar sein, woher wie viel Geld kommen kann – sondern auch, wer es einsammelt und verwaltet und wohin es fließen soll. bpo
Die komplette Analyse lesen Sie im Climate.Table.
Die letzte Sitzungswoche dieser Legislaturperiode im EU-Parlament wird zum wahren Abstimmungsmarathon. Auf der Liste der Gesetze stehen diverse ESG-Themen:
Förderung der Reparatur von Waren (Recht auf Reparatur): Das Parlament stimmt am Montag über das Trilogergebnis zu Vorschriften ab, die durch. Es wird mit einer großen Mehrheit gerechnet. Anschließend müssen auch noch die Mitgliedstaaten das Ergebnis annehmen. Im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) ist dies für den 15. Mai vorgesehen; am 23. Mai sollen dann die Verbraucherschutzminister im Rat für Wettbewerbsfähigkeit abstimmen.
Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat: Die EU will die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Dazu soll auch der Gesetzesvorschlag beitragen, den die EU-Kommission im Oktober vorgestellt hat. Demnach sollen für alle Akteure, die mit Kunststoffpellets umgehen, Verpflichtungen gelten. Im Detail: Verluste zu vermeiden, Pläne zur Risikobewertung zu erstellen und im Falle eines Verlustes Schäden zu beseitigen. Der Umweltausschuss hat seinen Bericht im März angenommen, am Montag oder Dienstag stimmt das Plenum darüber ab. Die Verhandlungen mit dem Rat beginnen dann frühestens im Herbst.
Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit: Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat hatten sich Anfang März über die neue Verordnung geeinigt. Der Rat hat das Ergebnis bereits Mitte März angenommen. Voraussichtlich am Dienstag stimmt das Parlament ab.
EU-Lieferkettengesetz (CSDDD): Der Trilogeinigung über die Lieferkettenrichtlinie, deren Annahme im Rat über mehrere Wochen auf der Kippe stand, muss nun auch das Parlament noch formal zustimmen. Dies ist für Mittwochmittag angesetzt. Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis der Verhandlungen noch einmal deutlich entschärft, indem sie etwa den Anwendungsbereich verkleinert und die Risikosektoren gestrichen haben.
Verpackungsverordnung: Am Mittwochmittag stimmen die Abgeordneten auch über das Trilogergebnis von Anfang März ab. Die vorläufige Einigung hat das Ziel, Verpackungen auf dem EU-Binnenmarkt sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Bis 2030 sollen etwa alle Verpackungen recyclingfähig sein. Dass zwei kurz vor Ablauf der Frist eingereichte Änderungsanträge von Andreas Glück (FDP) noch angenommen werden, ist unwahrscheinlich. Glück möchte bestimmte Mehrwegziele für Verpackungen, die Unternehmen für den Transport von Produkten zwischen seinen eigenen Standorten und innerhalb eines Mitgliedstaats verwenden, streichen. Im Rat hatte der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) das Ergebnis der Trilogverhandlungen bereits vor Ostern angenommen.
Regeln für Plattformarbeiter: Im Februar haben sich Rat und Parlament über eine Richtlinie geeinigt, die die Bedingungen für Arbeitnehmer auf digitalen Arbeitsplattformen verbessern soll. Am Mittwoch stimmt das Plenum über das Ergebnis ab.
Ökodesign-Verordnung: Schon im Dezember hatten sich Rat und Parlament auf einen gemeinsamen Gesetzestext geeinigt. Nun müssen die Abgeordneten das Ergebnis noch formal annehmen, laut der Agenda am kommenden Donnerstagmittag. Die Verordnung erweitert die bisherige Ökodesign-Richtlinie, erweitert ihren Anwendungsbereich auf fast alle Produkte und sieht ein Verbot für unverkaufte Kleidung, Schuhe und Accessoires vor. leo
Die gute Nachricht zuerst: 19 EU-Länder – darunter Deutschland – haben ihre Zubauziele für öffentliche Ladesäulen für das Jahr 2024 im Rahmen der Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFIR) bereits erreicht. Das schreibt die Verkehrs- und Umwelt-Organisation T&E in einer heute erschienenen Analyse. Demnach hat sich die Zahl der Ladestationen in der EU den letzten drei Jahren verdreifacht. Ende 2023 habe es EU-weit mehr als 630.000 Ladepunkte gegeben.
Die AFIR ist seit vergangener Woche in Kraft und gibt den Mitgliedstaaten erstmals individuelle Ausbauziele vor – gemessen an der Größe ihrer E-Auto-Flotte. Daraus ergeben sich Zwischenziele für jedes Jahr, die T&E ausgewertet hat. Portugal, Ungarn und Litauen erreichen ihre Ziele zwar noch nicht, werden diese aber voraussichtlich noch bis Ende des Jahres schaffen. Luxemburg, Zypern und Malta werden laut T&E ihre Ziele voraussichtlich verpassen, könnten sie aber aufgrund der kleinen E-Auto-Flotten bereits durch geringen Zubau erreichen. Griechenland und Irland hinken am deutlichsten hinterher. luk
Am frühen Nachmittag steht zunächst der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Arbeitszeit flexibilisieren – Mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien” auf der Tagesordnung. Später befassen sich die Abgeordneten mit dem Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes. Dabei geht es um die angemessene Vergütung von Betriebsräten.
Am Mittwochmorgen berät der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung über einen Antrag der Ampel-Fraktionen zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation.
Kurz darauf findet im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz eine Anhörung zu PFAS, den sogenannten “Ewigkeitschemikalien”, statt. Anlass ist ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel “Vorteile von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen weiter nutzen – Wertschöpfung erhalten – Gesundheit und Umwelt schützen”.
Am Mittwochabend tagt dann wie üblich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Dort ist ein Fachgespräch zum Thema “Effiziente und nachhaltige Wassernutzung” angesetzt, das etwa zwei Stunden dauern soll.
Am Donnerstagmorgen findet im Plenum des Bundestags die zweite und dritte Beratung des Unionsantrags “Net-Zero-Industry-Act zum Motor für den Industriestandort Deutschland machen – Effizient, bürokratiearm und technologieoffen” statt. Der Antrag, der im November erstmals beraten worden war, zielt auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investitionen ab.
Ebenfalls abschließend behandelt wird am Freitagvormittag ein Antrag von CDU/CSU unter der Überschrift “Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten”.
Wann das Solarpaket 1, offiziell “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung“, in zweiter und dritter Lesung im Plenum beraten wird, stand bei Redaktionsschluss nicht fest, da die offizielle Zustimmung der FDP zum Änderungsantrag der Ampel-Fraktionen noch ausstand.
Die FDP wird sich am Dienstag in ihrer Fraktionssitzung mit dem Koalitionskompromiss befassen. Danach könnte es schnell gehen: Ausschussberatungen am Mittwoch, Abstimmung im Bundestag vielleicht am Freitag. Das würde dann sogar noch für den Bundesrat reichen, der ebenfalls am Freitag tagt. ch
Adieu, Schweröl – Der Spiegel
In Augsburg forscht MAN an Schiffsmotoren, die auch Methanol verbrennen können. Damit sollen die Weltmeere einmal befahren werden. Oder mit Wasserstoff, oder mit Ammoniak: noch ist nicht klar, welcher Treibstoff sich durchsetzt. Auf jeden Fall gehe die Zeit von Schiffsdiesel und Schweröl zu Ende, auch wenn die Fossilen noch billiger sind, berichtet Felix Wadewitz. Zum Artikel
Die Deutschen arbeiten so wenig und so viel wie noch nie – FAZ
Laut einer Studie des Deutschen Instituts zur Wirtschaftsforschung (DIW) ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland seit 1991 von 39 auf 36,5 Stunden gesunken, berichtet Patrick Welter. Das Arbeitsvolumen hingegen sei 2023 auf ein Rekordniveau gestiegen. Doch vor allem Frauen und geringer Qualifizierte würden gern mehr Stunden arbeiten. Zum Artikel
What Would the Economy Look Like Under a Second Biden Term? – The New York Times
Peter Coy geht in seinem Beitrag der Frage nach, in welche Richtung sich die Wirtschaftspolitik der USA in einer zweiten Amtszeit von Joe Biden entwickeln wird. Coy zufolge wird Biden nicht nur versuchen, die Steuern für die Reichen und die Ausgaben für die Armen zu erhöhen, sondern auch weiterhin auf eine Koalition zwischen der Arbeiter- und der Umweltbewegung hinarbeiten, indem er sich für gut bezahlte, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in der Produktion und für die Installation grüner Technologien einsetzt. Zum Artikel
Schäden durch Klimaerhitzung: Kosten des Klimawandels sechsmal so hoch wie Kosten zur Bekämpfung – Der Standard
36 Billionen Euro Schaden pro Jahr: Eine Neubewertung der Klimaschäden zeigt, dass bis 2049 mit einem globalen Einkommensverlust von 19 Prozent zu rechnen ist. Tanja Traxler hat sich eine entsprechende Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung angesehen. Zum Artikel
Nachhaltiger Konsum im Alltag: “Wir bevorzugen klimaschädigendes Verhalten” – Frankfurter Rundschau
Im Interview mit Joachim Wille erläutert der Umweltexperte Kai Niebert, wie Nachhaltigkeit in den Alltag integriert und so zur Normalität werden kann. Doch “so lange SUVs und Schnitzel subventioniert werden, werden Appelle zu nachhaltigem Konsum an unser aller wirtschaftsbürgerlicher Kompetenzen scheitern”, so Niebert. Zum Artikel
Umwelt-Klage wegen LNG-Terminal: “Großindustrialisierung” der Ostsee vor Gericht – Klimareporter
Die Rechtmäßigkeit der neuen Flüssiggas-Infrastruktur auf Rügen wird seit dieser Woche vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Geklagt haben zwei Umweltverbände. Sie fordern außerdem ein Moratorium für den LNG-Ausbau, weiß Jörg Staude. Zum Artikel
Umfrage: Die Sorgen der Zulieferer nehmen zu – Automobil Industrie
Die Halbjahresumfrage von Clepa und McKinsey zeigt eine hohe Unsicherheit unter den europäischen Automobilzulieferern. Der Nachfragerückgang bei der E-Mobilität sei dabei nur ein Problem, berichtet Lina Demmel. Hinzu kämen unter anderem die CO₂-Reduktionsziele und hohe Produktionskosten. Zum Artikel
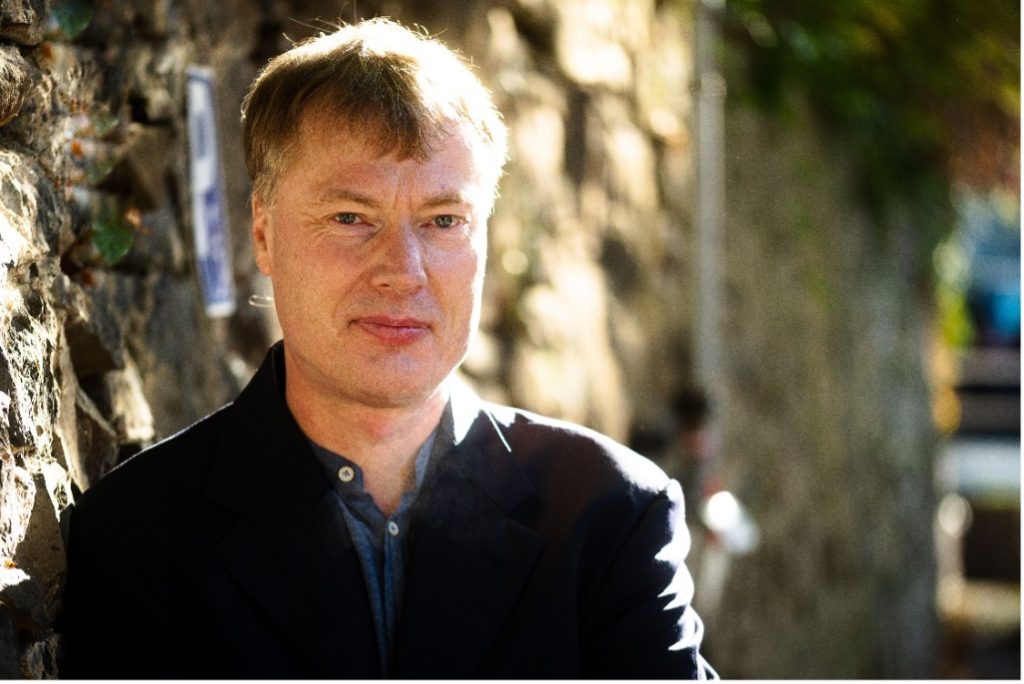
Der Kakaopreis erreicht Rekordhöhen, und zugleich wird der Kakao von Bäuerinnen und Bauern geerntet, die oft in tiefster Armut leben. Auch die Schokoladenpreise ziehen deutlich an. Doch Kakao macht nur einen kleinen Teil des Preises für Schokolade aus. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um endlich die massiven sozialen Probleme in der Lieferkette anzugehen.
Um das Jahr 2000 erreichten die Kakaopreise inflationsbereinigt einen historischen Tiefststand. Als Folge arbeiteten Studien zufolge zu Beginn des Jahrtausends rund zwei Millionen Kinder allein auf den Kakaoplantagen in der Côte d’Ivoire und Ghana. Immer noch gibt es Berichte über Sklavenarbeit von Kindern auf Kakaoplantagen.
Die letzte umfassende Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass weiterhin mindestens 1,5 Millionen Kinder in der Côte d’Ivoire und Ghana unter verbotenen Bedingungen arbeiten. Aus diesen beiden Ländern kommen rund 60 Prozent der Welternte, mehr als zehn Prozent stammen aus Nigeria und Kamerun, wo die Situation nicht besser ist.
Der Anbau von Kakao wird weiterhin von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dominiert, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Ernteerträge einfahren. Sie bewirtschaften in der Regel zwei bis vier Hektar und haben keinerlei Einfluss auf den Kakaopreis. Ist die Ernte gut, stürzt der Preis in den Keller, ist sie schlecht, geht der Preis in die Höhe.
2018 wurden die durchschnittlichen Einkommen der Kakao anbauenden Familien berechnet. Durchschnittlich lag ein existenzsicherndes Einkommen für Familien in der Côte d’Ivoire bei 6.517 US-Dollar pro Jahr, die realen Einkommen eines typischen Haushalts lagen jedoch nur bei 2.346 US-Dollar. Aufgrund der kleineren Familien und anderen Preisstruktur lag das existenzsichernde Einkommen in Ghana bei 4.742 US-Dollar, und die Einkommen typischer Haushalte betrugen 2.288 US-Dollar.
Organisationen der Bäuerinnen und Bauern, Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen verwiesen daher immer wieder auf die zwingende Notwendigkeit, die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern durch höhere Preise zu steigern.
Unternehmen wissen, dass darin der schnellste Weg zur deutlichen Linderung der sozialen Probleme in den Anbaugebieten liegt. Bislang wurde von Unternehmen jedoch immer wieder betont, “der Markt” mache den Preis, schließlich wird Kakao in London und New York an den Börsen gehandelt. Menschenrechtliche Aspekte spielen bei der Preisgestaltung keine Rolle.
Andererseits war und ist allen Schokoladenunternehmen klar, dass Kakao nur einen kleinen Teil der Kostenstruktur ihrer Lieferkette ausmacht. Bei einem Einkaufspreis auf dem Weltmarkt von 2.000 US-Dollar je Tonne Kakao, wie er über viele Jahre vorherrschte, lag bei Vollmilchschokolade mit einem Kakaoanteil von 30 Prozent der Preis für Kakao bei rund acht Cent je Tafel. Bei Schokoriegeln oder Schokoladenprodukten mit Füllungen ist der Kostenanteil des Kakaos noch bedeutend niedriger. Eine deutliche Erhöhung der Aufkaufpreise bei den Bäuerinnen und Bauern hätte somit nur zu einer moderaten Steigerung der Kosten für Schokoladenprodukte geführt.
Nun haben sich die Kakaopreise seit Frühjahr 2023 verdreifacht. Vor allem in Westafrika sind die Erntemengen deutlich gesunken. Ursache dafür ist unter anderem das regelmäßig wiederkehrende Klimaphänomen El Niño, das durch den Klimawandel verstärkt wird. Die weitgehende Entwaldung der Anbaugebiete in der Côte d’Ivoire und Ghana verschärft dort die Probleme. Durch massive Regenfälle Mitte 2023 sind große Flächen von Krankheiten befallen und die Bäume tragen wenige Früchte. Hinzu kommen strukturelle Probleme: Aufgrund der über Jahre niedrigen Kakaopreise fehlten vielen Bäuerinnen und Bauern die finanziellen Mittel, um ihre Plantagen optimal zu betreiben.
Die Schokoladenpreise steigen seit Monaten, wenn auch teilweise – angesichts des geringen Anteils der Kosten des Kakaos – in einem überraschend großen Umfang.
Nicht nur für die Côte d’Ivoire und Ghana, sondern auch für weitere Anbauländer liegen mittlerweile Kalkulationen existenzsichernder Einkommen vor. Aufgrund umfassender Datenerhebungen kennen die Unternehmen die durchschnittlichen Anbauflächen der Bäuerinnen und Bauern sowie die Produktivität je Hektar. Aufbauend auf diesen Daten müsste berechnet werden – und dies kann aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen nur innerhalb der einzelnen Unternehmen geschehen – welche Preise die Bäuerinnen und Bauern benötigen, sodass zumindest das Gros der Familien existenzsichernde Einkommen erreicht. Dies kann über garantierte Mindestpreise geschehen oder über Prämien, die bei fallenden Preisen erhöht und bei über eine gewisse Grenze steigenden Preisen gesenkt oder abgeschafft werden.
Einzelne Unternehmen zeigen, dass eine Kombination aus garantierten stabilen Preisen und langfristigen Lieferverträgen mit den Vereinigungen der Bäuerinnen und Bauern und Unterstützungsmaßnahmen zu einer massiven Reduzierung der Menschenrechtsverletzungen inklusive der Kinderarbeit führen können. Ein Beispiel dafür ist Tonys Chocolonely, ein niederländischer Konzern, der in den letzten Jahren schnell expandiert hat. Weitere Pilotprojekte großer Unternehmen zeigen, dass veränderte Lieferbeziehungen möglich sind und zu Verbesserungen führen. Dies sollte flächendeckend eingeführt werden.
Nur so werden die Unternehmen vor Klagen sicher sein. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz schreibt schließlich seit Anfang 2023 vor, dass große Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten mitverantwortlich sind. Auf EU-Ebene wurde kürzlich ein europäisches Lieferkettengesetz beschlossen. Um die Menschenrechte in den Lieferketten zu gewährleisten, braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, dass nach einigen guten Ernten die Preise nicht wieder ins Bodenlose fallen.
Die derzeit hohen Preise könnten es den Konzernen erleichtern, diese Maßnahmen einzuführen. Maßstab für die Preisgestaltung sollte nicht mehr der Preis an der Börse sein, sondern Zahlungen, die existenzsichernde Einkommen ermöglichen.
Friedel Hütz-Adams arbeitet seit 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das SÜDWIND-Institut. Er hat Studien zu verschiedensten Wertschöpfungsketten veröffentlicht, darunter während der vergangenen letzten Jahrzehnte etliche zum Thema Kakao. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss freiwillige Standards und gesetzliche Regulierungen zur Verantwortung der Wirtschaft für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards auf das Handeln von Unternehmen haben. Er arbeitet in mehreren Gremien mit, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten befassen, und ist unter anderem Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats der REWE-Group.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke unterzeichnete am Dienstag einen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft mit China. Dann ging es direkt weiter zur “Our Ocean Conference” in Athen. Thema: Meeresschutz. Sonntag und Montag ist Lemke im kanadischen Ottawa, wo am Dienstag die Verhandlungen für ein UN-Abkommen gegen Plastikmüll weitergehen.
Beobachter sind gespannt, ob es gelingt, sich auf effektive Regeln für den ganzen Lebenszyklus von Kunststoffen zu einigen. Einige Staaten mit starker Fossil-Industrie setzen sich für einen Fokus auf Sammlung und Recycling ein. Über ein Beispiel für neue Recyclingverfahren berichtet Petra Hoffknecht. Sie hat sich angesehen, wie Covestro den Schaumstoff von alten Matratzen verarbeitet.
Auch ein wichtiges Thema in Steffi Lemkes Ressort ist der natürliche Klimaschutz. Doch vergangenes Jahr wurde für Maßnahmen wie Wiederaufforstung nur ein kleiner Teil des Geldes aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) ausgegeben. Weil insgesamt lediglich rund die Hälfte des Geldes aus dem KTF ausgegeben wurde, fordert nun das Forum Ökosoziale Marktwirtschaft Konsequenzen. Malte Kreutzfeldt hat die Details.
Am Sonntag beginnt die Welt-Kakao-Konferenz in Brüssel, wo sich viele treffen, die an der Wertschöpfung beteiligt sind. Friedel Hütz-Adams, Experte für verantwortungsvolles Wirtschaften vom Südwind-Institut erklärt im Standpunkt, warum aus seiner Sicht aktuell ein guter Zeitpunkt ist, um die sozialen Missstände in dem Sektor anzugehen – und wie dies gelingen könnte.
Ich wünsche eine anregende Lektüre.


Pro Jahr fallen in Europa 40 Millionen ausrangierte Matratzen an. Die meisten werden verbrannt oder landen auf Mülldeponien. “Dieser lineare Ansatz belastet die Ressourcen, erhöht die Emissionen und birgt Umweltrisiken”, sagt Henning Wilts, Abteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut.
Das börsennotierte Chemieunternehmen Covestro aus Leverkusen arbeitet an Verfahren, um aus Kunststoffabfällen wieder gefragte Rohstoffe herzustellen. Dadurch sollen Produkte mit niedrigerem CO₂-Fußabdruck entstehen und die Recyclingquote soll gesteigert werden. Seit 2019 verfolgt das Unternehmen, das vier Jahre zuvor aus der Kunststoffsparte der Bayer AG hervorging, eine Kreislaufwirtschaftsstrategie mit dem Ziel der Minimierung fossiler Rohstoffe. Das Potenzial ist enorm: Covestro geht davon aus, dass 60 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion bis 2050 durch recycelte Rohstoffe erfolgen kann.
Ein Vorzeigeprojekt der Leverkusener ist ein Verfahren zum Wiederverwerten von gebrauchten Matratzen. Das Augenmerk liegt hier insbesondere auf dem weichen Schaumstoff unter dem Überzug. Dieser besteht aus Polyurethan – einem Material, das elastisch und fest zugleich ist.
Durch herkömmliche Methoden wie Kleinhacken und Einschmelzen lässt sich dieser Werkstoff nicht recyceln. Zwar kann klein geschredderter Matratzenschaum einmalig als Unterlage von Teppichen verwendet werden, damit sie nicht rutschen. Auch die Dämmung von Autos ist möglich. Ein neues Leben als Matratze gab es für Polyurethan-Schaum bislang aber nicht.
Covestro setzt nun darauf, die chemischen Bausteine aus dem Matratzenschaum zurückzugewinnen. Diese lassen sich dann als Rohstoffe wieder einsetzen, um neuen Schaum und damit neue Matratzen herzustellen. Und zwar “beliebig oft” und “ohne Qualitätsverlust”, wie Karin Clauberg betont. Die studierte Maschinenbauerin befasst sich in leitender Funktion mit den Prozessen für chemisches Recycling im Covestro-Matratzenprojekt.
Insgesamt hat Covestro mehr als 20 Projekte gestartet, um neue Methoden im Grundstoffrecycling zu etablieren. “Wir verändern unsere komplette Rohstoffbasis – weg von petrochemischen Rohstoffen und hin zu nachhaltigen Rohstoffquellen wie Biomasse, CO₂ und Abfall”, sagt Clauberg. Schrittweise möchte das Unternehmen fossile Rohstoffe zur Herstellung der Covestro-Vorprodukte ersetzen. Die Vorprodukte lassen sich dann beispielsweise zu hartem Schaumstoff für die Dämmung von Gebäuden oder zu weichem Schaumstoff für die Möbelindustrie weiterverarbeiten.
2021 baute die Firma eine Pilotanlage zum Matratzenrecycling. Noch in diesem Jahrzehnt möchte Covestro eine größere Anlage realisieren, aus der dann kommerzielle Produkte verkauft werden können. Matratzenschaum sei aber erst der Anfang: Die Technologie lässt sich den Angaben des Unternehmens zufolge noch weiter hochskalieren. Auch für das Recyceln von Autositzen und Sofas aus Polyurethan-Weichschaum komme das Verfahren infrage.
Von der Politik wünscht sich Covestro eine verbindliche Festschreibung von Rezyklat-Mindestanteilen in Kunststoffanwendungen. Hilfreich wären außerdem Matratzensammelstellen. Denn um effizient recyceln zu können, benötigt das Unternehmen den möglichst günstigen Zugang zu vielen Millionen Matratzen.
Chemisches Recycling wird kontrovers diskutiert. Denn es ist energieintensiver und technisch aufwändiger als Verfahren, bei denen sortierte Wertstoffe kleingehackt und eingeschmolzen werden. Zudem ist es nur mithilfe chemischer Prozesse möglich.
“Noch fehlen Transparenz und Beweise, dass diese Methode Treibhausgasemissionen tatsächlich reduziert und Ressourcen schont”, argumentiert Tom Ohlendorf, Senior Manager für Circular Economy bei der Umweltschutzorganisation WWF. Bislang gebe es nur Pilotanlagen, daher seien die offenen Fragen noch nicht eindeutig zu beantworten.
Einig sind sich die Experten Ohlendorf und Wilts darin, dass chemisches Recycling ein sinnvolles Zusatzverfahren für Kunststoffe ist, die sich nicht anders recyceln lassen, wie der Matratzenschaum. Wo jedoch mechanische Verfahren möglich sind, so Wilts, sollte ihnen wegen der besseren Ökobilanz Vorrang eingeräumt werden. Dem stimmt die Praktikerin Clauberg von Covestro zu: “Unsere Methode wird bestehende Verfahren nur ergänzen, nicht verdrängen.”
Experten wie Wilts und Ohlendorf befürchten jedoch, dass eines Tages in großen Anlagen für chemisches Recycling auch Stoffe verarbeitet werden, bei denen eine mechanische Aufbereitung eigentlich möglich wäre. Denn Großanlagen sind profitabler, wenn sie ausgelastet sind. Diese neuen, größeren Anlagen wird es geben. Die Plastikhersteller haben angekündigt, bis 2030 in der Europäischen Union sieben Milliarden Euro in chemisches Recycling zu investieren. Petra Hoffknecht

Die Kürzungen, die aufgrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts im Klima- und Transformationsfonds erforderlich sind, haben in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen. Eher unterbelichtet blieb dagegen ein mindestens ebenso wichtiges Problem bei der Klimaschutz-Finanzierung: Nur gut die Hälfte der eingeplanten Gelder wurde in den vergangenen beiden Jahren tatsächlich ausgegeben. 2022 waren es 49 Prozent, 2023 etwa 56 Prozent.
Diese Zahlen ergeben sich aus dem noch unveröffentlichten 13. KTF-Bericht des Bundesfinanzministeriums, über den Table.Briefings bereits berichtet hatte. In dieser Woche warnte nun der Expertenrat für Klimafragen, dass der schlechte Mittelabfluss das Erreichen der Klimaziele gefährde. Der Thinktank Forum Ökosoziale Marktwirtschaft (FÖS) veröffentlichte am Donnerstag zudem eine Analyse des Mittelabflusses, die Table.Briefings vorab vorlag – und fordert von der Bundesregierung Konsequenzen.
Der jüngste KTF-Bericht hatte gezeigt, dass von den vorgesehenen 36 Milliarden Euro nur rund 20 Milliarden Euro ausgegeben wurden. Das habe “Auswirkungen auf die im Klimaschutzprogramm unterstellte THG-Minderungswirkung”, schrieb der Expertenrat in seinem am Montag veröffentlichten Prüfbericht zur deutschen Klimabilanz 2023. “Diese kann auf jeden Fall nicht mehr im damals angegebenen Zeitrahmen und nicht mehr in vollem Umfang erwartet werden.” Eine Abschätzung, wie stark die Abweichung sein wird, wollte Brigitte Knopf als stellvertretende Vorsitzende des Gremiums auf Nachfragen von Table.Briefings nicht abgeben. Es sei aber klar, dass der Gesamteffekt geringer ausfalle, als in der Prognose des Umweltbundesamts unterstellt.
Auch das FÖS warnt in seiner neuen Studie vor den Folgen des schlechten Mittelabflusses. “Klimaschutzprojekte verschieben sich so mindestens in die Zukunft”, schreiben die Studienautoren. Die nicht ausgegebenen Gelder fließen zwar als Rücklage zurück in den KTF; in Folgejahren könnten sie aber für andere Programme genutzt werden. “Diese haben dann möglicherweise keine positive Klimaschutzwirkung oder sind Ausgleichsmaßnahmen für die energieintensive Industrie.”
Tatsächlich nehmen die KTF-Ausgaben für Programme ohne direkte zusätzliche Klimawirkung zu:
Die Studie zeigt zudem, dass es beim Mittelabfluss große Unterschiede zwischen verschiedenen Bereichen gibt. Programme, die sich auf Gebäude beziehen, wurden zu 64 Prozent ausgeschöpft; bei Förderprogrammen für den Individualverkehr waren es 67 Prozent, beim öffentlichen Personennahverkehr dagegen nur 48 Prozent. Industrieprogramme, bei denen es um Ausgleichszahlungen ging, hatten eine Abrufquote von 66 Prozent, beim Thema Wasserstoff waren es 48 Prozent, beim direkten Klimaschutz in der Industrie dagegen nur 19 Prozent.
Vergleichsweise besonders schlecht abgeschnitten hat der sogenannte natürliche Klimaschutz, zu dem etwa die Wiedervernässung von Mooren, die Wiederaufforstung und der klimagerechte Umbau der Wälder gezählt werden. Insgesamt wurden dort nach FÖS-Berechnungen im Jahr 2023 weniger als 20 Prozent der Gelder ausgegeben; beim größten Programm, den “Maßnahmen zum Natürlichen Klimaschutz” (ANK), das vom BMUV betreut wird, waren es sogar nur gut zwei Prozent.
Zur Begründung schreibt das Haus von Steffi Lemke, es hätten zunächst “Strukturen für die Umsetzung des ANK entwickelt und aufgebaut” werden müssen. Zudem habe die “Entwicklung von Fördermaßnahmen” länger gedauert als geplant, weil dabei “nicht auf etablierte und optimal abgestimmte Verfahrensweisen zwischen
den zu beteiligenden Akteuren zurückgegriffen werden” konnte. Wirklich überzeugend klingen diese Gründe nicht, weil die Probleme nicht überraschend gewesen sein dürften.
Daneben gab es aber offenbar auch Konflikte innerhalb der Koalition. Darauf deutet im Bericht der Hinweis hin, dass auch die “Abstimmung innerhalb der Bundesregierung” zu “langwierigen Prozessen” geführt habe. Offenbar hat das Finanzministerium zwischenzeitig infrage gestellt, ob der Bund überhaupt die Kompetenz für die entsprechende Förderung hatte. Darauf deutet hin, dass die Koalitionsfraktionen in einem Entschließungsantrag zum Klimaschutzgesetz nach Informationen von Table.Briefings folgende Klarstellung aufnehmen wollen: “Der Bundestag begrüßt, dass die Bundesregierung Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes fördert.”
Für dieses Jahr erwartet das BMUV einen deutlich höheren Mittelabfluss. Mittlerweile seien 21 von 50 Programmen gestartet, der Rest solle bis zum Jahresende folgen, teilte eine Sprecherin mit. Und: “Die Programme werden stark nachgefragt.”
Um die Ausgabequote insgesamt zu verbessern, müsse die Regierung ihre Abläufe aber generell überprüfen, fordert Holger Bär, einer der Autoren der FÖS-Studie. “Förderbedingungen sollten möglichst früh veröffentlicht werden”, sagte er Table.Briefings. Notwendig seien zudem “niedrigschwellige Informationen und zielgruppengerechte Zugänge”. In einem ersten Schritt sei zudem mehr Transparenz bezüglich der Ausgaben und eine bessere Evaluation erforderlich.
Die Kommunen in Deutschland rechnen mit steigenden Ausgaben für Klimaschutz und Klimaanpassung. Um die Maßnahmen langfristig abzusichern, hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland in einer Machbarkeitsstudie zwei Finanzierungsmöglichkeiten untersucht. Das Ergebnis: Eine im Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz ist einer Umverteilung von Umsatzsteuereinnahmen eindeutig vorzuziehen.
Die Autoren der Studie argumentieren, dass die Finanzmittel im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe effizient und flexibel dort eingesetzt werden könnten, wo Investitionen in den Klimaschutz notwendig sind und die größte Wirkung erzielen. Zudem sei es einfacher, finanzschwache Kommunen gezielt zu unterstützen. Die Umsatzsteuer würde dagegen nach starren Quoten verteilt und damit eher dem Gießkannenprinzip folgen.
“Es gilt, die Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden und die größte Klimaschutzwirkung erzielen”, erklärt Carsten Kühl, Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik und Co-Autor der Studie. Die Gemeinschaftsaufgabe sei daher der beste Weg, wie Bund, Länder und Kommunen Klimaschutz gemeinsam vor Ort umsetzen können.
Eine im Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe wäre zudem mit einem symbolträchtigen Bekenntnis zum ebenen-übergreifenden Klimaschutz verbunden. Sie könne perspektivisch zu einem neuen Ankerpunkt der föderalen Klimaschutzfinanzierung werden, heißt es in der Studie. Denn eine Vielzahl bestehender Förderprogramme könne sukzessive in den neuen Rahmen überführt werden.
“Wir planen und setzen die Wärme- und Verkehrswende um. Wir machen uns auf den Weg und gestalten die Zukunft, aber durch Mangel an Geld und Personal kommen wir nicht schnell genug voran”, kritisiert Andreas Wolter, Bürgermeister der Stadt Köln und Vorsitzender des Klima-Bündnisses, dem mit fast 2.000 Mitgliedskommunen größten europäischen Städtenetzwerk für Klimaschutz. “Deswegen unterstützen wir die Forderung nach einer Gemeinschaftsaufgabe – denn Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe”, betont Wolter. ch
Dem Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) fehlt im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung aktuell eine eindeutige Rechtsgrundlage zum Erlass von Empfehlungen und zur Vertretung Deutschlands in internationalen Standardisierungsgremien. Dies ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das die Kanzleien Günther und Simanovski im Auftrag der NGOs Germanwatch und NABU erstellt haben.
Das DRSC trägt durch einen Auftrag des Bundesjustizministeriums (BMJ) die Verantwortung für die Rechnungslegung in Deutschland und vertritt die Bundesrepublik auch nach außen. Im Rahmen der EU-Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), die bis Juli in deutsches Recht umgesetzt werden muss, und der Erarbeitung von europäischen Standards für die Berichterstattung hat das DRSC auch diesen Aufgabenbereich übernommen.
Eine Gruppe von NGOs um Germanwatch und NABU kritisiert, dass im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung des DRSC kein einziges Mitglied aus dem Umweltbereich komme. In einem offenen Brief an Bundesjustizminister Buschmann forderten sie mehr Kompetenz und Transparenz sowie die Einbindung verschiedener Stakeholder in dem zuständigen Gremium.
“Unsere Kritik am DRSC wurde nun auch aus juristischer Sicht untermauert”, sagte Lutz Weischer, Leiter des Berliner Büros von Germanwatch. Auch bei Gremien für die Standardisierung von Nachhaltigkeitsberichterstattung müsse die Form ihrer Funktion folgen. “Um effizient Standards zu entwickeln, die der komplexen gesellschaftlichen Herausforderung der sozial-ökologischen Transformation gerecht werden, braucht es ein Gremium, in dem diverse Perspektiven und Kompetenzen abgebildet sind”, erklärte Weischer. Interessenkonflikte innerhalb des Gremiums müssten verhindert werden.
Am heutigen Freitag endet die Verbändeanhörung des BMJ zur Umsetzung der CSRD. Laut dem Entwurf des BMJ soll auch das Handelsgesetzbuch angepasst werden. Unter anderem regelt dieses den Auftrag des DSRC. Das Gutachten mache jedoch deutlich, dass sich aus dem Mandat für die Rechnungslegung nicht automatisch das Mandat für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ergebe. Germanwatch fordert deshalb, die Gesamtstruktur des DSRC zu überdenken und “ein neues Mandat eines Beratungsgremiums für Nachhaltigkeitsberichterstattung an den Bedarfen einer zügigen Transformation auszurichten.” leo
Am Rande der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF in Washington beginnt eines der ehrgeizigsten Projekte der internationalen Klimafinanzierung: Mit der “Taskforce für internationale Besteuerung” will eine Gruppe von Industrie- und Entwicklungsländern die Optionen für globale Klimaabgaben erkunden und Allianzen für dieses Vorhaben ausloten.
Auf der COP30 in Brasilien, so die Pläne von Frankreich, Barbados, Kenia, Antigua und Barbuda und Spanien, soll das fertige Konzept für eine weltweite Klimasteuer verabschiedet werden. Jetzt zeichnet sich ab, welche neuen Abgaben dafür infrage kommen: Gesucht werden vor allem Maßnahmen, mit denen jeweils mindestens 0,1 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz aufgebracht werden kann – also jeweils mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
Ins Leben gerufen wurde diese Taskforce auf der COP28 in Dubai im Dezember 2023, nach Vorbereitungen auf dem Finanzgipfel von Paris im Juni 2023 und dem afrikanischen Klima-Gipfel im September 2023. Die Taskforce soll Pläne vorlegen, wie dringend benötigtes Kapital für den Klimaschutz vor allem in den Entwicklungsländern zusammenkommen kann. Sie soll “Steuerinstrumente entwickeln, die sicherstellen, dass alle Sektoren der Wirtschaft, besonders die momentan schwach besteuerten, ihren fairen Anteil dazu beitragen, in Übereinstimmung mit ihrer Wirkung in Bezug auf Treibhausgasemissionen.”
Den Finanzbedarf für wirksame CO₂-Minderung und Anpassung vor allem in den Ländern des Globalen Südens (ohne China) schätzt eine Expertengruppe im UN-Auftrag auf eine Billion US-Dollar im Jahr 2025 – und auf bereits 2,4 Billionen in 2030. Insgesamt haben die Industriestaaten aber bisher nur versprochen, bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar als Klimahilfen für den Globalen Süden zu mobilisieren.
Mögliche Quellen für Klima- und Entwicklungsabgaben könnten sein:
Das Sekretariat der Taskforce, angesiedelt bei der “European Climate Foundation”, will bis zur COP30 fertige Vorschläge vorlegen. Im Idealfall soll nicht nur klar sein, woher wie viel Geld kommen kann – sondern auch, wer es einsammelt und verwaltet und wohin es fließen soll. bpo
Die komplette Analyse lesen Sie im Climate.Table.
Die letzte Sitzungswoche dieser Legislaturperiode im EU-Parlament wird zum wahren Abstimmungsmarathon. Auf der Liste der Gesetze stehen diverse ESG-Themen:
Förderung der Reparatur von Waren (Recht auf Reparatur): Das Parlament stimmt am Montag über das Trilogergebnis zu Vorschriften ab, die durch. Es wird mit einer großen Mehrheit gerechnet. Anschließend müssen auch noch die Mitgliedstaaten das Ergebnis annehmen. Im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) ist dies für den 15. Mai vorgesehen; am 23. Mai sollen dann die Verbraucherschutzminister im Rat für Wettbewerbsfähigkeit abstimmen.
Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat: Die EU will die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Dazu soll auch der Gesetzesvorschlag beitragen, den die EU-Kommission im Oktober vorgestellt hat. Demnach sollen für alle Akteure, die mit Kunststoffpellets umgehen, Verpflichtungen gelten. Im Detail: Verluste zu vermeiden, Pläne zur Risikobewertung zu erstellen und im Falle eines Verlustes Schäden zu beseitigen. Der Umweltausschuss hat seinen Bericht im März angenommen, am Montag oder Dienstag stimmt das Plenum darüber ab. Die Verhandlungen mit dem Rat beginnen dann frühestens im Herbst.
Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit: Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, sollen zukünftig nicht mehr auf dem EU-Binnenmarkt bereitgestellt, verkauft und von dort exportiert werden. EU-Parlament und Rat hatten sich Anfang März über die neue Verordnung geeinigt. Der Rat hat das Ergebnis bereits Mitte März angenommen. Voraussichtlich am Dienstag stimmt das Parlament ab.
EU-Lieferkettengesetz (CSDDD): Der Trilogeinigung über die Lieferkettenrichtlinie, deren Annahme im Rat über mehrere Wochen auf der Kippe stand, muss nun auch das Parlament noch formal zustimmen. Dies ist für Mittwochmittag angesetzt. Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis der Verhandlungen noch einmal deutlich entschärft, indem sie etwa den Anwendungsbereich verkleinert und die Risikosektoren gestrichen haben.
Verpackungsverordnung: Am Mittwochmittag stimmen die Abgeordneten auch über das Trilogergebnis von Anfang März ab. Die vorläufige Einigung hat das Ziel, Verpackungen auf dem EU-Binnenmarkt sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Bis 2030 sollen etwa alle Verpackungen recyclingfähig sein. Dass zwei kurz vor Ablauf der Frist eingereichte Änderungsanträge von Andreas Glück (FDP) noch angenommen werden, ist unwahrscheinlich. Glück möchte bestimmte Mehrwegziele für Verpackungen, die Unternehmen für den Transport von Produkten zwischen seinen eigenen Standorten und innerhalb eines Mitgliedstaats verwenden, streichen. Im Rat hatte der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) das Ergebnis der Trilogverhandlungen bereits vor Ostern angenommen.
Regeln für Plattformarbeiter: Im Februar haben sich Rat und Parlament über eine Richtlinie geeinigt, die die Bedingungen für Arbeitnehmer auf digitalen Arbeitsplattformen verbessern soll. Am Mittwoch stimmt das Plenum über das Ergebnis ab.
Ökodesign-Verordnung: Schon im Dezember hatten sich Rat und Parlament auf einen gemeinsamen Gesetzestext geeinigt. Nun müssen die Abgeordneten das Ergebnis noch formal annehmen, laut der Agenda am kommenden Donnerstagmittag. Die Verordnung erweitert die bisherige Ökodesign-Richtlinie, erweitert ihren Anwendungsbereich auf fast alle Produkte und sieht ein Verbot für unverkaufte Kleidung, Schuhe und Accessoires vor. leo
Die gute Nachricht zuerst: 19 EU-Länder – darunter Deutschland – haben ihre Zubauziele für öffentliche Ladesäulen für das Jahr 2024 im Rahmen der Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFIR) bereits erreicht. Das schreibt die Verkehrs- und Umwelt-Organisation T&E in einer heute erschienenen Analyse. Demnach hat sich die Zahl der Ladestationen in der EU den letzten drei Jahren verdreifacht. Ende 2023 habe es EU-weit mehr als 630.000 Ladepunkte gegeben.
Die AFIR ist seit vergangener Woche in Kraft und gibt den Mitgliedstaaten erstmals individuelle Ausbauziele vor – gemessen an der Größe ihrer E-Auto-Flotte. Daraus ergeben sich Zwischenziele für jedes Jahr, die T&E ausgewertet hat. Portugal, Ungarn und Litauen erreichen ihre Ziele zwar noch nicht, werden diese aber voraussichtlich noch bis Ende des Jahres schaffen. Luxemburg, Zypern und Malta werden laut T&E ihre Ziele voraussichtlich verpassen, könnten sie aber aufgrund der kleinen E-Auto-Flotten bereits durch geringen Zubau erreichen. Griechenland und Irland hinken am deutlichsten hinterher. luk
Am frühen Nachmittag steht zunächst der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Arbeitszeit flexibilisieren – Mehr Freiheit für Beschäftigte und Familien” auf der Tagesordnung. Später befassen sich die Abgeordneten mit dem Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes. Dabei geht es um die angemessene Vergütung von Betriebsräten.
Am Mittwochmorgen berät der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung über einen Antrag der Ampel-Fraktionen zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation.
Kurz darauf findet im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz eine Anhörung zu PFAS, den sogenannten “Ewigkeitschemikalien”, statt. Anlass ist ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel “Vorteile von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen weiter nutzen – Wertschöpfung erhalten – Gesundheit und Umwelt schützen”.
Am Mittwochabend tagt dann wie üblich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Dort ist ein Fachgespräch zum Thema “Effiziente und nachhaltige Wassernutzung” angesetzt, das etwa zwei Stunden dauern soll.
Am Donnerstagmorgen findet im Plenum des Bundestags die zweite und dritte Beratung des Unionsantrags “Net-Zero-Industry-Act zum Motor für den Industriestandort Deutschland machen – Effizient, bürokratiearm und technologieoffen” statt. Der Antrag, der im November erstmals beraten worden war, zielt auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investitionen ab.
Ebenfalls abschließend behandelt wird am Freitagvormittag ein Antrag von CDU/CSU unter der Überschrift “Potenziale der Geothermie nutzen – Hürden abbauen, Risiken minimieren, Stromsektor entlasten”.
Wann das Solarpaket 1, offiziell “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung“, in zweiter und dritter Lesung im Plenum beraten wird, stand bei Redaktionsschluss nicht fest, da die offizielle Zustimmung der FDP zum Änderungsantrag der Ampel-Fraktionen noch ausstand.
Die FDP wird sich am Dienstag in ihrer Fraktionssitzung mit dem Koalitionskompromiss befassen. Danach könnte es schnell gehen: Ausschussberatungen am Mittwoch, Abstimmung im Bundestag vielleicht am Freitag. Das würde dann sogar noch für den Bundesrat reichen, der ebenfalls am Freitag tagt. ch
Adieu, Schweröl – Der Spiegel
In Augsburg forscht MAN an Schiffsmotoren, die auch Methanol verbrennen können. Damit sollen die Weltmeere einmal befahren werden. Oder mit Wasserstoff, oder mit Ammoniak: noch ist nicht klar, welcher Treibstoff sich durchsetzt. Auf jeden Fall gehe die Zeit von Schiffsdiesel und Schweröl zu Ende, auch wenn die Fossilen noch billiger sind, berichtet Felix Wadewitz. Zum Artikel
Die Deutschen arbeiten so wenig und so viel wie noch nie – FAZ
Laut einer Studie des Deutschen Instituts zur Wirtschaftsforschung (DIW) ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland seit 1991 von 39 auf 36,5 Stunden gesunken, berichtet Patrick Welter. Das Arbeitsvolumen hingegen sei 2023 auf ein Rekordniveau gestiegen. Doch vor allem Frauen und geringer Qualifizierte würden gern mehr Stunden arbeiten. Zum Artikel
What Would the Economy Look Like Under a Second Biden Term? – The New York Times
Peter Coy geht in seinem Beitrag der Frage nach, in welche Richtung sich die Wirtschaftspolitik der USA in einer zweiten Amtszeit von Joe Biden entwickeln wird. Coy zufolge wird Biden nicht nur versuchen, die Steuern für die Reichen und die Ausgaben für die Armen zu erhöhen, sondern auch weiterhin auf eine Koalition zwischen der Arbeiter- und der Umweltbewegung hinarbeiten, indem er sich für gut bezahlte, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in der Produktion und für die Installation grüner Technologien einsetzt. Zum Artikel
Schäden durch Klimaerhitzung: Kosten des Klimawandels sechsmal so hoch wie Kosten zur Bekämpfung – Der Standard
36 Billionen Euro Schaden pro Jahr: Eine Neubewertung der Klimaschäden zeigt, dass bis 2049 mit einem globalen Einkommensverlust von 19 Prozent zu rechnen ist. Tanja Traxler hat sich eine entsprechende Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung angesehen. Zum Artikel
Nachhaltiger Konsum im Alltag: “Wir bevorzugen klimaschädigendes Verhalten” – Frankfurter Rundschau
Im Interview mit Joachim Wille erläutert der Umweltexperte Kai Niebert, wie Nachhaltigkeit in den Alltag integriert und so zur Normalität werden kann. Doch “so lange SUVs und Schnitzel subventioniert werden, werden Appelle zu nachhaltigem Konsum an unser aller wirtschaftsbürgerlicher Kompetenzen scheitern”, so Niebert. Zum Artikel
Umwelt-Klage wegen LNG-Terminal: “Großindustrialisierung” der Ostsee vor Gericht – Klimareporter
Die Rechtmäßigkeit der neuen Flüssiggas-Infrastruktur auf Rügen wird seit dieser Woche vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Geklagt haben zwei Umweltverbände. Sie fordern außerdem ein Moratorium für den LNG-Ausbau, weiß Jörg Staude. Zum Artikel
Umfrage: Die Sorgen der Zulieferer nehmen zu – Automobil Industrie
Die Halbjahresumfrage von Clepa und McKinsey zeigt eine hohe Unsicherheit unter den europäischen Automobilzulieferern. Der Nachfragerückgang bei der E-Mobilität sei dabei nur ein Problem, berichtet Lina Demmel. Hinzu kämen unter anderem die CO₂-Reduktionsziele und hohe Produktionskosten. Zum Artikel
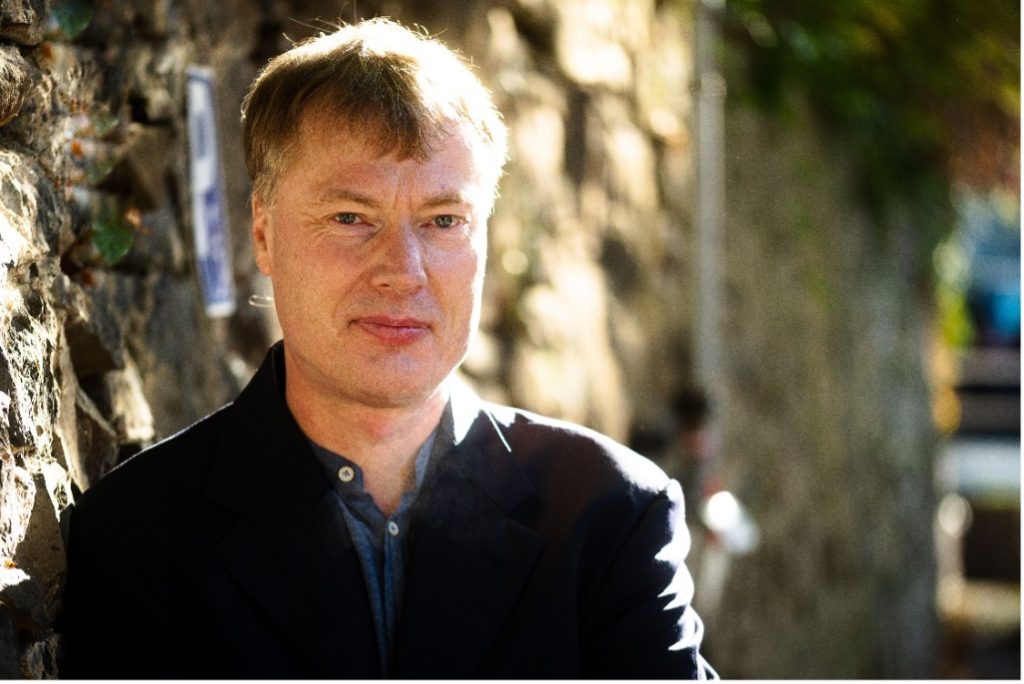
Der Kakaopreis erreicht Rekordhöhen, und zugleich wird der Kakao von Bäuerinnen und Bauern geerntet, die oft in tiefster Armut leben. Auch die Schokoladenpreise ziehen deutlich an. Doch Kakao macht nur einen kleinen Teil des Preises für Schokolade aus. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um endlich die massiven sozialen Probleme in der Lieferkette anzugehen.
Um das Jahr 2000 erreichten die Kakaopreise inflationsbereinigt einen historischen Tiefststand. Als Folge arbeiteten Studien zufolge zu Beginn des Jahrtausends rund zwei Millionen Kinder allein auf den Kakaoplantagen in der Côte d’Ivoire und Ghana. Immer noch gibt es Berichte über Sklavenarbeit von Kindern auf Kakaoplantagen.
Die letzte umfassende Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass weiterhin mindestens 1,5 Millionen Kinder in der Côte d’Ivoire und Ghana unter verbotenen Bedingungen arbeiten. Aus diesen beiden Ländern kommen rund 60 Prozent der Welternte, mehr als zehn Prozent stammen aus Nigeria und Kamerun, wo die Situation nicht besser ist.
Der Anbau von Kakao wird weiterhin von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dominiert, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Ernteerträge einfahren. Sie bewirtschaften in der Regel zwei bis vier Hektar und haben keinerlei Einfluss auf den Kakaopreis. Ist die Ernte gut, stürzt der Preis in den Keller, ist sie schlecht, geht der Preis in die Höhe.
2018 wurden die durchschnittlichen Einkommen der Kakao anbauenden Familien berechnet. Durchschnittlich lag ein existenzsicherndes Einkommen für Familien in der Côte d’Ivoire bei 6.517 US-Dollar pro Jahr, die realen Einkommen eines typischen Haushalts lagen jedoch nur bei 2.346 US-Dollar. Aufgrund der kleineren Familien und anderen Preisstruktur lag das existenzsichernde Einkommen in Ghana bei 4.742 US-Dollar, und die Einkommen typischer Haushalte betrugen 2.288 US-Dollar.
Organisationen der Bäuerinnen und Bauern, Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen verwiesen daher immer wieder auf die zwingende Notwendigkeit, die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern durch höhere Preise zu steigern.
Unternehmen wissen, dass darin der schnellste Weg zur deutlichen Linderung der sozialen Probleme in den Anbaugebieten liegt. Bislang wurde von Unternehmen jedoch immer wieder betont, “der Markt” mache den Preis, schließlich wird Kakao in London und New York an den Börsen gehandelt. Menschenrechtliche Aspekte spielen bei der Preisgestaltung keine Rolle.
Andererseits war und ist allen Schokoladenunternehmen klar, dass Kakao nur einen kleinen Teil der Kostenstruktur ihrer Lieferkette ausmacht. Bei einem Einkaufspreis auf dem Weltmarkt von 2.000 US-Dollar je Tonne Kakao, wie er über viele Jahre vorherrschte, lag bei Vollmilchschokolade mit einem Kakaoanteil von 30 Prozent der Preis für Kakao bei rund acht Cent je Tafel. Bei Schokoriegeln oder Schokoladenprodukten mit Füllungen ist der Kostenanteil des Kakaos noch bedeutend niedriger. Eine deutliche Erhöhung der Aufkaufpreise bei den Bäuerinnen und Bauern hätte somit nur zu einer moderaten Steigerung der Kosten für Schokoladenprodukte geführt.
Nun haben sich die Kakaopreise seit Frühjahr 2023 verdreifacht. Vor allem in Westafrika sind die Erntemengen deutlich gesunken. Ursache dafür ist unter anderem das regelmäßig wiederkehrende Klimaphänomen El Niño, das durch den Klimawandel verstärkt wird. Die weitgehende Entwaldung der Anbaugebiete in der Côte d’Ivoire und Ghana verschärft dort die Probleme. Durch massive Regenfälle Mitte 2023 sind große Flächen von Krankheiten befallen und die Bäume tragen wenige Früchte. Hinzu kommen strukturelle Probleme: Aufgrund der über Jahre niedrigen Kakaopreise fehlten vielen Bäuerinnen und Bauern die finanziellen Mittel, um ihre Plantagen optimal zu betreiben.
Die Schokoladenpreise steigen seit Monaten, wenn auch teilweise – angesichts des geringen Anteils der Kosten des Kakaos – in einem überraschend großen Umfang.
Nicht nur für die Côte d’Ivoire und Ghana, sondern auch für weitere Anbauländer liegen mittlerweile Kalkulationen existenzsichernder Einkommen vor. Aufgrund umfassender Datenerhebungen kennen die Unternehmen die durchschnittlichen Anbauflächen der Bäuerinnen und Bauern sowie die Produktivität je Hektar. Aufbauend auf diesen Daten müsste berechnet werden – und dies kann aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen nur innerhalb der einzelnen Unternehmen geschehen – welche Preise die Bäuerinnen und Bauern benötigen, sodass zumindest das Gros der Familien existenzsichernde Einkommen erreicht. Dies kann über garantierte Mindestpreise geschehen oder über Prämien, die bei fallenden Preisen erhöht und bei über eine gewisse Grenze steigenden Preisen gesenkt oder abgeschafft werden.
Einzelne Unternehmen zeigen, dass eine Kombination aus garantierten stabilen Preisen und langfristigen Lieferverträgen mit den Vereinigungen der Bäuerinnen und Bauern und Unterstützungsmaßnahmen zu einer massiven Reduzierung der Menschenrechtsverletzungen inklusive der Kinderarbeit führen können. Ein Beispiel dafür ist Tonys Chocolonely, ein niederländischer Konzern, der in den letzten Jahren schnell expandiert hat. Weitere Pilotprojekte großer Unternehmen zeigen, dass veränderte Lieferbeziehungen möglich sind und zu Verbesserungen führen. Dies sollte flächendeckend eingeführt werden.
Nur so werden die Unternehmen vor Klagen sicher sein. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz schreibt schließlich seit Anfang 2023 vor, dass große Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten mitverantwortlich sind. Auf EU-Ebene wurde kürzlich ein europäisches Lieferkettengesetz beschlossen. Um die Menschenrechte in den Lieferketten zu gewährleisten, braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, dass nach einigen guten Ernten die Preise nicht wieder ins Bodenlose fallen.
Die derzeit hohen Preise könnten es den Konzernen erleichtern, diese Maßnahmen einzuführen. Maßstab für die Preisgestaltung sollte nicht mehr der Preis an der Börse sein, sondern Zahlungen, die existenzsichernde Einkommen ermöglichen.
Friedel Hütz-Adams arbeitet seit 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das SÜDWIND-Institut. Er hat Studien zu verschiedensten Wertschöpfungsketten veröffentlicht, darunter während der vergangenen letzten Jahrzehnte etliche zum Thema Kakao. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss freiwillige Standards und gesetzliche Regulierungen zur Verantwortung der Wirtschaft für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards auf das Handeln von Unternehmen haben. Er arbeitet in mehreren Gremien mit, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten befassen, und ist unter anderem Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats der REWE-Group.
