die Entscheidungen von Politikern können entscheidend beeinflussen, ob die ökologische Transformation der Wirtschaft sich beschleunigt oder verlangsamt. Das zeigt sich dieser Tage deutlich: Eigentlich plant Großbritannien seine Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren. Aber, wie wir berichteten, will der konservative Premier Sunak über hundert neue Lizenzen an Unternehmen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee vergeben. Ein Rückschritt.
Ganz anders die Entwicklung in Brasilien: In den ersten sieben Monaten der Amtszeit von Präsident Lula nahm die Abholzung im Amazonas-Regenwald um 47 Prozent auf 3.000 Quadratkilometer ab. Unter seinem Vorgänger Bolsonaro hatte sie zugenommen. Nun will Lula sogar bei einer Konferenz in seinem Land die Regierungen Südamerikas zu einer gemeinsamen Regenwaldpolitik bewegen. Seit Dienstag beraten sie.
Wichtig sind Signale aus der Politik auch dafür, ob sich Unternehmen auf die Transformation einlassen. Damit beschäftigt sich Annette Mühlberger mit Blick auf die Umsetzung des LkSG bei den Unternehmen Kärcher und Körber. Was Unternehmen aus Überzeugung selbst leisten können, zeigt Christiane Keppel anhand des US-Teppichherstellers und Kreislaufpioniers Interface, der aber nur eine geringe Recyclingquote hat. Helfen könnte nach Ansicht von Experten die Politik. Sie ist auch mit neuen Problemen durch den technologischen Wandel konfrontiert, denn die KI-Industrie agiert nach ersten Einschätzungen extraktiv, darüber schreibt Marc Winkelmann.
Gestatten Sie uns bitte noch einen Glückwunsch in eigener Sache: Gestern Morgen um sechs Uhr ist bei Table.Media die 500. Ausgabe des Europe.Table erschienen. Fünfhundert Briefings, vollgepackt mit News zur europäischen Politik in Brüssel und tiefgründigen Analysen der EU-Gesetze und -Verordnungen. An (fast) jedem Werktag seit dem 3. August 2021 liefert das Team um Till Hoppe Aktualität, Relevanz und journalistische Qualität. Hier geht es zum kostenfreien Test.


Seit Anfang des Jahres müssen größere Firmen ihre Lieferkette im Rahmen des LkSG überwachen. Kärcher setzt auf ein etabliertes Risikosystem. Körber verknüpft die Sorgfaltspflicht mit der Klimatransformation.
Im Dezember endet das Berichtsjahr zur gesetzlichen Sorgfaltspflicht größerer Unternehmen. Jetzt, da das erste Halbjahr 2023 vorbei ist, zeigt sich: Firmen, die ihr Liefernetzwerk schon im Vorfeld durchleuchtet hatten oder die Sorgfaltspflicht mit Fragen der Transformation verknüpfen, hilft das LkSG beim Ausbau nachhaltiger Beschaffungsstrategien.
Kärcher (3,16 Milliarden Euro Umsatz, 15.330 Mitarbeitende) ist eines der großen deutschen Familienunternehmen. Produziert wird an 18 Standorten in neun Ländern. Die meisten Bauteile für die weltweit verkauften Reinigungsgeräte kommen von Zulieferern. 6.000 Firmen sind das. Hinzu kommen 20.000 Unternehmen, die sogenanntes Nicht-Produktionsmaterial liefern (unter anderem Büro-, Arbeitsschutzmaterialien, Betriebsmittel, IT). 2021, mitten in der Lieferkrise, registrierte der Einkauf 11.642 Lieferschwierigkeiten, so viele wie nie zuvor. Dass Kärcher diese Zahl so genau kennt, liegt auch an der Künstlichen Intelligenz, mit der das Unternehmen seine Lieferketten nach Auffälligkeiten durchforstet. Die gleiche KI nutzt Kärcher nun, um die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette zu überwachen: “Wir haben die mit dem LkSG verbundenen Anforderungen wie Selbstauskunft, Audits und Abhilfemaßnahmen an unser vorhandenes Risikosystem angedockt”, sagt Einkaufsleiter Heiko Braitmaier.
Die Informationen, die die KI des Anbieters Prewave auswertet und mit den Daten der Zulieferer verknüpft, stammen aus einem weltweiten Social Media- und News-Screening sowie aus Datenbanken zu Länder- und Industrierisiken. Die Überwachung von Lieferrisiken und der Einhaltung der Menschenrechte in einem Tool begründet Braitmaier so: “Beide Risiken brauchen Regelprozesse, von der Analyse, über das Tracking bis zu definierten Maßnahmenplänen.” Die Warnungen überprüft der Einkauf jeweils auf Plausibilität und leitet, so sich ein Verdacht bestätigt, auch Maßnahmen ein. Diese hat Kärcher fest definiert: Je nach Vorfall, Einflussmöglichkeiten und Risikokategorie sind etwa Online-Audits, Schulungen und Vor-Ort-Audits vorgesehen.
Risikosysteme brauchen eine gute Datenbasis: “Die Grundlagen hierfür muss man auch im eigenen Unternehmen schaffen”, mahnt Braitmaier und meint damit etwa das Zusammenführen zehntausender Lieferantendaten zu einem eindeutigen Stammdatensatz. Einen solchen “Golden Record” zu erstellen, ist für Unternehmen oft mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Zum Beispiel, weil Geschäftsbereiche gesondert einkaufen, Lieferanten in Warenwirtschaftssystemen mehrfach angelegt sind oder es in einer Firmengruppe mehrere Enterprise Resource Planning-Systeme gibt.
Kärcher analysiert auch die Vorstufen seiner Lieferkette und ermittelt diese aus öffentlich verfügbaren Frachtdaten. Auch die Einkäuferinnen und Einkäufer kennen Vorlieferanten. Die Daten hat Kärcher zusammengeführt. Und das Unternehmen hat sich mit der Thematik bereits frühzeitig befasst. “Dass wir uns schon im Vorfeld um Transparenz in der Lieferkette bemüht haben, war für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes ein großer Vorteil”, sagt Braitmaier.
Der Hamburger Technologiekonzern Körber schaut sich seine Lieferbeziehungen seit einigen Jahren genauer an. Das Unternehmen (13.000 Mitarbeitende, 2,53 Milliarden Euro Umsatz) produziert Maschinen und Digitallösungen unter anderem für die Pharmabranche, Verpackungsindustrie und Logistikzentren. “Ausgabentransparenz ist der Startpunkt aller Einkaufsstrategien und Entscheidungen und damit der Ausgangspunkt für die Transformation”, sagt Michael Stietz, Executive Vice President Operations im Geschäftsfeld Technologies und verantwortlich für den Einkauf. Rund 10.000 Firmen beliefern das Unternehmen. Die Ausgaben (wer kauft welche Materialien in welcher Menge bei wem) analysiert der Konzern für die Tochtergesellschaften zentral. Alle Einkäufer haben Zugriff auf ein System, über das sich die Lieferanten zunächst registrieren und wichtige Informationen wie Zertifikate zu Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen hochladen. “Wir schicken keine Exceldateien und PDFs mehr hin und her”, erklärt Stietz den Vorteil der zentralen Lieferantendossiers, die auf diese Weise entstehen.
Seit 2023 fließen dort hinein auch die Selbstauskünfte der Lieferanten im Rahmen des LkSG. Diese Befragung läuft über die Plattform Integrity Next, die die Daten an Körber weitergibt. Lieferanten, die bei Integrity Next bereits eine aktuelle Bewertung haben, müssen die Fragen nicht mehr beantworten. Alle anderen müssen sich registrieren und den Fragebogen ausfüllen. Auch die Treibhausgas-Emissionen (Company- und Product Carbon Footprints) werden in den Lieferantendossiers gesammelt.
Die Informationen aus den Dossiers (dazu gehören auch Informationen zur Zusammenarbeit und Lieferfähigkeit) spielen für die Ausgestaltung der Lieferkette eine große Rolle: “Das ist ein mehrstufiger Prozess”, sagt Stietz. Im ersten Schritt entscheide der Einkauf darüber, ob eine Firma als Lieferpartner überhaupt infrage komme. Im nächsten flössen die Informationen in die kontinuierliche Lieferantenbewertung, die wiederum entscheidend für die Vergaben sei.
Auf Lieferanten-Tagen und in persönlichen Gesprächen hat der Einkauf mit den Zulieferern nun sowohl die Anforderungen des Lieferkettengesetzes als auch jene der Klimaziele besprochen. “Die Transformation braucht eine enge Kommunikation und Begleitung”, sagt Stietz. Mit der Verknüpfung beider Themen habe man die Veränderung verdeutlichen wollen: Neben Qualität, Timing, Innovation und Preis sei Nachhaltigkeit das entscheidende Vergabekriterium, sagt der Einkaufsmanager.
Die Lieferantenstruktur beschreibt er als zweigeteilt. Auf der einen Seite die Großkonzerne. Dort seien beide Themen omnipräsent und man müsse sich nicht über Grundlagen austauschen. Auf der anderen Seite der kleinere Mittelstand: Dort geht es darum, mit den Inhabern zu sprechen, Awareness zu schaffen und Hilfe anzubieten. “Insbesondere beim Klimaschutz wird die Transformation ein gemeinsamer Weg über viele Jahre werden”, meint Stietz.

Seit 50 Jahren verkauft Interface seine Teppichfliesen an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die grüne Mission startet 1994. Der Sinneswandel basiert der Legende nach auf einer Kundenfrage, die Gründer Ray Anderson aufhorchen ließ: Was sein Unternehmen eigentlich für die Umwelt tue? So implementiert Anderson, der 2011 starb, 1995 das Rücknahmeprogramm “ReEntry” mit dem Ziel, genutzte Teppiche von Kunden zurückzunehmen, zu recyceln oder wiederzuverwenden und dadurch zu verhindern, dass die Produkte zu Müll werden. Im Jahr 2000 ruft Interface die Strategie “Mission Zero” aus: Bis 2020 will das Unternehmen klima- und umweltneutral sein.
2015 erreicht es einen Teil des Ziels. Interface ist klimaneutral, allerdings dank Kompensationen: “Sie dienen nur als Brücke”, sagt Ruth Prinzmeier, Sustainability Managerin für die DACH-Region bei Interface Deutschland. Künftig will sie ohne Kompensationen auskommen und bis 2040 zu einem CO₂-negativen Unternehmen zu werden. So ist es in der neuen Strategie (“Climate Take Back”) festgelegt. Bis 2030 will die Firma im Vergleich zu 2019 folgende Zwischenschritte erreichen:
Ein Baustein dieses Wegs sind die Teppichfliesen der Produktlinie “Embodied Beauty”. Interface fertigt sie unter anderem aus Kohlenstoff, was dazu führt, dass sie unterm Strich über ihren gesamten Produktionsprozess betrachtet CO₂-negativ sind. An seine Grenzen stößt Interface hingegen, wenn es darum geht, seine Produkte konsequent der Wiederverwendung und dem Recycling zuzuführen.
Interface nimmt deutlich weniger Teppiche über ReEntry zurück, als das Unternehmen produziert. 2015 waren es laut der Deutschen Umwelthilfe 900 Tonnen und damit lediglich 1,5 Prozent der im selben Jahr verkauften Menge. Auch 2021 nahm Interface gerade einmal 3.050 Tonnen über ReEntry zurück. Die Herausforderung: Interface kann nur wiederverwenden und recyclen, was Kunden und andere Branchenteilnehmer den vorgesehenen Prozessen des freiwilligen Rücknahmesystems ReEntry zuführen. Die Kunden müssen die Rücknahme einplanen: Interface kontaktieren, die Teppichfliesen ausbauen und auf Paletten laden, die das Unternehmen schließlich abholt und dem Kreislauf zuführt.
Recyclingfähiges Material ist in der Baubranche allerdings immer noch eine Ausnahme. Die wenigsten Kunden planen das Recycling bei einem Umbau oder Abriss ein. “Dann hängt es von einzelnen Mitarbeitenden ab, die um die Rückgabe bei Interface wissen”, so Prinzmeier. Wenn diese zwischenzeitlich das Unternehmen verlassen hätten, gehe das Wissen um die Wiederverwertbarkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren. Die Lösung sieht Prinzmeier deshalb im koordinierten, branchenweiten Vorgehen, beispielsweise in digitalen Zwillingen für Gebäude: “Dort könnten Verantwortliche bei der Planung auf einen Blick sehen, welche Materialien verbaut sind, was wiederverwendbar ist und entsprechenden Prozessen zugeführt werden kann.”
Laut Henning Wilts, Experte für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, sind Datenökonomie, Digitalisierung und staatliche Rahmenbedingungen maßgeblich für eine gelingende Kreislaufwirtschaft: “Wir benötigen Branchenlösungen, wie etwa digitale Zwillinge von Gebäuden, die mit verpflichtenden Rückbaukonzepten verknüpft sein sollten.” Regulatorische Vorgaben sowie die Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle könnten die entscheidenden Stellschrauben für das Gelingen der Kreislaufwirtschaft sein. “Unsere Wirtschaft funktioniert nach der Kaufen-Nutzen-Entsorgen-Logik”, so Wilts. Für Unternehmen, die reparaturfähige und wiederverwendbare Produkte mit langer Lebensdauer anböten, sei es schwierig, konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Firmen hätten oft hohe Transaktionskosten zu bewältigen, etwa durch rechtliche Unsicherheiten oder komplexe Prozesse. Kunden wiederum erkennen vor allem den höheren Kaufpreis, nicht aber die Recycel- und Kreislauffähigkeit der Produkte.
Wie eine bessere Kennzeichnung aussieht, könnten sich Politiker in Frankreich abschauen: “Dort sind Produkte mit einer Skala von eins bis zehn ausgezeichnet, die sich auf den Anteil der verarbeiteten recycelten Rohstoffe bezieht”, so Wilts. Vielversprechende regulatorische Ansätze sehen sowohl Prinzmeier als auch Wilts auf EU-Ebene: Die EU-Taxonomie definiert die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft als eines von sechs Umwelt- und Klimazielen. Allein, es fehlt bisher der Kriterienkatalog. Auch die Europäische Kommission arbeitet an einem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Prinzmeier beobachtet, dass der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit da ist. “Doch wenn die Umsetzung zu aufwendig ist, fällt die Entscheidung in der Praxis trotzdem oft gegen die nachhaltige Lösung.” Deshalb brauche es gesetzliche Rahmenbedingungen, die Produzenten branchenweit zu Rückgabe- oder Pfandsystemen verpflichten: “Damit das Recyceln zur Gewohnheit wird und nicht länger die Ausnahme bleibt”, sagt Prinzmeier. Christina Keppel
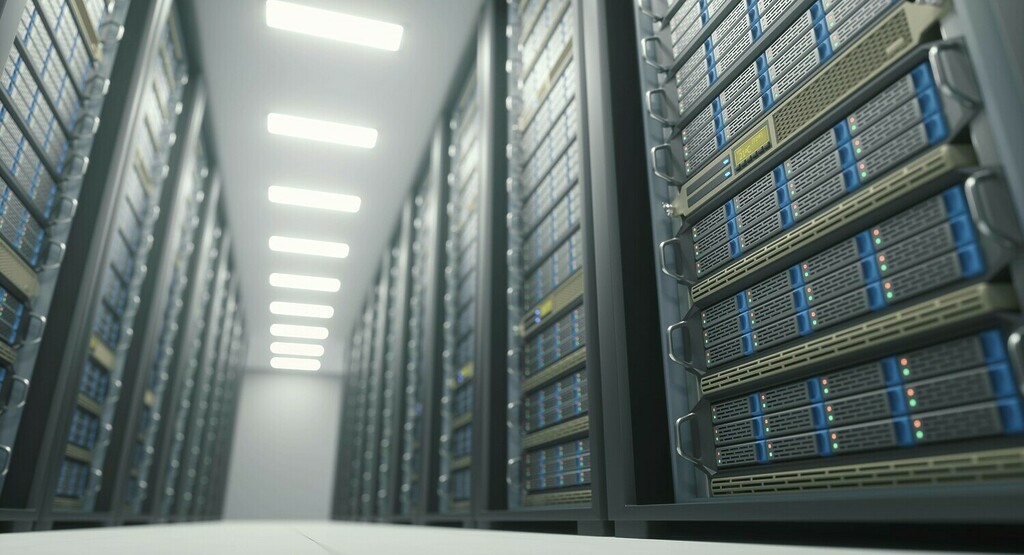
Im Museum of Modern Art in Manhattan hängt in Raum 216 im zweiten Stock eine Infografik. “Anatomy of an AI System” heißt die Arbeit und sie zeigt, was es braucht, um den “smarten” Lautsprecher “Amazon Echo” zum Leben zu erwecken. Es ist eine Landkarte der Inhaltsstoffe einer Künstlichen Intelligenz: Es geht um geologische Erdprozesse und die Gewinnung der Rohstoffe, um die Herstellung von Chips, die Löhne der beteiligten Arbeiter, das Training des Systems mit Daten, die Entsorgung ausrangierter Geräte.
Bis vor ein paar Jahren waren Ökobilanzen, sogenannte “Life Cycle Assessments” (LCA), die ein Produkt von der Wiege bis zur Bahre ausleuchten, nur etwas für Forschungslabore. Das ist vorbei. Im Zuge der globalen Nachhaltigkeitsziele und der Klimakrise geraten sie immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Selbst in Museen sind sie schon angekommen.
Während es mittlerweile aber präzise Daten über die öko-sozialen Folgen einer Jeans oder eines Flugs gibt, sind die Erkenntnisse zu Künstlicher Intelligenz noch gering. Das hat mehrere Gründe: Rechenzentren und Tech-Firmen wie Microsoft, Amazon, Meta und ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlichen kaum Zahlen, Unternehmen und Forscher messen mit verschiedenen Methoden und im globalen Material-, Daten- und Energiestrom fällt es schwer, KI-Anwendungen voneinander abzugrenzen. Zudem entwickelt sich die Technologie dynamisch. Angaben zum Stromverbrauch können bereits nach kurzer Zeit veraltet sein, weil sie Effizienzgewinne neuerer Geräte nicht berücksichtigen.
Das, was bekannt ist, lässt Experten – Stand jetzt – zu einem eher pessimistischen Zwischenfazit kommen. “KI-Systeme können ernsthafte Konsequenzen für die Umwelt haben”, heißt es im “AI Index Report 2023”, dem alljährlich viel beachteten Trendbericht der Stanford University.
Zwar kann durch das gewählte Design und die Infrastruktur Einfluss auf das Ergebnis genommen werden. Währung die Trainingsläufe von GPT-3 beispielsweise, einem ChatGPT-Vorläufer, der mit 175 Milliarden Parametern entwickelt wurde – darunter versteht man die Verbindungen von künstlichen Neuronen untereinander -, 502 Tonnen CO₂ produzierte, verursachte das Open-Source-Sprachmodell “Bloom” mit 176 Milliarden Parametern nur 25 Tonnen CO₂.
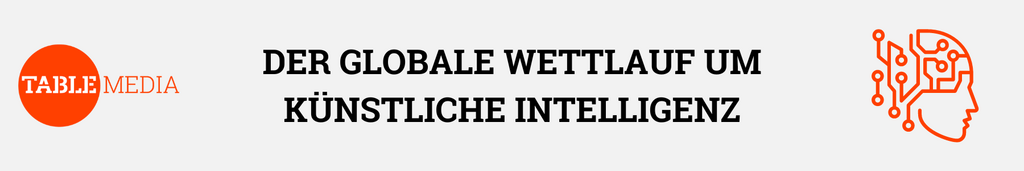
Befürchtet wird aber, dass die Zahlen steigen. Beflügelt durch das Interesse an der Ende November 2022 veröffentlichen Plattform ChatGPT ist die Branche im Rausch. Die Zahl der eingesetzten Trainingsdaten und daraus resultierenden Rechenoperationen wachsen exponentiell, immer mehr Unternehmen programmieren KI-Anwendungen für Smartphone-Apps, Computer oder Fahrzeuge – und Unternehmen und Endverbraucher nutzen diese täglich millionen- oder gar milliardenfach.
Rund 700 Millionen Tonnen CO₂ produzierte der globale Informations- und Telekommunikationssektor 2020. Das entsprach einem Anteil von 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Verkehrs- oder Bausektor nimmt sich das bescheiden aus. Durch KI wird es dabei wahrscheinlich aber nicht bleiben. Sasha Luccioni, die bei dem US-Unternehmen Hugging Face an der Schnittstelle von Klimawandel und KI arbeitet, sagt: “Meine Forschung zeigt, dass die neuen Generationen von Sprachmodellen tausende Mal mehr Kohlendioxid verursachen als vorige Generationen.”
Eine weitere Herausforderung, die angesichts steigender Hitze und sinkender Grundwasserspiegel drängend wird, ist der Wasserfußabdruck. Der University of California, Riverside, zufolge verbrauchen 20 bis 50 Anfragen bei ChatGPT etwa einen halben Liter Wasser. Benötigt wird es in zwei miteinander verbundenen Prozessen: Erstens dient es dazu, Kraftwerke zu kühlen, die Strom erzeugen – zweitens muss es eingesetzt werden, um Datenzentren zu kühlen, die mit dem zuvor produzierten Strom ihre Rechner betreiben. 30 Prozent aller Rechenzentren stehen in den USA, allein Googles Einrichtungen verbrauchten 2021 fast 13 Milliarden Liter Frischwasser. Und der Bestand wächst weiter: Zwischen 2017 und 2022 nahm die Zahl der Server weltweit um mehr als 37 Prozent zu, auf 85,6 Milliarden Einheiten.
Die Unternehmen rühmen sich zum Teil, Verantwortung zu übernehmen. Hersteller Nvidia erklärte, selbstlernende KI-Modelle dafür einzusetzen, die Produktion seiner Chips, die essenziell für Künstliche Intelligenz sind, energiesparender zu machen. Google gab an, sein Sprachmodell “PaLM” über ein Rechenzentrum in Oklahoma trainiert zu haben, das durch erneuerbare Energien zu 89 Prozent CO₂-frei sei. Das ist bislang aber eine Ausnahme. Weltweit betrachtet nutzt die Mehrheit der KI-Entwickler fossile Energienetze.
Die Wissenschaftlerin Kate Crawford sagt, dass Künstliche Intelligenz angesichts der zahlreichen Probleme, die die Technologie aufwirft, weder als künstlich noch als intelligent zu bezeichnen sei. Die Australierin hat zusammen mit einem Künstler die im New Yorker MoMa ausgestellte Infografik entworfen und die KI-Landschaft auch in ihrem Buch “Atlas of AI” kartografiert. Darin macht sie – neben den Folgen für Natur und Umwelt – auch darauf aufmerksam, dass Menschen ausgebeutet werden. Etwa, indem sie zu Niedriglöhnen in “digital Sweatshops” im Akkord Rohdaten aufbereiten müssen, damit diese für Firmen wie OpenAI und deren Plattform ChatGPT als Trainingsdaten nutzbar werden.
Crawford bestreitet nicht, dass Künstliche Intelligenz die Medizin voranbringen, beim Aufbau “smarter” Energienetze helfen und autonome Fahrzeuge steuern kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass KI eine “extraktive Industrie” ist, wie sie schreibt, und das in vielerlei Hinsicht. Nachhaltig ist das bislang kaum.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Die Beauftragung von Felix Hartmann, Professor für Arbeitsrecht an der Freien Universität Berlin, für ein Gutachten zum Bundestariftreuegesetz durch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kritisieren Fachleute. Dieser vertrete eine “absolute Außenseiter- und Extremposition” unter Juristen, twitterte Thorsten Schulten, Forscher für Arbeits- und Tarifpolitik am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Andere Experten teilen seine Einschätzung. Hartmann kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass die von der Bundesregierung geplante Tariftreueregelung verfassungswidrig und zudem nicht mit EU-Recht vereinbar sei.
“Tarifzwangsregelungen greifen in die vom Grundgesetz geschützte Tarifautonomie ein”, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger bei der Vorstellung des Gutachtens. Anders sieht dies die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi: “Öffentliche Aufträge an eine Tariftreue zu binden, ist mit der Koalitionsfreiheit gedeckt.” Sie bezieht sich dabei auch auf eine Expertise des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wonach das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur Tarifbindung bei öffentlichen Bauaufträgen in Berlin von 2006 “die zuvor vielfach geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Tariftreueregelungen im Hinblick auf das Grundrecht der Koalitionsfreiheit” ausräumt.
Nach Plänen der Bundesregierung sollen nur noch Unternehmen öffentliche Aufträge des Bundes ab 10.000 Euro ausführen dürfen, die Ihren Beschäftigten etwa den Lohn zahlen, den ein repräsentativer Tarifvertrag vorgibt. Welcher für Unternehmen maßgeblich ist, will der Bund per Verordnung festlegen. Aus Kreisen der SPD-Bundestagsfraktion heißt es, dass inzwischen ein gemeinsamer Entwurf von Arbeits- und Wirtschaftsministerium vorliegt, der aktuell mit den anderen Ressorts abgestimmt wird. nh
Die Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie braucht Recyclingverfahren, die große Abfallmengen in kurzer Zeit prozesssicher in hochwertige Sekundärrohstoffe umwandeln. Eine Kooperation der Recyclingspezialisten Erema und Lindner will das Kunststoffrecycling im industriellen Maßstab jetzt ein ganzes Stück voranbringen.
Kunststoffrecycling braucht viele Verarbeitungsschritte. Dazu gehören Zerkleinern, Waschen, Trocknen, Extrudieren, Filtern, das sogenannte Compounding, das Kunststoffen spezielle Eigenschaften verleiht, und die Geruchsoptimierung. Eine Maschine, die alles kann, gibt es nicht: Die Kunststoffaufbereitung erfolgt in Recyclingunternehmen deshalb in Anlagen verschiedener Hersteller, die sich ihrerseits auf einzelne Verfahren spezialisiert haben. So ist Erema Markführer für Extruder und Filtermaschinen, Lindner Spezialist für Schredder und Waschanlagen.
In einem Gemeinschaftsunternehmen wollen sich die Branchenvorreiter nun darum kümmern, dass ihre bislang autark arbeitenden Maschinen miteinander kommunizieren, prozessübergreifend gesteuert und überwacht werden. Die Vernetzung soll Recyclingfirmen, die die Anlagen nutzen, einen höheren Durchsatz ermöglichen und die Qualität der Kunststoffrezyklate steigern. Der vernetzte Prozess soll außerdem weniger Energie verbrauchen.
Der Blick auf die gesamte Verarbeitungskette sei für eine funktionierende Recyclingwirtschaft entscheidend, erklärt Manfred Hackl, CEO der Erema Group in einer Firmenmitteilung: “Essenziell wird sein, dass die gesamte Prozess- bzw. Wertschöpfungskette – von der Abfallsammlung und Aufbereitung über das Recycling bis hin zum Kunststoffendprodukt – im Fokus der agierenden Unternehmen steht.” Der Hebel der Bündelung sei groß, man wolle das Kunststoffrecycling revolutionieren, meint Linder-Geschäftsführer Michael Lackner. In gemeinsamen Forschungsprojekten arbeiten die Unternehmen auch an Branchenstandards für das Kunststoffrecycling. am
Nach einer neuen Modellierung eines niederländischen Forschungsteams befindet sich deutlich mehr Plastikmüll in den Weltmeeren als gedacht: 3,2 Millionen Tonnen, meist große Partikel. Zwei Millionen Tonnen davon schwimmen auf der Oberfläche, ein Vielfaches früherer Schätzungen von etwa 0,3 Millionen Tonnen. Unerfasst ist bei der Studie das Plastik, welches sich bereits in den Sedimenten abgelagert hat.
Die Modellierung umfasst die Jahre 1980 bis 2020 und alle Weltmeere. Berücksichtigt wurden über 20.000 Messwerte auf der Meeresoberfläche, an Stränden und der Tiefsee. Die Studie erschien am Montag im Fachjournal Nature Geoscience.
Allerdings gelangt nach dieser Modellierung weniger neuer Plastikmüll in die Ozeane als angenommen: jährlich 0,5 Millionen Tonnen. Davon stamme die Hälfte aus der Fischerei, rund 40 Prozent gelange über Küsten in die Meere, der Rest über Flüsse.
In früheren Studien kamen Forscher zu wesentlich höheren Mengen an Plastikeinträgen. Laut einer einschlägigen Studie aus dem Jahr 2020 betragen sie in allen aquatischen Systemen (Flüsse, Seen und Meere) zusammen jährlich 19 bis 23 Millionen Tonnen. Eine andere Studie bezifferte die Plastikeinträge allein von Flüssen in Meere mit 0,8 bis 2,7 Millionen Tonnen. Die Diskrepanzen erklären sind dadurch, dass die Messung von Plastikeinträgen im Meer schwierig ist.
Das neue Modell “kann als erster Versuch betrachtet werden, den globalen Massenhaushalt von schwimmfähigem Kunststoff im Meer zu verstehen“, sagt die Umweltwissenschaftlerin Serena Abel von der Universität Basel. Obwohl zwei der häufigsten Polymere aus der Untersuchung ausgeklammert wurden (PVC und PET), die 35 bis 40 Prozent der in die Meeresumwelt gelangenden Masse ausmachen, spricht sie von einem “Meilenstein in der Erforschung der Plastikverschmutzung, den Verbleib und die Auswirkungen von Plastik im Meer auf globaler Ebene und nicht nur aus lokaler Perspektive zu untersuchen”.
Zu den Konsequenzen sagt die Meeresökologin Melanie Bergmann vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung: “Nach wie vor gilt, dass wir den Hahn zudrehen müssen, bevor wir aufwendig und teuer Plastik aus dem Meer fischen.” In allererster Linie müsse die “eskalierende Produktion” minimiert werden und das Design von Kunststoffen so verbessert werden, dass weniger und gesundheitlich unbedenkliche Chemikalien eingesetzt werden. “Erst dies ermöglicht die Kreislaufwirtschaft des wirklich notwendigen Plastiks.” cd
Die US-Regierung hat Anfang August ein Maßnahmenpaket vorgelegt, nach dem US-Bundesbehörden bei ihrer Beschaffung noch stärker auf den Umwelt- und Klimaschutz achten müssen. Ziel der Biden-Administration ist es, die Ausgaben der öffentlichen Hand auf Bundesebene bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen.
Die nun vorgelegte Sustainable Products and Services Procurement Rule soll bisherige Entscheidungsspielräume einschränken und Bundesbehörden dazu verpflichten, künftig möglichst nur noch Produkte und Dienstleistungen einzukaufen, die höchsten Nachhaltigkeitsstandards genügen.
Die Vorschläge wurden vom Council on Procurement Regulation erarbeitet, dem zwei leitende Beamte des Federal Procurement Office sowie je ein Vertreter des Verteidigungsministeriums, der NASA und der Bundesverwaltung angehören. Die US-Bundesbehörden verfügen über ein jährliches Budget von mehr als 630 Milliarden US-Dollar.
“Als größter Einkäufer der Welt haben wir die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Umstellung auf saubere Produkte zu beschleunigen”, sagte Robin Carnahan, der für die Bundesverwaltung im Regulierungsrat sitzt.
Laut US-Regierung enthält bereits ein Drittel ihrer Verträge Nachhaltigkeitsklauseln. Grundlage dafür sind Spezifikationen, Standards und Umweltzeichen der US-Umweltschutzbehörde EPA – etwa der Energy Star für energiesparende Geräte, Baumaterialien und Gebäude oder das Water Sense Label für wassereffiziente Produkte.
“Durch die Förderung nachhaltiger Beschaffung auf Bundesebene profitieren Verbraucher von Waren und Dienstleistungen, die sicherer für ihre Familien und unseren Planeten sind”, sagte EPA-Direktor Michael Regan. Er kündigte an, die EPA-Empfehlungen zu überarbeiten und auf weitere Produkte und Branchen wie das Gesundheitswesen oder die Textilindustrie auszudehnen.
Die Vereinigten Staaten rühmen sich, schon jetzt weltweit führend im Bereich der nachhaltigen Beschaffung zu sein und als Vorbild zu dienen. So hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) den USA kürzlich als bisher einzigem Land den “höchstmöglichen Status” für nachhaltige Beschaffung zuerkannt.
Über die neuen Beschaffungsregeln wird nach einer Konsultationsphase von 60 Tagen entschieden. In der Zwischenzeit können Zivilgesellschaft und Wirtschaft Änderungs- und Ergänzungsvorschläge machen. ch
Die Verbände der deutschen Entsorgungswirtschaft erneuerten anlässlich des Inkrafttretens der deutschen Ersatzbaustoffverordnung vergangene Woche ihre Forderung nach verschärften Regeln für das Abfallende von Ersatzbaustoffen sowie für die öffentliche Beschaffung vorzugeben. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE), die Bundesvereinigung Recyclingbaustoffe (BRB) und die Interessengemeinschaft der Aufbereiter und Verwerter von Müllverbrennungsschlacken (IGAM) forderten in einer gemeinsamen Presseerklärung eine zeitnahe Überarbeitung der Verordnung.
Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist am 1. August in Kraft getreten und regelt die Herstellung und den Ersatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßen-, Erd- und Tiefbau. Die Vorgaben wurden 15 Jahre lang erarbeitet, danach galt eine zweijährige Übergangsfrist.
Ein möglicherweise etwas holpriger Start sei mit Blick auf die Komplexität des Verordnungstextes auch trotz der guten Vorarbeit nicht ganz zu vermeiden, erklärte BDE-Präsident Peter Kurth. Die Verbände bedauern, dass die bereits kürzlich beschlossene erste Novelle nicht genutzt worden sei, “um die EBV in für die Praxis entscheidenden Punkten auszubessern”.
Man unterstütze die Pläne des Bundesumweltministeriums, eine gesonderte “Abfallende-Verordnung” noch im Laufe dieser Legislatur zu erarbeiten, erklärte Kurth. Damit soll das Ende der Abfalleigenschaft bestimmter mineralischer Ersatzbaustoffe geregelt werden. Die “ordnungsgemäße Herstellung, Güteüberwachung und Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe” gemäß der EBV führe nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. “Eine Abfallende-Verordnung, die nur einen Teil der Materialklassen der EBV abdeckt, ist somit nicht sinngemäß und würde dem wichtigen Ziel einer nachhaltigen Kreislaufführung in der Bauwirtschaft nicht gerecht werden”, so der BDE-Präsident. leo
Die Jury hat entschieden: Der diesjährige Lean and Green Management Award in der Kategorie Automotive geht an den VW-Standort Kariega in Südafrika. In dem 1951 errichteten Werk produzieren mehr als 3.500 Beschäftigte Pkw-Motoren und verschiedene Modelle des VW Polo.
In der Kategorie Industrie entschied sich die Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien für den Produktionsstandort der TE Connectivity GmbH in Wört/Dinkelsbühl. Das weltweit tätige Unternehmen stellt Verbindungs- und Sensorprodukte her.
Das Thema Nachhaltigkeit werde für alle Unternehmen, unabhängig vom jeweiligen Industriezweig, zu einer zunehmenden Herausforderung, so die Ausschreibung des Awards. “Daher gilt es vermehrt in die Green Transformation zu investieren und diese mit der bereits in vielen Unternehmen etablierten Lean-Philosophie zu verknüpfen”, heißt es im Text weiter. “Durch Lean Exzellenz meistern wir die grüne Transformation”, ist Daniel Reichert, Leiter des Bereichs Lean & Green bei T&O, überzeugt.
Die diesjährige Sonderpreise für Excellence in Value Stream Management gingen an das Werk Nazarje in Slowenien der BSH Hausgeräte GmbH und für Excellence in Strategy an den Standort Ochsenhausen der Südpack GmbH & Co. KG.
Der Preis, der seit 2012 jährlich von der Münchner T&O Unternehmensberatung vergeben wird, zeichnet Standorte von Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit mindestens 150 Mitarbeitern aus, die erfolgreich betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien mit schlanken Produktionsprozessen verbinden.
Teil des Entscheidungsprozesses ist ein Assessment durch Experten von T&O. Wissenschaftlich begleitet wird der Award von der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Die Preisverleihung findet am 19. Oktober 2023 im Rahmen des Lean and Green Summit in Pfronten beim Werkzeugmaschinenhersteller und Vorjahressieger DMG Mori statt. ch
Südamerikas Staatschefs zur großen Regenwaldkonferenz zusammen – NZZ
Brasiliens Präsident Lula da Silva kann deutliche Fortschritte beim Schutz des Regenwaldes vermelden, schreibt Alexander Busch. Während die Rodung des Regenwalds unter seinem rechtspopulistischen Vorgänger dramatisch zugenommen hatte, war in den sieben Monaten seiner Amtszeit ein Rückgang um 47 Prozent zu verzeichnen. Mit Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru und Venezuela soll zudem der Amazonaspakt von 1978 wieder belebt werden. Das Signal an den Westen: Südamerika kümmert sich selbst. Zum Artikel
Rebranding ESG won’t save it from its internal contradictions – Financial Times
Stuart Kirk schreibt über Widersprüche bei EG-Investitionen. Dazu zählen für ihn die Folgen sich verändernder Normen, die Arbitrage zwischen den drei Zielen E-S-G oder Ungleichheiten in der Behandlung von Unternehmen. Da gebe es große Anstrengungen, um Tabakunternehmen aus Portfolios auszuschließen, aber keine für den Ausschluss von Lebensmittelunternehmen, welche unsere Nahrungsmittel mit Salz, Zucker und Fett überladen würden. Zum Artikel
How to manage the green backlash – Financial Times
Regierungen brauchten bessere Strategien, um die Kosten der Klimatransformation zu handhaben, kommentiert die FT. Sie lernten gerade, dass öffentliche Unterstützung für grüne Anliegen nicht umsonst zu haben sei. Die Zeitung zitiert einen Demonstranten aus der französischen Gelbwestenbewegung, der 2018 sagte: “Die Eliten reden über das Ende der Welt, aber wir reden über das Ende des Monats.” Zum Artikel
The fight for the right to repair – Financial Times
Bürger sollten sich für bessere und länger haltbare Technik einsetzen, kommentiert Camilla Cavendish. Denn es brauche mehr Transparenz mit Blick auf Effizienz und Lebensdauer über den Produktzyklus, Zehnjahres- statt Zweijahresgarantien, vereinheitlichte Stecker und Kabel. Zudem sollte jedes Land das französische Gesetz gegen geplante Obsoleszenz übernehmen, kommentiert sie. Zum Artikel
Der Kampf gegen Verpackungsmüll wird zur Lobbyschlacht – Süddeutsche Zeitung
Jan Diesteldorf beschreibt die Überlegungen der EU für Verpackungen als eine “revolutionäre Müll-Reform”. Darüber sei die Industrie entsetzt. Denn seit der Verpackungsverordnung geh es nicht mehr nur um Endverbraucher, sondern auch die großen Mengen an gewerblichen Verpackungen. Zum Artikel
Morgan Stanley Reaches 70% of $1 Trillion ESG Funding Goal – Bloomberg
Morgan Stanley hat nach eigenen Angaben mehr als zwei Drittel des Weges zu seinem Ziel zurückgelegt, bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von einer Billion US-Dollar in kohlenstoffarme und nachhaltige Technologien zu finanzieren, berichtet Alastair Marsh. Zum Artikel
VW-Menschenrechtsbeauftragte: “Die Lage im Kongo ist sehr schwierig” – FAZ
Kerstin Waltenberg, die Menschenrechtsbeauftragte des Volkswagen-Konzerns, steht vor gewaltigen Aufgaben. Ein Besuch im chinesischen Joint-Venture-Werk in Urumqi ist fest vorgesehen. Doch auch in anderen Ländern gibt es Probleme, hat Christian Müßgens recherchiert. Zum Artikel
Greenwashing Unmasked: A critical Examination of ESG Ratings and actual environmental Footprint – Forbes
Die Einführung von ESG-Ratings war ein bedeutender Schritt. Sie spiegelt das wachsende Bewusstsein in der Wirtschaft für die Umweltkrise und den Wunsch wider, ethische Überlegungen in Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Doch halten die Ratings, was sie versprechen, hat sich Ben Laker gefragt. Zum Artikel
Despite reforms, mining for EV metals in Congo exacts steep cost on workers – Washington Post
Nach Enthüllungen über Kinderarbeit und menschenunwürdige Bedingungen in vielen Kobaltminen haben Autohersteller und Minenbetreiber erklärt, sich an internationale Sicherheitsstandards zu halten. Doch im Kongo sind die Bedingungen für die Arbeiter, die das Metall für Batterien abbauen, nach wie vor schlecht, haben Katharine Houreld und Arlette Bashizi recherchiert. Zum Artikel
Elektromobilität: BEV-Absatz – Dynamischer Elektro-Hochlauf hält an – Automobil Industrie
Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden in China, Europa und den USA nach Berechnungen des Center of Automotive Management (CAM) mit insgesamt 4,05 Millionen Elektroautos 36 Prozent mehr vollelektrisch angetriebene Einheiten neu zugelassen als im gleichen Zeitraum 2022, berichtet Jens Rehberg. Zum Artikel
Generelles Verbot von PFAS-Chemikalien gefährdet laut Verbänden Klimaziele – Handelsblatt
Ein Verbot von PFAS-Chemikalien könne zu einem “Klimaschutz-Boomerang” werden, meinen Industrieverbände. Auch Wirtschaftsminister Habeck warnt vor einer Überregulierung für die Wirtschaft. Kein Windrad, kein E-Auto, kein Energiespeicher, keine Halbleiter – ohne PFAS-Chemikalien ließen sich Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht produzieren, zitiert das Handelsblatt eine Mitteilung der Verbände der Autoindustrie. In der EU wird über ein mögliches Verbot sogenannter Ewigkeits-Chemikalien diskutiert. Zum Artikel

Nun sind sie also da, die European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Die EU-Kommission hat sie angenommen und es ist nach aktueller Lage nicht davon auszugehen, dass das EU-Parlament und der Rat von ihrem Recht der Ablehnung Gebrauch machen. Der Weg ist also frei, das bereits verabschiedete zugrundeliegende Rahmenwerk, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mit den neuen Standards bis Mitte 2024 in nationales Recht umzusetzen.
Dass die Meinungen über die neuen Standards auseinandergehen, war zu erwarten. Wirtschaftsverbände warnen mit Blick auf Aufwand und notwendige Bürokratisierung zur Erfüllung der Berichtspflichten vor der Überforderung gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen. Umweltverbände sehen die im Vergleich zu den ursprünglichen Vorschlägen der eingesetzten Arbeitsgruppe deutlich gelockerten Vorgaben kritisch.
Es bleiben, wie so häufig, eine Reihe von Fragen offen, die auch der noch zu erwartende Leitfaden der EFRAG-Arbeitsgruppe zur Umsetzung nicht alle beantworten wird. Klar ist aber schon jetzt: Die Auswirkungen haben nicht nur eine inhaltliche, sondern gleich in doppelter Hinsicht auch eine Management-Dimension.
Zum einen: Mit einfacher Berichterstattung ist es nach diesen Standards nicht getan. Vielmehr wird ein systematisches Prozessmanagement gefordert, wie wir es etwa aus dem Qualitäts-, Innovations- oder Risikomanagement kennen. Es enthält die Analyse von Chancen und Risiken, die Definition von Indikatoren für einen Soll-Zustand, das Festlegen von Zielen, das Entwickeln und Umsetzen von geeigneten Maßnahmen zu ihrer Erreichung und natürlich die regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung und das Ableiten neuer Maßnahmen.
Unabhängig davon, was Unternehmen für sich als wesentlich und damit als relevant für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung definieren, werden sie ein solches Prozessmanagement benötigen. Die gute Nachricht: Das ist ein geübtes Verfahren und lässt sich vielfach problemlos in die bestehenden Standards des Prozessmanagements integrieren. Es entspricht dem bekannten PDCA-Zyklus des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und bewegt sich methodisch auf bekanntem Terrain. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die Kommission über die Berichtspflichten de facto ein solches Prozessmanagement einfordert.
Bemerkenswert ist auch, welch große Bedeutung die Wesentlichkeitsanalyse zumal in Kombination mit den Stakeholderdialogen erfährt. Sie wird das wichtigste Instrument sein, mit dem ein Unternehmen seine Nachhaltigkeitsaktivitäten priorisiert. Sie bildet daher die Grundlage für die Strategieentwicklung. Dass die Kommission dafür derart dezidierte methodische Vorgaben macht, ist beachtlich. Schon die vorliegenden Aussagen zur doppelten Materialität hinsichtlich externer (ökologischer und sozialer) Auswirkungen und interner (finanzieller) Wirkungen verbunden mit dem Bewertungsmaßstab nach Umfang, Reichweite und Irreversibilität zeigen, dass es sich dabei um ein komplexes Instrument handeln wird.
Dass zukünftig ein Thema als relevant betrachtet werden muss, wenn es entweder aus der inside-out- oder der outside-in-Perspektive in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens steht – und nicht mehr nur, wenn beide Perspektiven gegeben sind -, wird es künftig erschweren, Themen als nicht wesentlich zu betrachten.
In unserer Beratung erleben wir, dass sich insbesondere inhaltlich weniger ambitionierte Unternehmen, die bislang auch nur wenig datengetriebenes Prozessmanagement betreiben, mit den Anforderungen schwertun. Sie müssen nicht nur von der Sinnhaftigkeit des Themas, sondern auch von der Notwendigkeit eines systematischen Prozessmanagements überzeugt werden. Wir befürchten, dass sie die abgeschwächten Berichtsstandards und die daraus entstehenden Berichtslücken ausnutzen werden, um in ihrer Komfortzone zu bleiben. Der methodische Rahmen, so hilfreich er auch sein kann, würde dann eher als zusätzliches Argument unter dem Stichwort “Bürokratisierung” genutzt. Ihnen raten wir, die Chance durch die gestiegenen Transparenzanforderungen für eine Weiterentwicklung ihrer Management-Methodik zu nutzen.
Unternehmen, die bereits datengetrieben operieren und über ein entsprechendes Prozessmanagement verfügen, werden sich bei der Adaption der ESRS leichter tun. Sie werden zumindest auf Management-Ebene ESG-Anforderungen schneller integrieren. Für sie liegt die Herausforderung eher auf der inhaltlichen Ebene: ESG-Kompetenzen müssen in alle Geschäftsprozesse integriert und Geschäftsmodelle angepasst werden. Ihnen kann dabei ein systematisches und langfristiges Change Management helfen: Mit seinem gut orchestrierten Mix von Maßnahmen aus Kommunikation, Partizipation und Qualifikation bietet es den notwendigen Werkzeugkasten.
Die EU-Regulierungsbemühungen müssen sich – so wie die Aktivitäten der Unternehmen – im Sinne einer Wirkungsorientierung am Ende daran messen lassen, inwiefern sie tatsächlich zu einer ökologischen und sozialen Transformation beitragen. Die Berichtsstandards sind nur ein Puzzlestück. Die Sorgen um deren inhaltliche Verwässerung sind berechtigt. Mit ihren Vorgaben zur Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsmanagements können sie jedoch eine gute methodische Weiterentwicklung anstoßen, auf die sich Unternehmen frühzeitig einstellen sollten.
Hilke Posor und Thomas Leppert sind geschäftsführende Gesellschafterin und Gesellschafter der Heldenrat GmbH, einem Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltigem Wirtschaften und sektorübergreifenden Kompetenztransfer in Hamburg.

Mathematiker und Musiker haben es gut. Zwar mag es nicht leicht sein, ihre Profession zu erlernen. Aber wenn man den Stoff einmal drauf hat, kann man sich global verständig machen. Zahlen und Noten bedeuten überall das gleiche. Weltweit. Mit der Nachhaltigkeit funktioniert das nicht. Sie wird, sehr häufig, auf unterschiedliche Weise interpretiert.
Emmanuel Faber möchte das ändern. Er will eine gemeinsame Sprache für Unternehmen etablieren, damit man zuverlässig und über Branchen hinweg erkennen kann, ob sich sie zu grünen, klimafreundlichen Firmen entwickeln. Und das ebenfalls: weltweit. “Wir brauchen eine gemeinsame Sprache”, sagt er, es brauche eine “globale Baseline”.
Der 59-Jährige ist Vorsitzender des mit 14 Mitgliedern besetzten International Sustainability Standards Boards (ISSB), das auf der Klimakonferenz in Glasgow vor knapp zwei Jahren gegründet wurde. Das Board ist Teil der IFRS-Stiftung in London – der es schon einmal gelungen ist, Regeln zu setzen. Ihr International Accounting Standards Board (IASB) war maßgeblich daran beteiligt, die heutigen Normen für die finanzielle Bilanzierung festzulegen. Nun soll das auch bei Fragen zu Umwelt, Gesellschaft und Klima klappen.
Dass die Wahl auf Faber fiel beim Aufbau des ISSB, ist kein Zufall. Der Franzose, der aus Grenoble stammt, hat vergleichsweise früh in seiner vorigen Karriere als Topmanager und Chef von Danone auf Nachhaltigkeit gesetzt. Schon vor Jahren sprach er von einer “Revolution”, derer sich Unternehmen anschließen müssten; in seinem Lebensmittelkonzern hatte er erkannt, dass sich die Kundinnen und Kunden zunehmend bewusst, gesund und regional ernähren wollten.
Fortan forderte er von Landwirten in den USA, bei Futtermitteln auf genveränderten Mais zu verzichten. Er schloss mit französischen Viehbauern langfristige Verträge ab, strebte eine klimaneutrale Abfüllung von Evian an und kooperierte mit Nobelpreisträger Muhammed Yunus. Das Ziel: eine Joghurtfabrik in Bangladesch, die nach den Prinzipien eines Social Business funktionieren und Mangelernährung bekämpfen sollte.
Andererseits fällt seine Bilanz nach den sieben Jahren an der Spitze von Danone zwiespältig aus. Denn Faber ordnete nicht alles den Stakeholdern unter. Um die Rendite zu steigern, forcierte er gegen interne Widerstände Rationalisierungen, insbesondere nach den Verlusten durch die Corona-Pandemie. Weil Restaurants lange keine Gäste empfangen durften, brach der Umsatz mit Wasser bei Danone ein. In der Folge strich Faber 2000 Stellen, verkaufte kleinere Marken und optimierte die Prozesse weiter. Ihm persönlich half das wenig. Im Frühjahr 2021 wurde er abberufen, weil die Konkurrenz dem Unternehmen davoneilte.
In seiner neuen Funktion führt er die Geschäfte von Frankfurt am Main aus. Er steht weniger im Rampenlicht als zuvor. Dafür ist seine Aufgabe vielleicht noch anspruchsvoller. Und Konkurrenz hat er auch. Die Europäische Union strebt für den Beginn des kommenden Jahres neue Richtlinien beim Nachhaltigkeitsreporting an, in den USA will die Börsenaufsicht Unternehmen zu Umweltrisiken berichten lassen. Dem gegenüber stehen die Konservativen, die jegliche ESG-Einmischung ablehnen und immer mehr Einfluss gewinnen. Kann er mit dem ISSB erfolgreich sein? Faber glaubt daran. “Keine Frage, ESG ist zwischen die Fronten der Auseinandersetzung geraten”, sagte er kürzlich dem “Manager Magazin”. “Aber es besteht ein großer Bedarf des Marktes an qualitativ hochwertigen Informationen, anhand derer Investoren Chancen und Risiken einschätzen können.” Und weiter: “Kann sich die Politik wirklich gegen die Interessen des Marktes stellen? Daran glaube ich nicht.”
2025 sollen die ersten Berichte nach ISSB-Format veröffentlicht werden, so plant Faber es momentan. Die würden dann auf das vorige Geschäftsjahr zurückblicken. Abzuwarten bleibt allerdings, ob die Regulierer und Unternehmen weltweit bereit dafür sind, ESG-Komplexe in einer einheitlichen Sprache zu verhandeln und darzustellen. Und ob sie möchten, dass Emmanuel Faber mit seinem ISSB-Team derjenige ist, der die dafür notwendigen Vokabeln und die Grammatik vorgibt. Marc Winkelmann
die Entscheidungen von Politikern können entscheidend beeinflussen, ob die ökologische Transformation der Wirtschaft sich beschleunigt oder verlangsamt. Das zeigt sich dieser Tage deutlich: Eigentlich plant Großbritannien seine Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren. Aber, wie wir berichteten, will der konservative Premier Sunak über hundert neue Lizenzen an Unternehmen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee vergeben. Ein Rückschritt.
Ganz anders die Entwicklung in Brasilien: In den ersten sieben Monaten der Amtszeit von Präsident Lula nahm die Abholzung im Amazonas-Regenwald um 47 Prozent auf 3.000 Quadratkilometer ab. Unter seinem Vorgänger Bolsonaro hatte sie zugenommen. Nun will Lula sogar bei einer Konferenz in seinem Land die Regierungen Südamerikas zu einer gemeinsamen Regenwaldpolitik bewegen. Seit Dienstag beraten sie.
Wichtig sind Signale aus der Politik auch dafür, ob sich Unternehmen auf die Transformation einlassen. Damit beschäftigt sich Annette Mühlberger mit Blick auf die Umsetzung des LkSG bei den Unternehmen Kärcher und Körber. Was Unternehmen aus Überzeugung selbst leisten können, zeigt Christiane Keppel anhand des US-Teppichherstellers und Kreislaufpioniers Interface, der aber nur eine geringe Recyclingquote hat. Helfen könnte nach Ansicht von Experten die Politik. Sie ist auch mit neuen Problemen durch den technologischen Wandel konfrontiert, denn die KI-Industrie agiert nach ersten Einschätzungen extraktiv, darüber schreibt Marc Winkelmann.
Gestatten Sie uns bitte noch einen Glückwunsch in eigener Sache: Gestern Morgen um sechs Uhr ist bei Table.Media die 500. Ausgabe des Europe.Table erschienen. Fünfhundert Briefings, vollgepackt mit News zur europäischen Politik in Brüssel und tiefgründigen Analysen der EU-Gesetze und -Verordnungen. An (fast) jedem Werktag seit dem 3. August 2021 liefert das Team um Till Hoppe Aktualität, Relevanz und journalistische Qualität. Hier geht es zum kostenfreien Test.


Seit Anfang des Jahres müssen größere Firmen ihre Lieferkette im Rahmen des LkSG überwachen. Kärcher setzt auf ein etabliertes Risikosystem. Körber verknüpft die Sorgfaltspflicht mit der Klimatransformation.
Im Dezember endet das Berichtsjahr zur gesetzlichen Sorgfaltspflicht größerer Unternehmen. Jetzt, da das erste Halbjahr 2023 vorbei ist, zeigt sich: Firmen, die ihr Liefernetzwerk schon im Vorfeld durchleuchtet hatten oder die Sorgfaltspflicht mit Fragen der Transformation verknüpfen, hilft das LkSG beim Ausbau nachhaltiger Beschaffungsstrategien.
Kärcher (3,16 Milliarden Euro Umsatz, 15.330 Mitarbeitende) ist eines der großen deutschen Familienunternehmen. Produziert wird an 18 Standorten in neun Ländern. Die meisten Bauteile für die weltweit verkauften Reinigungsgeräte kommen von Zulieferern. 6.000 Firmen sind das. Hinzu kommen 20.000 Unternehmen, die sogenanntes Nicht-Produktionsmaterial liefern (unter anderem Büro-, Arbeitsschutzmaterialien, Betriebsmittel, IT). 2021, mitten in der Lieferkrise, registrierte der Einkauf 11.642 Lieferschwierigkeiten, so viele wie nie zuvor. Dass Kärcher diese Zahl so genau kennt, liegt auch an der Künstlichen Intelligenz, mit der das Unternehmen seine Lieferketten nach Auffälligkeiten durchforstet. Die gleiche KI nutzt Kärcher nun, um die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette zu überwachen: “Wir haben die mit dem LkSG verbundenen Anforderungen wie Selbstauskunft, Audits und Abhilfemaßnahmen an unser vorhandenes Risikosystem angedockt”, sagt Einkaufsleiter Heiko Braitmaier.
Die Informationen, die die KI des Anbieters Prewave auswertet und mit den Daten der Zulieferer verknüpft, stammen aus einem weltweiten Social Media- und News-Screening sowie aus Datenbanken zu Länder- und Industrierisiken. Die Überwachung von Lieferrisiken und der Einhaltung der Menschenrechte in einem Tool begründet Braitmaier so: “Beide Risiken brauchen Regelprozesse, von der Analyse, über das Tracking bis zu definierten Maßnahmenplänen.” Die Warnungen überprüft der Einkauf jeweils auf Plausibilität und leitet, so sich ein Verdacht bestätigt, auch Maßnahmen ein. Diese hat Kärcher fest definiert: Je nach Vorfall, Einflussmöglichkeiten und Risikokategorie sind etwa Online-Audits, Schulungen und Vor-Ort-Audits vorgesehen.
Risikosysteme brauchen eine gute Datenbasis: “Die Grundlagen hierfür muss man auch im eigenen Unternehmen schaffen”, mahnt Braitmaier und meint damit etwa das Zusammenführen zehntausender Lieferantendaten zu einem eindeutigen Stammdatensatz. Einen solchen “Golden Record” zu erstellen, ist für Unternehmen oft mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Zum Beispiel, weil Geschäftsbereiche gesondert einkaufen, Lieferanten in Warenwirtschaftssystemen mehrfach angelegt sind oder es in einer Firmengruppe mehrere Enterprise Resource Planning-Systeme gibt.
Kärcher analysiert auch die Vorstufen seiner Lieferkette und ermittelt diese aus öffentlich verfügbaren Frachtdaten. Auch die Einkäuferinnen und Einkäufer kennen Vorlieferanten. Die Daten hat Kärcher zusammengeführt. Und das Unternehmen hat sich mit der Thematik bereits frühzeitig befasst. “Dass wir uns schon im Vorfeld um Transparenz in der Lieferkette bemüht haben, war für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes ein großer Vorteil”, sagt Braitmaier.
Der Hamburger Technologiekonzern Körber schaut sich seine Lieferbeziehungen seit einigen Jahren genauer an. Das Unternehmen (13.000 Mitarbeitende, 2,53 Milliarden Euro Umsatz) produziert Maschinen und Digitallösungen unter anderem für die Pharmabranche, Verpackungsindustrie und Logistikzentren. “Ausgabentransparenz ist der Startpunkt aller Einkaufsstrategien und Entscheidungen und damit der Ausgangspunkt für die Transformation”, sagt Michael Stietz, Executive Vice President Operations im Geschäftsfeld Technologies und verantwortlich für den Einkauf. Rund 10.000 Firmen beliefern das Unternehmen. Die Ausgaben (wer kauft welche Materialien in welcher Menge bei wem) analysiert der Konzern für die Tochtergesellschaften zentral. Alle Einkäufer haben Zugriff auf ein System, über das sich die Lieferanten zunächst registrieren und wichtige Informationen wie Zertifikate zu Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen hochladen. “Wir schicken keine Exceldateien und PDFs mehr hin und her”, erklärt Stietz den Vorteil der zentralen Lieferantendossiers, die auf diese Weise entstehen.
Seit 2023 fließen dort hinein auch die Selbstauskünfte der Lieferanten im Rahmen des LkSG. Diese Befragung läuft über die Plattform Integrity Next, die die Daten an Körber weitergibt. Lieferanten, die bei Integrity Next bereits eine aktuelle Bewertung haben, müssen die Fragen nicht mehr beantworten. Alle anderen müssen sich registrieren und den Fragebogen ausfüllen. Auch die Treibhausgas-Emissionen (Company- und Product Carbon Footprints) werden in den Lieferantendossiers gesammelt.
Die Informationen aus den Dossiers (dazu gehören auch Informationen zur Zusammenarbeit und Lieferfähigkeit) spielen für die Ausgestaltung der Lieferkette eine große Rolle: “Das ist ein mehrstufiger Prozess”, sagt Stietz. Im ersten Schritt entscheide der Einkauf darüber, ob eine Firma als Lieferpartner überhaupt infrage komme. Im nächsten flössen die Informationen in die kontinuierliche Lieferantenbewertung, die wiederum entscheidend für die Vergaben sei.
Auf Lieferanten-Tagen und in persönlichen Gesprächen hat der Einkauf mit den Zulieferern nun sowohl die Anforderungen des Lieferkettengesetzes als auch jene der Klimaziele besprochen. “Die Transformation braucht eine enge Kommunikation und Begleitung”, sagt Stietz. Mit der Verknüpfung beider Themen habe man die Veränderung verdeutlichen wollen: Neben Qualität, Timing, Innovation und Preis sei Nachhaltigkeit das entscheidende Vergabekriterium, sagt der Einkaufsmanager.
Die Lieferantenstruktur beschreibt er als zweigeteilt. Auf der einen Seite die Großkonzerne. Dort seien beide Themen omnipräsent und man müsse sich nicht über Grundlagen austauschen. Auf der anderen Seite der kleinere Mittelstand: Dort geht es darum, mit den Inhabern zu sprechen, Awareness zu schaffen und Hilfe anzubieten. “Insbesondere beim Klimaschutz wird die Transformation ein gemeinsamer Weg über viele Jahre werden”, meint Stietz.

Seit 50 Jahren verkauft Interface seine Teppichfliesen an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die grüne Mission startet 1994. Der Sinneswandel basiert der Legende nach auf einer Kundenfrage, die Gründer Ray Anderson aufhorchen ließ: Was sein Unternehmen eigentlich für die Umwelt tue? So implementiert Anderson, der 2011 starb, 1995 das Rücknahmeprogramm “ReEntry” mit dem Ziel, genutzte Teppiche von Kunden zurückzunehmen, zu recyceln oder wiederzuverwenden und dadurch zu verhindern, dass die Produkte zu Müll werden. Im Jahr 2000 ruft Interface die Strategie “Mission Zero” aus: Bis 2020 will das Unternehmen klima- und umweltneutral sein.
2015 erreicht es einen Teil des Ziels. Interface ist klimaneutral, allerdings dank Kompensationen: “Sie dienen nur als Brücke”, sagt Ruth Prinzmeier, Sustainability Managerin für die DACH-Region bei Interface Deutschland. Künftig will sie ohne Kompensationen auskommen und bis 2040 zu einem CO₂-negativen Unternehmen zu werden. So ist es in der neuen Strategie (“Climate Take Back”) festgelegt. Bis 2030 will die Firma im Vergleich zu 2019 folgende Zwischenschritte erreichen:
Ein Baustein dieses Wegs sind die Teppichfliesen der Produktlinie “Embodied Beauty”. Interface fertigt sie unter anderem aus Kohlenstoff, was dazu führt, dass sie unterm Strich über ihren gesamten Produktionsprozess betrachtet CO₂-negativ sind. An seine Grenzen stößt Interface hingegen, wenn es darum geht, seine Produkte konsequent der Wiederverwendung und dem Recycling zuzuführen.
Interface nimmt deutlich weniger Teppiche über ReEntry zurück, als das Unternehmen produziert. 2015 waren es laut der Deutschen Umwelthilfe 900 Tonnen und damit lediglich 1,5 Prozent der im selben Jahr verkauften Menge. Auch 2021 nahm Interface gerade einmal 3.050 Tonnen über ReEntry zurück. Die Herausforderung: Interface kann nur wiederverwenden und recyclen, was Kunden und andere Branchenteilnehmer den vorgesehenen Prozessen des freiwilligen Rücknahmesystems ReEntry zuführen. Die Kunden müssen die Rücknahme einplanen: Interface kontaktieren, die Teppichfliesen ausbauen und auf Paletten laden, die das Unternehmen schließlich abholt und dem Kreislauf zuführt.
Recyclingfähiges Material ist in der Baubranche allerdings immer noch eine Ausnahme. Die wenigsten Kunden planen das Recycling bei einem Umbau oder Abriss ein. “Dann hängt es von einzelnen Mitarbeitenden ab, die um die Rückgabe bei Interface wissen”, so Prinzmeier. Wenn diese zwischenzeitlich das Unternehmen verlassen hätten, gehe das Wissen um die Wiederverwertbarkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren. Die Lösung sieht Prinzmeier deshalb im koordinierten, branchenweiten Vorgehen, beispielsweise in digitalen Zwillingen für Gebäude: “Dort könnten Verantwortliche bei der Planung auf einen Blick sehen, welche Materialien verbaut sind, was wiederverwendbar ist und entsprechenden Prozessen zugeführt werden kann.”
Laut Henning Wilts, Experte für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, sind Datenökonomie, Digitalisierung und staatliche Rahmenbedingungen maßgeblich für eine gelingende Kreislaufwirtschaft: “Wir benötigen Branchenlösungen, wie etwa digitale Zwillinge von Gebäuden, die mit verpflichtenden Rückbaukonzepten verknüpft sein sollten.” Regulatorische Vorgaben sowie die Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle könnten die entscheidenden Stellschrauben für das Gelingen der Kreislaufwirtschaft sein. “Unsere Wirtschaft funktioniert nach der Kaufen-Nutzen-Entsorgen-Logik”, so Wilts. Für Unternehmen, die reparaturfähige und wiederverwendbare Produkte mit langer Lebensdauer anböten, sei es schwierig, konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Firmen hätten oft hohe Transaktionskosten zu bewältigen, etwa durch rechtliche Unsicherheiten oder komplexe Prozesse. Kunden wiederum erkennen vor allem den höheren Kaufpreis, nicht aber die Recycel- und Kreislauffähigkeit der Produkte.
Wie eine bessere Kennzeichnung aussieht, könnten sich Politiker in Frankreich abschauen: “Dort sind Produkte mit einer Skala von eins bis zehn ausgezeichnet, die sich auf den Anteil der verarbeiteten recycelten Rohstoffe bezieht”, so Wilts. Vielversprechende regulatorische Ansätze sehen sowohl Prinzmeier als auch Wilts auf EU-Ebene: Die EU-Taxonomie definiert die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft als eines von sechs Umwelt- und Klimazielen. Allein, es fehlt bisher der Kriterienkatalog. Auch die Europäische Kommission arbeitet an einem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Prinzmeier beobachtet, dass der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit da ist. “Doch wenn die Umsetzung zu aufwendig ist, fällt die Entscheidung in der Praxis trotzdem oft gegen die nachhaltige Lösung.” Deshalb brauche es gesetzliche Rahmenbedingungen, die Produzenten branchenweit zu Rückgabe- oder Pfandsystemen verpflichten: “Damit das Recyceln zur Gewohnheit wird und nicht länger die Ausnahme bleibt”, sagt Prinzmeier. Christina Keppel
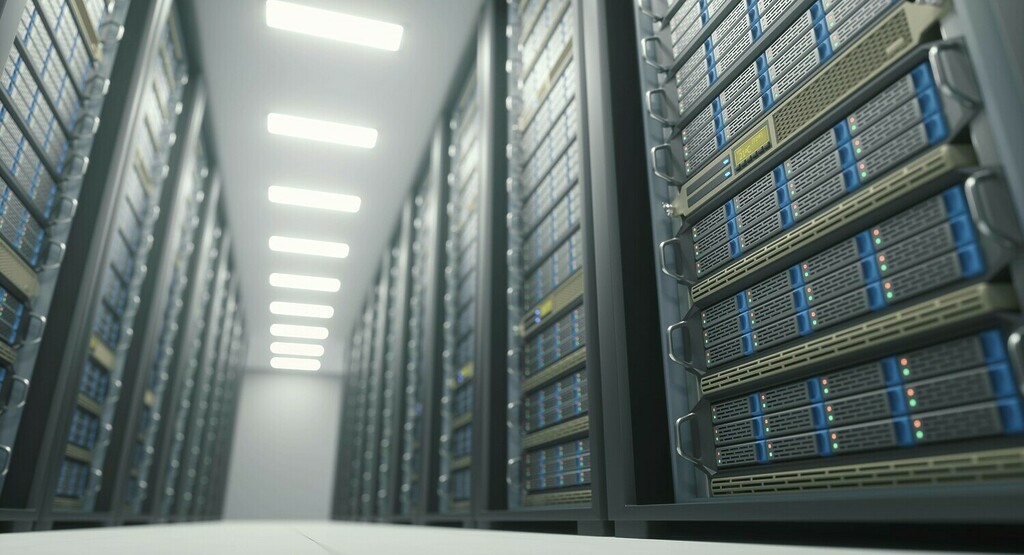
Im Museum of Modern Art in Manhattan hängt in Raum 216 im zweiten Stock eine Infografik. “Anatomy of an AI System” heißt die Arbeit und sie zeigt, was es braucht, um den “smarten” Lautsprecher “Amazon Echo” zum Leben zu erwecken. Es ist eine Landkarte der Inhaltsstoffe einer Künstlichen Intelligenz: Es geht um geologische Erdprozesse und die Gewinnung der Rohstoffe, um die Herstellung von Chips, die Löhne der beteiligten Arbeiter, das Training des Systems mit Daten, die Entsorgung ausrangierter Geräte.
Bis vor ein paar Jahren waren Ökobilanzen, sogenannte “Life Cycle Assessments” (LCA), die ein Produkt von der Wiege bis zur Bahre ausleuchten, nur etwas für Forschungslabore. Das ist vorbei. Im Zuge der globalen Nachhaltigkeitsziele und der Klimakrise geraten sie immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Selbst in Museen sind sie schon angekommen.
Während es mittlerweile aber präzise Daten über die öko-sozialen Folgen einer Jeans oder eines Flugs gibt, sind die Erkenntnisse zu Künstlicher Intelligenz noch gering. Das hat mehrere Gründe: Rechenzentren und Tech-Firmen wie Microsoft, Amazon, Meta und ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlichen kaum Zahlen, Unternehmen und Forscher messen mit verschiedenen Methoden und im globalen Material-, Daten- und Energiestrom fällt es schwer, KI-Anwendungen voneinander abzugrenzen. Zudem entwickelt sich die Technologie dynamisch. Angaben zum Stromverbrauch können bereits nach kurzer Zeit veraltet sein, weil sie Effizienzgewinne neuerer Geräte nicht berücksichtigen.
Das, was bekannt ist, lässt Experten – Stand jetzt – zu einem eher pessimistischen Zwischenfazit kommen. “KI-Systeme können ernsthafte Konsequenzen für die Umwelt haben”, heißt es im “AI Index Report 2023”, dem alljährlich viel beachteten Trendbericht der Stanford University.
Zwar kann durch das gewählte Design und die Infrastruktur Einfluss auf das Ergebnis genommen werden. Währung die Trainingsläufe von GPT-3 beispielsweise, einem ChatGPT-Vorläufer, der mit 175 Milliarden Parametern entwickelt wurde – darunter versteht man die Verbindungen von künstlichen Neuronen untereinander -, 502 Tonnen CO₂ produzierte, verursachte das Open-Source-Sprachmodell “Bloom” mit 176 Milliarden Parametern nur 25 Tonnen CO₂.
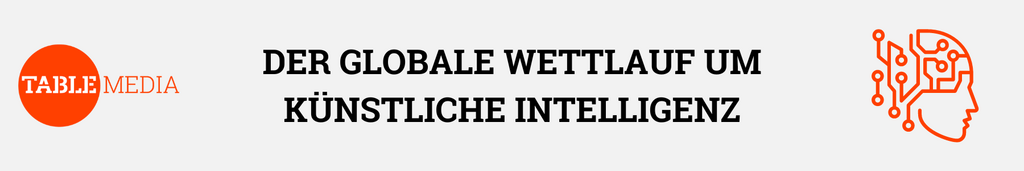
Befürchtet wird aber, dass die Zahlen steigen. Beflügelt durch das Interesse an der Ende November 2022 veröffentlichen Plattform ChatGPT ist die Branche im Rausch. Die Zahl der eingesetzten Trainingsdaten und daraus resultierenden Rechenoperationen wachsen exponentiell, immer mehr Unternehmen programmieren KI-Anwendungen für Smartphone-Apps, Computer oder Fahrzeuge – und Unternehmen und Endverbraucher nutzen diese täglich millionen- oder gar milliardenfach.
Rund 700 Millionen Tonnen CO₂ produzierte der globale Informations- und Telekommunikationssektor 2020. Das entsprach einem Anteil von 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Verkehrs- oder Bausektor nimmt sich das bescheiden aus. Durch KI wird es dabei wahrscheinlich aber nicht bleiben. Sasha Luccioni, die bei dem US-Unternehmen Hugging Face an der Schnittstelle von Klimawandel und KI arbeitet, sagt: “Meine Forschung zeigt, dass die neuen Generationen von Sprachmodellen tausende Mal mehr Kohlendioxid verursachen als vorige Generationen.”
Eine weitere Herausforderung, die angesichts steigender Hitze und sinkender Grundwasserspiegel drängend wird, ist der Wasserfußabdruck. Der University of California, Riverside, zufolge verbrauchen 20 bis 50 Anfragen bei ChatGPT etwa einen halben Liter Wasser. Benötigt wird es in zwei miteinander verbundenen Prozessen: Erstens dient es dazu, Kraftwerke zu kühlen, die Strom erzeugen – zweitens muss es eingesetzt werden, um Datenzentren zu kühlen, die mit dem zuvor produzierten Strom ihre Rechner betreiben. 30 Prozent aller Rechenzentren stehen in den USA, allein Googles Einrichtungen verbrauchten 2021 fast 13 Milliarden Liter Frischwasser. Und der Bestand wächst weiter: Zwischen 2017 und 2022 nahm die Zahl der Server weltweit um mehr als 37 Prozent zu, auf 85,6 Milliarden Einheiten.
Die Unternehmen rühmen sich zum Teil, Verantwortung zu übernehmen. Hersteller Nvidia erklärte, selbstlernende KI-Modelle dafür einzusetzen, die Produktion seiner Chips, die essenziell für Künstliche Intelligenz sind, energiesparender zu machen. Google gab an, sein Sprachmodell “PaLM” über ein Rechenzentrum in Oklahoma trainiert zu haben, das durch erneuerbare Energien zu 89 Prozent CO₂-frei sei. Das ist bislang aber eine Ausnahme. Weltweit betrachtet nutzt die Mehrheit der KI-Entwickler fossile Energienetze.
Die Wissenschaftlerin Kate Crawford sagt, dass Künstliche Intelligenz angesichts der zahlreichen Probleme, die die Technologie aufwirft, weder als künstlich noch als intelligent zu bezeichnen sei. Die Australierin hat zusammen mit einem Künstler die im New Yorker MoMa ausgestellte Infografik entworfen und die KI-Landschaft auch in ihrem Buch “Atlas of AI” kartografiert. Darin macht sie – neben den Folgen für Natur und Umwelt – auch darauf aufmerksam, dass Menschen ausgebeutet werden. Etwa, indem sie zu Niedriglöhnen in “digital Sweatshops” im Akkord Rohdaten aufbereiten müssen, damit diese für Firmen wie OpenAI und deren Plattform ChatGPT als Trainingsdaten nutzbar werden.
Crawford bestreitet nicht, dass Künstliche Intelligenz die Medizin voranbringen, beim Aufbau “smarter” Energienetze helfen und autonome Fahrzeuge steuern kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass KI eine “extraktive Industrie” ist, wie sie schreibt, und das in vielerlei Hinsicht. Nachhaltig ist das bislang kaum.
Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.
Die Beauftragung von Felix Hartmann, Professor für Arbeitsrecht an der Freien Universität Berlin, für ein Gutachten zum Bundestariftreuegesetz durch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kritisieren Fachleute. Dieser vertrete eine “absolute Außenseiter- und Extremposition” unter Juristen, twitterte Thorsten Schulten, Forscher für Arbeits- und Tarifpolitik am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Andere Experten teilen seine Einschätzung. Hartmann kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass die von der Bundesregierung geplante Tariftreueregelung verfassungswidrig und zudem nicht mit EU-Recht vereinbar sei.
“Tarifzwangsregelungen greifen in die vom Grundgesetz geschützte Tarifautonomie ein”, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger bei der Vorstellung des Gutachtens. Anders sieht dies die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi: “Öffentliche Aufträge an eine Tariftreue zu binden, ist mit der Koalitionsfreiheit gedeckt.” Sie bezieht sich dabei auch auf eine Expertise des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wonach das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur Tarifbindung bei öffentlichen Bauaufträgen in Berlin von 2006 “die zuvor vielfach geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Tariftreueregelungen im Hinblick auf das Grundrecht der Koalitionsfreiheit” ausräumt.
Nach Plänen der Bundesregierung sollen nur noch Unternehmen öffentliche Aufträge des Bundes ab 10.000 Euro ausführen dürfen, die Ihren Beschäftigten etwa den Lohn zahlen, den ein repräsentativer Tarifvertrag vorgibt. Welcher für Unternehmen maßgeblich ist, will der Bund per Verordnung festlegen. Aus Kreisen der SPD-Bundestagsfraktion heißt es, dass inzwischen ein gemeinsamer Entwurf von Arbeits- und Wirtschaftsministerium vorliegt, der aktuell mit den anderen Ressorts abgestimmt wird. nh
Die Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie braucht Recyclingverfahren, die große Abfallmengen in kurzer Zeit prozesssicher in hochwertige Sekundärrohstoffe umwandeln. Eine Kooperation der Recyclingspezialisten Erema und Lindner will das Kunststoffrecycling im industriellen Maßstab jetzt ein ganzes Stück voranbringen.
Kunststoffrecycling braucht viele Verarbeitungsschritte. Dazu gehören Zerkleinern, Waschen, Trocknen, Extrudieren, Filtern, das sogenannte Compounding, das Kunststoffen spezielle Eigenschaften verleiht, und die Geruchsoptimierung. Eine Maschine, die alles kann, gibt es nicht: Die Kunststoffaufbereitung erfolgt in Recyclingunternehmen deshalb in Anlagen verschiedener Hersteller, die sich ihrerseits auf einzelne Verfahren spezialisiert haben. So ist Erema Markführer für Extruder und Filtermaschinen, Lindner Spezialist für Schredder und Waschanlagen.
In einem Gemeinschaftsunternehmen wollen sich die Branchenvorreiter nun darum kümmern, dass ihre bislang autark arbeitenden Maschinen miteinander kommunizieren, prozessübergreifend gesteuert und überwacht werden. Die Vernetzung soll Recyclingfirmen, die die Anlagen nutzen, einen höheren Durchsatz ermöglichen und die Qualität der Kunststoffrezyklate steigern. Der vernetzte Prozess soll außerdem weniger Energie verbrauchen.
Der Blick auf die gesamte Verarbeitungskette sei für eine funktionierende Recyclingwirtschaft entscheidend, erklärt Manfred Hackl, CEO der Erema Group in einer Firmenmitteilung: “Essenziell wird sein, dass die gesamte Prozess- bzw. Wertschöpfungskette – von der Abfallsammlung und Aufbereitung über das Recycling bis hin zum Kunststoffendprodukt – im Fokus der agierenden Unternehmen steht.” Der Hebel der Bündelung sei groß, man wolle das Kunststoffrecycling revolutionieren, meint Linder-Geschäftsführer Michael Lackner. In gemeinsamen Forschungsprojekten arbeiten die Unternehmen auch an Branchenstandards für das Kunststoffrecycling. am
Nach einer neuen Modellierung eines niederländischen Forschungsteams befindet sich deutlich mehr Plastikmüll in den Weltmeeren als gedacht: 3,2 Millionen Tonnen, meist große Partikel. Zwei Millionen Tonnen davon schwimmen auf der Oberfläche, ein Vielfaches früherer Schätzungen von etwa 0,3 Millionen Tonnen. Unerfasst ist bei der Studie das Plastik, welches sich bereits in den Sedimenten abgelagert hat.
Die Modellierung umfasst die Jahre 1980 bis 2020 und alle Weltmeere. Berücksichtigt wurden über 20.000 Messwerte auf der Meeresoberfläche, an Stränden und der Tiefsee. Die Studie erschien am Montag im Fachjournal Nature Geoscience.
Allerdings gelangt nach dieser Modellierung weniger neuer Plastikmüll in die Ozeane als angenommen: jährlich 0,5 Millionen Tonnen. Davon stamme die Hälfte aus der Fischerei, rund 40 Prozent gelange über Küsten in die Meere, der Rest über Flüsse.
In früheren Studien kamen Forscher zu wesentlich höheren Mengen an Plastikeinträgen. Laut einer einschlägigen Studie aus dem Jahr 2020 betragen sie in allen aquatischen Systemen (Flüsse, Seen und Meere) zusammen jährlich 19 bis 23 Millionen Tonnen. Eine andere Studie bezifferte die Plastikeinträge allein von Flüssen in Meere mit 0,8 bis 2,7 Millionen Tonnen. Die Diskrepanzen erklären sind dadurch, dass die Messung von Plastikeinträgen im Meer schwierig ist.
Das neue Modell “kann als erster Versuch betrachtet werden, den globalen Massenhaushalt von schwimmfähigem Kunststoff im Meer zu verstehen“, sagt die Umweltwissenschaftlerin Serena Abel von der Universität Basel. Obwohl zwei der häufigsten Polymere aus der Untersuchung ausgeklammert wurden (PVC und PET), die 35 bis 40 Prozent der in die Meeresumwelt gelangenden Masse ausmachen, spricht sie von einem “Meilenstein in der Erforschung der Plastikverschmutzung, den Verbleib und die Auswirkungen von Plastik im Meer auf globaler Ebene und nicht nur aus lokaler Perspektive zu untersuchen”.
Zu den Konsequenzen sagt die Meeresökologin Melanie Bergmann vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung: “Nach wie vor gilt, dass wir den Hahn zudrehen müssen, bevor wir aufwendig und teuer Plastik aus dem Meer fischen.” In allererster Linie müsse die “eskalierende Produktion” minimiert werden und das Design von Kunststoffen so verbessert werden, dass weniger und gesundheitlich unbedenkliche Chemikalien eingesetzt werden. “Erst dies ermöglicht die Kreislaufwirtschaft des wirklich notwendigen Plastiks.” cd
Die US-Regierung hat Anfang August ein Maßnahmenpaket vorgelegt, nach dem US-Bundesbehörden bei ihrer Beschaffung noch stärker auf den Umwelt- und Klimaschutz achten müssen. Ziel der Biden-Administration ist es, die Ausgaben der öffentlichen Hand auf Bundesebene bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen.
Die nun vorgelegte Sustainable Products and Services Procurement Rule soll bisherige Entscheidungsspielräume einschränken und Bundesbehörden dazu verpflichten, künftig möglichst nur noch Produkte und Dienstleistungen einzukaufen, die höchsten Nachhaltigkeitsstandards genügen.
Die Vorschläge wurden vom Council on Procurement Regulation erarbeitet, dem zwei leitende Beamte des Federal Procurement Office sowie je ein Vertreter des Verteidigungsministeriums, der NASA und der Bundesverwaltung angehören. Die US-Bundesbehörden verfügen über ein jährliches Budget von mehr als 630 Milliarden US-Dollar.
“Als größter Einkäufer der Welt haben wir die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Umstellung auf saubere Produkte zu beschleunigen”, sagte Robin Carnahan, der für die Bundesverwaltung im Regulierungsrat sitzt.
Laut US-Regierung enthält bereits ein Drittel ihrer Verträge Nachhaltigkeitsklauseln. Grundlage dafür sind Spezifikationen, Standards und Umweltzeichen der US-Umweltschutzbehörde EPA – etwa der Energy Star für energiesparende Geräte, Baumaterialien und Gebäude oder das Water Sense Label für wassereffiziente Produkte.
“Durch die Förderung nachhaltiger Beschaffung auf Bundesebene profitieren Verbraucher von Waren und Dienstleistungen, die sicherer für ihre Familien und unseren Planeten sind”, sagte EPA-Direktor Michael Regan. Er kündigte an, die EPA-Empfehlungen zu überarbeiten und auf weitere Produkte und Branchen wie das Gesundheitswesen oder die Textilindustrie auszudehnen.
Die Vereinigten Staaten rühmen sich, schon jetzt weltweit führend im Bereich der nachhaltigen Beschaffung zu sein und als Vorbild zu dienen. So hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) den USA kürzlich als bisher einzigem Land den “höchstmöglichen Status” für nachhaltige Beschaffung zuerkannt.
Über die neuen Beschaffungsregeln wird nach einer Konsultationsphase von 60 Tagen entschieden. In der Zwischenzeit können Zivilgesellschaft und Wirtschaft Änderungs- und Ergänzungsvorschläge machen. ch
Die Verbände der deutschen Entsorgungswirtschaft erneuerten anlässlich des Inkrafttretens der deutschen Ersatzbaustoffverordnung vergangene Woche ihre Forderung nach verschärften Regeln für das Abfallende von Ersatzbaustoffen sowie für die öffentliche Beschaffung vorzugeben. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE), die Bundesvereinigung Recyclingbaustoffe (BRB) und die Interessengemeinschaft der Aufbereiter und Verwerter von Müllverbrennungsschlacken (IGAM) forderten in einer gemeinsamen Presseerklärung eine zeitnahe Überarbeitung der Verordnung.
Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist am 1. August in Kraft getreten und regelt die Herstellung und den Ersatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßen-, Erd- und Tiefbau. Die Vorgaben wurden 15 Jahre lang erarbeitet, danach galt eine zweijährige Übergangsfrist.
Ein möglicherweise etwas holpriger Start sei mit Blick auf die Komplexität des Verordnungstextes auch trotz der guten Vorarbeit nicht ganz zu vermeiden, erklärte BDE-Präsident Peter Kurth. Die Verbände bedauern, dass die bereits kürzlich beschlossene erste Novelle nicht genutzt worden sei, “um die EBV in für die Praxis entscheidenden Punkten auszubessern”.
Man unterstütze die Pläne des Bundesumweltministeriums, eine gesonderte “Abfallende-Verordnung” noch im Laufe dieser Legislatur zu erarbeiten, erklärte Kurth. Damit soll das Ende der Abfalleigenschaft bestimmter mineralischer Ersatzbaustoffe geregelt werden. Die “ordnungsgemäße Herstellung, Güteüberwachung und Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe” gemäß der EBV führe nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. “Eine Abfallende-Verordnung, die nur einen Teil der Materialklassen der EBV abdeckt, ist somit nicht sinngemäß und würde dem wichtigen Ziel einer nachhaltigen Kreislaufführung in der Bauwirtschaft nicht gerecht werden”, so der BDE-Präsident. leo
Die Jury hat entschieden: Der diesjährige Lean and Green Management Award in der Kategorie Automotive geht an den VW-Standort Kariega in Südafrika. In dem 1951 errichteten Werk produzieren mehr als 3.500 Beschäftigte Pkw-Motoren und verschiedene Modelle des VW Polo.
In der Kategorie Industrie entschied sich die Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien für den Produktionsstandort der TE Connectivity GmbH in Wört/Dinkelsbühl. Das weltweit tätige Unternehmen stellt Verbindungs- und Sensorprodukte her.
Das Thema Nachhaltigkeit werde für alle Unternehmen, unabhängig vom jeweiligen Industriezweig, zu einer zunehmenden Herausforderung, so die Ausschreibung des Awards. “Daher gilt es vermehrt in die Green Transformation zu investieren und diese mit der bereits in vielen Unternehmen etablierten Lean-Philosophie zu verknüpfen”, heißt es im Text weiter. “Durch Lean Exzellenz meistern wir die grüne Transformation”, ist Daniel Reichert, Leiter des Bereichs Lean & Green bei T&O, überzeugt.
Die diesjährige Sonderpreise für Excellence in Value Stream Management gingen an das Werk Nazarje in Slowenien der BSH Hausgeräte GmbH und für Excellence in Strategy an den Standort Ochsenhausen der Südpack GmbH & Co. KG.
Der Preis, der seit 2012 jährlich von der Münchner T&O Unternehmensberatung vergeben wird, zeichnet Standorte von Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit mindestens 150 Mitarbeitern aus, die erfolgreich betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien mit schlanken Produktionsprozessen verbinden.
Teil des Entscheidungsprozesses ist ein Assessment durch Experten von T&O. Wissenschaftlich begleitet wird der Award von der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Die Preisverleihung findet am 19. Oktober 2023 im Rahmen des Lean and Green Summit in Pfronten beim Werkzeugmaschinenhersteller und Vorjahressieger DMG Mori statt. ch
Südamerikas Staatschefs zur großen Regenwaldkonferenz zusammen – NZZ
Brasiliens Präsident Lula da Silva kann deutliche Fortschritte beim Schutz des Regenwaldes vermelden, schreibt Alexander Busch. Während die Rodung des Regenwalds unter seinem rechtspopulistischen Vorgänger dramatisch zugenommen hatte, war in den sieben Monaten seiner Amtszeit ein Rückgang um 47 Prozent zu verzeichnen. Mit Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru und Venezuela soll zudem der Amazonaspakt von 1978 wieder belebt werden. Das Signal an den Westen: Südamerika kümmert sich selbst. Zum Artikel
Rebranding ESG won’t save it from its internal contradictions – Financial Times
Stuart Kirk schreibt über Widersprüche bei EG-Investitionen. Dazu zählen für ihn die Folgen sich verändernder Normen, die Arbitrage zwischen den drei Zielen E-S-G oder Ungleichheiten in der Behandlung von Unternehmen. Da gebe es große Anstrengungen, um Tabakunternehmen aus Portfolios auszuschließen, aber keine für den Ausschluss von Lebensmittelunternehmen, welche unsere Nahrungsmittel mit Salz, Zucker und Fett überladen würden. Zum Artikel
How to manage the green backlash – Financial Times
Regierungen brauchten bessere Strategien, um die Kosten der Klimatransformation zu handhaben, kommentiert die FT. Sie lernten gerade, dass öffentliche Unterstützung für grüne Anliegen nicht umsonst zu haben sei. Die Zeitung zitiert einen Demonstranten aus der französischen Gelbwestenbewegung, der 2018 sagte: “Die Eliten reden über das Ende der Welt, aber wir reden über das Ende des Monats.” Zum Artikel
The fight for the right to repair – Financial Times
Bürger sollten sich für bessere und länger haltbare Technik einsetzen, kommentiert Camilla Cavendish. Denn es brauche mehr Transparenz mit Blick auf Effizienz und Lebensdauer über den Produktzyklus, Zehnjahres- statt Zweijahresgarantien, vereinheitlichte Stecker und Kabel. Zudem sollte jedes Land das französische Gesetz gegen geplante Obsoleszenz übernehmen, kommentiert sie. Zum Artikel
Der Kampf gegen Verpackungsmüll wird zur Lobbyschlacht – Süddeutsche Zeitung
Jan Diesteldorf beschreibt die Überlegungen der EU für Verpackungen als eine “revolutionäre Müll-Reform”. Darüber sei die Industrie entsetzt. Denn seit der Verpackungsverordnung geh es nicht mehr nur um Endverbraucher, sondern auch die großen Mengen an gewerblichen Verpackungen. Zum Artikel
Morgan Stanley Reaches 70% of $1 Trillion ESG Funding Goal – Bloomberg
Morgan Stanley hat nach eigenen Angaben mehr als zwei Drittel des Weges zu seinem Ziel zurückgelegt, bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von einer Billion US-Dollar in kohlenstoffarme und nachhaltige Technologien zu finanzieren, berichtet Alastair Marsh. Zum Artikel
VW-Menschenrechtsbeauftragte: “Die Lage im Kongo ist sehr schwierig” – FAZ
Kerstin Waltenberg, die Menschenrechtsbeauftragte des Volkswagen-Konzerns, steht vor gewaltigen Aufgaben. Ein Besuch im chinesischen Joint-Venture-Werk in Urumqi ist fest vorgesehen. Doch auch in anderen Ländern gibt es Probleme, hat Christian Müßgens recherchiert. Zum Artikel
Greenwashing Unmasked: A critical Examination of ESG Ratings and actual environmental Footprint – Forbes
Die Einführung von ESG-Ratings war ein bedeutender Schritt. Sie spiegelt das wachsende Bewusstsein in der Wirtschaft für die Umweltkrise und den Wunsch wider, ethische Überlegungen in Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Doch halten die Ratings, was sie versprechen, hat sich Ben Laker gefragt. Zum Artikel
Despite reforms, mining for EV metals in Congo exacts steep cost on workers – Washington Post
Nach Enthüllungen über Kinderarbeit und menschenunwürdige Bedingungen in vielen Kobaltminen haben Autohersteller und Minenbetreiber erklärt, sich an internationale Sicherheitsstandards zu halten. Doch im Kongo sind die Bedingungen für die Arbeiter, die das Metall für Batterien abbauen, nach wie vor schlecht, haben Katharine Houreld und Arlette Bashizi recherchiert. Zum Artikel
Elektromobilität: BEV-Absatz – Dynamischer Elektro-Hochlauf hält an – Automobil Industrie
Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden in China, Europa und den USA nach Berechnungen des Center of Automotive Management (CAM) mit insgesamt 4,05 Millionen Elektroautos 36 Prozent mehr vollelektrisch angetriebene Einheiten neu zugelassen als im gleichen Zeitraum 2022, berichtet Jens Rehberg. Zum Artikel
Generelles Verbot von PFAS-Chemikalien gefährdet laut Verbänden Klimaziele – Handelsblatt
Ein Verbot von PFAS-Chemikalien könne zu einem “Klimaschutz-Boomerang” werden, meinen Industrieverbände. Auch Wirtschaftsminister Habeck warnt vor einer Überregulierung für die Wirtschaft. Kein Windrad, kein E-Auto, kein Energiespeicher, keine Halbleiter – ohne PFAS-Chemikalien ließen sich Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht produzieren, zitiert das Handelsblatt eine Mitteilung der Verbände der Autoindustrie. In der EU wird über ein mögliches Verbot sogenannter Ewigkeits-Chemikalien diskutiert. Zum Artikel

Nun sind sie also da, die European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Die EU-Kommission hat sie angenommen und es ist nach aktueller Lage nicht davon auszugehen, dass das EU-Parlament und der Rat von ihrem Recht der Ablehnung Gebrauch machen. Der Weg ist also frei, das bereits verabschiedete zugrundeliegende Rahmenwerk, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mit den neuen Standards bis Mitte 2024 in nationales Recht umzusetzen.
Dass die Meinungen über die neuen Standards auseinandergehen, war zu erwarten. Wirtschaftsverbände warnen mit Blick auf Aufwand und notwendige Bürokratisierung zur Erfüllung der Berichtspflichten vor der Überforderung gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen. Umweltverbände sehen die im Vergleich zu den ursprünglichen Vorschlägen der eingesetzten Arbeitsgruppe deutlich gelockerten Vorgaben kritisch.
Es bleiben, wie so häufig, eine Reihe von Fragen offen, die auch der noch zu erwartende Leitfaden der EFRAG-Arbeitsgruppe zur Umsetzung nicht alle beantworten wird. Klar ist aber schon jetzt: Die Auswirkungen haben nicht nur eine inhaltliche, sondern gleich in doppelter Hinsicht auch eine Management-Dimension.
Zum einen: Mit einfacher Berichterstattung ist es nach diesen Standards nicht getan. Vielmehr wird ein systematisches Prozessmanagement gefordert, wie wir es etwa aus dem Qualitäts-, Innovations- oder Risikomanagement kennen. Es enthält die Analyse von Chancen und Risiken, die Definition von Indikatoren für einen Soll-Zustand, das Festlegen von Zielen, das Entwickeln und Umsetzen von geeigneten Maßnahmen zu ihrer Erreichung und natürlich die regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung und das Ableiten neuer Maßnahmen.
Unabhängig davon, was Unternehmen für sich als wesentlich und damit als relevant für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung definieren, werden sie ein solches Prozessmanagement benötigen. Die gute Nachricht: Das ist ein geübtes Verfahren und lässt sich vielfach problemlos in die bestehenden Standards des Prozessmanagements integrieren. Es entspricht dem bekannten PDCA-Zyklus des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und bewegt sich methodisch auf bekanntem Terrain. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die Kommission über die Berichtspflichten de facto ein solches Prozessmanagement einfordert.
Bemerkenswert ist auch, welch große Bedeutung die Wesentlichkeitsanalyse zumal in Kombination mit den Stakeholderdialogen erfährt. Sie wird das wichtigste Instrument sein, mit dem ein Unternehmen seine Nachhaltigkeitsaktivitäten priorisiert. Sie bildet daher die Grundlage für die Strategieentwicklung. Dass die Kommission dafür derart dezidierte methodische Vorgaben macht, ist beachtlich. Schon die vorliegenden Aussagen zur doppelten Materialität hinsichtlich externer (ökologischer und sozialer) Auswirkungen und interner (finanzieller) Wirkungen verbunden mit dem Bewertungsmaßstab nach Umfang, Reichweite und Irreversibilität zeigen, dass es sich dabei um ein komplexes Instrument handeln wird.
Dass zukünftig ein Thema als relevant betrachtet werden muss, wenn es entweder aus der inside-out- oder der outside-in-Perspektive in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens steht – und nicht mehr nur, wenn beide Perspektiven gegeben sind -, wird es künftig erschweren, Themen als nicht wesentlich zu betrachten.
In unserer Beratung erleben wir, dass sich insbesondere inhaltlich weniger ambitionierte Unternehmen, die bislang auch nur wenig datengetriebenes Prozessmanagement betreiben, mit den Anforderungen schwertun. Sie müssen nicht nur von der Sinnhaftigkeit des Themas, sondern auch von der Notwendigkeit eines systematischen Prozessmanagements überzeugt werden. Wir befürchten, dass sie die abgeschwächten Berichtsstandards und die daraus entstehenden Berichtslücken ausnutzen werden, um in ihrer Komfortzone zu bleiben. Der methodische Rahmen, so hilfreich er auch sein kann, würde dann eher als zusätzliches Argument unter dem Stichwort “Bürokratisierung” genutzt. Ihnen raten wir, die Chance durch die gestiegenen Transparenzanforderungen für eine Weiterentwicklung ihrer Management-Methodik zu nutzen.
Unternehmen, die bereits datengetrieben operieren und über ein entsprechendes Prozessmanagement verfügen, werden sich bei der Adaption der ESRS leichter tun. Sie werden zumindest auf Management-Ebene ESG-Anforderungen schneller integrieren. Für sie liegt die Herausforderung eher auf der inhaltlichen Ebene: ESG-Kompetenzen müssen in alle Geschäftsprozesse integriert und Geschäftsmodelle angepasst werden. Ihnen kann dabei ein systematisches und langfristiges Change Management helfen: Mit seinem gut orchestrierten Mix von Maßnahmen aus Kommunikation, Partizipation und Qualifikation bietet es den notwendigen Werkzeugkasten.
Die EU-Regulierungsbemühungen müssen sich – so wie die Aktivitäten der Unternehmen – im Sinne einer Wirkungsorientierung am Ende daran messen lassen, inwiefern sie tatsächlich zu einer ökologischen und sozialen Transformation beitragen. Die Berichtsstandards sind nur ein Puzzlestück. Die Sorgen um deren inhaltliche Verwässerung sind berechtigt. Mit ihren Vorgaben zur Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsmanagements können sie jedoch eine gute methodische Weiterentwicklung anstoßen, auf die sich Unternehmen frühzeitig einstellen sollten.
Hilke Posor und Thomas Leppert sind geschäftsführende Gesellschafterin und Gesellschafter der Heldenrat GmbH, einem Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltigem Wirtschaften und sektorübergreifenden Kompetenztransfer in Hamburg.

Mathematiker und Musiker haben es gut. Zwar mag es nicht leicht sein, ihre Profession zu erlernen. Aber wenn man den Stoff einmal drauf hat, kann man sich global verständig machen. Zahlen und Noten bedeuten überall das gleiche. Weltweit. Mit der Nachhaltigkeit funktioniert das nicht. Sie wird, sehr häufig, auf unterschiedliche Weise interpretiert.
Emmanuel Faber möchte das ändern. Er will eine gemeinsame Sprache für Unternehmen etablieren, damit man zuverlässig und über Branchen hinweg erkennen kann, ob sich sie zu grünen, klimafreundlichen Firmen entwickeln. Und das ebenfalls: weltweit. “Wir brauchen eine gemeinsame Sprache”, sagt er, es brauche eine “globale Baseline”.
Der 59-Jährige ist Vorsitzender des mit 14 Mitgliedern besetzten International Sustainability Standards Boards (ISSB), das auf der Klimakonferenz in Glasgow vor knapp zwei Jahren gegründet wurde. Das Board ist Teil der IFRS-Stiftung in London – der es schon einmal gelungen ist, Regeln zu setzen. Ihr International Accounting Standards Board (IASB) war maßgeblich daran beteiligt, die heutigen Normen für die finanzielle Bilanzierung festzulegen. Nun soll das auch bei Fragen zu Umwelt, Gesellschaft und Klima klappen.
Dass die Wahl auf Faber fiel beim Aufbau des ISSB, ist kein Zufall. Der Franzose, der aus Grenoble stammt, hat vergleichsweise früh in seiner vorigen Karriere als Topmanager und Chef von Danone auf Nachhaltigkeit gesetzt. Schon vor Jahren sprach er von einer “Revolution”, derer sich Unternehmen anschließen müssten; in seinem Lebensmittelkonzern hatte er erkannt, dass sich die Kundinnen und Kunden zunehmend bewusst, gesund und regional ernähren wollten.
Fortan forderte er von Landwirten in den USA, bei Futtermitteln auf genveränderten Mais zu verzichten. Er schloss mit französischen Viehbauern langfristige Verträge ab, strebte eine klimaneutrale Abfüllung von Evian an und kooperierte mit Nobelpreisträger Muhammed Yunus. Das Ziel: eine Joghurtfabrik in Bangladesch, die nach den Prinzipien eines Social Business funktionieren und Mangelernährung bekämpfen sollte.
Andererseits fällt seine Bilanz nach den sieben Jahren an der Spitze von Danone zwiespältig aus. Denn Faber ordnete nicht alles den Stakeholdern unter. Um die Rendite zu steigern, forcierte er gegen interne Widerstände Rationalisierungen, insbesondere nach den Verlusten durch die Corona-Pandemie. Weil Restaurants lange keine Gäste empfangen durften, brach der Umsatz mit Wasser bei Danone ein. In der Folge strich Faber 2000 Stellen, verkaufte kleinere Marken und optimierte die Prozesse weiter. Ihm persönlich half das wenig. Im Frühjahr 2021 wurde er abberufen, weil die Konkurrenz dem Unternehmen davoneilte.
In seiner neuen Funktion führt er die Geschäfte von Frankfurt am Main aus. Er steht weniger im Rampenlicht als zuvor. Dafür ist seine Aufgabe vielleicht noch anspruchsvoller. Und Konkurrenz hat er auch. Die Europäische Union strebt für den Beginn des kommenden Jahres neue Richtlinien beim Nachhaltigkeitsreporting an, in den USA will die Börsenaufsicht Unternehmen zu Umweltrisiken berichten lassen. Dem gegenüber stehen die Konservativen, die jegliche ESG-Einmischung ablehnen und immer mehr Einfluss gewinnen. Kann er mit dem ISSB erfolgreich sein? Faber glaubt daran. “Keine Frage, ESG ist zwischen die Fronten der Auseinandersetzung geraten”, sagte er kürzlich dem “Manager Magazin”. “Aber es besteht ein großer Bedarf des Marktes an qualitativ hochwertigen Informationen, anhand derer Investoren Chancen und Risiken einschätzen können.” Und weiter: “Kann sich die Politik wirklich gegen die Interessen des Marktes stellen? Daran glaube ich nicht.”
2025 sollen die ersten Berichte nach ISSB-Format veröffentlicht werden, so plant Faber es momentan. Die würden dann auf das vorige Geschäftsjahr zurückblicken. Abzuwarten bleibt allerdings, ob die Regulierer und Unternehmen weltweit bereit dafür sind, ESG-Komplexe in einer einheitlichen Sprache zu verhandeln und darzustellen. Und ob sie möchten, dass Emmanuel Faber mit seinem ISSB-Team derjenige ist, der die dafür notwendigen Vokabeln und die Grammatik vorgibt. Marc Winkelmann
