gerade einmal eine Minute und 44 Sekunden lang haben Kamala Harris und Donald Trump in ihrem TV-Duell über Klimapolitik gesprochen. Nur ein einziges Mal nannte die amtierende Vizepräsidentin den Inflation Reduction Act (IRA) – und hält sich im Wahlkampf bei den Themen Klima und Nachhaltigkeit bisher insgesamt zurück. Wie also würde es unter ihrer Präsidentschaft in der US-Klimapolitik weitergehen? Laurin Meyer ist dieser Frage in seiner Analyse nachgegangen.
Welche Risiken bringt der Verlust von Biodiversität mit sich? Eine Studie zeigt: Anleger an den Aktienmärkten reagieren auf dieses Thema nicht nur aus Sorge um unseren Planeten. Studienautor Zacharias Sautner vom European Corporate Governance Institute erklärt im Interview mit Lukas Homrich, weshalb die Artenvielfalt für die Finanzwelt wichtiger ist, als oft angenommen wird.
Am heutigen Freitag beginnt die Faire Woche, die übrigens zwei Wochen dauert: Bis zum 27. September finden bundesweit Veranstaltungen zum Thema Fairer Handel statt. Zum Auftakt schreibt Claudia Brück, Geschäftsführerin von Fairtrade Deutschland, in ihrem Standpunkt: Die Menschenrechte seien unantastbar und würden für Unternehmen zunehmend zur Business-Grundlage. Dies hätten allerdings noch nicht alle in Wirtschaft und Politik verstanden – deshalb müsse immer wieder daran erinnert werden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!


Es hätte ein Auftritt werden können, bei dem Kamala Harris klar Farbe bekennt. Doch gerade einmal eine Minute und 44 Sekunden hat die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten im TV-Duell beim Sender “ABC” mit ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump über das Klima gesprochen. Und nur ein einziges Mal nannte die Vizepräsidentin den Inflation Reduction Act (IRA), das wohl wichtigste klimapolitische Gesetz der amtierenden US-Regierung. “Als Vizepräsidentin bin ich stolz darauf, dass wir in den vergangenen vier Jahren eine Billion Dollar in eine saubere Energiewirtschaft investiert haben”, sagte sie.
Mit klaren Forderungen zur Klimapolitik hält sich Harris bislang zurück. Auch beim TV-Duell blieb sie ihrem Publikum einen Ausblick darauf schuldig. Beobachter können deshalb nur mutmaßen, was ihre mögliche Präsidentschaft für eine nachhaltige Wirtschaft bedeutet. Ihren Fokus legt die 59-Jährige bislang auf andere Themen, etwa die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungsnot in den USA. Schließlich treibt das die Amerikaner gegenwärtig am meisten um.
Selbst erfahrene Polit-Beobachter wagen sich derzeit kaum an Prognosen heran. “Harris hält sich da bewusst bedeckt”, sagte Johannes Thimm, leitender Amerika-Analyst bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), zu Table.Briefings. Über Details wolle er deshalb nicht spekulieren.
In der TV-Debatte nutzte Harris ihre Zeit vor allem, um sich gegen die Angriffe von Trump zu wehren. Sie betonte, dass im Rahmen des IRA auch neue Flächen fürs Fracking ausgewiesen worden seien. “Wir haben außerdem die heimische Gasproduktion auf ein Rekordniveau gebracht”, entgegnete sie auf Trumps Vorwurf, die fossilen Industrien zu zerstören. Experten in den USA vermuten, Harris’ Zurückhaltung könnte politisches Kalkül sein. Sie wolle ihrem Kontrahenten keine inhaltlichen Angriffspunkte geben, so die Lesart.
Das offizielle Wahlprogramm steht zumindest für klimapolitische Kontinuität. In den Ausführungen, die die Demokraten bei ihrem Parteitag in Chicago im vergangenen Monat verabschiedet hatten, war noch mehrmals von “Bidens zweiter Amtszeit” die Rede. Bob Inglis, Gründer der konservativen Klima-Initiative RepublicEn, sieht die Anreize aus dem IRA im Falle einer Wahl Harris’ auch deshalb als sicher an. “Klimamaßnahmen werden in einer Harris-Regierung mit Sicherheit ganz oben auf der Regierungsagenda stehen”, sagte der Republikaner und Trump-Gegner zu Table.Briefings.
Das wichtigste Klimagesetz der vergangenen Jahre ist schließlich überaus erfolgreich. Unter der Biden-Regierung haben private Unternehmen bislang rund 910 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen in Zukunftsindustrien angekündigt, wie das Weiße Haus vor wenigen Tagen mitteilte. Davon profitieren vor allem jene Branchen, die für die massiven Steuererleichterungen aus dem IRA infrage kommen. Fast die Hälfte der Mittel soll in die Halbleiter- und Elektronikproduktion fließen, weitere 177 Milliarden Dollar in die Elektroauto- und Batterieherstellung.
Matt Piotrowski geht davon aus, dass die bisherige Vizepräsidentin den Kampf gegen den Klimawandel noch verstärken dürfte. “Harris’ bisherige Haltung zum Klimawandel lässt darauf schließen, dass sie wahrscheinlich progressiver sein wird als Präsident Biden“, schreibt der leitende Direktor für Politik und Forschung beim Washingtoner Beratungsunternehmen Climate Advisers in einem Beitrag. Sie könnte strenger gegenüber der fossilen Brennstoffindustrie sein als ihr Vorgänger.
Als Generalstaatsanwältin von Kalifornien habe Harris mehrfach rechtliche Schritte gegen große Ölgesellschaften eingeleitet und damit ihre entschlossene Haltung unter Beweis gestellt, schreibt Piotrowski. Und nicht zuletzt forderte sie während ihrer Präsidentschaftsbewerbung vor vier Jahren eine CO₂ -Steuer und zehn Billionen Dollar an Klimaausgaben. Ihr Ziel war eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2045.
Daneben sprechen ihre jüngsten Entscheidungen für sich: Mit Tim Walz, dem Gouverneur von Minnesota, hat sich Harris einen besonders klimafreundlichen Vizekandidaten ins Team geholt. Bis zum Jahr 2040 will sein Bundesstaat vollständig auf kohlenstofffreien Strom umstellen. Im vergangenen Jahr hatte Walz ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet.
Diese Haltung könnte sich auch noch nachträglich im IRA niederschlagen. “Eine abermalige demokratische Administration wird noch in beträchtlichem Umfang Maßnahmen nachlegen müssen, um das aktuelle Klimaziel für 2030 zu erreichen”, schreibt SWP-Analystin Sonja Thielges in einer aktuellen Analyse. Einige Regulierungen dafür seien schon in Arbeit, so etwa Leitlinien für IRA-Steuererleichterungen für sauberen Strom und Wasserstoff. Thielges erwartet, dass diese Arbeit unter Harris fortgeführt werde. Daneben sind auch andere Vorgaben schon in Planung, auf die Harris dann Einfluss nehmen könnte – so etwa die Festsetzung von Emissionsgrenzen für bereits bestehende Gaskraftwerke.
Eine Abkehr vom IRA erscheint ohnehin schwer, wie Thielges in ihrer Analyse aufzeigt. “Um ein Gesetz zu streichen, braucht es ein neues Gesetzesverfahren und in aller Regel eine Mehrheit von 60 Stimmen im US-Senat”, schreibt sie. Nicht einmal eine republikanische Mehrheit könnte also den IRA gefährden. Denn laut den aktuellen Prognosen würde das Ergebnis knapp ausfallen, betont Thielges. Hinzu kommt: “Der Großteil der Gelder aus dem Gesetz fließt an republikanische Staaten, auch wenn diese allesamt gegen den IRA gestimmt haben.” Die Staaten, so die Expertin, könnten daher für eine gewisse Stabilität bei der US-Klimapolitik sorgen. Schließlich findet das Subventionsprogramm parteiübergreifend Anhänger.
Bob Inglis von RepublicEn sieht deshalb gerade im IRA eine Chance für Harris. Sie werde mit ihrer Klimapolitik dann Erfolg haben, wenn sie die Polarisierung beim Thema Klima durchbrechen könne, sagte er. Das könne ihr gelingen, indem sie echte Konservative bei der Suche nach Lösungen willkommen heißt. Ein erstes Zugeständnis scheint Harris den Republikanern vor wenigen Wochen bereits gemacht zu haben. Als Präsidentschaftsbewerberin vor vier Jahren hatte die Demokratin noch versprochen, im Falle einer Wahl das Fracking landesweit zu verbieten. In einem Interview mit dem US-Sender CNN hatte Harris ihre Meinung geändert. Sie habe erkannt, dass “wir wachsen und eine saubere Energiewirtschaft aufbauen können, ohne Fracking zu verbieten”. Laurin Meyer

Herr Sautner, kümmern sich Investoren tatsächlich um Biodiversität?
Ja, unsere Studie zeigt, dass schwindende Biodiversität vom Kapitalmarkt als Risiko wahrgenommen wird. Das ist das Thema, welches nach den Risiken des Klimawandels aktuell institutionelle Investoren am meisten beschäftigt. Das zeigt aber nicht nur die Studie, die das statistisch in den Aktienkursen nachweist.
Wie gefährden Unternehmen die Artenvielfalt?
Natürlich spielen Treibhausgas-Emissionen da eine Rolle. Doch es ist nicht so, dass es eine perfekte Korrelation gibt. Auch Wasserverschmutzung und besonders die Landnutzung bedrohen die Artenvielfalt. Etwa wenn Unternehmen Wälder abholzen, Bodenschätze fördern oder Viehwirtschaft betreiben. Dazu zählen insbesondere indirekte Effekte über die Lieferkette. Das betrifft vor allem Produzenten von Nahrungsmitteln, Papierproduktion und natürlich alles, was mit dem Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle zu tun hat. Und daraus ergeben sich die nächsten Risiken.
Haben Sie ein Beispiel für diese Risiken?
Ja, da fallen mir Touristikunternehmen ein, die Hotels in Ägypten betreiben. Urlauber fliegen zum Tauchen dorthin. Wenn die Biodiversität zurückgeht, Fische und Korallen sterben, dann haben sie Probleme mit ihrem Hotel, weil die Taucher nicht mehr kommen. Die Logik ist also, dass Unternehmen nicht nur vom Klimawandel, sondern auch vom Verlust der Artenvielfalt ökonomisch betroffen sind. Studien zeigen, dass unser Wirtschaftssystem stark von sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen abhängt. Das heißt: Für wirtschaftliche Prosperität brauchen wir Naturkapital oder auch Biodiversität. Das nehmen auch die Anleger wahr.
Was haben sie dazu herausgefunden?
In unserer Studie zeigen wir, dass Unternehmen, die die Artenvielfalt negativ beeinflussten, seit der Kunming-Erklärung im Jahr 2021 höhere Aktienrenditen liefern mussten als Unternehmen, die weniger negativen Einfluss haben. Vor diesem Ereignis ist kein Unterschied in den Daten zu finden. Anleger verlangen also seitdem eine Risikoprämie von diesen Unternehmen. Das können fünf Prozent oder mehr sein. Damit möchten Anleger künftige Verluste kompensieren, die sie bei diesen Unternehmen aufgrund ihres Handelns erwarten.
Was hat die Kunming-Erklärung ausgelöst?
Auf dieser Konferenz haben sich Staaten 2021 ersten Biodiversitätszielen verpflichtet, ähnlich wie es beim Pariser Klimaabkommen mit dem 2-Grad-Ziel passiert ist. Kunming ist zwar nicht so bekannt, hatte aber einen spürbaren Einfluss auf das Handeln von Investoren. Das wurde besonders in den Tagen nach der Erklärung sichtbar. Da gingen die Aktienkurse von den Unternehmen runter, die Artenvielfalt besonders gefährden.
Welche Risiken befürchten Anleger noch?
Übergangsrisiken, die entstehen, wenn eine Regulierung erwartet wird. Das war nach dem Kunming-Abkommen so. Das setzt die Unternehmen, die Natur zerstören, zunehmend unter Druck, etwa durch eine CO₂-Steuer. Interessant ist dabei, dass in Ländern, in denen der Schutz von Artenvielfalt eine untergeordnete Rolle spielt, die Risikoprämie höher ist.
Wo kann man die Reaktion der Anleger noch beobachten?
Das sieht man, wenn man darauf achtet, über was auf Investoren-Konferenzen gesprochen wird, worüber Analysten aktuell Berichte für ihre Anleger schreiben und welche Risikomanagement-Systeme und Daten sie gerade kaufen. Aber auch Investoren engagieren sich gegenüber Unternehmen. Deswegen ist es nicht überraschend, dass wir dies auch statistisch in den Aktienmärkten nachweisen können.
Reagieren Unternehmen bereits auf den Druck?
Die betroffenen Unternehmen haben höhere Kapitalkosten. Und jeder CFO hat natürlich ein Interesse, die Kapitalkosten zu reduzieren. Also dürften die Unternehmen auch nicht erst warten, bis die Investoren anklopfen. Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie diese Abhängigkeiten abbauen können, etwa indem sie ihre Lieferketten umstellen und diversifizieren. Machen Lebensmittelunternehmen versuchen beispielsweise verstärkt auf regenerative Landwirtschaft zu setzen, durch die Artenvielfalt stärker geschützt wird.
Führt der ESG-Backlash an den Aktienmärkten dazu, dass Biodiversität durch die Unternehmen ignoriert wird?
Einen Teil des Backlashes kann ich verstehen, weil viele Themen übertrieben wurden, viele Ziele versprochen wurden, die nicht eingehalten werden konnten. Beispielsweise wird häufig versprochen, dass ESG-Fonds überdurchschnittliche Renditen abwerfen werden. Wenn aber gleichzeitig argumentiert wird, dass ESG-Fonds auch weniger riskant sind, dann passt das nicht zusammen. Mein Gefühl ist, dass man von dem Überbegriff ESG weggehen und über konkrete Risiken sprechen sollte. Es ist immer gut, wenn es eine Studie wie unsere gibt, die zeigt, dass das Thema wirkliche Relevanz für Unternehmen hat. Und wir haben nun eine breite Evidenz, dass diese Risiken eingepreist sind. Das kann kein Investor, egal wie er zur ESG steht, ignorieren.
Zacharias Sautner ist Mitglied des European Corporate Governance Institute (ECGI) und Professor für Nachhaltige Finanzen an der Universität Zürich. Dort forscht er zu Klimawandel, Biodiversität und den Finanzmärkten. Davor war er Professor für Finanzen an der Frankfurt School of Finance & Management.
Bereits im Mai hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir an die EU-Kommission appelliert, Tempo bei den Vorbereitungen für den Anwendungsstart der europäischen Anti-Entwaldungsverordnung (EUDR) zu machen. Passiert ist seither wenig. Mit einem Schreiben im Namen der Bundesregierung an den exekutiven Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und kommissarischen Umweltkommissar, Maroš Šefčovič, hat Özdemir seiner Forderung nach Aufschub der EUDR-Umsetzung deshalb nun Nachdruck verliehen.
Özdemir fordert in dem Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, den Anwendungsstart der EUDR “dringend” um ein halbes Jahr zu verschieben – vom 30. Dezember 2024 auf den 1. Juli 2025. Vier Monate vor dem planmäßigen Start fehlten wichtige Umsetzungselemente wie die Einstufung Deutschlands als Land mit geringem Entwaldungsrisiko, schreibt Özdemir.
“Die EU-Kommission muss endlich aus der Sommerpause kommen und Klarheit schaffen”, so der Grünen-Politiker weiter. Die Voraussetzungen für eine angemessene Vorbereitung der Wirtschaft und eine effiziente nationale Anwendung müssten unverzüglich geschaffen werden. Die Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft bräuchten ausreichend Zeit, um sich vorzubereiten. “Sonst drohen Lieferketten zum Ende des Jahres zu reißen – zum Schaden der deutschen und europäischen Wirtschaft, der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Drittstaaten sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher”, mahnt Özdemir.
Das Ziel der EUDR, den notwendigen globalen Waldschutz zu stärken, stehe zwar außer Frage, die Umsetzung müsse aber praktikabel, bürokratiearm und reibungslos funktionieren, fordert der Bundeslandwirtschaftsminister. “Die EU-Kommission kann hier alle Voraussetzungen im Alleingang schaffen, ohne die EUDR neu zu verhandeln.”
Erst am Dienstag hatten Mitglieder der brasilianischen Regierung Vertreter der EU-Kommission in einem Brief dazu aufgefordert, die Bestimmungen der EUDR nicht wie geplant Ende des Jahres umzusetzen, sondern zu überarbeiten, um brasilianische Exporte nicht zu gefährden. Vertreter der US-Regierung hatten die EU bereits Ende Mai gebeten, die Umsetzung zu verschieben.
Gemäß der Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, so der volle Titel, sollen Unternehmen die Vorschriften eigentlich ab dem 30. Dezember 2024 anwenden, kleinere Unternehmen ab Ende Juni 2025. Dann dürfen sie Einfuhren bestimmter Produkte – unter anderem Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz – nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese bestätigt, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt, und dass bei seiner Herstellung die lokale Gesetzgebung eingehalten wurde.
Kritik, der zufolge die Kommission wichtige Grundlagen für die Umsetzung der EUDR noch nicht vorgelegt habe – etwa bestimmte Leitlinien und das Länder-Benchmarking – war zuletzt von vielen Seiten zu vernehmen. Mit dem Länder-Benchmarking will die Kommission jedem Land eine bestimmte Risikostufe für Entwaldung zuweisen. heu
Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wünscht sich, dass Nachhaltigkeitspolitik gesetzlich im Bundestag verankert wird. In einer Stellungnahme kritisiert er, dass das Parlament aktuell lediglich die Möglichkeit habe, durch den Beirat Position zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) zu beziehen. “Ganz wichtig ist: Der Bundestag als höchstes deutsches Verfassungsorgan muss Taktgeber bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele werden”, sagte Beirats-Mitglied Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) zu Table.Briefings. “Wir brauchen eine Nachhaltigkeitsgesetzgebung, die die DNS in den Bundestag holt.”
Auch zu den Inhalten der DNS-Weiterentwicklung äußerte sich der Beirat. Er bemängelt etwa, dass es “oft an Konkretheit, Überprüfbarkeit und Umsetzungssicherheit bei Zielen und Maßnahme” mangele. Er empfiehlt, “einen besonderen Fokus auf die Indikatoren zu legen, bei denen laut der Analyse des Statistischen Bundesamts eines wesentliche Zielverfehlung droht”. Brinkhaus: “Wir wollen weniger weiche Prosa und mehr Konzentration auf die konkreten und messbaren Ziele. Die Silostruktur der Ministerien bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele von Klima bis Gesundheit muss aufgebrochen werden.” Für künftige Weiterentwicklungen sollte es dem Beirat zufolge einen “übergeordneten Prozess zur Evaluation der bestehenden Indikatoren” geben, “der die Indikatoren grundsätzlich neu denkt”.
Im Fokus des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung steht die Überprüfung und Bewertung von Gesetzentwürfen und Verordnungen anhand der Ziele der DNS. Die Dialogfassung von deren Weiterentwicklung hat die Regierung Anfang Juni veröffentlicht; die Öffentlichkeit konnte sie zwei Monate lang kommentieren. Spätestens Anfang 2025 will die Regierung die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie beschließen. maw
Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament (S&D) hat Delara Burkhardt zur neuen Berichterstatterin des Umweltausschusses (ENVI) für die Green Claims-Richtlinie ernannt. Auch der Binnenmarktausschuss (IMCO), der gleichberechtigt an den Verhandlungen beteiligt ist, wird in den kommenden Tagen einen neuen Berichterstatter auswählen. Diese Neubesetzung ist notwendig, weil die bisherigen Berichterstatter Cyrus Engerer (S&D) und Andrus Ansip (Renew) bei den Europawahlen nicht erneut angetreten waren.
Die Richtlinie über umweltbezogene Werbeaussagen, so die deutsche Bezeichnung, soll Angaben über die Umweltfreundlichkeit von Produkten und Dienstleistungen regulieren. Ziel ist, Greenwashing zu bekämpfen und Verbraucherinnen und Verbrauchern verlässliche Informationen zu garantieren. Das EU-Parlament hat bereits im März seine Verhandlungsposition beschlossen, der Umweltrat im Juni. Die Trilogverhandlungen können beginnen, sobald die neue EU-Kommission ihre Arbeit aufgenommen hat.
Burkhardt sagte, sie werde sich für ein starkes Rahmenwerk einsetzen. Mit der Richtlinie könne die EU wirksam Alltagsbetrug durch irreführende Werbeversprechen bekämpfen. Sie werde das Mandat des EU-Parlaments in den Verhandlungen verteidigen, insbesondere die “Anforderungen für eine ex-ante Überprüfung von Umweltaussagen durch Dritte und Einschränkungen bei Aussagen über CO₂-Kompensationen.” Burkhardt ist umweltpolitische Sprecherin der S&D-Fraktion und war in der vergangenen Legislaturperiode unter anderem Schattenberichterstatterin für die Verpackungsverordnung. leo
Im Verkehrssektor drohen in den 2030er Jahren Fahrverbote und Auto-Stilllegungen, wenn die Bundesregierung weiterhin wenig unternimmt, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Davor warnt eine neue Studie im Auftrag von Greenpeace und Germanwatch, die Table.Briefings vorab vorlag. Je später die Bundesregierung aktiv wird, desto drastischer seien die nötigen Eingriffe, so die Studie.
Die Autorinnen und Autoren vom New Climate Institute haben mehrere Szenarien analysiert. Würde die Regierung weiterhin zu zögerlich handeln, müsste sie ab 2030 harte Maßnahmen ergreifen, da die Emissionen fast doppelt so schnell (um 18,2 Millionen Tonnen pro Jahr) sinken müssten, als wenn sofortige Maßnahmen ergriffen würden:
Bei sofortigem entschiedenem Handeln müssten die Emissionen im Verkehrssektor hingegen um 10,3 Millionen Tonnen pro Jahr sinken. Erforderliche Maßnahmen wären:
Die Autorinnen und Autoren warnen, dass andere Sektoren die Zielverfehlung des Verkehrssektors kaum auffangen könnten. Die Nutzung von E-Fuels für den nationalen Verkehrssektor sei ebenfalls kein Ausweg, da sie in anderen Sektoren (Flug- und Schiffsverkehr) gebraucht würden und dort hohe Preise gezahlt würden, weil es dort kaum andere Klimaschutzmaßnahmen gäbe. Doch die Autorinnen und Autoren zeigen sich auch optimistisch: “Bei ausreichend politischem Willen steht einer schnellen Umsetzung ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor nichts entgegen.” nib
In ihrem letzten Jahresbericht “State of the Energy Union” äußerte sich die scheidende EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Mittwoch optimistisch, dass die EU ihre Klimaziele im Energiebereich erreichen könne. Ein Zeichen dafür sei, dass im ersten Halbjahr 2024 mehr Strom aus Windkraft und Solar produziert worden sei als aus fossilen Energiequellen. Allerdings seien die Energiepreise in Europa weiterhin zu hoch. Industriestrom, so heißt es in dem Bericht, sei zwei bis dreimal so teuer wie in den USA, Erdgas koste sogar das drei- bis sechsfache. Die mittelfristige Lösung für dieses Problem sei ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion und der Ersatz von Erdgas mit grünem Wasserstoff in einigen Industriesektoren.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat die EU alle ihre diesbezüglichen Ziele bislang verfehlt.
Auch bei grünem Wasserstoff sieht es offenbar schlecht aus: Statt gesicherter Zahlen legte die Kommissarin nur Schätzungen der Internationalen Energie-Agentur über den zeitnahen Aufbau der Produktionskapazitäten vor. Den Nachfragen von Journalisten nach den Wasserstoff-Zielen bis 2030 wich Simson aus.
Das bislang gültige Ziel, ab 2030 zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff in der EU zu produzieren und weitere zehn Millionen Tonnen zu importieren, wollte sie weder bestätigen noch abräumen. In dem Bericht heißt es jedoch, dass viele Bauprojekte für Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff herstellen können, vor der finalen Finanzierungsentscheidung stünden. Im Juli hatte der EU-Rechnungsprüfungshof die offiziellen Ziele im Wasserstoffbereich als unrealistisch eingeschätzt. av
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert angesichts der Haushaltslage vieler Kommunen eine stärkere Förderung der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude durch Bund und Länder. “Andernfalls werden wir die Klima- und Sanierungsziele in Deutschland bis 2045 nicht erreichen“, warnte DStGB-Hauptgeschäftsführer André Berghegger im Gespräch mit Table.Briefings.
Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) hatte am Montag eine Studie zum energetischen Sanierungsbedarf öffentlicher Gebäude in Deutschland vorgestellt. Demnach belaufen sich die notwendigen Investitionen für die Liegenschaften von Bund, Ländern und Kommunen bis 2045 auf insgesamt 120 Milliarden Euro. Das entspricht sechs Milliarden Euro pro Jahr. Laut Dena entfallen davon zwei Drittel auf Städte und Gemeinden.
“Der energetische Sanierungsbedarf der über 180.000 kommunalen Gebäude mit jährlich über vier Milliarden Euro überfordert zahlreiche Städte und Gemeinden finanziell”, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Berghegger. Schon heute gebe es einen Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur von fast 186 Milliarden Euro. “Hinzu kommt ein Finanzierungssaldo der kommunalen Haushalte von derzeit 6,8 Milliarden Euro, das im kommenden Jahr auf über 13 Milliarden Euro anwachsen wird.”
Programme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zielen Bergherr zufolge “in die richtige Richtung, sind in der Förderhöhe aber nicht ausreichend und decken nur Teilbereiche ab”. Unverständlich sei zudem, dass der Bund das “langjährige Erfolgsprogramm” zur energetischen Stadtsanierung Ende letzten Jahres abrupt beendet habe. Nach Einschätzung von Berghegger war dies ein “ein völlig falsches Signal und sollte rückgängig gemacht werden”.
Mit Blick auf die großen Einsparpotenziale nach einer energetischen Sanierung mahnte Berghegger “schnelles und gezieltes Handeln” an. Laut Dena-Studie stehen dem Gesamtinvestitionsbedarf von 120 Milliarden Euro bereits in den ersten zwanzig Jahren Energiekosteneinsparungen von 45 Milliarden Euro gegenüber. Nach weiteren zwanzig Jahren hätten sich die Investitionen amortisiert. ch
Anlässlich der laufenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 hat ein Bündnis aus Verbänden und Gewerkschaften eine Aufstockung der Trassenpreisförderung um mindestens 400 Millionen Euro gefordert. Ansonsten drohe im kommenden Jahr ein Anstieg der Kunden- und Verbraucherpreise, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Befürchtet werde ein Plus von 16 Prozent im Schienengüterverkehr und von 19 Prozent im Fernverkehr.
“Wir appellieren an die Parlamentarier, eine Lösung für die stark steigenden Trassenpreise zu finden. Kurzfristig geht das nur, indem der Bund die Trassenpreise deutlich stärker bezuschusst”, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Zwar sei für den Verkehrsetat 2025 bereits eine leichte Anhebung der Förderung vorgesehen, dennoch fehlten weiterhin mindestens 100 Millionen Euro im Schienengüterverkehr und 300 Millionen Euro im Fernverkehr.
Hintergrund ist eine kurzfristige Einigung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner von Mitte August. Sie sieht vor, dass zur Einhaltung der Schuldenbremse die eigentlich für den Bundeshaushalt 2025 vorgesehenen Zuschüsse an die DB-Infrastruktursparte DB Infrago in Höhe von 4,5 Milliarden Euro jetzt als zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit der bereits geplanten Aufstockung um 5,9 Milliarden Euro erhöht sich das Eigenkapital der Bahn damit um 10,4 Milliarden Euro.
Da das Eisenbahnregulierungsgesetz aber eine hohe Eigenkapitalverzinsung vorschreibt, müssten nun die Trassenpreise erhöht werden, um die Zinsen zu erwirtschaften. Diese Kosten würden weitergegeben; in der Folge müssten alle, die die Bahn nutzen, “mit erheblichen Preiserhöhungen rechnen”, so das Bündnis. Ihm gehören neben der Allianz pro Schiene die Gewerkschaften EVG und Verdi sowie die Deutsche Umwelthilfe, die Klima-Allianz, Greenpeace und Germanwatch an.
Um künftig auf “Ausweichfinanzierungsmodelle, die neue Probleme erzeugen” verzichten zu können, schlägt die Allianz pro Schiene neben dem Abbau klima- und umweltschädlicher Subventionen ein grundlegend anderes Modell der Infrastrukturfinanzierung vor. “Langfristig wäre ein Schienenfonds die beste Lösung, um Stabilität und Verlässlichkeit in die Schieneninvestitionen zu bringen”, so Flege. ch
Deutsche Unternehmen wandeln sich zu langsam – Süddeutsche Zeitung
Berater von Kearney und IW Consult haben 500 Firmen befragt und dabei festgestellt, dass nur rund jedes zehnte Unternehmen ein “Transformationsleader” bei Nachhaltigkeit oder Digitalisierung sei. Vor allem traditionelle Branchen, die die Basis des Wohlstands legen, seien “strukturverharrend” – im Maschinenbau und der Prozessindustrie etwa sind kaum Leader zu finden, schreibt Elisabeth Dostert. Zum Artikel
Wall Street quietly turns tail on its sustainability commitments – Bloomberg
Der ESG-Backlash in den USA hält an, schreibt Alastair Marsh. Unter dem Druck rechtspopulistischer Politiker begraben weitere Finanzfirmen Nachhaltigkeitsziele, darunter jüngst Morgan Stanley, das sich nicht mehr zur Reduzierung von Plastikmüll bekennen will. Vorstandschefs sorgen sich dagegen mehr um die Folgen von Inflation, Künstlicher Intelligenz und der gegenwärtigen Geopolitik. Zum Artikel
Panda auf Abwegen – Tagesschau
Der vom WWF und der Deutsche-Bank-Tochter DWS gemeinsam aufgelegte Fonds “DWS ESG Blue Economy” soll weit weniger nachhaltig sein als versprochen. Zu den Unternehmen im Anlageuniversum zählt etwa eine der größten Kreuzfahrtgesellschaften. Einem Investigativteam zufolge beanstanden WWF-Mitarbeiter die Auswahl intern schon länger. Zugleich hat die Umweltorganisation finanzielle Probleme und scheint auf Geld aus Kooperationen angewiesen zu sein. Zum Artikel
Finanzindustrie will mit nachhaltigen Fonds in Rüstung investieren – Manager Magazin
Die Kriege und Konflikte der letzten zweieinhalb Jahre haben den Blick auf die Rüstungsindustrie verändert. Es brauche mehr Investitionen in der Verteidigung, sagt die Politik – und jetzt wollen Deutsche Banken- und Fondsverbände nachhaltigen Anlageprodukten nicht mehr verbieten, Geld in konventionelle Rüstungsgüter zu stecken. Mit den Prioritäten von nachhaltig interessierten Anlegern deckt sich das allerdings nicht, wie etwa der Nachhaltigkeitschef von Union Investment erklärt. Zum Artikel

Seit dieser Woche gibt es sie wieder: Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen. Sie sind das sichtbare Zeichen eines Abschottungswettbewerbs, der derzeit in Deutschland stattfindet. Alles Schlechte kommt von außen, könnte man meinen.
Die Neugierde nach etwas Unbekanntem wird derzeit durch Angst überlagert, es wird das Trennende betont und nicht das Einende. Gräueltaten wie in Solingen, Anschlagsversuche wie in München und die latente Gefahr für die Allgemeinheit, die von ihnen ausgehen, machen uns betroffen, aber auch misstrauisch gegenüber anderen Menschen. Deutschland, der Export- und Reiseweltmeister, fühlt sich derzeit am wohlsten auf ausgetretenen Wegen.
Dabei müssen wir gerade jetzt den Blick weiten, über die eigenen Grenzen und Mauern hinweg. Denn die großen Probleme unserer Zeit können nur angegangen werden, wenn sie global betrachtet werden. Beispiel Klimakrise: Ob Hausbesitzerin im Ahrtal oder Bäuerin in Bangladesch – sie sind Teil einer Schicksalsgemeinschaft geworden. Die Frage ist nun, ob wir angesichts der gemeinsamen Herausforderungen bereit sind, dies anzuerkennen und solidarischer zu werden. Eine Insel aufzubauen und die Gitter hinunterzulassen wird uns nicht helfen.
Bei Fairtrade haben wir vor allem die Landwirtschaft im Blick, jener Sektor, der die meisten Menschen auf diesem Planeten beschäftigt. Hier war globale Solidarität noch nie so notwendig: Genau wie in Deutschland treffen die Auswirkungen der Klimakrise Bäuerinnen und Bauern in Lateinamerika, Asien und Afrika hart. Sie benötigen Beratung, Trainings und Finanzhilfen, um die aktuellen Herausforderungen zu überstehen. Und die Unterstützung eines anderen teils dieser Gemeinschaft: der Konsumentinnen und Konsumenten, die sich am Regal für Produkte entscheiden, bei denen Ausbeutung kein Teil des Geschäftsmodells ist.
Immerhin achten laut neuesten Studien mehr als 40 Prozent der Deutschen beim Einkauf auf Nachhaltigkeit, und der Markt für nachhaltige Produkte wächst wieder. Das ist eine gute Nachricht. Diese Menschen machen sich über den Preis hinaus Gedanken – darüber, wie die Lebensmittel, die sie konsumieren, produziert werden, und auch darüber, wer sie unter welchen Bedingungen anbaut. Eine weitere positive Nachricht ist die zunehmende Zahl von Teilnehmenden an der am Freitag beginnenden Fairen Woche, die größte Aktion des fairen Handels in Deutschland. Tausende von Engagierten werden sich in den nächsten zwei Wochen bundesweit an Aktionen, Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen zum Thema fairer Handel beteiligen und den Gedanken der globalen Solidarität weitertragen.
Dieser Gedanke muss auch bei den Unternehmen fest verankert werden. Allein auf Freiwilligkeit zu setzen, hilft hier nicht, was unter anderem der Misserfolg des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) zeigte. Das hat auch die Politik festgestellt und das deutsche sowie das europäische Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, die Fairtrade trotz Mängel begrüßt.
Die Diskussionen im Vorfeld des Europäischen Sorgfaltspflichtengesetzes (CSDDD) machten allerdings deutlich, dass viele Firmen und auch Politiker eines noch nicht begriffen haben: Geschäftspraktiken, die nicht nachhaltig sind und auf Ausbeutung setzen, müssen endgültig der Vergangenheit angehören. Sie sind rechtlich und moralisch verwerflich. Und sie werden von den Konsumentinnen und Konsumenten im zunehmenden Maße geächtet.
Unternehmen sollten erkennen, dass sie langfristig nur dann ein sicheres Geschäft haben, wenn nicht nur die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch die Menschen am Anfang der Lieferkette ein würdiges Auskommen haben. Dazu gehört die Zahlung existenzsichernder Einkommen und Löhne, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen. Fairtrade hat dazu Referenzpreise für viele Produkte ausgerechnet sowie einen Plan, wie mit verschiedenen Maßnahmen Einkommen in der kleinbäuerlichen Wirtschaft und Löhne in Plantagen existenzsicherndes Niveau erreichen können.
Wer bei diesem Thema vorangeht, wird in Zukunft die Früchte ernten. Denn die Achtung der Menschenrechte und der Respekt für alle Menschen entlang der Lieferkette werden zunehmend zur Business-Grundlage. Dafür sorgt nicht nur die Politik, sondern auch der Markt.
Claudia Brück ist seit 2016 geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Fairtrade Deutschland e.V. Sie verantwortet die strategische Kommunikation, die entwicklungspolitische Positionierung und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern in der Zivilgesellschaft und der Entwicklungspolitik.
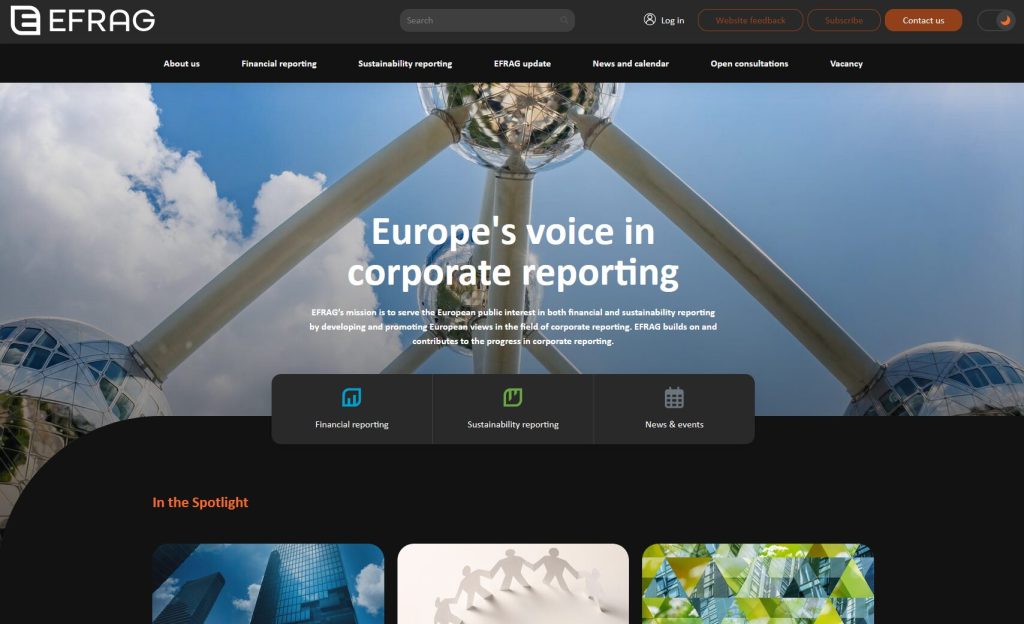
Seit mehr als zwanzig Jahren versucht die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Licht in das Dickicht der europäischen Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu bringen. Doch nun schaltet die Organisation mit Sitz in Brüssel von sich aus in den Dunkelmodus – und freut sich auch noch darüber.
Denn der “Dark Mode”, das neue Feature auf ihrer Website (oben rechts), “senkt den Energieverbrauch erheblich und unterstützt unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit”, wie es in einer Mitteilung heißt. Tatsächlich zeigt eine Studie der Purdue University, dass der Dark Mode bei voller Bildschirmhelligkeit durchschnittlich 39 bis 47 Prozent Strom spart. Allerdings: Je niedriger die eingestellte Helligkeit, desto geringer ist der Unterschied im Stromverbrauch zwischen Light- und Dark-Modus.
Neben dem Energieverbrauch gibt es aber noch andere gute Gründe, den Dark Mode einzuschalten – zumindest, wenn man nicht gerade im Büro sitzt. So stehen helles und blaues Licht, die durch den Dark Mode reduziert werden, im Verdacht, wach zu machen und Schlafprobleme zu verursachen.
Ob das tatsächlich so ist, kann man übrigens in der Nacht von Freitag auf Samstag ausprobieren: Dann findet die nächste Earth Night statt. Die Initiative Paten der Nacht ruft dazu auf, eine Nacht lang alle künstlichen Lichter auszuschalten. Damit soll ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und Lichtverschwendung gesetzt werden. Es muss ja auch nicht immer alles beleuchtet sein. Carsten Hübner
gerade einmal eine Minute und 44 Sekunden lang haben Kamala Harris und Donald Trump in ihrem TV-Duell über Klimapolitik gesprochen. Nur ein einziges Mal nannte die amtierende Vizepräsidentin den Inflation Reduction Act (IRA) – und hält sich im Wahlkampf bei den Themen Klima und Nachhaltigkeit bisher insgesamt zurück. Wie also würde es unter ihrer Präsidentschaft in der US-Klimapolitik weitergehen? Laurin Meyer ist dieser Frage in seiner Analyse nachgegangen.
Welche Risiken bringt der Verlust von Biodiversität mit sich? Eine Studie zeigt: Anleger an den Aktienmärkten reagieren auf dieses Thema nicht nur aus Sorge um unseren Planeten. Studienautor Zacharias Sautner vom European Corporate Governance Institute erklärt im Interview mit Lukas Homrich, weshalb die Artenvielfalt für die Finanzwelt wichtiger ist, als oft angenommen wird.
Am heutigen Freitag beginnt die Faire Woche, die übrigens zwei Wochen dauert: Bis zum 27. September finden bundesweit Veranstaltungen zum Thema Fairer Handel statt. Zum Auftakt schreibt Claudia Brück, Geschäftsführerin von Fairtrade Deutschland, in ihrem Standpunkt: Die Menschenrechte seien unantastbar und würden für Unternehmen zunehmend zur Business-Grundlage. Dies hätten allerdings noch nicht alle in Wirtschaft und Politik verstanden – deshalb müsse immer wieder daran erinnert werden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!


Es hätte ein Auftritt werden können, bei dem Kamala Harris klar Farbe bekennt. Doch gerade einmal eine Minute und 44 Sekunden hat die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten im TV-Duell beim Sender “ABC” mit ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump über das Klima gesprochen. Und nur ein einziges Mal nannte die Vizepräsidentin den Inflation Reduction Act (IRA), das wohl wichtigste klimapolitische Gesetz der amtierenden US-Regierung. “Als Vizepräsidentin bin ich stolz darauf, dass wir in den vergangenen vier Jahren eine Billion Dollar in eine saubere Energiewirtschaft investiert haben”, sagte sie.
Mit klaren Forderungen zur Klimapolitik hält sich Harris bislang zurück. Auch beim TV-Duell blieb sie ihrem Publikum einen Ausblick darauf schuldig. Beobachter können deshalb nur mutmaßen, was ihre mögliche Präsidentschaft für eine nachhaltige Wirtschaft bedeutet. Ihren Fokus legt die 59-Jährige bislang auf andere Themen, etwa die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnungsnot in den USA. Schließlich treibt das die Amerikaner gegenwärtig am meisten um.
Selbst erfahrene Polit-Beobachter wagen sich derzeit kaum an Prognosen heran. “Harris hält sich da bewusst bedeckt”, sagte Johannes Thimm, leitender Amerika-Analyst bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), zu Table.Briefings. Über Details wolle er deshalb nicht spekulieren.
In der TV-Debatte nutzte Harris ihre Zeit vor allem, um sich gegen die Angriffe von Trump zu wehren. Sie betonte, dass im Rahmen des IRA auch neue Flächen fürs Fracking ausgewiesen worden seien. “Wir haben außerdem die heimische Gasproduktion auf ein Rekordniveau gebracht”, entgegnete sie auf Trumps Vorwurf, die fossilen Industrien zu zerstören. Experten in den USA vermuten, Harris’ Zurückhaltung könnte politisches Kalkül sein. Sie wolle ihrem Kontrahenten keine inhaltlichen Angriffspunkte geben, so die Lesart.
Das offizielle Wahlprogramm steht zumindest für klimapolitische Kontinuität. In den Ausführungen, die die Demokraten bei ihrem Parteitag in Chicago im vergangenen Monat verabschiedet hatten, war noch mehrmals von “Bidens zweiter Amtszeit” die Rede. Bob Inglis, Gründer der konservativen Klima-Initiative RepublicEn, sieht die Anreize aus dem IRA im Falle einer Wahl Harris’ auch deshalb als sicher an. “Klimamaßnahmen werden in einer Harris-Regierung mit Sicherheit ganz oben auf der Regierungsagenda stehen”, sagte der Republikaner und Trump-Gegner zu Table.Briefings.
Das wichtigste Klimagesetz der vergangenen Jahre ist schließlich überaus erfolgreich. Unter der Biden-Regierung haben private Unternehmen bislang rund 910 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen in Zukunftsindustrien angekündigt, wie das Weiße Haus vor wenigen Tagen mitteilte. Davon profitieren vor allem jene Branchen, die für die massiven Steuererleichterungen aus dem IRA infrage kommen. Fast die Hälfte der Mittel soll in die Halbleiter- und Elektronikproduktion fließen, weitere 177 Milliarden Dollar in die Elektroauto- und Batterieherstellung.
Matt Piotrowski geht davon aus, dass die bisherige Vizepräsidentin den Kampf gegen den Klimawandel noch verstärken dürfte. “Harris’ bisherige Haltung zum Klimawandel lässt darauf schließen, dass sie wahrscheinlich progressiver sein wird als Präsident Biden“, schreibt der leitende Direktor für Politik und Forschung beim Washingtoner Beratungsunternehmen Climate Advisers in einem Beitrag. Sie könnte strenger gegenüber der fossilen Brennstoffindustrie sein als ihr Vorgänger.
Als Generalstaatsanwältin von Kalifornien habe Harris mehrfach rechtliche Schritte gegen große Ölgesellschaften eingeleitet und damit ihre entschlossene Haltung unter Beweis gestellt, schreibt Piotrowski. Und nicht zuletzt forderte sie während ihrer Präsidentschaftsbewerbung vor vier Jahren eine CO₂ -Steuer und zehn Billionen Dollar an Klimaausgaben. Ihr Ziel war eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2045.
Daneben sprechen ihre jüngsten Entscheidungen für sich: Mit Tim Walz, dem Gouverneur von Minnesota, hat sich Harris einen besonders klimafreundlichen Vizekandidaten ins Team geholt. Bis zum Jahr 2040 will sein Bundesstaat vollständig auf kohlenstofffreien Strom umstellen. Im vergangenen Jahr hatte Walz ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet.
Diese Haltung könnte sich auch noch nachträglich im IRA niederschlagen. “Eine abermalige demokratische Administration wird noch in beträchtlichem Umfang Maßnahmen nachlegen müssen, um das aktuelle Klimaziel für 2030 zu erreichen”, schreibt SWP-Analystin Sonja Thielges in einer aktuellen Analyse. Einige Regulierungen dafür seien schon in Arbeit, so etwa Leitlinien für IRA-Steuererleichterungen für sauberen Strom und Wasserstoff. Thielges erwartet, dass diese Arbeit unter Harris fortgeführt werde. Daneben sind auch andere Vorgaben schon in Planung, auf die Harris dann Einfluss nehmen könnte – so etwa die Festsetzung von Emissionsgrenzen für bereits bestehende Gaskraftwerke.
Eine Abkehr vom IRA erscheint ohnehin schwer, wie Thielges in ihrer Analyse aufzeigt. “Um ein Gesetz zu streichen, braucht es ein neues Gesetzesverfahren und in aller Regel eine Mehrheit von 60 Stimmen im US-Senat”, schreibt sie. Nicht einmal eine republikanische Mehrheit könnte also den IRA gefährden. Denn laut den aktuellen Prognosen würde das Ergebnis knapp ausfallen, betont Thielges. Hinzu kommt: “Der Großteil der Gelder aus dem Gesetz fließt an republikanische Staaten, auch wenn diese allesamt gegen den IRA gestimmt haben.” Die Staaten, so die Expertin, könnten daher für eine gewisse Stabilität bei der US-Klimapolitik sorgen. Schließlich findet das Subventionsprogramm parteiübergreifend Anhänger.
Bob Inglis von RepublicEn sieht deshalb gerade im IRA eine Chance für Harris. Sie werde mit ihrer Klimapolitik dann Erfolg haben, wenn sie die Polarisierung beim Thema Klima durchbrechen könne, sagte er. Das könne ihr gelingen, indem sie echte Konservative bei der Suche nach Lösungen willkommen heißt. Ein erstes Zugeständnis scheint Harris den Republikanern vor wenigen Wochen bereits gemacht zu haben. Als Präsidentschaftsbewerberin vor vier Jahren hatte die Demokratin noch versprochen, im Falle einer Wahl das Fracking landesweit zu verbieten. In einem Interview mit dem US-Sender CNN hatte Harris ihre Meinung geändert. Sie habe erkannt, dass “wir wachsen und eine saubere Energiewirtschaft aufbauen können, ohne Fracking zu verbieten”. Laurin Meyer

Herr Sautner, kümmern sich Investoren tatsächlich um Biodiversität?
Ja, unsere Studie zeigt, dass schwindende Biodiversität vom Kapitalmarkt als Risiko wahrgenommen wird. Das ist das Thema, welches nach den Risiken des Klimawandels aktuell institutionelle Investoren am meisten beschäftigt. Das zeigt aber nicht nur die Studie, die das statistisch in den Aktienkursen nachweist.
Wie gefährden Unternehmen die Artenvielfalt?
Natürlich spielen Treibhausgas-Emissionen da eine Rolle. Doch es ist nicht so, dass es eine perfekte Korrelation gibt. Auch Wasserverschmutzung und besonders die Landnutzung bedrohen die Artenvielfalt. Etwa wenn Unternehmen Wälder abholzen, Bodenschätze fördern oder Viehwirtschaft betreiben. Dazu zählen insbesondere indirekte Effekte über die Lieferkette. Das betrifft vor allem Produzenten von Nahrungsmitteln, Papierproduktion und natürlich alles, was mit dem Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle zu tun hat. Und daraus ergeben sich die nächsten Risiken.
Haben Sie ein Beispiel für diese Risiken?
Ja, da fallen mir Touristikunternehmen ein, die Hotels in Ägypten betreiben. Urlauber fliegen zum Tauchen dorthin. Wenn die Biodiversität zurückgeht, Fische und Korallen sterben, dann haben sie Probleme mit ihrem Hotel, weil die Taucher nicht mehr kommen. Die Logik ist also, dass Unternehmen nicht nur vom Klimawandel, sondern auch vom Verlust der Artenvielfalt ökonomisch betroffen sind. Studien zeigen, dass unser Wirtschaftssystem stark von sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen abhängt. Das heißt: Für wirtschaftliche Prosperität brauchen wir Naturkapital oder auch Biodiversität. Das nehmen auch die Anleger wahr.
Was haben sie dazu herausgefunden?
In unserer Studie zeigen wir, dass Unternehmen, die die Artenvielfalt negativ beeinflussten, seit der Kunming-Erklärung im Jahr 2021 höhere Aktienrenditen liefern mussten als Unternehmen, die weniger negativen Einfluss haben. Vor diesem Ereignis ist kein Unterschied in den Daten zu finden. Anleger verlangen also seitdem eine Risikoprämie von diesen Unternehmen. Das können fünf Prozent oder mehr sein. Damit möchten Anleger künftige Verluste kompensieren, die sie bei diesen Unternehmen aufgrund ihres Handelns erwarten.
Was hat die Kunming-Erklärung ausgelöst?
Auf dieser Konferenz haben sich Staaten 2021 ersten Biodiversitätszielen verpflichtet, ähnlich wie es beim Pariser Klimaabkommen mit dem 2-Grad-Ziel passiert ist. Kunming ist zwar nicht so bekannt, hatte aber einen spürbaren Einfluss auf das Handeln von Investoren. Das wurde besonders in den Tagen nach der Erklärung sichtbar. Da gingen die Aktienkurse von den Unternehmen runter, die Artenvielfalt besonders gefährden.
Welche Risiken befürchten Anleger noch?
Übergangsrisiken, die entstehen, wenn eine Regulierung erwartet wird. Das war nach dem Kunming-Abkommen so. Das setzt die Unternehmen, die Natur zerstören, zunehmend unter Druck, etwa durch eine CO₂-Steuer. Interessant ist dabei, dass in Ländern, in denen der Schutz von Artenvielfalt eine untergeordnete Rolle spielt, die Risikoprämie höher ist.
Wo kann man die Reaktion der Anleger noch beobachten?
Das sieht man, wenn man darauf achtet, über was auf Investoren-Konferenzen gesprochen wird, worüber Analysten aktuell Berichte für ihre Anleger schreiben und welche Risikomanagement-Systeme und Daten sie gerade kaufen. Aber auch Investoren engagieren sich gegenüber Unternehmen. Deswegen ist es nicht überraschend, dass wir dies auch statistisch in den Aktienmärkten nachweisen können.
Reagieren Unternehmen bereits auf den Druck?
Die betroffenen Unternehmen haben höhere Kapitalkosten. Und jeder CFO hat natürlich ein Interesse, die Kapitalkosten zu reduzieren. Also dürften die Unternehmen auch nicht erst warten, bis die Investoren anklopfen. Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie diese Abhängigkeiten abbauen können, etwa indem sie ihre Lieferketten umstellen und diversifizieren. Machen Lebensmittelunternehmen versuchen beispielsweise verstärkt auf regenerative Landwirtschaft zu setzen, durch die Artenvielfalt stärker geschützt wird.
Führt der ESG-Backlash an den Aktienmärkten dazu, dass Biodiversität durch die Unternehmen ignoriert wird?
Einen Teil des Backlashes kann ich verstehen, weil viele Themen übertrieben wurden, viele Ziele versprochen wurden, die nicht eingehalten werden konnten. Beispielsweise wird häufig versprochen, dass ESG-Fonds überdurchschnittliche Renditen abwerfen werden. Wenn aber gleichzeitig argumentiert wird, dass ESG-Fonds auch weniger riskant sind, dann passt das nicht zusammen. Mein Gefühl ist, dass man von dem Überbegriff ESG weggehen und über konkrete Risiken sprechen sollte. Es ist immer gut, wenn es eine Studie wie unsere gibt, die zeigt, dass das Thema wirkliche Relevanz für Unternehmen hat. Und wir haben nun eine breite Evidenz, dass diese Risiken eingepreist sind. Das kann kein Investor, egal wie er zur ESG steht, ignorieren.
Zacharias Sautner ist Mitglied des European Corporate Governance Institute (ECGI) und Professor für Nachhaltige Finanzen an der Universität Zürich. Dort forscht er zu Klimawandel, Biodiversität und den Finanzmärkten. Davor war er Professor für Finanzen an der Frankfurt School of Finance & Management.
Bereits im Mai hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir an die EU-Kommission appelliert, Tempo bei den Vorbereitungen für den Anwendungsstart der europäischen Anti-Entwaldungsverordnung (EUDR) zu machen. Passiert ist seither wenig. Mit einem Schreiben im Namen der Bundesregierung an den exekutiven Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und kommissarischen Umweltkommissar, Maroš Šefčovič, hat Özdemir seiner Forderung nach Aufschub der EUDR-Umsetzung deshalb nun Nachdruck verliehen.
Özdemir fordert in dem Schreiben, das Table.Briefings vorliegt, den Anwendungsstart der EUDR “dringend” um ein halbes Jahr zu verschieben – vom 30. Dezember 2024 auf den 1. Juli 2025. Vier Monate vor dem planmäßigen Start fehlten wichtige Umsetzungselemente wie die Einstufung Deutschlands als Land mit geringem Entwaldungsrisiko, schreibt Özdemir.
“Die EU-Kommission muss endlich aus der Sommerpause kommen und Klarheit schaffen”, so der Grünen-Politiker weiter. Die Voraussetzungen für eine angemessene Vorbereitung der Wirtschaft und eine effiziente nationale Anwendung müssten unverzüglich geschaffen werden. Die Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft bräuchten ausreichend Zeit, um sich vorzubereiten. “Sonst drohen Lieferketten zum Ende des Jahres zu reißen – zum Schaden der deutschen und europäischen Wirtschaft, der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Drittstaaten sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher”, mahnt Özdemir.
Das Ziel der EUDR, den notwendigen globalen Waldschutz zu stärken, stehe zwar außer Frage, die Umsetzung müsse aber praktikabel, bürokratiearm und reibungslos funktionieren, fordert der Bundeslandwirtschaftsminister. “Die EU-Kommission kann hier alle Voraussetzungen im Alleingang schaffen, ohne die EUDR neu zu verhandeln.”
Erst am Dienstag hatten Mitglieder der brasilianischen Regierung Vertreter der EU-Kommission in einem Brief dazu aufgefordert, die Bestimmungen der EUDR nicht wie geplant Ende des Jahres umzusetzen, sondern zu überarbeiten, um brasilianische Exporte nicht zu gefährden. Vertreter der US-Regierung hatten die EU bereits Ende Mai gebeten, die Umsetzung zu verschieben.
Gemäß der Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, so der volle Titel, sollen Unternehmen die Vorschriften eigentlich ab dem 30. Dezember 2024 anwenden, kleinere Unternehmen ab Ende Juni 2025. Dann dürfen sie Einfuhren bestimmter Produkte – unter anderem Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz – nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese bestätigt, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt, und dass bei seiner Herstellung die lokale Gesetzgebung eingehalten wurde.
Kritik, der zufolge die Kommission wichtige Grundlagen für die Umsetzung der EUDR noch nicht vorgelegt habe – etwa bestimmte Leitlinien und das Länder-Benchmarking – war zuletzt von vielen Seiten zu vernehmen. Mit dem Länder-Benchmarking will die Kommission jedem Land eine bestimmte Risikostufe für Entwaldung zuweisen. heu
Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wünscht sich, dass Nachhaltigkeitspolitik gesetzlich im Bundestag verankert wird. In einer Stellungnahme kritisiert er, dass das Parlament aktuell lediglich die Möglichkeit habe, durch den Beirat Position zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) zu beziehen. “Ganz wichtig ist: Der Bundestag als höchstes deutsches Verfassungsorgan muss Taktgeber bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele werden”, sagte Beirats-Mitglied Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) zu Table.Briefings. “Wir brauchen eine Nachhaltigkeitsgesetzgebung, die die DNS in den Bundestag holt.”
Auch zu den Inhalten der DNS-Weiterentwicklung äußerte sich der Beirat. Er bemängelt etwa, dass es “oft an Konkretheit, Überprüfbarkeit und Umsetzungssicherheit bei Zielen und Maßnahme” mangele. Er empfiehlt, “einen besonderen Fokus auf die Indikatoren zu legen, bei denen laut der Analyse des Statistischen Bundesamts eines wesentliche Zielverfehlung droht”. Brinkhaus: “Wir wollen weniger weiche Prosa und mehr Konzentration auf die konkreten und messbaren Ziele. Die Silostruktur der Ministerien bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele von Klima bis Gesundheit muss aufgebrochen werden.” Für künftige Weiterentwicklungen sollte es dem Beirat zufolge einen “übergeordneten Prozess zur Evaluation der bestehenden Indikatoren” geben, “der die Indikatoren grundsätzlich neu denkt”.
Im Fokus des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung steht die Überprüfung und Bewertung von Gesetzentwürfen und Verordnungen anhand der Ziele der DNS. Die Dialogfassung von deren Weiterentwicklung hat die Regierung Anfang Juni veröffentlicht; die Öffentlichkeit konnte sie zwei Monate lang kommentieren. Spätestens Anfang 2025 will die Regierung die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie beschließen. maw
Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament (S&D) hat Delara Burkhardt zur neuen Berichterstatterin des Umweltausschusses (ENVI) für die Green Claims-Richtlinie ernannt. Auch der Binnenmarktausschuss (IMCO), der gleichberechtigt an den Verhandlungen beteiligt ist, wird in den kommenden Tagen einen neuen Berichterstatter auswählen. Diese Neubesetzung ist notwendig, weil die bisherigen Berichterstatter Cyrus Engerer (S&D) und Andrus Ansip (Renew) bei den Europawahlen nicht erneut angetreten waren.
Die Richtlinie über umweltbezogene Werbeaussagen, so die deutsche Bezeichnung, soll Angaben über die Umweltfreundlichkeit von Produkten und Dienstleistungen regulieren. Ziel ist, Greenwashing zu bekämpfen und Verbraucherinnen und Verbrauchern verlässliche Informationen zu garantieren. Das EU-Parlament hat bereits im März seine Verhandlungsposition beschlossen, der Umweltrat im Juni. Die Trilogverhandlungen können beginnen, sobald die neue EU-Kommission ihre Arbeit aufgenommen hat.
Burkhardt sagte, sie werde sich für ein starkes Rahmenwerk einsetzen. Mit der Richtlinie könne die EU wirksam Alltagsbetrug durch irreführende Werbeversprechen bekämpfen. Sie werde das Mandat des EU-Parlaments in den Verhandlungen verteidigen, insbesondere die “Anforderungen für eine ex-ante Überprüfung von Umweltaussagen durch Dritte und Einschränkungen bei Aussagen über CO₂-Kompensationen.” Burkhardt ist umweltpolitische Sprecherin der S&D-Fraktion und war in der vergangenen Legislaturperiode unter anderem Schattenberichterstatterin für die Verpackungsverordnung. leo
Im Verkehrssektor drohen in den 2030er Jahren Fahrverbote und Auto-Stilllegungen, wenn die Bundesregierung weiterhin wenig unternimmt, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Davor warnt eine neue Studie im Auftrag von Greenpeace und Germanwatch, die Table.Briefings vorab vorlag. Je später die Bundesregierung aktiv wird, desto drastischer seien die nötigen Eingriffe, so die Studie.
Die Autorinnen und Autoren vom New Climate Institute haben mehrere Szenarien analysiert. Würde die Regierung weiterhin zu zögerlich handeln, müsste sie ab 2030 harte Maßnahmen ergreifen, da die Emissionen fast doppelt so schnell (um 18,2 Millionen Tonnen pro Jahr) sinken müssten, als wenn sofortige Maßnahmen ergriffen würden:
Bei sofortigem entschiedenem Handeln müssten die Emissionen im Verkehrssektor hingegen um 10,3 Millionen Tonnen pro Jahr sinken. Erforderliche Maßnahmen wären:
Die Autorinnen und Autoren warnen, dass andere Sektoren die Zielverfehlung des Verkehrssektors kaum auffangen könnten. Die Nutzung von E-Fuels für den nationalen Verkehrssektor sei ebenfalls kein Ausweg, da sie in anderen Sektoren (Flug- und Schiffsverkehr) gebraucht würden und dort hohe Preise gezahlt würden, weil es dort kaum andere Klimaschutzmaßnahmen gäbe. Doch die Autorinnen und Autoren zeigen sich auch optimistisch: “Bei ausreichend politischem Willen steht einer schnellen Umsetzung ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor nichts entgegen.” nib
In ihrem letzten Jahresbericht “State of the Energy Union” äußerte sich die scheidende EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Mittwoch optimistisch, dass die EU ihre Klimaziele im Energiebereich erreichen könne. Ein Zeichen dafür sei, dass im ersten Halbjahr 2024 mehr Strom aus Windkraft und Solar produziert worden sei als aus fossilen Energiequellen. Allerdings seien die Energiepreise in Europa weiterhin zu hoch. Industriestrom, so heißt es in dem Bericht, sei zwei bis dreimal so teuer wie in den USA, Erdgas koste sogar das drei- bis sechsfache. Die mittelfristige Lösung für dieses Problem sei ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion und der Ersatz von Erdgas mit grünem Wasserstoff in einigen Industriesektoren.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat die EU alle ihre diesbezüglichen Ziele bislang verfehlt.
Auch bei grünem Wasserstoff sieht es offenbar schlecht aus: Statt gesicherter Zahlen legte die Kommissarin nur Schätzungen der Internationalen Energie-Agentur über den zeitnahen Aufbau der Produktionskapazitäten vor. Den Nachfragen von Journalisten nach den Wasserstoff-Zielen bis 2030 wich Simson aus.
Das bislang gültige Ziel, ab 2030 zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff in der EU zu produzieren und weitere zehn Millionen Tonnen zu importieren, wollte sie weder bestätigen noch abräumen. In dem Bericht heißt es jedoch, dass viele Bauprojekte für Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff herstellen können, vor der finalen Finanzierungsentscheidung stünden. Im Juli hatte der EU-Rechnungsprüfungshof die offiziellen Ziele im Wasserstoffbereich als unrealistisch eingeschätzt. av
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert angesichts der Haushaltslage vieler Kommunen eine stärkere Förderung der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude durch Bund und Länder. “Andernfalls werden wir die Klima- und Sanierungsziele in Deutschland bis 2045 nicht erreichen“, warnte DStGB-Hauptgeschäftsführer André Berghegger im Gespräch mit Table.Briefings.
Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) hatte am Montag eine Studie zum energetischen Sanierungsbedarf öffentlicher Gebäude in Deutschland vorgestellt. Demnach belaufen sich die notwendigen Investitionen für die Liegenschaften von Bund, Ländern und Kommunen bis 2045 auf insgesamt 120 Milliarden Euro. Das entspricht sechs Milliarden Euro pro Jahr. Laut Dena entfallen davon zwei Drittel auf Städte und Gemeinden.
“Der energetische Sanierungsbedarf der über 180.000 kommunalen Gebäude mit jährlich über vier Milliarden Euro überfordert zahlreiche Städte und Gemeinden finanziell”, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Berghegger. Schon heute gebe es einen Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur von fast 186 Milliarden Euro. “Hinzu kommt ein Finanzierungssaldo der kommunalen Haushalte von derzeit 6,8 Milliarden Euro, das im kommenden Jahr auf über 13 Milliarden Euro anwachsen wird.”
Programme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zielen Bergherr zufolge “in die richtige Richtung, sind in der Förderhöhe aber nicht ausreichend und decken nur Teilbereiche ab”. Unverständlich sei zudem, dass der Bund das “langjährige Erfolgsprogramm” zur energetischen Stadtsanierung Ende letzten Jahres abrupt beendet habe. Nach Einschätzung von Berghegger war dies ein “ein völlig falsches Signal und sollte rückgängig gemacht werden”.
Mit Blick auf die großen Einsparpotenziale nach einer energetischen Sanierung mahnte Berghegger “schnelles und gezieltes Handeln” an. Laut Dena-Studie stehen dem Gesamtinvestitionsbedarf von 120 Milliarden Euro bereits in den ersten zwanzig Jahren Energiekosteneinsparungen von 45 Milliarden Euro gegenüber. Nach weiteren zwanzig Jahren hätten sich die Investitionen amortisiert. ch
Anlässlich der laufenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 hat ein Bündnis aus Verbänden und Gewerkschaften eine Aufstockung der Trassenpreisförderung um mindestens 400 Millionen Euro gefordert. Ansonsten drohe im kommenden Jahr ein Anstieg der Kunden- und Verbraucherpreise, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Befürchtet werde ein Plus von 16 Prozent im Schienengüterverkehr und von 19 Prozent im Fernverkehr.
“Wir appellieren an die Parlamentarier, eine Lösung für die stark steigenden Trassenpreise zu finden. Kurzfristig geht das nur, indem der Bund die Trassenpreise deutlich stärker bezuschusst”, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Zwar sei für den Verkehrsetat 2025 bereits eine leichte Anhebung der Förderung vorgesehen, dennoch fehlten weiterhin mindestens 100 Millionen Euro im Schienengüterverkehr und 300 Millionen Euro im Fernverkehr.
Hintergrund ist eine kurzfristige Einigung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner von Mitte August. Sie sieht vor, dass zur Einhaltung der Schuldenbremse die eigentlich für den Bundeshaushalt 2025 vorgesehenen Zuschüsse an die DB-Infrastruktursparte DB Infrago in Höhe von 4,5 Milliarden Euro jetzt als zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit der bereits geplanten Aufstockung um 5,9 Milliarden Euro erhöht sich das Eigenkapital der Bahn damit um 10,4 Milliarden Euro.
Da das Eisenbahnregulierungsgesetz aber eine hohe Eigenkapitalverzinsung vorschreibt, müssten nun die Trassenpreise erhöht werden, um die Zinsen zu erwirtschaften. Diese Kosten würden weitergegeben; in der Folge müssten alle, die die Bahn nutzen, “mit erheblichen Preiserhöhungen rechnen”, so das Bündnis. Ihm gehören neben der Allianz pro Schiene die Gewerkschaften EVG und Verdi sowie die Deutsche Umwelthilfe, die Klima-Allianz, Greenpeace und Germanwatch an.
Um künftig auf “Ausweichfinanzierungsmodelle, die neue Probleme erzeugen” verzichten zu können, schlägt die Allianz pro Schiene neben dem Abbau klima- und umweltschädlicher Subventionen ein grundlegend anderes Modell der Infrastrukturfinanzierung vor. “Langfristig wäre ein Schienenfonds die beste Lösung, um Stabilität und Verlässlichkeit in die Schieneninvestitionen zu bringen”, so Flege. ch
Deutsche Unternehmen wandeln sich zu langsam – Süddeutsche Zeitung
Berater von Kearney und IW Consult haben 500 Firmen befragt und dabei festgestellt, dass nur rund jedes zehnte Unternehmen ein “Transformationsleader” bei Nachhaltigkeit oder Digitalisierung sei. Vor allem traditionelle Branchen, die die Basis des Wohlstands legen, seien “strukturverharrend” – im Maschinenbau und der Prozessindustrie etwa sind kaum Leader zu finden, schreibt Elisabeth Dostert. Zum Artikel
Wall Street quietly turns tail on its sustainability commitments – Bloomberg
Der ESG-Backlash in den USA hält an, schreibt Alastair Marsh. Unter dem Druck rechtspopulistischer Politiker begraben weitere Finanzfirmen Nachhaltigkeitsziele, darunter jüngst Morgan Stanley, das sich nicht mehr zur Reduzierung von Plastikmüll bekennen will. Vorstandschefs sorgen sich dagegen mehr um die Folgen von Inflation, Künstlicher Intelligenz und der gegenwärtigen Geopolitik. Zum Artikel
Panda auf Abwegen – Tagesschau
Der vom WWF und der Deutsche-Bank-Tochter DWS gemeinsam aufgelegte Fonds “DWS ESG Blue Economy” soll weit weniger nachhaltig sein als versprochen. Zu den Unternehmen im Anlageuniversum zählt etwa eine der größten Kreuzfahrtgesellschaften. Einem Investigativteam zufolge beanstanden WWF-Mitarbeiter die Auswahl intern schon länger. Zugleich hat die Umweltorganisation finanzielle Probleme und scheint auf Geld aus Kooperationen angewiesen zu sein. Zum Artikel
Finanzindustrie will mit nachhaltigen Fonds in Rüstung investieren – Manager Magazin
Die Kriege und Konflikte der letzten zweieinhalb Jahre haben den Blick auf die Rüstungsindustrie verändert. Es brauche mehr Investitionen in der Verteidigung, sagt die Politik – und jetzt wollen Deutsche Banken- und Fondsverbände nachhaltigen Anlageprodukten nicht mehr verbieten, Geld in konventionelle Rüstungsgüter zu stecken. Mit den Prioritäten von nachhaltig interessierten Anlegern deckt sich das allerdings nicht, wie etwa der Nachhaltigkeitschef von Union Investment erklärt. Zum Artikel

Seit dieser Woche gibt es sie wieder: Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen. Sie sind das sichtbare Zeichen eines Abschottungswettbewerbs, der derzeit in Deutschland stattfindet. Alles Schlechte kommt von außen, könnte man meinen.
Die Neugierde nach etwas Unbekanntem wird derzeit durch Angst überlagert, es wird das Trennende betont und nicht das Einende. Gräueltaten wie in Solingen, Anschlagsversuche wie in München und die latente Gefahr für die Allgemeinheit, die von ihnen ausgehen, machen uns betroffen, aber auch misstrauisch gegenüber anderen Menschen. Deutschland, der Export- und Reiseweltmeister, fühlt sich derzeit am wohlsten auf ausgetretenen Wegen.
Dabei müssen wir gerade jetzt den Blick weiten, über die eigenen Grenzen und Mauern hinweg. Denn die großen Probleme unserer Zeit können nur angegangen werden, wenn sie global betrachtet werden. Beispiel Klimakrise: Ob Hausbesitzerin im Ahrtal oder Bäuerin in Bangladesch – sie sind Teil einer Schicksalsgemeinschaft geworden. Die Frage ist nun, ob wir angesichts der gemeinsamen Herausforderungen bereit sind, dies anzuerkennen und solidarischer zu werden. Eine Insel aufzubauen und die Gitter hinunterzulassen wird uns nicht helfen.
Bei Fairtrade haben wir vor allem die Landwirtschaft im Blick, jener Sektor, der die meisten Menschen auf diesem Planeten beschäftigt. Hier war globale Solidarität noch nie so notwendig: Genau wie in Deutschland treffen die Auswirkungen der Klimakrise Bäuerinnen und Bauern in Lateinamerika, Asien und Afrika hart. Sie benötigen Beratung, Trainings und Finanzhilfen, um die aktuellen Herausforderungen zu überstehen. Und die Unterstützung eines anderen teils dieser Gemeinschaft: der Konsumentinnen und Konsumenten, die sich am Regal für Produkte entscheiden, bei denen Ausbeutung kein Teil des Geschäftsmodells ist.
Immerhin achten laut neuesten Studien mehr als 40 Prozent der Deutschen beim Einkauf auf Nachhaltigkeit, und der Markt für nachhaltige Produkte wächst wieder. Das ist eine gute Nachricht. Diese Menschen machen sich über den Preis hinaus Gedanken – darüber, wie die Lebensmittel, die sie konsumieren, produziert werden, und auch darüber, wer sie unter welchen Bedingungen anbaut. Eine weitere positive Nachricht ist die zunehmende Zahl von Teilnehmenden an der am Freitag beginnenden Fairen Woche, die größte Aktion des fairen Handels in Deutschland. Tausende von Engagierten werden sich in den nächsten zwei Wochen bundesweit an Aktionen, Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen zum Thema fairer Handel beteiligen und den Gedanken der globalen Solidarität weitertragen.
Dieser Gedanke muss auch bei den Unternehmen fest verankert werden. Allein auf Freiwilligkeit zu setzen, hilft hier nicht, was unter anderem der Misserfolg des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) zeigte. Das hat auch die Politik festgestellt und das deutsche sowie das europäische Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, die Fairtrade trotz Mängel begrüßt.
Die Diskussionen im Vorfeld des Europäischen Sorgfaltspflichtengesetzes (CSDDD) machten allerdings deutlich, dass viele Firmen und auch Politiker eines noch nicht begriffen haben: Geschäftspraktiken, die nicht nachhaltig sind und auf Ausbeutung setzen, müssen endgültig der Vergangenheit angehören. Sie sind rechtlich und moralisch verwerflich. Und sie werden von den Konsumentinnen und Konsumenten im zunehmenden Maße geächtet.
Unternehmen sollten erkennen, dass sie langfristig nur dann ein sicheres Geschäft haben, wenn nicht nur die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch die Menschen am Anfang der Lieferkette ein würdiges Auskommen haben. Dazu gehört die Zahlung existenzsichernder Einkommen und Löhne, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen. Fairtrade hat dazu Referenzpreise für viele Produkte ausgerechnet sowie einen Plan, wie mit verschiedenen Maßnahmen Einkommen in der kleinbäuerlichen Wirtschaft und Löhne in Plantagen existenzsicherndes Niveau erreichen können.
Wer bei diesem Thema vorangeht, wird in Zukunft die Früchte ernten. Denn die Achtung der Menschenrechte und der Respekt für alle Menschen entlang der Lieferkette werden zunehmend zur Business-Grundlage. Dafür sorgt nicht nur die Politik, sondern auch der Markt.
Claudia Brück ist seit 2016 geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Fairtrade Deutschland e.V. Sie verantwortet die strategische Kommunikation, die entwicklungspolitische Positionierung und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern in der Zivilgesellschaft und der Entwicklungspolitik.
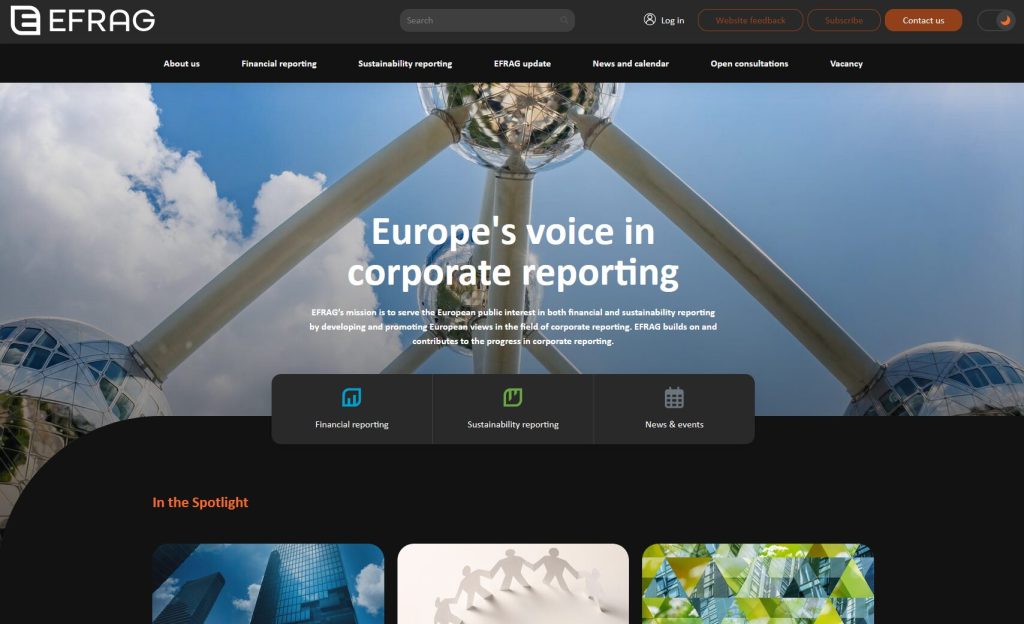
Seit mehr als zwanzig Jahren versucht die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Licht in das Dickicht der europäischen Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu bringen. Doch nun schaltet die Organisation mit Sitz in Brüssel von sich aus in den Dunkelmodus – und freut sich auch noch darüber.
Denn der “Dark Mode”, das neue Feature auf ihrer Website (oben rechts), “senkt den Energieverbrauch erheblich und unterstützt unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit”, wie es in einer Mitteilung heißt. Tatsächlich zeigt eine Studie der Purdue University, dass der Dark Mode bei voller Bildschirmhelligkeit durchschnittlich 39 bis 47 Prozent Strom spart. Allerdings: Je niedriger die eingestellte Helligkeit, desto geringer ist der Unterschied im Stromverbrauch zwischen Light- und Dark-Modus.
Neben dem Energieverbrauch gibt es aber noch andere gute Gründe, den Dark Mode einzuschalten – zumindest, wenn man nicht gerade im Büro sitzt. So stehen helles und blaues Licht, die durch den Dark Mode reduziert werden, im Verdacht, wach zu machen und Schlafprobleme zu verursachen.
Ob das tatsächlich so ist, kann man übrigens in der Nacht von Freitag auf Samstag ausprobieren: Dann findet die nächste Earth Night statt. Die Initiative Paten der Nacht ruft dazu auf, eine Nacht lang alle künstlichen Lichter auszuschalten. Damit soll ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und Lichtverschwendung gesetzt werden. Es muss ja auch nicht immer alles beleuchtet sein. Carsten Hübner
