wahrscheinlich wurde auf einem “Digital-Gipfel” der Bundesregierung noch nie so viel über Nachhaltigkeit gesprochen wie in diesem Jahr. Bei der Veranstaltung in Jena Anfang der Woche fand sich der Begriff im Untertitel (“Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.”) und in zahlreichen Diskussionsrunden wieder. Zwei Jugendliche formulierten auf der Bühne Forderungen wie die Reparierfähigkeit von Hardware und Umweltministerin Steffi Lemke prangerte an, dass die Digitalisierung Rohstoffe “verschlingen” würde.
Sieht man sich die Entwicklung an, muss man feststellen, dass das keine Übertreibung ist. Wie Laurin Meyer erklärt, wächst der Wasserverbrauch, der zur Kühlung von Rechenzentren notwendig ist, rapide an. Die Digitalisierung insgesamt und insbesondere KI-Anwendungen führen dazu, dass das Frischwasser vielerorts knapp werden kann. Eine fatale Konkurrenz, die da entstanden ist.
Aber es gibt auch die Gegenbewegung. Das konnte man beim Digital-Gipfel von Gründern, Wissenschaftlern und Unternehmern erfahren, die digitale Werkzeuge für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Und das zeigt auch Denise Baidinger, die wir Ihnen in unserer heutigen Ausgabe vorstellen möchten: Sie arbeitet daran, die Digitalisierung der Deutschen Bahn fair und ökologisch zu gestalten.


Kaum ein Gesetzgebungsverfahren wird derzeit mit solcher Spannung beobachtet wie das europäische Sorgfaltspflichtengesetz (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Am heutigen Mittwoch findet der nächste politische Trilog statt, das hochrangige Treffen der Verhandler aus EU-Parlament, Rat und Kommission. Nach den Terminen im Juni, Juli und September ist es der vierte Trilog. Eine finale Einigung wird allerdings nicht erwartet, bei zu vielen Themen liegen die Positionen noch zu weit auseinander.
Die EU-Kommission hatte im Februar 2022 den Entwurf für das entsprechende Gesetz vorgestellt. Dieser enthält umwelt- und menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten und verpflichtet große Unternehmen, Klimaübergangspläne zu erstellen. Als Vorbilder dienen das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, und das französische “loi de vigilance” aus dem Jahr 2017.
Beim heutigen Trilog könnten sich die Verhandler laut Informationen von Table.Media über den Anwendungsbereich einigen, der wohl dem Vorschlag der Kommission sehr nah bleiben würde. Nach dem Entwurf soll die CSDDD EU- und ausländische Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und mehr als 150 Millionen Euro Nettoumsatz jährlich umfassen. Für Unternehmen in Risikosektoren (unter anderem der Textil-, Landwirtschaft- und Rohstoffsektor) soll die Richtlinie schon ab 250 Beschäftigten und mehr als 40 Millionen Euro Nettoumsatz jährlich gelten.
Dies bedeutet eine starke Ausweitung gegenüber dem deutschen und dem französischen Gesetz, die für Unternehmen ab 3.000 bzw. 5.000 Angestellten gelten. In Deutschland werden ab 2024 Unternehmen ab 1.000 Angestellten betroffen sein. Auf viele andere Mitgliedstaaten hat dies kaum Auswirkungen, da die meisten dort ansässigen Unternehmen kleiner sind.
Nach Angaben einer Quelle im Parlament soll Artikel 25 aus dem Kommissionsentwurf, der eine zusätzliche Sorgfaltspflicht der Mitglieder der Unternehmensleitung vorsieht, beim heutigen Trilog gestrichen werden. Darüber hinaus steht auch die Definition der Sorgfaltspflichten und der Annexe sowie die Bestimmungen zu einer möglichen Vertragsbeendigung mit den Partnern im Falle negativer Auswirkungen (Artikel 7 und 8) auf der Agenda. Zudem soll über die Definition der Wertschöpfungskette gesprochen werden; von Parlamentsseite wird hier jedoch keine Einigung erwartet.
Für eine Reihe an Themen wird zunächst keine Lösung erwartet, einige davon werden vermutlich heute gar nicht angesprochen. Die spanische Ratspräsidentschaft will laut einem internen Kompromissvorschlag Lösungen finden, die “praxistauglich sind, Rechtssicherheit gewährleisten und keine übermäßigen Kosten für Unternehmen und Verwaltungen verursachen”.
Dazu gehört unter anderem die noch ungeklärte Frage, ob der Finanzsektor in den Anwendungsbereich einbezogen wird. Während das Parlament und die Kommission entsprechende Sorgfaltspflichten für Finanzinstitute fordern, hält der Rat dagegen. Auf Druck von Frankreich hatten die Mitgliedstaaten bereits in ihrer Allgemeinen Ausrichtung eine Sonderrolle für den Finanzsektor beschlossen. Demnach sollte es jedem Mitgliedstaat selbst überlassen werden, ob Finanzdienstleistungen unter das Gesetz fallen oder nicht. Das Parlament fordert, die Sorgfaltspflichten auf den nachgelagerten Teil der Wertschöpfungskette von Finanzunternehmen anzuwenden und die Hauptmärkte des Finanzsektors (Investitionen, Banken, Versicherungen) einzubeziehen.
Die Ratspräsidentschaft schlägt nun vor, aufgrund “des empfindlichen Gleichgewichts, das im Rat in dieser Frage erreicht wurde, und der Schwierigkeiten, einen Kompromiss mit dem Standpunkt des Parlaments zu finden”, den Finanzsektor zunächst komplett aus dem Anwendungsbereich auszuschließen und die Ausweitung auf diesen auf eine spätere Phase zu verschieben. Dafür soll dem Gesetzestext eine Überprüfungsklausel hinzugefügt werden; Rat, Parlament und Kommission sollen eine interinstitutionelle politische Erklärung vereinbaren.
Entgegen dem Standpunkt seiner Parlamentskollegen äußerte Axel Voss (EVP), Schattenberichterstatter für die CSDDD im EU-Parlament, im Gespräch mit Table.Media Verständnis für diese Ausnahme. “Man kann den generellen Ansatz des Lieferkettengesetzes nicht eins zu eins auf den Finanzsektor übertragen, das würde zu großer Unsicherheit führen. Deshalb bräuchte dieser Sektor eigentlich speziellere Vorschriften”.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum unterstützt die Einbeziehung des Sektors. Damit das private Finanzwesen den grünen Wandel in der Realwirtschaft wirksam unterstützen könne, sei eine sektorübergreifend einheitliche Regulierung entscheidend, sagte Frank Elderson, Mitglied des EZB-Direktoriums, vergangene Woche auf einer Konferenz. Den Finanzsektor in den Anwendungsbereich der CSDDD einzuschließen, könne dazu beitragen, dass Banken und andere Finanzinstitute “systematisch Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Entscheidungsfindung und ihr Risikomanagement integrieren”. Darüber hinaus entstünde so mehr Sicherheit in Bezug auf die Verpflichtungen und Prozessrisiken des Sektors.
In der Zivilgesellschaft stößt die Ratsposition auf scharfe Kritik: “Banken und Investoren haben einen Freifahrtschein, um von Menschenrechts- und Umweltschäden zu profitieren“, sagte Aurelie Skrobik, Referentin für Unternehmensverantwortung bei der Menschenrechtsorganisation Global Witness. “Der Missbrauch wird Teil des Geschäftsmodells der Banken bleiben, wenn die EU sich nicht auf ein starkes Gesetz einigt, das den Finanzsektor zwingt, sauberer zu werden.”
Auch die Definition von Umweltauswirkungen im Gesetzestext bleibt ein strittiges Thema. Während das Parlament eine Orientierung an konkreten Kategorien wie Klimaauswirkungen, Biodiversität oder Luft- und Wasserverschmutzung fordert, sind die Vorschläge von Kommission und Rat hier eingeschränkter: Unternehmen sollen Auswirkungen nur ermitteln und gegen sie vorgehen, wenn sie gegen internationale Abkommen verstoßen. Die Ratspräsidentschaft schlägt als Kompromiss die Aufnahme weiterer Abkommen vor.
Umwelt-NGOs befürchten, dass selbst ehrgeizige Sorgfaltspflichten aus ökologischer Sicht ihre Wirkung verfehlen, wenn Rat und Kommission sich durchsetzen und die Unternehmen nur begrenzt Umweltauswirkungen feststellen müssen. Denn die internationalen Umweltabkommen seien ein sehr fragmentierter Bereich des internationalen Rechts, erklärt Ceren Yildiz vom BUND. “Viele Fragen der Umweltzerstörung bleiben vollkommen unberührt. Es gibt zum Beispiel keinen globalen Pakt über den Schutz von Wäldern; das Plastikabkommen wird derzeit erst verhandelt.”
Als Vorbild für den Ansatz von Rat und Kommission diente das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das für den Nachweis von Umweltauswirkungen auf internationale Verträge wie das Stockholmer und das Baseler Übereinkommen, die den Einsatz von Schadstoffen bzw. die Ausfuhr von Abfällen einschränken, verweist. Klimaauswirkungen werden gar nicht genannt. Im Rat hat sich die Bundesregierung zwar dafür eingesetzt, weitere Umweltübereinkommen in die Definition aufzunehmen und diese dadurch auszuweiten – allerdings lehnt sie die sogenannten Umweltkategorien, die das EU-Parlament vorschlägt, ab, und hat sich auch gegen eine Umsetzungspflicht für die Klimapläne der Unternehmen ausgesprochen (Artikel 15).
Die spanische Ratspräsidentschaft räumt nun allerdings ein Entgegenkommen ein und schlägt eine Mittelverpflichtung vor, mit genauen Vorgaben zum Inhalt der Klimapläne sowie einer Verknüpfung mit der Vergütung des Unternehmensvorstands. Dadurch soll ein stärkerer Anreiz für die Umsetzung des Plans geschaffen werden.
Für die Berichte nach dem deutschen LkSG diskutieren das Bundeswirtschafts- und das Bundesarbeitsministerium währenddessen eine Vereinfachung: Unternehmen sollen laut der Nachrichtenagentur Reuters mehr Zeit für ihre Berichte erhalten. Reuters hatte am Montag zunächst berichtet, dass es schon eine Einigung gegeben hätte, hatte dies dann jedoch korrigiert. Das Bundesjustizministerium erarbeite zurzeit einen Referentenentwurf auf Fachebene; entsprechende Rechtsänderungen würden gemeinsam mit dem BMWK und dem BMAS erörtert, berichtete Reuters am späten Montagabend. Eine Abstimmung in der Bundesregierung zu diesen Vorschlägen habe bisher noch nicht begonnen.

In West Des Moines haben sie ihre Lehren bereits gezogen. Künftige Projekte für Rechenzentren werde man nur berücksichtigen, wenn sie Technologien zum Wassersparen vorweisen können. So haben es zuletzt die örtlichen Wasserwerke beschlossen. In der Stadt im US-Bundesstaat Iowa hat Microsoft einen Hochleistungscomputer aufgestellt, um vielversprechende KI-Anwendungen zu trainieren. Doch im vergangenen Jahr schluckte allein die Kühlung des Rechenzentrums nach Angaben der Wasserwerke bis zu 43,5 Millionen Liter Wasser pro Monat – und damit ganze sechs Prozent des Gesamtverbrauchs der Stadt im Sommer.
Die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen dürfte in den kommenden Jahren den Verbrauch von Wasser massiv in die Höhe treiben. Laut einer Studie von Forschern der University of California in Riverside und der University of Texas in Arlington könnte der weltweite Bedarf allein für den KI-Bereich schon im Jahr 2027 für 4,2 bis 6,6 Milliarden Kubikmeter an Wasserentnahmen verantwortlich sein. Das wäre etwa die Hälfte des jährlichen Verbrauchs des Vereinigten Königreichs, erklären die Autoren. Während sich der Klimaschutz bislang besonders auf den CO₂-Fußabdruck von KI-Anwendungen durch den Energieverbrauch konzentriert hat, spiele das Bewusstsein für Wasser nur eine untergeordnete Rolle, kritisieren Experten. Und das zu einer Zeit, in der die globalen Temperaturen und die Meldungen über Dürren zunehmen und sich Deutschland eine Nationale Wasserstrategie gegeben hat, um den Mangel zu managen.
Shaolei Ren ist Professor für Computertechnik an der University of California in Riverside und Mitautor der Studie. Er schätzt, dass das Sprachmodell ChatGPT von Microsoft-Partner OpenAI durchschnittlich 500 Milliliter Wasser trinkt, wenn Nutzer der Anwendung zwischen zehn und 50 Eingabeaufforderungen oder Fragen stellen. Die genaue Menge variiere je nach Standort der Server und dem aktuellen Strommix. Ren bezeichnet die Zahlen gegenüber Table.Media als “besorgniserregend”. “Die Süßwasserknappheit ist wegen des raschen Bevölkerungswachstums, der schwindenden Ressourcen und der alternden Wasserinfrastruktur zu einer der größten Herausforderungen für uns alle geworden”, sagt er. Die Bemühungen in diesem Bereich lägen allerdings etwa zehn Jahre hinter denen im Bereich Kohlenstoff zurück. Um das Jahr 2010 herum hätten die großen Tech-Konzerne mit Initiativen zur Kohlenstoffneutralität begonnen, um das Jahr 2020 herum aber erst mit Schritten in Richtung positiver Wasserbilanzen. “Trotz seiner entscheidenden Bedeutung wird Wasser immer noch unverhältnismäßig weniger Aufmerksamkeit geschenkt als Kohlenstoff”, sagt Ren.
Die Unternehmen wiederum betonen, die Herausforderung längst erkannt zu haben. Die drei Großen der Branche – Microsoft, Meta und Google – haben sich dazu verpflichtet, bis 2030 “wasserpositiv” zu sein. Sie wollen bis dahin mehr aufbereitetes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, als sie selbst für die Kühlung der Zentren benötigen. Bislang nutzen die Konzerne Frischwasser, das mit der Trinkwasserversorgung konkurriert. Besonders in den USA und Europa setzen Datencenter auf die Methode der Verdunstungskühlung, bei der warme Luft Wasser verdunsten lässt und so die Zentren klimatisiert.
Noch ist die Bilanz negativ. Microsoft meldete für das vergangene Jahr einen um 34 Prozent gestiegenen Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr; bei Google, der Suchmaschinen-Tochter von Alphabet, betrug der Anstieg über denselben Zeitraum rund 20 Prozent.
Um das zu ändern, setzen die Konzerne nach eigenen Angaben auf zwei Strategien: Zum einen wollen sie Wasser effizienter nutzen, beispielsweise durch Kreislaufsysteme an ihren Standorten oder durch moderne Luftkühlungen. Zum anderen wollen sie Wasser in besonders trockenen Landesgegenden wieder zurückführen – etwa durch den Bau von Anlagen zur Abwasseraufbereitung.
Die Facebook-Mutter Meta hat seit 2017 in 25 verschiedene Aufbereitungsprojekte investiert. Sobald diese vollständig in Betrieb sind, sollen sie 7,2 Millionen Kubikmeter Wasser zurückführen, heißt es. Daneben hat Meta im vergangenen Jahr damit begonnen, mit höheren Temperaturen in ausgewählten Rechenzentren zu experimentieren. Die Datencenter wurden dort nicht mehr auf rund 29 Grad Celsius heruntergekühlt, sondern nur noch auf etwa 32 Grad. Im Sommer habe man damit den Wasserverbrauch um mehr als 50 Prozent senken können, mit geringen oder keinen Auswirkungen auf den Betrieb, wie das Unternehmen erklärt.
Google hat vor wenigen Wochen den Aufbau eines Rechenzentrums bei Mesa in Arizona angekündigt, das mit Luft statt Wasser gekühlt wird. Der Strom dafür soll vollständig aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Details zur Funktionsweise ließ der verantwortliche Google-Manager Joseph Kava gegenüber Reportern beim Spatenstich offen. Nur so viel: “Mein Innovationsteam hat daran gearbeitet, wie wir luftgekühlte Lösungen nutzen und sie genauso kostengünstig machen können wie wassergekühlte”, sagte er gegenüber US-Medien.
In seinem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht betont Google noch, dass wassergekühlte Rechenzentren durchschnittlich zehn Prozent weniger Energie verbrauchen als luftgekühlte. Deshalb arbeite das Unternehmen auch an Kühlsystemen aus Ab- und Meerwasser. Im Bundesstaat Georgia betreibt Google bereits seit einigen Jahren ein Rechenzentrum, das mit recyceltem Abwasser aus dem örtlichen Douglas County gekühlt wird.
Und auch Microsoft beteiligt sich an Aufbereitungsprojekten – insbesondere in wasserarmen Regionen, in denen der Konzern tätig ist. Insgesamt 40 Standorte hat der Konzern als vorrangig ausgemacht. Daneben investiere man viel in die Forschung, um den “Energieverbrauch und die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Umwelt zu messen”, wie eine Sprecherin auf Anfrage von Table.Media erklärt. Zuletzt hat der Konzern mit einer speziellen Kühlflüssigkeit experimentiert, die nicht leitfähig ist. Ganze Server-Racks können deshalb vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht werden.
Computertechniker Ren kritisiert jedoch, dass viele Unternehmen ihre Bemühungen bislang auf die Kühlung von Rechenzentren beschränken würden – und damit nur auf die direkten Auswirkungen des eigenen Betriebs (Scope 1). Dabei sorge auch der genutzte Strom je nach Energiequelle für indirekten Wasserverbrauch (Scope 2). Ebenso werde bei der Produktion der Hochleistungs-Chips für die Rechenzentren Wasser benötigt (Scope 3).
Doch für einen umfassenden Überblick mangele es an Transparenz, kritisiert der Experte. “Während die großen Technologieunternehmen versprechen, wasserpositiv zu sein, fehlen noch immer Details zum Wasserfußabdruck.” Das Datenblatt eines veröffentlichten KI-Modells enthalte standardmäßig den indirekten CO₂-Fußabdruck, der mit dem Energieverbrauch für das Modelltraining verbunden ist. “Leider enthält das Datenblatt aber so gut wie keine Informationen zum Wasser”, kritisiert Ren. “Das ist in etwa so, als würde man die Kalorienangaben auf dem Etikett eines Lebensmittels weglassen.” Laurin Meyer
22.11.2023, 14:00-15:30 Uhr
Online-Seminar THG-Bilanzierung in der Lieferkette Info & Anmeldung
22.11.2023, 13:30 Uhr
Online-Konferenz Shifting the Trillions – Finanzierung der Zukunftswirtschaft Info & Anmeldung
23.-24.11.2023, Berlin
Konferenz SDIA Green Coding Summit Info & Anmeldung
23.11.2023, 17:00-19:00 Uhr
Online-Diskussion Green Cities 2035: Smart City Info & Anmeldung
23.11.2023, 9:30-15:30 Uhr
Tagung 4. Konferenz zu Sustainability Transformation Info & Anmeldung
23.-24.11.2023, Berlin
Fachtagung Bundesprogramm Energieeffizienz Info & Anmeldung
28.11.2023, 17:00-20:00 Uhr, Berlin
Workshop Die große Transformation: Gestaltung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Zukunft Info & Anmeldung
29.11.2023, 18.00-20.00 Uhr, Berlin
Kongress Menschenrechte – Fundament der Weltordnung Info & Anmeldung
28.11.2023, Brüssel
Konferenz 2023 EFRAG Conference “European corporate reporting: two pillars for success” Info & Anmeldung
30.11.2023, 9:30-13:30 Uhr
Konferenz Policy Accelerator for Climate Innovation Info & Anmeldung
30.11.2023, 15:00-17:00 Uhr, Berlin
KPMG-Zukunftsgipfel ESG – jetzt die nachhaltige Transformation umsetzen Info & Anmeldung
1.12.2023, 11:30-14:00 Uhr, Berlin
Diskussion Wie kann die energetische Gebäudesanierung verbraucherfreundlich gestaltet werden? Info & Anmeldung
5.12.2023 · 17:30-20:15 Uhr, Berlin
Diskussion Klimakrise: Wie gelingt gesellschaftlicher Wandel? Info & Anmeldung
6.12.2023, 9:30-17:00 Uhr, Köln
Stakeholder-Dialog Polyproblem: Wie viel Disruption braucht die Plastik-Wende? Info & Anmeldung
Entgegen den ursprünglichen Ankündigungen der Koalitionsfraktionen wurde die von vielen Ökonomen als zu voraussetzungsreich kritisierte Klimaschutz-Investitionsprämie im Wachstumschancen-Gesetz nicht mehr verändert. Die Prämie, von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Katja Hassel (FDP), als “Kernstück des Gesetzentwurfs” bezeichnet, unterstützt betriebliche Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter mit bis zu 30 Millionen Euro.
Das Nadelöhr der Förderung ist jedoch ein Energiesparkonzept (“Audit”), das von einem der wenigen zertifizierten Energieberater erstellt werden muss oder bereits vorliegt. Der Bundesrechnungshof hatte daher kritisiert, dass nur “0,1 bis 0,5 Prozent” der Unternehmen in Deutschland die Beihilfe in Anspruch nehmen könnten. Auch das Bundesfinanzministerium rechnet mit nur 1.500 Förderanträgen. Dem widersprach nun Parsa Marvi gegenüber Table.Media, der die SPD im Bundestags-Finanzausschuss vertritt: “Wir haben jetzt schon nach unserer Kenntnis mindestens 90.000 Unternehmen, die über offizielle Energieaudits verfügen und somit Zugang zu der Investitionsprämie haben.”
Zudem fordert der Finanzausschuss die Regierung in einer Protokollnotiz auf, weitere Verbesserungen im nächsten Jahressteuergesetz umzusetzen. Für die grüne Bundestagsabgeordnete Katharina Beck gehört dazu, “die Investitionsprämie für Klimaschutz schnellstmöglich im Sinne der Technologieoffenheit” auszubauen und Erleichterungen für kleinere und mittlere Unternehmen auf den zu Weg bringen. Nach Informationen von Table.Media wird dabei über eine eventuelle Förderung von Solar-, Batterie- und Wasserstofftechnologie diskutiert.
Einer der wenigen anderen transformativen Bausteine im Wachstumschancen-Gesetz ist für die Koalitionsfraktionen auch die erweiterte steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für den Mietwohnungsbau. Hier konnten die Abgeordneten durchsetzen, dass bereits bestehende mit den im Wachstumschancen-Gesetz enthaltenen neuen Regelungen kombiniert werden können. Sofern die neuen Mietwohnungen dem Effizienzhaus-Standard 40 (EH 40) entsprechen sowie mit dem Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen versehen sind, seien bis zu elf Prozent steuerliche Abschreibungen möglich. Marvi sieht darin “einen enormen Impuls für das energieeffiziente Bauen”. Allerdings können die Bauträger auch ohne Nachhaltigkeitssiegel und Energiehaus-Standard nun sechs Prozent ihrer Investition abschreiben, was gerade im preisgünstigeren Segment die profitablere Variante sein könnte.
Nur eingeschränkt berücksichtigt wurde die Kritik der Deutschen Umwelthilfe an der Ausweitung des sogenannten Dienstwagenprivilegs, welches die NGO als “sozial ungerechte Subvention für Gutverdienende” bezeichnet hatte. Im ursprünglichen Gesetzentwurf plante die Bundesregierung, den maximalen Bruttolistenpreis von besonders geförderten E-Autos von bislang 60.000 auf 80.000 Euro zu erhöhen. Dieser Höchstpreis wurde durch das Parlament wieder auf 70.000 Euro verringert. Zudem wurde die Förderung von Hybridfahrzeugen eingeschränkt. Der Bundesrat berät das Gesetz am Freitag und wird es möglicherweise in den Vermittlungsausschuss verweisen. av
Die nationale Kontaktstelle der OECD in Frankreich prüft, ob der chinesische Onlinehändler Shein gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln für Arbeits- und Menschenrechte verstößt. Das teilte die Kontaktstelle vergangene Woche mit. Shein sagte zu Table.Media, man habe “umgehend” reagiert und sich mit der Kontaktstelle (NKS) getroffen. “Wir haben und werden auch weiterhin voll und ganz kooperieren, um etwaige Fragen der NKS zu beantworten”, ergänzt das Unternehmen.
Die Kontaktstelle will die Einhaltung der Sorgfaltspflichten bei dem Unternehmen selbst und im Hinblick auf Zulieferer prüfen. Dabei geht es auch um die Frage, ob Shein transparent genug über seine Bemühungen zur Einhaltung der OECD-Leitsätze auf seiner Website berichtet. Die Kontaktstelle beschäftigt sich auch mit der Frage, ob das Geschäftsgebaren des Unternehmens der Umwelt oder Gesundheit der Verbraucher schadet.
Davon gehen Dominique Potier und Boris Vallaud aus, beides sozialistische Abgeordnete der französischen Nationalversammlung. Sie haben am 20. Juni Beschwerde bei der OECD eingelegt. In einer aktuellen Pressemitteilung schreibt die Partei, sie sei der Ansicht, dass die Herstellung und die Lieferkette der Produkte, die Shein in Frankreich vermarktet, die Menschenrechte, die Umwelt und die Interessen der Verbraucher nicht respektiert.
Die nationalen OECD-Kontaktstellen sollen bei Beschwerden über die Anwendung der OECD-Leitsätze zwischen Beschwerdeführern und Unternehmen vermitteln. Die Teilnahme an den Verfahren der Kontaktstellen ist freiwillig. Bereits im September haben sich Vertreter der Schlichtungsstelle mit der Geschäftsleitung von Shein getroffen. Jetzt will sie beide Parteien erneut anhören, bevor es später zu einem direkten Aufeinandertreffen kommen soll. Shein könnte sich aber auch jederzeit aus dem Verfahren zurückziehen. nh
Laut einer am heutigen Mittwoch erscheinenden Studie von KPMG und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), die Table.Media exklusiv vorab vorliegt, berücksichtigen über 50 Prozent der befragten Unternehmen Klimarisiken und Folgeschäden nicht vollumfänglich im eigenen Risikomanagementsystem.
Als größte Klimarisiken sehen die Unternehmen eine Veränderung der Nachfrage, knappe Ressourcen und Schäden an der Infrastruktur. Die Auswirkungen von Hitze oder Dürre sowie Risiken durch den Verlust von Artenvielfalt sind für die Mehrheit bisher keine Themen in ihrem Risikomanagement. 22 Prozent berücksichtigen Klimarisiken im Beschaffungsprozess nicht.
Gleichzeitig planen insgesamt 43 Prozent der Unternehmen, ein Zehntel oder mehr ihres Umsatzes in die “grüne Transformation” zu investieren, heißt es in der Studie. Bei Firmen mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz sind es 36 Prozent, bei Unternehmen mit mehr 57 Prozent. Auf mehr als ein Zehntel ihres Umsatzes oder ihrer Gewinnmarge verzichten würden acht Prozent der kleineren Unternehmen mit weniger Umsatz und kein Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz.
Darüber hinaus sehen 73 Prozent der Unternehmen zusätzliches Geschäftspotenzial in der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zur Minderung von Klimafolgeschäden. Die Studienautoren gehen davon aus, dass es für den europäischen Maschinen- und Anlagenbau in zehn Jahren ein jährliches Umsatzpotenzial von über 200 Milliarden Euro bei Lösungen zum Schutz vor Klimarisiken und zur Minderung von Klimafolgeschäden gibt.
Für die Studie “Klimarisiken und Folgeschäden des Klimawandels 2023” haben KPMG und der VDMA 235 Entscheider aus Unternehmen in Deutschland befragt. nh
Kenia und Frankreich haben angekündigt, beim Klimagipfel in Dubai die Debatte über internationale Klimasteuern voranzutreiben. Die Präsidenten der beiden Länder, William Ruto und Emmanuel Macron, planen dazu die Gründung einer “Taskforce”, die innerhalb von zwei Jahren konkrete Vorschläge erarbeiten soll. Wie Climatechangenews.com vergangene Woche berichtete, hoffen die Staatschefs, eine Koalition aus Europa und dem globalen Süden in der Taskforce zu versammeln.
Die Debatte über globale Klimasteuern und Abgaben wird seit einem von Macron anberaumten Finanz-Gipfeltreffen in Paris im Juni lebhafter. Der von Ruto im September in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ausgerichtete “Afrikanische Klimagipfel” etwa endete mit der Forderung nach einem “globalen System zur Besteuerung von Kohlenstoff”, “um zweckgebundene, erschwingliche und zugängliche Finanzmittel für klimaschonende Investitionen in großem Umfang bereitzustellen”.
Auch internationale Organisationen befassen sich mit dem Thema. Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), kündigte im Oktober eine eigene Taskforce an, die Vorschläge für “eine Methode für einen globalen Kohlenstoffpreis” entwickeln soll, “der alle zustimmen können.” Der Internationale Währungsfonds (IWF) wiederum argumentierte in seinem jüngsten “Fiscal Monitor”, dass CO₂-Steuern ein “integraler” Bestandteil aller nationalen Klimapakete sein müssten.
Welche Güter und Dienstleistungen durch eine globale Koordination besteuert werden sollten, ist umstritten. Im Juli konnte sich die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) nicht auf eine Steuer auf Schifffahrts-Emissionen einigen. Andere Ideen betreffen Abgaben auf Flugverkehr, Finanztransaktionen und fossile Brennstoffe. Weitere offene Fragen sind, welche Organisation globale Klimasteuern koordinieren sollte und wofür die Erlöse verwendet werden.
Diskutiert wird zudem, wie eine global gerechte Besteuerung aussehen könnte. Während US-Finanzministerin Janet Yellen eine Schifffahrtssteuer einen “sehr konstruktiven Vorschlag” nannte, sehen sich Staaten im globalen Süden aufgrund ihrer geografischen Entfernung zu wirtschaftlichen Zentren benachteiligt. “Wir müssen die Emissionsabgaben für Schifffahrt und Luftverkehr überdenken, damit sie nicht zu einer Steuer auf Abgelegenheit werden”, argumentierte etwa Avinash Persaud, Klimabotschafter von Barbados, der den Vorschlag einer globalen Klimasteuer an sich jedoch begrüßt. av
Die am Sonntag in Nairobi zu Ende gegangene dritte Verhandlungsrunde für ein globales Abkommen gegen Plastikmüll hat laut Teilnehmern und Beobachtern wenig Fortschritte gebracht. Aus Sicht von Graham Forbes, Delegationsleiter von Greenpeace, sei das Hauptziel verfehlt worden: Ein Mandat zu vereinbaren, um bis zur Verhandlungsrunde an einem Entwurf für den Vertrag arbeiten zu können. Bundesumweltministerin Steffi Lemke findet es “sehr bedauerlich”, dass die dritte Runde “ohne Einigung über nächste Schritte zu Ende gegangen ist.”
Gescheitert sei eine Einigung an Staaten, die auch künftig von fossilen Geschäftsmodellen wie der Plastikproduktion profitieren wollen, sagte Lemke. “Die Bremsmanöver und der Widerstand von ölproduzierenden Staaten wie Saudi-Arabien, Russland und Iran haben viel Zeit gekostet und die Verhandlungen beinahe vollständig zum Stillstand gebracht”, kommentierte Florian Titze, WWF Deutschland. Immerhin sei es gelungen, Rückschritte zu vermeiden. So würde sich weiterhin eine Mehrheit dafür einsetzen, “dass das Abkommen den gesamten Lebenszyklus von Plastik inklusive der Produktion umfassen muss, statt nur Fragen von Abfallentsorgung und -aufbereitung”, sagte Titze.
Im März 2022 hatten sich die UN-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, einen Vertrag zu erarbeiten, um die weltweite Plastikverschmutzung zu beenden. Nach der vierten Verhandlungsrunde im April 2024 im kanadischen Ottawa soll es Ende 2024 eine fünfte und letzte in Südkorea geben. nh mit dpa und rtr
Das EU-Parlament in Straßburg hat am Dienstag sein Verhandlungsmandat zu einem verstärkten “Recht auf Reparatur” angenommen. Die Richtlinie soll einen nachhaltigen Konsum stärken, indem die Reparatur fehlerhafter Waren vereinfacht, Abfall reduziert und die Reparaturbranche gefördert wird.
Der Entwurf von Berichterstatter René Repasi (S&D) schärft den Vorschlag der EU-Kommission. Er will Verkäufer während der gesetzlichen Garantiezeit verpflichten, zu reparieren anstatt zu ersetzen, wenn eine Reparatur gleich viel oder weniger kostet – es sei denn, die Reparatur ist nicht machbar oder für den Verbraucher ungünstig. Die Abgeordneten schlagen zudem vor, die gesetzliche Garantiezeit um ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Reparatur zu verlängern.
“Die Leute wollen die Lebensdauer ihrer Geräte verlängern, aber das ist oft zu kostspielig oder schwierig. Nun reagieren wir auf diese Forderungen”, erklärte Repasi. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen das Recht erhalten, für Geräte wie Waschmaschinen, Staubsauger und Smartphones sowie für Fahrräder auch nach Ablauf der Garantiezeit eine Reparatur zu verlangen. Damit Reparieren attraktiver wird als Ersetzen, sollen Hersteller für die Dauer der Reparatur Leihgeräte zur Verfügung stellen. Kann ein Produkt nicht mehr repariert werden, könnte stattdessen ein bereits repariertes Produkt angeboten werden.
Online-Plattformen sollen eine Übersicht über Reparaturbetriebe und Verkäufer überholter Waren in der Nähe bieten. Die Abgeordneten schlagen außerdem vor, über nationale Reparaturfonds Gutscheine und andere finanzielle Anreize bereitzustellen, um Reparaturen erschwinglicher und attraktiver zu machen.
Der Rat wird seine Verhandlungsposition voraussichtlich am heutigen Mittwoch festlegen. Danach können die Verhandlungen mit dem Parlament beginnen. Ein erstes Treffen ist für den 7. Dezember geplant. leo
Laut dem Thinktank Climate Analytics haben die Staaten im Jahr 2023 weltweit den Emissionspeak mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht. Die Forscherinnen und Forscher zeigen sich optimistisch, dass die globalen Treibhausgasemissionen im Jahr 2024 mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent fallen werden. Voraussetzung hierfür sei die Beschleunigung der aktuellen Wachstumstrends bei den erneuerbaren Energien und grünen Technologien wie E-Autos, und dass die Staaten ihre Zusagen zur Verminderung der Methan-Emissionen umsetzen.
Das Wachstum bei den Erneuerbaren und E-Autos könne demnach zu:
Die Autorinnen und Autoren haben für ihre Studie ein “Szenario der weiteren Beschleunigung” des Ausbaus der Erneuerbaren und des Verkaufs von E-Autos ausgewählt. Dadurch würden in den kommenden Jahren so viele Erneuerbare zugebaut, dass sie fossile Energien aus den Netzen verdrängen. Doch selbst dieses Szenario würde bis 2030 lediglich zu einer Absenkung der Emissionen um zehn Prozent führen (im Vergleich zum Jahr 2019). Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, bräuchte es eine Absenkung um 43 Prozent bis 2030.
Es bedürfe dementsprechend:
Laut der Climate Analytics-Recherche haben bis 2015 schon 50 Staaten ihren Emissionspeak erreicht und sind in die Phase des langfristigen Rückgangs eingetreten. Dazu gehören die USA, Deutschland, Japan und Australien. China könne im nächsten Jahr fallende Emissionen erreichen, Indien seinen Peak in den frühen 2030er-Jahren. In der EU könne der Zubau von Wind- und Solarenergie bis 2030 den gesamten Kohlestrom verdrängen. nib
Die Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen über den Rechtsakt zur Förderung klimafreundlicher Industrien werden voraussichtlich am 17. Dezember beginnen. Das Europaparlament beschloss am Dienstag wie erwartet seine Position zum Net-Zero Industry Act (NZIA). Die Mitgliedstaaten wiederum wollen ihre eigenen Forderungen beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 7. Dezember festzurren. Anschließend kann der Trilog beginnen, der rechtzeitig vor der Europawahl im Juni abgeschlossen werden soll.
Die Abgeordneten stimmten gestern im Plenum ohne Änderungen dem Kompromiss zu, den Berichterstatter Christian Ehler (CDU) im Industrieausschuss ausgehandelt hatte. Wichtigste Änderung zum ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission und zugleich absehbar Hauptstreitpunkt im Trilog: die deutliche Ausweitung der Technologiesektoren, die von den Fördermaßnahmen profitieren sollen. Dazu zählen neben unstrittigen Bereichen wie Solar, Wind oder Wärmepumpen auch “Kernspaltungs- und Fusionsenergietechnologien”. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss kritisierte: “Der Schritt in die Vergangenheit weicht den Green Deal auf.” tho
Die Angst der Techmilliardäre vor ihrem Personal – Deutschlandfunk
In einem sehr erhellenden Interview spricht der Medienwissenschaftler Douglas Rushkoff über das Menschenbild der Tech-Milliardäre im Silicon Valley und die daraus für die Transformation resultierenden Schwierigkeiten. Vor menschlicher Kooperation schreckten die Milliardäre zurück, dabei sei diese dringend zur Lösung der Probleme nötig, sagt Rushkoff. Zum Interview
Decarbonisation of industrial activities is beginning – The Economist
Der Autor Vijay Vaithheeswaran erwartet einen Wandel im ESG-Investment. Nach Exzessen des ESG-Aktivismus, der dazu aufgerufen habe, traditionelle und schwer zu transformierende Industrien wie Stahl und Zement zu verschmähen, gingen viele Investoren zu einem eher programmatischen Ansatz über. So habe BlackRock einen transformativen “Braun-zu-Grün”-Fonds für alte Industrien aufgelegt. Zum Artikel
Oil Majors’ Carbon Capture Plans Dubbed a ‘Dangerous Delusion’ – Bloomberg
Carbon-Capture-Technologien tragen auch künftig nicht genug zur CO₂-Reduktion bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Gruppe von Experten um Adair Turner, den ehemaligen Vorsitzenden der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde der Londoner City. Nach ihrer Berechnung sinken die Kosten der Entwicklung zu langsam, zudem blieben die Projekte und deren Finanzierung unter den Erwartungen. Zum Artikel
Das amerikanische Windkraft-Desaster – Der Spiegel
Trotz ihrer 150.000 Kilometer langen Küsten seien die USA Nachzügler bei der Windkraft, schreibt Ines Zöttl. Präsident Joe Biden wolle den Rückstand aufholen, indem das Land die Kapazität auf 30 Gigawatt ausbaut. Doch die Windkraftindustrie habe sich bei den Kosten verkalkuliert und ziehe sich aus Projekten zurück. Mehr als die Hälfte der Offshore-Kapazitäten, die aktuell in Entwicklung sind, seien gefährdet. Zum Artikel
Shades of green hydrogen: EU demand set to transform Namibia – Climate Home News
Die EU benötigt saubere Energie – und die soll, unter anderem, in Form von grünem Wasserstoff aus Namibia kommen. Umsätze in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar plant das afrikanische Land ein. Wie drei Autoren ausführlich beleuchten, kann das aber negative Konsequenzen für die Einwohner und die Natur haben. Zum Artikel
In Congo’s Cobalt Mines – The New York Review of Books
In der Demokratischen Republik Kongo befinden sich große Vorkommen zentraler Rohstoffe für die Energiewende. Doch die Bevölkerung profitiert kaum davon. Wohlmeinende westliche Kampagnen für Reformen sind jedoch nicht immer hilfreich, wie Nicolas Niarchos anhand neu erschienener Sachbücher erklärt. Zum Artikel
Damit riskiert man Revolten in Frankreich, Portugal und Deutschland – Der Spiegel
Der Stellantis-Chef Carlos Tavares spricht im Interview mit Simon Hage und Martin Hesse über schwierige Zeiten für die europäischen Autohersteller. Während es den Unternehmen schwerfiele, ihren Kunden bezahlbare Fahrzeuge anzubieten, fielen hohe Kosten an und die Profitabilität sei in Gefahr. “Wenn es ihnen nicht gelingt, diesem Dilemma zu entkommen, wird es schlimm enden”, prophezeit er. Zum Artikel
Renault auf Partnersuche – FAZ
Niklas Záboji schreibt über die Investoren-Suche des Renault-Chefs, Luca De Meo, für die Ausgliederung der Elektro- und Software-Aktivitäten in das neue Unternehmen Ampere. Bis 2030 solle die Ampere-Palette aus sieben neuen Elektrofahrzeugen bestehen, darunter ein Kleinwagen für unter 20.000 Euro. Analysten seien aber skeptisch, ob die Firma mit der preisgünstigen Konkurrenz aus China mithalten könne. Zum Artikel
Den Ewigkeitschemikalien droht das Aus – Chemanager
Zum geplanten PFAS-Verbot schreibt die Wissenschaftsjournalistin Uta Neubauer, dass Risiken nicht allein in der Nutzung von Produkten lägen, sondern auch in der Produktion. Wenn PFAS-Substanzen über Abluft oder Abwässer in die Umwelt gelangten, erfordere die Sanierung kontaminierter Böden einen enormen technischen Aufwand. Für zahlreiche Anwendungen gäbe es jedoch PFAS-Alternativen. Zum Artikel
Kritik an Rezyklatquoten für Lebensmittelverpackungen – Plastverarbeiter
Verpackungsexperten warnen, dass Produzenten wegen der EU-Verpackungsverordnung auf schwer recyclebare, beschichtete Verbundverpackungen ausweichen. Es stünden nämlich zu wenig zugelassene Kunststoffrezyklate für kontaktempfindliche Verpackungen zur Verfügung. So seien für den Lebensmittelbereich beim PET bis dato etwa nur Rezyklate aus Pfandflaschen zugelassen. Zum Artikel


Die EU steht kurz vor einem historischen politischen Erfolg. Sie könnte im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte globale Standards setzen, wie dies die USA 1977 mit dem Foreign Corrupt Practices Act bei der Korruptionsbekämpfung taten. Notwendig ist dafür aber, dass die EU ihre ambitionierten Entwürfe für ein EU-Lieferkettengesetz (Corporate Due Diligence Directive, CSDDD) auf der Zielgrade nicht erheblich verwässert. Lobbyisten haben bereits sowohl den Entwurf der Kommission als auch den Entwurf des Rats abgeschwächt. Außerdem gibt es noch weitergehende Änderungswünsche der Lobby für den vorgeschlagenen regulatorischen Rahmens für Menschenrechtsschutz in Lieferketten.
So drängt US-Finanzministerin Janet Yellen die EU, Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb der Gemeinschaft von den Pflichten auszunehmen. Zudem fordert der Vorsitzende des International Sustainability Standards Board, Emmanuel Faber, Europa auf, das verwandte Gesetz zur Berichterstattung über die Nachhaltigkeit so einzuschränken, dass die Unternehmen nicht mehr alle Risiken für Mensch und Umwelt melden müssen. Wenn sich Yellen und Faber durchsetzen sollten, wären die Folgen fatal, denn das EU-System für Wirtschaft und Menschenrechte würde nur die Anteilseigner selbst schützen und US-Firmen, die in Europa Geschäfte machen, einen Freifahrtschein geben.
Die vor einem Jahr verabschiedete EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zwingt alle in Europa tätigen Firmen – darunter etwa 4000 mit Hauptsitz außerhalb der EU – dazu, öffentlich über alle wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu berichten. Zu Fabers Bestürzung hat Europa einen neuen Ansatz der “doppelten Wesentlichkeit” eingeführt. Demnach müssen Unternehmen über jedes Nachhaltigkeitsrisiko berichten, das entweder für die Anteilseigner des Unternehmens oder für die Menschen und den Planeten von Bedeutung ist. Faber bevorzugt dagegen den alten Ansatz der “finanziellen Wesentlichkeit”. Demnach müssen Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken nur melden, wenn sie den finanziellen Wert des Unternehmens für seine Anteilseigner gefährden.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass genau dies Fortschritte durch ESG behindert. Das belegt ein neuer Bericht des NYU Stern Center for Business and Human Rights zur Wirkungsweise der finanziellen Wesentlichkeit. Demnach behindert eine Vorgehensweise nach der alten Methode, dass das System von Investitionen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) Wirkung entfaltet.
Denn die meisten aktuellen ESG-Rahmenwerke bewerten, wie Umwelt- oder Sozialrisiken den Unternehmen schaden können, und nicht, wie Unternehmen der Welt schaden können. Das ist kontraproduktiv, denn Unternehmen schaden oft der Umwelt oder der Gesellschaft, ohne gleichzeitig ihren Anteilseignern zu schaden. So können Unternehmen sich umweltschädigend verhalten, wenn es profitabel ist – und wenn die rechtlichen oder reputationsbezogenen Konsequenzen nicht vorhanden oder überschaubar sind. Unmoral im Geschäftsleben kann gewinnbringend, legal und skandalfrei sein. Manches Fehlverhalten ist sogar so profitabel, dass es für ein Unternehmen finanziell rational sein kann, Skandale und rechtliche Sanktionen in Kauf zu nehmen. Unternehmen, die sich schädlich verhalten, können versuchen, sich vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, indem sie Lobbyarbeit betreiben und Prozesse führen, um das Regelwerk zu schwächen, in Länder mit geringer Regulierung abwandern oder Aufgaben auslagern, bei denen es zu Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen kommen kann.
Daher kann die Kopplung von ESG an die finanzielle Wesentlichkeit Unternehmen belohnen, die sich vor den rechtlichen Konsequenzen drücken. Auch ihre Reputation muss nicht zwingend leiden: Wo Medien und die Zivilgesellschaft schwach sind, kommen Skandale selten ans Licht. Und selbst wenn Skandale ans Tageslicht kommen, wissen viele Kunden und Arbeitnehmer nichts von ethischen Fragen oder interessieren sich nicht dafür. Ein Bedarf an neuen regulatorischen Mechanismen wie dem EU-Lieferkettengesetz entsteht, wenn die Unternehmen nicht durch den bestehenden rechtlichen oder marktwirtschaftlichen Druck diszipliniert werden, über die Kosten, die sie Mensch und Umwelt auferlegen, Rechenschaft abzulegen.
Unternehmensberichterstattung alleine ist noch kein derartiger Rechenschaftsmechanismus. Die Theorie hinter der Nachhaltigkeitsberichterstattung besteht darin, Investoren mit den Daten auszustatten, die sie benötigen, um Unternehmen zu disziplinieren. Bedauerlicherweise kommt der NYU-Bericht zu dem Schluss, dass viele ESG-Fonds in ihrer Rolle als wirksame Kontrolleure versagen. ESG-Ratings sind sogar so inkohärent, dass die Unternehmen nicht wissen, welches Verhalten sie fördern oder verhindern. Einige führende US-amerikanische ESG-Fonds sind praktisch nicht von Marktindizes zu unterscheiden und enthalten große Anteile problematischer Aktien. Damit die ESG-Investoren tatsächlich wirksam werden könnten, schlägt der NYU-Bericht einige Reformen vor.
Weil die meisten ESG-Investoren versagen, wenn es darum geht, freiwillig Nachhaltigkeitsdaten sinnvoll zu nutzen, braucht es einen verpflichtenden Ansatz im Bereich ESG. Das EU-Lieferkettengesetz würde die Unternehmen dazu zwingen, einen riesigen Schritt über die letztjährige Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung hinauszugehen: Sie müssten nicht nur über Umwelt- und Sozialrisiken berichten, sondern sie auch in ihrer globalen Wertschöpfungskette durch effektive Maßnahmen adressieren. Ein starkes Lieferkettengesetz würde die Unternehmen also gewissermaßen dazu zwingen, Nachhaltigkeitsdaten endlich sinnvoll zu nutzen. Das hätte revolutionäres Potenzial für die Verbesserung der natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen – wenn es richtig gemacht wird.
Das Gesetz muss global anwendbar sein, weil der Schutzbedarf in den Wertschöpfungsketten global ist. Wird das Gesetz nicht auch auf Unternehmen angewendet, die Waren oder Dienstleistungen in die EU liefern, entstände für Unternehmen ein Anreiz, ihren Hauptsitz in ein Land mit schwacher Regulierung zu verlegen. Das würde nicht nur der Sache an sich, sondern Europa auch noch ökonomisch schaden.
Diese wichtige Regulierungsaufgabe fällt Europa zu, da die USA in diesem Bereich höchstens eine lückenhafte Unternehmensberichterstattung vorschreiben werden und hoffen, dass ESG-Investoren ihre Arbeit tun. Die EU ist der einzige Player, der im Jahr 2023 einen globalen Menschenrechtsschutz in Wertschöpfungsketten durchsetzen kann, so wie die USA im Jahr 1977 der einzige Akteur waren, der eine globale Korruptionsbekämpfung durchsetzen konnte.
Wie damals bei der Korruptionsbekämpfung könnte eine jetzige EU-Lieferkettenregulierung einen sich selbst verstärkenden, positiven Kreislauf schaffen. Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz würde für globale Unternehmen einen Anreiz darstellen, hohe ESG-Standards einzuhalten, um den Zugang zum EU-Markt zu erhalten. Gleichzeitig könnte sie andere Länder unter Druck setzen, ähnliche Vorschriften einzuführen, um für multinationale Unternehmen attraktiv zu bleiben, die sich an europäische Regelwerke halten müssen. Der “Brüssel Effekt” des Marktortsprinzips würde einen erheblichen Anreiz für Unternehmen und Staaten weltweit darstellen, Menschenrechte und Umwelt stärker zu schützen, um den Anschluss an einen der größten Binnenmärkte der Welt nicht zu verlieren. Ähnliches ist bei der EU-Regulierung im digitalen Bereich zu beobachten. So könnte Brüssel ein “Race to the Top” in Gang setzen, was zu einer gerechteren Weltwirtschaft führen könnte. Diese Chance sollte sich die EU nicht entgehen lassen.
Michael Goldhaber ist Senior Research Scholar am NYU Stern Center for Business and Human Rights und Autor des Berichts “Making ESG Real: A Return to Values-Driven Investing.“
Stéphane Brabant ist Rechtsanwalt in Paris und Senior Partner bei Trinity International AARPI in Paris, spezialisiert auf Unternehmen und Menschenrechte.
Daniel Schönfelder ist als European Legal Advsior für das Responsible Contracting Project tätig und wirkt als Jurist in einem Großkonzern an der Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes mit.

Die Deutsche Bahn will digital werden. Milliarden Euro investiert sie in dieses Vorhaben und verbindet damit große Hoffnungen: autonom fahrende Züge, die pünktlich ans Ziel kommen; KI-Programme, die Schäden an Rädern innerhalb von Minuten erkennen; und eine Datenübertragung, die Kunden in Echtzeit mit Informationen versorgt.
Denise Baidinger gehört zu den Führungskräften in der Berliner Konzernzentrale, die an diesem Großprojekt mitarbeiten. Zugleich versucht sie, es in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Die 33-Jährige leitet die Initiative “Grüne Digitalisierung” – denn Rechner, Server, Sensoren, Maschinen und Endgeräte verursachen einen wachsenden Energie- und Rohstoffverbrauch. Baidinger will für diese häufig übersehenen negativen Seiten sensibilisieren. Mit ihrem Team aus 17 Kolleginnen und Kollegen, die in den Tochtergesellschaften sitzen, treibt sie das Thema voran. Momentan geht es zum Beispiel darum, ein Dashboard zu entwickeln. “Das soll Programmierern zeigen, wie viel Energie ihre Softwarelösungen beanspruchen”, sagt sie.
Zur Bahn ist Baidinger vor sechs Jahren gekommen. Davor hat sie, die aus dem Main-Taunus-Kreis stammt, in Frankfurt am Main und Leeds BWL studiert, anschließend bei IBM und in einer IT-Beratung gearbeitet. Um Nachhaltigkeit ging es dabei nicht, sondern ums Datenmanagement, den Aufbau neuer Strukturen und die sogenannte “Customer Experience”. Heißt: Wie gelingt es, Kunden mit digitalen Mitteln ein möglichst reibungsloses Erlebnis zu bieten?
Diese Erfahrung hat ihren Blick für unterschiedliche Bedürfnisse geprägt, was auch heute wichtig ist, sagt sie, denn: “Die Deutsche Bahn ist ein Abbild der gesamten Gesellschaft.” In dem Konzern arbeiten nicht nur “Digital Natives” und Veganer, die besonders auf ihren ökologischen Fußabdruck achten. Es gäbe viele Kolleginnen und Kollegen, die Sorgen und Fragen haben, Mehrarbeit befürchten, von der Notwendigkeit der Transformation nicht überzeugt sind oder sich schlichtweg verweigern. “Wenn man diese Menschen nicht mitnimmt, gelingt der Wandel nicht”, so Baidinger. Es gehe darum, “Awareness” zu schaffen, Aufmerksamkeit.
Wie die Dinge miteinander zusammenhängen, zeige sich etwa bei den Daten. Für eine erfolgreiche Digitalisierung müssen sie fließen, nahtlos und über die Grenzen von Abteilungen hinweg. In der Vergangenheit aber wurden Daten häufig in ihren jeweiligen Silos versteckt und nicht mit anderen geteilt. Das jetzt zu tun, erfordere Vertrauen, weil man andere plötzlich in die eigenen Prozesse hineinschauen lasse und sich transparenter mache als früher. “Davor war eine gewisse Angst spürbar.”
Um solche Bedenken abzubauen, will sie weniger darauf setzen, IT-Strategien zu verordnen, sondern mehr “bottom up” arbeiten. Zum Auftakt ihrer Initiative hat sie Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen dazu aufgerufen, sich einzubringen und Themen zu setzen. Daraus entstand ein “Blumenstrauß der grünen Digitalisierung”, wie sie es nennt. Es ging um nachhaltiges Coding, das den CO₂-Ausstoß von Digitalprojekten misst; um Regelungen zum Homeoffice; um die Nutzung von Balkonkraftwerken und den ökofairen IT-Einkauf. Eine Stunde pro Woche hätten sich alle Interessierten getroffen, diskutiert und – ohne die jeweiligen Vorgesetzten – eigene Ziele gesetzt. “Das war bereichernd, weil die verschiedensten Programmierer und Fachkollegen zusammenkamen, gerade aus Bereichen, die ich zuvor kaum kannte.”
Eine Aufgabe, die daraus entstanden ist, ist die Überprüfung der Ausschreibungen. Sind “Software as a Service”-Anbieter, die Programme über die Cloud zur Verfügung stellen, nachhaltiger als andere Hersteller? Haben sie überhaupt Daten zu ihrem Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß? Fragen wie diese sollen nach und nach in die Auswahl von Partnerfirmen einfließen.
Wie viel das bringt, wie groß also das Einsparpotenzial solcher Prozesse ist, das weiß Denise Baidinger übrigens nicht so genau. Vor zwei Jahren habe der Vorstand sie um eine Analyse der größten Nachhaltigkeitshebel gebeten. Welche Projekte solle man verfolgen? Doch noch ist Baidinger in einem Feld tätig, in dem es keine eindeutigen Antworten gibt, weil Daten fehlen, Entwicklungen dynamisch und Zusammenhänge komplex sind. Wie wichtig es ist, zentrale Transformationsaspekte zu priorisieren, ist ihr bewusst. Andererseits wäre es ein Fehler, nichts zu verändern und nur Daten zu sammeln. Deshalb setzt sie jetzt aufs “Learning by Doing”. Je mehr sie probiert, desto besser bekommt sie heraus, an welchen Stellschrauben zuerst gedreht werden sollte.
Und einen gar nicht so kleinen Nebeneffekt habe die Verknüpfung von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation bereits: “Das Thema zieht bei der jüngeren Generation.” Wer heute Anfang 20 ist, würde eigentlich gar nicht so gerne für einen Konzern arbeiten wollen. Zu groß, zu behäbig, zu wenig Möglichkeiten der eigenen Entfaltung. Mit ihrer Herangehensweise aber hätte die Deutsche Bahn ein Argument, Talente anzulocken. Marc Winkelmann
Agrifood.Table: EU-Parlament vor wegweisenden Green-Deal-Abstimmungen: Das EU-Parlament stimmt in dieser Woche über eine Reihe von Verordnungen ab, die transformatives Potenzial haben. Dazu gehören die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, die Vermeidung unnötiger und schwer recyclebarer Verpackungen. Hinzu kommt eine Resolution zum anstehenden Klimagipfel COP28 in Dubai.
Mehr
Europe.Table: Trilog-Einigung zum Methan nimmt Importe auf: Die Europäische Union reduziert die Methanemissionen im Energiebereich. Rat, Kommission und Parlament einigten sich im Trilog auch darauf, die Lieferketten dabei mit einzubeziehen. Doch Strafzahlungen für zu schädliche Importe werden erst ab 2030 erhoben.
Mehr
Europe.Table: EU-Kommission lässt Glyphosat für weitere zehn Jahre zu: Da es unter den EU-Mitgliedsstaaten keine qualifizierte Mehrheit gegen eine Verlängerung der Zulassung des Herbizids Glyphosat gab, konnte die Kommission in der vergangenen Woche den Wirkstoff für weitere zehn Jahre zulassen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir prüft nun, wenigstens in Deutschland die Verwendung einzuschränken.
Mehr
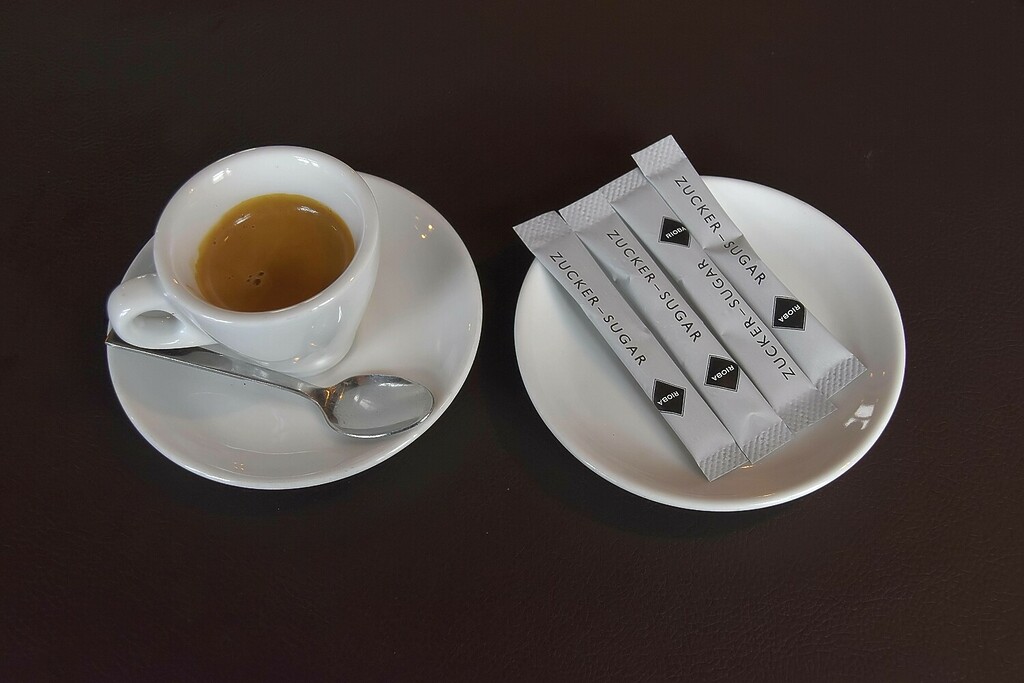
Vom Aufstand deutscher Bierbrauer über die Sorge eines Europaabgeordneten um Zuckertütchen bis hin zur Androhung einer neuen Französischen Revolution aus Angst um Käse – überall in Europa regt sich gerade Widerstand.
Der Grund: Die EU will Verpackungsabfälle reduzieren. Seit etwas mehr als einem Jahr arbeiten Kommission, Rat und Parlament an einer neuen Verordnung, die Mehrwegsysteme stärken und dafür sorgen soll, dass alle Verpackungen bis 2030 recycelbar sind. Etwa genauso lang dauert bereits der erbitterte Kampf von Industrie und Nostalgikern. Die beteiligten Europaabgeordneten sprachen von einer rekordverdächtigen Flut an Lobbyanfragen. Auch Medienberichterstattende erhielten ungewöhnlich viele Gesprächsanfragen und neue, vermeintlich bahnbrechende Studien der Einweglobby.
Bereits Ende Mai brach die Panik unter den deutschen Bierbrauern und Getränkeherstellern aus. Besorgte Verbandschefs warnten in der BILD: Es drohe die Vernichtung von “MILLIARDEN Bierflaschen”, sogar die Bierkästen müssten geschreddert werden. Die Verbände störten sich zum einen an der geplanten Deklarationspflicht, die eine dauerhaft angebrachte Kennzeichnung von Mehrwegverpackungen vorsieht. Denn auf deutschen Bierflaschen kleben seit jeher abwaschbare Etiketten. Zum anderen äußerten sie die Sorge, die geplante Begrenzung des Leerraumanteils (also der Luft in Transportverpackungen) würde auch die Bierkästen betreffen – und “den Transport und die Lagerung von Mehrwegflaschen künftig unmöglich machen”, hieß es in einem Brandbrief an die EU-Kommission.
Die EU-Kommission konnte Brauer und Bierliebhaber schnell wieder beruhigen: Natürlich wolle man nicht das deutsche Pfandsystem zerstören, für die Kästen und Etiketten seien Ausnahmen vorgesehen.
Vergangene Woche drohten dann die Franzosen mit einer Neuauflage der Revolution: Auch die traditionelle Holzschachtel des Camembert wäre durch die neuen Regeln bedroht, denn sie sei nicht recyclingfähig und entsprechende Anpassungen wären sehr kostspielig. “Wenn man Europa vor den Wahlen zur Karikatur machen will, dann fängt man an, die Camembert-Hersteller mit ihren Holzverpackungen zu nerven”, spottete die französische Europaministerin Laurence Boone. Mehrere Änderungsanträge wurden daraufhin im Parlament gestellt.
Die deutsche Schattenberichterstatterin für das Gesetz, Delara Burkhardt (SPD), gab im Hintergrundgespräch Entwarnung: Alle Produkte mit geschützten Ursprungs- und geschützten geographischen Angaben würden durch einen Delegierten Rechtsakt der Kommission ausgenommen.
Nur der deutsche Europaabgeordnete Peter Liese (CDU) hat noch keine Klarheit: Werden tatsächlich auch die kleinen Einwegverpackungen für Zucker, Salz und Pfeffer verboten, die zu Kaffee und Speisen in der Gastronomie gereicht werden? Liese posierte aus Protest für ein Foto mit Zuckertüten im EU-Parlament und reichte einen Änderungsantrag ein, der mindestens die Begrenzung des Verbotes auf Plastikverpackungen bewirken soll. Über diesen und rund hundert weitere Anträge stimmt das Parlament am heutigen Mittwoch ab. Leonie Düngefeld
wahrscheinlich wurde auf einem “Digital-Gipfel” der Bundesregierung noch nie so viel über Nachhaltigkeit gesprochen wie in diesem Jahr. Bei der Veranstaltung in Jena Anfang der Woche fand sich der Begriff im Untertitel (“Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.”) und in zahlreichen Diskussionsrunden wieder. Zwei Jugendliche formulierten auf der Bühne Forderungen wie die Reparierfähigkeit von Hardware und Umweltministerin Steffi Lemke prangerte an, dass die Digitalisierung Rohstoffe “verschlingen” würde.
Sieht man sich die Entwicklung an, muss man feststellen, dass das keine Übertreibung ist. Wie Laurin Meyer erklärt, wächst der Wasserverbrauch, der zur Kühlung von Rechenzentren notwendig ist, rapide an. Die Digitalisierung insgesamt und insbesondere KI-Anwendungen führen dazu, dass das Frischwasser vielerorts knapp werden kann. Eine fatale Konkurrenz, die da entstanden ist.
Aber es gibt auch die Gegenbewegung. Das konnte man beim Digital-Gipfel von Gründern, Wissenschaftlern und Unternehmern erfahren, die digitale Werkzeuge für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Und das zeigt auch Denise Baidinger, die wir Ihnen in unserer heutigen Ausgabe vorstellen möchten: Sie arbeitet daran, die Digitalisierung der Deutschen Bahn fair und ökologisch zu gestalten.


Kaum ein Gesetzgebungsverfahren wird derzeit mit solcher Spannung beobachtet wie das europäische Sorgfaltspflichtengesetz (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Am heutigen Mittwoch findet der nächste politische Trilog statt, das hochrangige Treffen der Verhandler aus EU-Parlament, Rat und Kommission. Nach den Terminen im Juni, Juli und September ist es der vierte Trilog. Eine finale Einigung wird allerdings nicht erwartet, bei zu vielen Themen liegen die Positionen noch zu weit auseinander.
Die EU-Kommission hatte im Februar 2022 den Entwurf für das entsprechende Gesetz vorgestellt. Dieser enthält umwelt- und menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten und verpflichtet große Unternehmen, Klimaübergangspläne zu erstellen. Als Vorbilder dienen das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, und das französische “loi de vigilance” aus dem Jahr 2017.
Beim heutigen Trilog könnten sich die Verhandler laut Informationen von Table.Media über den Anwendungsbereich einigen, der wohl dem Vorschlag der Kommission sehr nah bleiben würde. Nach dem Entwurf soll die CSDDD EU- und ausländische Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und mehr als 150 Millionen Euro Nettoumsatz jährlich umfassen. Für Unternehmen in Risikosektoren (unter anderem der Textil-, Landwirtschaft- und Rohstoffsektor) soll die Richtlinie schon ab 250 Beschäftigten und mehr als 40 Millionen Euro Nettoumsatz jährlich gelten.
Dies bedeutet eine starke Ausweitung gegenüber dem deutschen und dem französischen Gesetz, die für Unternehmen ab 3.000 bzw. 5.000 Angestellten gelten. In Deutschland werden ab 2024 Unternehmen ab 1.000 Angestellten betroffen sein. Auf viele andere Mitgliedstaaten hat dies kaum Auswirkungen, da die meisten dort ansässigen Unternehmen kleiner sind.
Nach Angaben einer Quelle im Parlament soll Artikel 25 aus dem Kommissionsentwurf, der eine zusätzliche Sorgfaltspflicht der Mitglieder der Unternehmensleitung vorsieht, beim heutigen Trilog gestrichen werden. Darüber hinaus steht auch die Definition der Sorgfaltspflichten und der Annexe sowie die Bestimmungen zu einer möglichen Vertragsbeendigung mit den Partnern im Falle negativer Auswirkungen (Artikel 7 und 8) auf der Agenda. Zudem soll über die Definition der Wertschöpfungskette gesprochen werden; von Parlamentsseite wird hier jedoch keine Einigung erwartet.
Für eine Reihe an Themen wird zunächst keine Lösung erwartet, einige davon werden vermutlich heute gar nicht angesprochen. Die spanische Ratspräsidentschaft will laut einem internen Kompromissvorschlag Lösungen finden, die “praxistauglich sind, Rechtssicherheit gewährleisten und keine übermäßigen Kosten für Unternehmen und Verwaltungen verursachen”.
Dazu gehört unter anderem die noch ungeklärte Frage, ob der Finanzsektor in den Anwendungsbereich einbezogen wird. Während das Parlament und die Kommission entsprechende Sorgfaltspflichten für Finanzinstitute fordern, hält der Rat dagegen. Auf Druck von Frankreich hatten die Mitgliedstaaten bereits in ihrer Allgemeinen Ausrichtung eine Sonderrolle für den Finanzsektor beschlossen. Demnach sollte es jedem Mitgliedstaat selbst überlassen werden, ob Finanzdienstleistungen unter das Gesetz fallen oder nicht. Das Parlament fordert, die Sorgfaltspflichten auf den nachgelagerten Teil der Wertschöpfungskette von Finanzunternehmen anzuwenden und die Hauptmärkte des Finanzsektors (Investitionen, Banken, Versicherungen) einzubeziehen.
Die Ratspräsidentschaft schlägt nun vor, aufgrund “des empfindlichen Gleichgewichts, das im Rat in dieser Frage erreicht wurde, und der Schwierigkeiten, einen Kompromiss mit dem Standpunkt des Parlaments zu finden”, den Finanzsektor zunächst komplett aus dem Anwendungsbereich auszuschließen und die Ausweitung auf diesen auf eine spätere Phase zu verschieben. Dafür soll dem Gesetzestext eine Überprüfungsklausel hinzugefügt werden; Rat, Parlament und Kommission sollen eine interinstitutionelle politische Erklärung vereinbaren.
Entgegen dem Standpunkt seiner Parlamentskollegen äußerte Axel Voss (EVP), Schattenberichterstatter für die CSDDD im EU-Parlament, im Gespräch mit Table.Media Verständnis für diese Ausnahme. “Man kann den generellen Ansatz des Lieferkettengesetzes nicht eins zu eins auf den Finanzsektor übertragen, das würde zu großer Unsicherheit führen. Deshalb bräuchte dieser Sektor eigentlich speziellere Vorschriften”.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum unterstützt die Einbeziehung des Sektors. Damit das private Finanzwesen den grünen Wandel in der Realwirtschaft wirksam unterstützen könne, sei eine sektorübergreifend einheitliche Regulierung entscheidend, sagte Frank Elderson, Mitglied des EZB-Direktoriums, vergangene Woche auf einer Konferenz. Den Finanzsektor in den Anwendungsbereich der CSDDD einzuschließen, könne dazu beitragen, dass Banken und andere Finanzinstitute “systematisch Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Entscheidungsfindung und ihr Risikomanagement integrieren”. Darüber hinaus entstünde so mehr Sicherheit in Bezug auf die Verpflichtungen und Prozessrisiken des Sektors.
In der Zivilgesellschaft stößt die Ratsposition auf scharfe Kritik: “Banken und Investoren haben einen Freifahrtschein, um von Menschenrechts- und Umweltschäden zu profitieren“, sagte Aurelie Skrobik, Referentin für Unternehmensverantwortung bei der Menschenrechtsorganisation Global Witness. “Der Missbrauch wird Teil des Geschäftsmodells der Banken bleiben, wenn die EU sich nicht auf ein starkes Gesetz einigt, das den Finanzsektor zwingt, sauberer zu werden.”
Auch die Definition von Umweltauswirkungen im Gesetzestext bleibt ein strittiges Thema. Während das Parlament eine Orientierung an konkreten Kategorien wie Klimaauswirkungen, Biodiversität oder Luft- und Wasserverschmutzung fordert, sind die Vorschläge von Kommission und Rat hier eingeschränkter: Unternehmen sollen Auswirkungen nur ermitteln und gegen sie vorgehen, wenn sie gegen internationale Abkommen verstoßen. Die Ratspräsidentschaft schlägt als Kompromiss die Aufnahme weiterer Abkommen vor.
Umwelt-NGOs befürchten, dass selbst ehrgeizige Sorgfaltspflichten aus ökologischer Sicht ihre Wirkung verfehlen, wenn Rat und Kommission sich durchsetzen und die Unternehmen nur begrenzt Umweltauswirkungen feststellen müssen. Denn die internationalen Umweltabkommen seien ein sehr fragmentierter Bereich des internationalen Rechts, erklärt Ceren Yildiz vom BUND. “Viele Fragen der Umweltzerstörung bleiben vollkommen unberührt. Es gibt zum Beispiel keinen globalen Pakt über den Schutz von Wäldern; das Plastikabkommen wird derzeit erst verhandelt.”
Als Vorbild für den Ansatz von Rat und Kommission diente das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das für den Nachweis von Umweltauswirkungen auf internationale Verträge wie das Stockholmer und das Baseler Übereinkommen, die den Einsatz von Schadstoffen bzw. die Ausfuhr von Abfällen einschränken, verweist. Klimaauswirkungen werden gar nicht genannt. Im Rat hat sich die Bundesregierung zwar dafür eingesetzt, weitere Umweltübereinkommen in die Definition aufzunehmen und diese dadurch auszuweiten – allerdings lehnt sie die sogenannten Umweltkategorien, die das EU-Parlament vorschlägt, ab, und hat sich auch gegen eine Umsetzungspflicht für die Klimapläne der Unternehmen ausgesprochen (Artikel 15).
Die spanische Ratspräsidentschaft räumt nun allerdings ein Entgegenkommen ein und schlägt eine Mittelverpflichtung vor, mit genauen Vorgaben zum Inhalt der Klimapläne sowie einer Verknüpfung mit der Vergütung des Unternehmensvorstands. Dadurch soll ein stärkerer Anreiz für die Umsetzung des Plans geschaffen werden.
Für die Berichte nach dem deutschen LkSG diskutieren das Bundeswirtschafts- und das Bundesarbeitsministerium währenddessen eine Vereinfachung: Unternehmen sollen laut der Nachrichtenagentur Reuters mehr Zeit für ihre Berichte erhalten. Reuters hatte am Montag zunächst berichtet, dass es schon eine Einigung gegeben hätte, hatte dies dann jedoch korrigiert. Das Bundesjustizministerium erarbeite zurzeit einen Referentenentwurf auf Fachebene; entsprechende Rechtsänderungen würden gemeinsam mit dem BMWK und dem BMAS erörtert, berichtete Reuters am späten Montagabend. Eine Abstimmung in der Bundesregierung zu diesen Vorschlägen habe bisher noch nicht begonnen.

In West Des Moines haben sie ihre Lehren bereits gezogen. Künftige Projekte für Rechenzentren werde man nur berücksichtigen, wenn sie Technologien zum Wassersparen vorweisen können. So haben es zuletzt die örtlichen Wasserwerke beschlossen. In der Stadt im US-Bundesstaat Iowa hat Microsoft einen Hochleistungscomputer aufgestellt, um vielversprechende KI-Anwendungen zu trainieren. Doch im vergangenen Jahr schluckte allein die Kühlung des Rechenzentrums nach Angaben der Wasserwerke bis zu 43,5 Millionen Liter Wasser pro Monat – und damit ganze sechs Prozent des Gesamtverbrauchs der Stadt im Sommer.
Die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen dürfte in den kommenden Jahren den Verbrauch von Wasser massiv in die Höhe treiben. Laut einer Studie von Forschern der University of California in Riverside und der University of Texas in Arlington könnte der weltweite Bedarf allein für den KI-Bereich schon im Jahr 2027 für 4,2 bis 6,6 Milliarden Kubikmeter an Wasserentnahmen verantwortlich sein. Das wäre etwa die Hälfte des jährlichen Verbrauchs des Vereinigten Königreichs, erklären die Autoren. Während sich der Klimaschutz bislang besonders auf den CO₂-Fußabdruck von KI-Anwendungen durch den Energieverbrauch konzentriert hat, spiele das Bewusstsein für Wasser nur eine untergeordnete Rolle, kritisieren Experten. Und das zu einer Zeit, in der die globalen Temperaturen und die Meldungen über Dürren zunehmen und sich Deutschland eine Nationale Wasserstrategie gegeben hat, um den Mangel zu managen.
Shaolei Ren ist Professor für Computertechnik an der University of California in Riverside und Mitautor der Studie. Er schätzt, dass das Sprachmodell ChatGPT von Microsoft-Partner OpenAI durchschnittlich 500 Milliliter Wasser trinkt, wenn Nutzer der Anwendung zwischen zehn und 50 Eingabeaufforderungen oder Fragen stellen. Die genaue Menge variiere je nach Standort der Server und dem aktuellen Strommix. Ren bezeichnet die Zahlen gegenüber Table.Media als “besorgniserregend”. “Die Süßwasserknappheit ist wegen des raschen Bevölkerungswachstums, der schwindenden Ressourcen und der alternden Wasserinfrastruktur zu einer der größten Herausforderungen für uns alle geworden”, sagt er. Die Bemühungen in diesem Bereich lägen allerdings etwa zehn Jahre hinter denen im Bereich Kohlenstoff zurück. Um das Jahr 2010 herum hätten die großen Tech-Konzerne mit Initiativen zur Kohlenstoffneutralität begonnen, um das Jahr 2020 herum aber erst mit Schritten in Richtung positiver Wasserbilanzen. “Trotz seiner entscheidenden Bedeutung wird Wasser immer noch unverhältnismäßig weniger Aufmerksamkeit geschenkt als Kohlenstoff”, sagt Ren.
Die Unternehmen wiederum betonen, die Herausforderung längst erkannt zu haben. Die drei Großen der Branche – Microsoft, Meta und Google – haben sich dazu verpflichtet, bis 2030 “wasserpositiv” zu sein. Sie wollen bis dahin mehr aufbereitetes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, als sie selbst für die Kühlung der Zentren benötigen. Bislang nutzen die Konzerne Frischwasser, das mit der Trinkwasserversorgung konkurriert. Besonders in den USA und Europa setzen Datencenter auf die Methode der Verdunstungskühlung, bei der warme Luft Wasser verdunsten lässt und so die Zentren klimatisiert.
Noch ist die Bilanz negativ. Microsoft meldete für das vergangene Jahr einen um 34 Prozent gestiegenen Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr; bei Google, der Suchmaschinen-Tochter von Alphabet, betrug der Anstieg über denselben Zeitraum rund 20 Prozent.
Um das zu ändern, setzen die Konzerne nach eigenen Angaben auf zwei Strategien: Zum einen wollen sie Wasser effizienter nutzen, beispielsweise durch Kreislaufsysteme an ihren Standorten oder durch moderne Luftkühlungen. Zum anderen wollen sie Wasser in besonders trockenen Landesgegenden wieder zurückführen – etwa durch den Bau von Anlagen zur Abwasseraufbereitung.
Die Facebook-Mutter Meta hat seit 2017 in 25 verschiedene Aufbereitungsprojekte investiert. Sobald diese vollständig in Betrieb sind, sollen sie 7,2 Millionen Kubikmeter Wasser zurückführen, heißt es. Daneben hat Meta im vergangenen Jahr damit begonnen, mit höheren Temperaturen in ausgewählten Rechenzentren zu experimentieren. Die Datencenter wurden dort nicht mehr auf rund 29 Grad Celsius heruntergekühlt, sondern nur noch auf etwa 32 Grad. Im Sommer habe man damit den Wasserverbrauch um mehr als 50 Prozent senken können, mit geringen oder keinen Auswirkungen auf den Betrieb, wie das Unternehmen erklärt.
Google hat vor wenigen Wochen den Aufbau eines Rechenzentrums bei Mesa in Arizona angekündigt, das mit Luft statt Wasser gekühlt wird. Der Strom dafür soll vollständig aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Details zur Funktionsweise ließ der verantwortliche Google-Manager Joseph Kava gegenüber Reportern beim Spatenstich offen. Nur so viel: “Mein Innovationsteam hat daran gearbeitet, wie wir luftgekühlte Lösungen nutzen und sie genauso kostengünstig machen können wie wassergekühlte”, sagte er gegenüber US-Medien.
In seinem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht betont Google noch, dass wassergekühlte Rechenzentren durchschnittlich zehn Prozent weniger Energie verbrauchen als luftgekühlte. Deshalb arbeite das Unternehmen auch an Kühlsystemen aus Ab- und Meerwasser. Im Bundesstaat Georgia betreibt Google bereits seit einigen Jahren ein Rechenzentrum, das mit recyceltem Abwasser aus dem örtlichen Douglas County gekühlt wird.
Und auch Microsoft beteiligt sich an Aufbereitungsprojekten – insbesondere in wasserarmen Regionen, in denen der Konzern tätig ist. Insgesamt 40 Standorte hat der Konzern als vorrangig ausgemacht. Daneben investiere man viel in die Forschung, um den “Energieverbrauch und die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Umwelt zu messen”, wie eine Sprecherin auf Anfrage von Table.Media erklärt. Zuletzt hat der Konzern mit einer speziellen Kühlflüssigkeit experimentiert, die nicht leitfähig ist. Ganze Server-Racks können deshalb vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht werden.
Computertechniker Ren kritisiert jedoch, dass viele Unternehmen ihre Bemühungen bislang auf die Kühlung von Rechenzentren beschränken würden – und damit nur auf die direkten Auswirkungen des eigenen Betriebs (Scope 1). Dabei sorge auch der genutzte Strom je nach Energiequelle für indirekten Wasserverbrauch (Scope 2). Ebenso werde bei der Produktion der Hochleistungs-Chips für die Rechenzentren Wasser benötigt (Scope 3).
Doch für einen umfassenden Überblick mangele es an Transparenz, kritisiert der Experte. “Während die großen Technologieunternehmen versprechen, wasserpositiv zu sein, fehlen noch immer Details zum Wasserfußabdruck.” Das Datenblatt eines veröffentlichten KI-Modells enthalte standardmäßig den indirekten CO₂-Fußabdruck, der mit dem Energieverbrauch für das Modelltraining verbunden ist. “Leider enthält das Datenblatt aber so gut wie keine Informationen zum Wasser”, kritisiert Ren. “Das ist in etwa so, als würde man die Kalorienangaben auf dem Etikett eines Lebensmittels weglassen.” Laurin Meyer
22.11.2023, 14:00-15:30 Uhr
Online-Seminar THG-Bilanzierung in der Lieferkette Info & Anmeldung
22.11.2023, 13:30 Uhr
Online-Konferenz Shifting the Trillions – Finanzierung der Zukunftswirtschaft Info & Anmeldung
23.-24.11.2023, Berlin
Konferenz SDIA Green Coding Summit Info & Anmeldung
23.11.2023, 17:00-19:00 Uhr
Online-Diskussion Green Cities 2035: Smart City Info & Anmeldung
23.11.2023, 9:30-15:30 Uhr
Tagung 4. Konferenz zu Sustainability Transformation Info & Anmeldung
23.-24.11.2023, Berlin
Fachtagung Bundesprogramm Energieeffizienz Info & Anmeldung
28.11.2023, 17:00-20:00 Uhr, Berlin
Workshop Die große Transformation: Gestaltung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Zukunft Info & Anmeldung
29.11.2023, 18.00-20.00 Uhr, Berlin
Kongress Menschenrechte – Fundament der Weltordnung Info & Anmeldung
28.11.2023, Brüssel
Konferenz 2023 EFRAG Conference “European corporate reporting: two pillars for success” Info & Anmeldung
30.11.2023, 9:30-13:30 Uhr
Konferenz Policy Accelerator for Climate Innovation Info & Anmeldung
30.11.2023, 15:00-17:00 Uhr, Berlin
KPMG-Zukunftsgipfel ESG – jetzt die nachhaltige Transformation umsetzen Info & Anmeldung
1.12.2023, 11:30-14:00 Uhr, Berlin
Diskussion Wie kann die energetische Gebäudesanierung verbraucherfreundlich gestaltet werden? Info & Anmeldung
5.12.2023 · 17:30-20:15 Uhr, Berlin
Diskussion Klimakrise: Wie gelingt gesellschaftlicher Wandel? Info & Anmeldung
6.12.2023, 9:30-17:00 Uhr, Köln
Stakeholder-Dialog Polyproblem: Wie viel Disruption braucht die Plastik-Wende? Info & Anmeldung
Entgegen den ursprünglichen Ankündigungen der Koalitionsfraktionen wurde die von vielen Ökonomen als zu voraussetzungsreich kritisierte Klimaschutz-Investitionsprämie im Wachstumschancen-Gesetz nicht mehr verändert. Die Prämie, von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Katja Hassel (FDP), als “Kernstück des Gesetzentwurfs” bezeichnet, unterstützt betriebliche Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter mit bis zu 30 Millionen Euro.
Das Nadelöhr der Förderung ist jedoch ein Energiesparkonzept (“Audit”), das von einem der wenigen zertifizierten Energieberater erstellt werden muss oder bereits vorliegt. Der Bundesrechnungshof hatte daher kritisiert, dass nur “0,1 bis 0,5 Prozent” der Unternehmen in Deutschland die Beihilfe in Anspruch nehmen könnten. Auch das Bundesfinanzministerium rechnet mit nur 1.500 Förderanträgen. Dem widersprach nun Parsa Marvi gegenüber Table.Media, der die SPD im Bundestags-Finanzausschuss vertritt: “Wir haben jetzt schon nach unserer Kenntnis mindestens 90.000 Unternehmen, die über offizielle Energieaudits verfügen und somit Zugang zu der Investitionsprämie haben.”
Zudem fordert der Finanzausschuss die Regierung in einer Protokollnotiz auf, weitere Verbesserungen im nächsten Jahressteuergesetz umzusetzen. Für die grüne Bundestagsabgeordnete Katharina Beck gehört dazu, “die Investitionsprämie für Klimaschutz schnellstmöglich im Sinne der Technologieoffenheit” auszubauen und Erleichterungen für kleinere und mittlere Unternehmen auf den zu Weg bringen. Nach Informationen von Table.Media wird dabei über eine eventuelle Förderung von Solar-, Batterie- und Wasserstofftechnologie diskutiert.
Einer der wenigen anderen transformativen Bausteine im Wachstumschancen-Gesetz ist für die Koalitionsfraktionen auch die erweiterte steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für den Mietwohnungsbau. Hier konnten die Abgeordneten durchsetzen, dass bereits bestehende mit den im Wachstumschancen-Gesetz enthaltenen neuen Regelungen kombiniert werden können. Sofern die neuen Mietwohnungen dem Effizienzhaus-Standard 40 (EH 40) entsprechen sowie mit dem Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen versehen sind, seien bis zu elf Prozent steuerliche Abschreibungen möglich. Marvi sieht darin “einen enormen Impuls für das energieeffiziente Bauen”. Allerdings können die Bauträger auch ohne Nachhaltigkeitssiegel und Energiehaus-Standard nun sechs Prozent ihrer Investition abschreiben, was gerade im preisgünstigeren Segment die profitablere Variante sein könnte.
Nur eingeschränkt berücksichtigt wurde die Kritik der Deutschen Umwelthilfe an der Ausweitung des sogenannten Dienstwagenprivilegs, welches die NGO als “sozial ungerechte Subvention für Gutverdienende” bezeichnet hatte. Im ursprünglichen Gesetzentwurf plante die Bundesregierung, den maximalen Bruttolistenpreis von besonders geförderten E-Autos von bislang 60.000 auf 80.000 Euro zu erhöhen. Dieser Höchstpreis wurde durch das Parlament wieder auf 70.000 Euro verringert. Zudem wurde die Förderung von Hybridfahrzeugen eingeschränkt. Der Bundesrat berät das Gesetz am Freitag und wird es möglicherweise in den Vermittlungsausschuss verweisen. av
Die nationale Kontaktstelle der OECD in Frankreich prüft, ob der chinesische Onlinehändler Shein gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln für Arbeits- und Menschenrechte verstößt. Das teilte die Kontaktstelle vergangene Woche mit. Shein sagte zu Table.Media, man habe “umgehend” reagiert und sich mit der Kontaktstelle (NKS) getroffen. “Wir haben und werden auch weiterhin voll und ganz kooperieren, um etwaige Fragen der NKS zu beantworten”, ergänzt das Unternehmen.
Die Kontaktstelle will die Einhaltung der Sorgfaltspflichten bei dem Unternehmen selbst und im Hinblick auf Zulieferer prüfen. Dabei geht es auch um die Frage, ob Shein transparent genug über seine Bemühungen zur Einhaltung der OECD-Leitsätze auf seiner Website berichtet. Die Kontaktstelle beschäftigt sich auch mit der Frage, ob das Geschäftsgebaren des Unternehmens der Umwelt oder Gesundheit der Verbraucher schadet.
Davon gehen Dominique Potier und Boris Vallaud aus, beides sozialistische Abgeordnete der französischen Nationalversammlung. Sie haben am 20. Juni Beschwerde bei der OECD eingelegt. In einer aktuellen Pressemitteilung schreibt die Partei, sie sei der Ansicht, dass die Herstellung und die Lieferkette der Produkte, die Shein in Frankreich vermarktet, die Menschenrechte, die Umwelt und die Interessen der Verbraucher nicht respektiert.
Die nationalen OECD-Kontaktstellen sollen bei Beschwerden über die Anwendung der OECD-Leitsätze zwischen Beschwerdeführern und Unternehmen vermitteln. Die Teilnahme an den Verfahren der Kontaktstellen ist freiwillig. Bereits im September haben sich Vertreter der Schlichtungsstelle mit der Geschäftsleitung von Shein getroffen. Jetzt will sie beide Parteien erneut anhören, bevor es später zu einem direkten Aufeinandertreffen kommen soll. Shein könnte sich aber auch jederzeit aus dem Verfahren zurückziehen. nh
Laut einer am heutigen Mittwoch erscheinenden Studie von KPMG und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), die Table.Media exklusiv vorab vorliegt, berücksichtigen über 50 Prozent der befragten Unternehmen Klimarisiken und Folgeschäden nicht vollumfänglich im eigenen Risikomanagementsystem.
Als größte Klimarisiken sehen die Unternehmen eine Veränderung der Nachfrage, knappe Ressourcen und Schäden an der Infrastruktur. Die Auswirkungen von Hitze oder Dürre sowie Risiken durch den Verlust von Artenvielfalt sind für die Mehrheit bisher keine Themen in ihrem Risikomanagement. 22 Prozent berücksichtigen Klimarisiken im Beschaffungsprozess nicht.
Gleichzeitig planen insgesamt 43 Prozent der Unternehmen, ein Zehntel oder mehr ihres Umsatzes in die “grüne Transformation” zu investieren, heißt es in der Studie. Bei Firmen mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz sind es 36 Prozent, bei Unternehmen mit mehr 57 Prozent. Auf mehr als ein Zehntel ihres Umsatzes oder ihrer Gewinnmarge verzichten würden acht Prozent der kleineren Unternehmen mit weniger Umsatz und kein Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz.
Darüber hinaus sehen 73 Prozent der Unternehmen zusätzliches Geschäftspotenzial in der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zur Minderung von Klimafolgeschäden. Die Studienautoren gehen davon aus, dass es für den europäischen Maschinen- und Anlagenbau in zehn Jahren ein jährliches Umsatzpotenzial von über 200 Milliarden Euro bei Lösungen zum Schutz vor Klimarisiken und zur Minderung von Klimafolgeschäden gibt.
Für die Studie “Klimarisiken und Folgeschäden des Klimawandels 2023” haben KPMG und der VDMA 235 Entscheider aus Unternehmen in Deutschland befragt. nh
Kenia und Frankreich haben angekündigt, beim Klimagipfel in Dubai die Debatte über internationale Klimasteuern voranzutreiben. Die Präsidenten der beiden Länder, William Ruto und Emmanuel Macron, planen dazu die Gründung einer “Taskforce”, die innerhalb von zwei Jahren konkrete Vorschläge erarbeiten soll. Wie Climatechangenews.com vergangene Woche berichtete, hoffen die Staatschefs, eine Koalition aus Europa und dem globalen Süden in der Taskforce zu versammeln.
Die Debatte über globale Klimasteuern und Abgaben wird seit einem von Macron anberaumten Finanz-Gipfeltreffen in Paris im Juni lebhafter. Der von Ruto im September in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ausgerichtete “Afrikanische Klimagipfel” etwa endete mit der Forderung nach einem “globalen System zur Besteuerung von Kohlenstoff”, “um zweckgebundene, erschwingliche und zugängliche Finanzmittel für klimaschonende Investitionen in großem Umfang bereitzustellen”.
Auch internationale Organisationen befassen sich mit dem Thema. Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), kündigte im Oktober eine eigene Taskforce an, die Vorschläge für “eine Methode für einen globalen Kohlenstoffpreis” entwickeln soll, “der alle zustimmen können.” Der Internationale Währungsfonds (IWF) wiederum argumentierte in seinem jüngsten “Fiscal Monitor”, dass CO₂-Steuern ein “integraler” Bestandteil aller nationalen Klimapakete sein müssten.
Welche Güter und Dienstleistungen durch eine globale Koordination besteuert werden sollten, ist umstritten. Im Juli konnte sich die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) nicht auf eine Steuer auf Schifffahrts-Emissionen einigen. Andere Ideen betreffen Abgaben auf Flugverkehr, Finanztransaktionen und fossile Brennstoffe. Weitere offene Fragen sind, welche Organisation globale Klimasteuern koordinieren sollte und wofür die Erlöse verwendet werden.
Diskutiert wird zudem, wie eine global gerechte Besteuerung aussehen könnte. Während US-Finanzministerin Janet Yellen eine Schifffahrtssteuer einen “sehr konstruktiven Vorschlag” nannte, sehen sich Staaten im globalen Süden aufgrund ihrer geografischen Entfernung zu wirtschaftlichen Zentren benachteiligt. “Wir müssen die Emissionsabgaben für Schifffahrt und Luftverkehr überdenken, damit sie nicht zu einer Steuer auf Abgelegenheit werden”, argumentierte etwa Avinash Persaud, Klimabotschafter von Barbados, der den Vorschlag einer globalen Klimasteuer an sich jedoch begrüßt. av
Die am Sonntag in Nairobi zu Ende gegangene dritte Verhandlungsrunde für ein globales Abkommen gegen Plastikmüll hat laut Teilnehmern und Beobachtern wenig Fortschritte gebracht. Aus Sicht von Graham Forbes, Delegationsleiter von Greenpeace, sei das Hauptziel verfehlt worden: Ein Mandat zu vereinbaren, um bis zur Verhandlungsrunde an einem Entwurf für den Vertrag arbeiten zu können. Bundesumweltministerin Steffi Lemke findet es “sehr bedauerlich”, dass die dritte Runde “ohne Einigung über nächste Schritte zu Ende gegangen ist.”
Gescheitert sei eine Einigung an Staaten, die auch künftig von fossilen Geschäftsmodellen wie der Plastikproduktion profitieren wollen, sagte Lemke. “Die Bremsmanöver und der Widerstand von ölproduzierenden Staaten wie Saudi-Arabien, Russland und Iran haben viel Zeit gekostet und die Verhandlungen beinahe vollständig zum Stillstand gebracht”, kommentierte Florian Titze, WWF Deutschland. Immerhin sei es gelungen, Rückschritte zu vermeiden. So würde sich weiterhin eine Mehrheit dafür einsetzen, “dass das Abkommen den gesamten Lebenszyklus von Plastik inklusive der Produktion umfassen muss, statt nur Fragen von Abfallentsorgung und -aufbereitung”, sagte Titze.
Im März 2022 hatten sich die UN-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, einen Vertrag zu erarbeiten, um die weltweite Plastikverschmutzung zu beenden. Nach der vierten Verhandlungsrunde im April 2024 im kanadischen Ottawa soll es Ende 2024 eine fünfte und letzte in Südkorea geben. nh mit dpa und rtr
Das EU-Parlament in Straßburg hat am Dienstag sein Verhandlungsmandat zu einem verstärkten “Recht auf Reparatur” angenommen. Die Richtlinie soll einen nachhaltigen Konsum stärken, indem die Reparatur fehlerhafter Waren vereinfacht, Abfall reduziert und die Reparaturbranche gefördert wird.
Der Entwurf von Berichterstatter René Repasi (S&D) schärft den Vorschlag der EU-Kommission. Er will Verkäufer während der gesetzlichen Garantiezeit verpflichten, zu reparieren anstatt zu ersetzen, wenn eine Reparatur gleich viel oder weniger kostet – es sei denn, die Reparatur ist nicht machbar oder für den Verbraucher ungünstig. Die Abgeordneten schlagen zudem vor, die gesetzliche Garantiezeit um ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Reparatur zu verlängern.
“Die Leute wollen die Lebensdauer ihrer Geräte verlängern, aber das ist oft zu kostspielig oder schwierig. Nun reagieren wir auf diese Forderungen”, erklärte Repasi. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen das Recht erhalten, für Geräte wie Waschmaschinen, Staubsauger und Smartphones sowie für Fahrräder auch nach Ablauf der Garantiezeit eine Reparatur zu verlangen. Damit Reparieren attraktiver wird als Ersetzen, sollen Hersteller für die Dauer der Reparatur Leihgeräte zur Verfügung stellen. Kann ein Produkt nicht mehr repariert werden, könnte stattdessen ein bereits repariertes Produkt angeboten werden.
Online-Plattformen sollen eine Übersicht über Reparaturbetriebe und Verkäufer überholter Waren in der Nähe bieten. Die Abgeordneten schlagen außerdem vor, über nationale Reparaturfonds Gutscheine und andere finanzielle Anreize bereitzustellen, um Reparaturen erschwinglicher und attraktiver zu machen.
Der Rat wird seine Verhandlungsposition voraussichtlich am heutigen Mittwoch festlegen. Danach können die Verhandlungen mit dem Parlament beginnen. Ein erstes Treffen ist für den 7. Dezember geplant. leo
Laut dem Thinktank Climate Analytics haben die Staaten im Jahr 2023 weltweit den Emissionspeak mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht. Die Forscherinnen und Forscher zeigen sich optimistisch, dass die globalen Treibhausgasemissionen im Jahr 2024 mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent fallen werden. Voraussetzung hierfür sei die Beschleunigung der aktuellen Wachstumstrends bei den erneuerbaren Energien und grünen Technologien wie E-Autos, und dass die Staaten ihre Zusagen zur Verminderung der Methan-Emissionen umsetzen.
Das Wachstum bei den Erneuerbaren und E-Autos könne demnach zu:
Die Autorinnen und Autoren haben für ihre Studie ein “Szenario der weiteren Beschleunigung” des Ausbaus der Erneuerbaren und des Verkaufs von E-Autos ausgewählt. Dadurch würden in den kommenden Jahren so viele Erneuerbare zugebaut, dass sie fossile Energien aus den Netzen verdrängen. Doch selbst dieses Szenario würde bis 2030 lediglich zu einer Absenkung der Emissionen um zehn Prozent führen (im Vergleich zum Jahr 2019). Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, bräuchte es eine Absenkung um 43 Prozent bis 2030.
Es bedürfe dementsprechend:
Laut der Climate Analytics-Recherche haben bis 2015 schon 50 Staaten ihren Emissionspeak erreicht und sind in die Phase des langfristigen Rückgangs eingetreten. Dazu gehören die USA, Deutschland, Japan und Australien. China könne im nächsten Jahr fallende Emissionen erreichen, Indien seinen Peak in den frühen 2030er-Jahren. In der EU könne der Zubau von Wind- und Solarenergie bis 2030 den gesamten Kohlestrom verdrängen. nib
Die Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen über den Rechtsakt zur Förderung klimafreundlicher Industrien werden voraussichtlich am 17. Dezember beginnen. Das Europaparlament beschloss am Dienstag wie erwartet seine Position zum Net-Zero Industry Act (NZIA). Die Mitgliedstaaten wiederum wollen ihre eigenen Forderungen beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 7. Dezember festzurren. Anschließend kann der Trilog beginnen, der rechtzeitig vor der Europawahl im Juni abgeschlossen werden soll.
Die Abgeordneten stimmten gestern im Plenum ohne Änderungen dem Kompromiss zu, den Berichterstatter Christian Ehler (CDU) im Industrieausschuss ausgehandelt hatte. Wichtigste Änderung zum ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission und zugleich absehbar Hauptstreitpunkt im Trilog: die deutliche Ausweitung der Technologiesektoren, die von den Fördermaßnahmen profitieren sollen. Dazu zählen neben unstrittigen Bereichen wie Solar, Wind oder Wärmepumpen auch “Kernspaltungs- und Fusionsenergietechnologien”. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss kritisierte: “Der Schritt in die Vergangenheit weicht den Green Deal auf.” tho
Die Angst der Techmilliardäre vor ihrem Personal – Deutschlandfunk
In einem sehr erhellenden Interview spricht der Medienwissenschaftler Douglas Rushkoff über das Menschenbild der Tech-Milliardäre im Silicon Valley und die daraus für die Transformation resultierenden Schwierigkeiten. Vor menschlicher Kooperation schreckten die Milliardäre zurück, dabei sei diese dringend zur Lösung der Probleme nötig, sagt Rushkoff. Zum Interview
Decarbonisation of industrial activities is beginning – The Economist
Der Autor Vijay Vaithheeswaran erwartet einen Wandel im ESG-Investment. Nach Exzessen des ESG-Aktivismus, der dazu aufgerufen habe, traditionelle und schwer zu transformierende Industrien wie Stahl und Zement zu verschmähen, gingen viele Investoren zu einem eher programmatischen Ansatz über. So habe BlackRock einen transformativen “Braun-zu-Grün”-Fonds für alte Industrien aufgelegt. Zum Artikel
Oil Majors’ Carbon Capture Plans Dubbed a ‘Dangerous Delusion’ – Bloomberg
Carbon-Capture-Technologien tragen auch künftig nicht genug zur CO₂-Reduktion bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Gruppe von Experten um Adair Turner, den ehemaligen Vorsitzenden der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde der Londoner City. Nach ihrer Berechnung sinken die Kosten der Entwicklung zu langsam, zudem blieben die Projekte und deren Finanzierung unter den Erwartungen. Zum Artikel
Das amerikanische Windkraft-Desaster – Der Spiegel
Trotz ihrer 150.000 Kilometer langen Küsten seien die USA Nachzügler bei der Windkraft, schreibt Ines Zöttl. Präsident Joe Biden wolle den Rückstand aufholen, indem das Land die Kapazität auf 30 Gigawatt ausbaut. Doch die Windkraftindustrie habe sich bei den Kosten verkalkuliert und ziehe sich aus Projekten zurück. Mehr als die Hälfte der Offshore-Kapazitäten, die aktuell in Entwicklung sind, seien gefährdet. Zum Artikel
Shades of green hydrogen: EU demand set to transform Namibia – Climate Home News
Die EU benötigt saubere Energie – und die soll, unter anderem, in Form von grünem Wasserstoff aus Namibia kommen. Umsätze in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar plant das afrikanische Land ein. Wie drei Autoren ausführlich beleuchten, kann das aber negative Konsequenzen für die Einwohner und die Natur haben. Zum Artikel
In Congo’s Cobalt Mines – The New York Review of Books
In der Demokratischen Republik Kongo befinden sich große Vorkommen zentraler Rohstoffe für die Energiewende. Doch die Bevölkerung profitiert kaum davon. Wohlmeinende westliche Kampagnen für Reformen sind jedoch nicht immer hilfreich, wie Nicolas Niarchos anhand neu erschienener Sachbücher erklärt. Zum Artikel
Damit riskiert man Revolten in Frankreich, Portugal und Deutschland – Der Spiegel
Der Stellantis-Chef Carlos Tavares spricht im Interview mit Simon Hage und Martin Hesse über schwierige Zeiten für die europäischen Autohersteller. Während es den Unternehmen schwerfiele, ihren Kunden bezahlbare Fahrzeuge anzubieten, fielen hohe Kosten an und die Profitabilität sei in Gefahr. “Wenn es ihnen nicht gelingt, diesem Dilemma zu entkommen, wird es schlimm enden”, prophezeit er. Zum Artikel
Renault auf Partnersuche – FAZ
Niklas Záboji schreibt über die Investoren-Suche des Renault-Chefs, Luca De Meo, für die Ausgliederung der Elektro- und Software-Aktivitäten in das neue Unternehmen Ampere. Bis 2030 solle die Ampere-Palette aus sieben neuen Elektrofahrzeugen bestehen, darunter ein Kleinwagen für unter 20.000 Euro. Analysten seien aber skeptisch, ob die Firma mit der preisgünstigen Konkurrenz aus China mithalten könne. Zum Artikel
Den Ewigkeitschemikalien droht das Aus – Chemanager
Zum geplanten PFAS-Verbot schreibt die Wissenschaftsjournalistin Uta Neubauer, dass Risiken nicht allein in der Nutzung von Produkten lägen, sondern auch in der Produktion. Wenn PFAS-Substanzen über Abluft oder Abwässer in die Umwelt gelangten, erfordere die Sanierung kontaminierter Böden einen enormen technischen Aufwand. Für zahlreiche Anwendungen gäbe es jedoch PFAS-Alternativen. Zum Artikel
Kritik an Rezyklatquoten für Lebensmittelverpackungen – Plastverarbeiter
Verpackungsexperten warnen, dass Produzenten wegen der EU-Verpackungsverordnung auf schwer recyclebare, beschichtete Verbundverpackungen ausweichen. Es stünden nämlich zu wenig zugelassene Kunststoffrezyklate für kontaktempfindliche Verpackungen zur Verfügung. So seien für den Lebensmittelbereich beim PET bis dato etwa nur Rezyklate aus Pfandflaschen zugelassen. Zum Artikel


Die EU steht kurz vor einem historischen politischen Erfolg. Sie könnte im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte globale Standards setzen, wie dies die USA 1977 mit dem Foreign Corrupt Practices Act bei der Korruptionsbekämpfung taten. Notwendig ist dafür aber, dass die EU ihre ambitionierten Entwürfe für ein EU-Lieferkettengesetz (Corporate Due Diligence Directive, CSDDD) auf der Zielgrade nicht erheblich verwässert. Lobbyisten haben bereits sowohl den Entwurf der Kommission als auch den Entwurf des Rats abgeschwächt. Außerdem gibt es noch weitergehende Änderungswünsche der Lobby für den vorgeschlagenen regulatorischen Rahmens für Menschenrechtsschutz in Lieferketten.
So drängt US-Finanzministerin Janet Yellen die EU, Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb der Gemeinschaft von den Pflichten auszunehmen. Zudem fordert der Vorsitzende des International Sustainability Standards Board, Emmanuel Faber, Europa auf, das verwandte Gesetz zur Berichterstattung über die Nachhaltigkeit so einzuschränken, dass die Unternehmen nicht mehr alle Risiken für Mensch und Umwelt melden müssen. Wenn sich Yellen und Faber durchsetzen sollten, wären die Folgen fatal, denn das EU-System für Wirtschaft und Menschenrechte würde nur die Anteilseigner selbst schützen und US-Firmen, die in Europa Geschäfte machen, einen Freifahrtschein geben.
Die vor einem Jahr verabschiedete EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zwingt alle in Europa tätigen Firmen – darunter etwa 4000 mit Hauptsitz außerhalb der EU – dazu, öffentlich über alle wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu berichten. Zu Fabers Bestürzung hat Europa einen neuen Ansatz der “doppelten Wesentlichkeit” eingeführt. Demnach müssen Unternehmen über jedes Nachhaltigkeitsrisiko berichten, das entweder für die Anteilseigner des Unternehmens oder für die Menschen und den Planeten von Bedeutung ist. Faber bevorzugt dagegen den alten Ansatz der “finanziellen Wesentlichkeit”. Demnach müssen Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken nur melden, wenn sie den finanziellen Wert des Unternehmens für seine Anteilseigner gefährden.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass genau dies Fortschritte durch ESG behindert. Das belegt ein neuer Bericht des NYU Stern Center for Business and Human Rights zur Wirkungsweise der finanziellen Wesentlichkeit. Demnach behindert eine Vorgehensweise nach der alten Methode, dass das System von Investitionen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) Wirkung entfaltet.
Denn die meisten aktuellen ESG-Rahmenwerke bewerten, wie Umwelt- oder Sozialrisiken den Unternehmen schaden können, und nicht, wie Unternehmen der Welt schaden können. Das ist kontraproduktiv, denn Unternehmen schaden oft der Umwelt oder der Gesellschaft, ohne gleichzeitig ihren Anteilseignern zu schaden. So können Unternehmen sich umweltschädigend verhalten, wenn es profitabel ist – und wenn die rechtlichen oder reputationsbezogenen Konsequenzen nicht vorhanden oder überschaubar sind. Unmoral im Geschäftsleben kann gewinnbringend, legal und skandalfrei sein. Manches Fehlverhalten ist sogar so profitabel, dass es für ein Unternehmen finanziell rational sein kann, Skandale und rechtliche Sanktionen in Kauf zu nehmen. Unternehmen, die sich schädlich verhalten, können versuchen, sich vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, indem sie Lobbyarbeit betreiben und Prozesse führen, um das Regelwerk zu schwächen, in Länder mit geringer Regulierung abwandern oder Aufgaben auslagern, bei denen es zu Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen kommen kann.
Daher kann die Kopplung von ESG an die finanzielle Wesentlichkeit Unternehmen belohnen, die sich vor den rechtlichen Konsequenzen drücken. Auch ihre Reputation muss nicht zwingend leiden: Wo Medien und die Zivilgesellschaft schwach sind, kommen Skandale selten ans Licht. Und selbst wenn Skandale ans Tageslicht kommen, wissen viele Kunden und Arbeitnehmer nichts von ethischen Fragen oder interessieren sich nicht dafür. Ein Bedarf an neuen regulatorischen Mechanismen wie dem EU-Lieferkettengesetz entsteht, wenn die Unternehmen nicht durch den bestehenden rechtlichen oder marktwirtschaftlichen Druck diszipliniert werden, über die Kosten, die sie Mensch und Umwelt auferlegen, Rechenschaft abzulegen.
Unternehmensberichterstattung alleine ist noch kein derartiger Rechenschaftsmechanismus. Die Theorie hinter der Nachhaltigkeitsberichterstattung besteht darin, Investoren mit den Daten auszustatten, die sie benötigen, um Unternehmen zu disziplinieren. Bedauerlicherweise kommt der NYU-Bericht zu dem Schluss, dass viele ESG-Fonds in ihrer Rolle als wirksame Kontrolleure versagen. ESG-Ratings sind sogar so inkohärent, dass die Unternehmen nicht wissen, welches Verhalten sie fördern oder verhindern. Einige führende US-amerikanische ESG-Fonds sind praktisch nicht von Marktindizes zu unterscheiden und enthalten große Anteile problematischer Aktien. Damit die ESG-Investoren tatsächlich wirksam werden könnten, schlägt der NYU-Bericht einige Reformen vor.
Weil die meisten ESG-Investoren versagen, wenn es darum geht, freiwillig Nachhaltigkeitsdaten sinnvoll zu nutzen, braucht es einen verpflichtenden Ansatz im Bereich ESG. Das EU-Lieferkettengesetz würde die Unternehmen dazu zwingen, einen riesigen Schritt über die letztjährige Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung hinauszugehen: Sie müssten nicht nur über Umwelt- und Sozialrisiken berichten, sondern sie auch in ihrer globalen Wertschöpfungskette durch effektive Maßnahmen adressieren. Ein starkes Lieferkettengesetz würde die Unternehmen also gewissermaßen dazu zwingen, Nachhaltigkeitsdaten endlich sinnvoll zu nutzen. Das hätte revolutionäres Potenzial für die Verbesserung der natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen – wenn es richtig gemacht wird.
Das Gesetz muss global anwendbar sein, weil der Schutzbedarf in den Wertschöpfungsketten global ist. Wird das Gesetz nicht auch auf Unternehmen angewendet, die Waren oder Dienstleistungen in die EU liefern, entstände für Unternehmen ein Anreiz, ihren Hauptsitz in ein Land mit schwacher Regulierung zu verlegen. Das würde nicht nur der Sache an sich, sondern Europa auch noch ökonomisch schaden.
Diese wichtige Regulierungsaufgabe fällt Europa zu, da die USA in diesem Bereich höchstens eine lückenhafte Unternehmensberichterstattung vorschreiben werden und hoffen, dass ESG-Investoren ihre Arbeit tun. Die EU ist der einzige Player, der im Jahr 2023 einen globalen Menschenrechtsschutz in Wertschöpfungsketten durchsetzen kann, so wie die USA im Jahr 1977 der einzige Akteur waren, der eine globale Korruptionsbekämpfung durchsetzen konnte.
Wie damals bei der Korruptionsbekämpfung könnte eine jetzige EU-Lieferkettenregulierung einen sich selbst verstärkenden, positiven Kreislauf schaffen. Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz würde für globale Unternehmen einen Anreiz darstellen, hohe ESG-Standards einzuhalten, um den Zugang zum EU-Markt zu erhalten. Gleichzeitig könnte sie andere Länder unter Druck setzen, ähnliche Vorschriften einzuführen, um für multinationale Unternehmen attraktiv zu bleiben, die sich an europäische Regelwerke halten müssen. Der “Brüssel Effekt” des Marktortsprinzips würde einen erheblichen Anreiz für Unternehmen und Staaten weltweit darstellen, Menschenrechte und Umwelt stärker zu schützen, um den Anschluss an einen der größten Binnenmärkte der Welt nicht zu verlieren. Ähnliches ist bei der EU-Regulierung im digitalen Bereich zu beobachten. So könnte Brüssel ein “Race to the Top” in Gang setzen, was zu einer gerechteren Weltwirtschaft führen könnte. Diese Chance sollte sich die EU nicht entgehen lassen.
Michael Goldhaber ist Senior Research Scholar am NYU Stern Center for Business and Human Rights und Autor des Berichts “Making ESG Real: A Return to Values-Driven Investing.“
Stéphane Brabant ist Rechtsanwalt in Paris und Senior Partner bei Trinity International AARPI in Paris, spezialisiert auf Unternehmen und Menschenrechte.
Daniel Schönfelder ist als European Legal Advsior für das Responsible Contracting Project tätig und wirkt als Jurist in einem Großkonzern an der Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes mit.

Die Deutsche Bahn will digital werden. Milliarden Euro investiert sie in dieses Vorhaben und verbindet damit große Hoffnungen: autonom fahrende Züge, die pünktlich ans Ziel kommen; KI-Programme, die Schäden an Rädern innerhalb von Minuten erkennen; und eine Datenübertragung, die Kunden in Echtzeit mit Informationen versorgt.
Denise Baidinger gehört zu den Führungskräften in der Berliner Konzernzentrale, die an diesem Großprojekt mitarbeiten. Zugleich versucht sie, es in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Die 33-Jährige leitet die Initiative “Grüne Digitalisierung” – denn Rechner, Server, Sensoren, Maschinen und Endgeräte verursachen einen wachsenden Energie- und Rohstoffverbrauch. Baidinger will für diese häufig übersehenen negativen Seiten sensibilisieren. Mit ihrem Team aus 17 Kolleginnen und Kollegen, die in den Tochtergesellschaften sitzen, treibt sie das Thema voran. Momentan geht es zum Beispiel darum, ein Dashboard zu entwickeln. “Das soll Programmierern zeigen, wie viel Energie ihre Softwarelösungen beanspruchen”, sagt sie.
Zur Bahn ist Baidinger vor sechs Jahren gekommen. Davor hat sie, die aus dem Main-Taunus-Kreis stammt, in Frankfurt am Main und Leeds BWL studiert, anschließend bei IBM und in einer IT-Beratung gearbeitet. Um Nachhaltigkeit ging es dabei nicht, sondern ums Datenmanagement, den Aufbau neuer Strukturen und die sogenannte “Customer Experience”. Heißt: Wie gelingt es, Kunden mit digitalen Mitteln ein möglichst reibungsloses Erlebnis zu bieten?
Diese Erfahrung hat ihren Blick für unterschiedliche Bedürfnisse geprägt, was auch heute wichtig ist, sagt sie, denn: “Die Deutsche Bahn ist ein Abbild der gesamten Gesellschaft.” In dem Konzern arbeiten nicht nur “Digital Natives” und Veganer, die besonders auf ihren ökologischen Fußabdruck achten. Es gäbe viele Kolleginnen und Kollegen, die Sorgen und Fragen haben, Mehrarbeit befürchten, von der Notwendigkeit der Transformation nicht überzeugt sind oder sich schlichtweg verweigern. “Wenn man diese Menschen nicht mitnimmt, gelingt der Wandel nicht”, so Baidinger. Es gehe darum, “Awareness” zu schaffen, Aufmerksamkeit.
Wie die Dinge miteinander zusammenhängen, zeige sich etwa bei den Daten. Für eine erfolgreiche Digitalisierung müssen sie fließen, nahtlos und über die Grenzen von Abteilungen hinweg. In der Vergangenheit aber wurden Daten häufig in ihren jeweiligen Silos versteckt und nicht mit anderen geteilt. Das jetzt zu tun, erfordere Vertrauen, weil man andere plötzlich in die eigenen Prozesse hineinschauen lasse und sich transparenter mache als früher. “Davor war eine gewisse Angst spürbar.”
Um solche Bedenken abzubauen, will sie weniger darauf setzen, IT-Strategien zu verordnen, sondern mehr “bottom up” arbeiten. Zum Auftakt ihrer Initiative hat sie Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen dazu aufgerufen, sich einzubringen und Themen zu setzen. Daraus entstand ein “Blumenstrauß der grünen Digitalisierung”, wie sie es nennt. Es ging um nachhaltiges Coding, das den CO₂-Ausstoß von Digitalprojekten misst; um Regelungen zum Homeoffice; um die Nutzung von Balkonkraftwerken und den ökofairen IT-Einkauf. Eine Stunde pro Woche hätten sich alle Interessierten getroffen, diskutiert und – ohne die jeweiligen Vorgesetzten – eigene Ziele gesetzt. “Das war bereichernd, weil die verschiedensten Programmierer und Fachkollegen zusammenkamen, gerade aus Bereichen, die ich zuvor kaum kannte.”
Eine Aufgabe, die daraus entstanden ist, ist die Überprüfung der Ausschreibungen. Sind “Software as a Service”-Anbieter, die Programme über die Cloud zur Verfügung stellen, nachhaltiger als andere Hersteller? Haben sie überhaupt Daten zu ihrem Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß? Fragen wie diese sollen nach und nach in die Auswahl von Partnerfirmen einfließen.
Wie viel das bringt, wie groß also das Einsparpotenzial solcher Prozesse ist, das weiß Denise Baidinger übrigens nicht so genau. Vor zwei Jahren habe der Vorstand sie um eine Analyse der größten Nachhaltigkeitshebel gebeten. Welche Projekte solle man verfolgen? Doch noch ist Baidinger in einem Feld tätig, in dem es keine eindeutigen Antworten gibt, weil Daten fehlen, Entwicklungen dynamisch und Zusammenhänge komplex sind. Wie wichtig es ist, zentrale Transformationsaspekte zu priorisieren, ist ihr bewusst. Andererseits wäre es ein Fehler, nichts zu verändern und nur Daten zu sammeln. Deshalb setzt sie jetzt aufs “Learning by Doing”. Je mehr sie probiert, desto besser bekommt sie heraus, an welchen Stellschrauben zuerst gedreht werden sollte.
Und einen gar nicht so kleinen Nebeneffekt habe die Verknüpfung von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation bereits: “Das Thema zieht bei der jüngeren Generation.” Wer heute Anfang 20 ist, würde eigentlich gar nicht so gerne für einen Konzern arbeiten wollen. Zu groß, zu behäbig, zu wenig Möglichkeiten der eigenen Entfaltung. Mit ihrer Herangehensweise aber hätte die Deutsche Bahn ein Argument, Talente anzulocken. Marc Winkelmann
Agrifood.Table: EU-Parlament vor wegweisenden Green-Deal-Abstimmungen: Das EU-Parlament stimmt in dieser Woche über eine Reihe von Verordnungen ab, die transformatives Potenzial haben. Dazu gehören die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, die Vermeidung unnötiger und schwer recyclebarer Verpackungen. Hinzu kommt eine Resolution zum anstehenden Klimagipfel COP28 in Dubai.
Mehr
Europe.Table: Trilog-Einigung zum Methan nimmt Importe auf: Die Europäische Union reduziert die Methanemissionen im Energiebereich. Rat, Kommission und Parlament einigten sich im Trilog auch darauf, die Lieferketten dabei mit einzubeziehen. Doch Strafzahlungen für zu schädliche Importe werden erst ab 2030 erhoben.
Mehr
Europe.Table: EU-Kommission lässt Glyphosat für weitere zehn Jahre zu: Da es unter den EU-Mitgliedsstaaten keine qualifizierte Mehrheit gegen eine Verlängerung der Zulassung des Herbizids Glyphosat gab, konnte die Kommission in der vergangenen Woche den Wirkstoff für weitere zehn Jahre zulassen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir prüft nun, wenigstens in Deutschland die Verwendung einzuschränken.
Mehr
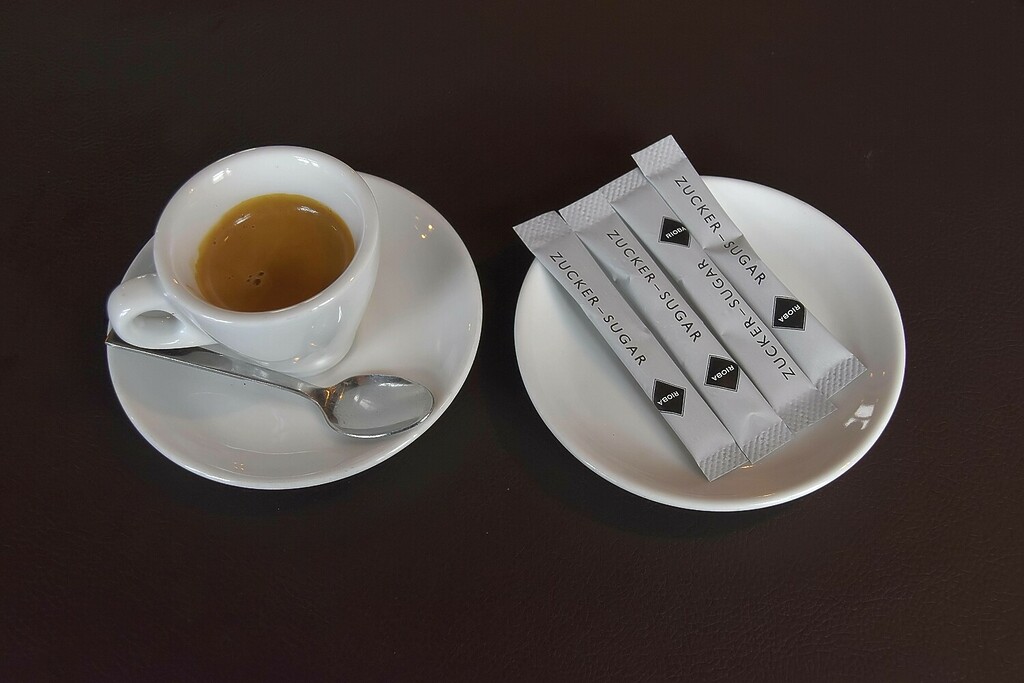
Vom Aufstand deutscher Bierbrauer über die Sorge eines Europaabgeordneten um Zuckertütchen bis hin zur Androhung einer neuen Französischen Revolution aus Angst um Käse – überall in Europa regt sich gerade Widerstand.
Der Grund: Die EU will Verpackungsabfälle reduzieren. Seit etwas mehr als einem Jahr arbeiten Kommission, Rat und Parlament an einer neuen Verordnung, die Mehrwegsysteme stärken und dafür sorgen soll, dass alle Verpackungen bis 2030 recycelbar sind. Etwa genauso lang dauert bereits der erbitterte Kampf von Industrie und Nostalgikern. Die beteiligten Europaabgeordneten sprachen von einer rekordverdächtigen Flut an Lobbyanfragen. Auch Medienberichterstattende erhielten ungewöhnlich viele Gesprächsanfragen und neue, vermeintlich bahnbrechende Studien der Einweglobby.
Bereits Ende Mai brach die Panik unter den deutschen Bierbrauern und Getränkeherstellern aus. Besorgte Verbandschefs warnten in der BILD: Es drohe die Vernichtung von “MILLIARDEN Bierflaschen”, sogar die Bierkästen müssten geschreddert werden. Die Verbände störten sich zum einen an der geplanten Deklarationspflicht, die eine dauerhaft angebrachte Kennzeichnung von Mehrwegverpackungen vorsieht. Denn auf deutschen Bierflaschen kleben seit jeher abwaschbare Etiketten. Zum anderen äußerten sie die Sorge, die geplante Begrenzung des Leerraumanteils (also der Luft in Transportverpackungen) würde auch die Bierkästen betreffen – und “den Transport und die Lagerung von Mehrwegflaschen künftig unmöglich machen”, hieß es in einem Brandbrief an die EU-Kommission.
Die EU-Kommission konnte Brauer und Bierliebhaber schnell wieder beruhigen: Natürlich wolle man nicht das deutsche Pfandsystem zerstören, für die Kästen und Etiketten seien Ausnahmen vorgesehen.
Vergangene Woche drohten dann die Franzosen mit einer Neuauflage der Revolution: Auch die traditionelle Holzschachtel des Camembert wäre durch die neuen Regeln bedroht, denn sie sei nicht recyclingfähig und entsprechende Anpassungen wären sehr kostspielig. “Wenn man Europa vor den Wahlen zur Karikatur machen will, dann fängt man an, die Camembert-Hersteller mit ihren Holzverpackungen zu nerven”, spottete die französische Europaministerin Laurence Boone. Mehrere Änderungsanträge wurden daraufhin im Parlament gestellt.
Die deutsche Schattenberichterstatterin für das Gesetz, Delara Burkhardt (SPD), gab im Hintergrundgespräch Entwarnung: Alle Produkte mit geschützten Ursprungs- und geschützten geographischen Angaben würden durch einen Delegierten Rechtsakt der Kommission ausgenommen.
Nur der deutsche Europaabgeordnete Peter Liese (CDU) hat noch keine Klarheit: Werden tatsächlich auch die kleinen Einwegverpackungen für Zucker, Salz und Pfeffer verboten, die zu Kaffee und Speisen in der Gastronomie gereicht werden? Liese posierte aus Protest für ein Foto mit Zuckertüten im EU-Parlament und reichte einen Änderungsantrag ein, der mindestens die Begrenzung des Verbotes auf Plastikverpackungen bewirken soll. Über diesen und rund hundert weitere Anträge stimmt das Parlament am heutigen Mittwoch ab. Leonie Düngefeld
