der Umbau der Wirtschaft verläuft nicht gradlinig, sondern in höchst unterschiedlichem Tempo. Das konnte man in diesen Tagen wieder beobachten, in Eisenhüttenstadt zum Beispiel. Dort übergab Robert Habeck einen Förderbescheid an einen Stahlhersteller, in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Die Summe ist Teil einer größeren Unterstützung, die das Ziel hat, den Sektor zügig zu dekarbonisieren. Aber, wie Alex Veit zeigt: Die drei größten deutschen Produzenten haben ganz unterschiedliche Auffassungen davon, wie und wie schnell sie vorgehen sollten.
Das gilt auch für ExxonMobil. Der US-amerikanische Öl-Gigant wurde bei seiner Hauptversammlung von einem Teil seiner Anteilseigner unter Druck gesetzt, mehr für Umwelt und Klima zu tun. Und zwar nicht irgendwann Mitte des Jahrhunderts, sondern jetzt. Daraufhin aber ging der Konzern zum Gegenangriff über – und verklagte die Aktionäre. Über den Konflikt berichtet Umair Irfan.
Und dann möchte ich Ihnen noch einen Text meiner Kollegin Annette Bruhns ans Herz legen. Sie stellt Julia Adou vor, die Nachhaltigkeitschefin von Aldi Süd, die sich in den vergangenen 16 Jahren in der Branche Respekt verschafft hat, weil sie Bio in die Breite trägt. Wo die Supermarktkette bei diesem Vorhaben inzwischen steht und was Adou noch erreichen will – das erfahren Sie in unserem Porträt.


Bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt übergab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag einen weiteren Zuwendungsbescheid für die Transformation der Stahlindustrie. Diesmal waren es 1,3 Milliarden Euro, mit denen er eine schnelle Dekarbonisierung in Brandenburg und am zweiten großen Standort des Konzerns in Bremen lostreten möchte. “Das ist gut angelegtes Geld. Geld, das gehebelt wird mit weiteren Investitionen des Unternehmens selbst”, sagte Habeck vor 250 Arbeitern in einer Ausbildungshalle des ehemaligen staatseigenen Betriebs der DDR.
Fraglich ist aber, ob Arcelor Mittal die Fördermittel, zu denen das Unternehmen etwa die gleiche Summe aus Eigenmitteln auflegen muss, tatsächlich abruft. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt mit Sitz in Luxemburg will das erst 2025 entscheiden.
Habeck gab sich zuversichtlich und sagte unter Applaus: “Es wäre traurig, wenn der Konzern zu lange wartet oder gar nicht investiert.” Der ebenfalls anwesende Wirtschaftsminister Brandenburgs, Jörg Steinbach, drohte scherzhaft damit, er werde den Managern “jede Nacht im Schlaf erscheinen”.
Nach einer Untersuchung des Öko-Instituts sind 30 deutsche Industrieanlagen für rund ein Drittel der CO₂-Emissionen der Industrie verantwortlich – und auf den ersten 13 Plätzen landen Produktionsstätten der Eisen- und Stahlerzeugung.
Um das zu ändern, haben Bund und Länder den drei größten deutschen Produzenten Thyssenkrupp Steel, Arcelor Mittal und Salzgitter AG jeweils zwischen einer und zwei Milliarden Euro zugesagt. Es soll zum Um- und Neubau der Anlagen dienen, damit diese nicht mehr mit Koks und Kohle betrieben werden, sondern mit Strom, Erdgas und später Wasserstoff. Hinzu kommen 2,6 Milliarden Euro für die Stahlindustrie im Saarland, so dass unter dem Strich bislang sieben Milliarden vom Staat bereitgestellt worden sind.
Allerdings schreitet der Wandel unterschiedlich schnell voran. Zum Teil stockt er sogar erheblich.
Ausgerechnet beim größten Stahlhersteller in Deutschland, Thyssenkrupp Steel, sei hierbei “der Druck am größten”, sagte Jürgen Kerner, im IG Metall-Vorstand für Industriepolitik zuständig, zu Table.Briefings. Nur ein Viertel der Kapazitäten seien bislang staatlich gefördert auf dem Transformationsweg. “Das heißt, drei Viertel müssen wir noch auf der Wegstrecke klären.”
In der letzten Woche stimmte der Aufsichtsrat in Essen jedoch für den Einstieg der EP Corporate Group (EPCG) des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský, der ein Fünftel und optional die Hälfte der Anteile übernehmen soll.
Das Argument des Vorstands für Křetínský ist, dass der Investor grüne Energie zu günstigen Preisen liefern könne. Ihm gehört die ostdeutsche LEAG, die in Solarparks, Stromspeicher und Wasserstoff investiert. Allerdings plant die LEAG auch, ihre Braunkohlekraftwerke bis 2038 weiterzubetreiben, so dass auch besonders schmutzige Energie aus der Lausitz ins Ruhrgebiet fließen könnte.
Jürgen Kerner von der IG Metall beklagt die Intransparenz der Vorstandspläne. Auch in der Politik ist man verstimmt, gerüchteweise wird ein Einstieg des Staats erwogen. Kerner sieht dies als nicht notwendig an. “Herr Křetínský hat gesagt, wenn er 20 Prozent kauft, will er bei der Planung mitreden”, so der zweite Vorsitzende der Metallgewerkschaft. “Das Gleiche erwarten wir von der Bundesregierung und vom Land NRW.” Vor allem fehle Klarheit darüber, wie das Unternehmen die Eigenmittel für die Transformation aufbringen werde: “Wenn man zwei Milliarden gibt, dann ist es legitim zu sagen: Wir geben keine Blankoschecks, sondern wollen wissen, was ihr vorhabt.”
Ganz anders sieht es beim drittgrößten Stahlproduzenten aus, der Salzgitter AG, die am Mittwoch ihre Hauptversammlung abhielt. Vorstandsvorsitzender Gunnar Groebler bekräftigte, dass man sich als “Vorreiter” verstehe.
Die Fundamente für eine Direktreduktionsanlage, die mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben werden kann, seien gelegt. Das Unternehmen will damit ab 2026 emissionsreduzierten Stahl produzieren. Schon 2033, schneller als bei allen großen deutschen Konkurrenten, sollen die CO₂-Emissionen um 95 Prozent zurückgegangen sein. Um dies überprüfbar zu machen, ist die Salzgitter AG der Science-based Targets Initiative (SBTi) beigetreten.
Groebler kritisierte aber die Bundesregierung als zu langsam beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. So würde die neue Anlage erst drei Jahre nach Inbetriebnahme an das Wasserstoffnetz angeschlossen. Bis dahin müsse mit fossilem Erdgas produziert werden.
Arcelor Mittal nimmt hingegen eine abwartende Position ein. Am Donnerstag warnte Deutschland-Chef Thomas Bünger erneut, dass “international wettbewerbsfähige Energiepreise und ausreichend verfügbare Mengen an grünem Wasserstoff” zentrale Faktoren für eine finale Investitionsentscheidung seien. Der Konzern hat auch in Frankreich, Belgien und Spanien Subventionsbescheide über jeweils hunderte Millionen Euro eingesammelt. Trotzdem überlegt die Führung laut, ob Investitionen in grünen Stahl in den USA profitabler wären.
Dirk Vogeler, Betriebsratsvorsitzender in Eisenhüttenstadt, freute sich trotzdem über Habecks Besuch: “Dass der Förderbescheid nun in Papierform kommt, ist für uns ein wichtiger Meilenstein.” Er ist hoffnungsvoll, dass die Dekarbonisierung nun umgesetzt wird: “Der nächste Meilenstein ist die Investitionsbestätigung durch den Konzern.”
Vogeler findet es nachvollziehbar, dass der Konzern die Rahmenbedingungen für Investition weiter prüft. Aber ohne Transformation sieht er den Standort in Gefahr. Daher sei die Belegschaft auch bereit, den Arbeitgeber zu konfrontieren. Darin habe man Erfahrung: “Wir hatten hier in Eisenhüttenstadt nach der Wende viele große Probleme zu lösen und haben erfolgreich für den Erhalt des Stahlstandorts gekämpft.”
Wie lassen sich die Unterschiede beim Umbau erklären? Bei Salzgitter hält das Land Niedersachsen mehr als ein Viertel der Aktien und kann so manche Entscheidungen vorantreiben. Thyssenkrupp ist in privaten Händen, scheut die Kosten der Transformation und will die Stahlsparte abstoßen. Arcelor Mittal nutzt seine globale Aufstellung und spielt Standorte und Subventionsgeber gegeneinander aus.
Auf die Frage von Table.Briefings, ob die Politik den Prozess noch weiter beschleunigen könne, sagte Robert Habeck: “Wir können nicht anordnen, dass investiert wird. So weit reicht mein Arm nicht.”
Stattdessen setzt der Wirtschaftsminister darauf, die Rahmenbedingungen zu verbessern und “permanent im Gespräch zu bleiben”. Immerhin stellte er in Aussicht, dass die energieintensive Industrie wieder von den Netzentgelten für Strom entlastet wird, wie es bis zum KTF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr geplant war.
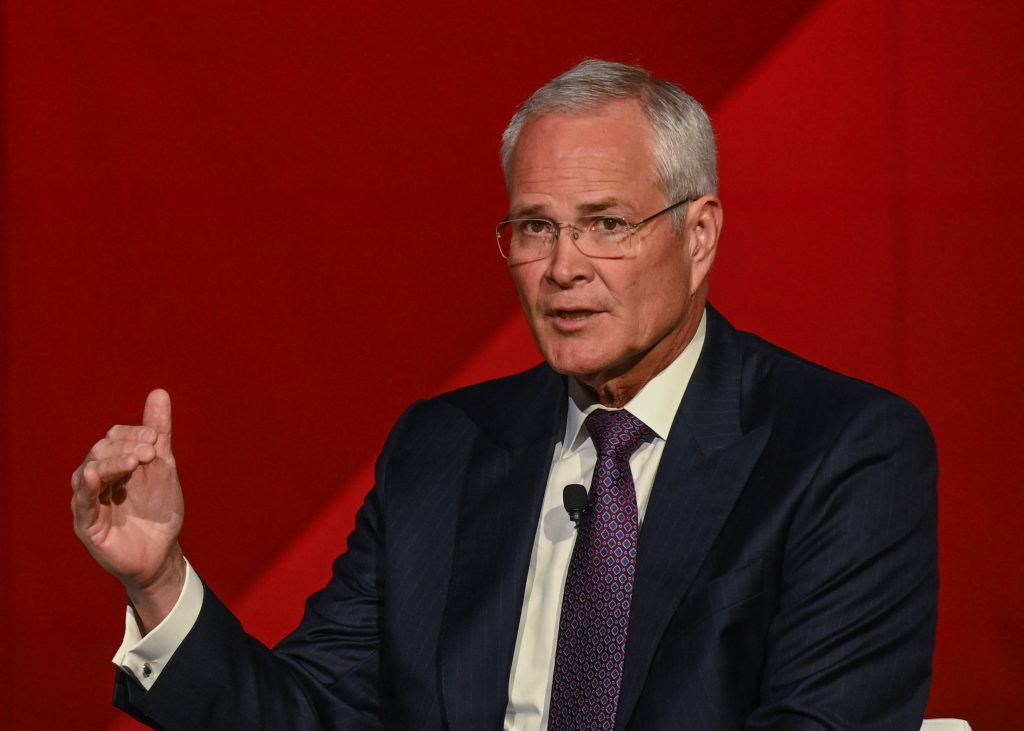
ExxonMobil, der größte Ölkonzern der Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, wird auch in Zukunft seine Geschäftspolitik nicht auf mehr Klimaschutz ausrichten, wie es aktionistische Aktieninhaber verlangen. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung, die am Mittwoch online stattfand, bestätigte eine überwältigende Mehrheit von bis zu 98 Prozent der Aktionärsstimmen den Firmenchef Darren Woods und etwa ein Dutzend seiner Direktoren im Amt. Sie wiesen damit im Kampf um den Kurs des Unternehmens in der Sozial- und Klimapolitik Forderungen von kleinen Aktionären zurück – und bestätigten indirekt das juristische Vorgehen des Managements gegen die Aktivisten. Das Ergebnis “signalisiert den Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind”, erklärte ExxonMobil.
Der Ölriese sieht sich in letzter Zeit mit einer Reihe von internen und externen Zwängen konfrontiert. Die Gewinne des Unternehmens sind im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gesunken, was zum Teil auf die niedrigen Erdgaspreise und die geringeren Gewinne aus der Ölraffination zurückzuführen ist.
Exxon befindet sich außerdem in einem chaotischen Rechtsstreit mit Chevron wegen der 53 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme der Hess Corporation durch Chevron. Exxon behauptet, es habe aufgrund einer früheren Vereinbarung das Vorkaufsrecht für die Vermögenswerte von Hess in Guyana, einschließlich eines großen Offshore-Ölfelds. Der Fall ist derzeit Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das möglicherweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen wird.
Das größte Kopfzerbrechen bereiten Exxon jedoch seit einiger Zeit eine kleine Gruppe der eigenen Aktionäre. Das Unternehmen ging Anfang dieses Jahres in die Offensive und verklagte zwei seiner Anteilseigner, Arjuna Capital und Follow This. Sie wollten das Unternehmen auf der Aktionärsversammlung dazu drängen, mehr für die Eindämmung des Klimawandels zu tun und seine Treibhausgasemissionen zu begrenzen.
Der Vorstandsvorsitzende von Exxon, Darren Woods, sagte jedoch, dass diese Gruppen das Abstimmungsverfahren für börsennotierte Unternehmen missbrauchen würden. “Diese Aktivisten haben kein Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen unseres Unternehmens”, sagte Woods bereits Anfang des Jahres auf der Energiekonferenz CERAWeek von S&P Global in Houston, Texas. Bei der Aktionärsversammlung nannte er den Vorstoß der Kritiker nun “ein weiteres Beispiel dafür, wie sie einen legitimen Prozess der Aktieninhaber für eine aktivistische Agenda nutzen, die nicht damit übereinstimmt, den Aktienwert zu steigern.” Energie aus “Wind und Sonne hat eine wichtige Rolle, aber sie reichen einfach nicht aus.”
Der Kampf zeigt eine Kluft zwischen einer kleinen Minderheit und der großen Mehrheit der Exxon-Aktionäre. Beamte aus 19 Bundesstaaten, die von Republikanern angeführt werden, drängten die Investoren, das Exxon-Management zu unterstützen. Unterdessen forderte das California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) Exxon auf, die Klagen gegen Arjuna Capital und Follow This fallen zu lassen. CalPERS ist der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA und hält einen Anteil von 0,2 Prozent an Exxon.
Den Aktionären ist es in der Vergangenheit gelungen, Exxon in Sachen Klima unter Druck zu setzen. Im Jahr 2017 brachten sie das Unternehmen dazu, eine Klimawissenschaftlerin, Susan Avery, in den Vorstand zu holen. Avery erklärte jedoch Anfang des Jahres, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen würde, und es ist nicht klar, ob Exxon einen anderen Klimawissenschaftler als Ersatz für sie sucht. Im Jahr 2021 gelang es der Investmentfirma Engine No. 1, zwei ihrer Mitglieder in den Vorstand von Exxon zu bringen, um sich für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen.
Es ist schwer zu sagen, ob diese Schritte zu größeren Veränderungen geführt haben. Die Ölproduktion von Exxon ist in den letzten zehn Jahren tendenziell zurückgegangen, im vergangenen Jahr aber gestiegen.
Exxon seinerseits sagt, der Konzern tue mehr denn je, um den Klimawandel zu bekämpfen. Woods wies darauf hin, dass er im vergangenen Jahr an der COP28 teilgenommen habe und damit zum ersten Mal bei einem internationalen Klimaverhandlungstreffen gewesen sei. Exxon hat damit begonnen, seine Scope-3-Emissionen im Jahr 2021 öffentlich zu melden, obwohl sich das Unternehmen nicht auf ein Reduktionsziel festgelegt hat. Das Unternehmen setzt nun Technologien zur Kohlenstoffabscheidung ein, verhindert Methan-Lecks und entwickelt eine Wasserstoffinfrastruktur, wofür es zwischen 2022 und 2027 mehr als 20 Milliarden US-Dollar ausgeben will. Woods lobte auch den Inflation Reduction Act, die größte Einzelinvestition der US-Regierung zur Bewältigung des Klimawandels, weil das Gesetz auf dem Papier technologieneutral sei. “Wir werden alles brauchen, was geht, um die Emissionen zu senken”, sagte Woods.
Aber für Exxon bedeutet “alles” auch mehr fossile Brennstoffe. Das Unternehmen geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Erdöl und Erdgas bis in die 2040er-Jahre weiter steigen wird. Daher setzt es auf Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung, um seine Auswirkungen auf das Klima zu neutralisieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Umweltschützer weisen auch darauf hin, dass Exxon sich seiner Rolle bei der Veränderung des Weltklimas seit Jahrzehnten bewusst ist, aber dennoch Fehlinformationen über die Erwärmung verbreitet und hinter den Kulissen an der Blockierung von Gesetzen arbeitet. Diese Bilanz macht es Klimaschützern schwer, Exxons Klimaarbeit als gutgläubige Bemühung zu betrachten. Deshalb versuchen sie, ihre Macht als Aktionäre zu nutzen, um in die Räume zu gelangen, in denen die Entscheidungen getroffen werden und das Unternehmen zu zwingen, bessere Entscheidungen für das Klima zu treffen.
Die EU-Mitgliedstaaten haben am Donnerstag endgültig der Richtlinie zum Recht auf Reparatur zugestimmt. Damit kann das Gesetz, das Reparaturen einfacher und erschwinglicher machen und damit die Kreislaufwirtschaft stärken soll, in einigen Wochen in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten haben anschließend zwei Jahre Zeit, um die Vorschriften in nationales Recht umzusetzen, also bis Sommer 2026.
Zu den neuen Vorschriften gehört unter anderem eine Pflicht für Hersteller, auch nach Ablauf der gesetzlichen Garantie für bestimmte Produkte wie Waschmaschinen und Kühlschränke Reparaturen anzubieten und auf ihrer Website über Ersatzteile zu informieren. Verbraucher müssen über diese Reparaturpflicht informiert werden und kostenlosen Online-Zugang zu Information über Reparaturpreise erhalten. Die Mitgliedstaaten müssen zudem finanzielle Anreize für Reparaturen schaffen, etwa in Form von Gutscheinen oder Fonds. leo
Der Umwelt- und Verkehrsverband Transport & Environment (T&E) Deutschland fordert von der Bundesregierung, mehr Geld für die Erforschung und Markteinführung von E-Kerosin bereitzustellen. Nur so könne der nationale Grundbedarf an klimafreundlichem Flugtreibstoff in Zukunft sichergestellt werden, heißt es in einer Erklärung. Deutschland will den Luftverkehr bis 2050 klimaneutral gestalten.
Laut T&E wurden die Mittel für E-Kerosin im vergangenen Jahr gekürzt, obwohl Deutschland das Potenzial habe, bei Forschung und Innovation führend zu sein. “Von den 20 in Europa geplanten E-Kerosin-Forschungsanlagen befinden sich 14 in Deutschland. Ohne staatliche Förderung könnte sich das ganz schnell ändern”, schreibt die Organisation in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Briefing.
Um die notwendigen Mittel aufzubringen, drängt T&E auf eine Reform der Luftverkehrssteuer. Die drei geforderten Maßnahmen würden jährliche Mehreinnahmen von über 560 Millionen Euro bringen:
“Die umweltschädlichsten Privatjet- und Business-Class-Flieger profitieren von Steuerlücken, während die Bundesregierung den E-Kerosin-Markt aus Mangel an Geldern augenscheinlich aufgibt”, kritisiert Marte van der Graaf, Referentin für Luftfahrt bei T&E Deutschland. Dabei sei das E-Kerosin derzeit der größte Hebel, um die Luftfahrt klimafreundlicher zu machen, so van der Graaf. ch
Die Bundestagswoche beginnt am Montag mit einer Anhörung im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Beraten wird ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes. Danach sollen künftig auch Verstöße gegen bestimmte Arbeitsschutz- und Arbeitsrechtsvorschriften sanktioniert werden können. Ziel ist eine sozialverträgliche Landwirtschaft.
Am Nachmittag befasst sich der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bau und Kommunen mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Hochbaustatistikgesetzes. Auch dieser Entwurf stammt von der Bundesregierung. Sie verspricht sich davon wichtige Informationen für Politik, Städtebau, Wirtschaft, Wissenschaft und Klimaschutz.
Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Anlass der öffentlichen Anhörung ist der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Endlagersuche beschleunigen – Akzeptanz sichern”.
Am Mittwochabend kommt dann in öffentlicher Sitzung der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung zusammen. Auf der Tagesordnung steht diesmal ein Fachgespräch zum europäischen Wasserstoffbinnenmarkt.
Mit Europa startet der Bundestag auch in den Donnerstag. In der vereinbarten Debatte geht es um die aktuelle Europapolitik. Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Ungenutzte Potenziale der Wärme aus Abwasser erschließen” wird hingegen ohne Aussprache an die Ausschüsse überwiesen. Später geht es um die von der CDU/CSU geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dazu will die Union das Arbeitszeitgesetz reformieren, was mehr Freiräume für Arbeitnehmer und Familien bringen soll. ch
Je kleiner ein Unternehmen ist, desto weniger korrekt fühlt sich die zuständige Geschäftsführung von ESG-Ratings bewertet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Berenberg Bank unter 98 Firmen durchgeführt hat. Die Unternehmen stammen aus Europa, ein Drittel von ihnen aus Deutschland, und sie haben eine Marktkapitalisierung von weniger als einer und maximal mehr als drei Milliarden Euro. Es ist die zweite Umfrage dieser Art der Privatbank seit 2020.
Den Antworten zufolge gaben lediglich 6 Prozent an, dass die Ratings ihre Bemühungen richtig spiegeln, 79 Prozent hingegen erklärten, dass sie nicht oder nur teilweise richtig beurteilt werden. Auch wenn es darum geht, Kontakt zu den Ratingagenturen aufzunehmen und das Ergebnis durch persönliche Gespräche zu beeinflussen – was immerhin 80 Prozent versuchen -, vergaben sie schlechte Noten: Rund 60 Prozent von ihnen machten die Erfahrung, dass ihr Beitrag kaum erwünscht sei. Für 80 Prozent sei es zudem aufgrund ihrer geringeren Ressourcen eine “relevante” oder “sehr relevante” Herausforderung, den Anforderungen bei der Berichterstattung gerecht zu werden. maw
Ein Bündnis aus NGOs will den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Exportverbot für gefährliche Pestizide umzusetzen. Dazu wollen sie am Mittwoch einen Appell an Sylvia Bender, Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL), überreichen.
Das katholische Hilfswerk Misereor, die entwicklungspolitische Organisation INKOTA und das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) hatten den Appell “Giftexporte stoppen” initiiert, den nach Angaben der Organisatoren inzwischen mehr als 150.000 Menschen unterzeichnet haben. Vom Bundesjustizministerium (BMJ), so ein Mitorganisator, habe man trotz “vielfache(r) Anfragen” keine Antwort erhalten.
Deutsche Unternehmen exportieren weltweit Pflanzenschutzmittel, die in der EU aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten sind. Ein großer Teil davon geht in Länder des Globalen Südens. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) hat vor über einem Jahr angekündigt, diese Praxis zu beenden. Es kann sich dabei auf den Koalitionsvertrag berufen. Doch eine entsprechende Verordnung lässt bis heute auf sich warten, weil sich die Bundesregierung nicht einigen kann.
Markus Wolter, Experte für Landwirtschaft und Welternährung beim katholischen Entwicklungshilfswerk Misereor, geht im Gespräch mit Table.Briefings davon aus, dass es in der Ressortabstimmung zwischen den Ministerien hakt. “Das FDP-geführte Justizministerium blockiert das grün-geführte Landwirtschaftsministerium in dieser Sache.”
Als Begründung gebe das BMJ laut Wolter an, es sei fraglich, ob ein solches Verbot per Verordnung erlassen werden könne, so Wolter. “Außerdem lobbyieren große deutsche Chemieunternehmen wie Bayer und BASF intensiv gegen dieses Vorhaben.”
Bundesumweltministerin Steffi Lemke hatte bereits vergangenes Jahr im Interview mit Table.Briefings Exportverbote und klare Regelungen in globalen Lieferketten für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Pestiziden gefordert.
Laut einer Studie des Pestizid-Aktions-Netzwerks (PAN) beträgt der Wert der deutschen Exporte von Pestiziden, die in der EU aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten sind, weniger als fünf Prozent des Gesamtumsatzes mit landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmitteln. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Exportverbots wären also gering, erklärt PAN-Expertin Susan Haffmans auf Anfrage.
Gleichzeitig weist die Agraringenieurin auf die Gefahren hin, die mit dem Einsatz dieser Mittel verbunden sind. “Wir sprechen hier von Pestiziden, die unter anderem Kinder im Mutterleib schädigen, die Krebs erzeugen oder das Hormonsystem schädigen können.” Experten gehen davon aus, dass es weltweit jährlich zu rund 385 Millionen unbeabsichtigter Pestizidvergiftungen kommt. Mindestens 11.000 Menschen sterben an den Folgen. ch
Der Rat der EU hat am Donnerstag endgültig dem Austritt der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) aus dem Energiecharta-Vertrag (ECT) zugestimmt. Damit ist der letzte formelle Schritt in dem Entscheidungsprozess abgeschlossen und der Beschluss tritt direkt in Kraft.
Der Energiecharta-Vertrag ist ein multilaterales Investitionsschutzabkommen, das seit 1998 Investitionen in fossile Energieträger im postsowjetischen Raum absichern sollte. In der Zwischenzeit nutzten Firmen im Energiesektor den Vertrag jedoch für Entschädigungsklagen im Rahmen der Energiewende.
Nachdem ein koordinierter Austritt aller EU-Mitgliedstaaten scheiterte, tritt nun die EU aus und einzelne Mitgliedstaaten können dem Abkommen weiterhin angehören. 2018 wurde zudem ein Modernisierungsprozess begonnen, um den Vertrag stärker mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang zu bringen. Auf der nächsten Energiechartakonferenz, voraussichtlich Ende 2024, können die einzelnen Mitgliedstaaten für ihren Verbleib im Abkommen und die Modernisierung des Vertrags stimmen.
Noch hat das Vertragswerk etwa 50 Mitgliedstaaten. Drei EU-Staaten, darunter Deutschland, haben den ECT Ende 2023 verlassen, sieben weitere haben dies angekündigt. leo/av/ber
Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Abtrennung und Speicherung sowie der Export von Kohlendioxid in Deutschland ermöglicht werden sollen. Im Vergleich zu einem früheren Entwurf des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) wurden die naturschutzrechtlichen Anforderungen an potenzielle CO₂-Speichergebiete in der deutschen Nordsee dabei verschärft. So soll die Speicherung unterhalb von Meeresschutzgebieten nun auch ausgeschlossen werden, wenn die Bohrung, über die das CO₂ injiziert werden soll, außerhalb dieser Schutzgebiete liegt. Zudem sind CCS-Bohrungen auch in einer Sperrzone von acht Kilometern um die Schutzgebiete herum unzulässig.
Umweltverbände begrüßten diese Veränderung. “Da hat offenbar das BMUV für Nachbesserung gesorgt”, kommentierte DUH-Energieexperte Constantin Zerger. Zugleich kritisierte er, dass das Gesetz eine Verordnungsermächtigung enthalte, mit der das Verbot der Speicherung unter Meeresschutzzonen durch das BMWK wieder aufgehoben werden kann. Möglich ist das laut Gesetz aber nur, wenn zuvor in einer Evaluierung nachgewiesen wird, dass die Speicherkapazitäten der übrigen Meeresgebiete in der deutschen Wirtschaftszone nicht ausreichend sind – was zumindest für die nächsten Jahre ausgeschlossen sein dürfte. An Land soll die Speicherung nur möglich sein, wenn ein Bundesland sie mit einem eigenen Gesetz erlaubt; auch das gilt angesichts der massiven Proteste in der Vergangenheit derzeit als wenig wahrscheinlich.
Die Hauptkritik von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen ist eine andere. Denn obwohl das Wirtschaftsministerium in seiner Kommunikation zum KSpG stets die Bedeutung von CCS für “schwer oder nicht vermeidbare Emissionen” betont, wird die Nutzung nicht auf Industrien wie die Zement- oder Kalkherstellung beschränkt. Stattdessen wird CCS auch zur CO₂-Abscheidung an Gaskraftwerken zugelassen, obwohl die Emissionen dort gerade nicht unvermeidbar sind, sondern mit der Umrüstung auf Wasserstoff eine aus Klimaschutzsicht bessere Alternative zur Verfügung steht. Bei Kohlekraftwerken ist eine Nutzung von CCS dagegen im Gesetz explizit ausgeschlossen; im neuen Entwurf wurde klargestellt, dass das auch für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung gilt.
“Der Einsatz von CO₂-Abscheidung und -speicherung bei Gaskraftwerken würde die massive Gefahr eines fossilen Lock-ins bergen, also den Ausstieg aus der Erdgas-Verstromung enorm erschweren”, kritisiert Germanwatch-Experte Simon Wolf. “Die CO₂-Abscheidung an Kraftwerken erfordert hohe Anfangsinvestitionen, die sich für die Betreiber nur lohnen, wenn sie langfristig Erdgas verstromen können. Das ist aber mit den deutschen Klimazielen nicht zu vereinbaren.” Auch Viviane Raddatz vom WWF fordert, CCS bei Gaskraftwerken auszuschließen. Die Technik müsse “auf sehr wenige, aktuell nicht-vermeidbare Restemissionen aus der Industrie beschränkt sein”.
Im Wirtschaftsministerium setzt man darauf, dass die Technik dort trotz der Zulassung nicht zur Anwendung kommt. Denn eine finanzielle Förderung für CCS ist in diesem Bereich bisher nicht vorgesehen. Und ohne diese werde sich die Technik am Markt nicht durchsetzen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits bei der Vorstellung der CCS-Eckpunkte im Februar. In einem aktuellen FAQ-Papier des Ministeriums klingt das weniger eindeutig: “Nach aktuellem Stand deutet viel darauf hin, dass CCS eine vergleichsweise geringe Rolle im Stromsektor spielen wird”, heißt es dort. Auch der Branchenverband BDEW hält die Frage noch für offen. “Inwiefern CCS für Gaskraftwerke künftig eine Rolle spielen kann, wird von den Kosten, der Infrastruktur und der Flexibilität der Anlagen abhängen”, erklärte Geschäftsführerin Kerstin Andreae.
Ob das Gesetz den Bundestag in dieser Form passiert, ist offen. Denn die FDP hatte mit dem Argument der “Technologieoffenheit” auf die Zulassung von CCS auch bei Gaskraftwerken gedrängt. Die Fraktionen von SPD und Grünen lehnen die Nutzung von CCS im Energiesektor – und damit auch bei Gaskraftwerken – bisher hingegen ab.
Zusammen mit dem CCS-Gesetz hat das Kabinett am Mittwoch auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen. Es sieht vor, die Genehmigungs- und Planungsprozesse für den Bau von Infrastruktur für Wasserstoff deutlich zu beschleunigen. Das sei “von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie”, erklärte Habeck. Tobias Pforte-von Randow vom Umwelt-Dachverband DNR kritisierte dagegen, das Gesetz schere “grünen und fossilen Wasserstoff sowie einfache Elektrolyseure und Terminals für hochgiftigen Ammoniak über einen Kamm”. mkr
How one of the most revered climate groups descended into chaos – Bloomberg
Wird die renommierte Science Based Targets initiative unterwandert, damit Unternehmen es durch CO₂-Kompensationen leichter beim Klimaschutz haben? Alastair Marsh zeichnet nach, wie es dazu kam, dass die strikten wissenschaftlichen Ziele zwischenzeitlich aufgeweicht wurden. Ausgestanden ist der Streit noch nicht – es wird nach einem Kompromiss gesucht. Zum Artikel
Volkswagens 20.000-Euro-Attacke – Spiegel
Ziemlich viel Zeit hat sich Volkswagen für die “zukunftsweisende Entscheidung” gelassen, im Alleingang ein preiswertes E-Fahrzeug anzubieten. Dahinter stehe Betriebsratschefin Cavallo. Peinlich, dass VW derart ins Hintertreffen geraten ist, findet Simon Hage, aber der Wettlauf sei noch nicht verloren. Zum Artikel
Great Wall: Chinesischer Hersteller macht Europa-Zentrale dicht – Süddeutsche Zeitung
Rund 100 Mitarbeiter des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motors (GWM) in der Europazentrale in München müssen gehen. Grund für den drastischen Schritt sind nach Unternehmensangaben die enormen Verluste, die man derzeit in Europa mit jedem verkauften Fahrzeug einfährt. Neben Deutschland bietet GWR seine Elektroautos und Plug-in-Hybride auch in Großbritannien, Irland, Schweden und Israel an. Ist das der Anfang vom Ende der China-Offensive in Europa, fragt Christina Kunkel. Zum Artikel
Umstrittener Biosprit HVO100: Tanken mit Speisefett – taz
Seit Mittwoch darf der Dieselkraftstoff HVO100 an Tankstellen in Deutschland verkauft werden. HVO100 wird aus Speisefett hergestellt und kann bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgase emittieren – sofern er aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wird. Umweltverbände kritisieren, dass bestimmte Faktoren bei den Berechnungen außer Acht gelassen werden. So würden etwa Emissionen bei der Verbrennung und im Produktionsprozess nicht in die Berechnungen einbezogen, zudem werde der Kraftstoff auch aus Ackerpflanzen wie Soja und Raps hergestellt. Zum Artikel
Interview: “Eine nachhaltige Lieferkette spart Kosten” – Springer Professional
Der Logistikexperte David Strauss sieht Unternehmen klar im Vorteil, die ihre Lieferketten bereits in den vergangenen Jahren auf Resilienz und Nachhaltigkeit umgestellt haben. Die Vorteile lägen dabei meist nicht unbedingt in der Erfüllung von ESG-Kriterien. Vielmehr sei es eine Frage der Kosten. “Langfristig spart eine transparente und nachhaltige Lieferkette Kosten und steigert die Effizienz”, so Strauss. Zum Artikel
Betrug bei Klimaschutzprojekten in China? Wie Autofahrer abgezockt werden – ZDF
Klimaschutzprojekte in China im Wert von über einer halben Milliarde Euro waren nur vorgetäuscht. Die Kosten tragen die Verbraucher beim Tanken oder beim Heizölkauf. Das haben Hans Koberstein, Nathan Niedermeier und Marta Orosz für das Magazin “Frontal” recherchiert. Genehmigt werden die Projekte vom Umweltbundesamt. In den Skandal verwickelt sind renommierte deutsche Prüfinstitute und globale Ölkonzerne. Zum Video
IFRS Says Over Half of Global Economy Moving Towards Coverage by ISSB Sustainability Reporting Standards – ESG Today
Der IFRS-Stiftung zufolge wenden über 20 Staaten, die etwa 55 Prozent des globalen BIP produzieren, die Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung des International Sustainability Standards Board (ISSB) an oder unternehmen Schritte dahin. Die Stiftung bezeichnet das als “Meilenstein” hin zu einem globalen Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Am Montag hat auch das chinesische Finanzministerium einen Entwurf für Standards vorgelegt, der auf den Vorschläge des ISSB basiert. Zum Artikel
The Berlin Summit Declaration and the new consensus around industrial policy – Chartbook
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze und Harvard-Ökonom Dani Rodrik sind erstaunt: die Notwendigkeit gezielter Industriepolitik sei Konsens unter den prominenten Wirtschaftswissenschaftlern, die sich bei einer Konferenz des Forum New Economy nahe Berlin trafen. So schlecht laufe es mit der Dekarbonisierung der EU und der USA aber nicht. Nur die deutschen Teilnehmer scheinen angeschlagen von den Kämpfen um den Green Deal. Zum Artikel

Julia Adou und der blaue Discounter: Das bringt man nicht sofort zusammen. “Endlich wieder grillen”, wirbt Aldi Süd dieser Tage. Adou dagegen wirkt, als mache sie morgens um 6 Uhr Pilates und rühre nach 18 Uhr nichts Fettiges mehr an. Eine schlanke Mittvierzigerin mit smartem Kurzhaarschnitt und noch smarterer Zunge.
Die Bio-Branche bewundert und fürchtet Julia Adou. Aldi Süd, das größere der zwei Aldi-Imperien, ist in seinem Vertriebsgebiet Marktführer für Produkte aus ökologischem Anbau. Sie machen eigenen Angaben zufolge 16 Prozent des Standardsortiments aus. Zum Vergleich: Lidl hat sich zehn Prozent Bio-Anteil für 2025 zum Ziel gesetzt; musste Medienberichten zufolge aber zuletzt sogar einen Rückgang einräumen. Der Öko-Markt ist hart umkämpft, weil er zahlende Kundschaft in die Läden zieht. Aldi-Süd hat seine Bio-Umsätze seit 2020 um 30 Prozent gesteigert.
Das ist vor allem Adous Werk. Seit 16 Jahren leitet sie die Nachhaltigkeitsabteilung, heute arbeiten dort 40 Leute. Zuvor promovierte die Sozialpädagogin bei den Ford-Werken über “Corporate Volunteering”: gemeinwohlorientiertes Mitarbeiterengagement. Sie weiß aus Theorie und Praxis, wie man Menschen für sinnhaftes Handeln begeistert.
Bei den Öko-Marketingtagen auf Schloss Kirchberg an der Jagst ist es mucksmäuschenstill während ihres Vortrags. Aldi nimmt im Herbst 2023 zum ersten Mal an diesem alljährlichen Branchentreffen teil. Der Discounter kooperiert neuerdings mit Naturland, einem Verband, der Höfe und Produkte auf der ganzen Welt nach den hohen Anforderungen der deutschen Bio-Verbände zertifiziert.
Ihren Werdegang bei Aldi beschreibt Adou als eine Reise. Als sie dort anfing, habe der Discounter schon erste Bio-Produkte geführt, vor allem Eier und Hackfleisch. Wie, habe sie gefragt, solle sich denn davon eine Familie ernähren? Es brauche doch wohl so etwas wie einen “Bio-Warenkorb”.
Die Einkäufer hätten abgewunken. Die meisten hätten Adous Einfluss sowieso lieber beschränkt. “Das hat man mir auch sehr schnell gesagt.” Aus Einkäufersicht gab es dafür gute Gründe: Das Discounter-Sortiment darf nur aus 1800 Basisartikeln bestehen. Und die müssen sich alle daran messen lassen, ob sie “drehen”, also ob pro Filiale pro Woche genug Stück verkauft werden. Sonst fliegen sie raus. Zu potenziellen Bio-Käufern hieß es: “Die fünf Prozent kommen sowieso nicht zu uns.”
Doch zur Aldi-Geschichte, so sagt es Adou, gehöre ja gerade, Luxusartikel wie Computer oder Champagner für alle erschwinglich zu machen. Wieso also nicht Bio für alle? Diese Argumentation verfing und führte zur ersten Bio-Eigenmarke: das Wort “Bio” als Smiley. “Und die Marktforschung hat uns dann glücklicherweise immer wieder gespiegelt, dass unser Bio-Smiley teilweise bekannter ist in der Bevölkerung als das EU-Bio-Siegel.”
Irgendwann hätten die Aldi-Süd-Filialen übers Jahr gesehen ganze 550 Bio-Produkte im Sortiment gehabt. Das sei dann auch den Entscheidern aufgefallen. Und habe zu Fragen geführt: Wie geht’s weiter? Welche Produkte brauchen Menschen, damit es sowohl ihnen als auch der Umwelt besser geht?
“Diese Fragen haben uns monatelang umgetrieben und gequält: Weil wir die Antworten ja ganz leicht, für jeden verständlich, erklären müssen.” Denn die Kundschaft seien keine Öko-Experten. Viele seien nie auf einem Bauernhof gewesen. Sie wüssten nicht, warum nicht-homogenisierte Milch “der Knaller” ist oder ein Joghurt aus nur drei Zutaten ein Qualitätsprodukt. Also: Wie erklärt man das, möglichst einfach?
“Jedes dieser Produkte stellt uns vor eine Erklärungsherausforderung”, sagt Adou. Dabei würden auch Aldi-Kunden inzwischen Fragen stellen nach der Herkunft, den Zutaten, der Regionalität, “sie wollen wissen, wie der Bauer und seine Freundin heißen”.
Ihre Leute, sagt sie, säßen nicht nur am Schreibtisch. Sie kontrollierten die gesamte Wertschöpfungskette, kämen auch mal unangemeldet auf einen Hof. Denn darum gehe es bei den Eigenmarken: Der Kunde soll sie erkennen und sich auf sie verlassen, ohne dafür viel lesen zu müssen.
Adous Team hat jetzt eine neue Marke kreiert, für die noch höhere Bio-Qualität der Naturland-zertifizierten Produkte. Eine Premium-Bio-Eigenmarke, sie heißt: “Nur Nur Natur”. “Weil das Thema Nachhaltigkeit bleibt. So wie ich gekommen bin, um zu bleiben.”
Für Nachhaltigkeitsprojekte von Naturland-Landwirten gibt es sogar Bares: Für jedes mit einem speziellen Bio-Diversitäts-Siegel verkaufte Produkt zahlt Aldi Süd in einen Fonds ein. Das wird an die Produzenten verteilt, wenn diese nachweisen, dass sie eine Hecke angelegt haben oder Kleegras tierwildschonend bewirtschaften. Viele in der Branche hoffen, dass das Projekt Nachahmer findet.
Julia Adou hat noch einiges vor. Baby- und Kinderprodukte etwa soll es nur noch in Bio-Qualität geben. Das sei ein Novum, denn: “Bisher hatte jedes Bio-Produkt eine konventionelle Schwester.” Das ist zugleich eine Kampfansage an die Drogeriemärkte, die mit Bio gute Schnitte machen.
Läuft es? “Ja und nein. Es läuft noch nicht so wie die klassischen Schnelldreher. Aber wir haben Geduld. Das hat man mir von ganz oben gesagt, und daran halte ich mich fest.” Adous Reise geht weiter, flankiert von “ganz viel” Marketing und Kommunikation. Sie sieht sich vor einer “Ernährungsbildungsaufgabe”. Auch bei der jungen Kundschaft. Die wisse zwar bereits viel über Trends wie vegan und regional – echte Nachhaltigkeit sei aber komplexer. Annette Bruhns
China.Table – Überkapazitäten: Wie Entwicklungsländer von Chinas günstigen Solar-Importen profitieren: China hat bei grünen Technologien wie Batterien und Solarmodulen riesige Überkapazitäten aufgebaut, die im Westen gefürchtet sind. Für Entwicklungsländer und für den Klimaschutz sind die günstigen Produkte allerdings ein Segen. Und damit auch fürs Klima. Zum Artikel
China.Table – Bazooka im Mai: Wie Peking nun doch die Wirtschaft ankurbeln will: Innerhalb weniger Tage hat Chinas Führung drei milliardenschwere Programme auf den Weg gebracht. Damit zeigt Peking, dass es doch viel Geld für Konjunkturhilfen ausgeben will. Vor allem die Chip-Industrie darf sich über Kapital für Investitionen freuen. Zum Artikel
Climate.Table – Klimafinanzen: So soll der 116-Milliarden-Erfolg den Verhandlungen in Bonn helfen: Die Industrieländer haben 2022 nach Zahlen der OECD knapp 116 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung mobilisiert. Zum ersten Mal übertreffen sie damit die Zielmarke von 100 Milliarden. Das beflügelt die Verhandlungen um ein neues Klimafinanz-Ziel. Unklar ist, ob der Trend anhält. Zum Artikel
Europe.Table – Bernd Lange hofft auf Freihandelsabkommen mit Mercosur, Australien und Indonesien: Im Interview mit Table.Briefings argumentiert der Europaabgeordnete, dass die EU-Handelspolitik auf eine Trump-Präsidentschaft gewappnet ist. Zudem hofft er auf einen Abschluss des Mercosur-Abkommens bis spätestens 2025. Zum Artikel
der Umbau der Wirtschaft verläuft nicht gradlinig, sondern in höchst unterschiedlichem Tempo. Das konnte man in diesen Tagen wieder beobachten, in Eisenhüttenstadt zum Beispiel. Dort übergab Robert Habeck einen Förderbescheid an einen Stahlhersteller, in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Die Summe ist Teil einer größeren Unterstützung, die das Ziel hat, den Sektor zügig zu dekarbonisieren. Aber, wie Alex Veit zeigt: Die drei größten deutschen Produzenten haben ganz unterschiedliche Auffassungen davon, wie und wie schnell sie vorgehen sollten.
Das gilt auch für ExxonMobil. Der US-amerikanische Öl-Gigant wurde bei seiner Hauptversammlung von einem Teil seiner Anteilseigner unter Druck gesetzt, mehr für Umwelt und Klima zu tun. Und zwar nicht irgendwann Mitte des Jahrhunderts, sondern jetzt. Daraufhin aber ging der Konzern zum Gegenangriff über – und verklagte die Aktionäre. Über den Konflikt berichtet Umair Irfan.
Und dann möchte ich Ihnen noch einen Text meiner Kollegin Annette Bruhns ans Herz legen. Sie stellt Julia Adou vor, die Nachhaltigkeitschefin von Aldi Süd, die sich in den vergangenen 16 Jahren in der Branche Respekt verschafft hat, weil sie Bio in die Breite trägt. Wo die Supermarktkette bei diesem Vorhaben inzwischen steht und was Adou noch erreichen will – das erfahren Sie in unserem Porträt.


Bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt übergab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag einen weiteren Zuwendungsbescheid für die Transformation der Stahlindustrie. Diesmal waren es 1,3 Milliarden Euro, mit denen er eine schnelle Dekarbonisierung in Brandenburg und am zweiten großen Standort des Konzerns in Bremen lostreten möchte. “Das ist gut angelegtes Geld. Geld, das gehebelt wird mit weiteren Investitionen des Unternehmens selbst”, sagte Habeck vor 250 Arbeitern in einer Ausbildungshalle des ehemaligen staatseigenen Betriebs der DDR.
Fraglich ist aber, ob Arcelor Mittal die Fördermittel, zu denen das Unternehmen etwa die gleiche Summe aus Eigenmitteln auflegen muss, tatsächlich abruft. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt mit Sitz in Luxemburg will das erst 2025 entscheiden.
Habeck gab sich zuversichtlich und sagte unter Applaus: “Es wäre traurig, wenn der Konzern zu lange wartet oder gar nicht investiert.” Der ebenfalls anwesende Wirtschaftsminister Brandenburgs, Jörg Steinbach, drohte scherzhaft damit, er werde den Managern “jede Nacht im Schlaf erscheinen”.
Nach einer Untersuchung des Öko-Instituts sind 30 deutsche Industrieanlagen für rund ein Drittel der CO₂-Emissionen der Industrie verantwortlich – und auf den ersten 13 Plätzen landen Produktionsstätten der Eisen- und Stahlerzeugung.
Um das zu ändern, haben Bund und Länder den drei größten deutschen Produzenten Thyssenkrupp Steel, Arcelor Mittal und Salzgitter AG jeweils zwischen einer und zwei Milliarden Euro zugesagt. Es soll zum Um- und Neubau der Anlagen dienen, damit diese nicht mehr mit Koks und Kohle betrieben werden, sondern mit Strom, Erdgas und später Wasserstoff. Hinzu kommen 2,6 Milliarden Euro für die Stahlindustrie im Saarland, so dass unter dem Strich bislang sieben Milliarden vom Staat bereitgestellt worden sind.
Allerdings schreitet der Wandel unterschiedlich schnell voran. Zum Teil stockt er sogar erheblich.
Ausgerechnet beim größten Stahlhersteller in Deutschland, Thyssenkrupp Steel, sei hierbei “der Druck am größten”, sagte Jürgen Kerner, im IG Metall-Vorstand für Industriepolitik zuständig, zu Table.Briefings. Nur ein Viertel der Kapazitäten seien bislang staatlich gefördert auf dem Transformationsweg. “Das heißt, drei Viertel müssen wir noch auf der Wegstrecke klären.”
In der letzten Woche stimmte der Aufsichtsrat in Essen jedoch für den Einstieg der EP Corporate Group (EPCG) des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský, der ein Fünftel und optional die Hälfte der Anteile übernehmen soll.
Das Argument des Vorstands für Křetínský ist, dass der Investor grüne Energie zu günstigen Preisen liefern könne. Ihm gehört die ostdeutsche LEAG, die in Solarparks, Stromspeicher und Wasserstoff investiert. Allerdings plant die LEAG auch, ihre Braunkohlekraftwerke bis 2038 weiterzubetreiben, so dass auch besonders schmutzige Energie aus der Lausitz ins Ruhrgebiet fließen könnte.
Jürgen Kerner von der IG Metall beklagt die Intransparenz der Vorstandspläne. Auch in der Politik ist man verstimmt, gerüchteweise wird ein Einstieg des Staats erwogen. Kerner sieht dies als nicht notwendig an. “Herr Křetínský hat gesagt, wenn er 20 Prozent kauft, will er bei der Planung mitreden”, so der zweite Vorsitzende der Metallgewerkschaft. “Das Gleiche erwarten wir von der Bundesregierung und vom Land NRW.” Vor allem fehle Klarheit darüber, wie das Unternehmen die Eigenmittel für die Transformation aufbringen werde: “Wenn man zwei Milliarden gibt, dann ist es legitim zu sagen: Wir geben keine Blankoschecks, sondern wollen wissen, was ihr vorhabt.”
Ganz anders sieht es beim drittgrößten Stahlproduzenten aus, der Salzgitter AG, die am Mittwoch ihre Hauptversammlung abhielt. Vorstandsvorsitzender Gunnar Groebler bekräftigte, dass man sich als “Vorreiter” verstehe.
Die Fundamente für eine Direktreduktionsanlage, die mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben werden kann, seien gelegt. Das Unternehmen will damit ab 2026 emissionsreduzierten Stahl produzieren. Schon 2033, schneller als bei allen großen deutschen Konkurrenten, sollen die CO₂-Emissionen um 95 Prozent zurückgegangen sein. Um dies überprüfbar zu machen, ist die Salzgitter AG der Science-based Targets Initiative (SBTi) beigetreten.
Groebler kritisierte aber die Bundesregierung als zu langsam beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. So würde die neue Anlage erst drei Jahre nach Inbetriebnahme an das Wasserstoffnetz angeschlossen. Bis dahin müsse mit fossilem Erdgas produziert werden.
Arcelor Mittal nimmt hingegen eine abwartende Position ein. Am Donnerstag warnte Deutschland-Chef Thomas Bünger erneut, dass “international wettbewerbsfähige Energiepreise und ausreichend verfügbare Mengen an grünem Wasserstoff” zentrale Faktoren für eine finale Investitionsentscheidung seien. Der Konzern hat auch in Frankreich, Belgien und Spanien Subventionsbescheide über jeweils hunderte Millionen Euro eingesammelt. Trotzdem überlegt die Führung laut, ob Investitionen in grünen Stahl in den USA profitabler wären.
Dirk Vogeler, Betriebsratsvorsitzender in Eisenhüttenstadt, freute sich trotzdem über Habecks Besuch: “Dass der Förderbescheid nun in Papierform kommt, ist für uns ein wichtiger Meilenstein.” Er ist hoffnungsvoll, dass die Dekarbonisierung nun umgesetzt wird: “Der nächste Meilenstein ist die Investitionsbestätigung durch den Konzern.”
Vogeler findet es nachvollziehbar, dass der Konzern die Rahmenbedingungen für Investition weiter prüft. Aber ohne Transformation sieht er den Standort in Gefahr. Daher sei die Belegschaft auch bereit, den Arbeitgeber zu konfrontieren. Darin habe man Erfahrung: “Wir hatten hier in Eisenhüttenstadt nach der Wende viele große Probleme zu lösen und haben erfolgreich für den Erhalt des Stahlstandorts gekämpft.”
Wie lassen sich die Unterschiede beim Umbau erklären? Bei Salzgitter hält das Land Niedersachsen mehr als ein Viertel der Aktien und kann so manche Entscheidungen vorantreiben. Thyssenkrupp ist in privaten Händen, scheut die Kosten der Transformation und will die Stahlsparte abstoßen. Arcelor Mittal nutzt seine globale Aufstellung und spielt Standorte und Subventionsgeber gegeneinander aus.
Auf die Frage von Table.Briefings, ob die Politik den Prozess noch weiter beschleunigen könne, sagte Robert Habeck: “Wir können nicht anordnen, dass investiert wird. So weit reicht mein Arm nicht.”
Stattdessen setzt der Wirtschaftsminister darauf, die Rahmenbedingungen zu verbessern und “permanent im Gespräch zu bleiben”. Immerhin stellte er in Aussicht, dass die energieintensive Industrie wieder von den Netzentgelten für Strom entlastet wird, wie es bis zum KTF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr geplant war.
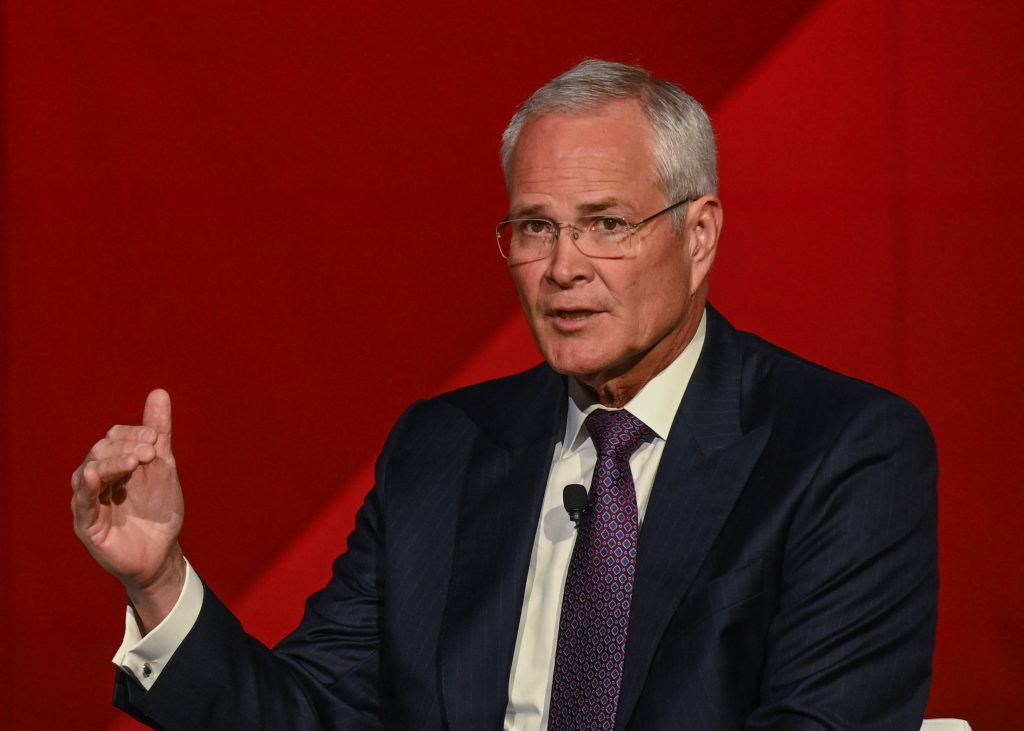
ExxonMobil, der größte Ölkonzern der Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, wird auch in Zukunft seine Geschäftspolitik nicht auf mehr Klimaschutz ausrichten, wie es aktionistische Aktieninhaber verlangen. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung, die am Mittwoch online stattfand, bestätigte eine überwältigende Mehrheit von bis zu 98 Prozent der Aktionärsstimmen den Firmenchef Darren Woods und etwa ein Dutzend seiner Direktoren im Amt. Sie wiesen damit im Kampf um den Kurs des Unternehmens in der Sozial- und Klimapolitik Forderungen von kleinen Aktionären zurück – und bestätigten indirekt das juristische Vorgehen des Managements gegen die Aktivisten. Das Ergebnis “signalisiert den Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind”, erklärte ExxonMobil.
Der Ölriese sieht sich in letzter Zeit mit einer Reihe von internen und externen Zwängen konfrontiert. Die Gewinne des Unternehmens sind im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gesunken, was zum Teil auf die niedrigen Erdgaspreise und die geringeren Gewinne aus der Ölraffination zurückzuführen ist.
Exxon befindet sich außerdem in einem chaotischen Rechtsstreit mit Chevron wegen der 53 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme der Hess Corporation durch Chevron. Exxon behauptet, es habe aufgrund einer früheren Vereinbarung das Vorkaufsrecht für die Vermögenswerte von Hess in Guyana, einschließlich eines großen Offshore-Ölfelds. Der Fall ist derzeit Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das möglicherweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen wird.
Das größte Kopfzerbrechen bereiten Exxon jedoch seit einiger Zeit eine kleine Gruppe der eigenen Aktionäre. Das Unternehmen ging Anfang dieses Jahres in die Offensive und verklagte zwei seiner Anteilseigner, Arjuna Capital und Follow This. Sie wollten das Unternehmen auf der Aktionärsversammlung dazu drängen, mehr für die Eindämmung des Klimawandels zu tun und seine Treibhausgasemissionen zu begrenzen.
Der Vorstandsvorsitzende von Exxon, Darren Woods, sagte jedoch, dass diese Gruppen das Abstimmungsverfahren für börsennotierte Unternehmen missbrauchen würden. “Diese Aktivisten haben kein Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen unseres Unternehmens”, sagte Woods bereits Anfang des Jahres auf der Energiekonferenz CERAWeek von S&P Global in Houston, Texas. Bei der Aktionärsversammlung nannte er den Vorstoß der Kritiker nun “ein weiteres Beispiel dafür, wie sie einen legitimen Prozess der Aktieninhaber für eine aktivistische Agenda nutzen, die nicht damit übereinstimmt, den Aktienwert zu steigern.” Energie aus “Wind und Sonne hat eine wichtige Rolle, aber sie reichen einfach nicht aus.”
Der Kampf zeigt eine Kluft zwischen einer kleinen Minderheit und der großen Mehrheit der Exxon-Aktionäre. Beamte aus 19 Bundesstaaten, die von Republikanern angeführt werden, drängten die Investoren, das Exxon-Management zu unterstützen. Unterdessen forderte das California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) Exxon auf, die Klagen gegen Arjuna Capital und Follow This fallen zu lassen. CalPERS ist der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA und hält einen Anteil von 0,2 Prozent an Exxon.
Den Aktionären ist es in der Vergangenheit gelungen, Exxon in Sachen Klima unter Druck zu setzen. Im Jahr 2017 brachten sie das Unternehmen dazu, eine Klimawissenschaftlerin, Susan Avery, in den Vorstand zu holen. Avery erklärte jedoch Anfang des Jahres, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen würde, und es ist nicht klar, ob Exxon einen anderen Klimawissenschaftler als Ersatz für sie sucht. Im Jahr 2021 gelang es der Investmentfirma Engine No. 1, zwei ihrer Mitglieder in den Vorstand von Exxon zu bringen, um sich für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen.
Es ist schwer zu sagen, ob diese Schritte zu größeren Veränderungen geführt haben. Die Ölproduktion von Exxon ist in den letzten zehn Jahren tendenziell zurückgegangen, im vergangenen Jahr aber gestiegen.
Exxon seinerseits sagt, der Konzern tue mehr denn je, um den Klimawandel zu bekämpfen. Woods wies darauf hin, dass er im vergangenen Jahr an der COP28 teilgenommen habe und damit zum ersten Mal bei einem internationalen Klimaverhandlungstreffen gewesen sei. Exxon hat damit begonnen, seine Scope-3-Emissionen im Jahr 2021 öffentlich zu melden, obwohl sich das Unternehmen nicht auf ein Reduktionsziel festgelegt hat. Das Unternehmen setzt nun Technologien zur Kohlenstoffabscheidung ein, verhindert Methan-Lecks und entwickelt eine Wasserstoffinfrastruktur, wofür es zwischen 2022 und 2027 mehr als 20 Milliarden US-Dollar ausgeben will. Woods lobte auch den Inflation Reduction Act, die größte Einzelinvestition der US-Regierung zur Bewältigung des Klimawandels, weil das Gesetz auf dem Papier technologieneutral sei. “Wir werden alles brauchen, was geht, um die Emissionen zu senken”, sagte Woods.
Aber für Exxon bedeutet “alles” auch mehr fossile Brennstoffe. Das Unternehmen geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Erdöl und Erdgas bis in die 2040er-Jahre weiter steigen wird. Daher setzt es auf Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung, um seine Auswirkungen auf das Klima zu neutralisieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Umweltschützer weisen auch darauf hin, dass Exxon sich seiner Rolle bei der Veränderung des Weltklimas seit Jahrzehnten bewusst ist, aber dennoch Fehlinformationen über die Erwärmung verbreitet und hinter den Kulissen an der Blockierung von Gesetzen arbeitet. Diese Bilanz macht es Klimaschützern schwer, Exxons Klimaarbeit als gutgläubige Bemühung zu betrachten. Deshalb versuchen sie, ihre Macht als Aktionäre zu nutzen, um in die Räume zu gelangen, in denen die Entscheidungen getroffen werden und das Unternehmen zu zwingen, bessere Entscheidungen für das Klima zu treffen.
Die EU-Mitgliedstaaten haben am Donnerstag endgültig der Richtlinie zum Recht auf Reparatur zugestimmt. Damit kann das Gesetz, das Reparaturen einfacher und erschwinglicher machen und damit die Kreislaufwirtschaft stärken soll, in einigen Wochen in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten haben anschließend zwei Jahre Zeit, um die Vorschriften in nationales Recht umzusetzen, also bis Sommer 2026.
Zu den neuen Vorschriften gehört unter anderem eine Pflicht für Hersteller, auch nach Ablauf der gesetzlichen Garantie für bestimmte Produkte wie Waschmaschinen und Kühlschränke Reparaturen anzubieten und auf ihrer Website über Ersatzteile zu informieren. Verbraucher müssen über diese Reparaturpflicht informiert werden und kostenlosen Online-Zugang zu Information über Reparaturpreise erhalten. Die Mitgliedstaaten müssen zudem finanzielle Anreize für Reparaturen schaffen, etwa in Form von Gutscheinen oder Fonds. leo
Der Umwelt- und Verkehrsverband Transport & Environment (T&E) Deutschland fordert von der Bundesregierung, mehr Geld für die Erforschung und Markteinführung von E-Kerosin bereitzustellen. Nur so könne der nationale Grundbedarf an klimafreundlichem Flugtreibstoff in Zukunft sichergestellt werden, heißt es in einer Erklärung. Deutschland will den Luftverkehr bis 2050 klimaneutral gestalten.
Laut T&E wurden die Mittel für E-Kerosin im vergangenen Jahr gekürzt, obwohl Deutschland das Potenzial habe, bei Forschung und Innovation führend zu sein. “Von den 20 in Europa geplanten E-Kerosin-Forschungsanlagen befinden sich 14 in Deutschland. Ohne staatliche Förderung könnte sich das ganz schnell ändern”, schreibt die Organisation in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Briefing.
Um die notwendigen Mittel aufzubringen, drängt T&E auf eine Reform der Luftverkehrssteuer. Die drei geforderten Maßnahmen würden jährliche Mehreinnahmen von über 560 Millionen Euro bringen:
“Die umweltschädlichsten Privatjet- und Business-Class-Flieger profitieren von Steuerlücken, während die Bundesregierung den E-Kerosin-Markt aus Mangel an Geldern augenscheinlich aufgibt”, kritisiert Marte van der Graaf, Referentin für Luftfahrt bei T&E Deutschland. Dabei sei das E-Kerosin derzeit der größte Hebel, um die Luftfahrt klimafreundlicher zu machen, so van der Graaf. ch
Die Bundestagswoche beginnt am Montag mit einer Anhörung im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Beraten wird ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des GAP-Konditionalitäten-Gesetzes. Danach sollen künftig auch Verstöße gegen bestimmte Arbeitsschutz- und Arbeitsrechtsvorschriften sanktioniert werden können. Ziel ist eine sozialverträgliche Landwirtschaft.
Am Nachmittag befasst sich der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bau und Kommunen mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Hochbaustatistikgesetzes. Auch dieser Entwurf stammt von der Bundesregierung. Sie verspricht sich davon wichtige Informationen für Politik, Städtebau, Wirtschaft, Wissenschaft und Klimaschutz.
Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Anlass der öffentlichen Anhörung ist der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Endlagersuche beschleunigen – Akzeptanz sichern”.
Am Mittwochabend kommt dann in öffentlicher Sitzung der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung zusammen. Auf der Tagesordnung steht diesmal ein Fachgespräch zum europäischen Wasserstoffbinnenmarkt.
Mit Europa startet der Bundestag auch in den Donnerstag. In der vereinbarten Debatte geht es um die aktuelle Europapolitik. Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion “Ungenutzte Potenziale der Wärme aus Abwasser erschließen” wird hingegen ohne Aussprache an die Ausschüsse überwiesen. Später geht es um die von der CDU/CSU geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dazu will die Union das Arbeitszeitgesetz reformieren, was mehr Freiräume für Arbeitnehmer und Familien bringen soll. ch
Je kleiner ein Unternehmen ist, desto weniger korrekt fühlt sich die zuständige Geschäftsführung von ESG-Ratings bewertet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Berenberg Bank unter 98 Firmen durchgeführt hat. Die Unternehmen stammen aus Europa, ein Drittel von ihnen aus Deutschland, und sie haben eine Marktkapitalisierung von weniger als einer und maximal mehr als drei Milliarden Euro. Es ist die zweite Umfrage dieser Art der Privatbank seit 2020.
Den Antworten zufolge gaben lediglich 6 Prozent an, dass die Ratings ihre Bemühungen richtig spiegeln, 79 Prozent hingegen erklärten, dass sie nicht oder nur teilweise richtig beurteilt werden. Auch wenn es darum geht, Kontakt zu den Ratingagenturen aufzunehmen und das Ergebnis durch persönliche Gespräche zu beeinflussen – was immerhin 80 Prozent versuchen -, vergaben sie schlechte Noten: Rund 60 Prozent von ihnen machten die Erfahrung, dass ihr Beitrag kaum erwünscht sei. Für 80 Prozent sei es zudem aufgrund ihrer geringeren Ressourcen eine “relevante” oder “sehr relevante” Herausforderung, den Anforderungen bei der Berichterstattung gerecht zu werden. maw
Ein Bündnis aus NGOs will den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Exportverbot für gefährliche Pestizide umzusetzen. Dazu wollen sie am Mittwoch einen Appell an Sylvia Bender, Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL), überreichen.
Das katholische Hilfswerk Misereor, die entwicklungspolitische Organisation INKOTA und das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) hatten den Appell “Giftexporte stoppen” initiiert, den nach Angaben der Organisatoren inzwischen mehr als 150.000 Menschen unterzeichnet haben. Vom Bundesjustizministerium (BMJ), so ein Mitorganisator, habe man trotz “vielfache(r) Anfragen” keine Antwort erhalten.
Deutsche Unternehmen exportieren weltweit Pflanzenschutzmittel, die in der EU aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten sind. Ein großer Teil davon geht in Länder des Globalen Südens. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) hat vor über einem Jahr angekündigt, diese Praxis zu beenden. Es kann sich dabei auf den Koalitionsvertrag berufen. Doch eine entsprechende Verordnung lässt bis heute auf sich warten, weil sich die Bundesregierung nicht einigen kann.
Markus Wolter, Experte für Landwirtschaft und Welternährung beim katholischen Entwicklungshilfswerk Misereor, geht im Gespräch mit Table.Briefings davon aus, dass es in der Ressortabstimmung zwischen den Ministerien hakt. “Das FDP-geführte Justizministerium blockiert das grün-geführte Landwirtschaftsministerium in dieser Sache.”
Als Begründung gebe das BMJ laut Wolter an, es sei fraglich, ob ein solches Verbot per Verordnung erlassen werden könne, so Wolter. “Außerdem lobbyieren große deutsche Chemieunternehmen wie Bayer und BASF intensiv gegen dieses Vorhaben.”
Bundesumweltministerin Steffi Lemke hatte bereits vergangenes Jahr im Interview mit Table.Briefings Exportverbote und klare Regelungen in globalen Lieferketten für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Pestiziden gefordert.
Laut einer Studie des Pestizid-Aktions-Netzwerks (PAN) beträgt der Wert der deutschen Exporte von Pestiziden, die in der EU aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten sind, weniger als fünf Prozent des Gesamtumsatzes mit landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmitteln. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Exportverbots wären also gering, erklärt PAN-Expertin Susan Haffmans auf Anfrage.
Gleichzeitig weist die Agraringenieurin auf die Gefahren hin, die mit dem Einsatz dieser Mittel verbunden sind. “Wir sprechen hier von Pestiziden, die unter anderem Kinder im Mutterleib schädigen, die Krebs erzeugen oder das Hormonsystem schädigen können.” Experten gehen davon aus, dass es weltweit jährlich zu rund 385 Millionen unbeabsichtigter Pestizidvergiftungen kommt. Mindestens 11.000 Menschen sterben an den Folgen. ch
Der Rat der EU hat am Donnerstag endgültig dem Austritt der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) aus dem Energiecharta-Vertrag (ECT) zugestimmt. Damit ist der letzte formelle Schritt in dem Entscheidungsprozess abgeschlossen und der Beschluss tritt direkt in Kraft.
Der Energiecharta-Vertrag ist ein multilaterales Investitionsschutzabkommen, das seit 1998 Investitionen in fossile Energieträger im postsowjetischen Raum absichern sollte. In der Zwischenzeit nutzten Firmen im Energiesektor den Vertrag jedoch für Entschädigungsklagen im Rahmen der Energiewende.
Nachdem ein koordinierter Austritt aller EU-Mitgliedstaaten scheiterte, tritt nun die EU aus und einzelne Mitgliedstaaten können dem Abkommen weiterhin angehören. 2018 wurde zudem ein Modernisierungsprozess begonnen, um den Vertrag stärker mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang zu bringen. Auf der nächsten Energiechartakonferenz, voraussichtlich Ende 2024, können die einzelnen Mitgliedstaaten für ihren Verbleib im Abkommen und die Modernisierung des Vertrags stimmen.
Noch hat das Vertragswerk etwa 50 Mitgliedstaaten. Drei EU-Staaten, darunter Deutschland, haben den ECT Ende 2023 verlassen, sieben weitere haben dies angekündigt. leo/av/ber
Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Abtrennung und Speicherung sowie der Export von Kohlendioxid in Deutschland ermöglicht werden sollen. Im Vergleich zu einem früheren Entwurf des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) wurden die naturschutzrechtlichen Anforderungen an potenzielle CO₂-Speichergebiete in der deutschen Nordsee dabei verschärft. So soll die Speicherung unterhalb von Meeresschutzgebieten nun auch ausgeschlossen werden, wenn die Bohrung, über die das CO₂ injiziert werden soll, außerhalb dieser Schutzgebiete liegt. Zudem sind CCS-Bohrungen auch in einer Sperrzone von acht Kilometern um die Schutzgebiete herum unzulässig.
Umweltverbände begrüßten diese Veränderung. “Da hat offenbar das BMUV für Nachbesserung gesorgt”, kommentierte DUH-Energieexperte Constantin Zerger. Zugleich kritisierte er, dass das Gesetz eine Verordnungsermächtigung enthalte, mit der das Verbot der Speicherung unter Meeresschutzzonen durch das BMWK wieder aufgehoben werden kann. Möglich ist das laut Gesetz aber nur, wenn zuvor in einer Evaluierung nachgewiesen wird, dass die Speicherkapazitäten der übrigen Meeresgebiete in der deutschen Wirtschaftszone nicht ausreichend sind – was zumindest für die nächsten Jahre ausgeschlossen sein dürfte. An Land soll die Speicherung nur möglich sein, wenn ein Bundesland sie mit einem eigenen Gesetz erlaubt; auch das gilt angesichts der massiven Proteste in der Vergangenheit derzeit als wenig wahrscheinlich.
Die Hauptkritik von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen ist eine andere. Denn obwohl das Wirtschaftsministerium in seiner Kommunikation zum KSpG stets die Bedeutung von CCS für “schwer oder nicht vermeidbare Emissionen” betont, wird die Nutzung nicht auf Industrien wie die Zement- oder Kalkherstellung beschränkt. Stattdessen wird CCS auch zur CO₂-Abscheidung an Gaskraftwerken zugelassen, obwohl die Emissionen dort gerade nicht unvermeidbar sind, sondern mit der Umrüstung auf Wasserstoff eine aus Klimaschutzsicht bessere Alternative zur Verfügung steht. Bei Kohlekraftwerken ist eine Nutzung von CCS dagegen im Gesetz explizit ausgeschlossen; im neuen Entwurf wurde klargestellt, dass das auch für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung gilt.
“Der Einsatz von CO₂-Abscheidung und -speicherung bei Gaskraftwerken würde die massive Gefahr eines fossilen Lock-ins bergen, also den Ausstieg aus der Erdgas-Verstromung enorm erschweren”, kritisiert Germanwatch-Experte Simon Wolf. “Die CO₂-Abscheidung an Kraftwerken erfordert hohe Anfangsinvestitionen, die sich für die Betreiber nur lohnen, wenn sie langfristig Erdgas verstromen können. Das ist aber mit den deutschen Klimazielen nicht zu vereinbaren.” Auch Viviane Raddatz vom WWF fordert, CCS bei Gaskraftwerken auszuschließen. Die Technik müsse “auf sehr wenige, aktuell nicht-vermeidbare Restemissionen aus der Industrie beschränkt sein”.
Im Wirtschaftsministerium setzt man darauf, dass die Technik dort trotz der Zulassung nicht zur Anwendung kommt. Denn eine finanzielle Förderung für CCS ist in diesem Bereich bisher nicht vorgesehen. Und ohne diese werde sich die Technik am Markt nicht durchsetzen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits bei der Vorstellung der CCS-Eckpunkte im Februar. In einem aktuellen FAQ-Papier des Ministeriums klingt das weniger eindeutig: “Nach aktuellem Stand deutet viel darauf hin, dass CCS eine vergleichsweise geringe Rolle im Stromsektor spielen wird”, heißt es dort. Auch der Branchenverband BDEW hält die Frage noch für offen. “Inwiefern CCS für Gaskraftwerke künftig eine Rolle spielen kann, wird von den Kosten, der Infrastruktur und der Flexibilität der Anlagen abhängen”, erklärte Geschäftsführerin Kerstin Andreae.
Ob das Gesetz den Bundestag in dieser Form passiert, ist offen. Denn die FDP hatte mit dem Argument der “Technologieoffenheit” auf die Zulassung von CCS auch bei Gaskraftwerken gedrängt. Die Fraktionen von SPD und Grünen lehnen die Nutzung von CCS im Energiesektor – und damit auch bei Gaskraftwerken – bisher hingegen ab.
Zusammen mit dem CCS-Gesetz hat das Kabinett am Mittwoch auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen. Es sieht vor, die Genehmigungs- und Planungsprozesse für den Bau von Infrastruktur für Wasserstoff deutlich zu beschleunigen. Das sei “von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie”, erklärte Habeck. Tobias Pforte-von Randow vom Umwelt-Dachverband DNR kritisierte dagegen, das Gesetz schere “grünen und fossilen Wasserstoff sowie einfache Elektrolyseure und Terminals für hochgiftigen Ammoniak über einen Kamm”. mkr
How one of the most revered climate groups descended into chaos – Bloomberg
Wird die renommierte Science Based Targets initiative unterwandert, damit Unternehmen es durch CO₂-Kompensationen leichter beim Klimaschutz haben? Alastair Marsh zeichnet nach, wie es dazu kam, dass die strikten wissenschaftlichen Ziele zwischenzeitlich aufgeweicht wurden. Ausgestanden ist der Streit noch nicht – es wird nach einem Kompromiss gesucht. Zum Artikel
Volkswagens 20.000-Euro-Attacke – Spiegel
Ziemlich viel Zeit hat sich Volkswagen für die “zukunftsweisende Entscheidung” gelassen, im Alleingang ein preiswertes E-Fahrzeug anzubieten. Dahinter stehe Betriebsratschefin Cavallo. Peinlich, dass VW derart ins Hintertreffen geraten ist, findet Simon Hage, aber der Wettlauf sei noch nicht verloren. Zum Artikel
Great Wall: Chinesischer Hersteller macht Europa-Zentrale dicht – Süddeutsche Zeitung
Rund 100 Mitarbeiter des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motors (GWM) in der Europazentrale in München müssen gehen. Grund für den drastischen Schritt sind nach Unternehmensangaben die enormen Verluste, die man derzeit in Europa mit jedem verkauften Fahrzeug einfährt. Neben Deutschland bietet GWR seine Elektroautos und Plug-in-Hybride auch in Großbritannien, Irland, Schweden und Israel an. Ist das der Anfang vom Ende der China-Offensive in Europa, fragt Christina Kunkel. Zum Artikel
Umstrittener Biosprit HVO100: Tanken mit Speisefett – taz
Seit Mittwoch darf der Dieselkraftstoff HVO100 an Tankstellen in Deutschland verkauft werden. HVO100 wird aus Speisefett hergestellt und kann bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgase emittieren – sofern er aus Abfall- und Reststoffen hergestellt wird. Umweltverbände kritisieren, dass bestimmte Faktoren bei den Berechnungen außer Acht gelassen werden. So würden etwa Emissionen bei der Verbrennung und im Produktionsprozess nicht in die Berechnungen einbezogen, zudem werde der Kraftstoff auch aus Ackerpflanzen wie Soja und Raps hergestellt. Zum Artikel
Interview: “Eine nachhaltige Lieferkette spart Kosten” – Springer Professional
Der Logistikexperte David Strauss sieht Unternehmen klar im Vorteil, die ihre Lieferketten bereits in den vergangenen Jahren auf Resilienz und Nachhaltigkeit umgestellt haben. Die Vorteile lägen dabei meist nicht unbedingt in der Erfüllung von ESG-Kriterien. Vielmehr sei es eine Frage der Kosten. “Langfristig spart eine transparente und nachhaltige Lieferkette Kosten und steigert die Effizienz”, so Strauss. Zum Artikel
Betrug bei Klimaschutzprojekten in China? Wie Autofahrer abgezockt werden – ZDF
Klimaschutzprojekte in China im Wert von über einer halben Milliarde Euro waren nur vorgetäuscht. Die Kosten tragen die Verbraucher beim Tanken oder beim Heizölkauf. Das haben Hans Koberstein, Nathan Niedermeier und Marta Orosz für das Magazin “Frontal” recherchiert. Genehmigt werden die Projekte vom Umweltbundesamt. In den Skandal verwickelt sind renommierte deutsche Prüfinstitute und globale Ölkonzerne. Zum Video
IFRS Says Over Half of Global Economy Moving Towards Coverage by ISSB Sustainability Reporting Standards – ESG Today
Der IFRS-Stiftung zufolge wenden über 20 Staaten, die etwa 55 Prozent des globalen BIP produzieren, die Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung des International Sustainability Standards Board (ISSB) an oder unternehmen Schritte dahin. Die Stiftung bezeichnet das als “Meilenstein” hin zu einem globalen Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Am Montag hat auch das chinesische Finanzministerium einen Entwurf für Standards vorgelegt, der auf den Vorschläge des ISSB basiert. Zum Artikel
The Berlin Summit Declaration and the new consensus around industrial policy – Chartbook
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze und Harvard-Ökonom Dani Rodrik sind erstaunt: die Notwendigkeit gezielter Industriepolitik sei Konsens unter den prominenten Wirtschaftswissenschaftlern, die sich bei einer Konferenz des Forum New Economy nahe Berlin trafen. So schlecht laufe es mit der Dekarbonisierung der EU und der USA aber nicht. Nur die deutschen Teilnehmer scheinen angeschlagen von den Kämpfen um den Green Deal. Zum Artikel

Julia Adou und der blaue Discounter: Das bringt man nicht sofort zusammen. “Endlich wieder grillen”, wirbt Aldi Süd dieser Tage. Adou dagegen wirkt, als mache sie morgens um 6 Uhr Pilates und rühre nach 18 Uhr nichts Fettiges mehr an. Eine schlanke Mittvierzigerin mit smartem Kurzhaarschnitt und noch smarterer Zunge.
Die Bio-Branche bewundert und fürchtet Julia Adou. Aldi Süd, das größere der zwei Aldi-Imperien, ist in seinem Vertriebsgebiet Marktführer für Produkte aus ökologischem Anbau. Sie machen eigenen Angaben zufolge 16 Prozent des Standardsortiments aus. Zum Vergleich: Lidl hat sich zehn Prozent Bio-Anteil für 2025 zum Ziel gesetzt; musste Medienberichten zufolge aber zuletzt sogar einen Rückgang einräumen. Der Öko-Markt ist hart umkämpft, weil er zahlende Kundschaft in die Läden zieht. Aldi-Süd hat seine Bio-Umsätze seit 2020 um 30 Prozent gesteigert.
Das ist vor allem Adous Werk. Seit 16 Jahren leitet sie die Nachhaltigkeitsabteilung, heute arbeiten dort 40 Leute. Zuvor promovierte die Sozialpädagogin bei den Ford-Werken über “Corporate Volunteering”: gemeinwohlorientiertes Mitarbeiterengagement. Sie weiß aus Theorie und Praxis, wie man Menschen für sinnhaftes Handeln begeistert.
Bei den Öko-Marketingtagen auf Schloss Kirchberg an der Jagst ist es mucksmäuschenstill während ihres Vortrags. Aldi nimmt im Herbst 2023 zum ersten Mal an diesem alljährlichen Branchentreffen teil. Der Discounter kooperiert neuerdings mit Naturland, einem Verband, der Höfe und Produkte auf der ganzen Welt nach den hohen Anforderungen der deutschen Bio-Verbände zertifiziert.
Ihren Werdegang bei Aldi beschreibt Adou als eine Reise. Als sie dort anfing, habe der Discounter schon erste Bio-Produkte geführt, vor allem Eier und Hackfleisch. Wie, habe sie gefragt, solle sich denn davon eine Familie ernähren? Es brauche doch wohl so etwas wie einen “Bio-Warenkorb”.
Die Einkäufer hätten abgewunken. Die meisten hätten Adous Einfluss sowieso lieber beschränkt. “Das hat man mir auch sehr schnell gesagt.” Aus Einkäufersicht gab es dafür gute Gründe: Das Discounter-Sortiment darf nur aus 1800 Basisartikeln bestehen. Und die müssen sich alle daran messen lassen, ob sie “drehen”, also ob pro Filiale pro Woche genug Stück verkauft werden. Sonst fliegen sie raus. Zu potenziellen Bio-Käufern hieß es: “Die fünf Prozent kommen sowieso nicht zu uns.”
Doch zur Aldi-Geschichte, so sagt es Adou, gehöre ja gerade, Luxusartikel wie Computer oder Champagner für alle erschwinglich zu machen. Wieso also nicht Bio für alle? Diese Argumentation verfing und führte zur ersten Bio-Eigenmarke: das Wort “Bio” als Smiley. “Und die Marktforschung hat uns dann glücklicherweise immer wieder gespiegelt, dass unser Bio-Smiley teilweise bekannter ist in der Bevölkerung als das EU-Bio-Siegel.”
Irgendwann hätten die Aldi-Süd-Filialen übers Jahr gesehen ganze 550 Bio-Produkte im Sortiment gehabt. Das sei dann auch den Entscheidern aufgefallen. Und habe zu Fragen geführt: Wie geht’s weiter? Welche Produkte brauchen Menschen, damit es sowohl ihnen als auch der Umwelt besser geht?
“Diese Fragen haben uns monatelang umgetrieben und gequält: Weil wir die Antworten ja ganz leicht, für jeden verständlich, erklären müssen.” Denn die Kundschaft seien keine Öko-Experten. Viele seien nie auf einem Bauernhof gewesen. Sie wüssten nicht, warum nicht-homogenisierte Milch “der Knaller” ist oder ein Joghurt aus nur drei Zutaten ein Qualitätsprodukt. Also: Wie erklärt man das, möglichst einfach?
“Jedes dieser Produkte stellt uns vor eine Erklärungsherausforderung”, sagt Adou. Dabei würden auch Aldi-Kunden inzwischen Fragen stellen nach der Herkunft, den Zutaten, der Regionalität, “sie wollen wissen, wie der Bauer und seine Freundin heißen”.
Ihre Leute, sagt sie, säßen nicht nur am Schreibtisch. Sie kontrollierten die gesamte Wertschöpfungskette, kämen auch mal unangemeldet auf einen Hof. Denn darum gehe es bei den Eigenmarken: Der Kunde soll sie erkennen und sich auf sie verlassen, ohne dafür viel lesen zu müssen.
Adous Team hat jetzt eine neue Marke kreiert, für die noch höhere Bio-Qualität der Naturland-zertifizierten Produkte. Eine Premium-Bio-Eigenmarke, sie heißt: “Nur Nur Natur”. “Weil das Thema Nachhaltigkeit bleibt. So wie ich gekommen bin, um zu bleiben.”
Für Nachhaltigkeitsprojekte von Naturland-Landwirten gibt es sogar Bares: Für jedes mit einem speziellen Bio-Diversitäts-Siegel verkaufte Produkt zahlt Aldi Süd in einen Fonds ein. Das wird an die Produzenten verteilt, wenn diese nachweisen, dass sie eine Hecke angelegt haben oder Kleegras tierwildschonend bewirtschaften. Viele in der Branche hoffen, dass das Projekt Nachahmer findet.
Julia Adou hat noch einiges vor. Baby- und Kinderprodukte etwa soll es nur noch in Bio-Qualität geben. Das sei ein Novum, denn: “Bisher hatte jedes Bio-Produkt eine konventionelle Schwester.” Das ist zugleich eine Kampfansage an die Drogeriemärkte, die mit Bio gute Schnitte machen.
Läuft es? “Ja und nein. Es läuft noch nicht so wie die klassischen Schnelldreher. Aber wir haben Geduld. Das hat man mir von ganz oben gesagt, und daran halte ich mich fest.” Adous Reise geht weiter, flankiert von “ganz viel” Marketing und Kommunikation. Sie sieht sich vor einer “Ernährungsbildungsaufgabe”. Auch bei der jungen Kundschaft. Die wisse zwar bereits viel über Trends wie vegan und regional – echte Nachhaltigkeit sei aber komplexer. Annette Bruhns
China.Table – Überkapazitäten: Wie Entwicklungsländer von Chinas günstigen Solar-Importen profitieren: China hat bei grünen Technologien wie Batterien und Solarmodulen riesige Überkapazitäten aufgebaut, die im Westen gefürchtet sind. Für Entwicklungsländer und für den Klimaschutz sind die günstigen Produkte allerdings ein Segen. Und damit auch fürs Klima. Zum Artikel
China.Table – Bazooka im Mai: Wie Peking nun doch die Wirtschaft ankurbeln will: Innerhalb weniger Tage hat Chinas Führung drei milliardenschwere Programme auf den Weg gebracht. Damit zeigt Peking, dass es doch viel Geld für Konjunkturhilfen ausgeben will. Vor allem die Chip-Industrie darf sich über Kapital für Investitionen freuen. Zum Artikel
Climate.Table – Klimafinanzen: So soll der 116-Milliarden-Erfolg den Verhandlungen in Bonn helfen: Die Industrieländer haben 2022 nach Zahlen der OECD knapp 116 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung mobilisiert. Zum ersten Mal übertreffen sie damit die Zielmarke von 100 Milliarden. Das beflügelt die Verhandlungen um ein neues Klimafinanz-Ziel. Unklar ist, ob der Trend anhält. Zum Artikel
Europe.Table – Bernd Lange hofft auf Freihandelsabkommen mit Mercosur, Australien und Indonesien: Im Interview mit Table.Briefings argumentiert der Europaabgeordnete, dass die EU-Handelspolitik auf eine Trump-Präsidentschaft gewappnet ist. Zudem hofft er auf einen Abschluss des Mercosur-Abkommens bis spätestens 2025. Zum Artikel
