Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.
Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.
Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.
Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu.
Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive Briefing für alle CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.
Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.
Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.
In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen und wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.
In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.
Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.
Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.
Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier. Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
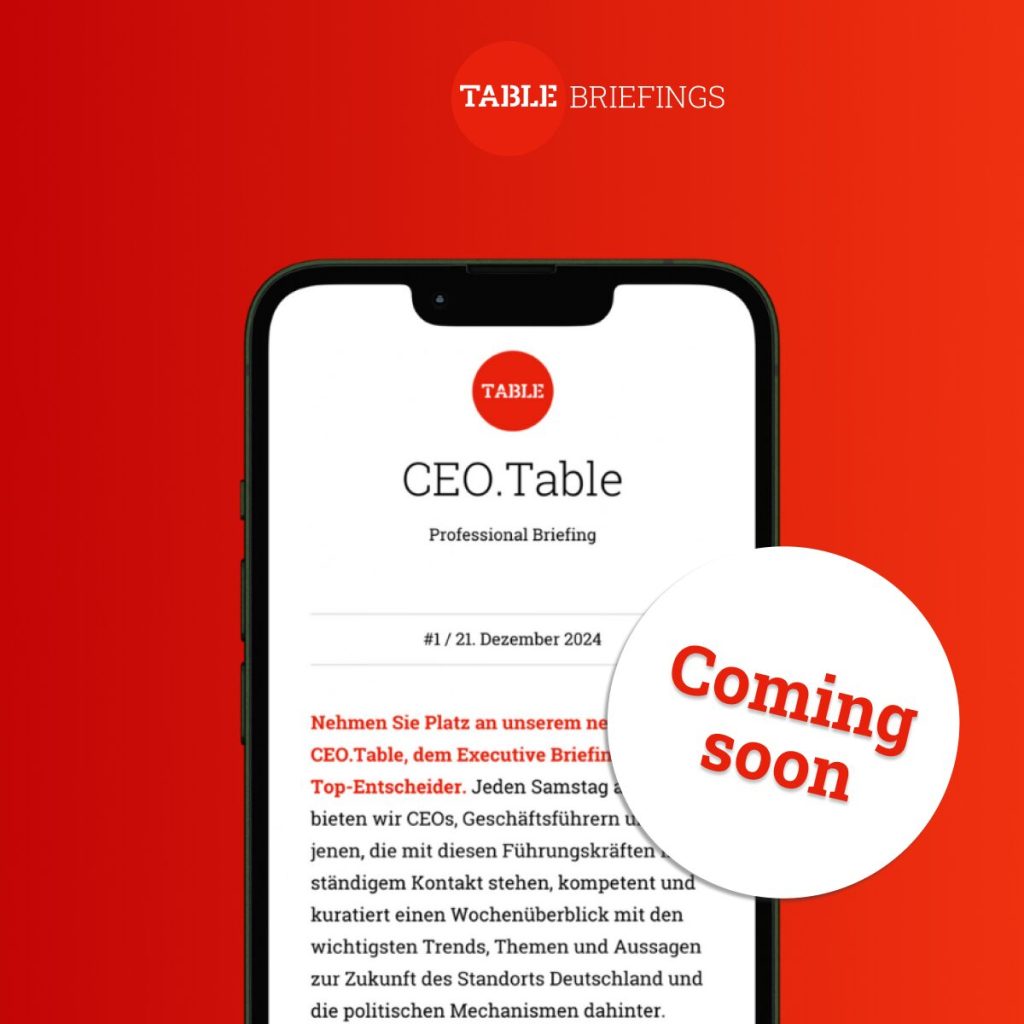


Die Bundesregierung hat der EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, wie die Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmen abgeschwächt werden sollten. In dem Schreiben, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, fordern sie eine Verschiebung der CSRD-Richtlinie um zwei Jahre und eine Eingrenzung des Adressatenkreises. Unterzeichnet wurde das Papier von Justizminister Volker Wissing, Finanzminister Jörg Kukies, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Arbeitsminister Hubertus Heil.
Mit dem Schreiben an Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque und Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis will die Bundesregierung die laufenden Arbeiten in der EU-Kommission beeinflussen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein sogenanntes Omnibus-Gesetz angekündigt, um die ESG-Berichtspflichten zu bündeln. Der Vorschlag ist derzeit für Ende Februar vorgesehen.
Die im Schreiben der Minister enthaltene Liste nimmt vor allem die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ins Visier. Mit dieser will die EU europaweit sukzessive rund 50.000 Unternehmen dazu verpflichten, umfangreiche Daten offenzulegen. Die CSRD ist Teil des Green Deals, mit dem der Kontinent bis 2050 klimaneutral werden soll.
Hintergrund der Initiative der vier Minister ist, dass die CSRD-Berichtspflichten von vielen Unternehmen und Verbänden als zu kleinteilig und ambitioniert kritisiert wird; die Regulierung würde tatsächliche Innovationen verhindern und mehr Bürokratie aufbauen, so eine verbreitete Klage. Der ehemalige und federführende Justizminister Marco Buschmann hatte keinen Hehl daraus gemacht, die CSRD in Deutschland eigentlich nicht umsetzen zu wollen.
Konkret schlagen die Minister jetzt diese Punkte vor:
Die CSRD ist Anfang 2023 in der EU in Kraft getreten, die Mitgliedsstaaten hatten bis Juli 2024 Zeit, sie in nationale Gesetze zu überführen. In Deutschland hängt das Umsetzungsgesetz seit dem Ende der Ampel-Koalition im Parlament fest, weil sich keine Mehrheit für eine Verabschiedung des aktuellen Entwurfs findet. Wahrscheinlich ist, dass die Arbeit daran von der kommenden Bundesregierung und dem nächsten Bundestag übernommen werden muss – und somit erst im Herbst 2025 verabschiedet werden kann.

Erklärtes Ziel der Unions-Parteien ist es, Freiräume für die Wirtschaft zu schaffen, um den Weg aus der Krise zu ebnen. Die Grundlage dafür soll FITT schaffen, was für Forschung, Innovationen, Technologien und Transfer steht. Auch dafür sollen Unternehmen weniger an den Fiskus abführen müssen: Die Maximalbesteuerung von Unternehmensgewinnen soll schrittweise auf 25 Prozent gesenkt werden. Zugleich will die Union an der Schuldenbremse festhalten.
Dem “Bürokratiewahnsinn” wollen CDU und CSU mit “Entrümpelungsgesetzen” und “Bürokratie-Checks” begegnen. Dazu gehört die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes. Generell soll ein “Anti-Gold-Plating-Gesetz” nationale Regelungen zurücknehmen, die über EU-Recht hinausgehen. “Belastungen” durch EU-Regulierungen wie die Nachhaltigkeits-Taxonomie und die CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung soll “ein Riegel” vorgeschoben werden. Außerdem will die Union eine Bürokratie-Vorprüfung bei EU-Vorhaben durchführen.
Im Energie- und Klimabereich soll die CO₂-Bepreisung als “Leitinstrument” für den Wandel dienen. Entsprechende Unternehmensinvestitionen will die Union “schneller und besser” steuerlich absetzbar machen.
Außerdem planen CDU/CSU:
Darüber hinaus soll die Reaktivierung abgeschalteter Atomreaktoren geprüft und Atomenergie-Forschung vorangetrieben werden.
Bei der Wärmewende setzt die Union darauf, “technologieoffen emissionsarme Wärmelösungen” zu fördern. Dafür setze man auf “Pioniermärkte” mit “Quoten für Grün-Gas im Gasnetz” und “Grün-Heizöl”. Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition soll hingegen abgeschafft werden.
Individuelle Mobilität ist für die Union der “Inbegriff von Freiheit”. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen wird daher genauso abgelehnt wie das Verbrenner-Verbot. Eine Verschärfung der Flottengrenzwerte und damit verbundene Strafzahlungen dürfe es nicht geben. Grundsätzlich stehe man auch hier zur Technologieoffenheit. Alle klimafreundlichen Möglichkeiten für alternative Antriebe und energieeffiziente Kraftstoffe sollen genutzt werden. Dazu gehörten neben E-Fuels und Wasserstoff auch Biokraftstoffe. Für die E-Mobilität soll die Ladeinfrastruktur ausgebaut und die Finanzierung von Autobahnen, Brücken- und Straßeninfrastruktur sichergestellt werden.
Auch die Sozialdemokraten versprechen an erster Stelle im Wahlprogramm einen wirtschaftlichen Aufschwung, den sie vor allem durch Investitionen erreichen wollen. Dafür schlagen sie vor:
Auch die staatlichen Einnahmen will die SPD erhöhen, unter anderem durch eine reformierte Erbschaftssteuer, eine Mindestbesteuerung von Betriebsvermögen und eine Steuer auf Vermögen ab 100 Millionen Euro.
Die Sozialdemokraten sehen “eine sichere und bezahlbare Energieversorgung” als unabdingbar an und versprechen “stabile Preise”. Netzentgelte für das Stromfernnetz sollen auf drei Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden, und mehr energieintensive Unternehmen sollen in den Genuss weiterer Entlastungen bei den Strompreisen kommen.
Ähnlich wie die Union ist für die SPD klar: “Deutschland ist ein Auto-Land”, und Strafzahlungen für überschrittene CO₂-Flottengrenzwerte seien kontraproduktiv. Anders als bei der Union fahren Autos in einer sozialdemokratischen Zukunft jedoch ausschließlich mit Strom.
Um den Verkauf von “in Deutschland” gebauten E-Autos anzukurbeln, soll es Kaufanreize geben, darunter Steuerabzüge und -befreiungen, Leasingmodelle für Geringverdiener und nochmals vergrößerte Abschreibungsmöglichkeiten für E-Dienstwagen. Vorsorglich wird die EU-Kommission angemahnt, dabei mitzumachen, oder aber einer “deutschen Lösung” nicht im Weg zu stehen. Zugleich sollen Tankstellen zum Bau von Ladesäulen verpflichtet werden.
Das deutsche Lieferkettengesetz wird im Wahlprogramm nicht erwähnt, die EU-Lieferkettenrichtlinie hingegen gelobt. “Besonders wertvolle” Rohstoffe sollen durch “strategische Partnerschaften” in “robusten Lieferketten” nach Deutschland kommen. Mehrfach wird betont, dass auch auf globaler Ebene – durch den UN Treaty – wirtschaftlicher Menschenrechtsschutz verwirklicht werden soll.
Für die Dekarbonisierung des Landes muss die Schuldenbremse “sinnvoll modernisiert” werden, fordert die Partei. Bis es so weit ist, will sie – wortgleich zur SPD – einen “Deutschlandfonds” für Infrastruktur und Forschung einrichten. Besonders betonen die Grünen aber, dass der Fonds nicht nur für den Bund, sondern auch Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen soll. Wie sich der Fonds finanziert, bleibt offen in dem Programm, bis auf diesen Hinweis: “Bürgerinnen und Bürgern wollen wir ermöglichen, sich an diesen Investitionen zu beteiligen.” Für die Entlastung des Haushalts ist unter anderem der Abbau ungenannter klima- und umweltschädlicher Subventionen geplant.
Bei der Energie hält die Partei eine weitere Absenkung der Steuern und Abgaben auf Strom für wichtig. Das Wasserstoff-Kernnetz soll zügig aufgebaut, die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Deutschland gefördert werden. Für die Sektoren Stahl und Zement “werden wir grüne Leitmärkte europaweit etablieren”. Um das zu erreichen, ist bei öffentlichen Aufträgen die Einführung einer Mindestquote von grünem Stahl vorgesehen, “die stetig ansteigt”. Für die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO₂ soll die notwendige Infrastruktur gefördert werden.
In der Autoindustrie will Bündnis 90/Die Grünen daran festhalten, ab 2035 nur noch klimafreundliche Antriebe zuzulassen. “Die konkreten Ziele der EU-Flottengrenzwerteverordnung unterstützten wir und lehnen eine Abschwächung ab. Mögliche Strafzahlungen sollen gegebenenfalls gestreckt und für den Hochlauf der E-Mobilität durch europäische Programme genutzt werden.” Außerdem soll es eine gezielte Förderung der Ladeinfrastruktur sowie “sozial ausgewogene Kauf- und Leasinganreize” für E-Autos geben, gerade für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Außerdem: “Als ersten Schritt werden wir das Dienstwagenprivileg so reformieren, damit es noch deutlichere Anreize für klimaneutrale Mobilität setzt.”
Weiter heißt es: “Die EU-Lieferkettenrichtlinie ist eine große Errungenschaft. Wir sorgen dafür, dass sie unbürokratisch in deutsches Recht übertragen wird.” Bei Rohstoffen will die Partei:
Zugleich soll die Kreislaufwirtschaftsstrategie umgesetzt werden.
Deutsche Konzerne hinken bei der Umsetzung von ESG-Standards vergleichbaren Unternehmen in Österreich und der Schweiz häufig hinterher. Das zeigt der jetzt vorgelegte dritte Teil der DACH-Studie 2024 der Managementberatung Kirchhoff Consult und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Der Bericht “zur nachhaltigen Unternehmensführung” nimmt die nichtfinanzielle Berichterstattung der 80 Unternehmen aus den Leitindizes DAX40, dem Austrian Trade Index (ATX) und dem Swiss Market Index (SMI) unter die Lupe.
Für die Verankerung von ESG-Standards sind Vorstands- und Aufsichtsräte zentral. Doch während sich alle Vorstände der ATX- und SMI-Unternehmen über ESG-Themen informieren lassen, sind es im DAX40 nur 78 Prozent. Ähnlich ist es beim ESG-Bezug der Aufsichtsräte: Der DAX40 kommt auf nur 48 Prozent, im ATX und SMI sind es rund zwei Drittel.
“Aufsichtsräte sollten Impulse geben und den Transformationsprozess wachsam begleiten”, sagt Jan-Ole Brandt, Senior Consultant für ESG und Sustainability bei Kirchhoff. Dieser Verantwortung kämen viele aber noch zu wenig nach. “Ein möglicher Grund dafür ist der Mangel an ESG-relevanten Kompetenzprofilen und praktischer Nachhaltigkeitserfahrung“, so Brandt.
Die Unterschiede zwischen deutschen, österreichischen und schweizerischen Unternehmen spiegeln sich auch in der Lieferantenauswahl wider: 90 Prozent der ATX- und 80 Prozent der SMI-Unternehmen wählten laut den Geschäftsberichten ihre Lieferanten “zumindest teilweise nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien” aus. Wiederum liegt der Dax40-Wert mit 68 Prozent am unteren Ende.
Positiver sieht es bei Whistleblower-Systemen aus, welche fast alle untersuchten Unternehmen eingerichtet haben. Dort können Mitarbeiter Verstöße gegen ESG-Standards und andere Missstände melden. Aber nur 58 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Mitarbeiter auch entsprechend zu schulen. ch
90 Prozent Treibhausgasreduktion im Vergleich zu 1990, wie von der EU-Kommission als Klimaziel für 2040 vorgeschlagen, ist für Polen nur “schwer zu akzeptieren”. Das machte Polens Klima- und Umweltministerin Paulina Hennig-Kloska schon vor Beginn des Umweltrates in Brüssel deutlich. “Wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte und historische Gegebenheiten, wir haben unterschiedliche Pro-Kopf-Einkommen – all das sollte bei den Zielen auf dem Weg zur Klimaneutralität berücksichtigt werden.”
Polen übernimmt im Januar den Vorsitz im Rat und wird maßgeblich dafür verantwortlich sein, die Position der Mitgliedstaaten zu verhandeln. Klimakommissar Wopke Hoekstra machte vor den Umweltministern noch einmal klar, dass er schnellstmöglich im kommenden Jahr eine entsprechende Anpassung des EU-Klimagesetzes vorlegen wird. Dies werde ein Emissionsreduktionsziel von 90 Prozent beinhalten.
Zahlreiche Länder unterstützen den Kommissionsvorschlag, verlangen von Brüssel aber eine starke Kopplung von Industrie- und Klimapolitik. Italien beispielsweise knüpft seine Unterstützung daran, dass die Auswirkungen des neuen Klimaziels auf die Industrie und die soziale Lage der Menschen zunächst überprüft werden. Deutschland hat noch keine geeinte Position.
Zwei eigentlich längst beschlossene Themen rückten kurzfristig in den Fokus der Gespräche beim letzten Umweltrat des Jahres. Tschechien fordert, unterstützt von weiteren Ländern, eine Verschiebung des Emissionshandels für Verkehrskraftstoffe und Heizen (ETS 2) um ein Jahr auf 2028. Außerdem soll der ETS 2 um weitere Schutzmechanismen gegen Preissprünge ergänzt werden. Es sei nicht klar, wie der Preis bei maximal 45 Euro pro Tonne gehalten werden solle, kritisierte Tschechiens Umweltminister Petr Hladík. Auch dies dürfte auf offene Ohren in Polen stoßen – in Warschau fürchtet man zusätzliche soziale Belastungen durch den erweiterten CO₂-Preis.
Auch die CO₂-Flottengrenzwerte für Pkw wurden erneut diskutiert. Einige Länder forderten die Aussetzung von Strafen, falls die Grenzwerte für 2025 verfehlt würden. Das Bild war allerdings durchmischt. Frankreich argumentierte, dass das Geld den Herstellern bei der Transformation fehle. Schweden entgegnete, eine Aussetzung sei Wettbewerbsverzerrung, da sie jene bestrafe, die die Ziele einhielten.
Die europäischen Umweltminister beschlossen am Dienstag zudem eine allgemeine Ausrichtung zu einer Verordnung über die Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat (“plastic pellets“). Das Gesetz soll die Freisetzung in die Umwelt um bis zu 74 Prozent verringern. “Viel zu häufig landet Mikroplastik über unsere Äcker in unseren Lebensmitteln und damit auf unserem Teller”, kritisiert Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Mit der Verordnung soll eine Quelle für Mikroplastik geschlossen werden, ohne “zu mehr Papierkram bei Unternehmen und Aufwand bei Behörden zu führen”, sagt Lemke.
Der Rat hat dem Kommissionsvorschlag spezifische Verpflichtungen zur Beförderung von Kunststoffgranulat auf dem Seeweg hinzugefügt, beispielsweise in Frachtcontainern. Allerdings eben doch mit neuen Berichtspflichten, ladungsbezogenen und anderen technischen Informationen. Jedoch sollen die Verpflichtungen für den Seeverkehr erst ein Jahr später als für die anderen Verkehrssektoren (18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes) eingeführt werden. Die Trilogverhandlungen mit dem Europaparlament sollen im kommenden Jahr beginnen. luk
Das kürzliche Scheitern des Kraftwerksicherheitsgesetzes könnte den Kohleausstieg wesentlich verzögern, sofern die nächste Bundesregierung nicht schnell eine Neuauflage des Gesetzes verabschiedet. Dies befürchtet Philipp Godron, Programmleiter Strom beim Thinktank Agora Energiewende: “Soll der Kohleausstieg bis 2030 umgesetzt werden bedeutet dies, dass die kommende Bundesregierung innerhalb der ersten Monate nach Amtsantritt eine entsprechende Gesetzesgrundlage schaffen muss”, so Godron gegenüber Table.Briefings.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte den Gesetzentwurf in der vergangenen Woche zurückgezogen, da er keine Mehrheit im Bundestag dafür erwartete. Der Entwurf enthielt unter anderem Finanzierungsregelungen für neue Gaskraftwerke, die später auf “grünen” Wasserstoff umgerüstet werden sollten. Solche Kraftwerke sind laut BMWK nötig, um die erneuerbare Stromversorgung auch während wind- und sonnenarmer Perioden verlässlich zu garantieren. Bislang übernehmen diese Aufgabe zu einem großen Teil CO₂-intensive Kohlekraftwerke.
Habeck selbst äußerte nach dem Ende seines Gesetzes Zweifel, dass der Kohleausstieg 2030 noch ohne Risiken für die Energieversorgung gelingen kann. Die Ampelregierung hatte geplant, die Verstromung von Kohle “idealerweise” im Jahr 2030 zu beenden.
Eine Verzögerung würde laut Godron teuer: “Dadurch sind nicht nur höhere Stromkosten zu befürchten”, so der Energieexperte, “sondern auch höhere CO₂-Emissionen” der Kohlekraftwerke. Der Preis dieser Emissionen wird durch den europäischen CO₂-Handel in den nächsten Jahren voraussichtlich stark steigen. Hinzu kämen staatliche Zuschüsse für die Kraftwerks-Reservehaltung.
Einen anderen Weg schlägt der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) vor. Anstatt einer Neuauflage des Kraftwerkssicherheitsgesetzes brauche es in der nächsten Legislatur ein “Flexibilitätspaket”. Statt zentraler Großkraftwerke sollten Anreize für flexiblen Stromverbrauch und dezentrale Stromspeicher helfen. Kleinere Kraftwerke – etwa Biogasanlagen – könnten die notwendige Absicherung eines weiter ausgebauten Wind- und Sonnenstromangebots übernehmen. Die kleineren Anlagen seien “nicht nur wesentlich günstiger, sondern auch klimafreundlich und dezentral verankert”, so BEE-Präsidentin Simone Peter. av
Die Solarenergie erfreut sich über Parteigrenzen hinweg großer Beliebtheit. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft. Demnach sprachen sich 64 Prozent der rund 2.000 Befragten dafür aus, dass die nächste Bundesregierung “den Ausbau der Solarenergie (eher) beschleunigen” sollte.
Am höchsten war die Zustimmung mit 85 Prozent bei Wählern, die bei der letzten Bundestagswahl die Grünen gewählt hatten, gefolgt von SPD- und Unionswählern. Aber auch die Anhänger der FDP waren mit 64 Prozent mehrheitlich dieser Meinung.
Noch höhere Zustimmungswerte ermittelten die Meinungsforscher bei der Frage, wie wichtig den Wählern der Klimaschutz und die Energiewende sind. 69 Prozent gaben an, dass ihnen diese Themen “(eher) wichtig” seien. Jeweils mindestens drei von vier damaligen Wählern der Grünen, der SPD und der Union äußerten sich entsprechend. Bei der FDP waren es 68 Prozent.
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat 2024 einen neuen Rekordwert erreicht. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben sie rund 55 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt. Das entspricht einem Zuwachs um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden im Jahr 2024 bisher 284 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Davon entfielen:
ch
Mit großer Mehrheit hat das Europäische Parlament dafür gestimmt, den Anwendungsstart der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) um ein Jahr zu verschieben. Zusätzliche inhaltliche Änderungen gibt es nicht. Die Abgeordneten im Plenum bestätigten damit das Ergebnis der Trilogverhandlungen, bei denen Berichterstatterin Christine Schneider (CDU) vergeblich darauf gepocht hatte, Lockerungen für Unternehmen in den Text aufzunehmen.
Auch der Rat stimmte am Mittwoch im schriftlichen Verfahren zu. Ab dem 30. Dezember 2025 müssen damit größere Unternehmen die neuen Regeln einhalten, Klein- und Kleinstunternehmen ein halbes Jahr später.
Damit richtet sich der Blick auf die Kommission, die bis dahin die Umsetzung der Regeln konkretisieren muss. Kurz nach der Trilogeinigung Anfang Dezember hatte sie den Start des IT-Systems verkündet, über das die Unternehmen ihre Erklärungen zur Sorgfaltspflicht einreichen müssen. Das Benchmarking, das jedem Herkunftsland eine Risikostufe zuweist, soll spätestens Mitte 2025 vorliegen. jd
Congo files criminal complaints against Apple in Europe over conflict minerals – Reuters
Die Demokratische Republik Kongo hat in Belgien und Frankreich Strafanzeigen gegen Tochterunternehmen des Tech-Konzerns Apple gestellt, berichtet Sonia Rolley. Der Vorwurf: die Verarbeitung von Gold, Zinn, Tantal und Wolfram aus Rebellengebieten. Damit würde der Konzern Menschenrechtsverbrechen indirekt finanzieren. Apple bestreitet die Vorwürfe. Zum Artikel
Wie ein norditalienisches Unternehmen dank der E-Mobilität über sich hinaus wächst – Süddeutsche Zeitung
In E-Autos in Europa und den USA, aber auch in China und Indien, stecken sehr häufig Motorteile der Eurogroup Laminations. Der Zulieferer aus der Po-Ebene hat früh in die E-Mobilität investiert und glaubt weiter fest daran, berichtet Ulrike Sauer. Doch Europa müsse den Mut haben, sich unwiderruflich auf die Stromer einzulassen. Zum Artikel
Can UN summits save the planet? A faltering year of talks brings up questions about the process – Associated Press
Dieses Jahr seien wichtige UN-Verhandlungen gescheitert oder hätten nur begrenzt Fortschritt gebracht. Multilateraler Umweltschutz funktioniere nicht mehr, sagten Experten zu Seth Borenstein und Sibi Arasu. Die Gründe: der Zwang zu konsensualen Entscheidungen, der Einfluss der Fossillobby und die schwierigen Verhandlungen in einer multipolaren Welt. Zum Artikel
“Es ist an der Zeit, diesen traurigen Handel zu beenden” – Der Spiegel
Laut einer Recherche werden in China Uiguren auch bei der Herstellung von Agrarerzeugnissen ausgebeutet, insbesondere bei der Tomatenernte. Im Interview fordert Francesco Mutti, der Chef des gleichnamigen italienischen Konservenherstellers, mehr Transparenz für Konsumenten und hohe Importzölle auf chinesische Tomaten. Zum Artikel
Bain engagiert eine Frau, die “ganz andere Fragen stellen” soll – Handelsblatt
Fehlende Kinderbetreuung oder eine männlich dominierte Unternehmenskultur lassen weibliche Talente an ihren Arbeitgeber zweifeln. Beraterin Julia Neuen unterstützt Unternehmen beim Wandel hin zu mehr Diversität. Jüngster Kunde: Die Strategieberatung Bain. Beraterin Neuen solle helfen, die männliche Dominanz auf der Führungsebene zu beenden, wie Tanja Kewes in ihrem Portrait beschreibt. Zum Artikel
How to clean up India’s filthy cities – Economist
Ganz Indien erstickt im Hausmüll. Ganz Indien? Nein, in der Hauptstadt des Bundesstaats Goa gäbe es ein erfolgreiches Mülltrennungssystem mit 17 Kategorien. Doch anderswo stiegen die Müllmengen rapide und würden immer Plastik-lastiger. Politikern jenseits der kleineren Städte fehle es an Ehrgeiz in der Müll-Frage, so Umweltschützer. Zum Artikel
ESG-Reporting bei der TUI Group: Ziele, Projektsteuerung, Erfolgsmessung – Haufe
TUI hat auf der Fachkonferenz Reporting 2024 Einblicke in seine Nachhaltigkeitsagenda gegeben und erläutert, wie Controlling und Internal Audit die Berichtspflichten erfüllen. Wie Nils Urban berichtet, ist der Reisekonzern damit gut vorangekommen. Die Umsetzung der CSRD und die umfassende Offenlegung klimabezogener Finanzrisiken sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Zum Artikel

Design ist mächtig. Ohne Design keine Kreislaufwirtschaft. So einfach ist das. Ungefähr 80 Prozent der Umwelteinwirkungen eines Produktes werden bereits im Design festgelegt.
Auf Podien fällt daher oft das Stichwort “Circular Design”, wenn von der Transformation hin zu einer kreislauffähigen Wirtschaft gesprochen wird. Wir beim German Design Council verstehen darunter das “Design für die Circular Economy”. Es geht dabei um den gesamten Lebenszyklus eines Produktes – von der Materialwahl und Herstellung über die Nutzung bis zum Recycling. Das Ziel: Produkte, Komponenten und Materialien so lange wie möglich im Kreislauf zu halten.
Der Hebel von Designverantwortlichen in Unternehmen ist entsprechend groß. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Von allen Beteiligten erfordert es ein radikales Umdenken: Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen etwa müssen angepasst werden, damit Unternehmen für zirkuläres Wirtschaften belohnt werden. Managementgehälter müssen stärker vom Wertbeitrag zur Steigerung der Zirkularitätsrate im jeweiligen Unternehmensbereich abhängen.

Auch aufgrund von fehlenden Anreizen sind wir aber längst nicht da, wo wir sein sollten. Laut dem Circularity Gap Report 2024 werden nur rund sieben Prozent aller Materialien weltweit in Kreisläufen geführt. Doch nur Unternehmen, die kreislauffähig wirtschaften, werden auch künftig wettbewerbsfähig sein. Design ist dabei zentral, um Produkte, Services und Geschäftsmodelle zukunftsfähig zu machen. Es ist ein wirkungsvolles Mittel zum Zweck. Der Zweck heißt Zirkularität und ist gleichzeitig das Ziel.
Wie so oft hilft es, wenn die Politik mit einer klugen Regulierung vorprescht. Das hat sie getan. Denn die Europäische Union (EU) macht mit der Ökodesign-Verordnung (ESPR) nachhaltige Produkte zur Norm. Die ESPR als Teil des Green Deals ist dabei weit mehr als ein Impuls für Unternehmen. Die, die bereits in Maßnahmen für die Circular Economy investiert haben, sind weitsichtig und auf dem richtigen Weg. Für alle anderen sind die Herausforderungen groß und rechtzeitiges Handeln und Informieren unabdingbar.
Denn: Circular Design verdient Geld, weil Zirkularität sich auszahlt. Wie eine Studie von BDI und Deloitte zeigt, bieten zirkuläre Produkte, Services und Geschäftsmodelle Wachstumspotenzial. Dabei ist das Leistungsvermögen von Design offensichtlich: Es kann auf verschiedenen Ebenen wie Prozessdesign, Materialdesign oder Servicedesign seinen Beitrag leisten, weil es vom Ziel her denkt.
Der Outdoor-Ausrüster Vaude etwa hat seine weltweiten Treibhausgasemissionen 2023 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent gesenkt, während der Umsatz im gleichen Zeitraum um 32 Prozent stieg. Vaude ist die Reduktion der Emissionen neben dem Umstieg auf erneuerbare Energien auch durch den Umstieg auf recycelte und biobasierte Materialien gelungen. Bei dieser Produktentwicklung spielte das Designmanagement eine entscheidende Rolle.
Der Werkzeughersteller Hilti hat als ein Kreislaufwirtschaftspionier bereits 2003 seine Wertschöpfungskette um ein innovatives Service-Geschäftsmodell erweitert und bietet in seinem Flottenmanagement seither Verleih, Wartung und Reparatur gewinnbringend an. Das Design entscheidet hier nicht nur über die Kundenzufriedenheit im Umgang mit dem Werkzeug, sondern auch über das Markenerlebnis des Kunden vom ersten digitalen Kontaktpunkt bis hin zur Reparatureinreichung.
Zahlreiche weitere deutsche Unternehmen sind bereits vorne dabei. Etwa BSH, Busch-Jaeger und Festo als Mitgliedsunternehmen des German Design Council sind sehr ambitioniert unterwegs – sei es im Bereich Recycling (Busch-Jaeger: Schalterprogramme mit Kunststoffteilen aus 92 bis 98 Prozent Rezyklat) oder Refurbishment (BSH: zweiter Lebenszyklus für Waschmaschinen) oder Reduce (ganzheitlicher KI-begleiteter Bioprozess in der BionicCellFactory, der Algen als Erdölersatz erforscht). Alle drei Unternehmen eint, dass sie die Vorteile der Kreislaufwirtschaft erkannt haben.
Neben ökologischen Erwägungen gilt: Nur wenn deutsche Unternehmen unabhängiger von teuren Rohstoffimporten aus dem Ausland werden, sind sie zukunftsfähig. Ein europäischer (Binnen-)Markt für Sekundärrohstoffe ergibt also auch aus ökonomischen Gründen Sinn – unter anderem, um die eigene Lieferkette zu stabilisieren.
“Stabile Rohstoffmärkte für zirkuläres Wirtschaften” ist daher neben “Produktdesign als Anker der Circular Economy” eines der sechs Arbeitsfelder, in denen die BDI-Initiative Circular Economy die Transformation der deutschen Wirtschaft vorantreiben will. Sie ist neben BMW, Google, Hansgrohe und IKEA einer der Impulsgeber beim “Circular Design Summit” im Frühjahr 2025, wo der German Design Council führende Köpfe aus Wirtschaft, Industrie und Design zusammenbringt.
Denn als Instanz für Design in Deutschland tragen wir eine besondere Verantwortung, das Potenzial von Design für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten.
Lutz Dietzold ist seit 2002 Geschäftsführer des German Design Council – Rat für Formgebung. Der Rat bringt Unternehmen mit Profis aus dem Design zusammen – um es als Hebel für Transformation und wirtschaftlichen Erfolg zu nutzen. Seit 1953, als er auf Beschluss des Bundestags gegründet wurde, setzt er sich dafür ein, das Bewusstsein für die Wirkkraft von Design zu stärken. Heute zählen über 330 deutsche Unternehmen zum Kreis seiner Stiftung.
Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.
Climate.Table – Agora Energiewende: Warum der Deutschland-Chef geht: In der heißen Phase des Bundestags-Wahlkampfs verlässt der Deutschland-Chef von Agora Energiewende, Simon Müller, den Thinktank. Auch Europachef Matthias Buck macht Platz für eine Nachfolgerin. Zum Artikel
Climate.Table – Klimaschutz-Pflichten: Wie sich die Staaten vor dem IGH positioniert haben: Welche Klimaschutz-Pflichten erlegt das Völkerrecht den Staaten auf? Was sind die Konsequenzen, wenn sie ihnen nicht nachkommen? Die Anhörungen vor dem IGH in Den Haag sind zu Ende, nun berät das Gericht über sein Gutachten. Zum Artikel
Agrifood.Table – Biomethan: Warum Klimaschützer vor einem EU-weiten Boom warnen: Während in Deutschland die Anzahl der Biomethananlagen stagniert, erlebt die Produktion in vielen EU-Ländern einen Boom. Umweltschützer sehen das kritisch. Zum Artikel
Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.
Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.
Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.
Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu.
Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive Briefing für alle CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.
Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.
Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.
In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen und wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.
In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.
Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.
Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.
Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier. Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
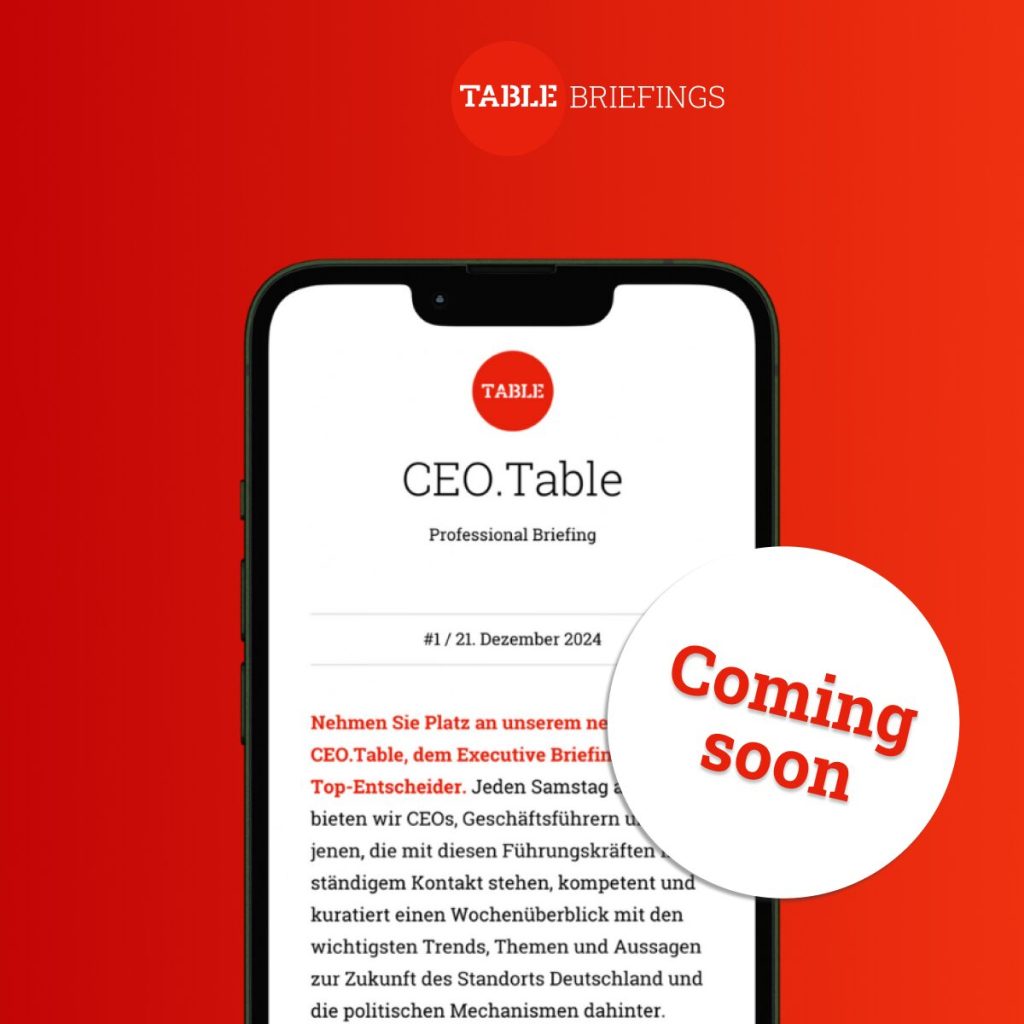


Die Bundesregierung hat der EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, wie die Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmen abgeschwächt werden sollten. In dem Schreiben, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, fordern sie eine Verschiebung der CSRD-Richtlinie um zwei Jahre und eine Eingrenzung des Adressatenkreises. Unterzeichnet wurde das Papier von Justizminister Volker Wissing, Finanzminister Jörg Kukies, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Arbeitsminister Hubertus Heil.
Mit dem Schreiben an Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque und Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis will die Bundesregierung die laufenden Arbeiten in der EU-Kommission beeinflussen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein sogenanntes Omnibus-Gesetz angekündigt, um die ESG-Berichtspflichten zu bündeln. Der Vorschlag ist derzeit für Ende Februar vorgesehen.
Die im Schreiben der Minister enthaltene Liste nimmt vor allem die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ins Visier. Mit dieser will die EU europaweit sukzessive rund 50.000 Unternehmen dazu verpflichten, umfangreiche Daten offenzulegen. Die CSRD ist Teil des Green Deals, mit dem der Kontinent bis 2050 klimaneutral werden soll.
Hintergrund der Initiative der vier Minister ist, dass die CSRD-Berichtspflichten von vielen Unternehmen und Verbänden als zu kleinteilig und ambitioniert kritisiert wird; die Regulierung würde tatsächliche Innovationen verhindern und mehr Bürokratie aufbauen, so eine verbreitete Klage. Der ehemalige und federführende Justizminister Marco Buschmann hatte keinen Hehl daraus gemacht, die CSRD in Deutschland eigentlich nicht umsetzen zu wollen.
Konkret schlagen die Minister jetzt diese Punkte vor:
Die CSRD ist Anfang 2023 in der EU in Kraft getreten, die Mitgliedsstaaten hatten bis Juli 2024 Zeit, sie in nationale Gesetze zu überführen. In Deutschland hängt das Umsetzungsgesetz seit dem Ende der Ampel-Koalition im Parlament fest, weil sich keine Mehrheit für eine Verabschiedung des aktuellen Entwurfs findet. Wahrscheinlich ist, dass die Arbeit daran von der kommenden Bundesregierung und dem nächsten Bundestag übernommen werden muss – und somit erst im Herbst 2025 verabschiedet werden kann.

Erklärtes Ziel der Unions-Parteien ist es, Freiräume für die Wirtschaft zu schaffen, um den Weg aus der Krise zu ebnen. Die Grundlage dafür soll FITT schaffen, was für Forschung, Innovationen, Technologien und Transfer steht. Auch dafür sollen Unternehmen weniger an den Fiskus abführen müssen: Die Maximalbesteuerung von Unternehmensgewinnen soll schrittweise auf 25 Prozent gesenkt werden. Zugleich will die Union an der Schuldenbremse festhalten.
Dem “Bürokratiewahnsinn” wollen CDU und CSU mit “Entrümpelungsgesetzen” und “Bürokratie-Checks” begegnen. Dazu gehört die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes. Generell soll ein “Anti-Gold-Plating-Gesetz” nationale Regelungen zurücknehmen, die über EU-Recht hinausgehen. “Belastungen” durch EU-Regulierungen wie die Nachhaltigkeits-Taxonomie und die CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung soll “ein Riegel” vorgeschoben werden. Außerdem will die Union eine Bürokratie-Vorprüfung bei EU-Vorhaben durchführen.
Im Energie- und Klimabereich soll die CO₂-Bepreisung als “Leitinstrument” für den Wandel dienen. Entsprechende Unternehmensinvestitionen will die Union “schneller und besser” steuerlich absetzbar machen.
Außerdem planen CDU/CSU:
Darüber hinaus soll die Reaktivierung abgeschalteter Atomreaktoren geprüft und Atomenergie-Forschung vorangetrieben werden.
Bei der Wärmewende setzt die Union darauf, “technologieoffen emissionsarme Wärmelösungen” zu fördern. Dafür setze man auf “Pioniermärkte” mit “Quoten für Grün-Gas im Gasnetz” und “Grün-Heizöl”. Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition soll hingegen abgeschafft werden.
Individuelle Mobilität ist für die Union der “Inbegriff von Freiheit”. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen wird daher genauso abgelehnt wie das Verbrenner-Verbot. Eine Verschärfung der Flottengrenzwerte und damit verbundene Strafzahlungen dürfe es nicht geben. Grundsätzlich stehe man auch hier zur Technologieoffenheit. Alle klimafreundlichen Möglichkeiten für alternative Antriebe und energieeffiziente Kraftstoffe sollen genutzt werden. Dazu gehörten neben E-Fuels und Wasserstoff auch Biokraftstoffe. Für die E-Mobilität soll die Ladeinfrastruktur ausgebaut und die Finanzierung von Autobahnen, Brücken- und Straßeninfrastruktur sichergestellt werden.
Auch die Sozialdemokraten versprechen an erster Stelle im Wahlprogramm einen wirtschaftlichen Aufschwung, den sie vor allem durch Investitionen erreichen wollen. Dafür schlagen sie vor:
Auch die staatlichen Einnahmen will die SPD erhöhen, unter anderem durch eine reformierte Erbschaftssteuer, eine Mindestbesteuerung von Betriebsvermögen und eine Steuer auf Vermögen ab 100 Millionen Euro.
Die Sozialdemokraten sehen “eine sichere und bezahlbare Energieversorgung” als unabdingbar an und versprechen “stabile Preise”. Netzentgelte für das Stromfernnetz sollen auf drei Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden, und mehr energieintensive Unternehmen sollen in den Genuss weiterer Entlastungen bei den Strompreisen kommen.
Ähnlich wie die Union ist für die SPD klar: “Deutschland ist ein Auto-Land”, und Strafzahlungen für überschrittene CO₂-Flottengrenzwerte seien kontraproduktiv. Anders als bei der Union fahren Autos in einer sozialdemokratischen Zukunft jedoch ausschließlich mit Strom.
Um den Verkauf von “in Deutschland” gebauten E-Autos anzukurbeln, soll es Kaufanreize geben, darunter Steuerabzüge und -befreiungen, Leasingmodelle für Geringverdiener und nochmals vergrößerte Abschreibungsmöglichkeiten für E-Dienstwagen. Vorsorglich wird die EU-Kommission angemahnt, dabei mitzumachen, oder aber einer “deutschen Lösung” nicht im Weg zu stehen. Zugleich sollen Tankstellen zum Bau von Ladesäulen verpflichtet werden.
Das deutsche Lieferkettengesetz wird im Wahlprogramm nicht erwähnt, die EU-Lieferkettenrichtlinie hingegen gelobt. “Besonders wertvolle” Rohstoffe sollen durch “strategische Partnerschaften” in “robusten Lieferketten” nach Deutschland kommen. Mehrfach wird betont, dass auch auf globaler Ebene – durch den UN Treaty – wirtschaftlicher Menschenrechtsschutz verwirklicht werden soll.
Für die Dekarbonisierung des Landes muss die Schuldenbremse “sinnvoll modernisiert” werden, fordert die Partei. Bis es so weit ist, will sie – wortgleich zur SPD – einen “Deutschlandfonds” für Infrastruktur und Forschung einrichten. Besonders betonen die Grünen aber, dass der Fonds nicht nur für den Bund, sondern auch Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen soll. Wie sich der Fonds finanziert, bleibt offen in dem Programm, bis auf diesen Hinweis: “Bürgerinnen und Bürgern wollen wir ermöglichen, sich an diesen Investitionen zu beteiligen.” Für die Entlastung des Haushalts ist unter anderem der Abbau ungenannter klima- und umweltschädlicher Subventionen geplant.
Bei der Energie hält die Partei eine weitere Absenkung der Steuern und Abgaben auf Strom für wichtig. Das Wasserstoff-Kernnetz soll zügig aufgebaut, die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Deutschland gefördert werden. Für die Sektoren Stahl und Zement “werden wir grüne Leitmärkte europaweit etablieren”. Um das zu erreichen, ist bei öffentlichen Aufträgen die Einführung einer Mindestquote von grünem Stahl vorgesehen, “die stetig ansteigt”. Für die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO₂ soll die notwendige Infrastruktur gefördert werden.
In der Autoindustrie will Bündnis 90/Die Grünen daran festhalten, ab 2035 nur noch klimafreundliche Antriebe zuzulassen. “Die konkreten Ziele der EU-Flottengrenzwerteverordnung unterstützten wir und lehnen eine Abschwächung ab. Mögliche Strafzahlungen sollen gegebenenfalls gestreckt und für den Hochlauf der E-Mobilität durch europäische Programme genutzt werden.” Außerdem soll es eine gezielte Förderung der Ladeinfrastruktur sowie “sozial ausgewogene Kauf- und Leasinganreize” für E-Autos geben, gerade für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Außerdem: “Als ersten Schritt werden wir das Dienstwagenprivileg so reformieren, damit es noch deutlichere Anreize für klimaneutrale Mobilität setzt.”
Weiter heißt es: “Die EU-Lieferkettenrichtlinie ist eine große Errungenschaft. Wir sorgen dafür, dass sie unbürokratisch in deutsches Recht übertragen wird.” Bei Rohstoffen will die Partei:
Zugleich soll die Kreislaufwirtschaftsstrategie umgesetzt werden.
Deutsche Konzerne hinken bei der Umsetzung von ESG-Standards vergleichbaren Unternehmen in Österreich und der Schweiz häufig hinterher. Das zeigt der jetzt vorgelegte dritte Teil der DACH-Studie 2024 der Managementberatung Kirchhoff Consult und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Der Bericht “zur nachhaltigen Unternehmensführung” nimmt die nichtfinanzielle Berichterstattung der 80 Unternehmen aus den Leitindizes DAX40, dem Austrian Trade Index (ATX) und dem Swiss Market Index (SMI) unter die Lupe.
Für die Verankerung von ESG-Standards sind Vorstands- und Aufsichtsräte zentral. Doch während sich alle Vorstände der ATX- und SMI-Unternehmen über ESG-Themen informieren lassen, sind es im DAX40 nur 78 Prozent. Ähnlich ist es beim ESG-Bezug der Aufsichtsräte: Der DAX40 kommt auf nur 48 Prozent, im ATX und SMI sind es rund zwei Drittel.
“Aufsichtsräte sollten Impulse geben und den Transformationsprozess wachsam begleiten”, sagt Jan-Ole Brandt, Senior Consultant für ESG und Sustainability bei Kirchhoff. Dieser Verantwortung kämen viele aber noch zu wenig nach. “Ein möglicher Grund dafür ist der Mangel an ESG-relevanten Kompetenzprofilen und praktischer Nachhaltigkeitserfahrung“, so Brandt.
Die Unterschiede zwischen deutschen, österreichischen und schweizerischen Unternehmen spiegeln sich auch in der Lieferantenauswahl wider: 90 Prozent der ATX- und 80 Prozent der SMI-Unternehmen wählten laut den Geschäftsberichten ihre Lieferanten “zumindest teilweise nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien” aus. Wiederum liegt der Dax40-Wert mit 68 Prozent am unteren Ende.
Positiver sieht es bei Whistleblower-Systemen aus, welche fast alle untersuchten Unternehmen eingerichtet haben. Dort können Mitarbeiter Verstöße gegen ESG-Standards und andere Missstände melden. Aber nur 58 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Mitarbeiter auch entsprechend zu schulen. ch
90 Prozent Treibhausgasreduktion im Vergleich zu 1990, wie von der EU-Kommission als Klimaziel für 2040 vorgeschlagen, ist für Polen nur “schwer zu akzeptieren”. Das machte Polens Klima- und Umweltministerin Paulina Hennig-Kloska schon vor Beginn des Umweltrates in Brüssel deutlich. “Wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte und historische Gegebenheiten, wir haben unterschiedliche Pro-Kopf-Einkommen – all das sollte bei den Zielen auf dem Weg zur Klimaneutralität berücksichtigt werden.”
Polen übernimmt im Januar den Vorsitz im Rat und wird maßgeblich dafür verantwortlich sein, die Position der Mitgliedstaaten zu verhandeln. Klimakommissar Wopke Hoekstra machte vor den Umweltministern noch einmal klar, dass er schnellstmöglich im kommenden Jahr eine entsprechende Anpassung des EU-Klimagesetzes vorlegen wird. Dies werde ein Emissionsreduktionsziel von 90 Prozent beinhalten.
Zahlreiche Länder unterstützen den Kommissionsvorschlag, verlangen von Brüssel aber eine starke Kopplung von Industrie- und Klimapolitik. Italien beispielsweise knüpft seine Unterstützung daran, dass die Auswirkungen des neuen Klimaziels auf die Industrie und die soziale Lage der Menschen zunächst überprüft werden. Deutschland hat noch keine geeinte Position.
Zwei eigentlich längst beschlossene Themen rückten kurzfristig in den Fokus der Gespräche beim letzten Umweltrat des Jahres. Tschechien fordert, unterstützt von weiteren Ländern, eine Verschiebung des Emissionshandels für Verkehrskraftstoffe und Heizen (ETS 2) um ein Jahr auf 2028. Außerdem soll der ETS 2 um weitere Schutzmechanismen gegen Preissprünge ergänzt werden. Es sei nicht klar, wie der Preis bei maximal 45 Euro pro Tonne gehalten werden solle, kritisierte Tschechiens Umweltminister Petr Hladík. Auch dies dürfte auf offene Ohren in Polen stoßen – in Warschau fürchtet man zusätzliche soziale Belastungen durch den erweiterten CO₂-Preis.
Auch die CO₂-Flottengrenzwerte für Pkw wurden erneut diskutiert. Einige Länder forderten die Aussetzung von Strafen, falls die Grenzwerte für 2025 verfehlt würden. Das Bild war allerdings durchmischt. Frankreich argumentierte, dass das Geld den Herstellern bei der Transformation fehle. Schweden entgegnete, eine Aussetzung sei Wettbewerbsverzerrung, da sie jene bestrafe, die die Ziele einhielten.
Die europäischen Umweltminister beschlossen am Dienstag zudem eine allgemeine Ausrichtung zu einer Verordnung über die Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat (“plastic pellets“). Das Gesetz soll die Freisetzung in die Umwelt um bis zu 74 Prozent verringern. “Viel zu häufig landet Mikroplastik über unsere Äcker in unseren Lebensmitteln und damit auf unserem Teller”, kritisiert Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Mit der Verordnung soll eine Quelle für Mikroplastik geschlossen werden, ohne “zu mehr Papierkram bei Unternehmen und Aufwand bei Behörden zu führen”, sagt Lemke.
Der Rat hat dem Kommissionsvorschlag spezifische Verpflichtungen zur Beförderung von Kunststoffgranulat auf dem Seeweg hinzugefügt, beispielsweise in Frachtcontainern. Allerdings eben doch mit neuen Berichtspflichten, ladungsbezogenen und anderen technischen Informationen. Jedoch sollen die Verpflichtungen für den Seeverkehr erst ein Jahr später als für die anderen Verkehrssektoren (18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes) eingeführt werden. Die Trilogverhandlungen mit dem Europaparlament sollen im kommenden Jahr beginnen. luk
Das kürzliche Scheitern des Kraftwerksicherheitsgesetzes könnte den Kohleausstieg wesentlich verzögern, sofern die nächste Bundesregierung nicht schnell eine Neuauflage des Gesetzes verabschiedet. Dies befürchtet Philipp Godron, Programmleiter Strom beim Thinktank Agora Energiewende: “Soll der Kohleausstieg bis 2030 umgesetzt werden bedeutet dies, dass die kommende Bundesregierung innerhalb der ersten Monate nach Amtsantritt eine entsprechende Gesetzesgrundlage schaffen muss”, so Godron gegenüber Table.Briefings.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte den Gesetzentwurf in der vergangenen Woche zurückgezogen, da er keine Mehrheit im Bundestag dafür erwartete. Der Entwurf enthielt unter anderem Finanzierungsregelungen für neue Gaskraftwerke, die später auf “grünen” Wasserstoff umgerüstet werden sollten. Solche Kraftwerke sind laut BMWK nötig, um die erneuerbare Stromversorgung auch während wind- und sonnenarmer Perioden verlässlich zu garantieren. Bislang übernehmen diese Aufgabe zu einem großen Teil CO₂-intensive Kohlekraftwerke.
Habeck selbst äußerte nach dem Ende seines Gesetzes Zweifel, dass der Kohleausstieg 2030 noch ohne Risiken für die Energieversorgung gelingen kann. Die Ampelregierung hatte geplant, die Verstromung von Kohle “idealerweise” im Jahr 2030 zu beenden.
Eine Verzögerung würde laut Godron teuer: “Dadurch sind nicht nur höhere Stromkosten zu befürchten”, so der Energieexperte, “sondern auch höhere CO₂-Emissionen” der Kohlekraftwerke. Der Preis dieser Emissionen wird durch den europäischen CO₂-Handel in den nächsten Jahren voraussichtlich stark steigen. Hinzu kämen staatliche Zuschüsse für die Kraftwerks-Reservehaltung.
Einen anderen Weg schlägt der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) vor. Anstatt einer Neuauflage des Kraftwerkssicherheitsgesetzes brauche es in der nächsten Legislatur ein “Flexibilitätspaket”. Statt zentraler Großkraftwerke sollten Anreize für flexiblen Stromverbrauch und dezentrale Stromspeicher helfen. Kleinere Kraftwerke – etwa Biogasanlagen – könnten die notwendige Absicherung eines weiter ausgebauten Wind- und Sonnenstromangebots übernehmen. Die kleineren Anlagen seien “nicht nur wesentlich günstiger, sondern auch klimafreundlich und dezentral verankert”, so BEE-Präsidentin Simone Peter. av
Die Solarenergie erfreut sich über Parteigrenzen hinweg großer Beliebtheit. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft. Demnach sprachen sich 64 Prozent der rund 2.000 Befragten dafür aus, dass die nächste Bundesregierung “den Ausbau der Solarenergie (eher) beschleunigen” sollte.
Am höchsten war die Zustimmung mit 85 Prozent bei Wählern, die bei der letzten Bundestagswahl die Grünen gewählt hatten, gefolgt von SPD- und Unionswählern. Aber auch die Anhänger der FDP waren mit 64 Prozent mehrheitlich dieser Meinung.
Noch höhere Zustimmungswerte ermittelten die Meinungsforscher bei der Frage, wie wichtig den Wählern der Klimaschutz und die Energiewende sind. 69 Prozent gaben an, dass ihnen diese Themen “(eher) wichtig” seien. Jeweils mindestens drei von vier damaligen Wählern der Grünen, der SPD und der Union äußerten sich entsprechend. Bei der FDP waren es 68 Prozent.
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat 2024 einen neuen Rekordwert erreicht. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben sie rund 55 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt. Das entspricht einem Zuwachs um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden im Jahr 2024 bisher 284 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Davon entfielen:
ch
Mit großer Mehrheit hat das Europäische Parlament dafür gestimmt, den Anwendungsstart der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) um ein Jahr zu verschieben. Zusätzliche inhaltliche Änderungen gibt es nicht. Die Abgeordneten im Plenum bestätigten damit das Ergebnis der Trilogverhandlungen, bei denen Berichterstatterin Christine Schneider (CDU) vergeblich darauf gepocht hatte, Lockerungen für Unternehmen in den Text aufzunehmen.
Auch der Rat stimmte am Mittwoch im schriftlichen Verfahren zu. Ab dem 30. Dezember 2025 müssen damit größere Unternehmen die neuen Regeln einhalten, Klein- und Kleinstunternehmen ein halbes Jahr später.
Damit richtet sich der Blick auf die Kommission, die bis dahin die Umsetzung der Regeln konkretisieren muss. Kurz nach der Trilogeinigung Anfang Dezember hatte sie den Start des IT-Systems verkündet, über das die Unternehmen ihre Erklärungen zur Sorgfaltspflicht einreichen müssen. Das Benchmarking, das jedem Herkunftsland eine Risikostufe zuweist, soll spätestens Mitte 2025 vorliegen. jd
Congo files criminal complaints against Apple in Europe over conflict minerals – Reuters
Die Demokratische Republik Kongo hat in Belgien und Frankreich Strafanzeigen gegen Tochterunternehmen des Tech-Konzerns Apple gestellt, berichtet Sonia Rolley. Der Vorwurf: die Verarbeitung von Gold, Zinn, Tantal und Wolfram aus Rebellengebieten. Damit würde der Konzern Menschenrechtsverbrechen indirekt finanzieren. Apple bestreitet die Vorwürfe. Zum Artikel
Wie ein norditalienisches Unternehmen dank der E-Mobilität über sich hinaus wächst – Süddeutsche Zeitung
In E-Autos in Europa und den USA, aber auch in China und Indien, stecken sehr häufig Motorteile der Eurogroup Laminations. Der Zulieferer aus der Po-Ebene hat früh in die E-Mobilität investiert und glaubt weiter fest daran, berichtet Ulrike Sauer. Doch Europa müsse den Mut haben, sich unwiderruflich auf die Stromer einzulassen. Zum Artikel
Can UN summits save the planet? A faltering year of talks brings up questions about the process – Associated Press
Dieses Jahr seien wichtige UN-Verhandlungen gescheitert oder hätten nur begrenzt Fortschritt gebracht. Multilateraler Umweltschutz funktioniere nicht mehr, sagten Experten zu Seth Borenstein und Sibi Arasu. Die Gründe: der Zwang zu konsensualen Entscheidungen, der Einfluss der Fossillobby und die schwierigen Verhandlungen in einer multipolaren Welt. Zum Artikel
“Es ist an der Zeit, diesen traurigen Handel zu beenden” – Der Spiegel
Laut einer Recherche werden in China Uiguren auch bei der Herstellung von Agrarerzeugnissen ausgebeutet, insbesondere bei der Tomatenernte. Im Interview fordert Francesco Mutti, der Chef des gleichnamigen italienischen Konservenherstellers, mehr Transparenz für Konsumenten und hohe Importzölle auf chinesische Tomaten. Zum Artikel
Bain engagiert eine Frau, die “ganz andere Fragen stellen” soll – Handelsblatt
Fehlende Kinderbetreuung oder eine männlich dominierte Unternehmenskultur lassen weibliche Talente an ihren Arbeitgeber zweifeln. Beraterin Julia Neuen unterstützt Unternehmen beim Wandel hin zu mehr Diversität. Jüngster Kunde: Die Strategieberatung Bain. Beraterin Neuen solle helfen, die männliche Dominanz auf der Führungsebene zu beenden, wie Tanja Kewes in ihrem Portrait beschreibt. Zum Artikel
How to clean up India’s filthy cities – Economist
Ganz Indien erstickt im Hausmüll. Ganz Indien? Nein, in der Hauptstadt des Bundesstaats Goa gäbe es ein erfolgreiches Mülltrennungssystem mit 17 Kategorien. Doch anderswo stiegen die Müllmengen rapide und würden immer Plastik-lastiger. Politikern jenseits der kleineren Städte fehle es an Ehrgeiz in der Müll-Frage, so Umweltschützer. Zum Artikel
ESG-Reporting bei der TUI Group: Ziele, Projektsteuerung, Erfolgsmessung – Haufe
TUI hat auf der Fachkonferenz Reporting 2024 Einblicke in seine Nachhaltigkeitsagenda gegeben und erläutert, wie Controlling und Internal Audit die Berichtspflichten erfüllen. Wie Nils Urban berichtet, ist der Reisekonzern damit gut vorangekommen. Die Umsetzung der CSRD und die umfassende Offenlegung klimabezogener Finanzrisiken sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Zum Artikel

Design ist mächtig. Ohne Design keine Kreislaufwirtschaft. So einfach ist das. Ungefähr 80 Prozent der Umwelteinwirkungen eines Produktes werden bereits im Design festgelegt.
Auf Podien fällt daher oft das Stichwort “Circular Design”, wenn von der Transformation hin zu einer kreislauffähigen Wirtschaft gesprochen wird. Wir beim German Design Council verstehen darunter das “Design für die Circular Economy”. Es geht dabei um den gesamten Lebenszyklus eines Produktes – von der Materialwahl und Herstellung über die Nutzung bis zum Recycling. Das Ziel: Produkte, Komponenten und Materialien so lange wie möglich im Kreislauf zu halten.
Der Hebel von Designverantwortlichen in Unternehmen ist entsprechend groß. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Von allen Beteiligten erfordert es ein radikales Umdenken: Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen etwa müssen angepasst werden, damit Unternehmen für zirkuläres Wirtschaften belohnt werden. Managementgehälter müssen stärker vom Wertbeitrag zur Steigerung der Zirkularitätsrate im jeweiligen Unternehmensbereich abhängen.

Auch aufgrund von fehlenden Anreizen sind wir aber längst nicht da, wo wir sein sollten. Laut dem Circularity Gap Report 2024 werden nur rund sieben Prozent aller Materialien weltweit in Kreisläufen geführt. Doch nur Unternehmen, die kreislauffähig wirtschaften, werden auch künftig wettbewerbsfähig sein. Design ist dabei zentral, um Produkte, Services und Geschäftsmodelle zukunftsfähig zu machen. Es ist ein wirkungsvolles Mittel zum Zweck. Der Zweck heißt Zirkularität und ist gleichzeitig das Ziel.
Wie so oft hilft es, wenn die Politik mit einer klugen Regulierung vorprescht. Das hat sie getan. Denn die Europäische Union (EU) macht mit der Ökodesign-Verordnung (ESPR) nachhaltige Produkte zur Norm. Die ESPR als Teil des Green Deals ist dabei weit mehr als ein Impuls für Unternehmen. Die, die bereits in Maßnahmen für die Circular Economy investiert haben, sind weitsichtig und auf dem richtigen Weg. Für alle anderen sind die Herausforderungen groß und rechtzeitiges Handeln und Informieren unabdingbar.
Denn: Circular Design verdient Geld, weil Zirkularität sich auszahlt. Wie eine Studie von BDI und Deloitte zeigt, bieten zirkuläre Produkte, Services und Geschäftsmodelle Wachstumspotenzial. Dabei ist das Leistungsvermögen von Design offensichtlich: Es kann auf verschiedenen Ebenen wie Prozessdesign, Materialdesign oder Servicedesign seinen Beitrag leisten, weil es vom Ziel her denkt.
Der Outdoor-Ausrüster Vaude etwa hat seine weltweiten Treibhausgasemissionen 2023 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent gesenkt, während der Umsatz im gleichen Zeitraum um 32 Prozent stieg. Vaude ist die Reduktion der Emissionen neben dem Umstieg auf erneuerbare Energien auch durch den Umstieg auf recycelte und biobasierte Materialien gelungen. Bei dieser Produktentwicklung spielte das Designmanagement eine entscheidende Rolle.
Der Werkzeughersteller Hilti hat als ein Kreislaufwirtschaftspionier bereits 2003 seine Wertschöpfungskette um ein innovatives Service-Geschäftsmodell erweitert und bietet in seinem Flottenmanagement seither Verleih, Wartung und Reparatur gewinnbringend an. Das Design entscheidet hier nicht nur über die Kundenzufriedenheit im Umgang mit dem Werkzeug, sondern auch über das Markenerlebnis des Kunden vom ersten digitalen Kontaktpunkt bis hin zur Reparatureinreichung.
Zahlreiche weitere deutsche Unternehmen sind bereits vorne dabei. Etwa BSH, Busch-Jaeger und Festo als Mitgliedsunternehmen des German Design Council sind sehr ambitioniert unterwegs – sei es im Bereich Recycling (Busch-Jaeger: Schalterprogramme mit Kunststoffteilen aus 92 bis 98 Prozent Rezyklat) oder Refurbishment (BSH: zweiter Lebenszyklus für Waschmaschinen) oder Reduce (ganzheitlicher KI-begleiteter Bioprozess in der BionicCellFactory, der Algen als Erdölersatz erforscht). Alle drei Unternehmen eint, dass sie die Vorteile der Kreislaufwirtschaft erkannt haben.
Neben ökologischen Erwägungen gilt: Nur wenn deutsche Unternehmen unabhängiger von teuren Rohstoffimporten aus dem Ausland werden, sind sie zukunftsfähig. Ein europäischer (Binnen-)Markt für Sekundärrohstoffe ergibt also auch aus ökonomischen Gründen Sinn – unter anderem, um die eigene Lieferkette zu stabilisieren.
“Stabile Rohstoffmärkte für zirkuläres Wirtschaften” ist daher neben “Produktdesign als Anker der Circular Economy” eines der sechs Arbeitsfelder, in denen die BDI-Initiative Circular Economy die Transformation der deutschen Wirtschaft vorantreiben will. Sie ist neben BMW, Google, Hansgrohe und IKEA einer der Impulsgeber beim “Circular Design Summit” im Frühjahr 2025, wo der German Design Council führende Köpfe aus Wirtschaft, Industrie und Design zusammenbringt.
Denn als Instanz für Design in Deutschland tragen wir eine besondere Verantwortung, das Potenzial von Design für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten.
Lutz Dietzold ist seit 2002 Geschäftsführer des German Design Council – Rat für Formgebung. Der Rat bringt Unternehmen mit Profis aus dem Design zusammen – um es als Hebel für Transformation und wirtschaftlichen Erfolg zu nutzen. Seit 1953, als er auf Beschluss des Bundestags gegründet wurde, setzt er sich dafür ein, das Bewusstsein für die Wirkkraft von Design zu stärken. Heute zählen über 330 deutsche Unternehmen zum Kreis seiner Stiftung.
Alle Artikel der Serie zur Circular Economy finden Sie hier.
Climate.Table – Agora Energiewende: Warum der Deutschland-Chef geht: In der heißen Phase des Bundestags-Wahlkampfs verlässt der Deutschland-Chef von Agora Energiewende, Simon Müller, den Thinktank. Auch Europachef Matthias Buck macht Platz für eine Nachfolgerin. Zum Artikel
Climate.Table – Klimaschutz-Pflichten: Wie sich die Staaten vor dem IGH positioniert haben: Welche Klimaschutz-Pflichten erlegt das Völkerrecht den Staaten auf? Was sind die Konsequenzen, wenn sie ihnen nicht nachkommen? Die Anhörungen vor dem IGH in Den Haag sind zu Ende, nun berät das Gericht über sein Gutachten. Zum Artikel
Agrifood.Table – Biomethan: Warum Klimaschützer vor einem EU-weiten Boom warnen: Während in Deutschland die Anzahl der Biomethananlagen stagniert, erlebt die Produktion in vielen EU-Ländern einen Boom. Umweltschützer sehen das kritisch. Zum Artikel
