wenn es um die “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) geht, die von den EU-Staaten in nationales Recht überführt werden muss, ist häufig von einer “1:1-Umsetzung” die Rede. Es klingt dann immer so, als ob die EU-Vorgabe bloß übersetzt und mit leichten Änderungen nur noch eben beschlossen werden muss.
In der Praxis zieht sich der Prozess aber schon seit einiger Zeit hin – und verzögert sich nun weiter. Was dahintersteckt, welche zum Teil deutliche Kritik es an dem Vorgehen gibt und was die Wirtschaft sagt, das können Sie in meiner Analyse lesen.
Mit einem erstaunlichen anderen Vorgehen hat sich mein Kollege Caspar Dohmen befasst. Er geht der Frage nach, ob die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), eine Tochter der KfW, Offshore-Finanzzentren genutzt hat. Einer Studie zufolge, die Table.Briefings vorab erhalten hat, sind die Leidtragenden Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer der Vorwürfe: Durch diese Anlage-Politik wird die Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele noch schwerer gemacht.

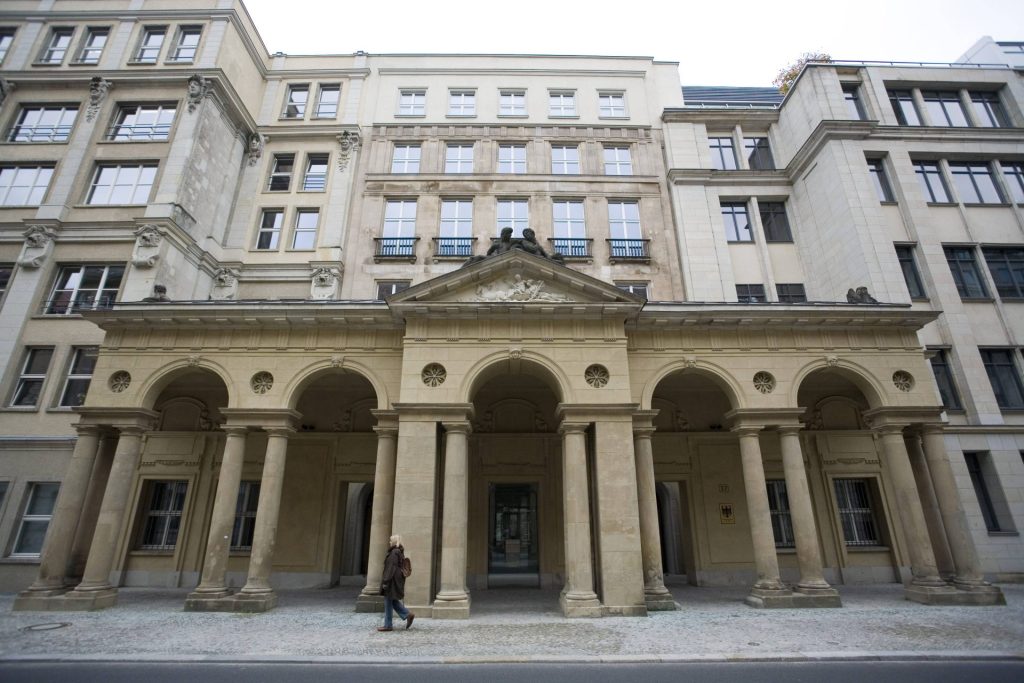
Frankreich, Spanien, Ungarn, Slowenien, Finnland und Rumänien sind schon durch. Sie haben die Frist der EU, die CSRD-Richtlinie bis Anfang Juli in ein nationales Gesetz umzusetzen, bereits jetzt eingehalten. Unternehmen in diesen Ländern wissen, was sie tun müssen, um Nachhaltigkeitsreports zu erstellen, die den neuen Anforderungen genügen.
In Deutschland herrscht dagegen noch Unklarheit. Zwar entspricht der im März veröffentlichte Referentenentwurf überwiegend der EU-Vorlage. Daran können sich die rund 15.000 Unternehmen, die hierzulande berichtspflichtig werden, orientieren. Verabschiedet ist das Vorhaben allerdings noch nicht. Und am heutigen Mittwoch wird die Vorlage auch nicht im Kabinett verabschiedet, wie es ursprünglich geplant war. Das hat das federführende Bundesjustizministerium (BMJ) bestätigt. Gründe für die Verschiebung wollte eine Sprecherin nicht nennen.
Otto Fricke, der CSRD-Berichterstatter der FDP im Bundestag, nennt die Verzögerung “konsequent”. “Offenbar ist die Zahl der Stellungnahmen, in denen Verbände sich zum Referentenentwurf äußern konnten, sehr viel größer als zuvor angekündigt”, sagte er zu Table.Briefings. “Gleichzeitig bin ich froh, dass damit dem hohen Grad an Komplexität und Relevanz Rechnung getragen wird. Vielleicht gelingt es ja doch noch, ein wenig zu entbürokratisieren.”
Katharina Beck hat weniger Verständnis. “Unternehmen brauchen Planungssicherheit, gerade in der aktuellen Lage. Daher ist es mehr als misslich, dass das Gesetz diese Woche nicht wie geplant im Kabinett beschlossen wird”, sagt die CSRD-Berichterstatterin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. “Sich selbst bei einem vergleichsweise unkomplizierten Umsetzungsgesetz im Bundesjustizministerium nicht an die Fristen zu halten, grenzt schon an Peinlichkeit.” Und weiter: “Das ist nicht der Grad an Professionalität in der Politik, wie sie für die drittgrößte Volkswirtschaft angemessen wäre.”
In der Verbändeanhörung, die bis Mitte April lief, hatten sich verschiedene Kritikpunkte an dem Entwurf herauskristallisiert. Vor allem die Frage, wer CSRD-Berichte künftig prüfen darf, beschäftigt viele. Dem BMJ-Vorschlag zufolge ist diese Aufgabe ausschließlich Wirtschaftsprüfern vorbehalten. Umweltgutachter und technische Sachverständige wie TÜV und Dekra sind ausgeschlossen. Diese sehen darin eine Benachteiligung.
Mehrere Akteure teilen diese Kritik. Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung empfahl, Umweltgutachter vorläufig zuzulassen und nach drei Jahren Bilanz zu ziehen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erklärte, dass eine Verknappung der Prüfer “gerade für kleine und mittelständische Unternehmen massive negative Auswirkungen” haben könnte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) glaubt zwar, dass größere, kapitalmarktorientierte Unternehmen Synergien nutzen könnten bei der geplanten Regelung. Kleinere Mitgliedsfirmen dürften aber Probleme haben. “Sie haben bereits Signale erhalten, dass manche Prüfer die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht anbieten können.”
Auch für Judith Herzog-Kuballa, Expertin für Nachhaltigkeitsthemen beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), ist der BMJ-Vorschlag “nicht nachvollziehbar”. Sie sagt: “Zertifizierungsgesellschaften haben in der Regel mehr Expertise und Kompetenzen in ESG-Themen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.” Eine Öffnung des Prüfungsmarkts könnte eine Chance sein, “die ohnehin schon enorme bürokratische Belastung auf der Prüfungsseite nicht noch weiter zu überreizen”. Dass sich das Ministerium jetzt offenbar mehr Zeit nimmt, um diese und weitere Fragen zu klären, dürfte von Kritikern wie dem VDMA begrüßt werden.
Andererseits trägt eine weitere Verzögerung der überfälligen nationalen CSRD-Umsetzung nicht zur baldigen Rechtssicherheit bei. Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), sagte zu Table.Briefings: “Die Verzögerung der nationalen Umsetzung der CSRD ist ärgerlich.” Die Umsetzung in nationales Recht solle schnellstmöglich erfolgen, andernfalls müssten Unternehmen “im schlimmsten Fall” Ende des Jahres kurzfristig Berichtssysteme umstellen. “Der damit verbundene Aufwand ist vermeidbar.”
Verunsicherung gibt es auch hinsichtlich der möglichen zusätzlichen Berichtspflicht, die das Lieferkettengesetz (LkSG) vorsieht. Der Verband der Chemischen Industrie erklärte auf Anfrage: “Unsere Unternehmen brauchen die Klarheit, dass die Berichtspflicht nach dem nationalen LkSG bis zur Veröffentlichung des CSRD-Berichts ausgesetzt ist. Diese Klarheit haben wir derzeit nicht.” Bis das CSRD-Umsetzungsgesetz in Kraft tritt, müssten Unternehmen deshalb doppelgleisig fahren. “Dies führt zu erheblichen Kosten und benachteiligt unsere Unternehmen im europäischen Wettbewerb.”
Laut eines Zeitplans, den das Justizministerium im März aufgestellt hatte und der den Hinweis “besondere Eilbedürftigkeit beim Kabinettbeschluss” trug, sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag und Ende November in Kraft treten. Angesichts der aktuellen Verzögerung des Kabinettsbeschlusses auf unbestimmte Zeit wäre dieser Plan nur dann haltbar, wenn das anschließende parlamentarische Verfahren besonders straff durchgeführt wird.

Die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) nutzt zur Förderung privatwirtschaftlicher Strukturen in Entwicklungs- und Schwellenländern Private Equity-Fonds und Zwischengesellschaften in Offshore-Finanzzentren (OFCs). Mehr als die Hälfte der 316 Beteiligungen der DEG seien 2022 in OFCs ansässig gewesen, heißt es in einer Studie des Netzwerks für Steuergerechtigkeit, die Table.Briefings vorab vorlag. Die wichtigsten Anlageorte seien die Kaimaninseln und Mauritius. Auch 2023 habe sich an der Situation wenig geändert.
Für den Autor der Studie, Christoph Trautvetter, ist nun klar, dass die DEG über OFC-Beteiligungen in mehreren Fällen Steuerzahlungen in Entwicklungs- und Schwellenländern vermieden hat. Negativ wirkten sich etwa Doppelbesteuerungsabkommen von OFCs mit Partnerländern der DEG aus. Trautvetter, dessen Studie vom Hilfswerk Misereor finanziert wurde, nennt ein solches Abkommen zwischen dem Entwicklungsland Kenia und der Steueroase Mauritius. Die DEG habe etwa beim Verkauf von Anteilen an der kenianischen Supermarktkette Naivas einen steuerfreien Gewinn erzielt. “Keine Riesensummen, sondern kleine Millionenbeträge”, sagt Trautvetter zu Table.Briefings. Aber das Beispiel zeige, dass die Aussage der DEG, an keiner Steuervermeidung in Entwicklungs- und Schwellenländern beteiligt zu sein, “nicht haltbar ist”. Er unterstellt der DEG keine Steuervermeidungsabsicht, sondern spricht von negativen Nebeneffekten dieser Art der Finanzierung durch die Entwicklungsbank.
Durch “Steuerflucht” über Offshore-Gesellschaften entgehen Ländern des Globalen Südens Mittel in erheblichem Ausmaß. Diese fehlen etwa zur Umsetzung der Klimawende und der Anpassung an Klimafolgeschäden. Auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) sind schwieriger zu erreichen. In welchem Umfang die OECD-Initiative zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für Konzerne die Steuervermeidung von Konzernen in ärmeren Ländern nachhaltig verbessern wird, ist umstritten. Die OECD sprach Anfang des Jahres davon, dass dadurch etwa vier Fünftel der sehr niedrig besteuerten Gewinne weltweit von der neuen Mindesteuer betroffen wären. Bislang werden 36 Prozent aller Gewinne weltweit noch niedriger besteuert – laut OECD sänke diese Zahl auf etwa sieben Prozent. Andere Experten hatten sich zuvor vorsichtiger geäußert.
Kritisch beurteilt Christoph Trautvetter, Koordinator des Netzwerks Steuergerechtigkeit, die Informationspolitik der Entwicklungsbank zu ihren Beteiligungen. Zwar habe sie auf frühere Kritik reagiert, wodurch mehr Transparenz hergestellt worden sei. Aber “wesentliche Informationen” zur steuerlichen Beurteilung der Offshore-Aktivitäten seien “weiterhin nicht öffentlich zugänglich”. Für die Studie griff er auf die veröffentlichen Informationen der DEG selbst und diejenigen anderer Investoren zurück. Im Einzelnen führt die Studie aus:
Aufgrund der mangelhaften Transparenz sei es für den Bundestag und die Öffentlichkeit “unmöglich”, die steuerlichen Auswirkungen des DEG-Engagements über OFCs zu bewerten, sagt Trautvetter.
Die DEG, eine Tochter der staatlichen Förderbank KfW, begründet die Nutzung der OFCs damit, dass dort privates Kapital leichter für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gewonnen werden könne. “Private Investoren scheuen oft das Risiko eines Engagements, wenn von unsicheren Strukturen in Investitionsländern auszugehen ist”, teilte die DEG auf Anfrage mit. Die Kritik der Studie an den Aktivitäten in OFCs und an fehlender Transparenz weist die Entwicklungsbank zurück: “Die DEG tätigt keine intransparenten Finanzierungen und nutzt keine Strukturen, die auf Steuervermeidung oder die Verschleierung von wirtschaftlich Berechtigten angelegt sind.”
Im März gab es einen zivilgesellschaftlichen Dialog mit der DEG. Die Entwicklungsbank konnte auch vor Veröffentlichung der Ergebnisse Stellung zu der Studie nehmen. Sie verweist mit Blick auf die Transparenz unter anderem auf die Vorgaben zur Tax Compliance der KfW-Bankengruppe, Geldwäscheverpflichtungen, umfangreiche Überprüfungen von Investitionen sowie vertraglich vereinbarte Berichtspflichten und Einsichtsrechte. Zudem würden alle Rückflüsse und Erträge “ausschließlich für Investitionen in Entwicklungsländern verwendet”. Annahmen und Schlussfolgerungen des Berichts “können wir nicht nachvollziehen”, teilte eine Sprecherin mit.
22. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Frankfurt
Diskussion Managerkreis Rhein-Main: Rechtspopulismus und -extremismus und die Verantwortung von Unternehmen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung
29. Mai 2024, 9:30-19:30 Uhr, Berlin
Workshop Zukunftssichernde soziale Investitionen – Was müssen wir tun? (Veranstalter: Arbeitskreis kirchlicher Investoren & VÖB) Info & Anmeldung
29. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Moritzburg
Diskussion Denkmale der Zukunft – Nachhaltigkeit und Architektur (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung
31. Mai-1. Juni 2024, Kassel
Seminar Ratschlag zur sozial-ökologischen Transformation der Mobilitätsindustrien (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung
31. Mai-1. Juni 2024, Wandlitz
Seminar Female Empowerment: Transformation in der Arbeitswelt – aktuelle Veränderungen verstehen und mitgestalten (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung
4. Juni 2024, 9:30-13 Uhr, Online
Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS, Teil 1 (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung
4.-5. Juni 2024, Berlin
Konferenz Woche der Umwelt 2024: Zusammen für Klimaneutralität (Veranstalter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Info & Anmeldung
4.-7. Juni 2024, Online/Hamburg
Konferenz Crashkurs Rohstoffwende 2024: Die Reise des Kupfers: Von der Mine über den Hafen bis zur ressourcensleichten Mobilität (Veranstalter: Powershift) Info & Anmeldung
Die United Autoworkers (UAW) haben die Wahl bei Mercedes-Benz in Vance im US-Bundesstaat Alabama verloren. Laut Auszählungsergebnis vom Freitag sprachen sich nur 44 Prozent der 5.075 Wahlberechtigten für eine gewerkschaftliche Interessenvertretung aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 92 Prozent. Etwa eintausend Beschäftigte des Mercedes-Werks durften nicht mitstimmen, beispielsweise weil sie Leitungspositionen innehaben.
In den Wochen vor der Wahl waren immer wieder Vorwürfe laut geworden, das Management von Mercedes versuche, die Belegschaft einzuschüchtern und von einer Stimmabgabe für eine Gewerkschaftsvertretung abzuhalten.
Das Mercedes-Management hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und betont, sie respektiere das Recht der Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Die Gewerkschaft will nun, dass offizielle Stellen untersuchen, ob das Unternehmen gegen geltendes Recht verstoßen hat. Die UAW hat nach eigenen Angaben in sechs Fällen Klage beim National Labor Relations Board eingereicht. Die Bundesbehörde überwacht die Einhaltung des National Labor Relations Act (NLRA).
Zudem hat sich die UAW Anfang April an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gewandt und einen Verstoß gegen das deutsche Lieferkettengesetz beklagt. Das seit Januar 2023 geltende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verbietet die “Missachtung der Koalitionsfreiheit”, wozu auch das Recht gehört, sich frei gewerkschaftlich zu organisieren. ch
Der Klimaschutz spielt für Nachwuchskräfte eine immer wichtigere Rolle bei der Berufswahl. Knapp die Hälfte hat bereits die Branche gewechselt oder erwägt dies, um einen nachhaltigeren Beruf zu finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die im Auftrag der Unternehmensberatung Deloitte durchgeführt wurde. Dafür wurden in 44 Ländern knapp 23.000 Berufstätige im Alter zwischen 18 und 41 Jahren befragt. Die Nachwuchskräfte wurden unterteilt in die “Millennial”-Generation (Jahrgang 1983 bis 1994, auch “Generation Y”) und die “Generation Z” (Jahrgang 1995 bis 2005).
Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie sich im letzten Monat wegen des Klimawandels beunruhigt oder besorgt gefühlt hätten. Immer mehr junge Erwachsene unternehmen deshalb aktiv Schritte, um die Umweltbelastung einzudämmen. So gab etwa die Hälfte der Befragten an, gemeinsam mit Kollegen Druck auf ihren Arbeitgeber auszuüben, damit dieser Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreift.
Die Hälfte der Generation Z und 43 Prozent der Millennials gaben an, bereits einen Job oder ein Projekt aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen oder Wertvorstellungen abgelehnt zu haben. Als Gründe dafür wurden negative Umweltauswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit sowie mangelnde Gleichberechtigung der Mitarbeitenden und fehlende Unterstützung des psychischen Wohlbefindens genannt.
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sehen viele junge Menschen Unternehmen als treibende Kraft. Knapp 80 Prozent der Befragten glauben, dass Unternehmen mehr tun sollten, um nachhaltigere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Ähnlich hoch verbreitet ist die Einschätzung, dass Regierungen dabei den Druck auf Unternehmen erhöhen sollten. Weitere gesellschaftliche Herausforderungen, auf die Unternehmen nach Ansicht der Befragten einen wichtigen Einfluss haben, sind die ethische Nutzung neuer Technologien und die soziale Gleichstellung.
Die Studie existiert bereits seit 2011 und wird jährlich von Deloitte durchgeführt. Im Vergleich zu den vergangenen “Gen Z und Millennial”-Studien ist die junge Generation dennoch optimistisch: Ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage in ihren Ländern im kommenden Jahr verbessern wird.
Die mit Abstand größte Sorge der Generation Z und der Millennials sind der Studie zufolge steigende Lebenshaltungskosten (Sorge von 34 Prozent der Gen Z und 40 Prozent der Millennials), gefolgt von Arbeitslosigkeit und dem Klimawandel. ag
Die Taxi- und Mietwagenbranche könnte erhebliche Mengen an Treibhausgasen einsparen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Fraunhofer Fokus, die das Berliner Forschungsinstitut gemeinsam mit dem Interessenverband “Wirfahren” veröffentlicht hat. Demnach gibt es allein in Berlin täglich 200.000 Kilometer unnötige Leerfahrten. Zudem sei der Anteil von Taxis und Mietwagen mit Elektroantrieb mit rund 17 Prozent viel zu gering.
Die Studie mit dem Titel “Transformation des Taxi- und Mietwagengewerbes” sei ein Ausgangspunkt, um Mobilität “neu, modern und nachhaltig zu denken”, so Thomas Mohnke, Sprecher von “Wirfahren”. Die Initiative vertritt nach eigenen Angaben vor allem Unternehmen der Mietwagenbranche. Thematisch befasst sie sich vor allem mit Chauffeurservices als Alternative zu Taxifahrten. Prominentester Vermittler solcher Dienstleistungen ist das US-Unternehmen Uber.
Die Autoren der Studie setzen vor allem auf zwei Konzepte, um den Wandel zu einer “grüneren Mobilität” im Taxi- und Mietwagengewerbe voranzutreiben:
“Neben der sofortigen Einsparung würde die Aufhebung der Rückkehrpflicht auch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge enorm erleichtern, die aufgrund ihrer noch geringen Reichweite für den kommerziellen Einsatz nicht wirtschaftlich sind”, betont Mohnke. ch
Im Vorfeld der Europawahlen am 9. Juni mehren sich Stimmen aus der Wirtschaft, die sich gegen rechtspopulistische Politik aussprechen. Jüngstes Beispiel ist eine Initiative des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW e.V.). Der Appell “Wirtschaft wählt Vielfalt und Nachhaltigkeit – für die Zukunft Europas” betont den Zusammenhang zwischen einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft und dem Gelingen der sozial-ökologischen Transformation.
Die unterzeichnenden Unternehmen würden “Klimaschutz als wirtschaftliche Chance für Arbeitsplätze, Technologien und Geschäftsmodelle” begreifen, “die nicht nur das Klima, sondern auch unser Leben auf dem Planeten schützen”, heißt es in der Erklärung. Ausgrenzung, Fremden- und Demokratiefeindlichkeit gefährde Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Die Forderungen rechtspopulistischer Parteien seien mithin auch wirtschaftsfeindlich.
Der Erklärung haben sich bereits über 150 Unternehmen angeschlossen. Darunter finden sich nicht nur Mitglieder des BNW, sondern auch Konzerne wie Otto und Unternehmen wie die Messe München. Die Erklärung kann unter www.wirtschaftsappell.org unterzeichnet werden. lf
Entwicklungs-Staatssekretärin Bärbel Kofler stellt am Mittwoch dieser Woche auf dem OECD-Forum zu Verantwortung in Rohstofflieferketten in Paris ein neues Positionspapier zur Rohstoffpolitik der Bundesregierung vor. In dem Papier, das Table.Briefings vorab vorlag, heißt es, die Bundesregierung wolle sich für mehr Rechtssicherheit in rohstoffreichen Ländern sowie den Aufbau einer lokalen Produktion einsetzen. Zudem will sich insbesondere das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) dafür einsetzen, “auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene verbindliche Sorgfaltspflichtenregelungen” auszuarbeiten.
Bereits im vergangenen Jahr hatte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) ein Eckpunktepapier zur nachhaltigen Rohstoffversorgung vorgelegt. Darin legt das Haus von Robert Habeck dar, wie Deutschland die Versorgung mit Rohstoffen, die für die Energiewende relevant sind, sichern will. Mit dem neuen Positionspapier des BMZ soll der Versorgungsaspekt um den Aspekt der nachhaltigen Rohstoffgewinnung und Verarbeitung im Globalen Süden ergänzt werden.
Wegen der globalen Energiewende steigt der Bedarf an Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, Nickel oder Grafit. Die Vorkommen liegen vor allem in Ländern des Globalen Südens. Die DR Kongo verfügt zum Beispiel mit Abstand über die größten Kobalt-Vorkommen weltweit. Der Abbau wird auch unter Einsatz von Kinderarbeit durchgeführt. dre
Sanktionen gegen die Einfuhr von fossilen russischen Energieträgern in die EU sollten nach Ansicht der polnischen Regierung schneller und wirksamer umgesetzt werden. Das sagte Urszula Zielińska, Staatssekretärin aus dem polnischen Klima- und Umweltministerium, am Freitag beim Deutsch-Polnischen Energiewendeforum im Auswärtigen Amt in Berlin.
Insbesondere kritisierte die grüne Staatssekretärin, dass weiterhin die Einfuhr von verarbeiteten Ölprodukten wie Diesel aus russischem Rohöl über Drittstaaten wie Indien und die Türkei möglich sei. “Unter diesen Umständen hat die Klimapolitik der EU mit der Abkehr von Kohle, Erdgas und Öl hin zu sauberen Energiequellen eine neue Dimension angenommen”, sagte die Stellvertreterin von Ministerin Paulina Hennig-Kloska. Zielińska warf Russland vor, in Polen, Deutschland und anderen EU-Staaten Desinformationskampagnen zur Klimapolitik zu betreiben.
Als ein Thema für Kooperationen nannte Udo Philipp, Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, den Bau von Offshore-Windparks. Polen habe im Bau von Fundamenten mehr Erfahrung als Deutschland: “Durch unsere Koordinierung könnten wir auch Infrastruktur wie Häfen und Schiffe effizienter nutzen.” Polen habe zudem Potenziale für Wasserstoffspeicher und die Flexibilisierung der Nachfrage. Zu letzterem Punkt hat das BMWK bereits eine Initiative mit Frankreich gestartet, um Erzeugungsspitzen erneuerbarer Energien besser in den europäischen Strommarkt zu integrieren. ber
Climate change criminal claim targets TotalEnergies and investors – Financial Times
Direktoren und Top-Anteilseigner von TotalEnergies sind in Frankreich wegen Totschlags angezeigt worden – von Angehörigen der Opfer extremer Wetterereignisse, die mutmaßlich vom Klimawandel ausgelöst worden sind. Der Staatsanwaltschaft bleiben nun drei Monate Zeit, um über die Einleitung von Ermittlungen zu entscheiden, schreibt Kenza Bryan. Zum Artikel
How the Shipping Industry Is Trying to Cut Its Billion Tons of CO₂ Emissions – Bloomberg
Vor welchen Herausforderungen steht die Schifffahrtsindustrie, die 80 Prozent der globalen Güter befördert? Jack Wittels gibt einen kompakten Überblick über alternative Antriebe und Treibstoffe, Selbstverpflichtungen der Reeder und politische Regulierungen. Allerdings: Eine schnelle Lösung des fossilen Problems sei nicht in Sicht. Zum Artikel
Warum Europa nur noch Mittelmaß ist – Spiegel
Europa sei zwar bei der Dekarbonisierung global führend, aber nicht bei grüner Technologie, Produktivität und Forschungsausgaben. Daher legen fünf Autoren vor der EU-Wahl einen Aufgabenzettel für die nächste Legislatur vor. Darauf steht: billigere Energie sowie mehr Risikokapital, Hochtechnologie und europäische Zusammenarbeit. Zum Artikel
Mehr Licht im Dunkel des Stiftungswesens – taz
Beim Deutschen Stiftungstag hat Joachim Göres eine gute Stimmung wahrgenommen, denn es gibt viele Neugründungen. Allerdings sei davon jede zweite eine privatnützige Familienstiftung, mit der Steuern gespart werden können. Zum Artikel
Grüne Grenze: Was ist dran am neuen EU-Klimazoll? – Standard
Ab Januar 2026 müssen Unternehmen auf Waren, die sie von außerhalb der Europäischen Union beziehen, einen Zoll zahlen, der die Klimaschäden dieser Produkte ausgleichen soll. Der sogenannte “Climate Border Adjustment Mechanism”, kurz CBAM, birgt Experten zufolge die Gefahr, dass vor allem ärmere Exportländer stark belastet werden, berichtet Joseph Gepp. Zudem sei mit einem hohen bürokratischen Aufwand zu rechnen. Zum Artikel
Finanzstandort Frankfurt: Der Ärger mit der Nachhaltigkeit – FAZ
Auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Finanzstandort ist Frankfurt mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, schreibt David Kremer. Seit dem Skandal der Deutschen-Bank-Tochter DWS vor zwei Jahren seien die Greenwashing-Beschwerden stark gestiegen, zudem würden nur noch wenige Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte zur Verbesserung ihres Images einsetzen. Auch im internationalen Ranking liegt Frankfurt weiter hinten als gedacht. Zum Artikel
ESG fund ownership higher in Asia than Europe – The Asset
Das Interesse an ESG-Fonds ist in Asien größer als in Europa. Das zeigt eine Studie von AXA Investment Managers. Demnach geben 39 Prozent der Investoren in Asien an, ESG-Fonds in ihren Portfolios zu haben. In Europa sind es nur 23 Prozent. Zum Artikel
Calpers Opposes All Exxon Directors Amid Shareholder Dispute – Bloomberg
Calpers, der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA, wird dem Top-Management von Exxon Mobil bei der bevorstehenden Aktionärsversammlung die Zustimmung verweigern. Das berichten Kevin Crowley und Eliyahu Kamisher. Streitpunkt ist ein Gerichtsverfahren, das der Ölmulti gegen zwei klimaaktivistische Kleinaktionäre führt. Calpers befürchtet, dass das Management einen Präzedenzfall schaffen will, um Aktionärsrechte zu beschneiden. Zum Artikel
Der Widerstand gegen das Stromgesetz ist unverständlich – Tagesanzeiger
Das Land übersät mit Windrädern, die Stromrechnung unbezahlbar, die demokratische Mitbestimmung ausgehöhlt: Dieses Bild zeichnen laut Charlotte Walser die Gegnerinnen und Gegner des Stromgesetzes, über das am 9. Juni in der Schweiz abgestimmt wird. Sie erweckten den Eindruck, so Walser, es gehe um einen Grundsatzentscheid – und ein Ja hätte gravierende Folgen. Beides stimme aber nicht. Zum Artikel
Deutscher Teeverband sorgt sich um Kleinbauern – dpa
Der Deutsche Teeverband fürchtet, dass sich deutsche Unternehmen wegen des EU-Lieferkettengesetzes aus den Lieferbeziehungen mit weltweit verstreuten Kleinbauern zurückziehen. Der Grund: Zwei Drittel der Rohwaren werden in sogenannten Wildsammlungen eingebracht, die die vom Gesetz geforderten Nachweise nicht erfüllen. Die Organisation Oxfam hält diese Sorgen allerdings für unbegründet. Zum Artikel

Mitte März hat die Industrie- und Handelskammer Berlin ihre erste “Sustainability Week” veranstaltet. Eine Woche lang ging es in Diskussionsrunden und Workshops um “Green Claims”, Strategien für die interne Umsetzung der CSRD-Nachhaltigkeitsberichtspflicht, Finanzierungen und das gegenseitige Inspirieren. Also immer auch um die Frage, wie man in der Wirtschaft schneller vorankommt mit der Nachhaltigkeit. “Wir brauchen mehr Menschen, die beharrlich an diesen Themen dranbleiben”, sagte Antje Meyer beim Auftaktfrühstück.
Meyer weiß, wovon sie spricht. Sie versucht selbst, beharrlich zu sein. Seit rund 20 Jahren schon und in verschiedenen Positionen. Einerseits in der IHK, in der sie als ehrenamtliche CSR-Sprecherin dem Ausschuss Nachhaltige Metropole vorsitzt und beispielsweise die Nachhaltigkeitswoche mit angestoßen hat. Andererseits als Unternehmerin, die bereits mehrere Firmen und Netzwerke gegründet und sich über die Jahre zunehmend auf die Transformation spezialisiert hat.
Wobei ihr persönlicher Fokus gar nicht so leicht zu beschreiben ist, wie sie sagt. Häufig sei sie auf der Metaebene unterwegs, um Teams und Führungskräfte zu entwickeln. “Damit das gelingt, erstelle ich Grund-Anamnesen von Organisationen und baue anschließend Verhandlungsräume, in denen Menschen ihre Möglichkeiten neu ausloten.”
Ihre erste berufliche Begegnung mit Fragen der Nachhaltigkeit hatte sie Anfang der 2000er-Jahre, ein paar Jahre nach Gründung ihrer Full-Service-Agentur Orangeblue. Kunden aus der Lebensmittelbranche wollten wissen, was es mit “Corporate Social Responsibility” und “Corporate Volunteering” auf sich habe. Meyer begann, sich mit regionalen Lieferketten und dem Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit und der Leistungsfähigkeit im Job auseinanderzusetzen. Sie wollte aber nicht nur reagieren, sondern agieren können, wie sie sagt. Sie nahm Kontakt zu Wissenschaftlern auf, etwa bei der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, die kurz zuvor ihren ersten Studiengang mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestartet hatte. So fing sie an, ihr eigenes Netzwerk aufzubauen.
Wenig später, 2007, setzte sie das bei der IHK fort. Sie wurde in die Vollversammlung gewählt und ins Präsidium berufen und machte sich im Herzen der Institution, die heute mehr als 300.000 Mitgliedsunternehmen vereint, für CSR stark. Erste Interessen formulieren, sich austauschen und weiterbilden, etwa durch Besuche bei beispielhaften Sozialunternehmen – darum ging es damals.
In den folgenden Jahren machte Meyer zwei Beobachtungen. Zum einen fand sie in Teilen verkrustete Strukturen mit “alteingespielten Systemen” und Widerständen vor. Zum anderen traf sie zahlreiche Menschen, die es ernst meinen mit der Nachhaltigkeit. “Meine Erfahrung ist: Wer sich auf die Organisation einlässt, Fragen stellt und den Willen signalisiert, etwas anstoßen zu wollen, der kommt weiter und kann eine Bewegung auslösen.”
Außerhalb der IHK war es ähnlich. “Ich bekomme ständig ‘Ja, aber’ zu hören”, so Meyer. “Unsere Welt besteht aus ‘Ja, abers'”. Zugleich fand sie auch hier immer mehr Gleichgesinnte, mit denen sie intensiver zusammenarbeiten wollte. 2016 löste sie deshalb ihre Agentur Orangeblue auf, die nicht auf Nachhaltigkeit spezialisiert war, und gründete stattdessen mit elf anderen die Genossenschaft Sustainable Natives. Heute zählen im Kern 30 Mitglieder sowie rund 300 assoziierte Expertinnen und Experten dazu. Das Netzwerk ist eine Anlaufstelle für Unternehmen, die Unterstützung benötigen. Wird der Bedarf konkret und ein Projekt definiert, wird ein für diesen Auftrag passendes Team zusammengestellt.
Wer dabei ist, hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab, die soziale Themen, ökonomische Fragen, CSRD-Berichterstattungen, die Weiterbildung von Mitarbeitenden und die Kultur ganzer Organisationen umfassen kann. Ein weiterer Baustein von Meyers Angebot sind Beratungen zur Digitalisierung, die sie in der 2022 zusätzlich gegründeten Agentur Nextblooming gebündelt hat. “Innovationen für die nachhaltige Transformation” will sie darüber entwickeln und vermitteln.
So vielfältig ihre Aktivitäten sind – das übergeordnete Ziel, das Meyer verfolgt, ist immer das gleiche. “Es geht nicht darum, dass Nachhaltigkeitsabteilungen größer werden müssen. Es geht darum, dass alle in einem Unternehmen Nachhaltigkeit draufhaben.” Dass das Zeit benötigt, weiß sie. “Das ist wie Buchhaltung – das lernt man nicht in einem Semester.” Sie spürt, dass “das Stresslevel der Wirtschaft maximal hoch” ist, auch aufgrund der zunehmenden ESG-Regulatorik. Abzuwarten, bis sich das wieder ändert, kann aber keine Option für sie sein. Das vergrößere die Dringlichkeit nur umso mehr. Stattdessen müsse es darum gehen, vor allem eins zu bleiben: beharrlich. Marc Winkelmann
Agrifood.Table – GAP nach 2027: Welche fünf Knackpunkte vor der nächsten Reform debattiert werden: Die nächste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist eine der wichtigsten Aufgaben, die nach der Europawahl auf die EU-Institutionen zukommt. Zum Artikel
China.Table – Batterien: Wie Bidens Zölle Europas Industrie in Bedrängnis bringen: Für Europa kommen die Zölle zu einer ungünstigen Zeit. Sie könnten zu noch mehr Importen aus China führen. Der Markthochlauf europäischer Batteriefabriken wird damit noch schwieriger. Zum Artikel
Climate.Table – Ökonomische Schäden des Klimawandels größer als bisher angenommen: Steigende Temperaturen haben offenbar größere Auswirkungen auf die Wirtschaft als gedacht. Eine neue Studie hat die Auswirkungen von globalen Temperaturschocks – statt lokalen Temperaturveränderungen – auf die Wirtschaftsentwicklung untersucht. Zum Artikel
wenn es um die “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) geht, die von den EU-Staaten in nationales Recht überführt werden muss, ist häufig von einer “1:1-Umsetzung” die Rede. Es klingt dann immer so, als ob die EU-Vorgabe bloß übersetzt und mit leichten Änderungen nur noch eben beschlossen werden muss.
In der Praxis zieht sich der Prozess aber schon seit einiger Zeit hin – und verzögert sich nun weiter. Was dahintersteckt, welche zum Teil deutliche Kritik es an dem Vorgehen gibt und was die Wirtschaft sagt, das können Sie in meiner Analyse lesen.
Mit einem erstaunlichen anderen Vorgehen hat sich mein Kollege Caspar Dohmen befasst. Er geht der Frage nach, ob die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), eine Tochter der KfW, Offshore-Finanzzentren genutzt hat. Einer Studie zufolge, die Table.Briefings vorab erhalten hat, sind die Leidtragenden Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer der Vorwürfe: Durch diese Anlage-Politik wird die Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele noch schwerer gemacht.

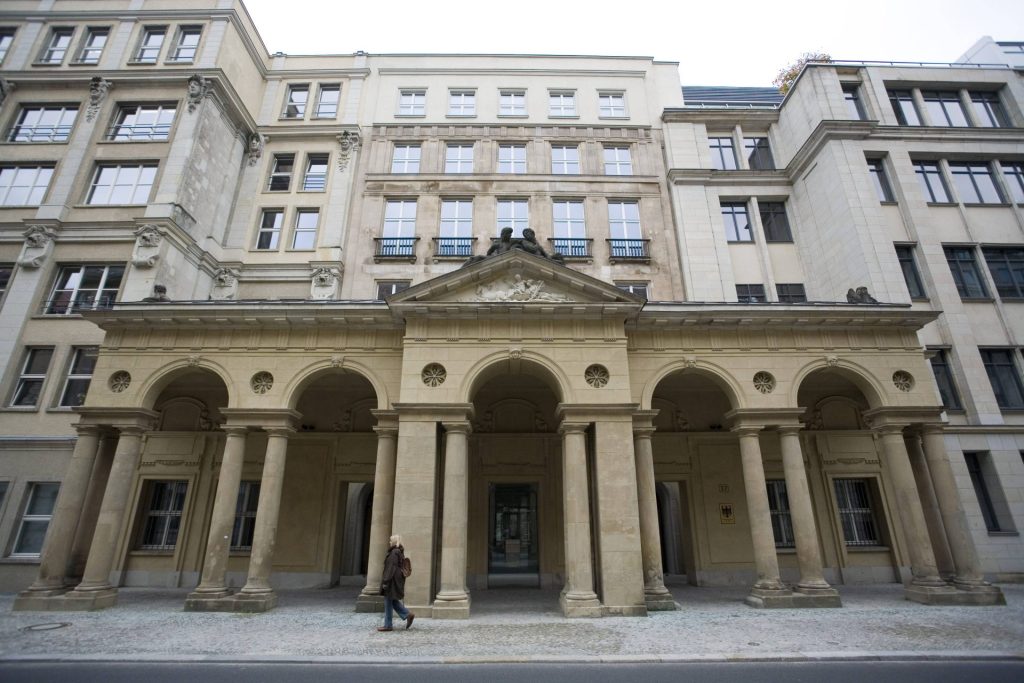
Frankreich, Spanien, Ungarn, Slowenien, Finnland und Rumänien sind schon durch. Sie haben die Frist der EU, die CSRD-Richtlinie bis Anfang Juli in ein nationales Gesetz umzusetzen, bereits jetzt eingehalten. Unternehmen in diesen Ländern wissen, was sie tun müssen, um Nachhaltigkeitsreports zu erstellen, die den neuen Anforderungen genügen.
In Deutschland herrscht dagegen noch Unklarheit. Zwar entspricht der im März veröffentlichte Referentenentwurf überwiegend der EU-Vorlage. Daran können sich die rund 15.000 Unternehmen, die hierzulande berichtspflichtig werden, orientieren. Verabschiedet ist das Vorhaben allerdings noch nicht. Und am heutigen Mittwoch wird die Vorlage auch nicht im Kabinett verabschiedet, wie es ursprünglich geplant war. Das hat das federführende Bundesjustizministerium (BMJ) bestätigt. Gründe für die Verschiebung wollte eine Sprecherin nicht nennen.
Otto Fricke, der CSRD-Berichterstatter der FDP im Bundestag, nennt die Verzögerung “konsequent”. “Offenbar ist die Zahl der Stellungnahmen, in denen Verbände sich zum Referentenentwurf äußern konnten, sehr viel größer als zuvor angekündigt”, sagte er zu Table.Briefings. “Gleichzeitig bin ich froh, dass damit dem hohen Grad an Komplexität und Relevanz Rechnung getragen wird. Vielleicht gelingt es ja doch noch, ein wenig zu entbürokratisieren.”
Katharina Beck hat weniger Verständnis. “Unternehmen brauchen Planungssicherheit, gerade in der aktuellen Lage. Daher ist es mehr als misslich, dass das Gesetz diese Woche nicht wie geplant im Kabinett beschlossen wird”, sagt die CSRD-Berichterstatterin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. “Sich selbst bei einem vergleichsweise unkomplizierten Umsetzungsgesetz im Bundesjustizministerium nicht an die Fristen zu halten, grenzt schon an Peinlichkeit.” Und weiter: “Das ist nicht der Grad an Professionalität in der Politik, wie sie für die drittgrößte Volkswirtschaft angemessen wäre.”
In der Verbändeanhörung, die bis Mitte April lief, hatten sich verschiedene Kritikpunkte an dem Entwurf herauskristallisiert. Vor allem die Frage, wer CSRD-Berichte künftig prüfen darf, beschäftigt viele. Dem BMJ-Vorschlag zufolge ist diese Aufgabe ausschließlich Wirtschaftsprüfern vorbehalten. Umweltgutachter und technische Sachverständige wie TÜV und Dekra sind ausgeschlossen. Diese sehen darin eine Benachteiligung.
Mehrere Akteure teilen diese Kritik. Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung empfahl, Umweltgutachter vorläufig zuzulassen und nach drei Jahren Bilanz zu ziehen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erklärte, dass eine Verknappung der Prüfer “gerade für kleine und mittelständische Unternehmen massive negative Auswirkungen” haben könnte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) glaubt zwar, dass größere, kapitalmarktorientierte Unternehmen Synergien nutzen könnten bei der geplanten Regelung. Kleinere Mitgliedsfirmen dürften aber Probleme haben. “Sie haben bereits Signale erhalten, dass manche Prüfer die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht anbieten können.”
Auch für Judith Herzog-Kuballa, Expertin für Nachhaltigkeitsthemen beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), ist der BMJ-Vorschlag “nicht nachvollziehbar”. Sie sagt: “Zertifizierungsgesellschaften haben in der Regel mehr Expertise und Kompetenzen in ESG-Themen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.” Eine Öffnung des Prüfungsmarkts könnte eine Chance sein, “die ohnehin schon enorme bürokratische Belastung auf der Prüfungsseite nicht noch weiter zu überreizen”. Dass sich das Ministerium jetzt offenbar mehr Zeit nimmt, um diese und weitere Fragen zu klären, dürfte von Kritikern wie dem VDMA begrüßt werden.
Andererseits trägt eine weitere Verzögerung der überfälligen nationalen CSRD-Umsetzung nicht zur baldigen Rechtssicherheit bei. Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), sagte zu Table.Briefings: “Die Verzögerung der nationalen Umsetzung der CSRD ist ärgerlich.” Die Umsetzung in nationales Recht solle schnellstmöglich erfolgen, andernfalls müssten Unternehmen “im schlimmsten Fall” Ende des Jahres kurzfristig Berichtssysteme umstellen. “Der damit verbundene Aufwand ist vermeidbar.”
Verunsicherung gibt es auch hinsichtlich der möglichen zusätzlichen Berichtspflicht, die das Lieferkettengesetz (LkSG) vorsieht. Der Verband der Chemischen Industrie erklärte auf Anfrage: “Unsere Unternehmen brauchen die Klarheit, dass die Berichtspflicht nach dem nationalen LkSG bis zur Veröffentlichung des CSRD-Berichts ausgesetzt ist. Diese Klarheit haben wir derzeit nicht.” Bis das CSRD-Umsetzungsgesetz in Kraft tritt, müssten Unternehmen deshalb doppelgleisig fahren. “Dies führt zu erheblichen Kosten und benachteiligt unsere Unternehmen im europäischen Wettbewerb.”
Laut eines Zeitplans, den das Justizministerium im März aufgestellt hatte und der den Hinweis “besondere Eilbedürftigkeit beim Kabinettbeschluss” trug, sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag und Ende November in Kraft treten. Angesichts der aktuellen Verzögerung des Kabinettsbeschlusses auf unbestimmte Zeit wäre dieser Plan nur dann haltbar, wenn das anschließende parlamentarische Verfahren besonders straff durchgeführt wird.

Die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) nutzt zur Förderung privatwirtschaftlicher Strukturen in Entwicklungs- und Schwellenländern Private Equity-Fonds und Zwischengesellschaften in Offshore-Finanzzentren (OFCs). Mehr als die Hälfte der 316 Beteiligungen der DEG seien 2022 in OFCs ansässig gewesen, heißt es in einer Studie des Netzwerks für Steuergerechtigkeit, die Table.Briefings vorab vorlag. Die wichtigsten Anlageorte seien die Kaimaninseln und Mauritius. Auch 2023 habe sich an der Situation wenig geändert.
Für den Autor der Studie, Christoph Trautvetter, ist nun klar, dass die DEG über OFC-Beteiligungen in mehreren Fällen Steuerzahlungen in Entwicklungs- und Schwellenländern vermieden hat. Negativ wirkten sich etwa Doppelbesteuerungsabkommen von OFCs mit Partnerländern der DEG aus. Trautvetter, dessen Studie vom Hilfswerk Misereor finanziert wurde, nennt ein solches Abkommen zwischen dem Entwicklungsland Kenia und der Steueroase Mauritius. Die DEG habe etwa beim Verkauf von Anteilen an der kenianischen Supermarktkette Naivas einen steuerfreien Gewinn erzielt. “Keine Riesensummen, sondern kleine Millionenbeträge”, sagt Trautvetter zu Table.Briefings. Aber das Beispiel zeige, dass die Aussage der DEG, an keiner Steuervermeidung in Entwicklungs- und Schwellenländern beteiligt zu sein, “nicht haltbar ist”. Er unterstellt der DEG keine Steuervermeidungsabsicht, sondern spricht von negativen Nebeneffekten dieser Art der Finanzierung durch die Entwicklungsbank.
Durch “Steuerflucht” über Offshore-Gesellschaften entgehen Ländern des Globalen Südens Mittel in erheblichem Ausmaß. Diese fehlen etwa zur Umsetzung der Klimawende und der Anpassung an Klimafolgeschäden. Auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) sind schwieriger zu erreichen. In welchem Umfang die OECD-Initiative zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für Konzerne die Steuervermeidung von Konzernen in ärmeren Ländern nachhaltig verbessern wird, ist umstritten. Die OECD sprach Anfang des Jahres davon, dass dadurch etwa vier Fünftel der sehr niedrig besteuerten Gewinne weltweit von der neuen Mindesteuer betroffen wären. Bislang werden 36 Prozent aller Gewinne weltweit noch niedriger besteuert – laut OECD sänke diese Zahl auf etwa sieben Prozent. Andere Experten hatten sich zuvor vorsichtiger geäußert.
Kritisch beurteilt Christoph Trautvetter, Koordinator des Netzwerks Steuergerechtigkeit, die Informationspolitik der Entwicklungsbank zu ihren Beteiligungen. Zwar habe sie auf frühere Kritik reagiert, wodurch mehr Transparenz hergestellt worden sei. Aber “wesentliche Informationen” zur steuerlichen Beurteilung der Offshore-Aktivitäten seien “weiterhin nicht öffentlich zugänglich”. Für die Studie griff er auf die veröffentlichen Informationen der DEG selbst und diejenigen anderer Investoren zurück. Im Einzelnen führt die Studie aus:
Aufgrund der mangelhaften Transparenz sei es für den Bundestag und die Öffentlichkeit “unmöglich”, die steuerlichen Auswirkungen des DEG-Engagements über OFCs zu bewerten, sagt Trautvetter.
Die DEG, eine Tochter der staatlichen Förderbank KfW, begründet die Nutzung der OFCs damit, dass dort privates Kapital leichter für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gewonnen werden könne. “Private Investoren scheuen oft das Risiko eines Engagements, wenn von unsicheren Strukturen in Investitionsländern auszugehen ist”, teilte die DEG auf Anfrage mit. Die Kritik der Studie an den Aktivitäten in OFCs und an fehlender Transparenz weist die Entwicklungsbank zurück: “Die DEG tätigt keine intransparenten Finanzierungen und nutzt keine Strukturen, die auf Steuervermeidung oder die Verschleierung von wirtschaftlich Berechtigten angelegt sind.”
Im März gab es einen zivilgesellschaftlichen Dialog mit der DEG. Die Entwicklungsbank konnte auch vor Veröffentlichung der Ergebnisse Stellung zu der Studie nehmen. Sie verweist mit Blick auf die Transparenz unter anderem auf die Vorgaben zur Tax Compliance der KfW-Bankengruppe, Geldwäscheverpflichtungen, umfangreiche Überprüfungen von Investitionen sowie vertraglich vereinbarte Berichtspflichten und Einsichtsrechte. Zudem würden alle Rückflüsse und Erträge “ausschließlich für Investitionen in Entwicklungsländern verwendet”. Annahmen und Schlussfolgerungen des Berichts “können wir nicht nachvollziehen”, teilte eine Sprecherin mit.
22. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Frankfurt
Diskussion Managerkreis Rhein-Main: Rechtspopulismus und -extremismus und die Verantwortung von Unternehmen (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung
29. Mai 2024, 9:30-19:30 Uhr, Berlin
Workshop Zukunftssichernde soziale Investitionen – Was müssen wir tun? (Veranstalter: Arbeitskreis kirchlicher Investoren & VÖB) Info & Anmeldung
29. Mai 2024, 18-19:30 Uhr, Moritzburg
Diskussion Denkmale der Zukunft – Nachhaltigkeit und Architektur (Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung) Info & Anmeldung
31. Mai-1. Juni 2024, Kassel
Seminar Ratschlag zur sozial-ökologischen Transformation der Mobilitätsindustrien (Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung) Info & Anmeldung
31. Mai-1. Juni 2024, Wandlitz
Seminar Female Empowerment: Transformation in der Arbeitswelt – aktuelle Veränderungen verstehen und mitgestalten (Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung) Info & Anmeldung
4. Juni 2024, 9:30-13 Uhr, Online
Workshop Einführung in das Umweltmanagement nach EMAS, Teil 1 (Veranstalter: KliMaWirtschaft) Info & Anmeldung
4.-5. Juni 2024, Berlin
Konferenz Woche der Umwelt 2024: Zusammen für Klimaneutralität (Veranstalter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Info & Anmeldung
4.-7. Juni 2024, Online/Hamburg
Konferenz Crashkurs Rohstoffwende 2024: Die Reise des Kupfers: Von der Mine über den Hafen bis zur ressourcensleichten Mobilität (Veranstalter: Powershift) Info & Anmeldung
Die United Autoworkers (UAW) haben die Wahl bei Mercedes-Benz in Vance im US-Bundesstaat Alabama verloren. Laut Auszählungsergebnis vom Freitag sprachen sich nur 44 Prozent der 5.075 Wahlberechtigten für eine gewerkschaftliche Interessenvertretung aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 92 Prozent. Etwa eintausend Beschäftigte des Mercedes-Werks durften nicht mitstimmen, beispielsweise weil sie Leitungspositionen innehaben.
In den Wochen vor der Wahl waren immer wieder Vorwürfe laut geworden, das Management von Mercedes versuche, die Belegschaft einzuschüchtern und von einer Stimmabgabe für eine Gewerkschaftsvertretung abzuhalten.
Das Mercedes-Management hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und betont, sie respektiere das Recht der Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Die Gewerkschaft will nun, dass offizielle Stellen untersuchen, ob das Unternehmen gegen geltendes Recht verstoßen hat. Die UAW hat nach eigenen Angaben in sechs Fällen Klage beim National Labor Relations Board eingereicht. Die Bundesbehörde überwacht die Einhaltung des National Labor Relations Act (NLRA).
Zudem hat sich die UAW Anfang April an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gewandt und einen Verstoß gegen das deutsche Lieferkettengesetz beklagt. Das seit Januar 2023 geltende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verbietet die “Missachtung der Koalitionsfreiheit”, wozu auch das Recht gehört, sich frei gewerkschaftlich zu organisieren. ch
Der Klimaschutz spielt für Nachwuchskräfte eine immer wichtigere Rolle bei der Berufswahl. Knapp die Hälfte hat bereits die Branche gewechselt oder erwägt dies, um einen nachhaltigeren Beruf zu finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die im Auftrag der Unternehmensberatung Deloitte durchgeführt wurde. Dafür wurden in 44 Ländern knapp 23.000 Berufstätige im Alter zwischen 18 und 41 Jahren befragt. Die Nachwuchskräfte wurden unterteilt in die “Millennial”-Generation (Jahrgang 1983 bis 1994, auch “Generation Y”) und die “Generation Z” (Jahrgang 1995 bis 2005).
Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie sich im letzten Monat wegen des Klimawandels beunruhigt oder besorgt gefühlt hätten. Immer mehr junge Erwachsene unternehmen deshalb aktiv Schritte, um die Umweltbelastung einzudämmen. So gab etwa die Hälfte der Befragten an, gemeinsam mit Kollegen Druck auf ihren Arbeitgeber auszuüben, damit dieser Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreift.
Die Hälfte der Generation Z und 43 Prozent der Millennials gaben an, bereits einen Job oder ein Projekt aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen oder Wertvorstellungen abgelehnt zu haben. Als Gründe dafür wurden negative Umweltauswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit sowie mangelnde Gleichberechtigung der Mitarbeitenden und fehlende Unterstützung des psychischen Wohlbefindens genannt.
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sehen viele junge Menschen Unternehmen als treibende Kraft. Knapp 80 Prozent der Befragten glauben, dass Unternehmen mehr tun sollten, um nachhaltigere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Ähnlich hoch verbreitet ist die Einschätzung, dass Regierungen dabei den Druck auf Unternehmen erhöhen sollten. Weitere gesellschaftliche Herausforderungen, auf die Unternehmen nach Ansicht der Befragten einen wichtigen Einfluss haben, sind die ethische Nutzung neuer Technologien und die soziale Gleichstellung.
Die Studie existiert bereits seit 2011 und wird jährlich von Deloitte durchgeführt. Im Vergleich zu den vergangenen “Gen Z und Millennial”-Studien ist die junge Generation dennoch optimistisch: Ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage in ihren Ländern im kommenden Jahr verbessern wird.
Die mit Abstand größte Sorge der Generation Z und der Millennials sind der Studie zufolge steigende Lebenshaltungskosten (Sorge von 34 Prozent der Gen Z und 40 Prozent der Millennials), gefolgt von Arbeitslosigkeit und dem Klimawandel. ag
Die Taxi- und Mietwagenbranche könnte erhebliche Mengen an Treibhausgasen einsparen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Fraunhofer Fokus, die das Berliner Forschungsinstitut gemeinsam mit dem Interessenverband “Wirfahren” veröffentlicht hat. Demnach gibt es allein in Berlin täglich 200.000 Kilometer unnötige Leerfahrten. Zudem sei der Anteil von Taxis und Mietwagen mit Elektroantrieb mit rund 17 Prozent viel zu gering.
Die Studie mit dem Titel “Transformation des Taxi- und Mietwagengewerbes” sei ein Ausgangspunkt, um Mobilität “neu, modern und nachhaltig zu denken”, so Thomas Mohnke, Sprecher von “Wirfahren”. Die Initiative vertritt nach eigenen Angaben vor allem Unternehmen der Mietwagenbranche. Thematisch befasst sie sich vor allem mit Chauffeurservices als Alternative zu Taxifahrten. Prominentester Vermittler solcher Dienstleistungen ist das US-Unternehmen Uber.
Die Autoren der Studie setzen vor allem auf zwei Konzepte, um den Wandel zu einer “grüneren Mobilität” im Taxi- und Mietwagengewerbe voranzutreiben:
“Neben der sofortigen Einsparung würde die Aufhebung der Rückkehrpflicht auch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge enorm erleichtern, die aufgrund ihrer noch geringen Reichweite für den kommerziellen Einsatz nicht wirtschaftlich sind”, betont Mohnke. ch
Im Vorfeld der Europawahlen am 9. Juni mehren sich Stimmen aus der Wirtschaft, die sich gegen rechtspopulistische Politik aussprechen. Jüngstes Beispiel ist eine Initiative des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW e.V.). Der Appell “Wirtschaft wählt Vielfalt und Nachhaltigkeit – für die Zukunft Europas” betont den Zusammenhang zwischen einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft und dem Gelingen der sozial-ökologischen Transformation.
Die unterzeichnenden Unternehmen würden “Klimaschutz als wirtschaftliche Chance für Arbeitsplätze, Technologien und Geschäftsmodelle” begreifen, “die nicht nur das Klima, sondern auch unser Leben auf dem Planeten schützen”, heißt es in der Erklärung. Ausgrenzung, Fremden- und Demokratiefeindlichkeit gefährde Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Die Forderungen rechtspopulistischer Parteien seien mithin auch wirtschaftsfeindlich.
Der Erklärung haben sich bereits über 150 Unternehmen angeschlossen. Darunter finden sich nicht nur Mitglieder des BNW, sondern auch Konzerne wie Otto und Unternehmen wie die Messe München. Die Erklärung kann unter www.wirtschaftsappell.org unterzeichnet werden. lf
Entwicklungs-Staatssekretärin Bärbel Kofler stellt am Mittwoch dieser Woche auf dem OECD-Forum zu Verantwortung in Rohstofflieferketten in Paris ein neues Positionspapier zur Rohstoffpolitik der Bundesregierung vor. In dem Papier, das Table.Briefings vorab vorlag, heißt es, die Bundesregierung wolle sich für mehr Rechtssicherheit in rohstoffreichen Ländern sowie den Aufbau einer lokalen Produktion einsetzen. Zudem will sich insbesondere das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) dafür einsetzen, “auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene verbindliche Sorgfaltspflichtenregelungen” auszuarbeiten.
Bereits im vergangenen Jahr hatte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) ein Eckpunktepapier zur nachhaltigen Rohstoffversorgung vorgelegt. Darin legt das Haus von Robert Habeck dar, wie Deutschland die Versorgung mit Rohstoffen, die für die Energiewende relevant sind, sichern will. Mit dem neuen Positionspapier des BMZ soll der Versorgungsaspekt um den Aspekt der nachhaltigen Rohstoffgewinnung und Verarbeitung im Globalen Süden ergänzt werden.
Wegen der globalen Energiewende steigt der Bedarf an Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, Nickel oder Grafit. Die Vorkommen liegen vor allem in Ländern des Globalen Südens. Die DR Kongo verfügt zum Beispiel mit Abstand über die größten Kobalt-Vorkommen weltweit. Der Abbau wird auch unter Einsatz von Kinderarbeit durchgeführt. dre
Sanktionen gegen die Einfuhr von fossilen russischen Energieträgern in die EU sollten nach Ansicht der polnischen Regierung schneller und wirksamer umgesetzt werden. Das sagte Urszula Zielińska, Staatssekretärin aus dem polnischen Klima- und Umweltministerium, am Freitag beim Deutsch-Polnischen Energiewendeforum im Auswärtigen Amt in Berlin.
Insbesondere kritisierte die grüne Staatssekretärin, dass weiterhin die Einfuhr von verarbeiteten Ölprodukten wie Diesel aus russischem Rohöl über Drittstaaten wie Indien und die Türkei möglich sei. “Unter diesen Umständen hat die Klimapolitik der EU mit der Abkehr von Kohle, Erdgas und Öl hin zu sauberen Energiequellen eine neue Dimension angenommen”, sagte die Stellvertreterin von Ministerin Paulina Hennig-Kloska. Zielińska warf Russland vor, in Polen, Deutschland und anderen EU-Staaten Desinformationskampagnen zur Klimapolitik zu betreiben.
Als ein Thema für Kooperationen nannte Udo Philipp, Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, den Bau von Offshore-Windparks. Polen habe im Bau von Fundamenten mehr Erfahrung als Deutschland: “Durch unsere Koordinierung könnten wir auch Infrastruktur wie Häfen und Schiffe effizienter nutzen.” Polen habe zudem Potenziale für Wasserstoffspeicher und die Flexibilisierung der Nachfrage. Zu letzterem Punkt hat das BMWK bereits eine Initiative mit Frankreich gestartet, um Erzeugungsspitzen erneuerbarer Energien besser in den europäischen Strommarkt zu integrieren. ber
Climate change criminal claim targets TotalEnergies and investors – Financial Times
Direktoren und Top-Anteilseigner von TotalEnergies sind in Frankreich wegen Totschlags angezeigt worden – von Angehörigen der Opfer extremer Wetterereignisse, die mutmaßlich vom Klimawandel ausgelöst worden sind. Der Staatsanwaltschaft bleiben nun drei Monate Zeit, um über die Einleitung von Ermittlungen zu entscheiden, schreibt Kenza Bryan. Zum Artikel
How the Shipping Industry Is Trying to Cut Its Billion Tons of CO₂ Emissions – Bloomberg
Vor welchen Herausforderungen steht die Schifffahrtsindustrie, die 80 Prozent der globalen Güter befördert? Jack Wittels gibt einen kompakten Überblick über alternative Antriebe und Treibstoffe, Selbstverpflichtungen der Reeder und politische Regulierungen. Allerdings: Eine schnelle Lösung des fossilen Problems sei nicht in Sicht. Zum Artikel
Warum Europa nur noch Mittelmaß ist – Spiegel
Europa sei zwar bei der Dekarbonisierung global führend, aber nicht bei grüner Technologie, Produktivität und Forschungsausgaben. Daher legen fünf Autoren vor der EU-Wahl einen Aufgabenzettel für die nächste Legislatur vor. Darauf steht: billigere Energie sowie mehr Risikokapital, Hochtechnologie und europäische Zusammenarbeit. Zum Artikel
Mehr Licht im Dunkel des Stiftungswesens – taz
Beim Deutschen Stiftungstag hat Joachim Göres eine gute Stimmung wahrgenommen, denn es gibt viele Neugründungen. Allerdings sei davon jede zweite eine privatnützige Familienstiftung, mit der Steuern gespart werden können. Zum Artikel
Grüne Grenze: Was ist dran am neuen EU-Klimazoll? – Standard
Ab Januar 2026 müssen Unternehmen auf Waren, die sie von außerhalb der Europäischen Union beziehen, einen Zoll zahlen, der die Klimaschäden dieser Produkte ausgleichen soll. Der sogenannte “Climate Border Adjustment Mechanism”, kurz CBAM, birgt Experten zufolge die Gefahr, dass vor allem ärmere Exportländer stark belastet werden, berichtet Joseph Gepp. Zudem sei mit einem hohen bürokratischen Aufwand zu rechnen. Zum Artikel
Finanzstandort Frankfurt: Der Ärger mit der Nachhaltigkeit – FAZ
Auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Finanzstandort ist Frankfurt mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, schreibt David Kremer. Seit dem Skandal der Deutschen-Bank-Tochter DWS vor zwei Jahren seien die Greenwashing-Beschwerden stark gestiegen, zudem würden nur noch wenige Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte zur Verbesserung ihres Images einsetzen. Auch im internationalen Ranking liegt Frankfurt weiter hinten als gedacht. Zum Artikel
ESG fund ownership higher in Asia than Europe – The Asset
Das Interesse an ESG-Fonds ist in Asien größer als in Europa. Das zeigt eine Studie von AXA Investment Managers. Demnach geben 39 Prozent der Investoren in Asien an, ESG-Fonds in ihren Portfolios zu haben. In Europa sind es nur 23 Prozent. Zum Artikel
Calpers Opposes All Exxon Directors Amid Shareholder Dispute – Bloomberg
Calpers, der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA, wird dem Top-Management von Exxon Mobil bei der bevorstehenden Aktionärsversammlung die Zustimmung verweigern. Das berichten Kevin Crowley und Eliyahu Kamisher. Streitpunkt ist ein Gerichtsverfahren, das der Ölmulti gegen zwei klimaaktivistische Kleinaktionäre führt. Calpers befürchtet, dass das Management einen Präzedenzfall schaffen will, um Aktionärsrechte zu beschneiden. Zum Artikel
Der Widerstand gegen das Stromgesetz ist unverständlich – Tagesanzeiger
Das Land übersät mit Windrädern, die Stromrechnung unbezahlbar, die demokratische Mitbestimmung ausgehöhlt: Dieses Bild zeichnen laut Charlotte Walser die Gegnerinnen und Gegner des Stromgesetzes, über das am 9. Juni in der Schweiz abgestimmt wird. Sie erweckten den Eindruck, so Walser, es gehe um einen Grundsatzentscheid – und ein Ja hätte gravierende Folgen. Beides stimme aber nicht. Zum Artikel
Deutscher Teeverband sorgt sich um Kleinbauern – dpa
Der Deutsche Teeverband fürchtet, dass sich deutsche Unternehmen wegen des EU-Lieferkettengesetzes aus den Lieferbeziehungen mit weltweit verstreuten Kleinbauern zurückziehen. Der Grund: Zwei Drittel der Rohwaren werden in sogenannten Wildsammlungen eingebracht, die die vom Gesetz geforderten Nachweise nicht erfüllen. Die Organisation Oxfam hält diese Sorgen allerdings für unbegründet. Zum Artikel

Mitte März hat die Industrie- und Handelskammer Berlin ihre erste “Sustainability Week” veranstaltet. Eine Woche lang ging es in Diskussionsrunden und Workshops um “Green Claims”, Strategien für die interne Umsetzung der CSRD-Nachhaltigkeitsberichtspflicht, Finanzierungen und das gegenseitige Inspirieren. Also immer auch um die Frage, wie man in der Wirtschaft schneller vorankommt mit der Nachhaltigkeit. “Wir brauchen mehr Menschen, die beharrlich an diesen Themen dranbleiben”, sagte Antje Meyer beim Auftaktfrühstück.
Meyer weiß, wovon sie spricht. Sie versucht selbst, beharrlich zu sein. Seit rund 20 Jahren schon und in verschiedenen Positionen. Einerseits in der IHK, in der sie als ehrenamtliche CSR-Sprecherin dem Ausschuss Nachhaltige Metropole vorsitzt und beispielsweise die Nachhaltigkeitswoche mit angestoßen hat. Andererseits als Unternehmerin, die bereits mehrere Firmen und Netzwerke gegründet und sich über die Jahre zunehmend auf die Transformation spezialisiert hat.
Wobei ihr persönlicher Fokus gar nicht so leicht zu beschreiben ist, wie sie sagt. Häufig sei sie auf der Metaebene unterwegs, um Teams und Führungskräfte zu entwickeln. “Damit das gelingt, erstelle ich Grund-Anamnesen von Organisationen und baue anschließend Verhandlungsräume, in denen Menschen ihre Möglichkeiten neu ausloten.”
Ihre erste berufliche Begegnung mit Fragen der Nachhaltigkeit hatte sie Anfang der 2000er-Jahre, ein paar Jahre nach Gründung ihrer Full-Service-Agentur Orangeblue. Kunden aus der Lebensmittelbranche wollten wissen, was es mit “Corporate Social Responsibility” und “Corporate Volunteering” auf sich habe. Meyer begann, sich mit regionalen Lieferketten und dem Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit und der Leistungsfähigkeit im Job auseinanderzusetzen. Sie wollte aber nicht nur reagieren, sondern agieren können, wie sie sagt. Sie nahm Kontakt zu Wissenschaftlern auf, etwa bei der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, die kurz zuvor ihren ersten Studiengang mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestartet hatte. So fing sie an, ihr eigenes Netzwerk aufzubauen.
Wenig später, 2007, setzte sie das bei der IHK fort. Sie wurde in die Vollversammlung gewählt und ins Präsidium berufen und machte sich im Herzen der Institution, die heute mehr als 300.000 Mitgliedsunternehmen vereint, für CSR stark. Erste Interessen formulieren, sich austauschen und weiterbilden, etwa durch Besuche bei beispielhaften Sozialunternehmen – darum ging es damals.
In den folgenden Jahren machte Meyer zwei Beobachtungen. Zum einen fand sie in Teilen verkrustete Strukturen mit “alteingespielten Systemen” und Widerständen vor. Zum anderen traf sie zahlreiche Menschen, die es ernst meinen mit der Nachhaltigkeit. “Meine Erfahrung ist: Wer sich auf die Organisation einlässt, Fragen stellt und den Willen signalisiert, etwas anstoßen zu wollen, der kommt weiter und kann eine Bewegung auslösen.”
Außerhalb der IHK war es ähnlich. “Ich bekomme ständig ‘Ja, aber’ zu hören”, so Meyer. “Unsere Welt besteht aus ‘Ja, abers'”. Zugleich fand sie auch hier immer mehr Gleichgesinnte, mit denen sie intensiver zusammenarbeiten wollte. 2016 löste sie deshalb ihre Agentur Orangeblue auf, die nicht auf Nachhaltigkeit spezialisiert war, und gründete stattdessen mit elf anderen die Genossenschaft Sustainable Natives. Heute zählen im Kern 30 Mitglieder sowie rund 300 assoziierte Expertinnen und Experten dazu. Das Netzwerk ist eine Anlaufstelle für Unternehmen, die Unterstützung benötigen. Wird der Bedarf konkret und ein Projekt definiert, wird ein für diesen Auftrag passendes Team zusammengestellt.
Wer dabei ist, hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab, die soziale Themen, ökonomische Fragen, CSRD-Berichterstattungen, die Weiterbildung von Mitarbeitenden und die Kultur ganzer Organisationen umfassen kann. Ein weiterer Baustein von Meyers Angebot sind Beratungen zur Digitalisierung, die sie in der 2022 zusätzlich gegründeten Agentur Nextblooming gebündelt hat. “Innovationen für die nachhaltige Transformation” will sie darüber entwickeln und vermitteln.
So vielfältig ihre Aktivitäten sind – das übergeordnete Ziel, das Meyer verfolgt, ist immer das gleiche. “Es geht nicht darum, dass Nachhaltigkeitsabteilungen größer werden müssen. Es geht darum, dass alle in einem Unternehmen Nachhaltigkeit draufhaben.” Dass das Zeit benötigt, weiß sie. “Das ist wie Buchhaltung – das lernt man nicht in einem Semester.” Sie spürt, dass “das Stresslevel der Wirtschaft maximal hoch” ist, auch aufgrund der zunehmenden ESG-Regulatorik. Abzuwarten, bis sich das wieder ändert, kann aber keine Option für sie sein. Das vergrößere die Dringlichkeit nur umso mehr. Stattdessen müsse es darum gehen, vor allem eins zu bleiben: beharrlich. Marc Winkelmann
Agrifood.Table – GAP nach 2027: Welche fünf Knackpunkte vor der nächsten Reform debattiert werden: Die nächste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist eine der wichtigsten Aufgaben, die nach der Europawahl auf die EU-Institutionen zukommt. Zum Artikel
China.Table – Batterien: Wie Bidens Zölle Europas Industrie in Bedrängnis bringen: Für Europa kommen die Zölle zu einer ungünstigen Zeit. Sie könnten zu noch mehr Importen aus China führen. Der Markthochlauf europäischer Batteriefabriken wird damit noch schwieriger. Zum Artikel
Climate.Table – Ökonomische Schäden des Klimawandels größer als bisher angenommen: Steigende Temperaturen haben offenbar größere Auswirkungen auf die Wirtschaft als gedacht. Eine neue Studie hat die Auswirkungen von globalen Temperaturschocks – statt lokalen Temperaturveränderungen – auf die Wirtschaftsentwicklung untersucht. Zum Artikel
