am Donnerstag beginnt in Dubai die 28. UN-Klimakonferenz. 70.000 Gäste erwarten die Organisatoren, so viele wie nie zuvor, und neben Bundeskanzler Olaf Scholz, den grünen Bundesministern und König Charles wird auch Papst Franziskus anreisen. Nicht teilnehmen werden hingegen die Präsidenten der USA und Chinas, Joe Biden und Xi Jinping.
Die COP28 ist die wahrscheinlich wichtigste seit der Konferenz 2015 in Paris – warum, weiß Bernhard Pötter. Welche drängenden Themen und offene Fragen auf dem Programm stehen, erklärt er in seinem Ausblick. Er und sein Team berichten ab sofort täglich aus Dubai. Dazu werden zahlreiche weitere Analysen, Hintergründe und Interviews verschiedener Table-Briefings kommen – und Sie können die Berichterstattung auf unserer neuen Website verfolgen. Dort finden Sie alle Texte, darunter zum Beispiel auch mein heutiges Porträt von Sultan Ahmed al Jaber, dem umstrittenen und widersprüchlichen COP-Präsidenten.
Empfehlen möchte ich Ihnen zudem noch ein Interview, das Caspar Dohmen geführt hat. Er hat sich von einem Ökonomen und Politikwissenschaftler erklären lassen, ob bei der Einführung der Schuldenbremse jemals die Frage im Raum stand, ob diese der Finanzierung der Transformation im Wege stehen könnte. Spoiler: Nein, daran wurde nicht gedacht. Was jetzt dazu führt, dass über den Sinn und Unsinn des Instruments gestritten wird. Ausgang: offen.


In Dubai findet in diesem Jahr mit der COP28 die wichtigste UN-Klimakonferenz seit dem Pariser Gipfel von 2015 statt. Erstmals ziehen die etwa 200 Staaten der Rahmenkonvention UNFCCC mit dem “Global Stocktake” eine offizielle Bilanz ihrer Anstrengungen und legen wichtige Fundamente für künftige Maßnahmen.
Offiziell soll der Global Stocktake (GST) in eine rechtlich bindende Entscheidung der Konferenz münden: Was darin steht und welche Rahmenbedingungen für die Zukunft daraus folgen, wird bis zur letzten Minute hart umkämpft sein. Denn diese Leitplanken sollen sich in den nächsten Klimaplänen der Länder (NDC) wiederfinden, die 2025 vorgelegt werden sollen.
Wie schon in den letzten Jahren bietet auch die COP28 jeden Tag thematische Schwerpunkte und ein umfangreiches Programm von “Side Events“, Foren, Gipfeln und Präsentationen: Besondere Thementage gibt es etwa zu Energie, Technologie, Artenschutz, Jugend oder Indigene. Zum ersten Mal wird auch Gesundheit im Fokus stehen. Erstmals gibt es auch einen eigenen Sondergipfel zu Klimaschutzaktionen von Städten und Gemeinden.
Darüber hinaus werden die Debatten auf und hinter den offiziellen Bühnen von weiteren Fragen geprägt. Diese entscheiden mit darüber, ob das Ergebnis der COP28 mehr oder weniger ehrgeizig ausfällt.
Der Krieg zwischen der islamistischen Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee in Gaza schwebt als Drohung über der COP28. Israel ist UNFCCC-Mitglied und verhandelt mit. Pro-palästinensische Gruppen haben bereits Demonstrationen angekündigt – die aber auf dem Konferenzgelände nach UN-Regeln untersagt sind. Zu Beginn des Krieges gab es Gerüchte, die Konferenz würde bei einer Eskalation möglicherweise verschoben, davon ist nicht mehr die Rede.
Neben einer allgemein verschärften Spannungslage birgt der Krieg ein Risiko für die Verhandlungen: Weil Israel als Teil des Globalen Nordens wahrgenommen wird und sich auf der Seite der Palästinenser die meisten Länder des Globalen Südens versammeln, könnte der Konflikt als Teil des Nord-Süd-Konflikts um Entwicklungschancen und historische Verantwortung gelesen werden – was beim Überfall Russlands auf die Ukraine nicht der Fall war. Die COP im letzten Jahr blieb deshalb auch praktisch unberührt von dem Konflikt.
Die Berufung von Sultan al Jaber (siehe Porträt), Industrieminister der VAE und Chef des Ölkonzerns ADNOC, zum COP-Präsidenten hat viel Kritik ausgelöst: Öl- und Gasinteressen würden die Klimakonferenz übernehmen, so der Vorwurf. Dagegen setzen die VAE eine andere Erzählung: Demnach haben sie sich in eine Zukunft der Erneuerbaren aufgemacht. Die Hoffnung ist, dass sie andere Staaten mitziehen können, deren Volkswirtschaften auf Kohle, Öl und Gas beruhen. Wie sehr al Jaber als COP-Präsident beiden Seiten Zugeständnisse machen und im Gegenzug von ihnen Fortschritte einfordern kann, wird darüber entscheiden, ob es in den zentralen Fragen wirklich vorangeht.
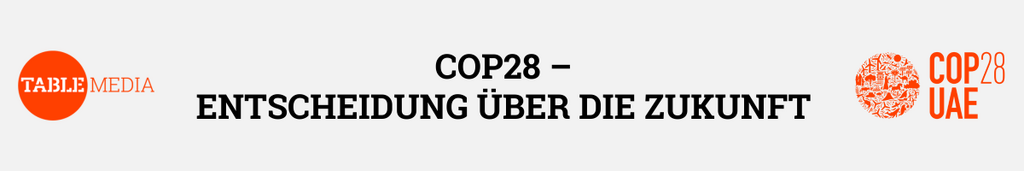
Bisher ist klar: Für Klimaschutz, Anpassung und Technologietransfer zahlen nur die UN-Länder, die 1992 beim Beschluss der Klima-Rahmenkonvention als Industrieländer (“Annex I”) galten. Weil die Welt sich verändert hat und Staaten wie Korea, Singapur, Mexiko, eventuell China und manche Ölstaaten wie Saudi-Arabien absolut und pro Kopf zu den reichen Ländern mit hohem CO₂-Ausstoß gehören, stellen die Industriestaaten immer lauter die Frage: Wann kommt auch Geld von ihnen?
Im neuen “Loss and Damage”-Fonds (LDF) etwa ist die Finanzierung ausdrücklich offen formuliert. Aber wenn etwa in der letzten Nacht die VAE als Gastgeber einen Deal absichern wollen und Geld für den LDF versprechen, könnte das System ins Rutschen geraten. Die Konsequenzen wären schwerwiegend: Ist diese Linie einmal gefallen, würde eine internationale Debatte beginnen, wer wann aus welchen Gründen welche finanziellen Hilfen leisten kann.
Traditionell gibt es auf der COP nur dann Bewegung, wenn sich die beiden größten globalen Verschmutzer einig sind: Das Pariser Abkommen wurde ein Jahr vorher durch eine US-China-Kooperation aufs Gleis gesetzt. Die politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen Peking und Washington haben in den letzten Jahren allerdings auch die Kooperation beim Klima gebremst. Seit dem Treffen der Präsidenten Xi und Biden im November in Kalifornien ist zumindest klar: Sie reden wieder miteinander, wollen kooperieren und sogar die nationalen Klimaziele auf alle Branchen ausdehnen, was China bislang verweigert hat. Ob dieses leichte Tauwetter ausreicht, andere Differenzen auszugleichen (etwa beim Kohleausstieg, den die USA fordern und der gegen Chinas Interessen geht), wird sich erweisen.
Wenig hat die Verhandlungen in den letzten Jahren so belastet wie das gebrochene Versprechen der Industrieländer, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz im Globalen Süden zu mobilisieren. Nun hat die OECD verkündet, 2021 habe die Zahl bei 89,6 Milliarden gelegen und laut vorläufigen Daten sehe es so aus, als sei das Ziel “wahrscheinlich 2022 erreicht worden”. Ob die Schwellenländer das als positiven Trend akzeptieren, wird sich zeigen.
Ebenfalls bleibt spannend, ob sie die angekündigte Reform der Weltbank zu mehr Nachhaltigkeit zumindest als Anfang einer grundlegenden Reform des Weltfinanzsystems akzeptieren. Das hatte die “Bridgetown Intiative” der Premierministerin Mia Mottley von Barbados skizziert. Diese Forderung war seit der COP27 immer wieder laut geworden.
Vor dem Beginn der COP28 gab es aufregende Nachrichten von den Energiemärkten: Hat die Welt tatsächlich 2023 den Höhepunkt der CO₂-Emissionen erreicht? Und sehen wir wirklich gerade den “Peak Coal” in 2023, den “Peak Gas” für 2024 und den “Peak Oil” 2025, wenn die derzeitigen Wachstumsraten bei E-Autos und Erneuerbaren anhalten? Und was bedeutet das? Über das Ende des fossilen Booms streiten sich zumindest die Energieagentur IEA und die Öl-Organisation OPEC öffentlich.
Auf der COP28 soll ein “Global Goal on Adaptation” (GGA) beschlossen werden. Diese Debatte wirft ihre Schatten voraus – auch weil, anders als beim 1,5-Grad-Ziel, unklar ist, wie ein solches Ziel aussehen könnte. Aber es bringt die lange vernachlässigte und unterfinanzierte Anpassung vor allem in den armen Ländern wieder auf die Tagesordnung. Immerhin ist die Lücke gewaltig: Den Kosten von etwa 210 Milliarden US-Dollar jährlich für Anpassung stehen laut UN-Bericht internationale Gelder in Höhe von 21 Milliarden gegenüber. Und gerade die ärmsten und verletzlichsten Länder bekommen oft nur wenig Hilfe.
Alle bisher erschienenen Texte zur COP28 lesen Sie hier.

Herr Haffert, seit wann gibt es die Diskussion über die Schuldenbremse?
Diskussionen über derartige Regeln gibt es seit den 1980er-Jahren, als sich in der Ökonomie die Vorstellung etablierte, dass es Zeitinkonsistenzen im politischen Handeln gibt, Politiker also dazu neigen, Wählern vor der Wahl nichts zuzumuten, obwohl alle wissen, dass das längerfristig notwendig wäre. Diese Sichtweise setzte sich durch, weil die Wissenschaft überrascht war, wie lange sich die Wirtschaftskrise der 1970er-Jahre in den Haushalten widerspiegelte. Der angebliche Politikfehler sollte korrigiert werden, indem Schuldenregeln eingeführt werden.
War das der richtige Schluss?
Rückblickend betrachtet hat man ein spezifisches Zeitphänomen zu sehr für ein allgemeines Problem der Demokratie gehalten. Später sahen wir in Deutschland und anderen Ländern, dass auch eine Haushaltspolitik mit Überschüssen sehr populär sein kann. Man kann also keineswegs sagen, dass Politik immer einen Anreiz hat, mehr Schulden zu machen.
Wie viele Staaten haben mittlerweile Schuldenbremsen?
Laut der Datenbank des Internationalen Währungsfonds haben inzwischen 111 Länder verschiedene Formen fiskalischer Regeln, auch autokratische Staaten. Allerdings sind solche Regeln, anders als die Schuldenbremse, längst nicht überall in der Verfassung verankert.
Als die Staaten begannen, Schuldenbremsen einzuführen, war der Klimawandel bereits ein großes Thema, 1992 etwa in Rio. Hat sich die Politik damals mit der Frage beschäftigt, ob Schuldenbremsen staatliche Ausgaben für die Transformationsbewältigung verhindern könnten?
Mir ist kein politischer Kontext bekannt, in dem es eine Rolle spielte. Allerdings gab es lange Zeit auch die Neigung der Politik, die Kosten für wirksamen Klimaschutz ein bisschen zu negieren, um die Bürger mitzunehmen. Die Haltung findet sich noch immer bei politischen Akteuren.
Lange verschwieg die Politik Bürgern also die wahren Kosten der Bekämpfung der Klimakrise?
So kann man es sagen. Inzwischen gibt die Ampel-Regierung immerhin zu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Unglücklicherweise sind aber nun wegen diverser Krisen die Mittel knapp. Wir ständen anders da, wenn die Politik während der Zeit der schwarzen Null einen Klima-Transformationsfonds aufgebaut hätte.
Welche Auswirkungen erwarteten Befürworter der Einführung von Schuldenbremsen grundsätzlich auf die Investitionen?
Gerade Parteien der linken Mitte sahen ein Problem für die öffentliche Hand darin, dass bei höheren Schulden die Zinskosten steigen und damit der Spielraum für Investitionen sinkt. Durch die Schuldenbremse wollten sie den Mechanismus umkehren und mehr Spielraum für Investitionen schaffen. Viele waren auch überzeugt, die Schuldenbremse führe dazu, dass der Staat unsinnige Konsumausgaben streicht, Investitionen aber verschont. Allerdings war es weder theoretisch noch empirisch gerechtfertigt, anzunehmen, Regierungen würden ausgerechnet diese Priorisierung vornehmen. Es passierte auch nicht.
Hätte man das in den 1990er-Jahren bereits wissen können?
Zumindest gab es da schon die Beispiele von Margret Thatcher und Ronald Reagan. Die wollten den Wohlfahrtsstaat ja sogar aus ideologischen Gründen zusammenkürzen, und trotzdem gingen die Sozialausgaben kaum zurück. Leuten etwas wegzunehmen, ist halt wahnsinnig schwierig in einer Demokratie.
Warum gewann das Thema der Schuldenbremse in der Politik eine so große Bedeutung, obwohl damit keine Inhalte verbunden sind?
Um das zu verstehen, ist es hilfreich, weiter zurückzuschauen. Ab dem Ende der 1960er-Jahre gab es eine Entideologisierung der politischen Debatte – für lange Zeit. Das ändert sich vielleicht gerade mit dem Aufstieg der Rechten wieder ein bisschen. Aber nehmen Sie den Wahlkampfslogan von Gerhard Schröder: “Nicht alles anders, aber vieles besser machen”. Das war ein unideologischer Appell, die eigentliche politische Auseinandersetzung erfolgte über Kompetenz. Das Management der Staatsverschuldung ist dafür ein prototypisches Thema. Alle Parteien können sich darauf abstrakt einigen, dass der Staat nicht völlig über seine Verhältnisse leben soll. Gerade für Linke war es attraktiv, diese Kompetenzbehauptung mit einem Bekenntnis zu Schuldenregeln zu belegen.
Ist die Bedeutung der Schuldenbremse in der Politik ein deutsches Phänomen?
Nein, es gibt da keinen deutschen Sonderweg. Die Vorstellung, die Deutschen hätten diesen schwäbischen Hausfrau-Knacks, ist ein Mythos. Den Trend sehen wir in vielen westlichen Ländern, nachdem sich die politischen Lager eben nicht mehr über das grundlegende Verhältnis von Staat und Markt streiten konnten, weil sie sich politisch angenähert hatten.
Gibt es Beispiele dafür, dass Regierungen in Haushalten Konsumausgaben in Investitionen umgeschichtet haben?
Das klingt in der Theorie gut, gelingt aber in der Praxis eigentlich nie. Wenn der Politik größere Investitionen gelingen, kommt das Geld dafür üblicherweise aus freien Mitteln. Diese kommen beispielsweise zustande, wenn Staatseinnahmen schneller wachsen als die Ausgaben. Die Differenz kann der Staat investieren, wie zur Zeit der jüngsten Großen Koalition. Jetzt haben wir eine andere Situation, weswegen die Bundesregierung die freien Mittel anderweitig beschaffen muss. Aber die Investitionen zu erhöhen, indem die Politik in einem existierenden Haushalt umschichtet, funktioniert gewöhnlich nicht. Und das bringt auf gar keinen Fall die 60 Milliarden Euro, die man jetzt braucht.
Demokratische Staaten erhöhten in Notlagen drastisch die Steuern, wie die USA und Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. Warum tun Regierungen dies nicht ebenso angesichts der Klimakrise?
Dafür brauchen sie die Unterstützung der Mittelschichten, die anders als damals über größere Vermögen verfügen und gleichzeitig mehr daraus finanzieren müssen, etwa ihre private Altersvorsorge oder in den USA die teure Ausbildung ihrer Kinder. Es fällt Menschen schwerer zu sagen, ich zahle mehr in den gemeinsamen Topf, wenn sie gleichzeitig aus ihrem eigenen Einkommen mehr bezahlen müssen. Andererseits halte ich die Angst vor Kapitalflucht in großem Ausmaß bei einer Anhebung der Kapitalsteuern für übertrieben.
Gibt es nicht Argumente, Vermögendere dafür zu gewinnen, höhere Steuern für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu akzeptieren, etwa durch einen Klimasoli?
Das ist noch nicht versucht worden. Aber tatsächlich fördert die Bindung von Einnahmen an konkrete, damit zu finanzierende Ziele die Zahlungsbereitschaft. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Ausschlaggebend dafür ist, dass das Geld nicht im allgemeinen Haushalt versickert, sondern einer bestimmten Verwendung zufließt. Das könnte möglicherweise auch für die Dekarbonisierung oder den Erhalt der Biodiversität gelten. Für die Politik wäre es wahrscheinlich aussichtsreicher, auf diesem Weg einen Transformationsfonds zu füllen, als für eine allgemeine Anhebung des Spitzensteuersatzes oder der Erbschaftssteuer zu streiten.
Ist Ordnungspolitik zur Bewältigung der Transformation eine Alternative zu Subventionen?
Unter dem Begriff wird ja momentan vor allem ein höherer CO₂-Preis diskutiert. Denkt man den Begriff breiter, heißt Ordnungspolitik ja aber erstmal: arbeiten mit Regeln statt mit Subventionen. Will ich CO₂ einsparen, kann das also auch bedeuten, etwas zu verbieten. Eigentlich wäre es doch reizvoll, wenn die Grünen jetzt sagen würden: Ihr sagt immer, wir wollen alles verbieten. Das wollen wir gar nicht. Aber jetzt, wo Geld fehlt, bleibt dem Staat keine andere Wahl als Verbote, etwa durch ein Tempolimit die CO2-Emmissionen zu senken. Noch traut sich das niemand.
Ist eine Erhöhung der CO₂-Preise eine Lösung?
Natürlich kann man mit höheren Preisen Verhalten verhindern. Mit dem Klima- und Transformationsfonds will die Bundesregierung ja aber aktiv eine Lenkung hin zu etwas erreichen. Nur weil man den CO₂-Preis erhöht, entstehen ja nicht automatisch Batterie- und erst recht keine Chipfabriken. Hinzu kommen die heftigen verteilungspolitischen Wirkungen einer CO₂-Preiserhöhung, wenn nicht gleichzeitig ein Klimageld gezahlt wird.
Oft warnen Experten, hoch verschuldete Staaten machten sich von den Finanzmärkten abhängig. Aber Japan hat ein Vielfaches der Staatsschulden Deutschlands und steht nicht schlechter da…
Am Markt verlangt niemand, Deutschland dürfe jetzt keine weiteren Schulden aufnehmen. Vielmehr haben die Bürger selbst, vermittelt über ihre politischen Institutionen, diese Selbstbeschränkung herbeigeführt. In Japan hat man sich kein solches Eigentor geschossen.
Reicht Geld zur Lösung der Klimafrage?
Sicher nicht. Man sollte auch nicht die Fähigkeiten staatlicher Lenkung überschätzen. Am Ende ist das Klimaproblem ein Demokratieproblem. Die entscheidende Frage ist, ob die demokratischen Institutionen mit nahenden, aber noch nicht eingetretenen Problemen umgehen können. In jedem Fall erschwert die Schuldenbremse dies.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht die Finanzierung wichtiger Transformationsprojekte auf dem Spiel. Für das kommende Jahr geplante Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe für industriepolitische Maßnahmen und die Energiewende fallen entweder weg oder sie müssen durch Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden. Davon könnte auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) betroffen sein.
Der Etat des BMZ hatte bereits im Sommer reichlich Federn lassen müssen, als das Kabinett monatelang über den Bundeshaushalt 2024 stritt. Am Ende sollte das Ministerium von Svenja Schulze (SPD) 640 Millionen Euro einsparen. Mit 11,5 Milliarden Euro lag der Etat rund fünf Prozent unter dem des Vorjahres. Die Finanzplanung für 2025 sieht eine weitere Absenkung auf 10,3 Milliarden Euro vor.
Åsa Månsson, Geschäftsführerin des entwicklungspolitischen Dachverbands VENRO, nannte die Kürzungen bei einem Protest Mitte November “nicht nur kurzsichtig, sondern unverantwortlich” und sprach von einer “Gefahr für das gesamte System der internationalen Zusammenarbeit”. Ihre Organisation rechnete vor, dass der BMZ-Etat in der Zeit der Ampelregierung von 2022 bis 2025 um 3,5 Milliarden Euro sinken würde. Das entspräche 25 Prozent.
Auch Volkmar Klein, Sprecher für Entwicklungspolitik der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, kritisiert die für 2024 geplante “dritte Kürzung im dritten Regierungsjahr”. Er prognostizierte gegenüber Table.Media, Entwicklungsministerin Schulze werde “das Versprechen des Koalitionsvertrags, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsarbeit aufzubringen, künftig kaum noch halten können”. So viel sollen die reichen Länder nach dem Willen der Vereinten Nationen mindestens für die öffentliche Entwicklungshilfe bereitstellen.
In der Bereinigungssitzung im November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages einen Teil der Kürzungen in Höhe von 114 Millionen Euro zurück. “Diese Steigerung mildert die anfänglich vorgesehenen Kürzungen und zeigt ein positives Ergebnis unserer parlamentarischen Arbeit. Allerdings bleiben die Bedarfe angesichts der aktuellen globalen Krisen weiterhin hoch”, sagte Deborah Düring, entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, auf Anfrage.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze hatte eigentlich eine Ausweitung des Engagements angekündigt. “Wir haben enorm viel aufzuholen, um die Ziele der Entwicklungsagenda 2030 zu erreichen”, sagte sie nach ihrem Amtsantritt. “Beim weltweiten Klimaschutz ist mein Leitbild die Just Transition als Teil einer globalen gestaltenden Strukturpolitik. Es geht darum, die Transformation zur Klimaneutralität mit sozialem Ausgleich zu verbinden.”
Laut dem Sustainable Development Report (SDR) hat Deutschland hier eine erhebliche Bringschuld. Der SDR analysiert jedes Jahr, wie weit die einzelnen Länder bei der Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (SDG) gekommen sind. Erarbeitet wird der Report vom Sustainable Development Solutions Network (SDSN), einem globalen Wissenschaftsnetzwerk unter Leitung des US-Ökonomen Jeffrey Sachs.
Der SDR dokumentiert aber nicht nur die Fortschritte bei den SDGs, sondern auch, inwieweit die Wirtschaftsweise und das Konsumverhalten eines Landes die nachhaltige Entwicklung anderer Länder beeinflusst. Dieser Effekt wird als Spillover bezeichnet. Ein Ranking, bei dem 100 Punkte erreicht werden können, zeigt an, wie negativ diese Auswirkungen sind. Je niedriger die Punktzahl, desto negativer sind die Folgen für andere Länder.
In diesem Spillover-Ranking liegt Deutschland seit Jahren auf den hinteren Plätzen. Im SDR für 2023 belegt die Bundesrepublik mit 65,2 Punkten lediglich Platz 144 von 166 Ländern. Damit schneidet Deutschland sogar deutlich schlechter ab als der Durchschnitt der OECD-Staaten mit 73,8 Punkten.
Bei einem weiteren Index, dem Global Commons Stewardship Index, gehört Deutschland ebenfalls zu den Schlusslichtern. Dieser Index, der ebenfalls von SDNS erstellt wird, misst die negativen Spillover-Effekte eines Landes auf die globalen Gemeinschaftsgüter. Dabei werden sechs Faktoren aus den Bereichen Emissionen, Biodiversität und Kreislauffähigkeit zugrunde gelegt. Auch hier schneidet Deutschland mit 18,3 von 100 möglichen Punkten schlecht ab. Der angerichtete Schaden an den globalen Gemeinschaftsgütern wird vom SDNS als “extrem” eingestuft.
“Deutschlands Ziel muss sein, negative Spillover-Effekte zu vermeiden, um andere Länder nicht in der Umsetzung der Agenda 2030 zu behindern”, forderten Leonie Droste und zwei weitere Wissenschaftler des SDSN Germany in einem Artikel im Mai. Dafür sei die “klare Adressierung negativer Spillover-Effekte und das Schaffen verbindlicher Strukturen in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie” notwendig.
Dazu sei das BMZ bereit, wie eine Sprecherin gegenüber Table.Media erklärte. So sollen in der Nachhaltigkeitsstrategie “künftig noch systematischer als bisher globale Zusammenhänge berücksichtigt werden”. Denn negative Spillover-Effekte wie schlechte Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung entlang globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten würden die betroffenen Länder bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausbremsen. Die Messung von Spillover-Effekten sei jedoch komplex. Deshalb fördere das BMZ seit Jahren das SDSN, das sich als Referenz für Spillover-Effekte etabliert habe.
30. November, 15:00-16:15 Uhr
Webinar Greening global energy grids with AI and connectivity (OECD) Info & Anmeldung
2. Dezember, 7:00-7:45 Uhr
Webinar How Global Financial Regulation Can Encourage More Climate Investment (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
3. Dezember, 11:00-12:30 Uhr
Webinar Transition Finance: From Implementation to Impact (EU) Info & Anmeldung
4. Dezember, 6:00-6:45 Uhr
Webinar Women as Catalysts for Climate Action for a Livable Planet (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
4. Dezember, 10:00-11:00 Uhr
Webinar Monitoring green financial flows (EU) Info & Anmeldung
4. Dezember, 13:30-14:30 Uhr
Webinar International Platform on Sustainable Finance (IPSF) – Annual Event Info & Anmeldung
5. Dezember, 12:30-14:00 Uhr
Webinar What we can learn from Slovenia: The role of the construction industry in national circular economies – challenges and opportunities (EU) Info & Anmeldung
6. Dezember, 12:30-14:00 Uhr
Webinar Jobs and skills for a just green transition (OECD) Info & Anmeldung
9. Dezember, 6:00-6:45 Uhr
Webinar Defining Pathways for Nature Finance (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
10. Dezember, 8:00-9:00 Uhr
Webinar Accelerating the financing of the circular economy in climate and biodiversity strategies (EU) Info & Anmeldung
12. Dezember, 10:30-12:00 Uhr
Webinar Reaching climate neutrality for the Hamburg economy by 2040 (OECD) Info & Anmeldung
Auftakt der neuerlichen Haushaltsdebatte war eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag, in der er den Willen zum Festhalten an den Transformationsprojekten der Ampelkoalition betonte. Zur Finanzierung äußerte er sich nicht. Einen vorläufigen Höhepunkt wird das Thema am Freitagvormittag mit der ersten Lesung des von der Bundesregierung kurzfristig eingebrachten Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 erreichen.
Auf der Tagesordnung dieser Sitzungswoche stehen noch weitere Themen mit ESG-Bezug. So wird am Mittwoch der Bericht der Bundesregierung über Forschungsergebnisse zu Methoden der Ökobilanzierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden diskutiert. Am Donnerstagnachmittag steht ein von der Ampelkoalition eingebrachter Gesetzentwurf zum Übereinkommen Nr. 184 der Internationalen Arbeitsorganisation über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft zur Abstimmung.
Am frühen Donnerstagabend debattiert der Bundestag zudem über die Unterrichtung der Bundesregierung zum Nationalen Reformprogramm 2023. Dabei geht es um Maßnahmen zur Bewältigung zentraler gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen, wie die Verringerung der Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energieträgern durch eine beschleunigte Energiewende.
Am Freitag wird in erster Beratung ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion diskutiert, Verbrennungsmotoren auch über das Jahr 2035 hinaus neu zuzulassen, sofern sie ausschließlich mit klimafreundlichen Kraftstoffen betrieben werden. Außerdem gibt es eine vereinbarte Debatte zur Klimaaußenpolitik anlässlich der am Donnerstag beginnenden UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai. ch
Nur neun von 77 am Bündnis für nachhaltige Textilen beteiligte Unternehmen haben sich nach Informationen von Table.Media in einem offenen Brief für höhere gesetzliche Mindestlöhne in Bangladesch ausgesprochen. In den vergangenen Tagen hatten sich einige weitere und mit KiK und Boss auch zwei größere Unternehmen dazu entschlossen. Zu den Unterzeichnern gehören auch Vaude, Jako und Sympatex. Geworben hatten dafür die 14 im Textilbündnis vertretenen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Inkota, Südwind und Femnet: Mit dem gemeinsamen Brief an die Regierung von Bangladesch und den Wirtschaftsverband BGMEA sollte den Gewerkschaften bei ihren Lohnforderungen der Rücken gestärkt werden.
Am 7. November hatte die Regierung einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von 12.500 Taka (113 US-Dollar) festgelegt, die erste Erhöhung seit fünf Jahren. Abzüglich der Inflation bedeutet dies laut dem Workers Rights Consortium ein Lohnplus von 14 Prozent gegenüber 2018. Die Gewerkschaften in Bangladesch hatten eine Erhöhung der Löhne auf 23.000 Taka (208 US-Dollar) gefordert, was immer noch hinter den Berechnungen für einen existenzsichernden Mindestlohn zurückbleibt, den etwa die Global Living Wage Coalition auf 235 US-Dollar veranschlagt. Am 26. November lief die Frist für Einsprüche beim Lohnausschuss Bangladesch aus.
Allerdings stehen die Textilunternehmen in Bangladesch auch unter erheblichem Preisdruck. Während der Pandemie hatten einige Kunden die Abnahmepreise teilweise um bis zu 50 Prozent gedrückt, heißt es in Branchenkreisen, von zwei US-Dollar etwa für eine Unterhose auf 80 Cent. Und diese Preise gelten teils immer noch. Das engt den Spielraum der Regierung in Bangladesch ein. Die gesetzlichen Mindestlöhne liegen auch in anderen textilen Produktionsländern deutlich unter einem existenzsichernden Lohn.
Die Textilindustrie ist die wichtigste Exportbranche von Bangladesch. Bei den Auseinandersetzungen um höhere Mindestlöhne war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Laut der Kampagne für saubere Kleidung kamen bereits vier Arbeiterinnen zu Tode, 115 wurden inhaftiert und gegen 23.000 Demonstrierende wurden Strafanzeigen erlassen. Mehr als 300 Fabriken hätten zwischenzeitlich die Lohnzahlungen verweigert.
Überraschend für Fachleute kommt die ablehnende Haltung der Mehrheit der Unternehmen aus dem Textilbündnis, weil einer der Schwerpunkte der von der Bundesregierung unterstützten Brancheninitiative das Thema existenzsichernde Mindestlöhne ist. Zudem mache die Arbeit der Multi-Stakeholder-Initiative mit rund 120 Mitgliedern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik nach Einführung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes nur dann Sinn, wenn sie höhere Standards in der textilen Lieferkette umsetze. cd
Ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, dass die Umstellung auf Erneuerbare Energien (EE) in vollem Gange ist. Zugleich werden jedoch weiter Summen in die Öl- und Gasförderung investiert, die mit dem Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius nicht vereinbar sind. Die internationale Organisation spart nicht mit Kritik an der Öl- und Gasindustrie, die gegenwärtig nur ein Prozent der weltweiten Investitionen in EE leistet. “Die Industrie muss sich dazu verpflichten, der Welt wirklich dabei zu helfen, ihren Energiebedarf zu decken und ihre Klimaziele zu erreichen”, sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.
Zugleich belegt der Bericht, dass Investitionen in EE im Vergleich zu denen in Öl und Gas seit 2020 bei Weitem überwiegen. Für Solar und Wind werden heute bereits 30 Prozent mehr neue Mittel bereitgestellt als für fossile Energieträger.
Dieser Zuwachs spiegelt sich auch in neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die zeigen, dass die Industrie in Deutschland ihre Investitionen in Klimaschutz seit 2011 um 74 Prozent gesteigert hat, davon knapp die Hälfte in Solar- und Windenergie. Weltweit müssten sich die aktuellen EE-Investitionen bis 2030 allerdings verdreifachen und die Fossilinvestitionen halbieren, um das 1,5-Grad-Ziel der Weltgemeinschaft noch realisieren zu können.
Der britische Ökonom Adam Tooze analysiert in einem Blogbeitrag die Strategien der Öl- und Gasindustrie. Insbesondere die saudi-arabische Aramco, die bei Weitem größte Erdölgesellschaft der Welt, investiert anders als ihre Konkurrenz massiv und sogar zunehmend in ihr Kerngeschäft. Das Kalkül ist anscheinend, dank der niedrigen Förderkosten im Mittleren Osten als eine der wenigen Ölfördergesellschaften übrigzubleiben, die 2050 noch existieren werden.
Dazu passt eine Undercover-Recherche des britischen Centre for Climate Reporting. Demnach plant Aramco milliardenschwere Investitionen in die fossile Energieversorgung in Afrika und Asien. Für Tooze stellt sich vor allem die Frage, wie die US-amerikanische Fossilindustrie mit dieser Herausforderung umgeht. “Das Interesse der US-amerikanischen Erdöl- und Erdgasinteressen besteht nicht darin, die Energiewende an sich zu stoppen”, kommentiert er. Vielmehr solle die Transition langsam genug erfolgen, um der Industrie “einen bedeutenden Weltmarkt zu sichern, damit sich die noch laufenden Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar lohnen.” av
Deutschland gehört zu den Regionen mit dem weltweit höchsten Verlust an Wasser durch die Klimaerhitzung. Wie der neue Montoringbericht zur “Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel” (DAS) zeigt, sind die Folgen weitreichend. So waren die vergangenen Jahre von starken regionalen Dürren geprägt. Vielerorts sanken die Grundwasserstände auf Rekordtiefe. Die Folge waren in manchen Jahren ein Rückgang der Ernten von Weizen und Silomais von 15 bis 20 Prozent. Die Wälder, insbesondere Fichtenbestände, litten ebenfalls unter dem Trockenstress und starben teils flächig ab. Durch die trockene Witterung kam es vor allem in den nordöstlichen Bundesländern zu großen Waldbränden. Hinzu kamen erstmals Hitzewellen mit Temperaturen über 40 Grad Celsius nördlich von Hamburg, sowie weitreichende Veränderungen in den Ökosystemen in den Meeren und an Land.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach von “verheerenden Folgen der Klimakrise”, die “sich auf die Gesundheit der Menschen, die Ökosysteme und die Wirtschaft” auswirken. Die Kommunen, so Lemke weiter, seien sich ihrer “entscheidenden Rolle” bei Vorsorgemaßnahmen zunehmend bewusst.
Dabei würden sie von der Bundesregierung durch das Klimaanpassungsgesetz und der zugehörigen Strategie, der Nationalen Wasserstrategie, dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und mehreren Förderprogrammen unterstützt. Der Präsident des Bundesumweltamts, Dirk Messner, ergänzte mit optimistischen Einschätzungen: “Neben den Schäden zeigt der Bericht auch, dass Anpassungen vor Ort wirken. Die Zahl der Hitzetoten konnte durch gezielte Informationskampagnen reduziert werden.” Zudem arbeiteten Bund und Länder an der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen und Böden. Die Bundesregierung legt künftig alle vier Jahre einen Monitoringbericht zur DAS vor, wie es das Klimaanpassungsgesetz verlangt. Damit soll die Umsetzung messbarer Ziele nachvollzogen werden können. av
Vergangene Woche hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit großer Mehrheit für eine Resolution zur Zusammenarbeit in der internationalen Steuerkooperation gestimmt. Eingebracht von der Gruppe der afrikanischen Länder, wurde die Resolution von 125 Ländern angenommen. 48 Länder aus dem Globalen Norden, darunter Deutschland, stimmten dagegen. Damit geht der Streit, ob die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit ihren 38 Mitgliedsstaaten oder die viel größeren Vereinten Nationen für dieses Feld der internationalen Zusammenarbeit federführend sein sollen, in eine neue Runde. Martin Kimani, Repräsentant von Kenia bei den Vereinten Nationen, kommentierte das Abstimmungsergebnis als “das eindeutigste Votum des globalen Nordens gegen den globalen Süden, das ich in letzter Zeit gesehen habe.”
Im Auftrag der G20, der Gruppe der großen Industriestaaten, hat die OECD in den vergangenen Jahren ein Rahmenabkommen für eine globale Mindestbesteuerung großer Konzerne ausgearbeitet, das vor einigen Wochen in deutsches Recht übernommen worden ist. Zwar traten auch viele Länder aus dem globalen Süden dem Abkommen bereits bei, kritisierten aber zugleich den darin vorgesehenen niedrigen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Zudem befürchten viele Länder, von den OECD-Regelungen nicht zu profitieren. Insbesondere die Gruppe der 77 (G77), in der sich viele Länder aus dem globalen Süden zusammengeschlossen haben, forderte daher ein “inklusives und effektives” Abkommen auf UN-Ebene ein.
Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und die Ökonomin Jayati Ghosh, Ko-Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für die Reform der Internationalen Unternehmensbesteuerung (ICRICT), sahen in der UN-Initiative die Chance zum “Ausbau der internationalen Steuerzusammenarbeit, der Bekämpfung illegaler Finanzströme und den Kampf gegen aggressive Steuervermeidung und -hinterziehung”. Die Europäische Union hingegen vertrat die Ansicht, ein UN-Steuergremium berge das Risiko, bestehende Abkommen zu duplizieren. av
Bloomberg will es Investoren erleichtern, die potenziellen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens auf jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen zu bewerten. Dafür hat der Informationsdienst die “Sector Impact Map” der Finanzinitiative des UN-Entwicklungsprogramms (UNEP FI) in sein ESG-Datenangebot integriert. Die Impact Map ordnet über 500 sektorale Aktivitäten 38 Wirkungsfeldern und den SDG zu. Sie unterscheidet zwischen positiven und negativen Auswirkungen, die ein Unternehmen auf Umwelt, Menschen und Wirtschaft haben kann.
“Indem wir die UN Sector Impact Map mit unseren umfassenden und qualitativ hochwertigen ESG-Daten verknüpfen, können wir unseren Kunden neue Erkenntnisse liefern”, sagt Patricia Torres, Global Head of Sustainable Finance Solutions bei Bloomberg. Dies helfe bei der Anpassung von Anlagestrategien.
Laut dem Global Impact Investing Network wuchs der Markt für Impact Investing im Jahr 2021 weltweit auf über eine Billion US-Dollar. Allerdings schätzt die UN Sustainable Development Group die Finanzierungslücke für Entwicklungsländer zur Erreichung der SDG bis 2030 auf 2,5 bis 3 Billionen US-Dollar pro Jahr. ch
Unternehmen aus der Textil- und Rohstoffbranche haben zwar Prozesse aufgesetzt, die die Einhaltung von Menschenrechten entlang ihrer Lieferketten ermöglichen sollen, viele beteiligen Beschäftigte und etwa Anwohner von Betriebsgeländen aber nicht ausreichend. Das ist das Ergebnis des Corporate Human Rights Benchmark Reports 2023.
Solche Managementprozesse seien wichtig für Unternehmen, um zu verstehen, welchen Einfluss Geschäftstätigkeiten auf potenziell betroffene Menschen (Rechteinhaber) entlang ihrer Lieferketten haben, heißt es in der Studie. Wirken würden sie aber nur, wenn Unternehmen auch in den Austausch mit Rechteinhabern gingen, die ihnen aus ihrer Perspektive schildern könnten, welche Risiken es gibt. Dies hätten nur 27 Prozent der 110 untersuchten Firmen aus der Textil- und Rohstoffbranche nachweislich getan.
Auch bei Beschwerdemechanismen, die es Betroffenen erlauben, ihre Rechte geltend zu machen, hätten viele Unternehmen noch Nachholbedarf. Denn die Existenz eines solchen Mechanismus reiche nicht, vielmehr müssten Unternehmen Rechteinhaber an der Gestaltung beteiligen und die nötige Transparenz sowie Verlässlichkeit schaffen, damit die potenziell Betroffenen dem Prozess vertrauen. Doch nur 5 Prozent der Firmen hätten Nachweise dafür geliefert, dass sie vertrauensbildende Maßnahmen umsetzen. Bei Maßnahmen, die die Beteiligung und das Gefühl von “Ownership” fördern, seien es lediglich 10 Prozent der Firmen gewesen.
Die World Benchmarking Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, die für die nach eigenen Aussagen 2.000 einflussreichsten Unternehmen der Welt Maßstäbe für die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) entwickelt. Für den Corporate Human Rights Benchmark Report 2023 hat die Organisation 110 Unternehmen aus der Textil- und Rohstoffbranche untersucht. Basis für die Ergebnisse sind Informationen, welche die Firmen veröffentlichen – etwa auf ihrer Website oder in Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten. nh
Was sind die Grenzen von Staatsschulden – Makronom
Laut einem Autorentrio der Economists for Future basierten die derzeit geltenden rechtlichen Begrenzungen von Staatsverschuldung auf Mythen, die nicht ökonomisch fundiert seien. Sinnvoller wäre es daher, die Schuldenaufnahme so zu gestalten, dass sie die ökonomischen, sozialen und ökologischen Grenzen respektiert. Zum Artikel
Kohle, die nicht versiegt – TAZ
Subventionen für klimaschädliche Energien sollten bis Ende 2022 gestoppt werden, beschloss die vorletzte Klimakonferenz COP26. Malina Dittrich und Christian Jakob berichten, warum die Klimastrategie der Niederlande dieses Ziel untergräbt. Zum Artikel
“Ein Szenario ist es, die Fertigung in die USA zu verlagern” – SZ
Da die deutsche Solarindustrie mit der günstigen Konkurrenz aus China aktuell nicht mithalten kann, fordert sie eine “Resilienz-Quote” im Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Investoren belohnt, die besonders viele europäische Komponenten verbauen. Zum Artikel
Carbon-dioxide removal needs more attention – The Economist
Technologien, die CO₂ abscheiden und in die Erde verpressen, sind umstritten und nicht sehr entwickelt. Dieser Essay plädiert gerade deshalb für die Entwicklung und Anwendung – weil die Eindämmung des Klimawandels sonst nicht gelinge. Zum Artikel
“Fühlen uns als Steuereintreiber der Nation” – Tagesschau
Axel John recherchierte bei Speditionen, die sich Kostensteigerungen durch die LKW-Maut gegenübersehen. Diese soll klimafreundliche Transporte fördern – doch es fehlt an Alternativen. Elektrisch betriebene LKW seien rar und die wichtigsten Güterstrecken der Bahn bereits ausgelastet.
Zum Artikel
Anlage zur Lithium-Produktion aus dem Oberrheingraben eröffnet – Automobilindustrie
Lithium aus dem Oberrheingraben könnte bis zu 100 Prozent des deutschen Bedarfs decken. Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energy will ab 2026 aus dem heimischen Rohstoff jährlich 24.000 Tonnen Lithium für 500.000 Autobatterien produzieren. Produziert wird in Landau, raffiniert in Frankfurt-Höchst. Testkunden sind Stellantis, VW und Renault. Zum Artikel
New satellite will track CO₂ emissions from worst polluters from space for the first time – Euronews
Ein kanadischer Satellit ist zum ersten Mal in der Lage, spezifische CO₂-Emissionen von etwa Kohleförderungen aus dem All zu lokalisieren und zu messen. Die Initiatoren hoffen, dass der Wahrheitsgehalt von Angaben zum Ausstoß von Treibhausgasen von Ländern so künftig besser überwacht werden kann. Zum Artikel
US industry disposed of at least 60m pounds of PFAS waste in last five years – The Guardian
Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), sogenannte Ewigkeitschemikalien, gelten als gesundheitsgefährdend und sollen in der EU verboten werden. In den USA hat die Industrie in den vergangenen fünf Jahren mindestens 60 Millionen Pfund PFAS-Abfälle entsorgt – und wie Tom Perkins erklärt, könnten es noch weit mehr sein. Zum Artikel
Moroccogate: Corruption And Blood Renewables In The Western Sahara – Forbes
Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien unterzeichneten 2016 ein Abkommen mit Marokko zu erneuerbaren Energien. Doch die Wind- und Solarfarmen entstehen zum Teil in Westsahara, einem seit 1976 von dem nordafrikanischen Staat besetzten Gebiet. Elias Ferrer Breda berichtet über mutmaßlich illegale zukünftige Energieimporte in die EU. Zum Artikel
Hier liegen die Seltene-Erden-Minen, über die China lieber nicht spricht – Wirtschaftswoche
Eine Recherche der Wirtschaftswoche in Kooperation mit LiveEO zeigt mithilfe von Satellitenbildern, wo in China seltene Erden abgebaut werden und welche Folgen der Abbau der für die Energiewende wichtigen Rohstoffe für die Umwelt hat. Zum Artikel

Die Ablehnung war deutlich und sie kam zügig, nur zwei Wochen nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Sultan Ahmed Al Jaber Anfang Januar 2023 zum COP28-Präsidenten ernannt hatten. Mehr als 400 NGO formulierten einen offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, in dem sie forderten, dass die Personalie rückgängig gemacht werden müsse. Denn: Al Jaber, der CEO der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), sei alles Mögliche – aber kein Klimaschützer.
Zum Beweis listeten sie ein paar Fakten auf: Im weltweiten Ranking der größten Ölproduzenten liege ADNOC auf Platz 12, beim Ausstoß von Treibhausgasen nehme das Unternehmen Rang 14 ein. Und zur vorigen Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh hätten die VAE mehr Lobbyisten der fossilen Industrie mitgebracht als jede andere Nation.
Geändert hat das nichts. Wenn die “Conference of Parties” (COP) am Donnerstag in ihre 28. Runde geht, dann wird sie zum ersten Mal von einem Konzernchef geleitet. Von einem fossilen Konzernchef.
Dass der 50-Jährige einmal eine so prominente Rolle in der Weltpolitik übernehmen würde, war nicht unbedingt vorbestimmt. Er wuchs in Umm al-Qaiwan auf, dem kleinsten Scheichtum der Vereinigten Arabischen Emirate, abseits vom politisch dominierenden Dubai und dem erdölreichen Abu Dhabi. Für sein Studium – Chemieingenieurswesen und BWL – ging er nach Kalifornien. In England promovierte er in Wirtschaftswissenschaften. Dazwischen, 1998, begann er beim staatlichen Ölkonzern ADNOC, zunächst als Prozess- und Planungsingenieur in der Erdgasspalte.
Dort stieg er schnell auf, wechselte als Manager zur staatlichen Investmentgesellschaft Mubadala, gründete Masdar, einen Versorger für erneuerbare Energien, und wurde von den damals neuen Herrschern auf Weltreise geschickt. Ihr Ziel: die Diversifizierung ihrer Wirtschaft voranzutreiben und das Geschäft mit der sauberen Energie auszubauen. Nach Besuchen in 15 Ländern auf vier Kontinenten kam Al Jaber mit einem Plan zurück: Nahe des Flughafens Abu Dhabi solle Masdar City entstehen, eine CO₂-neutrale Stadt für 50.000 Einwohner, in der junge Menschen lernen, wie die nachhaltige Zukunft gestaltet werden kann.
Seitdem sind weitere Aufgaben dazugekommen. 2009 berief ihn UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon in seine Advisory Group on Energy and Climate, 2010 wurde er zum Klima-Sondergesandten der VAE, 2016 Vorstandschef von ADNOC und 2020 Industrieminister. Zwischenzeitlich übernahm er noch den Chefposten des National Media Council, außerdem sitzt er in mehreren Aufsichtsräten.
Die Beschäftigung mit der Energiewende, seine Besuche bei vorigen Klimakonferenzen und seine verschiedenen Einblicke und Kontakte in die Wirtschaft sind es denn auch, die Befürworter Al Jabers betonen. Frans Timmermans etwa sagte ihm jegliche Unterstützung zu, als er noch EU-Kommissar für Klimaschutz war. John Kerry, der US-Sondergesandte für Klimafragen, bezeichnete ihn als “hervorragende Wahl”. Kerry sieht in ihm einen Mittler zwischen den Welten. “Wenn er das nicht hinbekommt, wenn die Öl- und Gasindustrie nicht teilnimmt und keinen ernsthaften Beitrag leistet, dann werden die Vereinigten Arabischen Emirate sehr schlecht aussehen, und er weiß das.” Sollten sie sich dazu jedoch durchringen, könnten die Emirate zu einem “all-time catalyst” werden, zu einem Akteur, der an entscheidender Stelle den Schalter umgelegt hat.
Öffentlich bekennt sich Al Jaber zur Energiewende. “Das Herunterfahren der fossilen Energien ist unerlässlich”, sagte er dem “Time Magazine”. “Das müssen wir akzeptieren.” Zugleich erklärte er, dass die Welt noch nicht bereit dafür sei, ganz auf Öl und Gas zu verzichten. “Wir können nicht den Stecker des bisherigen Energiesystems ziehen, bevor wir ein neues aufgebaut haben.”
Sätze wie diese lassen Kritiker aufhorchen. Noch können sie keine Belege für ein glaubwürdiges Umschwenken der arabischen Ölwelt erkennen, im Gegenteil. Sie verweisen auf die 150 Milliarden US-Dollar, die alleine ADNOC in seine Expansion stecken will. Bis 2030 plant das Unternehmen, seine tägliche Förderung von heute knapp drei auf fünf Millionen Barrel zu steigern.
Und dann sind da noch Recherchen von Medien. Dem “Guardian” zufolge landeten Mails, die nur für die Konferenzorganisation bestimmt waren, auch auf den ADNOC-Servern. Die “BBC” meldete, dass VAE-Verhandler die politischen Gespräche während der COP auch für Geschäftsabschlüsse nutzen wollten. “Bloomberg” berichtete, dass das Unternehmen Masdar, laut eigener Aussage eines der größten für erneuerbare Energien, gemessen an der installierten Kapazität weltweit nur auf Platz 62 rangiert. Zudem wird Masdar City wohl frühestens erst 2030 fertig, und nicht wie geplant 2016. Bislang ist gerade mal ein Drittel der anvisierten Stadt errichtet.
Vor der Klimakonferenz war Sultan Ahmed Al Jaber wieder viel unterwegs, auf internationaler “Listening Tour”, wie es hieß. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Papst Franziskus, John Kerry, King Charles und andere hat er getroffen. Auf der COP28 muss er dieses Zuhören und Ausloten fortsetzen, wenn er die Konferenz zum Erfolg führen will. Erfahrung darin, die Interessen von fast 200 Staaten zu moderieren, hat er bislang nicht.
Seine eigenen Ziele – und die der Emirate – könnten dabei selbst zum Konfliktfeld werden. Das eine tun und das andere nicht lassen, das war bislang die Maxime: Die Erdölstaaten wollen das erneuerbare Business etablieren – und das fossile weiter ausbauen, bevor sie es dann womöglich zurückfahren. Gelingen soll der Spagat mit “Carbon Capture and Storage” (CCS), mit dem Abscheiden und unterirdischen Einlagern von klimaschädlichem Kohlendioxid. Die Technik soll das dreckige Verfeuern fossiler Rohstoffe künftig legitimieren. Ein Ansatz, den die UN ablehnen. Um das Pariser Abkommen einzuhalten, sei es nötig, aus allen sogenannten unverminderten fossilen Brennstoffen auszusteigen, sagt die Organisation.
Dass die teure, energieintensive und wenig ausgereifte Technologie zum Wandel bislang nur Kleinstmengen beigetragen hat, scheint ihn nicht zu stören. Er wettet auf die Zukunft und darauf, dass die globale Marktreife in ein paar Jahren erreicht wird.
Deutlich früher dürfte sich dagegen zeigen, ob ihm tatsächlich daran gelegen ist, die Welt vor dem Klimawandel zu bewahren. In 14 Tagen wird man mehr wissen über Sultan Ahmed Al Jaber. Marc Winkelmann

Zerstörerische Rohstoffausbeutung, unkontrollierte Konzernmacht, Staatsschuldenkrisen: Diese Probleme beschäftigten schon 1974 die Generalversammlung der Vereinten Nationen, als sie einen Aktionsplan für eine “New International Economic Order” (NIEO) beschloss. Gelöst sind sie heute, knapp 50 Jahre später, immer noch nicht. Prägend für das NIEO-Programm war die Auffassung, dass die Weltgemeinschaft wirtschaftliche Aktivitäten so lenken müsse, dass Armut und soziale Ungleichheit überwunden werden könnten. Auch der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt begeisterte sich für die NIEO und arbeitete mehrere Jahre an ihrer Umsetzung. Vergeblich, denn westliche Staaten weigerten sich, die UN-Beschlüsse einzuhalten.
Das Buch “Eine gerechte Weltwirtschaft? Die ‘New International Economic Order’ und die Zukunft der Süd-Nord-Beziehungen”, herausgegeben von Table.Media-Redakteur Alex Veit und dem China-Experten Daniel Fuchs, untersucht, ob das UN-Programm noch immer als Konzept für eine sozialökologische Transformation taugt. Wie sich zeigt, prägte die NIEO die Diskurse über eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung nachhaltig. Auch unser Redaktionsleiter Caspar Dohmen hat ein Kapitel beigesteuert, in dem er den Einfluss der NIEO auf die Fairtrade-Bewegung analysiert. Doch eine Neuauflage der NIEO, eine NIEO², müsste vor allem die Klimaerhitzung in den Mittelpunkt stellen. Der Band, erschienen im Transcript-Verlag, ist kostenfrei als E-Book und auf Papier in jeder Buchhandlung erhältlich. av
am Donnerstag beginnt in Dubai die 28. UN-Klimakonferenz. 70.000 Gäste erwarten die Organisatoren, so viele wie nie zuvor, und neben Bundeskanzler Olaf Scholz, den grünen Bundesministern und König Charles wird auch Papst Franziskus anreisen. Nicht teilnehmen werden hingegen die Präsidenten der USA und Chinas, Joe Biden und Xi Jinping.
Die COP28 ist die wahrscheinlich wichtigste seit der Konferenz 2015 in Paris – warum, weiß Bernhard Pötter. Welche drängenden Themen und offene Fragen auf dem Programm stehen, erklärt er in seinem Ausblick. Er und sein Team berichten ab sofort täglich aus Dubai. Dazu werden zahlreiche weitere Analysen, Hintergründe und Interviews verschiedener Table-Briefings kommen – und Sie können die Berichterstattung auf unserer neuen Website verfolgen. Dort finden Sie alle Texte, darunter zum Beispiel auch mein heutiges Porträt von Sultan Ahmed al Jaber, dem umstrittenen und widersprüchlichen COP-Präsidenten.
Empfehlen möchte ich Ihnen zudem noch ein Interview, das Caspar Dohmen geführt hat. Er hat sich von einem Ökonomen und Politikwissenschaftler erklären lassen, ob bei der Einführung der Schuldenbremse jemals die Frage im Raum stand, ob diese der Finanzierung der Transformation im Wege stehen könnte. Spoiler: Nein, daran wurde nicht gedacht. Was jetzt dazu führt, dass über den Sinn und Unsinn des Instruments gestritten wird. Ausgang: offen.


In Dubai findet in diesem Jahr mit der COP28 die wichtigste UN-Klimakonferenz seit dem Pariser Gipfel von 2015 statt. Erstmals ziehen die etwa 200 Staaten der Rahmenkonvention UNFCCC mit dem “Global Stocktake” eine offizielle Bilanz ihrer Anstrengungen und legen wichtige Fundamente für künftige Maßnahmen.
Offiziell soll der Global Stocktake (GST) in eine rechtlich bindende Entscheidung der Konferenz münden: Was darin steht und welche Rahmenbedingungen für die Zukunft daraus folgen, wird bis zur letzten Minute hart umkämpft sein. Denn diese Leitplanken sollen sich in den nächsten Klimaplänen der Länder (NDC) wiederfinden, die 2025 vorgelegt werden sollen.
Wie schon in den letzten Jahren bietet auch die COP28 jeden Tag thematische Schwerpunkte und ein umfangreiches Programm von “Side Events“, Foren, Gipfeln und Präsentationen: Besondere Thementage gibt es etwa zu Energie, Technologie, Artenschutz, Jugend oder Indigene. Zum ersten Mal wird auch Gesundheit im Fokus stehen. Erstmals gibt es auch einen eigenen Sondergipfel zu Klimaschutzaktionen von Städten und Gemeinden.
Darüber hinaus werden die Debatten auf und hinter den offiziellen Bühnen von weiteren Fragen geprägt. Diese entscheiden mit darüber, ob das Ergebnis der COP28 mehr oder weniger ehrgeizig ausfällt.
Der Krieg zwischen der islamistischen Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee in Gaza schwebt als Drohung über der COP28. Israel ist UNFCCC-Mitglied und verhandelt mit. Pro-palästinensische Gruppen haben bereits Demonstrationen angekündigt – die aber auf dem Konferenzgelände nach UN-Regeln untersagt sind. Zu Beginn des Krieges gab es Gerüchte, die Konferenz würde bei einer Eskalation möglicherweise verschoben, davon ist nicht mehr die Rede.
Neben einer allgemein verschärften Spannungslage birgt der Krieg ein Risiko für die Verhandlungen: Weil Israel als Teil des Globalen Nordens wahrgenommen wird und sich auf der Seite der Palästinenser die meisten Länder des Globalen Südens versammeln, könnte der Konflikt als Teil des Nord-Süd-Konflikts um Entwicklungschancen und historische Verantwortung gelesen werden – was beim Überfall Russlands auf die Ukraine nicht der Fall war. Die COP im letzten Jahr blieb deshalb auch praktisch unberührt von dem Konflikt.
Die Berufung von Sultan al Jaber (siehe Porträt), Industrieminister der VAE und Chef des Ölkonzerns ADNOC, zum COP-Präsidenten hat viel Kritik ausgelöst: Öl- und Gasinteressen würden die Klimakonferenz übernehmen, so der Vorwurf. Dagegen setzen die VAE eine andere Erzählung: Demnach haben sie sich in eine Zukunft der Erneuerbaren aufgemacht. Die Hoffnung ist, dass sie andere Staaten mitziehen können, deren Volkswirtschaften auf Kohle, Öl und Gas beruhen. Wie sehr al Jaber als COP-Präsident beiden Seiten Zugeständnisse machen und im Gegenzug von ihnen Fortschritte einfordern kann, wird darüber entscheiden, ob es in den zentralen Fragen wirklich vorangeht.
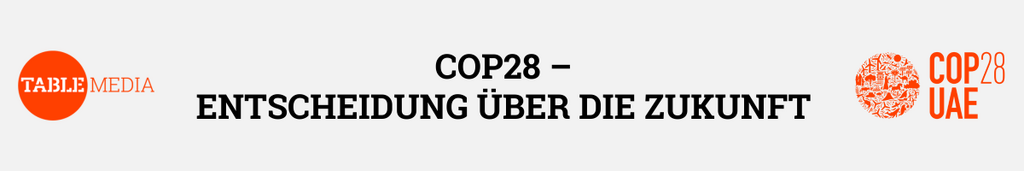
Bisher ist klar: Für Klimaschutz, Anpassung und Technologietransfer zahlen nur die UN-Länder, die 1992 beim Beschluss der Klima-Rahmenkonvention als Industrieländer (“Annex I”) galten. Weil die Welt sich verändert hat und Staaten wie Korea, Singapur, Mexiko, eventuell China und manche Ölstaaten wie Saudi-Arabien absolut und pro Kopf zu den reichen Ländern mit hohem CO₂-Ausstoß gehören, stellen die Industriestaaten immer lauter die Frage: Wann kommt auch Geld von ihnen?
Im neuen “Loss and Damage”-Fonds (LDF) etwa ist die Finanzierung ausdrücklich offen formuliert. Aber wenn etwa in der letzten Nacht die VAE als Gastgeber einen Deal absichern wollen und Geld für den LDF versprechen, könnte das System ins Rutschen geraten. Die Konsequenzen wären schwerwiegend: Ist diese Linie einmal gefallen, würde eine internationale Debatte beginnen, wer wann aus welchen Gründen welche finanziellen Hilfen leisten kann.
Traditionell gibt es auf der COP nur dann Bewegung, wenn sich die beiden größten globalen Verschmutzer einig sind: Das Pariser Abkommen wurde ein Jahr vorher durch eine US-China-Kooperation aufs Gleis gesetzt. Die politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen Peking und Washington haben in den letzten Jahren allerdings auch die Kooperation beim Klima gebremst. Seit dem Treffen der Präsidenten Xi und Biden im November in Kalifornien ist zumindest klar: Sie reden wieder miteinander, wollen kooperieren und sogar die nationalen Klimaziele auf alle Branchen ausdehnen, was China bislang verweigert hat. Ob dieses leichte Tauwetter ausreicht, andere Differenzen auszugleichen (etwa beim Kohleausstieg, den die USA fordern und der gegen Chinas Interessen geht), wird sich erweisen.
Wenig hat die Verhandlungen in den letzten Jahren so belastet wie das gebrochene Versprechen der Industrieländer, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz im Globalen Süden zu mobilisieren. Nun hat die OECD verkündet, 2021 habe die Zahl bei 89,6 Milliarden gelegen und laut vorläufigen Daten sehe es so aus, als sei das Ziel “wahrscheinlich 2022 erreicht worden”. Ob die Schwellenländer das als positiven Trend akzeptieren, wird sich zeigen.
Ebenfalls bleibt spannend, ob sie die angekündigte Reform der Weltbank zu mehr Nachhaltigkeit zumindest als Anfang einer grundlegenden Reform des Weltfinanzsystems akzeptieren. Das hatte die “Bridgetown Intiative” der Premierministerin Mia Mottley von Barbados skizziert. Diese Forderung war seit der COP27 immer wieder laut geworden.
Vor dem Beginn der COP28 gab es aufregende Nachrichten von den Energiemärkten: Hat die Welt tatsächlich 2023 den Höhepunkt der CO₂-Emissionen erreicht? Und sehen wir wirklich gerade den “Peak Coal” in 2023, den “Peak Gas” für 2024 und den “Peak Oil” 2025, wenn die derzeitigen Wachstumsraten bei E-Autos und Erneuerbaren anhalten? Und was bedeutet das? Über das Ende des fossilen Booms streiten sich zumindest die Energieagentur IEA und die Öl-Organisation OPEC öffentlich.
Auf der COP28 soll ein “Global Goal on Adaptation” (GGA) beschlossen werden. Diese Debatte wirft ihre Schatten voraus – auch weil, anders als beim 1,5-Grad-Ziel, unklar ist, wie ein solches Ziel aussehen könnte. Aber es bringt die lange vernachlässigte und unterfinanzierte Anpassung vor allem in den armen Ländern wieder auf die Tagesordnung. Immerhin ist die Lücke gewaltig: Den Kosten von etwa 210 Milliarden US-Dollar jährlich für Anpassung stehen laut UN-Bericht internationale Gelder in Höhe von 21 Milliarden gegenüber. Und gerade die ärmsten und verletzlichsten Länder bekommen oft nur wenig Hilfe.
Alle bisher erschienenen Texte zur COP28 lesen Sie hier.

Herr Haffert, seit wann gibt es die Diskussion über die Schuldenbremse?
Diskussionen über derartige Regeln gibt es seit den 1980er-Jahren, als sich in der Ökonomie die Vorstellung etablierte, dass es Zeitinkonsistenzen im politischen Handeln gibt, Politiker also dazu neigen, Wählern vor der Wahl nichts zuzumuten, obwohl alle wissen, dass das längerfristig notwendig wäre. Diese Sichtweise setzte sich durch, weil die Wissenschaft überrascht war, wie lange sich die Wirtschaftskrise der 1970er-Jahre in den Haushalten widerspiegelte. Der angebliche Politikfehler sollte korrigiert werden, indem Schuldenregeln eingeführt werden.
War das der richtige Schluss?
Rückblickend betrachtet hat man ein spezifisches Zeitphänomen zu sehr für ein allgemeines Problem der Demokratie gehalten. Später sahen wir in Deutschland und anderen Ländern, dass auch eine Haushaltspolitik mit Überschüssen sehr populär sein kann. Man kann also keineswegs sagen, dass Politik immer einen Anreiz hat, mehr Schulden zu machen.
Wie viele Staaten haben mittlerweile Schuldenbremsen?
Laut der Datenbank des Internationalen Währungsfonds haben inzwischen 111 Länder verschiedene Formen fiskalischer Regeln, auch autokratische Staaten. Allerdings sind solche Regeln, anders als die Schuldenbremse, längst nicht überall in der Verfassung verankert.
Als die Staaten begannen, Schuldenbremsen einzuführen, war der Klimawandel bereits ein großes Thema, 1992 etwa in Rio. Hat sich die Politik damals mit der Frage beschäftigt, ob Schuldenbremsen staatliche Ausgaben für die Transformationsbewältigung verhindern könnten?
Mir ist kein politischer Kontext bekannt, in dem es eine Rolle spielte. Allerdings gab es lange Zeit auch die Neigung der Politik, die Kosten für wirksamen Klimaschutz ein bisschen zu negieren, um die Bürger mitzunehmen. Die Haltung findet sich noch immer bei politischen Akteuren.
Lange verschwieg die Politik Bürgern also die wahren Kosten der Bekämpfung der Klimakrise?
So kann man es sagen. Inzwischen gibt die Ampel-Regierung immerhin zu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Unglücklicherweise sind aber nun wegen diverser Krisen die Mittel knapp. Wir ständen anders da, wenn die Politik während der Zeit der schwarzen Null einen Klima-Transformationsfonds aufgebaut hätte.
Welche Auswirkungen erwarteten Befürworter der Einführung von Schuldenbremsen grundsätzlich auf die Investitionen?
Gerade Parteien der linken Mitte sahen ein Problem für die öffentliche Hand darin, dass bei höheren Schulden die Zinskosten steigen und damit der Spielraum für Investitionen sinkt. Durch die Schuldenbremse wollten sie den Mechanismus umkehren und mehr Spielraum für Investitionen schaffen. Viele waren auch überzeugt, die Schuldenbremse führe dazu, dass der Staat unsinnige Konsumausgaben streicht, Investitionen aber verschont. Allerdings war es weder theoretisch noch empirisch gerechtfertigt, anzunehmen, Regierungen würden ausgerechnet diese Priorisierung vornehmen. Es passierte auch nicht.
Hätte man das in den 1990er-Jahren bereits wissen können?
Zumindest gab es da schon die Beispiele von Margret Thatcher und Ronald Reagan. Die wollten den Wohlfahrtsstaat ja sogar aus ideologischen Gründen zusammenkürzen, und trotzdem gingen die Sozialausgaben kaum zurück. Leuten etwas wegzunehmen, ist halt wahnsinnig schwierig in einer Demokratie.
Warum gewann das Thema der Schuldenbremse in der Politik eine so große Bedeutung, obwohl damit keine Inhalte verbunden sind?
Um das zu verstehen, ist es hilfreich, weiter zurückzuschauen. Ab dem Ende der 1960er-Jahre gab es eine Entideologisierung der politischen Debatte – für lange Zeit. Das ändert sich vielleicht gerade mit dem Aufstieg der Rechten wieder ein bisschen. Aber nehmen Sie den Wahlkampfslogan von Gerhard Schröder: “Nicht alles anders, aber vieles besser machen”. Das war ein unideologischer Appell, die eigentliche politische Auseinandersetzung erfolgte über Kompetenz. Das Management der Staatsverschuldung ist dafür ein prototypisches Thema. Alle Parteien können sich darauf abstrakt einigen, dass der Staat nicht völlig über seine Verhältnisse leben soll. Gerade für Linke war es attraktiv, diese Kompetenzbehauptung mit einem Bekenntnis zu Schuldenregeln zu belegen.
Ist die Bedeutung der Schuldenbremse in der Politik ein deutsches Phänomen?
Nein, es gibt da keinen deutschen Sonderweg. Die Vorstellung, die Deutschen hätten diesen schwäbischen Hausfrau-Knacks, ist ein Mythos. Den Trend sehen wir in vielen westlichen Ländern, nachdem sich die politischen Lager eben nicht mehr über das grundlegende Verhältnis von Staat und Markt streiten konnten, weil sie sich politisch angenähert hatten.
Gibt es Beispiele dafür, dass Regierungen in Haushalten Konsumausgaben in Investitionen umgeschichtet haben?
Das klingt in der Theorie gut, gelingt aber in der Praxis eigentlich nie. Wenn der Politik größere Investitionen gelingen, kommt das Geld dafür üblicherweise aus freien Mitteln. Diese kommen beispielsweise zustande, wenn Staatseinnahmen schneller wachsen als die Ausgaben. Die Differenz kann der Staat investieren, wie zur Zeit der jüngsten Großen Koalition. Jetzt haben wir eine andere Situation, weswegen die Bundesregierung die freien Mittel anderweitig beschaffen muss. Aber die Investitionen zu erhöhen, indem die Politik in einem existierenden Haushalt umschichtet, funktioniert gewöhnlich nicht. Und das bringt auf gar keinen Fall die 60 Milliarden Euro, die man jetzt braucht.
Demokratische Staaten erhöhten in Notlagen drastisch die Steuern, wie die USA und Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. Warum tun Regierungen dies nicht ebenso angesichts der Klimakrise?
Dafür brauchen sie die Unterstützung der Mittelschichten, die anders als damals über größere Vermögen verfügen und gleichzeitig mehr daraus finanzieren müssen, etwa ihre private Altersvorsorge oder in den USA die teure Ausbildung ihrer Kinder. Es fällt Menschen schwerer zu sagen, ich zahle mehr in den gemeinsamen Topf, wenn sie gleichzeitig aus ihrem eigenen Einkommen mehr bezahlen müssen. Andererseits halte ich die Angst vor Kapitalflucht in großem Ausmaß bei einer Anhebung der Kapitalsteuern für übertrieben.
Gibt es nicht Argumente, Vermögendere dafür zu gewinnen, höhere Steuern für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu akzeptieren, etwa durch einen Klimasoli?
Das ist noch nicht versucht worden. Aber tatsächlich fördert die Bindung von Einnahmen an konkrete, damit zu finanzierende Ziele die Zahlungsbereitschaft. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Ausschlaggebend dafür ist, dass das Geld nicht im allgemeinen Haushalt versickert, sondern einer bestimmten Verwendung zufließt. Das könnte möglicherweise auch für die Dekarbonisierung oder den Erhalt der Biodiversität gelten. Für die Politik wäre es wahrscheinlich aussichtsreicher, auf diesem Weg einen Transformationsfonds zu füllen, als für eine allgemeine Anhebung des Spitzensteuersatzes oder der Erbschaftssteuer zu streiten.
Ist Ordnungspolitik zur Bewältigung der Transformation eine Alternative zu Subventionen?
Unter dem Begriff wird ja momentan vor allem ein höherer CO₂-Preis diskutiert. Denkt man den Begriff breiter, heißt Ordnungspolitik ja aber erstmal: arbeiten mit Regeln statt mit Subventionen. Will ich CO₂ einsparen, kann das also auch bedeuten, etwas zu verbieten. Eigentlich wäre es doch reizvoll, wenn die Grünen jetzt sagen würden: Ihr sagt immer, wir wollen alles verbieten. Das wollen wir gar nicht. Aber jetzt, wo Geld fehlt, bleibt dem Staat keine andere Wahl als Verbote, etwa durch ein Tempolimit die CO2-Emmissionen zu senken. Noch traut sich das niemand.
Ist eine Erhöhung der CO₂-Preise eine Lösung?
Natürlich kann man mit höheren Preisen Verhalten verhindern. Mit dem Klima- und Transformationsfonds will die Bundesregierung ja aber aktiv eine Lenkung hin zu etwas erreichen. Nur weil man den CO₂-Preis erhöht, entstehen ja nicht automatisch Batterie- und erst recht keine Chipfabriken. Hinzu kommen die heftigen verteilungspolitischen Wirkungen einer CO₂-Preiserhöhung, wenn nicht gleichzeitig ein Klimageld gezahlt wird.
Oft warnen Experten, hoch verschuldete Staaten machten sich von den Finanzmärkten abhängig. Aber Japan hat ein Vielfaches der Staatsschulden Deutschlands und steht nicht schlechter da…
Am Markt verlangt niemand, Deutschland dürfe jetzt keine weiteren Schulden aufnehmen. Vielmehr haben die Bürger selbst, vermittelt über ihre politischen Institutionen, diese Selbstbeschränkung herbeigeführt. In Japan hat man sich kein solches Eigentor geschossen.
Reicht Geld zur Lösung der Klimafrage?
Sicher nicht. Man sollte auch nicht die Fähigkeiten staatlicher Lenkung überschätzen. Am Ende ist das Klimaproblem ein Demokratieproblem. Die entscheidende Frage ist, ob die demokratischen Institutionen mit nahenden, aber noch nicht eingetretenen Problemen umgehen können. In jedem Fall erschwert die Schuldenbremse dies.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht die Finanzierung wichtiger Transformationsprojekte auf dem Spiel. Für das kommende Jahr geplante Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe für industriepolitische Maßnahmen und die Energiewende fallen entweder weg oder sie müssen durch Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden. Davon könnte auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) betroffen sein.
Der Etat des BMZ hatte bereits im Sommer reichlich Federn lassen müssen, als das Kabinett monatelang über den Bundeshaushalt 2024 stritt. Am Ende sollte das Ministerium von Svenja Schulze (SPD) 640 Millionen Euro einsparen. Mit 11,5 Milliarden Euro lag der Etat rund fünf Prozent unter dem des Vorjahres. Die Finanzplanung für 2025 sieht eine weitere Absenkung auf 10,3 Milliarden Euro vor.
Åsa Månsson, Geschäftsführerin des entwicklungspolitischen Dachverbands VENRO, nannte die Kürzungen bei einem Protest Mitte November “nicht nur kurzsichtig, sondern unverantwortlich” und sprach von einer “Gefahr für das gesamte System der internationalen Zusammenarbeit”. Ihre Organisation rechnete vor, dass der BMZ-Etat in der Zeit der Ampelregierung von 2022 bis 2025 um 3,5 Milliarden Euro sinken würde. Das entspräche 25 Prozent.
Auch Volkmar Klein, Sprecher für Entwicklungspolitik der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, kritisiert die für 2024 geplante “dritte Kürzung im dritten Regierungsjahr”. Er prognostizierte gegenüber Table.Media, Entwicklungsministerin Schulze werde “das Versprechen des Koalitionsvertrags, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsarbeit aufzubringen, künftig kaum noch halten können”. So viel sollen die reichen Länder nach dem Willen der Vereinten Nationen mindestens für die öffentliche Entwicklungshilfe bereitstellen.
In der Bereinigungssitzung im November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages einen Teil der Kürzungen in Höhe von 114 Millionen Euro zurück. “Diese Steigerung mildert die anfänglich vorgesehenen Kürzungen und zeigt ein positives Ergebnis unserer parlamentarischen Arbeit. Allerdings bleiben die Bedarfe angesichts der aktuellen globalen Krisen weiterhin hoch”, sagte Deborah Düring, entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, auf Anfrage.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze hatte eigentlich eine Ausweitung des Engagements angekündigt. “Wir haben enorm viel aufzuholen, um die Ziele der Entwicklungsagenda 2030 zu erreichen”, sagte sie nach ihrem Amtsantritt. “Beim weltweiten Klimaschutz ist mein Leitbild die Just Transition als Teil einer globalen gestaltenden Strukturpolitik. Es geht darum, die Transformation zur Klimaneutralität mit sozialem Ausgleich zu verbinden.”
Laut dem Sustainable Development Report (SDR) hat Deutschland hier eine erhebliche Bringschuld. Der SDR analysiert jedes Jahr, wie weit die einzelnen Länder bei der Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (SDG) gekommen sind. Erarbeitet wird der Report vom Sustainable Development Solutions Network (SDSN), einem globalen Wissenschaftsnetzwerk unter Leitung des US-Ökonomen Jeffrey Sachs.
Der SDR dokumentiert aber nicht nur die Fortschritte bei den SDGs, sondern auch, inwieweit die Wirtschaftsweise und das Konsumverhalten eines Landes die nachhaltige Entwicklung anderer Länder beeinflusst. Dieser Effekt wird als Spillover bezeichnet. Ein Ranking, bei dem 100 Punkte erreicht werden können, zeigt an, wie negativ diese Auswirkungen sind. Je niedriger die Punktzahl, desto negativer sind die Folgen für andere Länder.
In diesem Spillover-Ranking liegt Deutschland seit Jahren auf den hinteren Plätzen. Im SDR für 2023 belegt die Bundesrepublik mit 65,2 Punkten lediglich Platz 144 von 166 Ländern. Damit schneidet Deutschland sogar deutlich schlechter ab als der Durchschnitt der OECD-Staaten mit 73,8 Punkten.
Bei einem weiteren Index, dem Global Commons Stewardship Index, gehört Deutschland ebenfalls zu den Schlusslichtern. Dieser Index, der ebenfalls von SDNS erstellt wird, misst die negativen Spillover-Effekte eines Landes auf die globalen Gemeinschaftsgüter. Dabei werden sechs Faktoren aus den Bereichen Emissionen, Biodiversität und Kreislauffähigkeit zugrunde gelegt. Auch hier schneidet Deutschland mit 18,3 von 100 möglichen Punkten schlecht ab. Der angerichtete Schaden an den globalen Gemeinschaftsgütern wird vom SDNS als “extrem” eingestuft.
“Deutschlands Ziel muss sein, negative Spillover-Effekte zu vermeiden, um andere Länder nicht in der Umsetzung der Agenda 2030 zu behindern”, forderten Leonie Droste und zwei weitere Wissenschaftler des SDSN Germany in einem Artikel im Mai. Dafür sei die “klare Adressierung negativer Spillover-Effekte und das Schaffen verbindlicher Strukturen in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie” notwendig.
Dazu sei das BMZ bereit, wie eine Sprecherin gegenüber Table.Media erklärte. So sollen in der Nachhaltigkeitsstrategie “künftig noch systematischer als bisher globale Zusammenhänge berücksichtigt werden”. Denn negative Spillover-Effekte wie schlechte Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung entlang globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten würden die betroffenen Länder bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausbremsen. Die Messung von Spillover-Effekten sei jedoch komplex. Deshalb fördere das BMZ seit Jahren das SDSN, das sich als Referenz für Spillover-Effekte etabliert habe.
30. November, 15:00-16:15 Uhr
Webinar Greening global energy grids with AI and connectivity (OECD) Info & Anmeldung
2. Dezember, 7:00-7:45 Uhr
Webinar How Global Financial Regulation Can Encourage More Climate Investment (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
3. Dezember, 11:00-12:30 Uhr
Webinar Transition Finance: From Implementation to Impact (EU) Info & Anmeldung
4. Dezember, 6:00-6:45 Uhr
Webinar Women as Catalysts for Climate Action for a Livable Planet (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
4. Dezember, 10:00-11:00 Uhr
Webinar Monitoring green financial flows (EU) Info & Anmeldung
4. Dezember, 13:30-14:30 Uhr
Webinar International Platform on Sustainable Finance (IPSF) – Annual Event Info & Anmeldung
5. Dezember, 12:30-14:00 Uhr
Webinar What we can learn from Slovenia: The role of the construction industry in national circular economies – challenges and opportunities (EU) Info & Anmeldung
6. Dezember, 12:30-14:00 Uhr
Webinar Jobs and skills for a just green transition (OECD) Info & Anmeldung
9. Dezember, 6:00-6:45 Uhr
Webinar Defining Pathways for Nature Finance (Weltbank, IWF, FT) Info & Anmeldung
10. Dezember, 8:00-9:00 Uhr
Webinar Accelerating the financing of the circular economy in climate and biodiversity strategies (EU) Info & Anmeldung
12. Dezember, 10:30-12:00 Uhr
Webinar Reaching climate neutrality for the Hamburg economy by 2040 (OECD) Info & Anmeldung
Auftakt der neuerlichen Haushaltsdebatte war eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag, in der er den Willen zum Festhalten an den Transformationsprojekten der Ampelkoalition betonte. Zur Finanzierung äußerte er sich nicht. Einen vorläufigen Höhepunkt wird das Thema am Freitagvormittag mit der ersten Lesung des von der Bundesregierung kurzfristig eingebrachten Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 erreichen.
Auf der Tagesordnung dieser Sitzungswoche stehen noch weitere Themen mit ESG-Bezug. So wird am Mittwoch der Bericht der Bundesregierung über Forschungsergebnisse zu Methoden der Ökobilanzierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden diskutiert. Am Donnerstagnachmittag steht ein von der Ampelkoalition eingebrachter Gesetzentwurf zum Übereinkommen Nr. 184 der Internationalen Arbeitsorganisation über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft zur Abstimmung.
Am frühen Donnerstagabend debattiert der Bundestag zudem über die Unterrichtung der Bundesregierung zum Nationalen Reformprogramm 2023. Dabei geht es um Maßnahmen zur Bewältigung zentraler gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen, wie die Verringerung der Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energieträgern durch eine beschleunigte Energiewende.
Am Freitag wird in erster Beratung ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion diskutiert, Verbrennungsmotoren auch über das Jahr 2035 hinaus neu zuzulassen, sofern sie ausschließlich mit klimafreundlichen Kraftstoffen betrieben werden. Außerdem gibt es eine vereinbarte Debatte zur Klimaaußenpolitik anlässlich der am Donnerstag beginnenden UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai. ch
Nur neun von 77 am Bündnis für nachhaltige Textilen beteiligte Unternehmen haben sich nach Informationen von Table.Media in einem offenen Brief für höhere gesetzliche Mindestlöhne in Bangladesch ausgesprochen. In den vergangenen Tagen hatten sich einige weitere und mit KiK und Boss auch zwei größere Unternehmen dazu entschlossen. Zu den Unterzeichnern gehören auch Vaude, Jako und Sympatex. Geworben hatten dafür die 14 im Textilbündnis vertretenen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Inkota, Südwind und Femnet: Mit dem gemeinsamen Brief an die Regierung von Bangladesch und den Wirtschaftsverband BGMEA sollte den Gewerkschaften bei ihren Lohnforderungen der Rücken gestärkt werden.
Am 7. November hatte die Regierung einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von 12.500 Taka (113 US-Dollar) festgelegt, die erste Erhöhung seit fünf Jahren. Abzüglich der Inflation bedeutet dies laut dem Workers Rights Consortium ein Lohnplus von 14 Prozent gegenüber 2018. Die Gewerkschaften in Bangladesch hatten eine Erhöhung der Löhne auf 23.000 Taka (208 US-Dollar) gefordert, was immer noch hinter den Berechnungen für einen existenzsichernden Mindestlohn zurückbleibt, den etwa die Global Living Wage Coalition auf 235 US-Dollar veranschlagt. Am 26. November lief die Frist für Einsprüche beim Lohnausschuss Bangladesch aus.
Allerdings stehen die Textilunternehmen in Bangladesch auch unter erheblichem Preisdruck. Während der Pandemie hatten einige Kunden die Abnahmepreise teilweise um bis zu 50 Prozent gedrückt, heißt es in Branchenkreisen, von zwei US-Dollar etwa für eine Unterhose auf 80 Cent. Und diese Preise gelten teils immer noch. Das engt den Spielraum der Regierung in Bangladesch ein. Die gesetzlichen Mindestlöhne liegen auch in anderen textilen Produktionsländern deutlich unter einem existenzsichernden Lohn.
Die Textilindustrie ist die wichtigste Exportbranche von Bangladesch. Bei den Auseinandersetzungen um höhere Mindestlöhne war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Laut der Kampagne für saubere Kleidung kamen bereits vier Arbeiterinnen zu Tode, 115 wurden inhaftiert und gegen 23.000 Demonstrierende wurden Strafanzeigen erlassen. Mehr als 300 Fabriken hätten zwischenzeitlich die Lohnzahlungen verweigert.
Überraschend für Fachleute kommt die ablehnende Haltung der Mehrheit der Unternehmen aus dem Textilbündnis, weil einer der Schwerpunkte der von der Bundesregierung unterstützten Brancheninitiative das Thema existenzsichernde Mindestlöhne ist. Zudem mache die Arbeit der Multi-Stakeholder-Initiative mit rund 120 Mitgliedern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik nach Einführung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes nur dann Sinn, wenn sie höhere Standards in der textilen Lieferkette umsetze. cd
Ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, dass die Umstellung auf Erneuerbare Energien (EE) in vollem Gange ist. Zugleich werden jedoch weiter Summen in die Öl- und Gasförderung investiert, die mit dem Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius nicht vereinbar sind. Die internationale Organisation spart nicht mit Kritik an der Öl- und Gasindustrie, die gegenwärtig nur ein Prozent der weltweiten Investitionen in EE leistet. “Die Industrie muss sich dazu verpflichten, der Welt wirklich dabei zu helfen, ihren Energiebedarf zu decken und ihre Klimaziele zu erreichen”, sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.
Zugleich belegt der Bericht, dass Investitionen in EE im Vergleich zu denen in Öl und Gas seit 2020 bei Weitem überwiegen. Für Solar und Wind werden heute bereits 30 Prozent mehr neue Mittel bereitgestellt als für fossile Energieträger.
Dieser Zuwachs spiegelt sich auch in neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die zeigen, dass die Industrie in Deutschland ihre Investitionen in Klimaschutz seit 2011 um 74 Prozent gesteigert hat, davon knapp die Hälfte in Solar- und Windenergie. Weltweit müssten sich die aktuellen EE-Investitionen bis 2030 allerdings verdreifachen und die Fossilinvestitionen halbieren, um das 1,5-Grad-Ziel der Weltgemeinschaft noch realisieren zu können.
Der britische Ökonom Adam Tooze analysiert in einem Blogbeitrag die Strategien der Öl- und Gasindustrie. Insbesondere die saudi-arabische Aramco, die bei Weitem größte Erdölgesellschaft der Welt, investiert anders als ihre Konkurrenz massiv und sogar zunehmend in ihr Kerngeschäft. Das Kalkül ist anscheinend, dank der niedrigen Förderkosten im Mittleren Osten als eine der wenigen Ölfördergesellschaften übrigzubleiben, die 2050 noch existieren werden.
Dazu passt eine Undercover-Recherche des britischen Centre for Climate Reporting. Demnach plant Aramco milliardenschwere Investitionen in die fossile Energieversorgung in Afrika und Asien. Für Tooze stellt sich vor allem die Frage, wie die US-amerikanische Fossilindustrie mit dieser Herausforderung umgeht. “Das Interesse der US-amerikanischen Erdöl- und Erdgasinteressen besteht nicht darin, die Energiewende an sich zu stoppen”, kommentiert er. Vielmehr solle die Transition langsam genug erfolgen, um der Industrie “einen bedeutenden Weltmarkt zu sichern, damit sich die noch laufenden Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar lohnen.” av
Deutschland gehört zu den Regionen mit dem weltweit höchsten Verlust an Wasser durch die Klimaerhitzung. Wie der neue Montoringbericht zur “Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel” (DAS) zeigt, sind die Folgen weitreichend. So waren die vergangenen Jahre von starken regionalen Dürren geprägt. Vielerorts sanken die Grundwasserstände auf Rekordtiefe. Die Folge waren in manchen Jahren ein Rückgang der Ernten von Weizen und Silomais von 15 bis 20 Prozent. Die Wälder, insbesondere Fichtenbestände, litten ebenfalls unter dem Trockenstress und starben teils flächig ab. Durch die trockene Witterung kam es vor allem in den nordöstlichen Bundesländern zu großen Waldbränden. Hinzu kamen erstmals Hitzewellen mit Temperaturen über 40 Grad Celsius nördlich von Hamburg, sowie weitreichende Veränderungen in den Ökosystemen in den Meeren und an Land.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach von “verheerenden Folgen der Klimakrise”, die “sich auf die Gesundheit der Menschen, die Ökosysteme und die Wirtschaft” auswirken. Die Kommunen, so Lemke weiter, seien sich ihrer “entscheidenden Rolle” bei Vorsorgemaßnahmen zunehmend bewusst.
Dabei würden sie von der Bundesregierung durch das Klimaanpassungsgesetz und der zugehörigen Strategie, der Nationalen Wasserstrategie, dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und mehreren Förderprogrammen unterstützt. Der Präsident des Bundesumweltamts, Dirk Messner, ergänzte mit optimistischen Einschätzungen: “Neben den Schäden zeigt der Bericht auch, dass Anpassungen vor Ort wirken. Die Zahl der Hitzetoten konnte durch gezielte Informationskampagnen reduziert werden.” Zudem arbeiteten Bund und Länder an der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen und Böden. Die Bundesregierung legt künftig alle vier Jahre einen Monitoringbericht zur DAS vor, wie es das Klimaanpassungsgesetz verlangt. Damit soll die Umsetzung messbarer Ziele nachvollzogen werden können. av
Vergangene Woche hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit großer Mehrheit für eine Resolution zur Zusammenarbeit in der internationalen Steuerkooperation gestimmt. Eingebracht von der Gruppe der afrikanischen Länder, wurde die Resolution von 125 Ländern angenommen. 48 Länder aus dem Globalen Norden, darunter Deutschland, stimmten dagegen. Damit geht der Streit, ob die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit ihren 38 Mitgliedsstaaten oder die viel größeren Vereinten Nationen für dieses Feld der internationalen Zusammenarbeit federführend sein sollen, in eine neue Runde. Martin Kimani, Repräsentant von Kenia bei den Vereinten Nationen, kommentierte das Abstimmungsergebnis als “das eindeutigste Votum des globalen Nordens gegen den globalen Süden, das ich in letzter Zeit gesehen habe.”
Im Auftrag der G20, der Gruppe der großen Industriestaaten, hat die OECD in den vergangenen Jahren ein Rahmenabkommen für eine globale Mindestbesteuerung großer Konzerne ausgearbeitet, das vor einigen Wochen in deutsches Recht übernommen worden ist. Zwar traten auch viele Länder aus dem globalen Süden dem Abkommen bereits bei, kritisierten aber zugleich den darin vorgesehenen niedrigen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Zudem befürchten viele Länder, von den OECD-Regelungen nicht zu profitieren. Insbesondere die Gruppe der 77 (G77), in der sich viele Länder aus dem globalen Süden zusammengeschlossen haben, forderte daher ein “inklusives und effektives” Abkommen auf UN-Ebene ein.
Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und die Ökonomin Jayati Ghosh, Ko-Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für die Reform der Internationalen Unternehmensbesteuerung (ICRICT), sahen in der UN-Initiative die Chance zum “Ausbau der internationalen Steuerzusammenarbeit, der Bekämpfung illegaler Finanzströme und den Kampf gegen aggressive Steuervermeidung und -hinterziehung”. Die Europäische Union hingegen vertrat die Ansicht, ein UN-Steuergremium berge das Risiko, bestehende Abkommen zu duplizieren. av
Bloomberg will es Investoren erleichtern, die potenziellen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens auf jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen zu bewerten. Dafür hat der Informationsdienst die “Sector Impact Map” der Finanzinitiative des UN-Entwicklungsprogramms (UNEP FI) in sein ESG-Datenangebot integriert. Die Impact Map ordnet über 500 sektorale Aktivitäten 38 Wirkungsfeldern und den SDG zu. Sie unterscheidet zwischen positiven und negativen Auswirkungen, die ein Unternehmen auf Umwelt, Menschen und Wirtschaft haben kann.
“Indem wir die UN Sector Impact Map mit unseren umfassenden und qualitativ hochwertigen ESG-Daten verknüpfen, können wir unseren Kunden neue Erkenntnisse liefern”, sagt Patricia Torres, Global Head of Sustainable Finance Solutions bei Bloomberg. Dies helfe bei der Anpassung von Anlagestrategien.
Laut dem Global Impact Investing Network wuchs der Markt für Impact Investing im Jahr 2021 weltweit auf über eine Billion US-Dollar. Allerdings schätzt die UN Sustainable Development Group die Finanzierungslücke für Entwicklungsländer zur Erreichung der SDG bis 2030 auf 2,5 bis 3 Billionen US-Dollar pro Jahr. ch
Unternehmen aus der Textil- und Rohstoffbranche haben zwar Prozesse aufgesetzt, die die Einhaltung von Menschenrechten entlang ihrer Lieferketten ermöglichen sollen, viele beteiligen Beschäftigte und etwa Anwohner von Betriebsgeländen aber nicht ausreichend. Das ist das Ergebnis des Corporate Human Rights Benchmark Reports 2023.
Solche Managementprozesse seien wichtig für Unternehmen, um zu verstehen, welchen Einfluss Geschäftstätigkeiten auf potenziell betroffene Menschen (Rechteinhaber) entlang ihrer Lieferketten haben, heißt es in der Studie. Wirken würden sie aber nur, wenn Unternehmen auch in den Austausch mit Rechteinhabern gingen, die ihnen aus ihrer Perspektive schildern könnten, welche Risiken es gibt. Dies hätten nur 27 Prozent der 110 untersuchten Firmen aus der Textil- und Rohstoffbranche nachweislich getan.
Auch bei Beschwerdemechanismen, die es Betroffenen erlauben, ihre Rechte geltend zu machen, hätten viele Unternehmen noch Nachholbedarf. Denn die Existenz eines solchen Mechanismus reiche nicht, vielmehr müssten Unternehmen Rechteinhaber an der Gestaltung beteiligen und die nötige Transparenz sowie Verlässlichkeit schaffen, damit die potenziell Betroffenen dem Prozess vertrauen. Doch nur 5 Prozent der Firmen hätten Nachweise dafür geliefert, dass sie vertrauensbildende Maßnahmen umsetzen. Bei Maßnahmen, die die Beteiligung und das Gefühl von “Ownership” fördern, seien es lediglich 10 Prozent der Firmen gewesen.
Die World Benchmarking Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, die für die nach eigenen Aussagen 2.000 einflussreichsten Unternehmen der Welt Maßstäbe für die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) entwickelt. Für den Corporate Human Rights Benchmark Report 2023 hat die Organisation 110 Unternehmen aus der Textil- und Rohstoffbranche untersucht. Basis für die Ergebnisse sind Informationen, welche die Firmen veröffentlichen – etwa auf ihrer Website oder in Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten. nh
Was sind die Grenzen von Staatsschulden – Makronom
Laut einem Autorentrio der Economists for Future basierten die derzeit geltenden rechtlichen Begrenzungen von Staatsverschuldung auf Mythen, die nicht ökonomisch fundiert seien. Sinnvoller wäre es daher, die Schuldenaufnahme so zu gestalten, dass sie die ökonomischen, sozialen und ökologischen Grenzen respektiert. Zum Artikel
Kohle, die nicht versiegt – TAZ
Subventionen für klimaschädliche Energien sollten bis Ende 2022 gestoppt werden, beschloss die vorletzte Klimakonferenz COP26. Malina Dittrich und Christian Jakob berichten, warum die Klimastrategie der Niederlande dieses Ziel untergräbt. Zum Artikel
“Ein Szenario ist es, die Fertigung in die USA zu verlagern” – SZ
Da die deutsche Solarindustrie mit der günstigen Konkurrenz aus China aktuell nicht mithalten kann, fordert sie eine “Resilienz-Quote” im Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Investoren belohnt, die besonders viele europäische Komponenten verbauen. Zum Artikel
Carbon-dioxide removal needs more attention – The Economist
Technologien, die CO₂ abscheiden und in die Erde verpressen, sind umstritten und nicht sehr entwickelt. Dieser Essay plädiert gerade deshalb für die Entwicklung und Anwendung – weil die Eindämmung des Klimawandels sonst nicht gelinge. Zum Artikel
“Fühlen uns als Steuereintreiber der Nation” – Tagesschau
Axel John recherchierte bei Speditionen, die sich Kostensteigerungen durch die LKW-Maut gegenübersehen. Diese soll klimafreundliche Transporte fördern – doch es fehlt an Alternativen. Elektrisch betriebene LKW seien rar und die wichtigsten Güterstrecken der Bahn bereits ausgelastet.
Zum Artikel
Anlage zur Lithium-Produktion aus dem Oberrheingraben eröffnet – Automobilindustrie
Lithium aus dem Oberrheingraben könnte bis zu 100 Prozent des deutschen Bedarfs decken. Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energy will ab 2026 aus dem heimischen Rohstoff jährlich 24.000 Tonnen Lithium für 500.000 Autobatterien produzieren. Produziert wird in Landau, raffiniert in Frankfurt-Höchst. Testkunden sind Stellantis, VW und Renault. Zum Artikel
New satellite will track CO₂ emissions from worst polluters from space for the first time – Euronews
Ein kanadischer Satellit ist zum ersten Mal in der Lage, spezifische CO₂-Emissionen von etwa Kohleförderungen aus dem All zu lokalisieren und zu messen. Die Initiatoren hoffen, dass der Wahrheitsgehalt von Angaben zum Ausstoß von Treibhausgasen von Ländern so künftig besser überwacht werden kann. Zum Artikel
US industry disposed of at least 60m pounds of PFAS waste in last five years – The Guardian
Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), sogenannte Ewigkeitschemikalien, gelten als gesundheitsgefährdend und sollen in der EU verboten werden. In den USA hat die Industrie in den vergangenen fünf Jahren mindestens 60 Millionen Pfund PFAS-Abfälle entsorgt – und wie Tom Perkins erklärt, könnten es noch weit mehr sein. Zum Artikel
Moroccogate: Corruption And Blood Renewables In The Western Sahara – Forbes
Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien unterzeichneten 2016 ein Abkommen mit Marokko zu erneuerbaren Energien. Doch die Wind- und Solarfarmen entstehen zum Teil in Westsahara, einem seit 1976 von dem nordafrikanischen Staat besetzten Gebiet. Elias Ferrer Breda berichtet über mutmaßlich illegale zukünftige Energieimporte in die EU. Zum Artikel
Hier liegen die Seltene-Erden-Minen, über die China lieber nicht spricht – Wirtschaftswoche
Eine Recherche der Wirtschaftswoche in Kooperation mit LiveEO zeigt mithilfe von Satellitenbildern, wo in China seltene Erden abgebaut werden und welche Folgen der Abbau der für die Energiewende wichtigen Rohstoffe für die Umwelt hat. Zum Artikel

Die Ablehnung war deutlich und sie kam zügig, nur zwei Wochen nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Sultan Ahmed Al Jaber Anfang Januar 2023 zum COP28-Präsidenten ernannt hatten. Mehr als 400 NGO formulierten einen offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, in dem sie forderten, dass die Personalie rückgängig gemacht werden müsse. Denn: Al Jaber, der CEO der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), sei alles Mögliche – aber kein Klimaschützer.
Zum Beweis listeten sie ein paar Fakten auf: Im weltweiten Ranking der größten Ölproduzenten liege ADNOC auf Platz 12, beim Ausstoß von Treibhausgasen nehme das Unternehmen Rang 14 ein. Und zur vorigen Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh hätten die VAE mehr Lobbyisten der fossilen Industrie mitgebracht als jede andere Nation.
Geändert hat das nichts. Wenn die “Conference of Parties” (COP) am Donnerstag in ihre 28. Runde geht, dann wird sie zum ersten Mal von einem Konzernchef geleitet. Von einem fossilen Konzernchef.
Dass der 50-Jährige einmal eine so prominente Rolle in der Weltpolitik übernehmen würde, war nicht unbedingt vorbestimmt. Er wuchs in Umm al-Qaiwan auf, dem kleinsten Scheichtum der Vereinigten Arabischen Emirate, abseits vom politisch dominierenden Dubai und dem erdölreichen Abu Dhabi. Für sein Studium – Chemieingenieurswesen und BWL – ging er nach Kalifornien. In England promovierte er in Wirtschaftswissenschaften. Dazwischen, 1998, begann er beim staatlichen Ölkonzern ADNOC, zunächst als Prozess- und Planungsingenieur in der Erdgasspalte.
Dort stieg er schnell auf, wechselte als Manager zur staatlichen Investmentgesellschaft Mubadala, gründete Masdar, einen Versorger für erneuerbare Energien, und wurde von den damals neuen Herrschern auf Weltreise geschickt. Ihr Ziel: die Diversifizierung ihrer Wirtschaft voranzutreiben und das Geschäft mit der sauberen Energie auszubauen. Nach Besuchen in 15 Ländern auf vier Kontinenten kam Al Jaber mit einem Plan zurück: Nahe des Flughafens Abu Dhabi solle Masdar City entstehen, eine CO₂-neutrale Stadt für 50.000 Einwohner, in der junge Menschen lernen, wie die nachhaltige Zukunft gestaltet werden kann.
Seitdem sind weitere Aufgaben dazugekommen. 2009 berief ihn UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon in seine Advisory Group on Energy and Climate, 2010 wurde er zum Klima-Sondergesandten der VAE, 2016 Vorstandschef von ADNOC und 2020 Industrieminister. Zwischenzeitlich übernahm er noch den Chefposten des National Media Council, außerdem sitzt er in mehreren Aufsichtsräten.
Die Beschäftigung mit der Energiewende, seine Besuche bei vorigen Klimakonferenzen und seine verschiedenen Einblicke und Kontakte in die Wirtschaft sind es denn auch, die Befürworter Al Jabers betonen. Frans Timmermans etwa sagte ihm jegliche Unterstützung zu, als er noch EU-Kommissar für Klimaschutz war. John Kerry, der US-Sondergesandte für Klimafragen, bezeichnete ihn als “hervorragende Wahl”. Kerry sieht in ihm einen Mittler zwischen den Welten. “Wenn er das nicht hinbekommt, wenn die Öl- und Gasindustrie nicht teilnimmt und keinen ernsthaften Beitrag leistet, dann werden die Vereinigten Arabischen Emirate sehr schlecht aussehen, und er weiß das.” Sollten sie sich dazu jedoch durchringen, könnten die Emirate zu einem “all-time catalyst” werden, zu einem Akteur, der an entscheidender Stelle den Schalter umgelegt hat.
Öffentlich bekennt sich Al Jaber zur Energiewende. “Das Herunterfahren der fossilen Energien ist unerlässlich”, sagte er dem “Time Magazine”. “Das müssen wir akzeptieren.” Zugleich erklärte er, dass die Welt noch nicht bereit dafür sei, ganz auf Öl und Gas zu verzichten. “Wir können nicht den Stecker des bisherigen Energiesystems ziehen, bevor wir ein neues aufgebaut haben.”
Sätze wie diese lassen Kritiker aufhorchen. Noch können sie keine Belege für ein glaubwürdiges Umschwenken der arabischen Ölwelt erkennen, im Gegenteil. Sie verweisen auf die 150 Milliarden US-Dollar, die alleine ADNOC in seine Expansion stecken will. Bis 2030 plant das Unternehmen, seine tägliche Förderung von heute knapp drei auf fünf Millionen Barrel zu steigern.
Und dann sind da noch Recherchen von Medien. Dem “Guardian” zufolge landeten Mails, die nur für die Konferenzorganisation bestimmt waren, auch auf den ADNOC-Servern. Die “BBC” meldete, dass VAE-Verhandler die politischen Gespräche während der COP auch für Geschäftsabschlüsse nutzen wollten. “Bloomberg” berichtete, dass das Unternehmen Masdar, laut eigener Aussage eines der größten für erneuerbare Energien, gemessen an der installierten Kapazität weltweit nur auf Platz 62 rangiert. Zudem wird Masdar City wohl frühestens erst 2030 fertig, und nicht wie geplant 2016. Bislang ist gerade mal ein Drittel der anvisierten Stadt errichtet.
Vor der Klimakonferenz war Sultan Ahmed Al Jaber wieder viel unterwegs, auf internationaler “Listening Tour”, wie es hieß. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Papst Franziskus, John Kerry, King Charles und andere hat er getroffen. Auf der COP28 muss er dieses Zuhören und Ausloten fortsetzen, wenn er die Konferenz zum Erfolg führen will. Erfahrung darin, die Interessen von fast 200 Staaten zu moderieren, hat er bislang nicht.
Seine eigenen Ziele – und die der Emirate – könnten dabei selbst zum Konfliktfeld werden. Das eine tun und das andere nicht lassen, das war bislang die Maxime: Die Erdölstaaten wollen das erneuerbare Business etablieren – und das fossile weiter ausbauen, bevor sie es dann womöglich zurückfahren. Gelingen soll der Spagat mit “Carbon Capture and Storage” (CCS), mit dem Abscheiden und unterirdischen Einlagern von klimaschädlichem Kohlendioxid. Die Technik soll das dreckige Verfeuern fossiler Rohstoffe künftig legitimieren. Ein Ansatz, den die UN ablehnen. Um das Pariser Abkommen einzuhalten, sei es nötig, aus allen sogenannten unverminderten fossilen Brennstoffen auszusteigen, sagt die Organisation.
Dass die teure, energieintensive und wenig ausgereifte Technologie zum Wandel bislang nur Kleinstmengen beigetragen hat, scheint ihn nicht zu stören. Er wettet auf die Zukunft und darauf, dass die globale Marktreife in ein paar Jahren erreicht wird.
Deutlich früher dürfte sich dagegen zeigen, ob ihm tatsächlich daran gelegen ist, die Welt vor dem Klimawandel zu bewahren. In 14 Tagen wird man mehr wissen über Sultan Ahmed Al Jaber. Marc Winkelmann

Zerstörerische Rohstoffausbeutung, unkontrollierte Konzernmacht, Staatsschuldenkrisen: Diese Probleme beschäftigten schon 1974 die Generalversammlung der Vereinten Nationen, als sie einen Aktionsplan für eine “New International Economic Order” (NIEO) beschloss. Gelöst sind sie heute, knapp 50 Jahre später, immer noch nicht. Prägend für das NIEO-Programm war die Auffassung, dass die Weltgemeinschaft wirtschaftliche Aktivitäten so lenken müsse, dass Armut und soziale Ungleichheit überwunden werden könnten. Auch der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt begeisterte sich für die NIEO und arbeitete mehrere Jahre an ihrer Umsetzung. Vergeblich, denn westliche Staaten weigerten sich, die UN-Beschlüsse einzuhalten.
Das Buch “Eine gerechte Weltwirtschaft? Die ‘New International Economic Order’ und die Zukunft der Süd-Nord-Beziehungen”, herausgegeben von Table.Media-Redakteur Alex Veit und dem China-Experten Daniel Fuchs, untersucht, ob das UN-Programm noch immer als Konzept für eine sozialökologische Transformation taugt. Wie sich zeigt, prägte die NIEO die Diskurse über eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung nachhaltig. Auch unser Redaktionsleiter Caspar Dohmen hat ein Kapitel beigesteuert, in dem er den Einfluss der NIEO auf die Fairtrade-Bewegung analysiert. Doch eine Neuauflage der NIEO, eine NIEO², müsste vor allem die Klimaerhitzung in den Mittelpunkt stellen. Der Band, erschienen im Transcript-Verlag, ist kostenfrei als E-Book und auf Papier in jeder Buchhandlung erhältlich. av
