für diesen Freitag ruft Fridays For Future wieder bundesweit zum Klimastreik auf: Um gegen schrumpfende Teilnehmerzahlen anzugehen und um breitere Unterstützung zu erhalten, gehen die Aktivisten zusammen mit der Gewerkschaft Verdi auf die Straße. Grund genug für uns, zu analysieren, wie sich die Klimabewegung in Deutschland gerade neu orientiert.
Außerdem schauen wir über die Alpen nach Österreich: Aus Wien erklärt Lukas Bayer für uns, warum das Land aktuell keinen Klimaplan hat und der Entwurf dafür ungenügend ist – übrigens wie auch der deutsche.
Auf EU-Ebene sind in dieser Woche auch wichtige Klimaentscheidungen gefallen: Das Renaturierungsgesetz wurde am Dienstag mit knapper Mehrheit angenommen. Lukas Scheid erklärt, warum es weniger Klimaeffekt haben wird, als ursprünglich geplant. Vorerst gescheitert ist hingegen das europäische Lieferkettengesetz. Leonie Düngefeld erklärt, warum es auch ein Verlust fürs Klima wäre, wenn das Gesetz tatsächlich nicht kommt.
Zudem lesen Sie bei uns, warum der Klimawandel Fische leichter macht, was hinter dem Boom an Wärmepumpen in Deutschland steckt und welches die schmutzigsten Flughäfen der Welt sind. Spoiler: Für die COP28 habe viele von uns und Ihnen den klimaschädlichsten im vergangenen Jahr hautnah erlebt.
Bleiben Sie dran!


Am 1. März will Fridays for Future (FFF) zusammen mit der Gewerkschaft Verdi für Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr demonstrieren. Dieses Bündnis wurde bereits erprobt, ist aktuell aber auch der Versuch, wieder mehr Menschen zu erreichen und Sympathien zurückzugewinnen. Anders geht die Gruppe Letzte Generation vor: Sie hat für den 16. März zu “ungehorsamen Versammlungen” in verschiedenen deutschen Städten aufgerufen. Die unterschiedlichen Termine und verschiedenen Ansätze zeigen: Die deutsche Klimabewegung ist sich uneinig – und sucht nach neuen Strategien.
Im vergangenen Jahr mussten die Aktivistinnen und Aktivisten Niederlagen einstecken:
Auch wenn viele der Aktivistinnen und Aktivisten das nicht offen zugeben: Die meisten spüren den Wandel. Und innerhalb der verschiedenen Bewegungen gibt es Strategie- und Personalwechsel.
Wie keine andere Klimagruppierung hat die Initiative “Letzte Generation” im vergangenen Jahr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun bröckelt es hinter der nach außen so entschlossenen Fassade: Im Januar gaben die Aktivistinnen und Aktivisten bekannt, dass sie sich in Zukunft nicht mehr auf die Straße kleben werden. Anfang Februar verkündete die Sprecherin der Bewegung dann überraschend, dass die Bewegung für das Europaparlament kandidieren möchte. Mit Lina Johnsen und Theo Schnarr stellt die Bewegung zwei eher unbekannte Gesichter dafür auf.
Für Maria-Christina Nimmerfroh, die als Psychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Letzte Generation intensiv beobachtet hat, ist die Gruppierung klar in einer Krise: “Solche Bewegungen zerlegen sich immer von innen”, sagt sie zu Table.Media. Nicht der mediale Druck und auch nicht die harten Gerichtsverfahren brächten die Aktivisten aus dem Konzept, sondern interne Unstimmigkeiten und Streit.
Zuletzt habe sich gezeigt, dass die Organisationsstruktur der “funktionalen Hierarchie”, mit der die Gruppe Entscheidungen trifft, an ihre Grenzen stoße. Außerdem habe die Letzte Generation massive Nachwuchsprobleme. Es sei ihr bisher nicht gelungen, in größerem Maß junge Menschen für den Aktivismus zu rekrutieren. Das liege auch daran, dass die Organisation sehr hohe Ansprüche stelle – am besten sollte man sich in Vollzeit engagieren. Simon Teune, Protestforscher an der FU Berlin, fügt hinzu, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten “frustriert und ausgepowert” sind.
Das Gegenbeispiel bleibt Fridays for Future. Darya Sotoodeh, Sprecherin von FFF, betont im Gespräch mit Table.Media: “Unsere Stärke ist, dass wir für viele Menschen anschlussfähig sind”. Dazu gehören Demonstrationen mit breiten Bündnissen wie mit den Gewerkschaften am 1. März. Auch die Beteiligung an der Organisation der großen Demonstrationen gegen rechts Anfang des Jahres sei ein Teil dieser Strategie. Teune sagt, es sei klar geworden, dass “eine autoritäre, möglicherweise sogar faschistische Politik das Ende einer wirksamen Klimapolitik wäre”.
Aus Sicht von Nimmerfroh ist die Klimabewegung damit aber nicht nach links gerückt – im Gegenteil. Die “Letzte Generation” habe beispielsweise sogar “bürgerlich” wirken wollen und sich vom klaren linken Spektrum abgegrenzt. Grundsätzlich strebten die meisten Klimagerechtigkeitsbewegungen Überparteilichkeit an. “Die Wahrnehmung von Klimaschutzthemen als links kommt eher durch die politische Besetzung der Themen durch die Grünen und die Verbindung von einem nachhaltigen Lebensstil mit linken Assoziationen der Nonkonformität und des Konsumverzichts”, meint Nimmerfroh. Zum rechten Rand gibt es aber eine klare Abgrenzung: FFF will sich besonders auf die “Mobilisierung von jungen Menschen, insbesondere anlässlich der Wahlen in Europa und Sachsen, Thüringen und Brandenburg” konzentrieren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
Mit breiten Bündnissen versuche FFF zudem Menschen zu erreichen, die sich bisher noch nicht fürs Klima engagieren. Das zeigt auch die aktuelle Kampagne “Wir fahren zusammen” in der FFF, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs an der Seite der Dienstleistungsgesellschaft Verdi unterstützt.
Für Protestforscher Dieter Rucht ist das “im Prinzip” eine erfolgversprechende Strategie. “Die Bewegung gewinnt an Breite”, sagt er dazu. “Damit entsteht aber auch die Gefahr, dass die Bewegung an Profil verliert und es zu internen Konflikten kommt”.
“Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint auch Sotoodeh zur Allianz mit Verdi. Zum einen sei die Verkehrswende ein wichtiges Thema. Der bessere Ausbau vom Nahverkehr sowie bezahlbare Preise für Bus und Bahn sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten seien zum anderen Themen, hinter denen eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung stehe. Die Kampagne sei auch wichtig, weil sie zeige, dass sich soziale Verbesserungen nicht gegen Klimaschutz ausspielen ließen. Außerdem sei sie greifbar und habe somit das Potenzial, viele Menschen zu erreichen.
Finanziert werden soll der Ausbau des ÖPNV aus Sicht von FFF über ein 100-Milliarden-Sondervermögen für eine sozial-gerechte Transformation. “Nicht das Geld für sozial gerechten Klimaschutz fehlt, sondern der politische Wille, es dafür einzusetzen”, fügt die Aktivistin hinzu. Zudem habe ein Streik von Arbeitskräften noch einmal mehr Macht als ein Schulstreik.
Wie erfolgreich FFF mit dieser Strategie die Klimaagenda nach vorne bringt, ist aber noch offen: Simon Teune denkt, es brauche “ein Nachdenken darüber, welche Hebel mit den begrenzten Ressourcen in Bewegung gesetzt werden können”. Möglicherweise dienten erst neue Extremwetterereignisse oder noch höhere Temperaturen als “Augenöffner”, um wieder Menschen zu aktivieren.
Auch die Expertin für soziale Bewegungen Nimmerfroh hat das Gefühl, dass die Klimabewegung aktuell kaum gehört wird. Protestforscher Rucht sieht die Probleme, von einer Krise der Klimabewegung will er aber nicht sprechen. Stattdessen sagt er, sie befinde sich in einer “Phase der Neuorientierung“. Klar sei aber, dass “es so nicht weiter geht”. Weder der breite, freundliche Ansatz von FFF noch die auffälligen Aktionen der “Letzten Generation” brächten signifikante politische Erfolge.

In Österreich hat ein Teil der klimawissenschaftlichen Community den Druck auf die Regierung erhöht, die überfällige Planung zur Energie- und Klimapolitik bei der EU-Kommission einzureichen. Dazu haben Wissenschaftler des Klimaforschungsnetzwerk CCCA am Mittwoch eine Pressekonferenz abgehalten und eine Bewertung von mehr als 1.400 Maßnahmen vorgestellt. Zusätzlich wurde eine repräsentative Meinungsumfrage eingeholt.
Die Maßnahmen stammen aus 100 Stellungnahmen von Vertretern aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diese sind während der Konsultationsphase zum Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplan Österreichs (NECP) eingelangt. Der Entwurf sollte bereits der EU-Kommission vorliegen, doch ÖVP und Grüne liegen darüber im koalitionsinternen Streit. Deshalb läuft gegen das Land seit Dezember 2023 ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.
Auf der Pressekonferenz betonten die Vertreter aus der Klimaforschung erneut, es sei zentral, dass Österreich diesen Entwurf vorlegt. Zudem stellten sie ausgewählte Maßnahmen aus den Stellungnahmen vor. Darunter auch solche, die besonders viel Zustimmung bekamen: Leerstandsabgaben, Heizungstausch, ÖPNV-Ausbau, die Streichung klimaschädlicher Subventionen und ein klimafreundlicheres Steuersystem.
Bis zum 30. Juni 2024 müssen alle Mitgliedstaaten ihre finalen NECPs abgeben. Darin skizzieren sie, wie sie ihre Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Österreich fehlen mit den bisher umgesetzten Maßnahmen 13 Prozentpunkte auf die EU-Vorgabe von minus 48 Prozent an Treibhausgasen. Diese Lücke könne auch mit dem aktuellen NECP-Entwurf nicht geschlossen werden, mahnte das CCCA bereits letztes Jahr. “Somit müssen einige der vorgeschlagenen Maßnahmen aufgenommen werden, wenn Österreich keine Vertragsverletzung riskieren möchte”, mahnt der Klimaforscher Keywan Riahi vom IIASA-Institut auf der Pressekonferenz.
Auch gegen Polen läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren, weil man wie Österreich versäumt hatte, den NECP-Entwurf fristgerecht an die Kommission zu übermitteln. Deutschlands Entwurf wurde von der Kommission mittlerweile überprüft. Er ist in Teilen unzureichend. Verbesserungen dafür haben Marion Guénard und Charly Heberer von der NGO Germanwatch in einem Standpunkt bei Table.Media vorgeschlagen.
Die unabhängige Bewertung der mehr als 1.400 vorgeschlagenen Maßnahmen für Österreichs NECP wurde von 55 Klimaforschenden bekannter Institute wie der BOKU Wien, Universität Graz und dem IIASA in Laxenburg durchgeführt und vom CCCA koordiniert. Die Maßnahmen wurden nach ihrem Potenzial zur Treibhausgasreduktion bewertet und nach Priorität gebündelt. Anschließend wurde das Gallup-Institut beauftragt, für 27 besonders effektive Maßnahmen die Zustimmung der Bevölkerung repräsentativ zu erheben. Diese befürwortet 24 von 27 dieser Maßnahmen.
Eine hohe Zustimmung von mehr als 60 Prozent gibt es beispielsweise für:
Eine geringe Zustimmung von weniger als 40 Prozent gab es beispielsweise für:
Österreichs Bundesregierung ist nicht verpflichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen in den NECP-Entwurf zu übernehmen. Da die Bewertung des Klimaforschungsnetzwerk CCCA vom Klimaschutzministerium gefördert wurde, dürfte sie aber berücksichtigt werden. Umwelt-NGOs wie Greenpeace und WWF Österreich sehen in der Bewertung eine Grundlage für Österreichs Klimapolitik. “Die Wissenschaft steht bereit, im politischen Prozess neutral zu vermitteln”, lädt Karl Steiniger von der Universität Graz zur Kooperation ein. Er war neben Keywan Riahi einer der Leitautoren des Berichts und begrüßt den partizipativen Ansatz des Klimaschutzministeriums. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wären Österreichs EU-Klimaziele “klar erreichbar”, betont Steininger.
Unterdessen geht der Koalitionsstreit um den NECP-Entwurf weiter. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte im Oktober den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übermittelten Entwurf zurückgezogen. Das begründete sie damit, dass dieser nicht mit dem Regierungspartner abgesprochen worden sei. Gewessler dementierte, man habe die betroffenen Ministerien einbezogen. Vor wenigen Tagen drängte sie ihre Ministerkollegin im ZiB2-Interview des ORF erneut dazu, den Entwurf nach Brüssel zu schicken. Doch Edtstadler bleibt bei ihrer Kritik und blockiert weiter.
29. Februar, 9 Uhr, Leipzig
Symposium Trinkwasserversorgung aus Talsperren im Klimawandel
Die Sicherheit der Trinkwasserversorgung aus Talsperren wird in besonderer Weise durch klimatische Veränderungen beeinflusst. Neben den für alle sichtbaren Dürre- und Hochwasserereignissen sind die Auswirkungen auf die Wasserqualität gravierend. Anpassungen im Management der Talsperren und Einzugsgebiete sowie in der Technologie der Wasseraufbereitung sind nötig. Wie die aussehen können, wird auf dem Symposium des Umweltforschungszentrums (UFZ) diskutiert. Infos
29. Februar, 19 Uhr, Online
Podiumsdiskussion Wem gehören die Flüsse? Wasser in Amazonien zwischen Lebensgrundlage und Rohstoff
Das Wasser der Flüsse und der mit den Staudämmen erzeugte elektrische Strom soll jetzt für die Herstellung von “Grünem Wasserstoff” genutzt werden, der dann exportiert wird – beispielsweise nach Deutschland. Wie grün sind Wasserkraft und Wasserstoff wirklich und welche Konflikte entstehen bei der Energiegewinnung entlang der blauen Adern Amazoniens? Um diese Konflikte geht es bei der Podiumsdiskussion der Nichtregierungsorganisation Gegenströmung. Infos
1. März, bundesweit
Demonstrationen Klimastreik Wir Fahren Zusammen
Fridays for Future organisiert zusammen mit der Gewerkschaft Verdi bundesweit einen Klimastreik. Dafür sind in zahlreichen Städten verschiedene Aktionen geplant. Infos
4. und 5. März, Vila do Conde, Brasilien
Arbeitstreffen G20 Global Mobilization against Climate Change Task Force
Die Taskforce soll in den G20 den Klimaschutz vorantreiben. Es ist ihr erstes Treffen unter Brasiliens G20-Vorsitz. Infos
4. und 5. März, Brüssel
Konferenz Solar Power Summit
Auf der Konferenz geht es darum, wie der Ausbau von Solarenergie auf europäischer Ebene vorangetrieben werden kann, um die Klimaziele von 2040 zu erreichen. Infos
5. und 6. März, Berlin
Konferenz Energie.Cross.Medial
Die Konferenz findet unter dem Motto “Umsetzung der Energiewende: zwischen Wunsch und Wirklichkeit” statt und soll verschiedene Stakeholder der Energiewende zusammenbringen. Infos
6. März, 9 Uhr, Online
Konferenz Mittelgebirgskonferenz: Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Auf dieser Konferenz stehen regionale und kommunale Anpassung im Mittelpunkt. Sie wird von den Klimakompetenzzentren der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen organisiert. Infos
6. März, 16 Uhr, Online
Webinar Urbane grün-blaue Infrastruktur – Renaturierung und natürliche Lösungen im Klimawandel
Das UN-Dekade-Büro organisiert regelmäßig Online-Dialoge rund um das Kernthema “Wiederherstellung von Ökosystemen”. Bei diesem sprechen Stefan Pauleit von der TU München und Rüdiger Dittmar von der Stadt Leipzig. Anmeldeschluss ist am 4. März. Infos
7. und 8. März, Paris
Forum Buildings and Climate Global Forum
Das Globale Forum Gebäude und Klima wird Minister und Vertreter wichtiger Organisationen zusammenbringen, um die Dekarbonisierung und Widerstandsfähigkeit des Gebäudesektors voranzutreiben. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art und knüpft an die Fortschritte an, die auf der jüngsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) erzielt wurden.
Die Veranstaltung wird gemeinsam von Frankreich und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit Unterstützung der Globalen Allianz für Gebäude und Bauwesen (GlobalABC) organisiert. Infos
7. März, 15 Uhr, Online
Webinar Deforestation Exposed: Using High Resolution Satellite Imagery to Investigate Forest Clearing
Dieses vom World Resources Institute organisierte Webinar bietet einen Überblick über die auf Global Forest Watch (GFW) verfügbaren Satellitenbilder und Ressourcen. Infos
Im vergangenen Jahr haben die europäischen Staaten mit 16,2 Gigawatt eine Rekordmenge an Windkraftanlagen neu gebaut. Der Zubau wecke die Hoffnung, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 erreichen kann, schreibt der Industrieverband “WindEurope” in seinem Jahresbericht.
In dem Bericht beschreibt der Verband das Jahr 2023 als ein Jahr mit “signifikanten Verbesserungen” in Schlüsselbereichen des europäischen Windenergiesektors. Im Jahr 2022 hatte der Sektor mit steigenden Inflationsraten, Zinssätzen und volatilen Energiemärkten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu kämpfen.
Mittlerweile haben die EU-Staaten die Genehmigungsverfahren für neue Projekte verbessert und die Inflation hat nachgelassen. Ebenso lobt der Verband das Windkraftpaket der Europäischen Kommission von Oktober, das Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der Branche vorsieht.
Ungetrübter Grund zur Freude ist das alles aber nicht: Um ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen, muss die EU im Schnitt 33 Gigawatt Windenergie jährlich zubauen – also doppelt so viel wie im vergangenen Rekordjahr, so WindEurope. kul/rtr/nib
Das Verhältnis der Deutschen zum Klimaschutz ist ambivalent: 71 Prozent ermuntern die politisch Verantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass einmal beschlossene Ziele auch eingehalten werden. Gleichzeitig halten es 49 Prozent für eine schlechte Idee, klimaschädliches Verhalten durch höhere Preise zu sanktionieren. Das geht aus einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts Pollytix im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor.
62 Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, die politischen Akteure sollten mehr für den Klimaschutz tun. Auch mit sich selbst gehen die Deutschen in puncto Klimaschutz durchaus kritisch um: 37 Prozent finden, sie selbst könnten mehr für das Klima und dessen Schutz tun.
Bei den möglichen Maßnahmen gibt es mit 81 Prozent große Unterstützung dafür, klimafreundliches Verhalten zu unterstützen, etwa durch finanzielle Förderung. Klimaschädliches Verhalten durch Gesetze zu verbieten, halten 55 Prozent für eine gute Idee. Den Vorschlag, klimaschädliches Verhalten zu verteuern, unterstützen dagegen nur 47 Prozent. Eine Mehrheit dafür gibt es nur in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 3.000 Euro.
Die Pollytix-Forscher folgern daraus: “Es braucht einen klaren Plan für mehr Klimaschutz.” Eine Mehrheit sehe diesen unter den gegebenen Umständen aber “aktuell nicht”. Und: Es sei geboten, die Komplexität des Themas zu reduzieren und klimaschädliches Verhalten deutlich zu benennen. Deshalb sei die “Wirksamkeit der Maßnahmen in einfacher, klarer Sprache (zu) benennen”. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie finden Sie hier.
Das EU-Renaturierungsgesetz, das am Dienstag mit knapper Mehrheit vom EU-Parlament angenommen wurde, hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Klimapolitik. 329 Europaabgeordnete stimmten dafür, 275 dagegen und 24 enthielten sich, als das erste Gesetz dieser Art auf europäischer Ebene abgestimmt wurde. Mit ihm sollen die Ziele des Kunming-Montreal-Rahmenabkommens zur Biodiversität erreicht werden: Bis 2030 müssen mindestens 20 Prozent der sanierungsbedürftigen Land- und Meeresflächen der EU wiederhergestellt werden.
Das hat Auswirkungen auf den Klimaschutz. Denn gemäß EU-Klimaziel sollen zehn Prozent der Emissionsreduktionen im LULUCF-Sektor (Land Use, Land-Use Change and Forestry) durch intakte Ökosysteme erreicht werden – beispielsweise durch Wiederaufforstung oder die Wiedervernässung von Mooren. Dieses Ziel entspricht IPCC-Vorgaben, 30 bis 50 Prozent der degradierten Ökosysteme unter Schutz zu stellen, um die Kapazitäten zur Speicherung von Kohlenstoff zu erhöhen.
Das Gesetz wurde im Verfahren insbesondere auf Druck der christdemokratischen EVP erheblich verwässert. Es sieht nun vor:
Allerdings ist fraglich, ob die Klimaziele mit dem vorliegenden Gesetz überhaupt erreicht werden können, denn es bleibt hinter dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission zurück.
Zudem ist noch offen, wie Renaturierungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Zwar schreibt die Kommission selbst, dass der Nutzen des Gesetzes (1.860 Milliarden Euro) die Kosten (circa 154 Milliarden Euro) bei Weitem überwiegt. Jedoch sieht das Gesetz keine Anreizmechanismen für die Renaturierung vor, sondern macht ausschließlich ordnungspolitische Vorgaben. Konkrete Finanzierungszusagen fehlen bislang.
So fehlt auch für Waldbesitzer der Anreiz, in Renaturierung statt in Nutzwirtschaft des Waldes zu investieren. Dabei wird die Senkenleistung des Waldes zum Erreichen der EU-Klimaziele dringend benötigt. Fördermöglichkeiten dafür bleiben Aufgaben für die nächste EU-Kommission. luk
In vielen europäischen Ländern ist der Verkauf von Wärmepumpen im Jahr 2023 zurückgegangen. Das geht aus Zahlen der European Heat Pump Association hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Mit 2,65 Millionen lag die Zahl EU-weit um fünf Prozent niedriger als im Boom-Jahr 2022, aber immer noch um 31 Prozent höher als 2021.
Als Grund für den Rückgang nennt der Verband, dass die EU ihren für letztes Jahr angekündigten Wärmepumpen-Aktionsplan bisher noch nicht vorgelegt hat. Zudem hätten viele Länder die Förderbedingungen, die 2022 in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine stark ausgeweitet wurden, 2023 wieder zurückgefahren. Das gilt etwa für Italien, wo die Zahlen besonders stark zurückgingen.
Deutschland steht im EU-Vergleich am besten da: Etwa 440.000 Wärmepumpen wurden hierzulande verkauft, ein Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das liegt allerdings vor allem daran, dass im ersten Halbjahr 2023 noch viele Aufträge aus dem Jahr 2022 abgearbeitet wurden; in der zweiten Jahreshälfte gingen die Zahlen auch in Deutschland zurück. “Die sehr destruktive und irreführende Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und das lange Warten auf die neue Förderkulisse haben den Markt insbesondere im letzten Quartal spürbar gelähmt”, sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), Claus Fest.
Inzwischen gibt es Klarheit über die Wärmepumpen-Förderung: Seit dieser Woche können die Zuschüsse, die für eine Investition bis zu 30.000 Euro mindestens 30 und maximal 70 Prozent betragen, zunächst für selbstgenutzte Einfamilienhäuser bei der KfW beantragt werden. Besitzer von Eigentumswohnungen können die Förderung voraussichtlich ab Mai beantragen, Vermieter ab August. Mit der Förderung allein ist es nach Ansicht des BWP aber noch nicht getan. Um den Umstieg zu beschleunigen, müsse die Politik dafür sorgen, dass Strom pro Kilowattstunde höchstens 2,5-mal so viel kostet wie Gas. mkr/av
Fische im Nordpazifik haben seit 2010 stark an Gewicht verloren. Das liege daran, dass sie im wärmeren Wasser weniger Futter finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Universität Tokio. Die Forschenden hatten dafür Daten zum individuellen Gewicht und der Biomasse von 13 Fischarten ausgewertet.
In den 1980er-Jahren waren die Fische auch schon einmal besonders leicht gewesen. Die erste Periode des Gewichtsverlusts sei damals auf eine größere Anzahl an Sardinen und damit mehr Konkurrenz ums Futter zurückzuführen gewesen. Aktuell hänge das niedrige Gewicht hingegen vor allem damit zusammen, dass durch die höheren Temperaturen weniger kühles, nährstoffreiches Wasser an die Meeresoberfläche komme.
Für Meeressäuger ist der warme Nordpazifik unter Umständen sogar tödlich: Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Buckelwale dort zwischen 2012 und 2021 um 20 Prozent zurückging. Besonders problematisch war die Meereshitzewelle “The Blob” zwischen 2013 und 2016, während der laut der Studie rund 7.000 Buckelwale verhungert sind. Durch den Klimawandel werden Hitzewellen in den Ozeanen häufiger: Aktuell warnen Wissenschaftler beispielsweise vor den Folgen der ungewöhnlich hohen Temperaturen im Atlantik. kul
Die Luftfahrt ist weiterhin ein erheblicher Treiber des Klimawandels und der Luftverschmutzung. Zwar waren die CO₂-Emissionen des Luftverkehrs im Pandemiejahr 2020 zurückgegangen, doch mittlerweile steigen sie wieder und werden voraussichtlich 2025 das Niveau vor der Pandemie erreichen. Das hat eine Studie der Thinktanks ODI und Transport & Environment ergeben.
Die Autoren haben dabei anhand von Daten von 2019 auch die schmutzigsten Flughäfen untersucht – gemessen an CO₂ und anderen Emissionen. Dubai ist demnach der weltweit schmutzigste Flughafen mit über 20 Millionen Tonnen CO₂ – und 7.531 Tonnen Stickstoff-Emissionen (NOx). Dahinter liegen London-Heathrow (19,1 MtCO₂) und Los Angeles (18,7 MtCO₂). Der Frankfurter Flughafen liegt mit 13,9 MtCO₂ auf Platz 8 des weltweiten Rankings, direkt hinter Paris Charles de Gaulle (14,2 MtCO₂).
“Die 100 umweltschädlichsten Flughäfen verursachten 610 MtCO₂“, schreiben die Autoren. Das entspreche 152 Kohlekraftwerken und mache 65 Prozent der gesamten CO₂-Emissionen im Personen- und Frachtverkehr aus. Dazu kämen 213.000 Tonnen NOx und 2.400 Tonnen Feinstaubemissionen (PM2,5), heißt es in der Studie. Die Zahlen machten deutlich, dass der Luftfahrtsektor nicht auf dem richtigen Weg sei, um seine Emissionen im Einklang mit den weltweit vereinbarten Zielen zu begrenzen. Außerdem zeigen sie, dass die Emissionen im regionalen Vergleich ungleich verteilt sind und die größten Verschmutzung im Asien-Pazifik-Raum, Nordamerika und Europa erfolgen. luk
Die wachsende Abhängigkeit von Flüssiggas-Importen entzweit zunehmend die Mitgliedsländer der EU. Bei ihrem Treffen in Brüssel am kommenden Montag diskutieren die Energieminister eine Beschwerde mehrerer mitteleuropäischer Staaten ohne LNG-Häfen über gestiegene Durchleitungsgebühren in Deutschland.
In der Kritik steht die Gasspeicherumlage, mit der die Bundesrepublik seit Oktober 2022 die Kosten für die staatlich angeordneten Wintervorräte des Marktgebietsverantwortlichen THE refinanziert. Fällig wird sie nicht nur für deutsche Gasverbraucher, sondern auch für Exporte. “Die Umlage bestraft die verwundbarsten Staaten ohne direkten Zugang zu LNG-Terminals”, heißt es in einem Schreiben von Tschechien, Österreich, Polen, Ungarn und der Slowakei, über das zuerst die Financial Times berichtete. “Letztlich könnte dies mehrere Mitgliedstaaten dazu zwingen, sich stärker auf Gasimporte aus Russland zu verlassen.”
Die Gasspeicherumlage hatte 2022 noch bei 59 Cent pro Megawattstunde gelegen und wurde zu Jahresbeginn auf 1,86 Euro erhöht. “Insgesamt kostet der Transit durch Deutschland etwa drei Euro pro Megawattstunde. Nicht wenig in Zeiten, wo Gas wieder bei 25 bis 28 Euro gehandelt wird”, sagt Gasexperte Jens Völler von Team Consult.
Erst im Februar hatte die Berliner Koalition die Umlage bis März 2027 verlängert. Inzwischen bereitet auch Italien eine ähnliche Abgabe an Grenzübergangspunkten vor. Solche unilateralen Maßnahmen würden den europäischen Gasmarkt erheblich beeinträchtigen, kritisieren die mitteleuropäischen Staaten.
Die deutschen und italienischen Umlagen beschäftigen inzwischen auch die EU-Kommission. “Wir haben bei all unseren Kontakten betont, dass Entgelte mit dem EU-Rechtsrahmen übereinstimmen müssen”, sagte eine Sprecherin von Energiekommissarin Kadri Simson vor der Debatte am 4. März. Nach Informationen von Table.Media läuft bereits ein “Pilotverfahren” unter Beteiligung der Bundesregierung, um den Streit zu lösen. ber
Mit der Verschiebung der Entscheidung über das europäische Lieferkettengesetz CSDDD liegen vorerst auch die Regeln für Klimaschutzmaßnahmen im internationalen Handel der EU auf Eis. Bei einer Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel zeichnete sich keine Mehrheit für das Gesetz ab; die endgültige Abstimmung wurde erneut verschoben.
Rat, EU-Parlament und EU-Kommission hatten sich im Dezember bereits auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Auf Druck der FDP hatte die deutsche Bundesregierung im Januar ihre Enthaltung erklärt, auch weitere Mitgliedstaaten haben Bedenken.
Die Richtlinie legt unternehmerische Sorgfaltspflichten für Auswirkungen auf Menschenrechte, Umwelt und Klima fest. Ziel ist laut EU-Kommission auch, die EU-Klimagesetzgebung samt der Klimaziele für 2030 und 2050 zu ergänzen. Artikel 15 legt Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels fest:
Die Sorgfaltspflichten umfassen sowohl die vorgelagerte Wertschöpfungskette (etwa den Rohstoffabbau) als auch teilweise die nachgelagerte Kette (Verwendung, Verwertung, Entsorgung). Die Unternehmen sind verpflichtet, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu kontrollieren, zu überwachen und darüber zu berichten.
Der Einigung im Rat ist eine klare Frist gesetzt: Im April muss das Parlament in seiner letzten Plenarsitzung vor den Europawahlen der Richtlinie formal zustimmen. leo
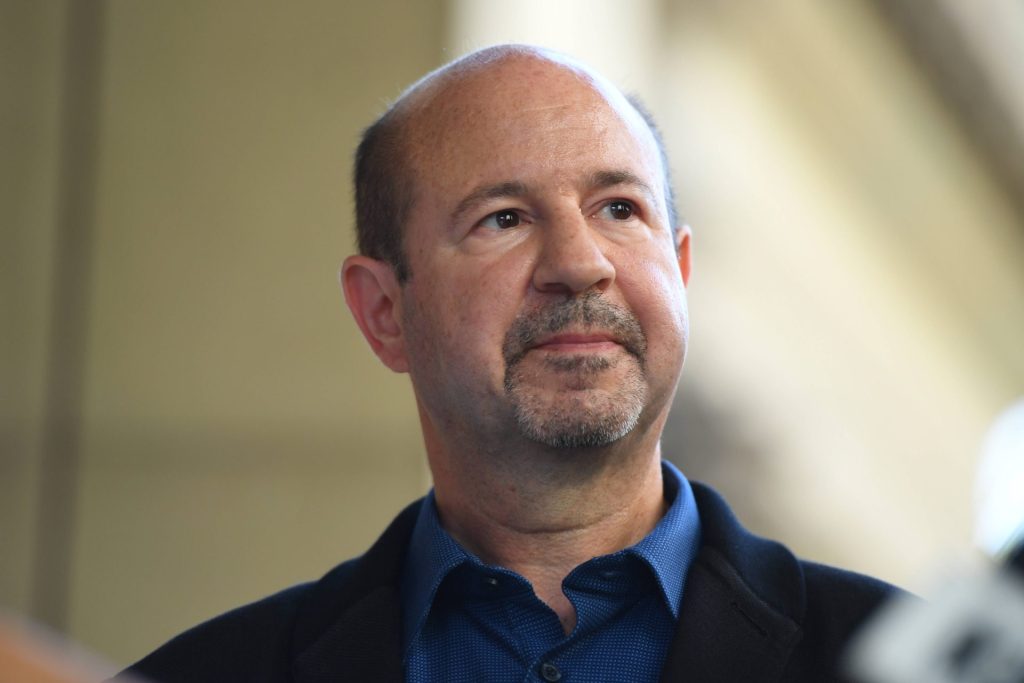
Michael Mann hat die meiste Zeit seiner Karriere als untypische Figur des öffentlichen Lebens verbracht. Er ist sowohl für seine Forschung als Klimawissenschaftler bekannt als auch für seine Bereitschaft, Wissenschaftsleugnern entgegenzutreten.
Der 58-Jährige gewann im Februar einen Prozess gegen zwei rechtsgerichtete Autoren, die 2012 in zwei Blogbeiträgen behauptet hatten, er habe seine Daten manipuliert, und ihn mit dem Kinderschänder Jerry Sandusky verglichen. Die Autoren nannten Mann den “Jerry Sandunsky der Klimawissenschaft”, denn anstelle von Kindern hätte er seine Daten “belästigt und gequält”. Ein Geschworenengericht entschied vor kurzem in dem Zivilprozess, die Autoren hätten den Wissenschaftler verleumdet, und sprachen ihm über eine Million US-Dollar Entschädigung wegen Rufschädigung zu.
Manns erste Begegnungen mit Verleumdung liegen Jahrzehnte zurück. Schon als wenig bekannter Wissenschaftler machte er schlechte Erfahrungen mit Klimawandel-Leugnern. Er und einige Kollegen hatten die Temperaturen des Planeten über die vergangenen Jahrtausende rekonstruiert und die Datenpunkte in einem ikonischen Diagramm dargestellt, das wie ein Hockeyschläger aussah. Es zeigte eine relativ stabile globale Temperatur bis zu einem plötzlichen deutlichen Anstieg im 20. Jahrhundert. Als dann das oberste UN-Klimawissenschaftsgremium das Hockeyschläger-Diagramm in seiner großen Klimabilanz im Jahr 2001 vorstellte, versuchten Klimawandel-Leugner, Manns Arbeit zu diskreditieren.
Diese Erfahrung lehrte Mann, dass er es sich nicht leisten kann, das Rampenlicht zu meiden. “Anfänglich habe ich mich selbst und meine Wissenschaft gegen böswillige Angriffe verteidigt”, sagte Mann. “Mit der Zeit lernte ich zu schätzen, dass ich auch eine größere Rolle spielen kann”.
Die größere Rolle, die Mann jetzt spielt, besteht darin, Fehlinformationen über das Klima abzuwehren und die Wissenschaftskommunikation zu fördern. Er betrachtet seine Verleumdungsklage als einen Teil dieser Aufgabe und sagt, er hoffe, dass sie “einen Raum für andere Wissenschaftler schafft, die sich nicht aus dem Labor wagen.”
Im Jahr 2022 verließ Mann seine langjährige Stelle an der Penn State University, um dem Kleinman Center for Energy Policy der University of Pennsylvania beizutreten, einem Programm, das an der Schnittstelle von Klimawissenschaft, Politik und Kommunikation arbeitet. Mann hat einen Doktortitel in Geologie und Geophysik und studierte Physik und angewandte Mathematik in Berkeley und Yale. Er hat ein halbes Dutzend Bücher verfasst, darunter ein Kinderbuch, ist mit dem Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio befreundet und war 2021 als Berater für die Klima-Filmsatire “Don’t Look Up” tätig.
Mann nimmt sich Zeit für Musik und Familie, und eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Nachspielen von Liedern nach Gehör auf dem Klavier. Er hat eine 18-jährige Tochter, die sein Interesse für Informatik und Mathematik teilt.
Eine Sache, die er nicht mag, sind Bücher und Filme mit apokalyptischen Klimaszenarien, die den Menschen die Hoffnung für die Zukunft rauben. “Wir müssen die emotionale Energie, die die Menschen wegen der Klimakrise empfinden, in etwas Positives umwandeln.” Rebecca Leber, Washington D.C.
für diesen Freitag ruft Fridays For Future wieder bundesweit zum Klimastreik auf: Um gegen schrumpfende Teilnehmerzahlen anzugehen und um breitere Unterstützung zu erhalten, gehen die Aktivisten zusammen mit der Gewerkschaft Verdi auf die Straße. Grund genug für uns, zu analysieren, wie sich die Klimabewegung in Deutschland gerade neu orientiert.
Außerdem schauen wir über die Alpen nach Österreich: Aus Wien erklärt Lukas Bayer für uns, warum das Land aktuell keinen Klimaplan hat und der Entwurf dafür ungenügend ist – übrigens wie auch der deutsche.
Auf EU-Ebene sind in dieser Woche auch wichtige Klimaentscheidungen gefallen: Das Renaturierungsgesetz wurde am Dienstag mit knapper Mehrheit angenommen. Lukas Scheid erklärt, warum es weniger Klimaeffekt haben wird, als ursprünglich geplant. Vorerst gescheitert ist hingegen das europäische Lieferkettengesetz. Leonie Düngefeld erklärt, warum es auch ein Verlust fürs Klima wäre, wenn das Gesetz tatsächlich nicht kommt.
Zudem lesen Sie bei uns, warum der Klimawandel Fische leichter macht, was hinter dem Boom an Wärmepumpen in Deutschland steckt und welches die schmutzigsten Flughäfen der Welt sind. Spoiler: Für die COP28 habe viele von uns und Ihnen den klimaschädlichsten im vergangenen Jahr hautnah erlebt.
Bleiben Sie dran!


Am 1. März will Fridays for Future (FFF) zusammen mit der Gewerkschaft Verdi für Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr demonstrieren. Dieses Bündnis wurde bereits erprobt, ist aktuell aber auch der Versuch, wieder mehr Menschen zu erreichen und Sympathien zurückzugewinnen. Anders geht die Gruppe Letzte Generation vor: Sie hat für den 16. März zu “ungehorsamen Versammlungen” in verschiedenen deutschen Städten aufgerufen. Die unterschiedlichen Termine und verschiedenen Ansätze zeigen: Die deutsche Klimabewegung ist sich uneinig – und sucht nach neuen Strategien.
Im vergangenen Jahr mussten die Aktivistinnen und Aktivisten Niederlagen einstecken:
Auch wenn viele der Aktivistinnen und Aktivisten das nicht offen zugeben: Die meisten spüren den Wandel. Und innerhalb der verschiedenen Bewegungen gibt es Strategie- und Personalwechsel.
Wie keine andere Klimagruppierung hat die Initiative “Letzte Generation” im vergangenen Jahr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun bröckelt es hinter der nach außen so entschlossenen Fassade: Im Januar gaben die Aktivistinnen und Aktivisten bekannt, dass sie sich in Zukunft nicht mehr auf die Straße kleben werden. Anfang Februar verkündete die Sprecherin der Bewegung dann überraschend, dass die Bewegung für das Europaparlament kandidieren möchte. Mit Lina Johnsen und Theo Schnarr stellt die Bewegung zwei eher unbekannte Gesichter dafür auf.
Für Maria-Christina Nimmerfroh, die als Psychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Letzte Generation intensiv beobachtet hat, ist die Gruppierung klar in einer Krise: “Solche Bewegungen zerlegen sich immer von innen”, sagt sie zu Table.Media. Nicht der mediale Druck und auch nicht die harten Gerichtsverfahren brächten die Aktivisten aus dem Konzept, sondern interne Unstimmigkeiten und Streit.
Zuletzt habe sich gezeigt, dass die Organisationsstruktur der “funktionalen Hierarchie”, mit der die Gruppe Entscheidungen trifft, an ihre Grenzen stoße. Außerdem habe die Letzte Generation massive Nachwuchsprobleme. Es sei ihr bisher nicht gelungen, in größerem Maß junge Menschen für den Aktivismus zu rekrutieren. Das liege auch daran, dass die Organisation sehr hohe Ansprüche stelle – am besten sollte man sich in Vollzeit engagieren. Simon Teune, Protestforscher an der FU Berlin, fügt hinzu, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten “frustriert und ausgepowert” sind.
Das Gegenbeispiel bleibt Fridays for Future. Darya Sotoodeh, Sprecherin von FFF, betont im Gespräch mit Table.Media: “Unsere Stärke ist, dass wir für viele Menschen anschlussfähig sind”. Dazu gehören Demonstrationen mit breiten Bündnissen wie mit den Gewerkschaften am 1. März. Auch die Beteiligung an der Organisation der großen Demonstrationen gegen rechts Anfang des Jahres sei ein Teil dieser Strategie. Teune sagt, es sei klar geworden, dass “eine autoritäre, möglicherweise sogar faschistische Politik das Ende einer wirksamen Klimapolitik wäre”.
Aus Sicht von Nimmerfroh ist die Klimabewegung damit aber nicht nach links gerückt – im Gegenteil. Die “Letzte Generation” habe beispielsweise sogar “bürgerlich” wirken wollen und sich vom klaren linken Spektrum abgegrenzt. Grundsätzlich strebten die meisten Klimagerechtigkeitsbewegungen Überparteilichkeit an. “Die Wahrnehmung von Klimaschutzthemen als links kommt eher durch die politische Besetzung der Themen durch die Grünen und die Verbindung von einem nachhaltigen Lebensstil mit linken Assoziationen der Nonkonformität und des Konsumverzichts”, meint Nimmerfroh. Zum rechten Rand gibt es aber eine klare Abgrenzung: FFF will sich besonders auf die “Mobilisierung von jungen Menschen, insbesondere anlässlich der Wahlen in Europa und Sachsen, Thüringen und Brandenburg” konzentrieren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
Mit breiten Bündnissen versuche FFF zudem Menschen zu erreichen, die sich bisher noch nicht fürs Klima engagieren. Das zeigt auch die aktuelle Kampagne “Wir fahren zusammen” in der FFF, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs an der Seite der Dienstleistungsgesellschaft Verdi unterstützt.
Für Protestforscher Dieter Rucht ist das “im Prinzip” eine erfolgversprechende Strategie. “Die Bewegung gewinnt an Breite”, sagt er dazu. “Damit entsteht aber auch die Gefahr, dass die Bewegung an Profil verliert und es zu internen Konflikten kommt”.
“Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint auch Sotoodeh zur Allianz mit Verdi. Zum einen sei die Verkehrswende ein wichtiges Thema. Der bessere Ausbau vom Nahverkehr sowie bezahlbare Preise für Bus und Bahn sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten seien zum anderen Themen, hinter denen eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung stehe. Die Kampagne sei auch wichtig, weil sie zeige, dass sich soziale Verbesserungen nicht gegen Klimaschutz ausspielen ließen. Außerdem sei sie greifbar und habe somit das Potenzial, viele Menschen zu erreichen.
Finanziert werden soll der Ausbau des ÖPNV aus Sicht von FFF über ein 100-Milliarden-Sondervermögen für eine sozial-gerechte Transformation. “Nicht das Geld für sozial gerechten Klimaschutz fehlt, sondern der politische Wille, es dafür einzusetzen”, fügt die Aktivistin hinzu. Zudem habe ein Streik von Arbeitskräften noch einmal mehr Macht als ein Schulstreik.
Wie erfolgreich FFF mit dieser Strategie die Klimaagenda nach vorne bringt, ist aber noch offen: Simon Teune denkt, es brauche “ein Nachdenken darüber, welche Hebel mit den begrenzten Ressourcen in Bewegung gesetzt werden können”. Möglicherweise dienten erst neue Extremwetterereignisse oder noch höhere Temperaturen als “Augenöffner”, um wieder Menschen zu aktivieren.
Auch die Expertin für soziale Bewegungen Nimmerfroh hat das Gefühl, dass die Klimabewegung aktuell kaum gehört wird. Protestforscher Rucht sieht die Probleme, von einer Krise der Klimabewegung will er aber nicht sprechen. Stattdessen sagt er, sie befinde sich in einer “Phase der Neuorientierung“. Klar sei aber, dass “es so nicht weiter geht”. Weder der breite, freundliche Ansatz von FFF noch die auffälligen Aktionen der “Letzten Generation” brächten signifikante politische Erfolge.

In Österreich hat ein Teil der klimawissenschaftlichen Community den Druck auf die Regierung erhöht, die überfällige Planung zur Energie- und Klimapolitik bei der EU-Kommission einzureichen. Dazu haben Wissenschaftler des Klimaforschungsnetzwerk CCCA am Mittwoch eine Pressekonferenz abgehalten und eine Bewertung von mehr als 1.400 Maßnahmen vorgestellt. Zusätzlich wurde eine repräsentative Meinungsumfrage eingeholt.
Die Maßnahmen stammen aus 100 Stellungnahmen von Vertretern aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diese sind während der Konsultationsphase zum Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplan Österreichs (NECP) eingelangt. Der Entwurf sollte bereits der EU-Kommission vorliegen, doch ÖVP und Grüne liegen darüber im koalitionsinternen Streit. Deshalb läuft gegen das Land seit Dezember 2023 ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.
Auf der Pressekonferenz betonten die Vertreter aus der Klimaforschung erneut, es sei zentral, dass Österreich diesen Entwurf vorlegt. Zudem stellten sie ausgewählte Maßnahmen aus den Stellungnahmen vor. Darunter auch solche, die besonders viel Zustimmung bekamen: Leerstandsabgaben, Heizungstausch, ÖPNV-Ausbau, die Streichung klimaschädlicher Subventionen und ein klimafreundlicheres Steuersystem.
Bis zum 30. Juni 2024 müssen alle Mitgliedstaaten ihre finalen NECPs abgeben. Darin skizzieren sie, wie sie ihre Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Österreich fehlen mit den bisher umgesetzten Maßnahmen 13 Prozentpunkte auf die EU-Vorgabe von minus 48 Prozent an Treibhausgasen. Diese Lücke könne auch mit dem aktuellen NECP-Entwurf nicht geschlossen werden, mahnte das CCCA bereits letztes Jahr. “Somit müssen einige der vorgeschlagenen Maßnahmen aufgenommen werden, wenn Österreich keine Vertragsverletzung riskieren möchte”, mahnt der Klimaforscher Keywan Riahi vom IIASA-Institut auf der Pressekonferenz.
Auch gegen Polen läuft bereits ein Vertragsverletzungsverfahren, weil man wie Österreich versäumt hatte, den NECP-Entwurf fristgerecht an die Kommission zu übermitteln. Deutschlands Entwurf wurde von der Kommission mittlerweile überprüft. Er ist in Teilen unzureichend. Verbesserungen dafür haben Marion Guénard und Charly Heberer von der NGO Germanwatch in einem Standpunkt bei Table.Media vorgeschlagen.
Die unabhängige Bewertung der mehr als 1.400 vorgeschlagenen Maßnahmen für Österreichs NECP wurde von 55 Klimaforschenden bekannter Institute wie der BOKU Wien, Universität Graz und dem IIASA in Laxenburg durchgeführt und vom CCCA koordiniert. Die Maßnahmen wurden nach ihrem Potenzial zur Treibhausgasreduktion bewertet und nach Priorität gebündelt. Anschließend wurde das Gallup-Institut beauftragt, für 27 besonders effektive Maßnahmen die Zustimmung der Bevölkerung repräsentativ zu erheben. Diese befürwortet 24 von 27 dieser Maßnahmen.
Eine hohe Zustimmung von mehr als 60 Prozent gibt es beispielsweise für:
Eine geringe Zustimmung von weniger als 40 Prozent gab es beispielsweise für:
Österreichs Bundesregierung ist nicht verpflichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen in den NECP-Entwurf zu übernehmen. Da die Bewertung des Klimaforschungsnetzwerk CCCA vom Klimaschutzministerium gefördert wurde, dürfte sie aber berücksichtigt werden. Umwelt-NGOs wie Greenpeace und WWF Österreich sehen in der Bewertung eine Grundlage für Österreichs Klimapolitik. “Die Wissenschaft steht bereit, im politischen Prozess neutral zu vermitteln”, lädt Karl Steiniger von der Universität Graz zur Kooperation ein. Er war neben Keywan Riahi einer der Leitautoren des Berichts und begrüßt den partizipativen Ansatz des Klimaschutzministeriums. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wären Österreichs EU-Klimaziele “klar erreichbar”, betont Steininger.
Unterdessen geht der Koalitionsstreit um den NECP-Entwurf weiter. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte im Oktober den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) übermittelten Entwurf zurückgezogen. Das begründete sie damit, dass dieser nicht mit dem Regierungspartner abgesprochen worden sei. Gewessler dementierte, man habe die betroffenen Ministerien einbezogen. Vor wenigen Tagen drängte sie ihre Ministerkollegin im ZiB2-Interview des ORF erneut dazu, den Entwurf nach Brüssel zu schicken. Doch Edtstadler bleibt bei ihrer Kritik und blockiert weiter.
29. Februar, 9 Uhr, Leipzig
Symposium Trinkwasserversorgung aus Talsperren im Klimawandel
Die Sicherheit der Trinkwasserversorgung aus Talsperren wird in besonderer Weise durch klimatische Veränderungen beeinflusst. Neben den für alle sichtbaren Dürre- und Hochwasserereignissen sind die Auswirkungen auf die Wasserqualität gravierend. Anpassungen im Management der Talsperren und Einzugsgebiete sowie in der Technologie der Wasseraufbereitung sind nötig. Wie die aussehen können, wird auf dem Symposium des Umweltforschungszentrums (UFZ) diskutiert. Infos
29. Februar, 19 Uhr, Online
Podiumsdiskussion Wem gehören die Flüsse? Wasser in Amazonien zwischen Lebensgrundlage und Rohstoff
Das Wasser der Flüsse und der mit den Staudämmen erzeugte elektrische Strom soll jetzt für die Herstellung von “Grünem Wasserstoff” genutzt werden, der dann exportiert wird – beispielsweise nach Deutschland. Wie grün sind Wasserkraft und Wasserstoff wirklich und welche Konflikte entstehen bei der Energiegewinnung entlang der blauen Adern Amazoniens? Um diese Konflikte geht es bei der Podiumsdiskussion der Nichtregierungsorganisation Gegenströmung. Infos
1. März, bundesweit
Demonstrationen Klimastreik Wir Fahren Zusammen
Fridays for Future organisiert zusammen mit der Gewerkschaft Verdi bundesweit einen Klimastreik. Dafür sind in zahlreichen Städten verschiedene Aktionen geplant. Infos
4. und 5. März, Vila do Conde, Brasilien
Arbeitstreffen G20 Global Mobilization against Climate Change Task Force
Die Taskforce soll in den G20 den Klimaschutz vorantreiben. Es ist ihr erstes Treffen unter Brasiliens G20-Vorsitz. Infos
4. und 5. März, Brüssel
Konferenz Solar Power Summit
Auf der Konferenz geht es darum, wie der Ausbau von Solarenergie auf europäischer Ebene vorangetrieben werden kann, um die Klimaziele von 2040 zu erreichen. Infos
5. und 6. März, Berlin
Konferenz Energie.Cross.Medial
Die Konferenz findet unter dem Motto “Umsetzung der Energiewende: zwischen Wunsch und Wirklichkeit” statt und soll verschiedene Stakeholder der Energiewende zusammenbringen. Infos
6. März, 9 Uhr, Online
Konferenz Mittelgebirgskonferenz: Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Auf dieser Konferenz stehen regionale und kommunale Anpassung im Mittelpunkt. Sie wird von den Klimakompetenzzentren der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen organisiert. Infos
6. März, 16 Uhr, Online
Webinar Urbane grün-blaue Infrastruktur – Renaturierung und natürliche Lösungen im Klimawandel
Das UN-Dekade-Büro organisiert regelmäßig Online-Dialoge rund um das Kernthema “Wiederherstellung von Ökosystemen”. Bei diesem sprechen Stefan Pauleit von der TU München und Rüdiger Dittmar von der Stadt Leipzig. Anmeldeschluss ist am 4. März. Infos
7. und 8. März, Paris
Forum Buildings and Climate Global Forum
Das Globale Forum Gebäude und Klima wird Minister und Vertreter wichtiger Organisationen zusammenbringen, um die Dekarbonisierung und Widerstandsfähigkeit des Gebäudesektors voranzutreiben. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art und knüpft an die Fortschritte an, die auf der jüngsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) erzielt wurden.
Die Veranstaltung wird gemeinsam von Frankreich und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit Unterstützung der Globalen Allianz für Gebäude und Bauwesen (GlobalABC) organisiert. Infos
7. März, 15 Uhr, Online
Webinar Deforestation Exposed: Using High Resolution Satellite Imagery to Investigate Forest Clearing
Dieses vom World Resources Institute organisierte Webinar bietet einen Überblick über die auf Global Forest Watch (GFW) verfügbaren Satellitenbilder und Ressourcen. Infos
Im vergangenen Jahr haben die europäischen Staaten mit 16,2 Gigawatt eine Rekordmenge an Windkraftanlagen neu gebaut. Der Zubau wecke die Hoffnung, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien bis 2030 erreichen kann, schreibt der Industrieverband “WindEurope” in seinem Jahresbericht.
In dem Bericht beschreibt der Verband das Jahr 2023 als ein Jahr mit “signifikanten Verbesserungen” in Schlüsselbereichen des europäischen Windenergiesektors. Im Jahr 2022 hatte der Sektor mit steigenden Inflationsraten, Zinssätzen und volatilen Energiemärkten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu kämpfen.
Mittlerweile haben die EU-Staaten die Genehmigungsverfahren für neue Projekte verbessert und die Inflation hat nachgelassen. Ebenso lobt der Verband das Windkraftpaket der Europäischen Kommission von Oktober, das Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der Branche vorsieht.
Ungetrübter Grund zur Freude ist das alles aber nicht: Um ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen, muss die EU im Schnitt 33 Gigawatt Windenergie jährlich zubauen – also doppelt so viel wie im vergangenen Rekordjahr, so WindEurope. kul/rtr/nib
Das Verhältnis der Deutschen zum Klimaschutz ist ambivalent: 71 Prozent ermuntern die politisch Verantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass einmal beschlossene Ziele auch eingehalten werden. Gleichzeitig halten es 49 Prozent für eine schlechte Idee, klimaschädliches Verhalten durch höhere Preise zu sanktionieren. Das geht aus einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts Pollytix im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor.
62 Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, die politischen Akteure sollten mehr für den Klimaschutz tun. Auch mit sich selbst gehen die Deutschen in puncto Klimaschutz durchaus kritisch um: 37 Prozent finden, sie selbst könnten mehr für das Klima und dessen Schutz tun.
Bei den möglichen Maßnahmen gibt es mit 81 Prozent große Unterstützung dafür, klimafreundliches Verhalten zu unterstützen, etwa durch finanzielle Förderung. Klimaschädliches Verhalten durch Gesetze zu verbieten, halten 55 Prozent für eine gute Idee. Den Vorschlag, klimaschädliches Verhalten zu verteuern, unterstützen dagegen nur 47 Prozent. Eine Mehrheit dafür gibt es nur in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von über 3.000 Euro.
Die Pollytix-Forscher folgern daraus: “Es braucht einen klaren Plan für mehr Klimaschutz.” Eine Mehrheit sehe diesen unter den gegebenen Umständen aber “aktuell nicht”. Und: Es sei geboten, die Komplexität des Themas zu reduzieren und klimaschädliches Verhalten deutlich zu benennen. Deshalb sei die “Wirksamkeit der Maßnahmen in einfacher, klarer Sprache (zu) benennen”. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie finden Sie hier.
Das EU-Renaturierungsgesetz, das am Dienstag mit knapper Mehrheit vom EU-Parlament angenommen wurde, hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Klimapolitik. 329 Europaabgeordnete stimmten dafür, 275 dagegen und 24 enthielten sich, als das erste Gesetz dieser Art auf europäischer Ebene abgestimmt wurde. Mit ihm sollen die Ziele des Kunming-Montreal-Rahmenabkommens zur Biodiversität erreicht werden: Bis 2030 müssen mindestens 20 Prozent der sanierungsbedürftigen Land- und Meeresflächen der EU wiederhergestellt werden.
Das hat Auswirkungen auf den Klimaschutz. Denn gemäß EU-Klimaziel sollen zehn Prozent der Emissionsreduktionen im LULUCF-Sektor (Land Use, Land-Use Change and Forestry) durch intakte Ökosysteme erreicht werden – beispielsweise durch Wiederaufforstung oder die Wiedervernässung von Mooren. Dieses Ziel entspricht IPCC-Vorgaben, 30 bis 50 Prozent der degradierten Ökosysteme unter Schutz zu stellen, um die Kapazitäten zur Speicherung von Kohlenstoff zu erhöhen.
Das Gesetz wurde im Verfahren insbesondere auf Druck der christdemokratischen EVP erheblich verwässert. Es sieht nun vor:
Allerdings ist fraglich, ob die Klimaziele mit dem vorliegenden Gesetz überhaupt erreicht werden können, denn es bleibt hinter dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission zurück.
Zudem ist noch offen, wie Renaturierungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Zwar schreibt die Kommission selbst, dass der Nutzen des Gesetzes (1.860 Milliarden Euro) die Kosten (circa 154 Milliarden Euro) bei Weitem überwiegt. Jedoch sieht das Gesetz keine Anreizmechanismen für die Renaturierung vor, sondern macht ausschließlich ordnungspolitische Vorgaben. Konkrete Finanzierungszusagen fehlen bislang.
So fehlt auch für Waldbesitzer der Anreiz, in Renaturierung statt in Nutzwirtschaft des Waldes zu investieren. Dabei wird die Senkenleistung des Waldes zum Erreichen der EU-Klimaziele dringend benötigt. Fördermöglichkeiten dafür bleiben Aufgaben für die nächste EU-Kommission. luk
In vielen europäischen Ländern ist der Verkauf von Wärmepumpen im Jahr 2023 zurückgegangen. Das geht aus Zahlen der European Heat Pump Association hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Mit 2,65 Millionen lag die Zahl EU-weit um fünf Prozent niedriger als im Boom-Jahr 2022, aber immer noch um 31 Prozent höher als 2021.
Als Grund für den Rückgang nennt der Verband, dass die EU ihren für letztes Jahr angekündigten Wärmepumpen-Aktionsplan bisher noch nicht vorgelegt hat. Zudem hätten viele Länder die Förderbedingungen, die 2022 in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine stark ausgeweitet wurden, 2023 wieder zurückgefahren. Das gilt etwa für Italien, wo die Zahlen besonders stark zurückgingen.
Deutschland steht im EU-Vergleich am besten da: Etwa 440.000 Wärmepumpen wurden hierzulande verkauft, ein Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das liegt allerdings vor allem daran, dass im ersten Halbjahr 2023 noch viele Aufträge aus dem Jahr 2022 abgearbeitet wurden; in der zweiten Jahreshälfte gingen die Zahlen auch in Deutschland zurück. “Die sehr destruktive und irreführende Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und das lange Warten auf die neue Förderkulisse haben den Markt insbesondere im letzten Quartal spürbar gelähmt”, sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), Claus Fest.
Inzwischen gibt es Klarheit über die Wärmepumpen-Förderung: Seit dieser Woche können die Zuschüsse, die für eine Investition bis zu 30.000 Euro mindestens 30 und maximal 70 Prozent betragen, zunächst für selbstgenutzte Einfamilienhäuser bei der KfW beantragt werden. Besitzer von Eigentumswohnungen können die Förderung voraussichtlich ab Mai beantragen, Vermieter ab August. Mit der Förderung allein ist es nach Ansicht des BWP aber noch nicht getan. Um den Umstieg zu beschleunigen, müsse die Politik dafür sorgen, dass Strom pro Kilowattstunde höchstens 2,5-mal so viel kostet wie Gas. mkr/av
Fische im Nordpazifik haben seit 2010 stark an Gewicht verloren. Das liege daran, dass sie im wärmeren Wasser weniger Futter finden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Universität Tokio. Die Forschenden hatten dafür Daten zum individuellen Gewicht und der Biomasse von 13 Fischarten ausgewertet.
In den 1980er-Jahren waren die Fische auch schon einmal besonders leicht gewesen. Die erste Periode des Gewichtsverlusts sei damals auf eine größere Anzahl an Sardinen und damit mehr Konkurrenz ums Futter zurückzuführen gewesen. Aktuell hänge das niedrige Gewicht hingegen vor allem damit zusammen, dass durch die höheren Temperaturen weniger kühles, nährstoffreiches Wasser an die Meeresoberfläche komme.
Für Meeressäuger ist der warme Nordpazifik unter Umständen sogar tödlich: Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Buckelwale dort zwischen 2012 und 2021 um 20 Prozent zurückging. Besonders problematisch war die Meereshitzewelle “The Blob” zwischen 2013 und 2016, während der laut der Studie rund 7.000 Buckelwale verhungert sind. Durch den Klimawandel werden Hitzewellen in den Ozeanen häufiger: Aktuell warnen Wissenschaftler beispielsweise vor den Folgen der ungewöhnlich hohen Temperaturen im Atlantik. kul
Die Luftfahrt ist weiterhin ein erheblicher Treiber des Klimawandels und der Luftverschmutzung. Zwar waren die CO₂-Emissionen des Luftverkehrs im Pandemiejahr 2020 zurückgegangen, doch mittlerweile steigen sie wieder und werden voraussichtlich 2025 das Niveau vor der Pandemie erreichen. Das hat eine Studie der Thinktanks ODI und Transport & Environment ergeben.
Die Autoren haben dabei anhand von Daten von 2019 auch die schmutzigsten Flughäfen untersucht – gemessen an CO₂ und anderen Emissionen. Dubai ist demnach der weltweit schmutzigste Flughafen mit über 20 Millionen Tonnen CO₂ – und 7.531 Tonnen Stickstoff-Emissionen (NOx). Dahinter liegen London-Heathrow (19,1 MtCO₂) und Los Angeles (18,7 MtCO₂). Der Frankfurter Flughafen liegt mit 13,9 MtCO₂ auf Platz 8 des weltweiten Rankings, direkt hinter Paris Charles de Gaulle (14,2 MtCO₂).
“Die 100 umweltschädlichsten Flughäfen verursachten 610 MtCO₂“, schreiben die Autoren. Das entspreche 152 Kohlekraftwerken und mache 65 Prozent der gesamten CO₂-Emissionen im Personen- und Frachtverkehr aus. Dazu kämen 213.000 Tonnen NOx und 2.400 Tonnen Feinstaubemissionen (PM2,5), heißt es in der Studie. Die Zahlen machten deutlich, dass der Luftfahrtsektor nicht auf dem richtigen Weg sei, um seine Emissionen im Einklang mit den weltweit vereinbarten Zielen zu begrenzen. Außerdem zeigen sie, dass die Emissionen im regionalen Vergleich ungleich verteilt sind und die größten Verschmutzung im Asien-Pazifik-Raum, Nordamerika und Europa erfolgen. luk
Die wachsende Abhängigkeit von Flüssiggas-Importen entzweit zunehmend die Mitgliedsländer der EU. Bei ihrem Treffen in Brüssel am kommenden Montag diskutieren die Energieminister eine Beschwerde mehrerer mitteleuropäischer Staaten ohne LNG-Häfen über gestiegene Durchleitungsgebühren in Deutschland.
In der Kritik steht die Gasspeicherumlage, mit der die Bundesrepublik seit Oktober 2022 die Kosten für die staatlich angeordneten Wintervorräte des Marktgebietsverantwortlichen THE refinanziert. Fällig wird sie nicht nur für deutsche Gasverbraucher, sondern auch für Exporte. “Die Umlage bestraft die verwundbarsten Staaten ohne direkten Zugang zu LNG-Terminals”, heißt es in einem Schreiben von Tschechien, Österreich, Polen, Ungarn und der Slowakei, über das zuerst die Financial Times berichtete. “Letztlich könnte dies mehrere Mitgliedstaaten dazu zwingen, sich stärker auf Gasimporte aus Russland zu verlassen.”
Die Gasspeicherumlage hatte 2022 noch bei 59 Cent pro Megawattstunde gelegen und wurde zu Jahresbeginn auf 1,86 Euro erhöht. “Insgesamt kostet der Transit durch Deutschland etwa drei Euro pro Megawattstunde. Nicht wenig in Zeiten, wo Gas wieder bei 25 bis 28 Euro gehandelt wird”, sagt Gasexperte Jens Völler von Team Consult.
Erst im Februar hatte die Berliner Koalition die Umlage bis März 2027 verlängert. Inzwischen bereitet auch Italien eine ähnliche Abgabe an Grenzübergangspunkten vor. Solche unilateralen Maßnahmen würden den europäischen Gasmarkt erheblich beeinträchtigen, kritisieren die mitteleuropäischen Staaten.
Die deutschen und italienischen Umlagen beschäftigen inzwischen auch die EU-Kommission. “Wir haben bei all unseren Kontakten betont, dass Entgelte mit dem EU-Rechtsrahmen übereinstimmen müssen”, sagte eine Sprecherin von Energiekommissarin Kadri Simson vor der Debatte am 4. März. Nach Informationen von Table.Media läuft bereits ein “Pilotverfahren” unter Beteiligung der Bundesregierung, um den Streit zu lösen. ber
Mit der Verschiebung der Entscheidung über das europäische Lieferkettengesetz CSDDD liegen vorerst auch die Regeln für Klimaschutzmaßnahmen im internationalen Handel der EU auf Eis. Bei einer Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel zeichnete sich keine Mehrheit für das Gesetz ab; die endgültige Abstimmung wurde erneut verschoben.
Rat, EU-Parlament und EU-Kommission hatten sich im Dezember bereits auf einen finalen Gesetzestext geeinigt. Auf Druck der FDP hatte die deutsche Bundesregierung im Januar ihre Enthaltung erklärt, auch weitere Mitgliedstaaten haben Bedenken.
Die Richtlinie legt unternehmerische Sorgfaltspflichten für Auswirkungen auf Menschenrechte, Umwelt und Klima fest. Ziel ist laut EU-Kommission auch, die EU-Klimagesetzgebung samt der Klimaziele für 2030 und 2050 zu ergänzen. Artikel 15 legt Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels fest:
Die Sorgfaltspflichten umfassen sowohl die vorgelagerte Wertschöpfungskette (etwa den Rohstoffabbau) als auch teilweise die nachgelagerte Kette (Verwendung, Verwertung, Entsorgung). Die Unternehmen sind verpflichtet, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu kontrollieren, zu überwachen und darüber zu berichten.
Der Einigung im Rat ist eine klare Frist gesetzt: Im April muss das Parlament in seiner letzten Plenarsitzung vor den Europawahlen der Richtlinie formal zustimmen. leo
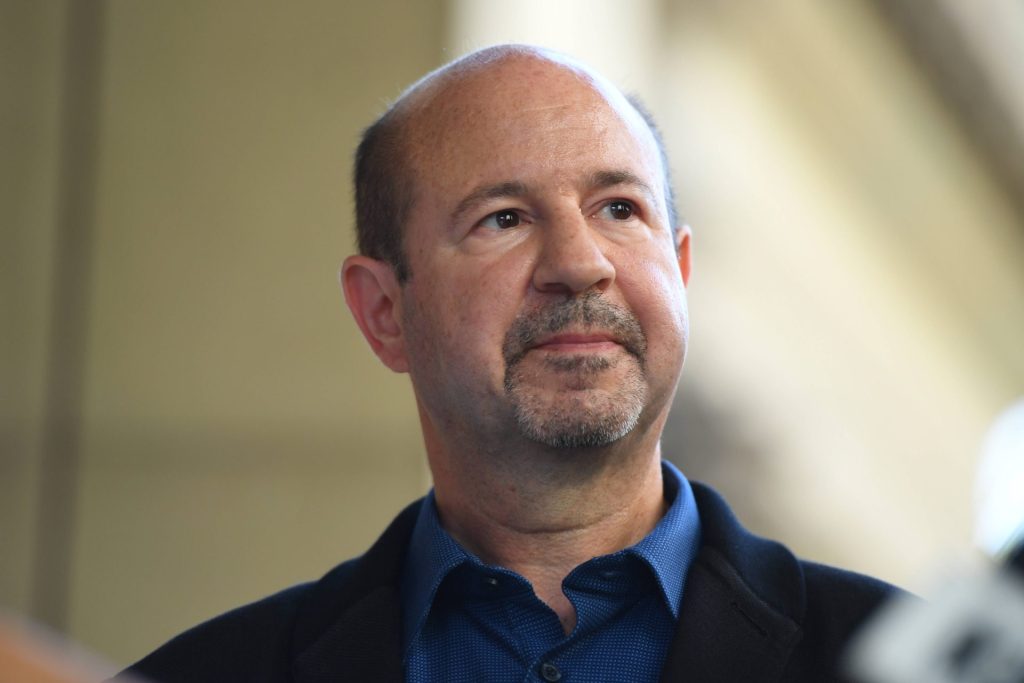
Michael Mann hat die meiste Zeit seiner Karriere als untypische Figur des öffentlichen Lebens verbracht. Er ist sowohl für seine Forschung als Klimawissenschaftler bekannt als auch für seine Bereitschaft, Wissenschaftsleugnern entgegenzutreten.
Der 58-Jährige gewann im Februar einen Prozess gegen zwei rechtsgerichtete Autoren, die 2012 in zwei Blogbeiträgen behauptet hatten, er habe seine Daten manipuliert, und ihn mit dem Kinderschänder Jerry Sandusky verglichen. Die Autoren nannten Mann den “Jerry Sandunsky der Klimawissenschaft”, denn anstelle von Kindern hätte er seine Daten “belästigt und gequält”. Ein Geschworenengericht entschied vor kurzem in dem Zivilprozess, die Autoren hätten den Wissenschaftler verleumdet, und sprachen ihm über eine Million US-Dollar Entschädigung wegen Rufschädigung zu.
Manns erste Begegnungen mit Verleumdung liegen Jahrzehnte zurück. Schon als wenig bekannter Wissenschaftler machte er schlechte Erfahrungen mit Klimawandel-Leugnern. Er und einige Kollegen hatten die Temperaturen des Planeten über die vergangenen Jahrtausende rekonstruiert und die Datenpunkte in einem ikonischen Diagramm dargestellt, das wie ein Hockeyschläger aussah. Es zeigte eine relativ stabile globale Temperatur bis zu einem plötzlichen deutlichen Anstieg im 20. Jahrhundert. Als dann das oberste UN-Klimawissenschaftsgremium das Hockeyschläger-Diagramm in seiner großen Klimabilanz im Jahr 2001 vorstellte, versuchten Klimawandel-Leugner, Manns Arbeit zu diskreditieren.
Diese Erfahrung lehrte Mann, dass er es sich nicht leisten kann, das Rampenlicht zu meiden. “Anfänglich habe ich mich selbst und meine Wissenschaft gegen böswillige Angriffe verteidigt”, sagte Mann. “Mit der Zeit lernte ich zu schätzen, dass ich auch eine größere Rolle spielen kann”.
Die größere Rolle, die Mann jetzt spielt, besteht darin, Fehlinformationen über das Klima abzuwehren und die Wissenschaftskommunikation zu fördern. Er betrachtet seine Verleumdungsklage als einen Teil dieser Aufgabe und sagt, er hoffe, dass sie “einen Raum für andere Wissenschaftler schafft, die sich nicht aus dem Labor wagen.”
Im Jahr 2022 verließ Mann seine langjährige Stelle an der Penn State University, um dem Kleinman Center for Energy Policy der University of Pennsylvania beizutreten, einem Programm, das an der Schnittstelle von Klimawissenschaft, Politik und Kommunikation arbeitet. Mann hat einen Doktortitel in Geologie und Geophysik und studierte Physik und angewandte Mathematik in Berkeley und Yale. Er hat ein halbes Dutzend Bücher verfasst, darunter ein Kinderbuch, ist mit dem Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio befreundet und war 2021 als Berater für die Klima-Filmsatire “Don’t Look Up” tätig.
Mann nimmt sich Zeit für Musik und Familie, und eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Nachspielen von Liedern nach Gehör auf dem Klavier. Er hat eine 18-jährige Tochter, die sein Interesse für Informatik und Mathematik teilt.
Eine Sache, die er nicht mag, sind Bücher und Filme mit apokalyptischen Klimaszenarien, die den Menschen die Hoffnung für die Zukunft rauben. “Wir müssen die emotionale Energie, die die Menschen wegen der Klimakrise empfinden, in etwas Positives umwandeln.” Rebecca Leber, Washington D.C.
