die europäische Solarindustrie kämpft um Marktanteile: Aus China kommen Module zu Dumpingpreisen und auch in den USA erhalten Hersteller hohe Subventionen. In Europa gibt es hingegen keine neuen Gelder. Warum viele Experten günstige Module aus China eher für einen Segen halten und Subventionen für den falschen Weg und wie die Abhängigkeit von China trotzdem reduziert werden könnte, analysiert Nico Beckert.
Zum Internationalen Frauentag am 8. März analysieren wir Strategien für eine feministische Klimapolitik und zeigen, wie konkrete Projekte zu Geschlechtergerechtigkeit führen können. Nicht nur im Globalen Süden, sondern auch in Europa gibt es noch Luft nach oben.
In unserer Grafik der Woche schauen wir auf die fallenden Preise im EU-Emissionshandel und was sie für Unternehmen bedeuten. Im Standpunkt erklärt der ehemalige IPCC-Leitautor Hans-Otto Pörtner, warum der Weltklimarat eine Zeitenwende braucht. Er fordert unter anderem kürzere Berichtszyklen, um schneller auf relevante Themen reagieren zu können.
Wir bleiben für Sie dran!


In der europäischen Solarindustrie herrscht Katerstimmung. Chinesische Konkurrenten überschwemmen den Weltmarkt mit staatlich geförderten Modulen zu Dumpingpreisen. Europäische Anbieter verlieren durch den Preisverfall immer stärker an Wettbewerbsfähigkeit. Die Firma Meyer Burger, der wichtigste europäische Produzent, droht mit Abzug in die USA, wo Subventionen winken. In Deutschland bitten auch Zulieferer die Bundesregierung um Hilfe. Komme die nicht, drohe auch hier das Aus.
Auch die EU-Kommission will den Kater nicht lindern. Sie plant weder Handelsbeschränkungen gegen chinesische Module noch neue Subventionen, wie EU-Kommissare jüngst deutlich gemacht haben. Die Kommission sieht vielmehr die Mitgliedsstaaten in der Pflicht. Denn die Ziele sind hochgesteckt: Die EU-Staaten wollen mit ihrem Net Zero Industry Act (NZIA) bis 2030 eine europäische Solarindustrie aufbauen, die 40 Prozent des heimischen Bedarfs decken kann – und zwar in allen Schritten der Wertschöpfungskette. Dadurch soll die Abhängigkeit von China gesenkt werden, das bisher 80 bis 95 Prozent der globalen Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette abdeckt.
Experten halten das 40-Prozent-Ziel weder für realistisch noch für sinnvoll. Es gebe weder genug Bereitschaft für Investitionen in neue Fabriken, noch die notwendigen Anreize für Investitionen, um das 40-Prozent-Ziel zu erreichen, sagt Antoine Vagneur-Jones, Solarexperte des Analyseunternehmens BloombergNEF, zu Table.Briefings. “Der Bau von Solarfabriken in Europa ist etwa drei- bis viermal so teuer wie in China. Die Produktion ist mit einem beträchtlichen Kostenaufschlag verbunden”, so Vagneur-Jones.
Laut optimistischen Schätzungen der EU-Kommission würde es 7,5 Milliarden Euro kosten, um eine Industrie mit den nötigen Kapazitäten aufzubauen. Der Verband Solar Power Europe geht hingegen von nötigen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro aus, die zudem bis 2025 getätigt werden müssten, wie Marie Tamba, Senior Research Analyst der Rhodium Group, sagt.
Um eine nennenswerte Industrie aufzubauen, müsste Europa “die Investitionen und Betriebskosten von Solarherstellern massiv subventionieren“, sagt Jenny Chase, langjährige Solaranalystin von BloombergNEF zu Table.Briefings. Die Produktionskosten von Meyer Burger liegen ihr zufolge bei über 40 US-Cent pro Watt – der Marktpreis allerdings nur bei etwas über 11 US-Cent. Chase bedauert: Meyer Burger hätte viel Erfahrung. Es sei ein “schwerer Schlag, wenn sie sich zurückziehen”.
Analysten des Thinktanks Bruegel bezweifeln, dass das 40-Prozent-Ziel überhaupt sinnvoll ist. “Vollständige Herstellungsprozesse erfordern energie- und kapitalintensive Investitionen, bei denen Europa keinen Vorteil hat“, schreiben die Analysten. So ist beispielsweise die Herstellung von Polysilizium, Ausgangsstoff von Solarzellen, sehr energieintensiv. Auf dem Solarmarkt herrsche schon heute ein massives Überangebot an Solarmodulen. “Die Subventionierung zusätzlicher Produktion hat keinen Nutzen für das Klima”, so das Fazit der Bruegel-Analysten. Auch Chase hat ihre Zweifel: “Die Solarindustrie ist ein schwieriges Geschäftsfeld. Der Wettbewerb ist brutal.” Die neuesten Fabriken hätten die beste Technologie und somit Wettbewerbsvorteile. Ältere Hersteller hätten große Nachteile, weil das Equipment schnell überholt werde.
Chase schätzt, dass sich die Energiewende im Bereich Solarenergie um “vielleicht 50 Prozent” verteuern würde, wenn Europa die Abhängigkeit von chinesischen Modulen nennenswert verringern würde. Aus diesem Grund werde das auch kaum passieren, so die Einschätzung der BloombergNEF-Expertin.
Auch die Analysten der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie gehen von einem massiven Preisaufschlag aus. Im letzten Jahrzehnt seien die Kosten für Solarmodule um 85 Prozent gefallen. “Der Ausbau der chinesischen Produktionskapazitäten im Bereich der sauberen Technologien ist das Herzstück dieser Entwicklung”, schreiben sie in einer aktuellen Analyse. Ohne China wären die “massiven Kostensenkungen, an die wir uns gewöhnt haben, vorbei”, so die Einschätzung der Berater. Allein Deutschland habe durch die globalisierte Solarlieferkette zwischen 2008 und 2020 circa sieben Milliarden US-Dollar gespart, wie eine Nature-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt.
Selbst wenn weitere Risiken, die mit einer hohen Abhängigkeit von China einhergehen, beachtet würden, “überwiegen bei der Solarindustrie erst einmal die Vorteile billiger Importe”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow des Thinktanks European Council on Foreign Relations. “Die sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Risiken sind zusammengenommen wohl zu gering, um den Nachteil der fehlenden europäischen Wettbewerbsfähigkeit unbedingt ausbügeln zu müssen”, so der Analyst und Experte für den Wettbewerb der Großmächte in der Weltwirtschaft.
Antoine Vagneur-Jones von BloombergNEF fasst die Situation zusammen: “Die Überkapazitäten im Solarsektor sind gut für die Energiewende: Sie machen alles billiger. Aber sie machen die wirtschaftlichen Argumente für den Aufbau einer eigenen Solarindustrie noch schwächer.”
Um unabhängiger von China zu werden, schlagen die Bruegel-Analysten den Aufbau von Lagerbeständen an Solarmodulen und eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen vor. Derzeit bauen beispielsweise die USA und Indien eine eigene Solarindustrie auf. Lagerbestände von etwa 30 Prozent der Marktnachfrage könnten zu einer gewissen Flexibilität führen, sollte China den Verkauf von Modulen tatsächlich einmal abrupt stoppen, so die Bruegel-Analysten. “Die Diversifizierung der Einfuhren ist ein wirksameres und effizienteres Instrument als die Importsubstitution”, schreiben sie.
Chase ist allerdings anderer Meinung. Wenn die EU-Staaten mehr aus den USA oder Indien importieren wollten, müssten sie “für schlechtere Produkte mehr Geld bezahlen als für solche aus China”. Ihr Kollege Antoine Vagneur-Jones sagt, auch die US-Hersteller litten unter Überkapazitäten, und erste angekündigte Investitionen würden schon wieder zurückgezogen – trotz US-Förderung. Laut BloombergNEF werde wohl nur etwa die Hälfte der angekündigten US-Solarinvestitionen in Höhe von 60 Gigawatt für das Jahr 2024 tatsächlich gebaut. Fast ein Viertel der geplanten Investitionen stammt ironischerweise von chinesischen Herstellern, die nun auch in den USA Subventionen erhalten. Indien könnte eher ein Exporteur in Richtung Europa werden, sagt Elissa Pierce, Research Associate der Energieberatungsagentur Wood Mackenzie. “Bei einem Preis von 20 US-Cent pro Watt sind indische Module für europäische Käufer attraktiver als US-Module”, sagt die Analystin. Die US-Module lägen derzeit bei 35 Cent pro Watt.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings für die Solarmodul-Produktion von Meyer Burger im sächsischen Freiberg. Das Unternehmen “1Komma5°”, ein Anbieter von Solaranlagen, Wärmepumpen, Stromspeichern und Wallboxen, scheint die Produktionsanlagen übernehmen zu wollen, sollte Meyer Burger das Werk tatsächlich aufgeben.
Neue Werke könnte die Bundesregierung mit einer neuen gesetzlichen Möglichkeit aus dem Net-Zero Industry Act schnell genehmigen – in speziellen Beschleunigungsgebieten, in denen private Investoren von Bürokratie entlastet würden. “Die Bundesregierung muss investieren, um Deutschland für die produzierende Industrie wieder attraktiv zu machen, beispielsweise durch die Einrichtung von Net-Zero Acceleration Valleys“, sagt der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler, der den NZIA für das Parlament verhandelt hat.

Aufgrund von Sozialisierung und Geschlechterrollen sind Frauen und Männer unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Das gilt nicht nur im Globalen Süden, sondern auch in Europa. Ein Beispiel: Die meiste formale Pflege- sowie informelle Sorgearbeit wird von Frauen übernommen. Der Klimawandel führt zu einem noch größeren Druck auf Gesundheitssysteme – und somit zu noch mehr, oftmals prekär oder gar nicht bezahlter Arbeit für Frauen. Gleichzeitig verdienen sie im Schnitt weniger, sodass sie nicht im selben Maß in private Schutzmaßnahmen investieren können wie Männer. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie “A Feminist Green Deal” der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Zudem ist Politik nicht geschlechtsneutral, nicht alle profitieren gleichermaßen von bestimmten Klimaschutzmaßnahmen. Katharina Wiese vom European Environmental Bureau erklärt das am Beispiel von Mobilität: “Frauen und Männer haben unterschiedliche Mobilitätbedarfe und Muster, die mit strukturellen Ungleichheiten verknüpft sind.” Da Frauen seltener Autos besitzen und häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen, brächten ihnen beispielsweise Förderungen für Elektroautos weniger. Eine feministische Klimapolitik sollte deshalb viel stärker in den Ausbau des ÖPNV investieren. Auch wirtschaftliche sind Frauen eher benachteiligt: Von zukünftigen Arbeitsplätzen im Bereich der Erneuerbaren beispielsweise profitieren Frauen seltener. Selbst in der Photovoltaik-Branche, die noch den größten Frauenanteil aufweist, sind weltweit nur 13 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt. Frauen haben zudem seltener Zugang zu Klimafinanzierung.
“Ist die Klimapolitik geschlechterblind, dann verstetigt sie Geschlechterungerechtigkeiten oder vergrößert diese sogar noch”, heißt es in der FES-Studie. Deshalb müsse man den Klimawandel als komplexe sozial-ökonomische Krise verstehen, meint Valeria Peláez Cardona von “Women Engage for a Common Future”. “Anders als viele Menschen denken, ist feministische Klimapolitik nicht nur Politik für Frauen”, sagt sie. Im Idealfall führe feministische Politik dazu, dass Ungerechtigkeiten abnehmen und zu Vorteilen für die Allgemeinheit – von besserem Nahverkehr profitieren beispielsweise alle.
Geschlechtergerechtigkeit bei Klimapolitik mitzudenken, ist inzwischen im Mainstream angekommen, zumindest in der Theorie. In Deutschland gibt es aus zwei Ministerien feministische Strategien mit Bezügen zu Klima: Das BMZ hat im vergangenen Jahr einen Leitfaden für “Feministische Entwicklungspolitik” veröffentlicht und vom Auswärtigen Amt gibt es die Leitlinie “Feministische Außenpolitik gestalten”. Laut dem BMZ sollen Frauen an “Entscheidungsprozessen beteiligt werden und ihr Zugang zu Klimamitteln vereinfacht” werden. Das Auswärtige Amt erklärt, es wolle in Zukunft auf Gender-Budgeting setzen, also in der Haushaltsplanung Aspekte der Gleichstellung berücksichtigen.
In der Umsetzung in Form von konkreten Projekten hat sich seit der Veröffentlichung wenig getan. Aus der Sicht von Katharina Wiese sind die beiden Leitfäden ein guter Anfang. Aber es gebe bisher zu wenig konkrete Maßnahmen und Ziele, sagt sie. Damit laufe man Gefahr, sich mit schönen Worten zu Geschlechtergerechtigkeit zu schmücken, aber zu wenig zu tun.
“Auf lokaler und regionaler Ebene gibt es aber gute Beispiele von feministischer Klimapolitik”, sagt Wiese. Diese können Regierungen, anderen öffentlichen Akteuren oder Unternehmen als Vorbild dienen. Wiese zählt auf:
Weitere gute Beispiele werden durch die “Gender Just Climate Solutions Awards” ausgezeichnet. Die Awards zeichnen Einzelprojekte aus dem Globalen Süden aus, die auch auf höherem Level umgesetzt werden könnten.
Sie gingen im vergangenen Jahr an:
Valeria Peláez nennt außerdem eine Initiative, die sie persönlich beeindruckt hat: In vielen Weltregionen haben Frauen kein Recht auf Landtitel, sie können damit auch oftmals keine eigenen Klimaschutzmaßnahmen wie die Installation einer Solaranlage, eines Wasserspeichers oder den Schutz des darauf stehenden Waldes durchführen. Dorothée Lisenga hat mit der Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable in der Demokratischen Republik Kongo erreicht, dass Frauen in verschiedenen Regionen des Landes Zugang zu Landtiteln haben.
“Soziale Gerechtigkeit – und damit auch Geschlechtergerechtigkeit – gehört zum Kampf gegen Klimawandel dazu”, fasst Wiese zusammen. Aus ihrer Sicht ist das kein “Nice-to-Have”, sondern essenziell. Sonst könnte Klimaschutz ins Leere laufen.
7. und 8. März, Paris
Konferenz Buildings and Climate Global Forum
Das Globale Forum Gebäude und Klima wird Ministerinnen und Minister sowie weitere Vertreter internationaler Organisationen zusammenbringen, um die Dekarbonisierung und Resilienz des Gebäudesektors voranzutreiben. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art und knüpft an die Fortschritte an, die auf der jüngsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) erzielt wurden. Die Veranstaltung wird gemeinsam von Frankreich und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit Unterstützung der Globalen Allianz für Gebäude und Bauwesen (GlobalABC) organisiert. Infos
7. März, 15 Uhr, Online
Webinar Deforestation Exposed: Using High Resolution Satellite Imagery to Investigate Forest Clearing
Dieses vom World Resources Institute organisierte Webinar bietet einen Überblick über die auf Global Forest Watch (GFW) verfügbaren Satellitenbilder und Ressourcen. Infos
7. März, 17 Uhr, Online
Veröffentlichung ‘Climate Policy Priorities for the next European Commission’ Report
Der European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) und das Ifo Institut veröffentlichen ihren Bericht zu Forderungen für Klimaprioritäten der nächsten Europäischen Kommission. Infos
8. und 9. März, Online
Symposium Klima in der Schule
Scientists for Future und Teachers for Future veranstalten das Symposium über den Transformationsdruck durch die Klima- und Biodiversitätskrise, mögliche Lösungsansätze und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Es geht unter anderem um Best Practices in Schule und Universitäten. Infos
8. und 9. März, Schwerte
Tagung Sozial Gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen – Wie geht das?
Auf der Tagung des Instituts für Kirche und Gesellschaft wird diskutiert, wie die Klimaziele in einer Zeit ohne Wirtschaftswachstum eingehalten werden können. Infos
10. März, Portugal
Wahlen Parlamentswahlen
In Portugal finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Aufgrund des Rücktritts des Präsidenten wurden die Wahlen vorgezogen.
12. März, Brüssel
Präsentation Klimaresilienz-Paket und European Climate Risk Assessment
Das Kommissionspaket zu Resilienz und Klima-Anpassung soll Policy-Entwürfe zur Resilienz von Wasserversorgung und zu Klimarisiken enthalten. Am selben Tag veröffentlicht die European Environment Agency (EEA) auch das erste European Climate Risk Assessment. Infos
12. März, Online
Webinar Öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkw
In dem Webinar vom Thinktank Agora Verkehrswende wird diskutiert, was jetzt zu tun ist, um mehr E-Lkw auf die Straße zu bringen. Infos
12. bis 14. März, Potsdam
Tagung Deutsche Klimatagung
Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft e. V. (DMG) lädt zusammen mit dem Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ), dem Alfred-Wegener Institut (AWI), dem Deutschen Wetterdienst (DWD), der Freien Universität Berlin (FU Berlin) und dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung e. V. (PIK) zur 13. Deutschen Klimatagung auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Ein Schwerpunkt wird die Attributionsforschung sein. Infos
14. März, 9 Uhr, Hamburg/Online
Seminar Energiepolitische Weichenstellung: EU-Vorgaben für den Ausbau der Offshore-Windenergie
Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e. V. diskutiert auf dem Event über die Rahmenbedingungen zum Ausbau von Offshore-Windenergie. Infos
Vor fast genau einem Jahr lag der europäische CO₂-Preis mit über 100 Euro je Tonne auf einem Rekordhoch. Bis Ende Februar war er auf rund 53 Euro gesunken – das ist fast eine Halbierung. Anfang März pendelte er um die 60 Euro, was immer noch einem Minus von rund 40 Prozent entspricht. Grundsätzliche Ursachen des Preisverfalls sind die generelle Volatilität des europäischen Emissionshandels (ETS) und fehlende Schutzmaßnahmen für schnell steigende oder sinkende Preise. Darüber hinaus tragen der sinkende Gaspreis und die dadurch günstiger werdende fossile Verstromung zum niedrigen CO₂-Preis bei.
Auch wenn der niedrige Preis an sich laut Experten zunächst kein Problem darstellt, haben die starken Schwankungen Folgen für die europäische Energiewende. “Es ist ein entmutigendes Signal für Unternehmen, die sonst in kohlenstoffarme Technologien investieren würden“, sagt Emil Dimanchev, Klimapolitik-Forscher an der Naturwissenschaftlichen Universität Trondheim. Ein instabiler Markt sorge dafür, dass die Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder Carbon Removals neu bewertet werden müsse.
“Unternehmen, die in eine kohlenstoffarme Technologie investieren wollen, müssen damit rechnen, dass ihre künftigen Einnahmen sehr viel volatiler und unsicherer werden”, so der Forscher zu Table.Briefings. Das erhöhe die Kapitalkosten. Für die Unternehmen werde es “schwieriger, eine Bank aufzusuchen und einen Kredit zu erhalten oder sich Anleihen zu sichern”.
Es sei jedoch ein interessanter Moment für den europäischen Emissionshandel, denn nun würde sich zeigen, ob die Marktstabilitätsreserve (MSR) des ETS funktioniere oder nicht, sagt Dimanchev. “Es ist ein Test, ob die Marktstabilitätsreserve für Händler überzeugend genug ist, dass der Preis wieder steigt, da sie wissen, dass die MSR den Markt an etwaige Veränderungen auf der Nachfrageseite anpassen wird.”
Der niedrige CO₂-Preis dürfte auch Auswirkungen auf den deutschen Klima- und Transformationsfonds haben, aus dem unter anderem die meisten Klimaschutzprogramme der Bundesregierung finanziert werden. Die Mittel des Fonds stammen aus den Einnahmen aus dem deutschen und EU-Emissionshandel. Er ist schon jetzt unterfinanziert. luk/mkr/ae
Die britische Regierung plant für 2024 zusätzliche 1,025 Milliarden Pfund (1,2 Milliarden Euro) für den Ausbau erneuerbarer Energien zur Verfügung zu stellen. Das geht aus dem Budget-Bericht für 2024 hervor. Während für Solarenergie, Onshore-Windanlagen oder Wasserkraft jährlich 263 Millionen Euro vorgesehen sind, ist für Offshore-Windanlagen eine Rekordsumme von jährlich 935 Millionen Euro geplant. Das Unterstützungspaket ist damit dreimal größer als alle bisherigen Pakete, wie Bloomberg berichtet.
Damit soll der Ausbau von Offshore-Windkraft angekurbelt werden. Bis 2030 will der Inselstaat seine Kapazitäten verdreifachen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern sind die Projektentwickler auf Förderungen angewiesen. In der letzten Auktionsphase im Vorjahr hatte kein einziger Entwickler mitgeboten, weil die Regierung den garantierten Strompreis zu niedrig angesetzt hatte. Dieser wird über Differenzverträge (Contracts for Difference) geregelt. Damit wird Projektentwicklern wie Orsted, Iberdrola und RWE ein Fixpreis garantiert. Das schafft Planungssicherheit und soll Preisschwankungen ausgleichen: Liegt der Marktpreis unter dem Fixpreis, zahlt der Staat die Differenz an den Betreiber. Letztes Jahr lag dieser Fixpreis bei 51 Euro pro MWh – zu niedrig, um für die Projektentwickler rentabel zu sein. Nun soll dieser Fixpreis auf 85 Euro angehoben werden. lb
Die Europäische Kommission hat einen Kompromissvorschlag zum Umgang der EU mit dem Energiecharta-Vertrag (ECT) vorgelegt. Vorgesehen ist, dass der Vertrag noch während der Mitgliedschaft der EU reformiert wird. Anschließend würde die EU aus dem Vertrag austreten, wie es die Kommission bereits letzten Juli vorgeschlagen hatte. Aus ihrer Sicht behindert der gegenwärtige hohe Investorenschutz des ECT die Klimawende und erlaubt missbräuchliche Klagen. Einzelne EU-Staaten, die dies wünschen, könnten aufgrund des Kompromissvorschlags jedoch Vertragsteilnehmer bleiben.
“Die vorgeschlagenen Änderungen am Vertragstext” bedeuteten “wesentliche Verbesserungen, die den ECT mit modernen Standards des Investitionsschutzes und den Positionen der EU in anderen Foren in Einklang bringen werden”, heißt es im Vorschlag der Kommission. Aufgezählt werden
Der ECT mit seinen gegenwärtig etwa 50 Mitgliedsstaaten trat 1998 in Kraft und ermöglicht es Investoren aus dem Energiebereich, Schadenersatz für aufgrund gesetzlicher Änderungen entgangener Gewinne einzuklagen. Kritisiert wurden auch die intransparenten Schiedsverfahren jenseits staatlicher Gerichte. Deutschland ist wie andere EU-Staaten bereits 2023 aus dem ECT ausgetreten. Es sind jedoch weiterhin Klagen gegen Deutschland anhängig. av
Beim Klimageld, dessen Einführung laut Koalitionsvertrag vorbereitet werden soll, zögert die SPD. Fraktionsvize Matthias Miersch, zuständig für den Umweltbereich, warnt schon länger vor heftigen Preissprüngen bei fossiler Energie, wenn der CO₂-Preis nach 2027 – wie absehbar – stark ansteigt. Nun hat der Ökonom Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) den SPD-Klimafachleuten vorgerechnet, was es konkret bedeutet, wenn die nationalen CO₂-Preissysteme in den europäischen Emissionshandel überführt werden.
Wenn der CO₂-Preis, wie in manchen Szenarien erwartet, auf 275 Euro pro Tonne steigt, was eine eher hohe Schätzung darstellt, würde sich Benzin im Vergleich zu heute um 55 Cent und Diesel um 62 Cent pro Liter verteuern; der Erdgaspreis stiege um 5 Cent pro Kilowattstunde. Nach Dulliens Berechnung würde sich daraus eine unmittelbare Inflationswirkung von 2,8 Prozentpunkten ergeben; dazu käme noch die indirekte Inflation durch die Überwälzung höherer Kosten von Gewerbebetrieben. (Dulliens Präsentation finden Sie hier.)
Ein pauschales Klimageld würde dabei nur teilweise helfen. Selbst wenn die gesamten Einnahmen aus dem CO₂-Preis für Wärme und Verkehr als Klimageld ausgezahlt würden, würden 44 Prozent der Haushalte per Saldo verlieren, 49 Prozent profitieren. Zwar würden ärmere Haushalte insgesamt entlastet, aber innerhalb gleicher Einkommensgruppen fielen die Belastungen sehr unterschiedlich aus. In jedem Fall seien Menschen auf dem Land “deutlich stärker betroffen” als die Stadtbevölkerung, und Hauseigentümer stärker als Mieter, bei denen der Vermieter einen Teil der Kosten tragen muss.
Für Dullien kann das Klimageld darum nur eines unter mehreren Instrumenten sein. Er hat aber noch einen weiteren Vorbehalt: “Ohne Reform der Schuldenbremse oder Steuererhöhung ist schwer zu sehen, woher die Finanzierung kommen sollte.” SPD-Fraktionsvize Miersch bremst in seiner Partei schon länger bei der vorbehaltlosen Forderung nach einem pauschalen Klimageld und plädiert etwa für eine soziale Staffelung bei der Auszahlung. hk/mkr
Die EU darf Palmöl-Biodiesel künftig als nicht erneuerbar einstufen und damit aus ihrer Beimischungsquote für Biokraftstoffe ausschließen. Einen entsprechenden Sieg hat die Europäische Union am Dienstag bei der Welthandelsorganisation (WTO) errungen. Ein Schiedsgericht wies eine malaysische Beschwerde gegen die EU-Entscheidung ab.
Für den Klimaschutz ist das relevant, weil Palmöl mit einem hohen Abholzungsrisiko einhergeht. Einige Studien gehen davon aus, dass Biodiesel aus Palmöl zu dreimal so hohen Emissionen führt wie fossiler Diesel. Palmöl hatte 2020 mit rund 30 Prozent nach Rapsöl (36 Prozent) den zweitgrößten Anteil am europäischen Biodiesel. Malaysia und Indonesien sind die größten Palmölproduzenten der Welt. Beide hatten vor dem WTO-Schiedsgericht geklagt.
Es war die erste WTO-Entscheidung im Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern. In ihr stimmte ein dreiköpfiges Gremium mit zwei zu eins Stimmen dafür, Malaysias inhaltliche Forderungen zurückzuweisen. Allerdings gaben sie Malaysia recht in dessen Beschwerde über die Art und Weise, wie die Maßnahmen vorbereitet, veröffentlicht und verwaltet wurden. Indonesien ließ daraufhin seine Beschwerde fallen und beantragte die Aussetzung der Arbeit des Panels.
Hintergrund ist, dass künftig EU-weit ein Anteil von zehn Prozent an Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll. Dazu zählen auch Biokraftstoffe auf pflanzlicher Basis. Die EU schließt Pflanzen aus, die auf abgeholzten Flächen angebaut werden oder bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie den Anbau von Nahrungsmitteln verdrängen, für die dann zusätzliche Fläche gerodet werden müsste. Daher hat die EU festgelegt, dass Biokraftstoff auf Palmölbasis bis 2030 nicht mehr zu den erneuerbaren Energiequellen zählen soll. Daraufhin hatten Malaysia und Indonesien bei der WTO Klage gegen die Europäische Union eingereicht. rtr/lei/kul/ae
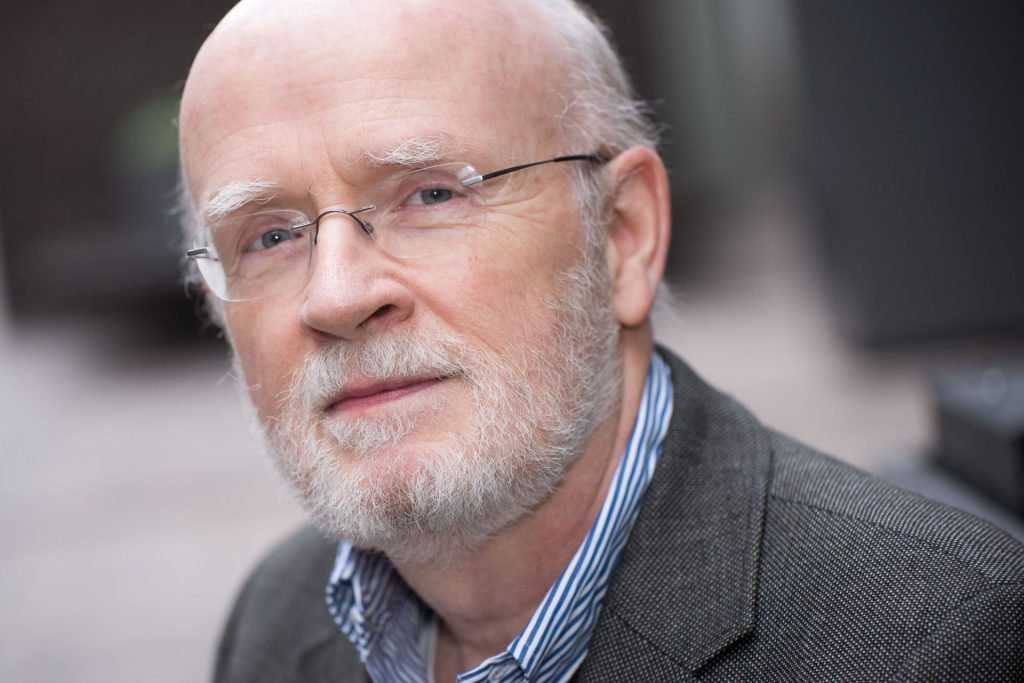
Der Weltklimarat (IPCC) ist als zwischenstaatlicher Ausschuss kein rein wissenschaftliches Gremium, sondern beruht seit seiner Gründung im Jahr 1988 auf einer engen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik. Das war und ist seine Stärke. Aber in Zeiten drängender Verschärfungen in der Klima- und Artenschutzkrise wird es mehr und mehr zu einer Schwäche.
Zu oft bremst und verhindert politisches Kalkül, das sich über wissenschaftliche Erkenntnisse erhebt, ein effizientes Arbeiten des IPCC. Der Rat braucht Reformen in internen Prozessen und der Auswahl seiner Arbeitsprojekte, und weniger politisch motivierten Einfluss. Anderenfalls steht zu befürchten, dass er den aktuellen Entwicklungen hinterherläuft und keine Politikberatung für zeitgerechtes Handeln mehr liefern kann.
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Regierungsdelegationen arbeiten in der Vollversammlung des IPCC zusammen, Entscheidungen folgen dem Konsensprinzip. Wie weit der politische Einfluss einzelner Akteure dabei jedoch im Detail reicht, ist vermutlich nur wenigen Außenstehenden bewusst:
Diese enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft hat in der Vergangenheit die Stärke des Weltklimarates ausgemacht. Mit der einstimmigen Verabschiedung der Zusammenfassung eines Arbeitsgruppen- oder Sonderberichtes erkennen alle Regierungen dessen Aussagen an. Kein Entscheidungsträger kann dann mehr behaupten, er hätte nichts vom Ausmaß und den Folgen des Klimawandels gewusst.
Die Ergebnisse der COP28 haben jedoch einmal mehr deutlich gemacht: Verzögerungsstrategien von Regierungen verhindern mehr und mehr die vollständige Umsetzung zeitkritischer wissenschaftlicher Befunde des Weltklimarates. Nahezu alle wichtigen Förderländer fossiler Energieträger versuchen, die enge Verbindung zwischen der Förderung und Nutzung fossiler Energieträger und dem gefährlich fortschreitenden Klimawandel zu leugnen oder auszublenden. Förderländer mit einseitiger Abhängigkeit ihrer Wirtschaft haben hier eine lange Tradition des Widerstands in UNFCCC und IPCC, aber auch Länder mit nach wie vor hohem Kohleverbrauch oder westliche Länder mit Öl- und Gasförderung sind hier nicht ausgenommen.
In Zeiten dramatisch zunehmender und sich gegenseitig verstärkender Umweltkrisen behindern zudem althergebrachte Denkweisen der politischen Führung vieler Länder die Arbeit und Wirksamkeit des Weltklimarates. Ein Beispiel:
Spätestens seit der Veröffentlichung des sechsten Sachstandsberichts des IPCC ist klar, dass wir die Belange von Klima, Natur und Menschen im Einklang denken müssen, wenn wir gemeinsame, sich ergänzende Auswege aus den lebensbedrohlichen Klima- und Biodiversitätskrisen finden und den Pfad einer nachhaltigen, klimaresilienten Entwicklung einschlagen wollen. Die Politik aber hat Schwierigkeiten, sich vom Dogma des ungebremsten ökonomischen Wachstums zu verabschieden.
Stattdessen werden Arten- und Klimaschutz zunehmend gegeneinander ausgespielt: etwa indem die Erneuerbaren vorrangig ausgebaut und neue, flächenhungrige Ideen zur Speicherung von CO₂ durch Produktion und Verbrennung von Biomasse strategisch eingeplant werden, ohne dass Rückzugsräume für Natur und Artenvielfalt im erforderlichen Umfang reserviert werden.
Politik erkennt oft nicht oder nur in ungenügendem Maße an, dass wir dem Klima- und Naturschutz absolute Priorität einräumen müssen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Kurzfristige, oft wirtschaftlich begründete Interessen dominieren. Sie verzögern die technologische Transformation um den Preis klimaschädlicher Emissionen und einer fortgesetzten Nutzung fossiler Energieträger. Auch im Zweifel und in akuten Krisenlagen unter steigendem Zeitdruck erfolgt der Rückgriff auf fossile Energieträger, teils ohne zweifelsfrei nachgewiesene Notwendigkeit, wie die aktuelle Debatte um die Planung der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung zeigt.
Dabei ist eine zeitgerechte Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft sowie unserer Lebensweisen alternativlos. Wir sind aktuell weit davon entfernt, unsere selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele für 2030 zu erreichen. Treibhausgas-Emissionen, Temperaturen und Extremwetter zeigen immer neue Höchststände, weltweit sind mehr als eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.
Trotz alledem konnten sich die Regierungen auf der ersten IPCC-Vollversammlung im siebten Begutachtungszeitraum im Januar in Istanbul nicht darauf einigen, Berichte zu beschließen, die zeitgerechte Entscheidungen und das Einhalten der Pariser Klimaziele befördern.
Eine schnellere Reaktionsfähigkeit des IPCC würde zum Beispiel beinhalten:
Wenn der Weltklimarat effektive Handlungsempfehlungen geben soll, dann braucht er die Freiheit, neue Wege zu gehen. Diese Freiheit und dafür wichtige Reformen muss die Politik mittragen, indem sie einer größeren Flexibilität bei der Themensetzung zustimmt und den wissenschaftlichen Prioritäten im Sinne der Krisenbewältigung folgt.
Als Teil der Reformen wäre zum Beispiel denkbar:
Nach den Beschlüssen von Istanbul sieht sich der Vorstand wieder mit der Aufgabe konfrontiert, einen Sonderbericht, einen umfassenden Sachstandsbericht mit drei Arbeitsgruppenberichten sowie einen Synthesebericht zu erstellen. Die immer stärkeren Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen Einschränkungen einer nachhaltigen Entwicklung werden jedoch parallel mit großen Schritten vorangehen und die Welt verändern. Die Gefahr besteht, dass der IPCC nicht angemessen auf diese Herausforderungen reagieren kann.
Hans-Otto Pörtner ist Professor für Integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen. Er hat als Autor und koordinierender Leitautor an diversen Sachstands- und Sonderberichten des IPCC mitgewirkt. In der sechsten Berichtsperiode des Rats war er Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels und den Möglichkeiten der Anpassung beschäftigt.
die europäische Solarindustrie kämpft um Marktanteile: Aus China kommen Module zu Dumpingpreisen und auch in den USA erhalten Hersteller hohe Subventionen. In Europa gibt es hingegen keine neuen Gelder. Warum viele Experten günstige Module aus China eher für einen Segen halten und Subventionen für den falschen Weg und wie die Abhängigkeit von China trotzdem reduziert werden könnte, analysiert Nico Beckert.
Zum Internationalen Frauentag am 8. März analysieren wir Strategien für eine feministische Klimapolitik und zeigen, wie konkrete Projekte zu Geschlechtergerechtigkeit führen können. Nicht nur im Globalen Süden, sondern auch in Europa gibt es noch Luft nach oben.
In unserer Grafik der Woche schauen wir auf die fallenden Preise im EU-Emissionshandel und was sie für Unternehmen bedeuten. Im Standpunkt erklärt der ehemalige IPCC-Leitautor Hans-Otto Pörtner, warum der Weltklimarat eine Zeitenwende braucht. Er fordert unter anderem kürzere Berichtszyklen, um schneller auf relevante Themen reagieren zu können.
Wir bleiben für Sie dran!


In der europäischen Solarindustrie herrscht Katerstimmung. Chinesische Konkurrenten überschwemmen den Weltmarkt mit staatlich geförderten Modulen zu Dumpingpreisen. Europäische Anbieter verlieren durch den Preisverfall immer stärker an Wettbewerbsfähigkeit. Die Firma Meyer Burger, der wichtigste europäische Produzent, droht mit Abzug in die USA, wo Subventionen winken. In Deutschland bitten auch Zulieferer die Bundesregierung um Hilfe. Komme die nicht, drohe auch hier das Aus.
Auch die EU-Kommission will den Kater nicht lindern. Sie plant weder Handelsbeschränkungen gegen chinesische Module noch neue Subventionen, wie EU-Kommissare jüngst deutlich gemacht haben. Die Kommission sieht vielmehr die Mitgliedsstaaten in der Pflicht. Denn die Ziele sind hochgesteckt: Die EU-Staaten wollen mit ihrem Net Zero Industry Act (NZIA) bis 2030 eine europäische Solarindustrie aufbauen, die 40 Prozent des heimischen Bedarfs decken kann – und zwar in allen Schritten der Wertschöpfungskette. Dadurch soll die Abhängigkeit von China gesenkt werden, das bisher 80 bis 95 Prozent der globalen Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette abdeckt.
Experten halten das 40-Prozent-Ziel weder für realistisch noch für sinnvoll. Es gebe weder genug Bereitschaft für Investitionen in neue Fabriken, noch die notwendigen Anreize für Investitionen, um das 40-Prozent-Ziel zu erreichen, sagt Antoine Vagneur-Jones, Solarexperte des Analyseunternehmens BloombergNEF, zu Table.Briefings. “Der Bau von Solarfabriken in Europa ist etwa drei- bis viermal so teuer wie in China. Die Produktion ist mit einem beträchtlichen Kostenaufschlag verbunden”, so Vagneur-Jones.
Laut optimistischen Schätzungen der EU-Kommission würde es 7,5 Milliarden Euro kosten, um eine Industrie mit den nötigen Kapazitäten aufzubauen. Der Verband Solar Power Europe geht hingegen von nötigen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro aus, die zudem bis 2025 getätigt werden müssten, wie Marie Tamba, Senior Research Analyst der Rhodium Group, sagt.
Um eine nennenswerte Industrie aufzubauen, müsste Europa “die Investitionen und Betriebskosten von Solarherstellern massiv subventionieren“, sagt Jenny Chase, langjährige Solaranalystin von BloombergNEF zu Table.Briefings. Die Produktionskosten von Meyer Burger liegen ihr zufolge bei über 40 US-Cent pro Watt – der Marktpreis allerdings nur bei etwas über 11 US-Cent. Chase bedauert: Meyer Burger hätte viel Erfahrung. Es sei ein “schwerer Schlag, wenn sie sich zurückziehen”.
Analysten des Thinktanks Bruegel bezweifeln, dass das 40-Prozent-Ziel überhaupt sinnvoll ist. “Vollständige Herstellungsprozesse erfordern energie- und kapitalintensive Investitionen, bei denen Europa keinen Vorteil hat“, schreiben die Analysten. So ist beispielsweise die Herstellung von Polysilizium, Ausgangsstoff von Solarzellen, sehr energieintensiv. Auf dem Solarmarkt herrsche schon heute ein massives Überangebot an Solarmodulen. “Die Subventionierung zusätzlicher Produktion hat keinen Nutzen für das Klima”, so das Fazit der Bruegel-Analysten. Auch Chase hat ihre Zweifel: “Die Solarindustrie ist ein schwieriges Geschäftsfeld. Der Wettbewerb ist brutal.” Die neuesten Fabriken hätten die beste Technologie und somit Wettbewerbsvorteile. Ältere Hersteller hätten große Nachteile, weil das Equipment schnell überholt werde.
Chase schätzt, dass sich die Energiewende im Bereich Solarenergie um “vielleicht 50 Prozent” verteuern würde, wenn Europa die Abhängigkeit von chinesischen Modulen nennenswert verringern würde. Aus diesem Grund werde das auch kaum passieren, so die Einschätzung der BloombergNEF-Expertin.
Auch die Analysten der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie gehen von einem massiven Preisaufschlag aus. Im letzten Jahrzehnt seien die Kosten für Solarmodule um 85 Prozent gefallen. “Der Ausbau der chinesischen Produktionskapazitäten im Bereich der sauberen Technologien ist das Herzstück dieser Entwicklung”, schreiben sie in einer aktuellen Analyse. Ohne China wären die “massiven Kostensenkungen, an die wir uns gewöhnt haben, vorbei”, so die Einschätzung der Berater. Allein Deutschland habe durch die globalisierte Solarlieferkette zwischen 2008 und 2020 circa sieben Milliarden US-Dollar gespart, wie eine Nature-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt.
Selbst wenn weitere Risiken, die mit einer hohen Abhängigkeit von China einhergehen, beachtet würden, “überwiegen bei der Solarindustrie erst einmal die Vorteile billiger Importe”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow des Thinktanks European Council on Foreign Relations. “Die sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Risiken sind zusammengenommen wohl zu gering, um den Nachteil der fehlenden europäischen Wettbewerbsfähigkeit unbedingt ausbügeln zu müssen”, so der Analyst und Experte für den Wettbewerb der Großmächte in der Weltwirtschaft.
Antoine Vagneur-Jones von BloombergNEF fasst die Situation zusammen: “Die Überkapazitäten im Solarsektor sind gut für die Energiewende: Sie machen alles billiger. Aber sie machen die wirtschaftlichen Argumente für den Aufbau einer eigenen Solarindustrie noch schwächer.”
Um unabhängiger von China zu werden, schlagen die Bruegel-Analysten den Aufbau von Lagerbeständen an Solarmodulen und eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen vor. Derzeit bauen beispielsweise die USA und Indien eine eigene Solarindustrie auf. Lagerbestände von etwa 30 Prozent der Marktnachfrage könnten zu einer gewissen Flexibilität führen, sollte China den Verkauf von Modulen tatsächlich einmal abrupt stoppen, so die Bruegel-Analysten. “Die Diversifizierung der Einfuhren ist ein wirksameres und effizienteres Instrument als die Importsubstitution”, schreiben sie.
Chase ist allerdings anderer Meinung. Wenn die EU-Staaten mehr aus den USA oder Indien importieren wollten, müssten sie “für schlechtere Produkte mehr Geld bezahlen als für solche aus China”. Ihr Kollege Antoine Vagneur-Jones sagt, auch die US-Hersteller litten unter Überkapazitäten, und erste angekündigte Investitionen würden schon wieder zurückgezogen – trotz US-Förderung. Laut BloombergNEF werde wohl nur etwa die Hälfte der angekündigten US-Solarinvestitionen in Höhe von 60 Gigawatt für das Jahr 2024 tatsächlich gebaut. Fast ein Viertel der geplanten Investitionen stammt ironischerweise von chinesischen Herstellern, die nun auch in den USA Subventionen erhalten. Indien könnte eher ein Exporteur in Richtung Europa werden, sagt Elissa Pierce, Research Associate der Energieberatungsagentur Wood Mackenzie. “Bei einem Preis von 20 US-Cent pro Watt sind indische Module für europäische Käufer attraktiver als US-Module”, sagt die Analystin. Die US-Module lägen derzeit bei 35 Cent pro Watt.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings für die Solarmodul-Produktion von Meyer Burger im sächsischen Freiberg. Das Unternehmen “1Komma5°”, ein Anbieter von Solaranlagen, Wärmepumpen, Stromspeichern und Wallboxen, scheint die Produktionsanlagen übernehmen zu wollen, sollte Meyer Burger das Werk tatsächlich aufgeben.
Neue Werke könnte die Bundesregierung mit einer neuen gesetzlichen Möglichkeit aus dem Net-Zero Industry Act schnell genehmigen – in speziellen Beschleunigungsgebieten, in denen private Investoren von Bürokratie entlastet würden. “Die Bundesregierung muss investieren, um Deutschland für die produzierende Industrie wieder attraktiv zu machen, beispielsweise durch die Einrichtung von Net-Zero Acceleration Valleys“, sagt der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler, der den NZIA für das Parlament verhandelt hat.

Aufgrund von Sozialisierung und Geschlechterrollen sind Frauen und Männer unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Das gilt nicht nur im Globalen Süden, sondern auch in Europa. Ein Beispiel: Die meiste formale Pflege- sowie informelle Sorgearbeit wird von Frauen übernommen. Der Klimawandel führt zu einem noch größeren Druck auf Gesundheitssysteme – und somit zu noch mehr, oftmals prekär oder gar nicht bezahlter Arbeit für Frauen. Gleichzeitig verdienen sie im Schnitt weniger, sodass sie nicht im selben Maß in private Schutzmaßnahmen investieren können wie Männer. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie “A Feminist Green Deal” der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Zudem ist Politik nicht geschlechtsneutral, nicht alle profitieren gleichermaßen von bestimmten Klimaschutzmaßnahmen. Katharina Wiese vom European Environmental Bureau erklärt das am Beispiel von Mobilität: “Frauen und Männer haben unterschiedliche Mobilitätbedarfe und Muster, die mit strukturellen Ungleichheiten verknüpft sind.” Da Frauen seltener Autos besitzen und häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen, brächten ihnen beispielsweise Förderungen für Elektroautos weniger. Eine feministische Klimapolitik sollte deshalb viel stärker in den Ausbau des ÖPNV investieren. Auch wirtschaftliche sind Frauen eher benachteiligt: Von zukünftigen Arbeitsplätzen im Bereich der Erneuerbaren beispielsweise profitieren Frauen seltener. Selbst in der Photovoltaik-Branche, die noch den größten Frauenanteil aufweist, sind weltweit nur 13 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt. Frauen haben zudem seltener Zugang zu Klimafinanzierung.
“Ist die Klimapolitik geschlechterblind, dann verstetigt sie Geschlechterungerechtigkeiten oder vergrößert diese sogar noch”, heißt es in der FES-Studie. Deshalb müsse man den Klimawandel als komplexe sozial-ökonomische Krise verstehen, meint Valeria Peláez Cardona von “Women Engage for a Common Future”. “Anders als viele Menschen denken, ist feministische Klimapolitik nicht nur Politik für Frauen”, sagt sie. Im Idealfall führe feministische Politik dazu, dass Ungerechtigkeiten abnehmen und zu Vorteilen für die Allgemeinheit – von besserem Nahverkehr profitieren beispielsweise alle.
Geschlechtergerechtigkeit bei Klimapolitik mitzudenken, ist inzwischen im Mainstream angekommen, zumindest in der Theorie. In Deutschland gibt es aus zwei Ministerien feministische Strategien mit Bezügen zu Klima: Das BMZ hat im vergangenen Jahr einen Leitfaden für “Feministische Entwicklungspolitik” veröffentlicht und vom Auswärtigen Amt gibt es die Leitlinie “Feministische Außenpolitik gestalten”. Laut dem BMZ sollen Frauen an “Entscheidungsprozessen beteiligt werden und ihr Zugang zu Klimamitteln vereinfacht” werden. Das Auswärtige Amt erklärt, es wolle in Zukunft auf Gender-Budgeting setzen, also in der Haushaltsplanung Aspekte der Gleichstellung berücksichtigen.
In der Umsetzung in Form von konkreten Projekten hat sich seit der Veröffentlichung wenig getan. Aus der Sicht von Katharina Wiese sind die beiden Leitfäden ein guter Anfang. Aber es gebe bisher zu wenig konkrete Maßnahmen und Ziele, sagt sie. Damit laufe man Gefahr, sich mit schönen Worten zu Geschlechtergerechtigkeit zu schmücken, aber zu wenig zu tun.
“Auf lokaler und regionaler Ebene gibt es aber gute Beispiele von feministischer Klimapolitik”, sagt Wiese. Diese können Regierungen, anderen öffentlichen Akteuren oder Unternehmen als Vorbild dienen. Wiese zählt auf:
Weitere gute Beispiele werden durch die “Gender Just Climate Solutions Awards” ausgezeichnet. Die Awards zeichnen Einzelprojekte aus dem Globalen Süden aus, die auch auf höherem Level umgesetzt werden könnten.
Sie gingen im vergangenen Jahr an:
Valeria Peláez nennt außerdem eine Initiative, die sie persönlich beeindruckt hat: In vielen Weltregionen haben Frauen kein Recht auf Landtitel, sie können damit auch oftmals keine eigenen Klimaschutzmaßnahmen wie die Installation einer Solaranlage, eines Wasserspeichers oder den Schutz des darauf stehenden Waldes durchführen. Dorothée Lisenga hat mit der Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable in der Demokratischen Republik Kongo erreicht, dass Frauen in verschiedenen Regionen des Landes Zugang zu Landtiteln haben.
“Soziale Gerechtigkeit – und damit auch Geschlechtergerechtigkeit – gehört zum Kampf gegen Klimawandel dazu”, fasst Wiese zusammen. Aus ihrer Sicht ist das kein “Nice-to-Have”, sondern essenziell. Sonst könnte Klimaschutz ins Leere laufen.
7. und 8. März, Paris
Konferenz Buildings and Climate Global Forum
Das Globale Forum Gebäude und Klima wird Ministerinnen und Minister sowie weitere Vertreter internationaler Organisationen zusammenbringen, um die Dekarbonisierung und Resilienz des Gebäudesektors voranzutreiben. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art und knüpft an die Fortschritte an, die auf der jüngsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) erzielt wurden. Die Veranstaltung wird gemeinsam von Frankreich und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit Unterstützung der Globalen Allianz für Gebäude und Bauwesen (GlobalABC) organisiert. Infos
7. März, 15 Uhr, Online
Webinar Deforestation Exposed: Using High Resolution Satellite Imagery to Investigate Forest Clearing
Dieses vom World Resources Institute organisierte Webinar bietet einen Überblick über die auf Global Forest Watch (GFW) verfügbaren Satellitenbilder und Ressourcen. Infos
7. März, 17 Uhr, Online
Veröffentlichung ‘Climate Policy Priorities for the next European Commission’ Report
Der European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) und das Ifo Institut veröffentlichen ihren Bericht zu Forderungen für Klimaprioritäten der nächsten Europäischen Kommission. Infos
8. und 9. März, Online
Symposium Klima in der Schule
Scientists for Future und Teachers for Future veranstalten das Symposium über den Transformationsdruck durch die Klima- und Biodiversitätskrise, mögliche Lösungsansätze und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Es geht unter anderem um Best Practices in Schule und Universitäten. Infos
8. und 9. März, Schwerte
Tagung Sozial Gerechter Klimaschutz unter Postwachstumsbedingungen – Wie geht das?
Auf der Tagung des Instituts für Kirche und Gesellschaft wird diskutiert, wie die Klimaziele in einer Zeit ohne Wirtschaftswachstum eingehalten werden können. Infos
10. März, Portugal
Wahlen Parlamentswahlen
In Portugal finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Aufgrund des Rücktritts des Präsidenten wurden die Wahlen vorgezogen.
12. März, Brüssel
Präsentation Klimaresilienz-Paket und European Climate Risk Assessment
Das Kommissionspaket zu Resilienz und Klima-Anpassung soll Policy-Entwürfe zur Resilienz von Wasserversorgung und zu Klimarisiken enthalten. Am selben Tag veröffentlicht die European Environment Agency (EEA) auch das erste European Climate Risk Assessment. Infos
12. März, Online
Webinar Öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkw
In dem Webinar vom Thinktank Agora Verkehrswende wird diskutiert, was jetzt zu tun ist, um mehr E-Lkw auf die Straße zu bringen. Infos
12. bis 14. März, Potsdam
Tagung Deutsche Klimatagung
Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft e. V. (DMG) lädt zusammen mit dem Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ), dem Alfred-Wegener Institut (AWI), dem Deutschen Wetterdienst (DWD), der Freien Universität Berlin (FU Berlin) und dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung e. V. (PIK) zur 13. Deutschen Klimatagung auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Ein Schwerpunkt wird die Attributionsforschung sein. Infos
14. März, 9 Uhr, Hamburg/Online
Seminar Energiepolitische Weichenstellung: EU-Vorgaben für den Ausbau der Offshore-Windenergie
Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e. V. diskutiert auf dem Event über die Rahmenbedingungen zum Ausbau von Offshore-Windenergie. Infos
Vor fast genau einem Jahr lag der europäische CO₂-Preis mit über 100 Euro je Tonne auf einem Rekordhoch. Bis Ende Februar war er auf rund 53 Euro gesunken – das ist fast eine Halbierung. Anfang März pendelte er um die 60 Euro, was immer noch einem Minus von rund 40 Prozent entspricht. Grundsätzliche Ursachen des Preisverfalls sind die generelle Volatilität des europäischen Emissionshandels (ETS) und fehlende Schutzmaßnahmen für schnell steigende oder sinkende Preise. Darüber hinaus tragen der sinkende Gaspreis und die dadurch günstiger werdende fossile Verstromung zum niedrigen CO₂-Preis bei.
Auch wenn der niedrige Preis an sich laut Experten zunächst kein Problem darstellt, haben die starken Schwankungen Folgen für die europäische Energiewende. “Es ist ein entmutigendes Signal für Unternehmen, die sonst in kohlenstoffarme Technologien investieren würden“, sagt Emil Dimanchev, Klimapolitik-Forscher an der Naturwissenschaftlichen Universität Trondheim. Ein instabiler Markt sorge dafür, dass die Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder Carbon Removals neu bewertet werden müsse.
“Unternehmen, die in eine kohlenstoffarme Technologie investieren wollen, müssen damit rechnen, dass ihre künftigen Einnahmen sehr viel volatiler und unsicherer werden”, so der Forscher zu Table.Briefings. Das erhöhe die Kapitalkosten. Für die Unternehmen werde es “schwieriger, eine Bank aufzusuchen und einen Kredit zu erhalten oder sich Anleihen zu sichern”.
Es sei jedoch ein interessanter Moment für den europäischen Emissionshandel, denn nun würde sich zeigen, ob die Marktstabilitätsreserve (MSR) des ETS funktioniere oder nicht, sagt Dimanchev. “Es ist ein Test, ob die Marktstabilitätsreserve für Händler überzeugend genug ist, dass der Preis wieder steigt, da sie wissen, dass die MSR den Markt an etwaige Veränderungen auf der Nachfrageseite anpassen wird.”
Der niedrige CO₂-Preis dürfte auch Auswirkungen auf den deutschen Klima- und Transformationsfonds haben, aus dem unter anderem die meisten Klimaschutzprogramme der Bundesregierung finanziert werden. Die Mittel des Fonds stammen aus den Einnahmen aus dem deutschen und EU-Emissionshandel. Er ist schon jetzt unterfinanziert. luk/mkr/ae
Die britische Regierung plant für 2024 zusätzliche 1,025 Milliarden Pfund (1,2 Milliarden Euro) für den Ausbau erneuerbarer Energien zur Verfügung zu stellen. Das geht aus dem Budget-Bericht für 2024 hervor. Während für Solarenergie, Onshore-Windanlagen oder Wasserkraft jährlich 263 Millionen Euro vorgesehen sind, ist für Offshore-Windanlagen eine Rekordsumme von jährlich 935 Millionen Euro geplant. Das Unterstützungspaket ist damit dreimal größer als alle bisherigen Pakete, wie Bloomberg berichtet.
Damit soll der Ausbau von Offshore-Windkraft angekurbelt werden. Bis 2030 will der Inselstaat seine Kapazitäten verdreifachen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern sind die Projektentwickler auf Förderungen angewiesen. In der letzten Auktionsphase im Vorjahr hatte kein einziger Entwickler mitgeboten, weil die Regierung den garantierten Strompreis zu niedrig angesetzt hatte. Dieser wird über Differenzverträge (Contracts for Difference) geregelt. Damit wird Projektentwicklern wie Orsted, Iberdrola und RWE ein Fixpreis garantiert. Das schafft Planungssicherheit und soll Preisschwankungen ausgleichen: Liegt der Marktpreis unter dem Fixpreis, zahlt der Staat die Differenz an den Betreiber. Letztes Jahr lag dieser Fixpreis bei 51 Euro pro MWh – zu niedrig, um für die Projektentwickler rentabel zu sein. Nun soll dieser Fixpreis auf 85 Euro angehoben werden. lb
Die Europäische Kommission hat einen Kompromissvorschlag zum Umgang der EU mit dem Energiecharta-Vertrag (ECT) vorgelegt. Vorgesehen ist, dass der Vertrag noch während der Mitgliedschaft der EU reformiert wird. Anschließend würde die EU aus dem Vertrag austreten, wie es die Kommission bereits letzten Juli vorgeschlagen hatte. Aus ihrer Sicht behindert der gegenwärtige hohe Investorenschutz des ECT die Klimawende und erlaubt missbräuchliche Klagen. Einzelne EU-Staaten, die dies wünschen, könnten aufgrund des Kompromissvorschlags jedoch Vertragsteilnehmer bleiben.
“Die vorgeschlagenen Änderungen am Vertragstext” bedeuteten “wesentliche Verbesserungen, die den ECT mit modernen Standards des Investitionsschutzes und den Positionen der EU in anderen Foren in Einklang bringen werden”, heißt es im Vorschlag der Kommission. Aufgezählt werden
Der ECT mit seinen gegenwärtig etwa 50 Mitgliedsstaaten trat 1998 in Kraft und ermöglicht es Investoren aus dem Energiebereich, Schadenersatz für aufgrund gesetzlicher Änderungen entgangener Gewinne einzuklagen. Kritisiert wurden auch die intransparenten Schiedsverfahren jenseits staatlicher Gerichte. Deutschland ist wie andere EU-Staaten bereits 2023 aus dem ECT ausgetreten. Es sind jedoch weiterhin Klagen gegen Deutschland anhängig. av
Beim Klimageld, dessen Einführung laut Koalitionsvertrag vorbereitet werden soll, zögert die SPD. Fraktionsvize Matthias Miersch, zuständig für den Umweltbereich, warnt schon länger vor heftigen Preissprüngen bei fossiler Energie, wenn der CO₂-Preis nach 2027 – wie absehbar – stark ansteigt. Nun hat der Ökonom Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) den SPD-Klimafachleuten vorgerechnet, was es konkret bedeutet, wenn die nationalen CO₂-Preissysteme in den europäischen Emissionshandel überführt werden.
Wenn der CO₂-Preis, wie in manchen Szenarien erwartet, auf 275 Euro pro Tonne steigt, was eine eher hohe Schätzung darstellt, würde sich Benzin im Vergleich zu heute um 55 Cent und Diesel um 62 Cent pro Liter verteuern; der Erdgaspreis stiege um 5 Cent pro Kilowattstunde. Nach Dulliens Berechnung würde sich daraus eine unmittelbare Inflationswirkung von 2,8 Prozentpunkten ergeben; dazu käme noch die indirekte Inflation durch die Überwälzung höherer Kosten von Gewerbebetrieben. (Dulliens Präsentation finden Sie hier.)
Ein pauschales Klimageld würde dabei nur teilweise helfen. Selbst wenn die gesamten Einnahmen aus dem CO₂-Preis für Wärme und Verkehr als Klimageld ausgezahlt würden, würden 44 Prozent der Haushalte per Saldo verlieren, 49 Prozent profitieren. Zwar würden ärmere Haushalte insgesamt entlastet, aber innerhalb gleicher Einkommensgruppen fielen die Belastungen sehr unterschiedlich aus. In jedem Fall seien Menschen auf dem Land “deutlich stärker betroffen” als die Stadtbevölkerung, und Hauseigentümer stärker als Mieter, bei denen der Vermieter einen Teil der Kosten tragen muss.
Für Dullien kann das Klimageld darum nur eines unter mehreren Instrumenten sein. Er hat aber noch einen weiteren Vorbehalt: “Ohne Reform der Schuldenbremse oder Steuererhöhung ist schwer zu sehen, woher die Finanzierung kommen sollte.” SPD-Fraktionsvize Miersch bremst in seiner Partei schon länger bei der vorbehaltlosen Forderung nach einem pauschalen Klimageld und plädiert etwa für eine soziale Staffelung bei der Auszahlung. hk/mkr
Die EU darf Palmöl-Biodiesel künftig als nicht erneuerbar einstufen und damit aus ihrer Beimischungsquote für Biokraftstoffe ausschließen. Einen entsprechenden Sieg hat die Europäische Union am Dienstag bei der Welthandelsorganisation (WTO) errungen. Ein Schiedsgericht wies eine malaysische Beschwerde gegen die EU-Entscheidung ab.
Für den Klimaschutz ist das relevant, weil Palmöl mit einem hohen Abholzungsrisiko einhergeht. Einige Studien gehen davon aus, dass Biodiesel aus Palmöl zu dreimal so hohen Emissionen führt wie fossiler Diesel. Palmöl hatte 2020 mit rund 30 Prozent nach Rapsöl (36 Prozent) den zweitgrößten Anteil am europäischen Biodiesel. Malaysia und Indonesien sind die größten Palmölproduzenten der Welt. Beide hatten vor dem WTO-Schiedsgericht geklagt.
Es war die erste WTO-Entscheidung im Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern. In ihr stimmte ein dreiköpfiges Gremium mit zwei zu eins Stimmen dafür, Malaysias inhaltliche Forderungen zurückzuweisen. Allerdings gaben sie Malaysia recht in dessen Beschwerde über die Art und Weise, wie die Maßnahmen vorbereitet, veröffentlicht und verwaltet wurden. Indonesien ließ daraufhin seine Beschwerde fallen und beantragte die Aussetzung der Arbeit des Panels.
Hintergrund ist, dass künftig EU-weit ein Anteil von zehn Prozent an Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll. Dazu zählen auch Biokraftstoffe auf pflanzlicher Basis. Die EU schließt Pflanzen aus, die auf abgeholzten Flächen angebaut werden oder bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie den Anbau von Nahrungsmitteln verdrängen, für die dann zusätzliche Fläche gerodet werden müsste. Daher hat die EU festgelegt, dass Biokraftstoff auf Palmölbasis bis 2030 nicht mehr zu den erneuerbaren Energiequellen zählen soll. Daraufhin hatten Malaysia und Indonesien bei der WTO Klage gegen die Europäische Union eingereicht. rtr/lei/kul/ae
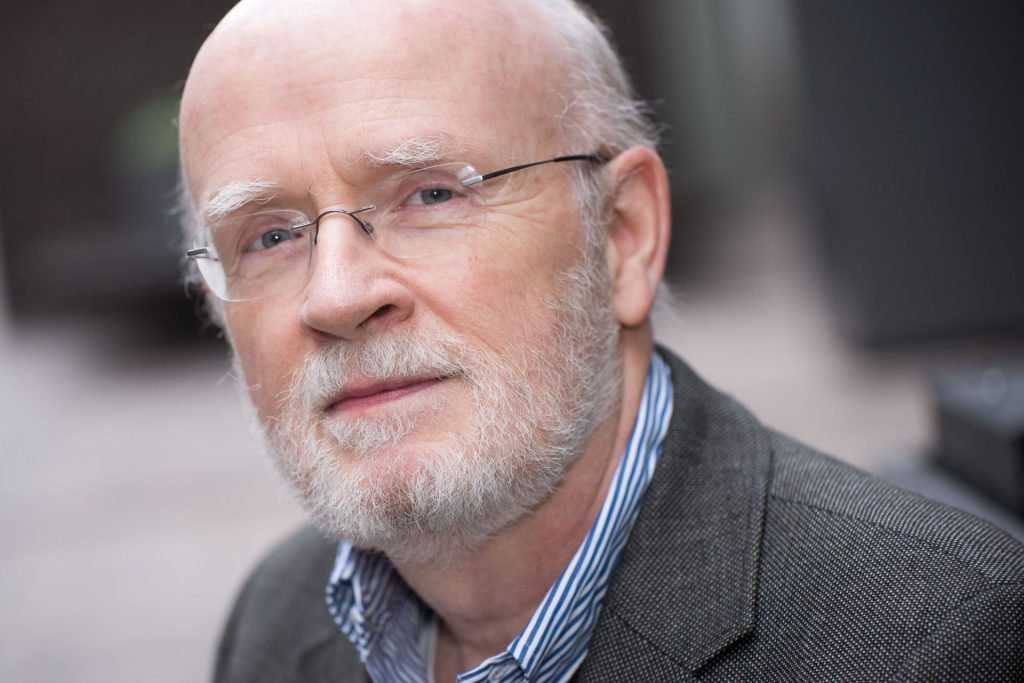
Der Weltklimarat (IPCC) ist als zwischenstaatlicher Ausschuss kein rein wissenschaftliches Gremium, sondern beruht seit seiner Gründung im Jahr 1988 auf einer engen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik. Das war und ist seine Stärke. Aber in Zeiten drängender Verschärfungen in der Klima- und Artenschutzkrise wird es mehr und mehr zu einer Schwäche.
Zu oft bremst und verhindert politisches Kalkül, das sich über wissenschaftliche Erkenntnisse erhebt, ein effizientes Arbeiten des IPCC. Der Rat braucht Reformen in internen Prozessen und der Auswahl seiner Arbeitsprojekte, und weniger politisch motivierten Einfluss. Anderenfalls steht zu befürchten, dass er den aktuellen Entwicklungen hinterherläuft und keine Politikberatung für zeitgerechtes Handeln mehr liefern kann.
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Regierungsdelegationen arbeiten in der Vollversammlung des IPCC zusammen, Entscheidungen folgen dem Konsensprinzip. Wie weit der politische Einfluss einzelner Akteure dabei jedoch im Detail reicht, ist vermutlich nur wenigen Außenstehenden bewusst:
Diese enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft hat in der Vergangenheit die Stärke des Weltklimarates ausgemacht. Mit der einstimmigen Verabschiedung der Zusammenfassung eines Arbeitsgruppen- oder Sonderberichtes erkennen alle Regierungen dessen Aussagen an. Kein Entscheidungsträger kann dann mehr behaupten, er hätte nichts vom Ausmaß und den Folgen des Klimawandels gewusst.
Die Ergebnisse der COP28 haben jedoch einmal mehr deutlich gemacht: Verzögerungsstrategien von Regierungen verhindern mehr und mehr die vollständige Umsetzung zeitkritischer wissenschaftlicher Befunde des Weltklimarates. Nahezu alle wichtigen Förderländer fossiler Energieträger versuchen, die enge Verbindung zwischen der Förderung und Nutzung fossiler Energieträger und dem gefährlich fortschreitenden Klimawandel zu leugnen oder auszublenden. Förderländer mit einseitiger Abhängigkeit ihrer Wirtschaft haben hier eine lange Tradition des Widerstands in UNFCCC und IPCC, aber auch Länder mit nach wie vor hohem Kohleverbrauch oder westliche Länder mit Öl- und Gasförderung sind hier nicht ausgenommen.
In Zeiten dramatisch zunehmender und sich gegenseitig verstärkender Umweltkrisen behindern zudem althergebrachte Denkweisen der politischen Führung vieler Länder die Arbeit und Wirksamkeit des Weltklimarates. Ein Beispiel:
Spätestens seit der Veröffentlichung des sechsten Sachstandsberichts des IPCC ist klar, dass wir die Belange von Klima, Natur und Menschen im Einklang denken müssen, wenn wir gemeinsame, sich ergänzende Auswege aus den lebensbedrohlichen Klima- und Biodiversitätskrisen finden und den Pfad einer nachhaltigen, klimaresilienten Entwicklung einschlagen wollen. Die Politik aber hat Schwierigkeiten, sich vom Dogma des ungebremsten ökonomischen Wachstums zu verabschieden.
Stattdessen werden Arten- und Klimaschutz zunehmend gegeneinander ausgespielt: etwa indem die Erneuerbaren vorrangig ausgebaut und neue, flächenhungrige Ideen zur Speicherung von CO₂ durch Produktion und Verbrennung von Biomasse strategisch eingeplant werden, ohne dass Rückzugsräume für Natur und Artenvielfalt im erforderlichen Umfang reserviert werden.
Politik erkennt oft nicht oder nur in ungenügendem Maße an, dass wir dem Klima- und Naturschutz absolute Priorität einräumen müssen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Kurzfristige, oft wirtschaftlich begründete Interessen dominieren. Sie verzögern die technologische Transformation um den Preis klimaschädlicher Emissionen und einer fortgesetzten Nutzung fossiler Energieträger. Auch im Zweifel und in akuten Krisenlagen unter steigendem Zeitdruck erfolgt der Rückgriff auf fossile Energieträger, teils ohne zweifelsfrei nachgewiesene Notwendigkeit, wie die aktuelle Debatte um die Planung der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung zeigt.
Dabei ist eine zeitgerechte Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft sowie unserer Lebensweisen alternativlos. Wir sind aktuell weit davon entfernt, unsere selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele für 2030 zu erreichen. Treibhausgas-Emissionen, Temperaturen und Extremwetter zeigen immer neue Höchststände, weltweit sind mehr als eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.
Trotz alledem konnten sich die Regierungen auf der ersten IPCC-Vollversammlung im siebten Begutachtungszeitraum im Januar in Istanbul nicht darauf einigen, Berichte zu beschließen, die zeitgerechte Entscheidungen und das Einhalten der Pariser Klimaziele befördern.
Eine schnellere Reaktionsfähigkeit des IPCC würde zum Beispiel beinhalten:
Wenn der Weltklimarat effektive Handlungsempfehlungen geben soll, dann braucht er die Freiheit, neue Wege zu gehen. Diese Freiheit und dafür wichtige Reformen muss die Politik mittragen, indem sie einer größeren Flexibilität bei der Themensetzung zustimmt und den wissenschaftlichen Prioritäten im Sinne der Krisenbewältigung folgt.
Als Teil der Reformen wäre zum Beispiel denkbar:
Nach den Beschlüssen von Istanbul sieht sich der Vorstand wieder mit der Aufgabe konfrontiert, einen Sonderbericht, einen umfassenden Sachstandsbericht mit drei Arbeitsgruppenberichten sowie einen Synthesebericht zu erstellen. Die immer stärkeren Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen Einschränkungen einer nachhaltigen Entwicklung werden jedoch parallel mit großen Schritten vorangehen und die Welt verändern. Die Gefahr besteht, dass der IPCC nicht angemessen auf diese Herausforderungen reagieren kann.
Hans-Otto Pörtner ist Professor für Integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen. Er hat als Autor und koordinierender Leitautor an diversen Sachstands- und Sonderberichten des IPCC mitgewirkt. In der sechsten Berichtsperiode des Rats war er Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels und den Möglichkeiten der Anpassung beschäftigt.
