wie leistungsfähig Strukturen sind, zeigt sich insbesondere in Krisenzeiten. Dass die Kultusministerkonferenz im Umgang mit der Pandemie keine Bestnoten erzielte, ist hinlänglich bekannt. Haben die Bildungs-Verantwortlichen daraus aber gelernt, jetzt, da hunderttausende ukrainische Schülerinnen und Schüler ihr Land verlassen müssen und in Deutschland Hilfe suchen? Robert Saar geht in seiner Analyse der Frage nach, ob die eigens zur Bewältigung dieser Krise von der KMK eingerichtete Taskforce in der Lage ist, die Einstellung ukrainischer Lehrkräfte bundesweit so effektiv zu organisieren, dass die Beschulung der Kinder ohne größeren Zeitverzug in Deutschland fortgesetzt werden kann. Sein Befund ist ernüchternd: Jedes Bundesland wählt seinen eigenen Weg. Sachsen unbürokratisch, Brandenburg bemüht, Berlin scheinbar ohne jede Sensibilität für die Lage – und die Taskforce: nicht zuständig.
Ausgerechnet Armenien als Vorbild für die Erschließung digitaler Interessen bei Schülern? Als Angela Merkel vor einigen Jahren das armenische Projekt TUMO besichtigte, in dem Jugendliche am Nachmittag den Umgang mit digitalen Tools unter kundiger Beratung erlernen, war sie begeistert. Die bundeseigene Förderbank KfW nahm die Idee auf und finanzierte (erstmals in ihrer Geschichte) mit eigenem Geld einen Referenzstandort in Berlin. Das hippe Projekt wurde allerorten gelobt, endlich mal coole Bildungsformen. Bildung.Table ist nun der Frage nachgegangen, wie die KfW die Idee verbreiten will, welche Investitionen interessierte Kommunen und Sponsoren erwarten müssen – und vor allem, ob der Bund willens ist, die Einrichtung solcher Lernzentren zu unterstützen.
Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem einen Blick in den Terminkalender, in dem Sie auch in dieser Ausgabe des Briefings wieder wichtige Hinweise für den Austausch mit Experten im Bildungsbereich erhalten.
Es grüßt Sie herzlich

Die von der Kultusministerkonferenz neu gegründete Taskforce Ukraine wird sich in die Anerkennungsprozeduren der einzelnen Bundesländer nicht einmischen. Das teilte die neue Feuerwehrstelle der Kultusminister bei einem Gespräch mit. Das bedeutet, die föderale Zersplitterung des deutschen Schulwesens bleibt trotz der nationalen Herausforderung des Ukraine-Kriegs bestehen. Eine kurze Umfrage in den Ländern von Bildung.Table zeigt: Der Umgang mit den geflüchteten Lehrern wird völlig unterschiedlich gehandhabt. Es gibt eine Gruppe von Ländern, die relativ schnell handelt – andere warten mit ihrer vollen Bürokratie auf.
Das Land Berlin etwa lud vergangene Woche zu einem digitalen Meeting für Lehrkräfte aus der Ukraine, um diese über Perspektiven und Berufschancen aufzuklären. In zwei Veranstaltungen – keine davon in russischer oder ukrainischer Sprache – wurden die Möglichkeiten der Mitarbeit vorgestellt. Für die Einstellung als reguläre Lehrkraft müssen Bewerbende Deutsch auf C1-Niveau sprechen und ihre Ausbildung für zwei Fächer des Berliner Lehrplans anerkannt sein. Das sind Voraussetzungen, die keine Lehrkraft aus der Ukraine sofort erfüllen kann.
Im Verfahren zur Anerkennung müssen Bewerbende viele Nachweise einreichen. In der Bundeshauptstadt etwa müssen die Ukrainer auch weiterhin ein zwölfstufiges Verfahren durchlaufen. Berlin akzeptiert aus Kulanz zwar auch einfache Kopien und bittet “nach Möglichkeit” um Übersetzungen vereidigter Dolmetscher. Wer die bis zu 222 Euro Bearbeitungsgebühr dafür nicht hat, kann beim Senat eine Kostenbefreiung beantragen. Wie lange es jedoch dauert, das gesamte Verfahren zu durchlaufen, an dessen Ende erst die eigentliche Bewerbung auf eine Stelle steht, ist nicht klar. In beiden Info-Veranstaltungen waren zusammen mit etwa 70 Personen verhältnismäßig wenig potenzielle Lehrkräfte. Für Anfang April kündigte der Senat eine weitere Veranstaltung an – dieses Mal auf Russisch. Zivilgesellschaftliche Initiativen für ukrainische Lerngruppen wollen schneller sein und im April schon unterrichten. Das sagt zumindest Initiator Hans-Jürgen Kuhn von “Schöneberg hilft”.
Ganz anders in Sachsen. Der Freistaat kündigte an, 100 Lehrerstellen und weitere 100 Assistenzstellen zu schaffen. Die Einstellungen haben bereits begonnen. Rekrutieren für die befristeten Stellen will das Land sowohl Geflüchtete als auch Ukrainer, die schon länger in Deutschland leben. Das benachbarte Brandenburg will eine schnelle Einstellung über Mittel aus Vertretungsbudgets erreichen, wobei deutschsprachige Ukrainer als Lehrkräfte eingesetzt werden sollen. Auch in Brandenburg sind die Stellen zunächst befristet.
Ähnlich plant auch Hamburg geflüchteten Lehrkräften berufliche Perspektive zu geben: Lehrkräfte sollen eingestellt werden, um etwa in Erstaufnahmeeinrichtungen zu unterrichten und pädagogisches Personal kann deutsche Lehrkräfte zu unterstützen. Auf eine Stelle als reguläre Lehrkraft kann sich aber auch hier nur bewerben, wer gut Deutsch spricht. Alle Stellen sind zunächst befristet.
In mindestens zwei Ländern scheint die Task-Force der KMK die Eigeninitiative sogar zu bremsen. In Rheinland-Pfalz sollen ukrainische Lehrkräfte “bei der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine mitwirken”. Ebenfalls denkbar sei ein Einsatz als Sprachmittler, sofern Deutsch- oder Englischkenntnisse vorliegen. Auf Anfrage von Bildung.Table nach den genauen Modalitäten des Einstellungsverfahrens und dessen Dauer teilte das Bildungsministerium in Mainz aber mit, dass man auf die Taskforce warte, die ebenfalls mit diesen Fragen befasst sei. Die Taskforce beharrt freilich darauf, dass sie nur generelle Fragen kläre, aber nicht in einzelne Länder hineinregiere.
Ähnlich ist das verzögernde Zusammenspiel zwischen der Taskforce und dem Land Hessen. Das Land informiert auf seiner Website zwar über Beschulung geflohener Kinder, Informationen für interessierte Lehrkräfte finden sich dort aber nicht. Wie überall in Deutschland kann auch in Hessen ein Antrag auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse gestellt werden. Allerdings ist auch hier fraglich, wie viele Geflüchtete alle dafür nötigen Nachweise und Beglaubigungen bereit haben. Das Hessische Kultusministerium bat auf Nachfrage von Bildung.Table um Geduld, da sich alle Fragen noch in “fachlicher Diskussion” befänden. Es wurde auf die Taskforce verwiesen – die bei Anfragen wiederum an die Länder zurückverweist.
Das bedeutet, einzelne Bundesländer zeigen politische Handlungsfähigkeit beim Einstellen geflüchteter Lehrkräfte. Die von der KMK einberufene Taskforce trifft selbst keine operativen Entscheidungen. Sie soll koordinieren und für Rechtssicherheit in den Entscheidungen der Länder sorgen – also genau das, was eigentlich Aufgabe der Konferenz der Kultusminister ist. Den Bildungsföderalismus hat auch Putin nicht abschaffen können.
Allerdings gibt es ein Schlupfloch für ukrainische Geflüchtete, die im Anerkennungsverfahren als reguläre Lehrkraft scheitern: Die Lehrer können sich als sogenannte Seiteneinsteiger bewerben – dort sind die Einstellungschancen besser und die formalen Voraussetzungen niedriger. Auf Nachfrage erklärte sowohl Berlin als auch Sachsen-Anhalt, dass den ukrainischen Lehrkräften dieser Weg offen stehe. Der zuständige Referent in Berlin erklärte, einzige Voraussetzung – neben einer pädagogischen Grundqualifikation – sei, dass es sich dabei um unbefristete Stellen handle. Auf Deutsch: die Geflüchteten müssten dann bleiben.
In Sachsen-Anhalt ist das anders. Dort seien zwar noch keine ukrainischen Lehrkräfte als Seiteneinsteiger eingestellt worden, es gebe hier aber großen Bedarf, sagte das Vorstandsmitglied der GEW in Sachsen-Anhalt, Torsten Richter. “Wir brauchen hier pragmatische Lösungen und können nicht warten, bis die KMK aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und ihre Anerkennungsverfahren überarbeitet hat”, sagte Richter. Voraussetzung zur Einstellung seien Deutschkenntnisse und mindestens ein Bachelorabschluss. So könnte man vorerst unbesetzte Stellen für Vertretungslehrkräfte nutzen, um schnell ukrainische Lehrkräfte vorerst befristet einzustellen. Richter beruhigte auch, dass jemand dann zwangsweise in Deutschland bleiben müsse. “In keinem Fall ist die Anerkennung an einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland geknüpft”, sagt er. Robert Saar

Frau Schröter, was müssen Schüler eigentlich können, um den Informations-Krieg zu verstehen, der neben dem Bombenkrieg stattfindet?
Bevor Schüler:innen Fake News erkennen können, sollten sie zunächst lernen, was seriöse News sind. Und wie bedeutsam sie für eine Demokratie sind. Das heißt zum Beispiel nicht nur, regelmäßig Presse-Artikel zu lesen, sondern diese auch mal selbst zu verfassen. In meinem Unterricht machen wir das kontinuierlich.
Im Fach Deutsch.
Ja, aber nicht nur. In Deutsch ist es Teil des Lehrplans bei den Darstellungsformen wie Bericht, Reportage und Nachricht. Aber Medienkompetenz passt genauso gut in Gesellschaftswissenschaften, in Mathematik oder etwa in Englisch. Da hat uns US-Präsident Trump immer eine Menge Material geliefert. Die Schüler lernen, anhand von Erkennungsmerkmalen Schritt für Schritt Fake-News zu identifizieren und zu enttarnen.
Woran erkennt ein Schüler, ob eine Nachricht gefälscht oder erfunden ist?
Ganz einfach anhand einer Checkliste, die wir gemeinsam erstellen. Dazu gehört unter anderem, sehr genau auf die Quellen zu achten, den Autor zu überprüfen. Sehr wichtig ist es, die Herkunft eines Bildes rückwärts untersuchen zu können. Das finden meine Schüler:innen spannend. Und sie sollen natürlich kritisch auf den Inhalt selbst schauen. Die Schüler lernen auch, in sozialen Medien nur gesicherte Informationen zu teilen. Das Thema, das uns im Moment so bewegt, der Info-Krieg, steht nicht explizit im Lehrplan. Deswegen muss dieser Begriff auf jeden Fall thematisiert werden.
Ganz konkret: wie können Schüler den vermeintlichen Mord an einem 16-jährigen Russlanddeutschen überprüfen, den angeblich Ukrainer in Euskirchen verübten?
Diesen Fall von Fake News haben meine Schüler:innen von sich aus angesprochen. Und sie haben es anhand ihrer Checkliste selbst als Falschinformation aufgeklärt. Dazu fand sich ein Faktencheck im Öffentlichen Rundfunk, der ihr Arbeitsergebnis bestätigte.
Reicht es denn heute noch, in der Schule Zeitung zu lesen? Die Generation Smartphone informiert sich doch ganz anders.
Soziale Medien im Unterricht zu thematisieren, ist essenziell. Das sollte das kleine 1×1 der politischen Bildung sein. Die Reaktion der Schüler ist übrigens interessant. Einige haben mir zurückgemeldet, dass sie soziale Medien lieber privat nutzen. Sie finden es interessant, regelmäßig Pressetexte im Unterricht zu lesen, weil sie das zu Hause nicht machen würden. Die Schüler:innen lernen an den verschiedenen Textsorten neben dem aktuellen Geschehen übrigens auch sprachliche Besonderheiten und erweitern ihren Wortschatz. Denn gute Pressetexte sind eine Fundgrube für den Unterricht.
Ist es überhaupt möglich, Schülerinnen und Schüler zu souveränen Akteuren im Netz zu machen? Nicht mal Erwachsene oder Regierungen können ja für sich digitale Souveränität beanspruchen.
Wir müssen das auf jeden Fall versuchen! Denn das ist unser Bildungsauftrag. Ich kann nur von meinen Schülern sprechen: wenn sie wissen, wie seriöse Informationen entstehen, gehen sie souveräner mit der Informationsflut um. Sie wissen, was man darf und was nicht. Und sie sind dann sogar in der Lage, sich über Fake News auch mal zu amüsieren – weil sie so dilettantisch gemacht sind.
Sollte man das Thema fest im Lehrplan verankern?
Ja, teilweise ist das bereits der Fall. Die Schülerinnen und Schüler sollten durch ein Spiral-Curriculum von Beginn an immer wieder mit dem Thema in Berührung kommen. Ich würde mir eine digitale Grundbildung wünschen. Sobald Kinder und Jugendliche Nachrichten aufnehmen können, müssen sie in die Lage versetzt werden, diese auch zu verarbeiten. Das Bedienen von Smartphones und Apps reicht nicht. Es ist in meinen Augen extrem wichtig, dass die Schüler Fakten gegenüber kritisch sind. Um mit der momentanen Flut von schrecklichen Nachrichten umgehen zu können, müssen Schüler auch bewusst Infopausen einlegen – in denen sie auch mal auf Nachrichten verzichten. Auch das sollten sie lernen.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen schlägt ein eigenes Schulfach vor, um so etwas wie eine “redaktionelle Gesellschaft” erreichen zu können.
Das wäre ideal! Dadurch könnte man das regelmäßige Konsumieren und Produzieren von Information gewissermaßen ritualisieren – und das Verstehen ihrer gesellschaftlichen Folgen. Das Thema Nachrichten- und Informationskompetenz würde so einen zentralen Stellenwert bekommen, von dem alle Lernenden profitieren könnten.
Wie geht man eigentlich damit um, wenn man russische Kinder im Unterricht hat? Wie gut sind sie informiert?
Mein Eindruck ist: Je jünger die Schüler sind, umso mehr werden sie im Denken von ihrem Elternhaus beeinflusst. Wir bemerken gerade bei einigen russischen Kindern und Jugendlichen, dass sie von ihren Eltern verfälschte Informationen zu hören bekommen. Wenn sie dann in der Schule mit der Wahrheit konfrontiert werden, entstehen bei ihnen innere Widersprüche und Konflikte. Das geht übrigens schon sehr früh los.
Was meinen Sie damit?
Ich habe in meinem Unterricht angehende Erzieherinnen, die das Phänomen schon im frühen Kindesalter erleben. Russische Kinder kommen mit falschen Nachrichten in die Kita oder Grundschule. Das bedeutet, wir müssen schon den Kleinsten den Unterschied zwischen, Wahrheit und Lüge beibringen. Je früher, desto besser.
Kerstin Schröter ist Lehrerin für Sprache/Kommunikation und Medienbildung an einer Fachschule. Jede Klasse wird bei der erfahrenen Journalistin zeitweise zur Redaktion. Es entstehen als Lernprodukte Interviews, Reportagen sowie Lern-Audios und -Videos im Unterricht. Sie bildet Lehrkräfte bundesweit fort, etwa im digital.learning.lab und bei digitale-lernideen.com.
Schröter gehört zum Verein “Journalismus macht Schule”, der am Freitag und Samstag zu einem bundesweiten Lehrer-Schüler-Kongressworkshop einlädt, u. a. mit Georg Mascolo, Bettina Stark-Watzinger, Bernhard Pörksen und Cordt Schnibben.
Im Berliner Bezirk Charlottenburg, fußläufig zur U-Bahn-Station Wilmersdorfer Straße, steht seit Herbst 2020 ein digitales Lernzentrum für Jugendliche, ein sogenanntes TUMO-Zentrum. Mehrstöckig, hell beleuchtet, mit bodentiefen Fenstern, die den Blick auf die technische Infrastruktur freigeben. Auf 2.000 Quadratmeter befinden sich futuristisch anmutende Schreibtische, ein Tonstudio, Sitzsäcke, 100 iMacs, 50 MacBooks – genug Kapazitäten für 150 Interessierte auf einmal. “Roboter programmieren? Du kannst das auch!” steht auf einem der Werbeplakate von TUMO. Die Message: Alles ist lernbar. Die Mission: Die Möglichkeiten dafür zur Verfügung zu stellen. Jugendliche können außerhalb der Schulzeit hierherkommen und ihre Kompetenzen stärken, ja sogar Zertifikate erwerben. Sie wählen aus zehn Themenkomplexen, von Grafik-Design über Spiele-Entwicklung bis zu Robotics, in je zweimal zwei Stunden pro Woche werden entweder in Expert:innen-Coachings oder im eigenen Tempo mit der Lernsoftware TUMO World die eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt.
Die Idee für das Projekt stammt aus Armenien, wo 2011 das erste Lernzentrum, initiiert von der amerikanisch-armenischen Simonian Educational Foundation, gegründet wurde. Mittlerweile gibt es vier Standorte im ganzen Land, sogenannte Hubs, an denen insgesamt 20.000 Jugendliche lernen. Diese werden außerdem von TUMO-Boxen, flexibel verlegbaren Mini-Lernzentren in Containern ergänzt. Weitere Standorte bestehen neben Berlin bereits in Moskau, Paris, Tirana und Beirut, zudem sind welche in Kalifornien, Kyiv, Tokyo und Nur-Sultan geplant. Das System ist immer gleich: TUMO Armenien agiert als Franchise-Geber, setzt Standards für die interessierten Betreiber, stellt die erforderliche Software zur Verfügung und schult Personal und Advisor für die Lernenden.
In Deutschland wurde die Idee für ein TUMO-Zentrum von der Förderbank des Bundes, der KfW, angestoßen. Es ist das erste so konkrete Projekt der KfW im Bildungsbereich. Diese finanziert das Projekt als Ideengeber für fünf Jahre aus KfW-Eigenmitteln, will es dann an einen nächsten Betreiber weitergeben. Für weitere Standorte in Deutschland möchte die KfW Betreiber und Sponsoren zu suchen – ohne zusätzliche Beteiligung der Förderbank. Infrage kommen Kommunen oder Landkreise, die ein solches Angebot in ihrer Region installieren wollen, oder auch Stiftungen oder Unternehmen. Public-Private-Partnership ist das Betreibersystem, das die bestehenden TUMO-Zentren in Europa auszeichnet und das die KfW auch hierzulande initiieren will. Insgesamt rund 20 solcher Zentren schweben der KfW vor.
Ob das aber funktioniert, ist mehr als zweifelhaft. Grund Nummer eins: Der Bund fördert zwar MINT-Kompetenzen deutscher Schülerinnen und Schüler. Aber er tut das mit seinem MINT-Aktionsplan. Und da passt TUMO nicht hinein. Ziel des MINT-Aktionsplans des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist es, sogenannte MINT-Cluster zu fördern, also Verbünde aus unterschiedlichen Akteuren wie MINT-Bildungsvereinen, Schülerlaboren & Schülerforschungszentren, Unis & Hochschulen, Museen, Landratsämtern oder Schulträgern zu vernetzen. Diese sollen MINT-Angebote systematisch ausbauen und verstetigen.
“Als Oberste Bundesbehörde fördern wir hierüber vor allen Dingen den Ausbau bundesweiter Strukturen und Netzwerke – nicht jedoch einzelne MINT-Anbieter oder Bildungsinstitutionen, wie etwa das TUMO-Zentrum”, sagt eine Sprecherin des BMBF und betont: Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern. “Es gibt aus Sicht des BMBF keinen Anlass – und auch keine Möglichkeit – sich an der Finanzierung des Betriebs einer außerschulischen Bildungseinrichtung zu beteiligen, die unabhängig von etablierten Qualifizierungswegen arbeitet.” TUMO passt nicht in die MINT-Netzwerke und bietet keine IT-Qualifikation.
Für Nicolas Seiler und Michael Strauß, Projektleiter und Chief Digital Officer der KfW schmälert das die Erfolgsaussichten auf der Suche nach Nachahmern in Deutschland nicht. Für sie soll TUMO als “Center for Creative Technologies” attraktive berufliche Orientierungshilfen und Begeisterung für digitale Technologien schaffen. Vor allem ist den Organisatoren wichtig, dass TUMO als kostenloses Angebot alle interessierten Jugendlichen erreichen kann, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Bildungsgrad. Nach zwei Jahren Pandemie wollen sie jetzt aktiv in den “Rollout” gehen, mit Kommunen sprechen und Partner einbeziehen. Dass sich bisher weder die Kultusministerien noch Unternehmensverbände besonders interessiert und unterstützungsbereit gezeigt haben, schreiben sie eher der noch frühen Phase in der Kommunikationsstrategie zu.
Leicht wird die Suche nach Sponsoren und Betreibern wahrscheinlich nicht. Denn TUMO ist teuer: Ein Zentrum in der Größe von dem Musterprojekt in Berlin zu betreiben kostet pro Jahr circa 1,5 Millionen Euro. Darin eingeschlossen sind eine Franchise-Gebühr, die im unteren sechsstelligen Bereich liegt und Geräten, die geleast zwischen 60.000 und 80.000 Euro kosten. Die Gebäudekosten sind noch nicht eingerechnet und für die Ausstattung eines Zentrums muss man mit weiteren rund 250.000 Euro rechnen. Der größte Teil des Geldes fließt ins Personal: Zentrumsleiter, Marketing-Manager, Coaches aus dem universitären, technischen oder pädagogischen Bereich und vor allem jede Menge Werkstudent:innen, die den Jugendlichen während der Selbstlernphasen bei Fragen helfen.
Zudem ist die Größe einer Stadt relevant: Für ein TUMO-Hub muss sie mindestens 150.000 Einwohner haben, für eine Box, in der nur die Grundkurse angeboten werden können, reichen dagegen schon 5.000 bis 10.000. Die Initiatoren der KfW setzen auf regionale Verbundinteressen. Wenn in einer ländlichen Region mehrere TUMO-Boxen für die Grundkurse zur Verfügung stehen und in der nächsten größeren Stadt ein Hub, dann könnten ganze Landkreise von dem System profitieren. Lernenden können einen Grundkurs in Wohnortnähe besuchen und dann zum spezialisierten Workshop in den Hub fahren. Doch dafür wird es regionale Netze von wirtschaftlich potenten Betreibern und Unterstützern brauchen. Nicht zu vergessen die Fachleute, die die Jugendlichen sachkundig schulen – und bei deren Einsatz für die kostenlosen Angebote auf Ehrenamtlichkeit gesetzt wird.
Im Berliner Leuchtturm, wie die KfW-Verantwortlichen ihr Zentrum nennen, sei die Rechnung bisher aufgegangen. Die Angebote würden intensiv genutzt, sagen sie. Allerdings haben sich weder die lokalen Politiker noch die in der Hauptstadt zahlreich ansässigen Wirtschaftsverbände bisher mit dem TUMO-Projekt befasst. Und auch die Bildungsverantwortlichen konnten noch nicht für das Angebot begeistert werden.
Es war angekündigt als rasche und effektive Hilfe für Pandemie-geplagte Schulen in ganz Deutschland: das Startchancen-Programm des Bundesbildungsministeriums (BMBF). Rund 4000 Schulen in ganz Deutschland sollen zusätzliche Mittel erhalten, um dringend notwendige Investitionen durchführen zu können. Auf welcher rechtlichen Grundlage der Bund diese Hilfen gewähren will, wie rasch das Geld fließen soll und nach welchen Kriterien die Schulen ausgewählt werden, wollte daraufhin die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag wissen und fragte beim Ministerium im Rahmen einer Kleinen Anfrage nach. Nun liegt die Antwort vor und der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek (CDU), kommentiert sie mit der ernüchternden Feststellung, die Ampel-Koalition habe “offenbar ihre eigene Chance für einen guten Regierungsstart verpasst”.
In der Kleinen Anfrage hatten die Oppositions-Abgeordneten gefragt, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage der Bund den Schulen Mittel zufließen lassen will, wie das Auswahlverfahren gestaltet werden soll und ob das Geld ergänzend oder alternativ zu bereits in einzelnen Bundesländern existierenden Hilfsprogrammen fließen soll. Konkrete Antworten darauf erhielten die Fragesteller ausweislich der Antwort des Parlamentarischen Bildungs-Staatssekretärs Jens Brandenburg, die Bildung.Table vorliegt, indes in keinem einzigen Fall. Das Verfahren zur Auswahl der geförderten Schulen, die konkrete Ausgestaltung des Investitionsprogramms, einschließlich der Details zu den Fördergegenständen und dem Kreis der Förderempfänger sowie die nähere Ausgestaltung des geplanten Chancenbudgets würden “Gegenstand sowohl der weiteren Vorabstimmungen innerhalb der Bundesregierung und der anschließenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sein”, ließ Brandenburg die Fragesteller wissen. Und ergänzte, das Programm befinde sich “aktuell in der Konzeptionsphase”. “Zu gegebener Zeit” würden die rechtlichen Grundlagen “innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und festgelegt werden”. asi
Deutschlands Schulleitungen sind ein – zumindest in einigen Kernfragen über die Zukunft der Schule. Das ergab die erste Cornelsen Schulleitungsstudie vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialfragen aus Berlin (Fibs). Befragt wurden 1.100 Schulleiter:innen aus unterschiedlichen Schulformen. Zusätzlich wurden 50 Einzelinterviews durchgeführt. Die Studienergebnisse werden am heutigen Mittwoch um 10 Uhr im Livestream vorgestellt.
Befragt wurden die Schulleitungen im Herbst 2021. Ihr Rückblick fällt nicht gut aus: 72 Prozent der Schulleitungen blicken unzufrieden auf das vergangene Jahr. Nur 52 Prozent sehen der Zukunft ihrer Schule optimistisch entgegen – und es gibt viel zu tun. 82 Prozent der Schulleitungen finden, dass der “althergebrachte Fächerkanon” nicht mehr zeitgemäß ist und verändert werden muss. Dementsprechend fordern 77 Prozent mehr Befugnisse zur Ausgestaltung der schulischen Bildung und rund die Hälfte der Schulleitungen möchte freier über Personal, Organisations- und Unterrichtsentwicklung sowie Mittelvergabe entscheiden können.
Was soll Schule leisten, fragten die Studienmacher. Neben “Lebenskompetenzen vermitteln” (93 Prozent) stehen “Digitale Bildung und Mündigkeit” mit 92 Prozent bei den Schulleitungen weit oben. Fast alle (97 Prozent) finden es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien im Klassenzimmer lernen. Ebenfalls sehr wichtig ist Chancengleichheit. 97 Prozent der Schulleiter sehen als zentrale Aufgabe, diese zu ermöglichen. Um Bildungsungleichheiten beizukommen, sind für 92 Prozent individuelle Förderangebote das beste Mittel.
Das Thema “Digitalität und Schule” hat in der Studie ein eigenes Kapitel bekommen. Die digitale Ausstattung ihrer Schule gaben 67 Prozent als eines der aktuell wichtigsten Themen an – noch vor baulichen Maßnahmen. Wie guter digitalisierter Unterricht gelingt, sehen 58 als größte Aufgabe für die kommenden fünf Jahre und 73 Prozent sind der Meinung, dass sich Schule an der Digitalität ausrichten soll. Dass Apps individualisiertes Lernen unterstützen können, denken 87 Prozent der Schulleitungen. Damit die Digitalisierung von Schule funktioniert, müssen auch die Lehrkräfte weitergebildet werden, finden fast alle (97 Prozent) Schulleitungen. Regelmäßige Fortbildungsangebote für Lehrkräfte befürworten 72 Prozent der Schulleitungen. Für sich selbst wünschen 96 Prozent der Schulleitungen solche Angebote. Und sie fordern Entlastung. Die Schulleitung klagen, hauptsächlich administrativen Aufgaben nachgehen zu müssen und zu wenig Zeit für Entwicklungsarbeit zu haben. Enno Eidens
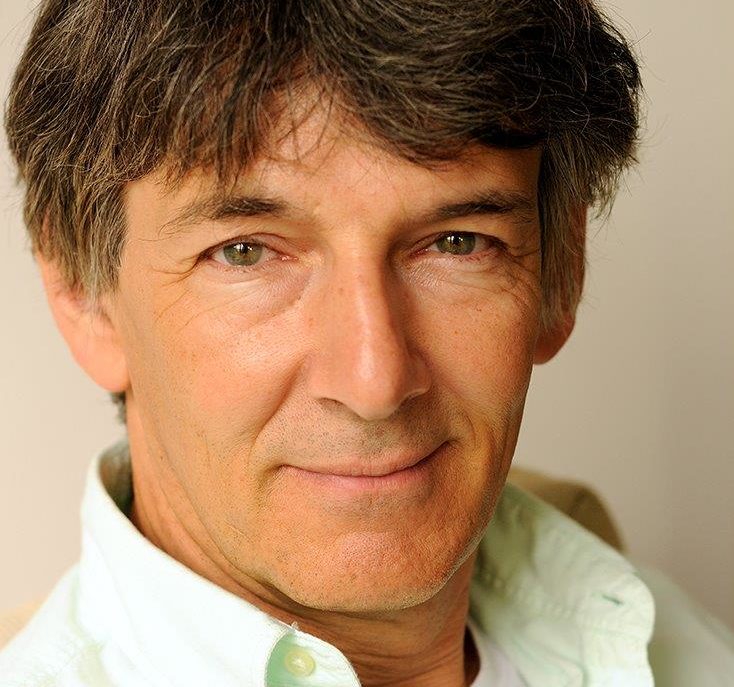
Eigentlich müsste Deutschland vorbereitet sein auf eine Großzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, nachdem über eine Million Menschen 2015 in Deutschland Schutz suchten. Doch die aktuelle Überforderung der Städte, vor allem Berlins, zeigt ein anderes Bild. Die Registrierung der Neuangekommenen läuft mehr als schleppend. Offenbar sind die Behörden überwältigt von der großen Zahl der fliehenden Menschen aus der Ukraine. Andere in Deutschland sind besser vorbereitet: die Zivilgesellschaft. Zahlreiche Willkommens- und Integrationsinitiativen bestehen seit 2015 fort. Sie sind untereinander gut vernetzt, das zeigt das Beispiel der Initiative “Schöneberg hilft”.
Hans-Jürgen Kuhn hat die Initiative mitbegründet. Kuhn ist Grünen-Mitglied und Bildungspolitiker, unter anderem war er Staatssekretär der Senatsverwaltung in Berlin und ehemaliger Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Noch heute ist der 68-jährige Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung von Bündnis 90/Die Grünen und eigentlich im Ruhestand, in dem er sich trotzdem ehrenamtlich für mehr Bildungsgerechtigkeit in Berlin engagiert.
2016, als sich die Initiative “Schöneberg hilft” bildete, bemühte er sich um die Unterbringung von Geflüchteten, kümmerte sich um BVG-Tickets und meldete die neu angekommenen Kinder in den Schulen an. Doch die Situation damals sei mit der heutigen nicht vergleichbar, sagt Hans-Jürgen Kuhn. 2015 und 2016 kamen vor allem jüngere Männer und nur wenige Frauen und Kinder. Heute, vor dem Krieg in der Ukraine, flüchten vor allem Frauen mit ihren Kindern. Und diese Kinder und Jugendlichen gilt es so schnell wie möglich zu beschulen.
Und noch etwas ist anders im Vergleich zu den Fluchtbewegungen von vor sieben Jahren: “Viele, gerade aus den Gebieten, die noch nicht zerstört sind, wollen so schnell wie möglich zurück“, sagt Hans-Jürgen Kuhn. Sie hoffen, dass der Krieg schnell vorbei sein wird. Die Russen haben nicht nur die staatliche Souveränität der Ukrainerinnen und Ukrainer angegriffen, sondern auch die ukrainische Identität. “Sie wollen sich diese Identität bewahren, auch an ihrem Zufluchtsort Berlin”, sagt Kuhn.
Deshalb gibt es zurzeit drei unterschiedliche Arten, wie ukrainische Kinder und Jugendliche am Unterricht teilnehmen: Einige ukrainische Schüler:innen besuchen die Willkommensklassen an Regelschulen, in denen Deutsch gelehrt wird, sodass sie so schnell wie möglich am regulären Unterricht teilnehmen können. Andere Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hingegen nehmen weiterhin am Unterricht ihrer Heimatschule teil -und zwar übers Internet.
Drittens gründen sich Gruppen in Berlin, mit ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern, die Unterricht vor Ort anbieten. Diese Gruppen möchte Hans-Jürgen Kuhn mit seiner Initiative “Schöneberg hilft” koordinieren. Also veröffentlichte er vor einer Woche eine Pressemitteilung mit dem Aufruf, dass sich ukrainische Lehrkräfte der Klassen 1 bis 11 bei ihm melden sollen, wenn sie in Berlin auf Ukrainisch unterrichten wollen. Er rief in seinem Netzwerk der anderen Flüchtlingsinitiativen an und teilte den Aufruf auf Social Media und innerhalb von drei Tagen erhielt er 180 Mails von interessierten Lehrkräften.
Der Bedarf und das Interesse sind da, doch es fehlen Räume für die kleinen Gruppen von zehn bis 15 Jugendlichen. Das können leerstehende Restaurants, kleine Räume in Bibliotheken und Büros sein, die zurzeit wegen Homeoffice nur selten genutzt werden. Aber vor allem hofft Hans-Jürgen Kuhn, dass über die Senatsverwaltung Gelder zur Verfügung gestellt werden, sodass die Lehrer für ihre Arbeit entlohnt werden können. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sucht gerade dringend Lehrkräfte für Willkommensklassen und. Vielleicht, sagt Kuhn, könnten bereits im April die ersten Lerngruppen starten. Damit wäre sein Programm deutlich schneller als Berlins offizieller Integrationsplan für Lehrkräfte aus der Ukraine.
30. März 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr
Livestream: Fragen zu Krieg und Frieden: Wie gehen wir in der Schule damit um?
Bei der Veranstaltung des Campus des Deutschen Schulpreises setzen sich die deutsch-ukrainische Politikerin Marina Weisband, Prof. Dr. Uli Jäger und Dr. Nicole Rieber von der Berghof Foundation aus dem Bereich “Global Learning for Conflict Transformation”, Maike Drewes, die Schulleiterin der Erich-Kästner-Schule Hamburg und die medienpädagogische Beraterin Dr. Julia Schmengler mit Fragen von Schüler:innen zu Krieg und Frieden auseinander. Infos
31. März 2022, 09:30 bis 11:00 Uhr
Online-Konferenz: Was brauchen Schulen in herausfordernden Lagen? Vorstellung und Diskussion von Studienergebnissen
In der Online-Konferenz widmet sich die Friedrich-Ebert-Stiftung dem Thema Bildungschancen und veröffentlicht Studienergebnisse einer Befragung von knapp 350 Lehrkräften und Schulleiter:innen an Schulen in benachteiligter sozialer Lage. Es diskutieren Studienautor Prof. Dr. Wolfgang Böttcher und die Berliner Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse. Infos & Anmeldung
01. & 02. April 2022
Konferenz mit Workshops: Nachrichtenkompetenz lehren – Medienkompetenz lernen
Wie können Schüler:innen den Informationskrieg rund um die Ukraine verstehen? Damit befasst sich die Konferenz in der Hauptstadt-Repräsentanz der Telekom in Berlin. Bernhard Pörksen spricht über “Anforderungen an die Medienmündigkeit im 21. Jahrhundert“, Cordt Schnibben lädt Schüler:innen und Lehrer:innen zu einer “Unterrichtseinheit News und Fake News” und Martin Spiewak interviewt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die Anmeldung ist kostenlos. Infos & Anmeldung
05. April 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr
Digitales Lernforum: Digital und in Präsenz: Lernen und Leistungsbeurteilung zukunftsorientiert denken – 1/3
Das Team des Deutschen Schulpreises bietet Impulse zu krisenfestem und zukunftsorientiertem Lernen mit einem Fokus auf dem Thema Leistungsbeurteilung. Zudem wird ein Einblick in die konkrete Arbeit verschiedener Schulen mit guten Ansätzen geboten. Die Referent:innen Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel,
Professorin für allgemeine Didaktik und Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Lehr-/Lernprozesse und Dr. Helmut Richter, Fortbildner an verschiedenen Schulformen, ehemaliger Schulleiter des WBK Duisburg bieten dabei sowohl Einblick in wissenschaftliche Anschauungen und schulpraktischen Input. Infos & Anmeldung
06. April 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr
Dialogforum: Digitale Kompetenzen entlang der Bildungskette sichern
Bei dieser Veranstaltung des Netzwerks Bildung Digital geht es um die Frage, wie Potenziale entlang der Bildungskette gebündelt und gemeinsam Veränderungen im Bildungssystem angestoßen werden können. Im öffentlichen Dialogforum findet außerdem eine Diskussion mit Expert:innen und Praktiker:innen aus verschiedenen Bildungsbereichen darüber statt, wie man sich in der digitalen Welt zurechtfinden kann. Infos
07.April 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr
Community-Call: Desinformation in der Digitalität – Wie können wir Nachrichtenkompetenzen von Schüler:innen stärken?
Mit der Frage, wie Schüler:innen für Fake News sensibilisiert werden können, beschäftigt sich der Community Call des Forum Bildung Digitalisierung. Außerdem geht es darum, wie Lehrkräfte ihre Schüler:innen im Umgang mit Desinformation begleiten und Nachrichtenkompetenz fördern können. Als Gäste geladen sind die Politologin Ferda Ataman, die Projektmanagerin von Weitblick Judith Kunz, die Schulleiterin Silke Müller und Leon Schwalbe, Fachkoordinator für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesschülerkonferenz. Infos & Anmeldung
07. April 2022, 15:00 bis 20:00 Uhr
Symposium: Schule erfolgreich digital transformieren
Dass eine erfolgreiche Digitale Transformation der Schulen zu mehr Lehr- und Lernerfolg führt, ist klar. Sie steigert das Bildungsniveau auf allen gesellschaftlichen Ebenen und stärkt so die Zukunftsfähigkeit des Landes. Bei diesem Symposium wird sich mit Fragen nach einer hochwertigen Lernsoftware, Praxiserfahrungen und einem Ökosystem, in dem die Schulfamilien künftig aus den besten digitalen Lernmitteln auswählen können, beschäftigt. In einem Zusammenspiel aus Diskussionen, Präsentationen und Ansprachen wird sich aus verschiedenen Perspektiven an das Thema angenähert. Infos & Anmeldung
wie leistungsfähig Strukturen sind, zeigt sich insbesondere in Krisenzeiten. Dass die Kultusministerkonferenz im Umgang mit der Pandemie keine Bestnoten erzielte, ist hinlänglich bekannt. Haben die Bildungs-Verantwortlichen daraus aber gelernt, jetzt, da hunderttausende ukrainische Schülerinnen und Schüler ihr Land verlassen müssen und in Deutschland Hilfe suchen? Robert Saar geht in seiner Analyse der Frage nach, ob die eigens zur Bewältigung dieser Krise von der KMK eingerichtete Taskforce in der Lage ist, die Einstellung ukrainischer Lehrkräfte bundesweit so effektiv zu organisieren, dass die Beschulung der Kinder ohne größeren Zeitverzug in Deutschland fortgesetzt werden kann. Sein Befund ist ernüchternd: Jedes Bundesland wählt seinen eigenen Weg. Sachsen unbürokratisch, Brandenburg bemüht, Berlin scheinbar ohne jede Sensibilität für die Lage – und die Taskforce: nicht zuständig.
Ausgerechnet Armenien als Vorbild für die Erschließung digitaler Interessen bei Schülern? Als Angela Merkel vor einigen Jahren das armenische Projekt TUMO besichtigte, in dem Jugendliche am Nachmittag den Umgang mit digitalen Tools unter kundiger Beratung erlernen, war sie begeistert. Die bundeseigene Förderbank KfW nahm die Idee auf und finanzierte (erstmals in ihrer Geschichte) mit eigenem Geld einen Referenzstandort in Berlin. Das hippe Projekt wurde allerorten gelobt, endlich mal coole Bildungsformen. Bildung.Table ist nun der Frage nachgegangen, wie die KfW die Idee verbreiten will, welche Investitionen interessierte Kommunen und Sponsoren erwarten müssen – und vor allem, ob der Bund willens ist, die Einrichtung solcher Lernzentren zu unterstützen.
Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem einen Blick in den Terminkalender, in dem Sie auch in dieser Ausgabe des Briefings wieder wichtige Hinweise für den Austausch mit Experten im Bildungsbereich erhalten.
Es grüßt Sie herzlich

Die von der Kultusministerkonferenz neu gegründete Taskforce Ukraine wird sich in die Anerkennungsprozeduren der einzelnen Bundesländer nicht einmischen. Das teilte die neue Feuerwehrstelle der Kultusminister bei einem Gespräch mit. Das bedeutet, die föderale Zersplitterung des deutschen Schulwesens bleibt trotz der nationalen Herausforderung des Ukraine-Kriegs bestehen. Eine kurze Umfrage in den Ländern von Bildung.Table zeigt: Der Umgang mit den geflüchteten Lehrern wird völlig unterschiedlich gehandhabt. Es gibt eine Gruppe von Ländern, die relativ schnell handelt – andere warten mit ihrer vollen Bürokratie auf.
Das Land Berlin etwa lud vergangene Woche zu einem digitalen Meeting für Lehrkräfte aus der Ukraine, um diese über Perspektiven und Berufschancen aufzuklären. In zwei Veranstaltungen – keine davon in russischer oder ukrainischer Sprache – wurden die Möglichkeiten der Mitarbeit vorgestellt. Für die Einstellung als reguläre Lehrkraft müssen Bewerbende Deutsch auf C1-Niveau sprechen und ihre Ausbildung für zwei Fächer des Berliner Lehrplans anerkannt sein. Das sind Voraussetzungen, die keine Lehrkraft aus der Ukraine sofort erfüllen kann.
Im Verfahren zur Anerkennung müssen Bewerbende viele Nachweise einreichen. In der Bundeshauptstadt etwa müssen die Ukrainer auch weiterhin ein zwölfstufiges Verfahren durchlaufen. Berlin akzeptiert aus Kulanz zwar auch einfache Kopien und bittet “nach Möglichkeit” um Übersetzungen vereidigter Dolmetscher. Wer die bis zu 222 Euro Bearbeitungsgebühr dafür nicht hat, kann beim Senat eine Kostenbefreiung beantragen. Wie lange es jedoch dauert, das gesamte Verfahren zu durchlaufen, an dessen Ende erst die eigentliche Bewerbung auf eine Stelle steht, ist nicht klar. In beiden Info-Veranstaltungen waren zusammen mit etwa 70 Personen verhältnismäßig wenig potenzielle Lehrkräfte. Für Anfang April kündigte der Senat eine weitere Veranstaltung an – dieses Mal auf Russisch. Zivilgesellschaftliche Initiativen für ukrainische Lerngruppen wollen schneller sein und im April schon unterrichten. Das sagt zumindest Initiator Hans-Jürgen Kuhn von “Schöneberg hilft”.
Ganz anders in Sachsen. Der Freistaat kündigte an, 100 Lehrerstellen und weitere 100 Assistenzstellen zu schaffen. Die Einstellungen haben bereits begonnen. Rekrutieren für die befristeten Stellen will das Land sowohl Geflüchtete als auch Ukrainer, die schon länger in Deutschland leben. Das benachbarte Brandenburg will eine schnelle Einstellung über Mittel aus Vertretungsbudgets erreichen, wobei deutschsprachige Ukrainer als Lehrkräfte eingesetzt werden sollen. Auch in Brandenburg sind die Stellen zunächst befristet.
Ähnlich plant auch Hamburg geflüchteten Lehrkräften berufliche Perspektive zu geben: Lehrkräfte sollen eingestellt werden, um etwa in Erstaufnahmeeinrichtungen zu unterrichten und pädagogisches Personal kann deutsche Lehrkräfte zu unterstützen. Auf eine Stelle als reguläre Lehrkraft kann sich aber auch hier nur bewerben, wer gut Deutsch spricht. Alle Stellen sind zunächst befristet.
In mindestens zwei Ländern scheint die Task-Force der KMK die Eigeninitiative sogar zu bremsen. In Rheinland-Pfalz sollen ukrainische Lehrkräfte “bei der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine mitwirken”. Ebenfalls denkbar sei ein Einsatz als Sprachmittler, sofern Deutsch- oder Englischkenntnisse vorliegen. Auf Anfrage von Bildung.Table nach den genauen Modalitäten des Einstellungsverfahrens und dessen Dauer teilte das Bildungsministerium in Mainz aber mit, dass man auf die Taskforce warte, die ebenfalls mit diesen Fragen befasst sei. Die Taskforce beharrt freilich darauf, dass sie nur generelle Fragen kläre, aber nicht in einzelne Länder hineinregiere.
Ähnlich ist das verzögernde Zusammenspiel zwischen der Taskforce und dem Land Hessen. Das Land informiert auf seiner Website zwar über Beschulung geflohener Kinder, Informationen für interessierte Lehrkräfte finden sich dort aber nicht. Wie überall in Deutschland kann auch in Hessen ein Antrag auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse gestellt werden. Allerdings ist auch hier fraglich, wie viele Geflüchtete alle dafür nötigen Nachweise und Beglaubigungen bereit haben. Das Hessische Kultusministerium bat auf Nachfrage von Bildung.Table um Geduld, da sich alle Fragen noch in “fachlicher Diskussion” befänden. Es wurde auf die Taskforce verwiesen – die bei Anfragen wiederum an die Länder zurückverweist.
Das bedeutet, einzelne Bundesländer zeigen politische Handlungsfähigkeit beim Einstellen geflüchteter Lehrkräfte. Die von der KMK einberufene Taskforce trifft selbst keine operativen Entscheidungen. Sie soll koordinieren und für Rechtssicherheit in den Entscheidungen der Länder sorgen – also genau das, was eigentlich Aufgabe der Konferenz der Kultusminister ist. Den Bildungsföderalismus hat auch Putin nicht abschaffen können.
Allerdings gibt es ein Schlupfloch für ukrainische Geflüchtete, die im Anerkennungsverfahren als reguläre Lehrkraft scheitern: Die Lehrer können sich als sogenannte Seiteneinsteiger bewerben – dort sind die Einstellungschancen besser und die formalen Voraussetzungen niedriger. Auf Nachfrage erklärte sowohl Berlin als auch Sachsen-Anhalt, dass den ukrainischen Lehrkräften dieser Weg offen stehe. Der zuständige Referent in Berlin erklärte, einzige Voraussetzung – neben einer pädagogischen Grundqualifikation – sei, dass es sich dabei um unbefristete Stellen handle. Auf Deutsch: die Geflüchteten müssten dann bleiben.
In Sachsen-Anhalt ist das anders. Dort seien zwar noch keine ukrainischen Lehrkräfte als Seiteneinsteiger eingestellt worden, es gebe hier aber großen Bedarf, sagte das Vorstandsmitglied der GEW in Sachsen-Anhalt, Torsten Richter. “Wir brauchen hier pragmatische Lösungen und können nicht warten, bis die KMK aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und ihre Anerkennungsverfahren überarbeitet hat”, sagte Richter. Voraussetzung zur Einstellung seien Deutschkenntnisse und mindestens ein Bachelorabschluss. So könnte man vorerst unbesetzte Stellen für Vertretungslehrkräfte nutzen, um schnell ukrainische Lehrkräfte vorerst befristet einzustellen. Richter beruhigte auch, dass jemand dann zwangsweise in Deutschland bleiben müsse. “In keinem Fall ist die Anerkennung an einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland geknüpft”, sagt er. Robert Saar

Frau Schröter, was müssen Schüler eigentlich können, um den Informations-Krieg zu verstehen, der neben dem Bombenkrieg stattfindet?
Bevor Schüler:innen Fake News erkennen können, sollten sie zunächst lernen, was seriöse News sind. Und wie bedeutsam sie für eine Demokratie sind. Das heißt zum Beispiel nicht nur, regelmäßig Presse-Artikel zu lesen, sondern diese auch mal selbst zu verfassen. In meinem Unterricht machen wir das kontinuierlich.
Im Fach Deutsch.
Ja, aber nicht nur. In Deutsch ist es Teil des Lehrplans bei den Darstellungsformen wie Bericht, Reportage und Nachricht. Aber Medienkompetenz passt genauso gut in Gesellschaftswissenschaften, in Mathematik oder etwa in Englisch. Da hat uns US-Präsident Trump immer eine Menge Material geliefert. Die Schüler lernen, anhand von Erkennungsmerkmalen Schritt für Schritt Fake-News zu identifizieren und zu enttarnen.
Woran erkennt ein Schüler, ob eine Nachricht gefälscht oder erfunden ist?
Ganz einfach anhand einer Checkliste, die wir gemeinsam erstellen. Dazu gehört unter anderem, sehr genau auf die Quellen zu achten, den Autor zu überprüfen. Sehr wichtig ist es, die Herkunft eines Bildes rückwärts untersuchen zu können. Das finden meine Schüler:innen spannend. Und sie sollen natürlich kritisch auf den Inhalt selbst schauen. Die Schüler lernen auch, in sozialen Medien nur gesicherte Informationen zu teilen. Das Thema, das uns im Moment so bewegt, der Info-Krieg, steht nicht explizit im Lehrplan. Deswegen muss dieser Begriff auf jeden Fall thematisiert werden.
Ganz konkret: wie können Schüler den vermeintlichen Mord an einem 16-jährigen Russlanddeutschen überprüfen, den angeblich Ukrainer in Euskirchen verübten?
Diesen Fall von Fake News haben meine Schüler:innen von sich aus angesprochen. Und sie haben es anhand ihrer Checkliste selbst als Falschinformation aufgeklärt. Dazu fand sich ein Faktencheck im Öffentlichen Rundfunk, der ihr Arbeitsergebnis bestätigte.
Reicht es denn heute noch, in der Schule Zeitung zu lesen? Die Generation Smartphone informiert sich doch ganz anders.
Soziale Medien im Unterricht zu thematisieren, ist essenziell. Das sollte das kleine 1×1 der politischen Bildung sein. Die Reaktion der Schüler ist übrigens interessant. Einige haben mir zurückgemeldet, dass sie soziale Medien lieber privat nutzen. Sie finden es interessant, regelmäßig Pressetexte im Unterricht zu lesen, weil sie das zu Hause nicht machen würden. Die Schüler:innen lernen an den verschiedenen Textsorten neben dem aktuellen Geschehen übrigens auch sprachliche Besonderheiten und erweitern ihren Wortschatz. Denn gute Pressetexte sind eine Fundgrube für den Unterricht.
Ist es überhaupt möglich, Schülerinnen und Schüler zu souveränen Akteuren im Netz zu machen? Nicht mal Erwachsene oder Regierungen können ja für sich digitale Souveränität beanspruchen.
Wir müssen das auf jeden Fall versuchen! Denn das ist unser Bildungsauftrag. Ich kann nur von meinen Schülern sprechen: wenn sie wissen, wie seriöse Informationen entstehen, gehen sie souveräner mit der Informationsflut um. Sie wissen, was man darf und was nicht. Und sie sind dann sogar in der Lage, sich über Fake News auch mal zu amüsieren – weil sie so dilettantisch gemacht sind.
Sollte man das Thema fest im Lehrplan verankern?
Ja, teilweise ist das bereits der Fall. Die Schülerinnen und Schüler sollten durch ein Spiral-Curriculum von Beginn an immer wieder mit dem Thema in Berührung kommen. Ich würde mir eine digitale Grundbildung wünschen. Sobald Kinder und Jugendliche Nachrichten aufnehmen können, müssen sie in die Lage versetzt werden, diese auch zu verarbeiten. Das Bedienen von Smartphones und Apps reicht nicht. Es ist in meinen Augen extrem wichtig, dass die Schüler Fakten gegenüber kritisch sind. Um mit der momentanen Flut von schrecklichen Nachrichten umgehen zu können, müssen Schüler auch bewusst Infopausen einlegen – in denen sie auch mal auf Nachrichten verzichten. Auch das sollten sie lernen.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen schlägt ein eigenes Schulfach vor, um so etwas wie eine “redaktionelle Gesellschaft” erreichen zu können.
Das wäre ideal! Dadurch könnte man das regelmäßige Konsumieren und Produzieren von Information gewissermaßen ritualisieren – und das Verstehen ihrer gesellschaftlichen Folgen. Das Thema Nachrichten- und Informationskompetenz würde so einen zentralen Stellenwert bekommen, von dem alle Lernenden profitieren könnten.
Wie geht man eigentlich damit um, wenn man russische Kinder im Unterricht hat? Wie gut sind sie informiert?
Mein Eindruck ist: Je jünger die Schüler sind, umso mehr werden sie im Denken von ihrem Elternhaus beeinflusst. Wir bemerken gerade bei einigen russischen Kindern und Jugendlichen, dass sie von ihren Eltern verfälschte Informationen zu hören bekommen. Wenn sie dann in der Schule mit der Wahrheit konfrontiert werden, entstehen bei ihnen innere Widersprüche und Konflikte. Das geht übrigens schon sehr früh los.
Was meinen Sie damit?
Ich habe in meinem Unterricht angehende Erzieherinnen, die das Phänomen schon im frühen Kindesalter erleben. Russische Kinder kommen mit falschen Nachrichten in die Kita oder Grundschule. Das bedeutet, wir müssen schon den Kleinsten den Unterschied zwischen, Wahrheit und Lüge beibringen. Je früher, desto besser.
Kerstin Schröter ist Lehrerin für Sprache/Kommunikation und Medienbildung an einer Fachschule. Jede Klasse wird bei der erfahrenen Journalistin zeitweise zur Redaktion. Es entstehen als Lernprodukte Interviews, Reportagen sowie Lern-Audios und -Videos im Unterricht. Sie bildet Lehrkräfte bundesweit fort, etwa im digital.learning.lab und bei digitale-lernideen.com.
Schröter gehört zum Verein “Journalismus macht Schule”, der am Freitag und Samstag zu einem bundesweiten Lehrer-Schüler-Kongressworkshop einlädt, u. a. mit Georg Mascolo, Bettina Stark-Watzinger, Bernhard Pörksen und Cordt Schnibben.
Im Berliner Bezirk Charlottenburg, fußläufig zur U-Bahn-Station Wilmersdorfer Straße, steht seit Herbst 2020 ein digitales Lernzentrum für Jugendliche, ein sogenanntes TUMO-Zentrum. Mehrstöckig, hell beleuchtet, mit bodentiefen Fenstern, die den Blick auf die technische Infrastruktur freigeben. Auf 2.000 Quadratmeter befinden sich futuristisch anmutende Schreibtische, ein Tonstudio, Sitzsäcke, 100 iMacs, 50 MacBooks – genug Kapazitäten für 150 Interessierte auf einmal. “Roboter programmieren? Du kannst das auch!” steht auf einem der Werbeplakate von TUMO. Die Message: Alles ist lernbar. Die Mission: Die Möglichkeiten dafür zur Verfügung zu stellen. Jugendliche können außerhalb der Schulzeit hierherkommen und ihre Kompetenzen stärken, ja sogar Zertifikate erwerben. Sie wählen aus zehn Themenkomplexen, von Grafik-Design über Spiele-Entwicklung bis zu Robotics, in je zweimal zwei Stunden pro Woche werden entweder in Expert:innen-Coachings oder im eigenen Tempo mit der Lernsoftware TUMO World die eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt.
Die Idee für das Projekt stammt aus Armenien, wo 2011 das erste Lernzentrum, initiiert von der amerikanisch-armenischen Simonian Educational Foundation, gegründet wurde. Mittlerweile gibt es vier Standorte im ganzen Land, sogenannte Hubs, an denen insgesamt 20.000 Jugendliche lernen. Diese werden außerdem von TUMO-Boxen, flexibel verlegbaren Mini-Lernzentren in Containern ergänzt. Weitere Standorte bestehen neben Berlin bereits in Moskau, Paris, Tirana und Beirut, zudem sind welche in Kalifornien, Kyiv, Tokyo und Nur-Sultan geplant. Das System ist immer gleich: TUMO Armenien agiert als Franchise-Geber, setzt Standards für die interessierten Betreiber, stellt die erforderliche Software zur Verfügung und schult Personal und Advisor für die Lernenden.
In Deutschland wurde die Idee für ein TUMO-Zentrum von der Förderbank des Bundes, der KfW, angestoßen. Es ist das erste so konkrete Projekt der KfW im Bildungsbereich. Diese finanziert das Projekt als Ideengeber für fünf Jahre aus KfW-Eigenmitteln, will es dann an einen nächsten Betreiber weitergeben. Für weitere Standorte in Deutschland möchte die KfW Betreiber und Sponsoren zu suchen – ohne zusätzliche Beteiligung der Förderbank. Infrage kommen Kommunen oder Landkreise, die ein solches Angebot in ihrer Region installieren wollen, oder auch Stiftungen oder Unternehmen. Public-Private-Partnership ist das Betreibersystem, das die bestehenden TUMO-Zentren in Europa auszeichnet und das die KfW auch hierzulande initiieren will. Insgesamt rund 20 solcher Zentren schweben der KfW vor.
Ob das aber funktioniert, ist mehr als zweifelhaft. Grund Nummer eins: Der Bund fördert zwar MINT-Kompetenzen deutscher Schülerinnen und Schüler. Aber er tut das mit seinem MINT-Aktionsplan. Und da passt TUMO nicht hinein. Ziel des MINT-Aktionsplans des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist es, sogenannte MINT-Cluster zu fördern, also Verbünde aus unterschiedlichen Akteuren wie MINT-Bildungsvereinen, Schülerlaboren & Schülerforschungszentren, Unis & Hochschulen, Museen, Landratsämtern oder Schulträgern zu vernetzen. Diese sollen MINT-Angebote systematisch ausbauen und verstetigen.
“Als Oberste Bundesbehörde fördern wir hierüber vor allen Dingen den Ausbau bundesweiter Strukturen und Netzwerke – nicht jedoch einzelne MINT-Anbieter oder Bildungsinstitutionen, wie etwa das TUMO-Zentrum”, sagt eine Sprecherin des BMBF und betont: Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern. “Es gibt aus Sicht des BMBF keinen Anlass – und auch keine Möglichkeit – sich an der Finanzierung des Betriebs einer außerschulischen Bildungseinrichtung zu beteiligen, die unabhängig von etablierten Qualifizierungswegen arbeitet.” TUMO passt nicht in die MINT-Netzwerke und bietet keine IT-Qualifikation.
Für Nicolas Seiler und Michael Strauß, Projektleiter und Chief Digital Officer der KfW schmälert das die Erfolgsaussichten auf der Suche nach Nachahmern in Deutschland nicht. Für sie soll TUMO als “Center for Creative Technologies” attraktive berufliche Orientierungshilfen und Begeisterung für digitale Technologien schaffen. Vor allem ist den Organisatoren wichtig, dass TUMO als kostenloses Angebot alle interessierten Jugendlichen erreichen kann, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Bildungsgrad. Nach zwei Jahren Pandemie wollen sie jetzt aktiv in den “Rollout” gehen, mit Kommunen sprechen und Partner einbeziehen. Dass sich bisher weder die Kultusministerien noch Unternehmensverbände besonders interessiert und unterstützungsbereit gezeigt haben, schreiben sie eher der noch frühen Phase in der Kommunikationsstrategie zu.
Leicht wird die Suche nach Sponsoren und Betreibern wahrscheinlich nicht. Denn TUMO ist teuer: Ein Zentrum in der Größe von dem Musterprojekt in Berlin zu betreiben kostet pro Jahr circa 1,5 Millionen Euro. Darin eingeschlossen sind eine Franchise-Gebühr, die im unteren sechsstelligen Bereich liegt und Geräten, die geleast zwischen 60.000 und 80.000 Euro kosten. Die Gebäudekosten sind noch nicht eingerechnet und für die Ausstattung eines Zentrums muss man mit weiteren rund 250.000 Euro rechnen. Der größte Teil des Geldes fließt ins Personal: Zentrumsleiter, Marketing-Manager, Coaches aus dem universitären, technischen oder pädagogischen Bereich und vor allem jede Menge Werkstudent:innen, die den Jugendlichen während der Selbstlernphasen bei Fragen helfen.
Zudem ist die Größe einer Stadt relevant: Für ein TUMO-Hub muss sie mindestens 150.000 Einwohner haben, für eine Box, in der nur die Grundkurse angeboten werden können, reichen dagegen schon 5.000 bis 10.000. Die Initiatoren der KfW setzen auf regionale Verbundinteressen. Wenn in einer ländlichen Region mehrere TUMO-Boxen für die Grundkurse zur Verfügung stehen und in der nächsten größeren Stadt ein Hub, dann könnten ganze Landkreise von dem System profitieren. Lernenden können einen Grundkurs in Wohnortnähe besuchen und dann zum spezialisierten Workshop in den Hub fahren. Doch dafür wird es regionale Netze von wirtschaftlich potenten Betreibern und Unterstützern brauchen. Nicht zu vergessen die Fachleute, die die Jugendlichen sachkundig schulen – und bei deren Einsatz für die kostenlosen Angebote auf Ehrenamtlichkeit gesetzt wird.
Im Berliner Leuchtturm, wie die KfW-Verantwortlichen ihr Zentrum nennen, sei die Rechnung bisher aufgegangen. Die Angebote würden intensiv genutzt, sagen sie. Allerdings haben sich weder die lokalen Politiker noch die in der Hauptstadt zahlreich ansässigen Wirtschaftsverbände bisher mit dem TUMO-Projekt befasst. Und auch die Bildungsverantwortlichen konnten noch nicht für das Angebot begeistert werden.
Es war angekündigt als rasche und effektive Hilfe für Pandemie-geplagte Schulen in ganz Deutschland: das Startchancen-Programm des Bundesbildungsministeriums (BMBF). Rund 4000 Schulen in ganz Deutschland sollen zusätzliche Mittel erhalten, um dringend notwendige Investitionen durchführen zu können. Auf welcher rechtlichen Grundlage der Bund diese Hilfen gewähren will, wie rasch das Geld fließen soll und nach welchen Kriterien die Schulen ausgewählt werden, wollte daraufhin die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag wissen und fragte beim Ministerium im Rahmen einer Kleinen Anfrage nach. Nun liegt die Antwort vor und der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek (CDU), kommentiert sie mit der ernüchternden Feststellung, die Ampel-Koalition habe “offenbar ihre eigene Chance für einen guten Regierungsstart verpasst”.
In der Kleinen Anfrage hatten die Oppositions-Abgeordneten gefragt, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage der Bund den Schulen Mittel zufließen lassen will, wie das Auswahlverfahren gestaltet werden soll und ob das Geld ergänzend oder alternativ zu bereits in einzelnen Bundesländern existierenden Hilfsprogrammen fließen soll. Konkrete Antworten darauf erhielten die Fragesteller ausweislich der Antwort des Parlamentarischen Bildungs-Staatssekretärs Jens Brandenburg, die Bildung.Table vorliegt, indes in keinem einzigen Fall. Das Verfahren zur Auswahl der geförderten Schulen, die konkrete Ausgestaltung des Investitionsprogramms, einschließlich der Details zu den Fördergegenständen und dem Kreis der Förderempfänger sowie die nähere Ausgestaltung des geplanten Chancenbudgets würden “Gegenstand sowohl der weiteren Vorabstimmungen innerhalb der Bundesregierung und der anschließenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sein”, ließ Brandenburg die Fragesteller wissen. Und ergänzte, das Programm befinde sich “aktuell in der Konzeptionsphase”. “Zu gegebener Zeit” würden die rechtlichen Grundlagen “innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und festgelegt werden”. asi
Deutschlands Schulleitungen sind ein – zumindest in einigen Kernfragen über die Zukunft der Schule. Das ergab die erste Cornelsen Schulleitungsstudie vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialfragen aus Berlin (Fibs). Befragt wurden 1.100 Schulleiter:innen aus unterschiedlichen Schulformen. Zusätzlich wurden 50 Einzelinterviews durchgeführt. Die Studienergebnisse werden am heutigen Mittwoch um 10 Uhr im Livestream vorgestellt.
Befragt wurden die Schulleitungen im Herbst 2021. Ihr Rückblick fällt nicht gut aus: 72 Prozent der Schulleitungen blicken unzufrieden auf das vergangene Jahr. Nur 52 Prozent sehen der Zukunft ihrer Schule optimistisch entgegen – und es gibt viel zu tun. 82 Prozent der Schulleitungen finden, dass der “althergebrachte Fächerkanon” nicht mehr zeitgemäß ist und verändert werden muss. Dementsprechend fordern 77 Prozent mehr Befugnisse zur Ausgestaltung der schulischen Bildung und rund die Hälfte der Schulleitungen möchte freier über Personal, Organisations- und Unterrichtsentwicklung sowie Mittelvergabe entscheiden können.
Was soll Schule leisten, fragten die Studienmacher. Neben “Lebenskompetenzen vermitteln” (93 Prozent) stehen “Digitale Bildung und Mündigkeit” mit 92 Prozent bei den Schulleitungen weit oben. Fast alle (97 Prozent) finden es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien im Klassenzimmer lernen. Ebenfalls sehr wichtig ist Chancengleichheit. 97 Prozent der Schulleiter sehen als zentrale Aufgabe, diese zu ermöglichen. Um Bildungsungleichheiten beizukommen, sind für 92 Prozent individuelle Förderangebote das beste Mittel.
Das Thema “Digitalität und Schule” hat in der Studie ein eigenes Kapitel bekommen. Die digitale Ausstattung ihrer Schule gaben 67 Prozent als eines der aktuell wichtigsten Themen an – noch vor baulichen Maßnahmen. Wie guter digitalisierter Unterricht gelingt, sehen 58 als größte Aufgabe für die kommenden fünf Jahre und 73 Prozent sind der Meinung, dass sich Schule an der Digitalität ausrichten soll. Dass Apps individualisiertes Lernen unterstützen können, denken 87 Prozent der Schulleitungen. Damit die Digitalisierung von Schule funktioniert, müssen auch die Lehrkräfte weitergebildet werden, finden fast alle (97 Prozent) Schulleitungen. Regelmäßige Fortbildungsangebote für Lehrkräfte befürworten 72 Prozent der Schulleitungen. Für sich selbst wünschen 96 Prozent der Schulleitungen solche Angebote. Und sie fordern Entlastung. Die Schulleitung klagen, hauptsächlich administrativen Aufgaben nachgehen zu müssen und zu wenig Zeit für Entwicklungsarbeit zu haben. Enno Eidens
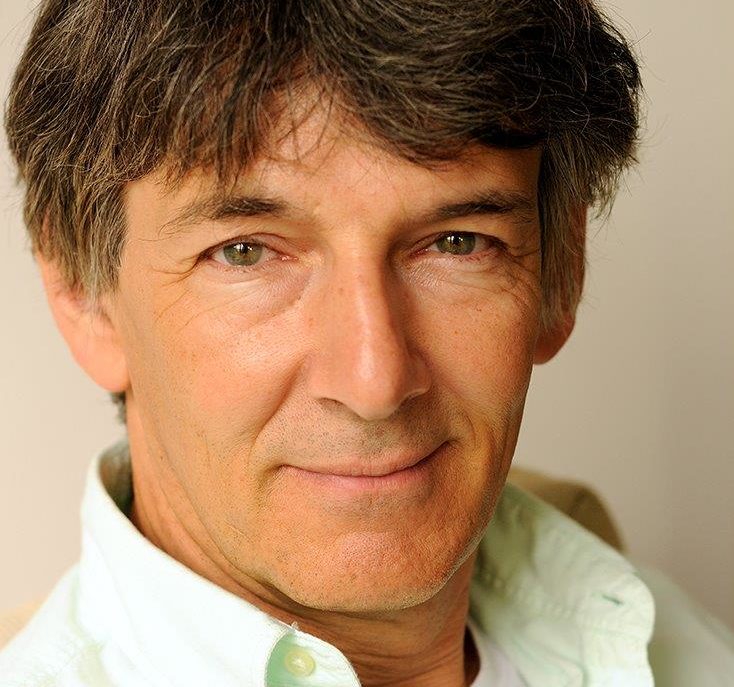
Eigentlich müsste Deutschland vorbereitet sein auf eine Großzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, nachdem über eine Million Menschen 2015 in Deutschland Schutz suchten. Doch die aktuelle Überforderung der Städte, vor allem Berlins, zeigt ein anderes Bild. Die Registrierung der Neuangekommenen läuft mehr als schleppend. Offenbar sind die Behörden überwältigt von der großen Zahl der fliehenden Menschen aus der Ukraine. Andere in Deutschland sind besser vorbereitet: die Zivilgesellschaft. Zahlreiche Willkommens- und Integrationsinitiativen bestehen seit 2015 fort. Sie sind untereinander gut vernetzt, das zeigt das Beispiel der Initiative “Schöneberg hilft”.
Hans-Jürgen Kuhn hat die Initiative mitbegründet. Kuhn ist Grünen-Mitglied und Bildungspolitiker, unter anderem war er Staatssekretär der Senatsverwaltung in Berlin und ehemaliger Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Noch heute ist der 68-jährige Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung von Bündnis 90/Die Grünen und eigentlich im Ruhestand, in dem er sich trotzdem ehrenamtlich für mehr Bildungsgerechtigkeit in Berlin engagiert.
2016, als sich die Initiative “Schöneberg hilft” bildete, bemühte er sich um die Unterbringung von Geflüchteten, kümmerte sich um BVG-Tickets und meldete die neu angekommenen Kinder in den Schulen an. Doch die Situation damals sei mit der heutigen nicht vergleichbar, sagt Hans-Jürgen Kuhn. 2015 und 2016 kamen vor allem jüngere Männer und nur wenige Frauen und Kinder. Heute, vor dem Krieg in der Ukraine, flüchten vor allem Frauen mit ihren Kindern. Und diese Kinder und Jugendlichen gilt es so schnell wie möglich zu beschulen.
Und noch etwas ist anders im Vergleich zu den Fluchtbewegungen von vor sieben Jahren: “Viele, gerade aus den Gebieten, die noch nicht zerstört sind, wollen so schnell wie möglich zurück“, sagt Hans-Jürgen Kuhn. Sie hoffen, dass der Krieg schnell vorbei sein wird. Die Russen haben nicht nur die staatliche Souveränität der Ukrainerinnen und Ukrainer angegriffen, sondern auch die ukrainische Identität. “Sie wollen sich diese Identität bewahren, auch an ihrem Zufluchtsort Berlin”, sagt Kuhn.
Deshalb gibt es zurzeit drei unterschiedliche Arten, wie ukrainische Kinder und Jugendliche am Unterricht teilnehmen: Einige ukrainische Schüler:innen besuchen die Willkommensklassen an Regelschulen, in denen Deutsch gelehrt wird, sodass sie so schnell wie möglich am regulären Unterricht teilnehmen können. Andere Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hingegen nehmen weiterhin am Unterricht ihrer Heimatschule teil -und zwar übers Internet.
Drittens gründen sich Gruppen in Berlin, mit ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern, die Unterricht vor Ort anbieten. Diese Gruppen möchte Hans-Jürgen Kuhn mit seiner Initiative “Schöneberg hilft” koordinieren. Also veröffentlichte er vor einer Woche eine Pressemitteilung mit dem Aufruf, dass sich ukrainische Lehrkräfte der Klassen 1 bis 11 bei ihm melden sollen, wenn sie in Berlin auf Ukrainisch unterrichten wollen. Er rief in seinem Netzwerk der anderen Flüchtlingsinitiativen an und teilte den Aufruf auf Social Media und innerhalb von drei Tagen erhielt er 180 Mails von interessierten Lehrkräften.
Der Bedarf und das Interesse sind da, doch es fehlen Räume für die kleinen Gruppen von zehn bis 15 Jugendlichen. Das können leerstehende Restaurants, kleine Räume in Bibliotheken und Büros sein, die zurzeit wegen Homeoffice nur selten genutzt werden. Aber vor allem hofft Hans-Jürgen Kuhn, dass über die Senatsverwaltung Gelder zur Verfügung gestellt werden, sodass die Lehrer für ihre Arbeit entlohnt werden können. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sucht gerade dringend Lehrkräfte für Willkommensklassen und. Vielleicht, sagt Kuhn, könnten bereits im April die ersten Lerngruppen starten. Damit wäre sein Programm deutlich schneller als Berlins offizieller Integrationsplan für Lehrkräfte aus der Ukraine.
30. März 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr
Livestream: Fragen zu Krieg und Frieden: Wie gehen wir in der Schule damit um?
Bei der Veranstaltung des Campus des Deutschen Schulpreises setzen sich die deutsch-ukrainische Politikerin Marina Weisband, Prof. Dr. Uli Jäger und Dr. Nicole Rieber von der Berghof Foundation aus dem Bereich “Global Learning for Conflict Transformation”, Maike Drewes, die Schulleiterin der Erich-Kästner-Schule Hamburg und die medienpädagogische Beraterin Dr. Julia Schmengler mit Fragen von Schüler:innen zu Krieg und Frieden auseinander. Infos
31. März 2022, 09:30 bis 11:00 Uhr
Online-Konferenz: Was brauchen Schulen in herausfordernden Lagen? Vorstellung und Diskussion von Studienergebnissen
In der Online-Konferenz widmet sich die Friedrich-Ebert-Stiftung dem Thema Bildungschancen und veröffentlicht Studienergebnisse einer Befragung von knapp 350 Lehrkräften und Schulleiter:innen an Schulen in benachteiligter sozialer Lage. Es diskutieren Studienautor Prof. Dr. Wolfgang Böttcher und die Berliner Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse. Infos & Anmeldung
01. & 02. April 2022
Konferenz mit Workshops: Nachrichtenkompetenz lehren – Medienkompetenz lernen
Wie können Schüler:innen den Informationskrieg rund um die Ukraine verstehen? Damit befasst sich die Konferenz in der Hauptstadt-Repräsentanz der Telekom in Berlin. Bernhard Pörksen spricht über “Anforderungen an die Medienmündigkeit im 21. Jahrhundert“, Cordt Schnibben lädt Schüler:innen und Lehrer:innen zu einer “Unterrichtseinheit News und Fake News” und Martin Spiewak interviewt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die Anmeldung ist kostenlos. Infos & Anmeldung
05. April 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr
Digitales Lernforum: Digital und in Präsenz: Lernen und Leistungsbeurteilung zukunftsorientiert denken – 1/3
Das Team des Deutschen Schulpreises bietet Impulse zu krisenfestem und zukunftsorientiertem Lernen mit einem Fokus auf dem Thema Leistungsbeurteilung. Zudem wird ein Einblick in die konkrete Arbeit verschiedener Schulen mit guten Ansätzen geboten. Die Referent:innen Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel,
Professorin für allgemeine Didaktik und Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Lehr-/Lernprozesse und Dr. Helmut Richter, Fortbildner an verschiedenen Schulformen, ehemaliger Schulleiter des WBK Duisburg bieten dabei sowohl Einblick in wissenschaftliche Anschauungen und schulpraktischen Input. Infos & Anmeldung
06. April 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr
Dialogforum: Digitale Kompetenzen entlang der Bildungskette sichern
Bei dieser Veranstaltung des Netzwerks Bildung Digital geht es um die Frage, wie Potenziale entlang der Bildungskette gebündelt und gemeinsam Veränderungen im Bildungssystem angestoßen werden können. Im öffentlichen Dialogforum findet außerdem eine Diskussion mit Expert:innen und Praktiker:innen aus verschiedenen Bildungsbereichen darüber statt, wie man sich in der digitalen Welt zurechtfinden kann. Infos
07.April 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr
Community-Call: Desinformation in der Digitalität – Wie können wir Nachrichtenkompetenzen von Schüler:innen stärken?
Mit der Frage, wie Schüler:innen für Fake News sensibilisiert werden können, beschäftigt sich der Community Call des Forum Bildung Digitalisierung. Außerdem geht es darum, wie Lehrkräfte ihre Schüler:innen im Umgang mit Desinformation begleiten und Nachrichtenkompetenz fördern können. Als Gäste geladen sind die Politologin Ferda Ataman, die Projektmanagerin von Weitblick Judith Kunz, die Schulleiterin Silke Müller und Leon Schwalbe, Fachkoordinator für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesschülerkonferenz. Infos & Anmeldung
07. April 2022, 15:00 bis 20:00 Uhr
Symposium: Schule erfolgreich digital transformieren
Dass eine erfolgreiche Digitale Transformation der Schulen zu mehr Lehr- und Lernerfolg führt, ist klar. Sie steigert das Bildungsniveau auf allen gesellschaftlichen Ebenen und stärkt so die Zukunftsfähigkeit des Landes. Bei diesem Symposium wird sich mit Fragen nach einer hochwertigen Lernsoftware, Praxiserfahrungen und einem Ökosystem, in dem die Schulfamilien künftig aus den besten digitalen Lernmitteln auswählen können, beschäftigt. In einem Zusammenspiel aus Diskussionen, Präsentationen und Ansprachen wird sich aus verschiedenen Perspektiven an das Thema angenähert. Infos & Anmeldung
