ist die Kultusministerkonferenz zukunftsfähig – und damit krisensicher – aufgestellt? Einen Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen beschloss die KMK eine Teilabkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Ein großer Schritt, sagt Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der A-Länder, im Interview mit Holger Schleper. Ginge es nach ihr, dürfte aber noch öfter nur ein Teil der Länder vorangehen. Zudem verrät sie, wie sie über das Vorgehen der Länder beim Startchancen-Programm denkt und was Kitas brauchen, um sozial gerechter zu werden.
Um Zukunft geht es auch in der Analyse meiner Kollegin Anna Parrisius. Allerdings legt sie den Fokus auf die berufliche Zukunft von Jugendlichen. Dafür wirft sie einen Blick in die Schweiz – wo berufliche Bildung ein deutlich besseres Image genießt als in Deutschland. Trotz zahlreicher Unterschiede zwischen den beiden Ländern, gibt es überraschend viele Impulse, die Deutschland übernehmen könnte.
Ich hoffe, auch Sie können interessante Impulse aus unserem Briefing mitnehmen.


Frau Hubig, die Kultusministerinnen und -minister haben am Montag beschlossen, dass es zumindest Teilbereiche gibt, für die das Prinzip der Einstimmigkeit in der KMK nicht mehr gelten muss. Sie sagten nach der Konferenz, die A-Länder hätten sich weitergehende Veränderungen vorstellen können. Welche?
Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem, was wir gemeinsam erreicht haben. Ein Beispiel, wo ich mir mehr hätte vorstellen können: dass künftig mit dem Mehrheitsprinzip auch beschlossen werden kann, neue Einrichtungen der KMK ins Leben zu rufen – nach einem vorausgegangenen Klärungsverfahren. An der Task Force Ukraine haben wir gesehen, dass es Situationen gibt, in denen wir sehr schnell und unbürokratisch handeln müssen. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn wir die Möglichkeit haben, Einrichtungen mit einer Mehrheit von 13 Ländern auf den Weg zu bringen. Auch für Zusammenschlüsse im Bereich der Digitalisierung oder zur Verbesserung von Bildungsstandards wäre es hilfreich, wenn mehrere Länder vorangehen können.
Mehrheitsentscheidungen kann es nun lediglich für Einrichtungen der KMK geben, die bereits bestehen. Wieso sperren sich Länder dagegen, dass dies auch für das Schaffen neuer Einrichtungen gilt?
Das hängt natürlich mit der Frage des Haushaltes der KMK zusammen, den die Länder gemeinsam tragen. Meine Wahrnehmung war, dass diejenigen, die den Weg nicht mitgehen wollten, um den Charakter der KMK als gleichwertiger Zusammenschluss aller Länder fürchten. Wenn man von der Einstimmigkeit abweicht, bedeutet das, auch gegen den Willen einzelner Länder etwas beschließen zu können. Das sehen nicht alle Länder gleichermaßen entspannt.
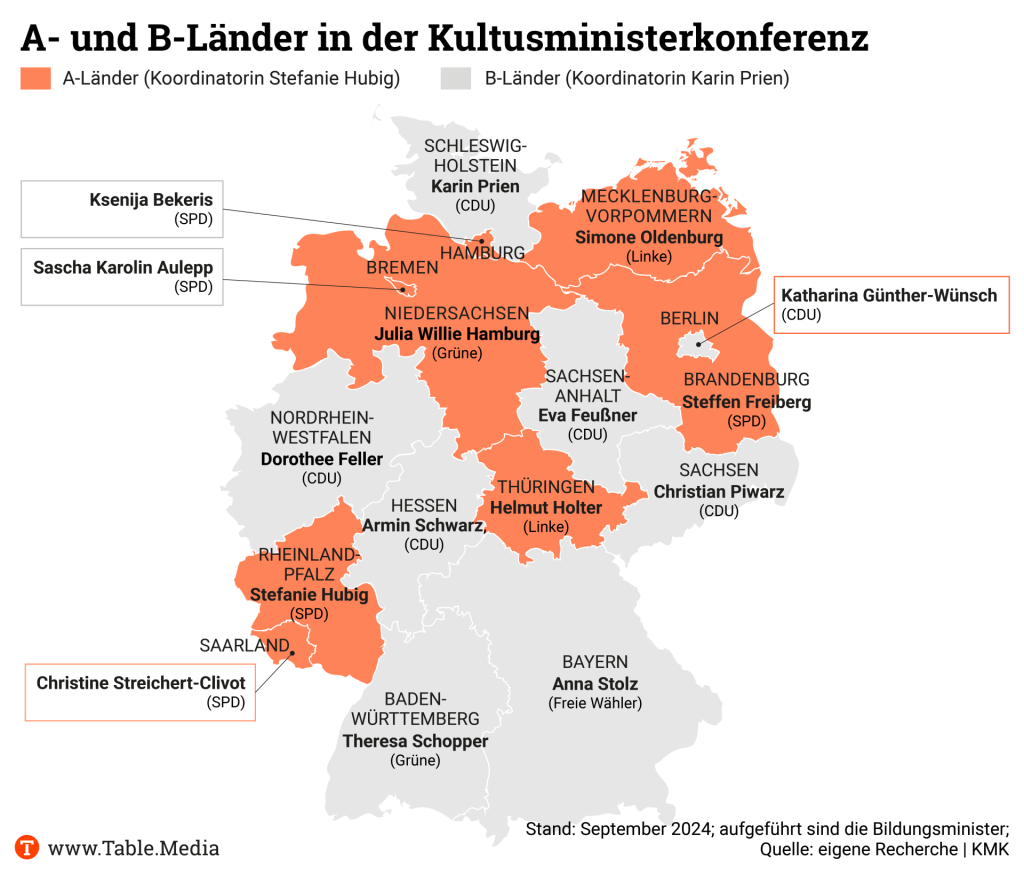
Also war die Sonder-KMK eine vertane Chance?
Nein. Man darf nicht verkennen, dass es wirklich ein großer Schritt ist, in bestimmten Kernbereichen von der Einstimmigkeit wegzugehen. Viele Augen waren am Montag auf die KMK gerichtet und es ist ein Erfolg, dass wir diesen wichtigen Schritt gemacht haben. Denn für mich ist das das Wichtigste: Wir stellen die KMK so auf, dass Einzelne sie nicht torpedieren können.
Also stimmt, was vielfach zu lesen war – gerade nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen: Die KMK wappnet sich gegen AfD und BSW?
Wir arbeiten schon lange an dem Thema, das reicht weit vor die Sondersitzung am Montag zurück. Grundsätzlich halte ich es für zentral, sich vorausschauend Gedanken darüber zu machen, wie sich ein Staat verändert und wie Institutionen verändert werden können, damit sie gewappnet sind gegen diejenigen, für die Demokratie nicht das zentrale Element ist. Eine Demokratie ist gut beraten, sich auch für stürmischere Zeiten zu rüsten. Wer zu spät kommt, den könnte das Schicksal bestrafen.
Braucht es grundsätzlich ein Mehr an Demokratiebildung?
Ja, natürlich. Wir haben jetzt bei den Wahlen gesehen, dass die unter 30-Jährigen in großer Zahl die AfD gewählt haben. Viele geben an, dass es ihnen egal sei, ob die Partei in Thüringen und Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft wird. Ich glaube, das hat sehr viel mit Bildung zu tun, mit Hintergrundwissen und der Herausforderung, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Das ist keine einfache Aufgabe. Trotzdem müssen und werden wir da dranbleiben. Die Schule ist der Ort, wo alle Kinder und Jugendlichen hingehen, und sie ist der Ort, wo sie die Heterogenität der Gesellschaft erleben und als Wert begreifen können.
Damit Schule gelingt, ist das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen grundlegend. Der Ampel-Koalitionsvertrag auf Bundesebene versprach hier spürbare Verbesserungen (hier zum Download, Seite 74), ebenso ein Beschluss der SPD Ende 2023 (hier zum Download, Seite 4). Wieso sehen wir davon nichts?
Wir arbeiten mit den Kommunen schon sehr gut im Bereich der Bildung zusammen, nehmen Sie beispielhaft die Digitalisierung und den Kita-Ausbau. Auch die Kommunen nehmen viel Geld in die Hand. Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass der Bund die Verantwortung, die er ja auch in der vorherigen Legislaturperiode übernommen hat, wieder stärker wahrnimmt. Der kooperative Föderalismus ist das richtige Modell. Aber dazu gehört es eben auch, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren.
Diskutieren Länder und BMBF gerade auf Augenhöhe?
Dass die Diskussionen um die Fortsetzung des Digitalpaktes und auch zum Startchancen-Programm schwierig waren und sind, ist kein Geheimnis. Es ist wichtig, dass man vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet und sich aufeinander verlassen kann. Wir sehen, denke ich, beiderseits die Nöte und auch die Schwierigkeiten in den jeweiligen politischen Rollen und auch die tatsächlichen Gegebenheiten.
Das Startchancen-Programm hat ein Volumen von 20 Milliarden Euro. Bund und Länder steuern je die Hälfte bei. Recherchen von Table.Briefings legen nahe, dass die Länder allerdings wenig frisches Geld in das Programm geben. Sie nutzen vorwiegend die Möglichkeit, laufende Maßnahmen anrechnen zu lassen.
Die Länder investieren viel in die Bildung, deshalb halte das nicht für ein Thema, das man skandalisieren kann. Als ich 2016 anfing, hatte das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz einen Haushalt von rund 4,2 Milliarden Euro, im nächsten Jahr liegt er bei mehr als 6,4 Milliarden Euro. Wir gehören damit zu den Ländern, die schon viel im Bereich der Bildungsgerechtigkeit getan haben, auch mit zusätzlichen Geldern. Diese Länder dürfen beim Startchancen-Programm nicht bestraft werden. In Rheinland-Pfalz etwa gibt es seit 2020 das Programm “S4 – Schule stärken, starke Schule’. Alle S4-Schulen werden jetzt zu Startchancen-Schulen. Das Startchancen-Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren und beginnt jetzt. In den aktuellen Länderhaushalten, darunter wie auch in Rheinland-Pfalz einige Doppelhaushalte, konnte noch keine Vorsorge getroffen werden. 2029 wird eine erste Bilanz gezogen, dann müssen Ländern und Kommunen die vereinbarten Summen auf den Tisch gelegt haben.
Lesen Sie auch: Startchancen – Warum das 20-Milliarden-Euro-Programm viel kleiner ausfällt
Die oft gehörte Formel “20 Milliarden Euro, zehn Jahre, 4.000 Schulen” suggeriert aber, dass hier frisches Geld in die Schulen fließt.
Tatsache ist: Am Ende nehmen wir zusammen wirklich 20 Milliarden Euro in die Hand. Das bedeutet, dass zum Beispiel Programme, die vielleicht sonst ausgelaufen wären, in den Ländern fortgesetzt werden. Wir finanzieren zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im Bereich der Schulsozialarbeit mit, ebenso bei Programmen für die Ferien, die sogar ausgebaut werden. Dieses Geld ist nicht fiktiv, es steckt in den Schulen, kommt Lehrerinnen, Lehrern und multiprofessionellen Teams zugute. Das Programm stärkt uns zudem den Rücken, denn trotz angespannter Haushaltslage ist vieles im Bildungsbereich unverzichtbar.
Braucht es auch ein Startchancen-Programm für Kitas?
Wir müssen auch bei den Kitas die Leistungen viel stärker von einem Sozialindex abhängig machen. Ich finde, dass man Kitas je nach sozialräumlicher Lage unterschiedlich behandeln sollte. Rheinland-Pfalz hat das schon getan und mit dem Kita-Gesetz 2021 ein Sozialraumbudget eingeführt. Damit finanziert das Land weiteres Personal mit, etwa für Kita-Sozialarbeit, interkulturelle Fachkräfte oder Französischkräfte. Ich glaube, dass wir genau diesen Weg weitergehen müssen.
Finden Sie, dass die Kitas grundsätzlich in Bildungsministerien gehören?
Ich finde ja, Kitas gehören in die Bildungsministerien. In Rheinland-Pfalz ist das seit 2016, mit meinem Amtsantritt, wieder der Fall. Und wir sind mit der KMK während meiner Präsidentschaft im Jahr 2020 einen eher unauffälligen, aber fast revolutionären Schritt gegangen, als wir beschlossen haben, auch die frühkindliche Bildung, den Übergang von der Kita in die Grundschule, mit in den Blick zu nehmen. Wir brauchen eine einheitliche Bildungskette. Kita ist keine Schule und Schule ist keine Kita. Aber die Systeme müssen sich annähern und verzahnen und dabei ihre Fachlichkeit behalten. Das als völlig selbstverständlich anzusehen, gelingt einfacher, wenn beide Systeme in einem Ministerium unter einem Dach sind und nicht in zwei getrennten Ministerien.

Angesichts unbesetzter Ausbildungsstellen in Deutschland und Jugendlichen, die gleichzeitig keine Lehre beginnen, stellt sich die Frage, wo es in der Ausbildung besser läuft. Helfen kann hier der Blick in die Schweiz. Dort lernt ein noch größerer Anteil der Azubis dual – und die Ausbildung hat Experten zufolge deutlich weniger unter der Pandemie gelitten. Insgesamt gilt die berufliche Bildung bei unseren Nachbarn als attraktiver.
Zwar gibt es auch in der Schweiz Passungsprobleme, wie hierzulande vor allem in der Gastronomie und der Baubranche. Zehn Prozent der Lehrstellen waren zuletzt unbesetzt. In Deutschland waren es laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2023 sogar 35 Prozent. Wie in Deutschland mache sich der demografische Wandel bemerkbar, sagt Sonja Engelage, Senior Researcherin der Abteilung Forschung und Entwicklung an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB). Er werde allerdings durch eine relativ hohe Migrationsquote abgefedert – allein 324.000 deutsche Staatsbürger lebten 2023 in der Schweiz.
Im Nachbarland beginnen mehr Jugendliche direkt eine Ausbildung: Über 60 Prozent der Jugendlichen starten laut EHB nach der neunten Klasse in eine Berufslehre. Nur ein Viertel gehe aufs Gymnasium und mache direkt die Matura, also das Abitur – da die Kantone lenkend eingreifen, etwa durch Aufnahmetests oder Lehrerempfehlungen. Zwar lassen sich Deutschland und die Schweiz nur begrenzt vergleichen – in Deutschland etwa machen direkt mehr Jugendliche das Abitur, fast die Hälfte eines Abiturientenjahrgangs beginnt nach Berechnungen des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie aber auch eine Lehre. Dennoch lassen sich Erfolgsfaktoren vom Schweizer Vorbild ableiten.
Lesen Sie auch: Zur Krise am Ausbildungsmarkt: Es braucht tiefergehende Analysen
“Deutschland hat seit den 1990er-Jahren stärker auf Akademisierung gesetzt, die Schweizer Politik hat der Berufsbildung einen hohen Stellenwert eingeräumt”, sagt Sonja Engelage. 2004 wurde gesetzlich festgeschrieben, dass Berufs- und Allgemeinbildung andersartig aber gleichwertig sind. “Bis heute setzen Politiker und Verbände sich dafür ein, dass die Berufsbildung nicht ,verakademisiert’ werden dürfe.” Für kritisch hält Engelage aber, dass beide Berufswege so auch gegeneinander ausgespielt würden.
Politiker wie der ehemalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann, von 2010 bis 2018 im Amt, verstünden es, das Image der Berufsbildung zu pflegen. Eine Initiative, die der Bund mit unterhält, verantwortet nationale Image-Kampagnen. “Regelmäßig werden hier im ganzen Land Plakate aufgehängt, die junge, fröhliche Menschen zeigen, die eine tolle Berufsausbildung machen”, sagt Engelage. Im Fernsehen gibt es Werbefilme für die Lehre. Ein Erfolgsfaktor: Die Werbung spricht auch Eltern an und vermittelt, dass ein Kind nicht aufs Gymnasium gehen muss, um erfolgreich zu sein.
Seit 30 Jahren können Schweizer begleitend zur Lehre oder im Anschluss eine Berufsmatura erwerben, mit der sie an einer Fachhochschule studieren können. Wer an die Universität will, kann in einer einjährigen “Passerelle” noch die eidgenössische Matura nachholen. In Deutschland gibt es zwar auch Möglichkeiten, Lehre und Abitur zu verbinden. Diese sind jedoch oft wenig bekannt und werden weniger genutzt.
Auf der anderen Seite gibt es auch in der Schweiz für Jugendliche, die nicht gleich den Weg in eine Ausbildung finden, sogenannte Brückenangebote. Anders als in Deutschland der Übergangssektor sind sie jedoch relativ effektiv. Die meisten Jugendlichen kommen nach einem Jahr in eine reguläre Berufsbildung, wozu Engelage zufolge Angebote mit vielen Praxiserfahrungen in Betrieben beitragen. “Für besonders erfolgreich halte ich aber eine verkürzte Berufsausbildung für Jugendliche, die sprachliche Probleme oder Lernschwierigkeiten haben.” Dieser vereinfachte Bildungsgang dauert zwei Jahre und wird für rund 60 Berufe angeboten, etwa in der Gastronomie und im Pflegebereich.
Das Besondere: Die Grundbildung findet überwiegend dual statt und endet mit einem anerkannten Abschluss, dem eidgenössischen Berufsattest. Danach können die Jugendlichen im erlernten Beruf arbeiten oder sie steigen noch in die reguläre Ausbildung ein, ein Lehrjahr können sie sich dann anrechnen lassen. “Das Credo lautet: Kein Abschluss ohne Anschluss.”
Die Vertragslösungsquote von Azubis ist in der Schweiz hoch: Im Schnitt liegt sie bei 20 Prozent. In Deutschland waren es 2022 sogar fast 30 Prozent. Sehr viele Jugendliche in der Schweiz, schätzungsweise 80 Prozent, beginnen allerdings schnell eine neue Lehre. In Deutschland sollen es weniger sein, laut Schätzungen mindestens 50 Prozent.
Ein möglicher Grund: In der Schweiz haben die Kantone die Lehraufsicht inne und sie haben Stellen für Ausbildungsberater oder Berufskommissare eingerichtet, die zwischen Lernenden und Betrieben vermitteln und den Jugendlichen auch helfen können, eine neue Lehrstelle oder einen neuen Betrieb zu finden. Zudem seien viele Betriebe bereit, Jugendliche aufzunehmen, sichtbar etwa in “Wir bilden aus”-Aufklebern an vielen Eingangstüren. “Es gibt hierzulande einen Betriebsstolz, dass die Ausbildung einfach dazugehört.” Das sei auch eine Folge der öffentlichkeitswirksamen Pflege der Berufsbildung.
Auch in der Schweiz fehlt Lehrpersonal, jedoch nicht in den Berufsfachschulen. Denn: Viele beruflich Tätige arbeiten nebenberuflich als Lehrkraft. “Es gibt ganz flexible Arbeitszeitmodelle und gute Möglichkeiten, zum Berufsfachschullehrdiplom zu kommen, auch für Nicht-Akademiker”, sagt Engelage. Neben diesen Rahmenbedingungen liegt es in ihren Augen vor allem an einer hohen Motivation vieler Praktiker, Wissen weiterzugeben.”Manche sehen es als zusätzliche, sicherer Verdienstquelle. Die meisten machen es aber aus einem großen Berufsstolz heraus.”
Fobizz, eine Plattform für Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte, ist eine Partnerschaft mit 13 EdTech-Anbietern eingegangen. Lehrkräfte, die sich bei Fobizz einloggen, haben über die Plattform ab sofort Zugang zu den Partnerunternehmen. Damit möchte Fobizz ein “EdTech-Ökosystem” schaffen, das mit Single Sign-On funktioniert.
“Es gibt bereits so viele tolle Inhalte und Programme, aber Lehrerinnen und Lehrer verbringen noch viel zu viel Zeit damit, diese zu suchen”, sagt Jeyran Sanee-Khonsari, Chief Strategy Officer bei Fobizz zu Table Briefings. Man wolle daher die Angebote bündeln und gleichzeitig kuratieren. “Unser Ziel ist es, möglichst viele Nutzungsanlässe abzudecken“, sagt Sanee-Khonsari. Gab es für einen Anwendungsbereich mehrere Wettbewerber, habe man nach internen Kriterien entschieden, wer die bessere Ergänzung für Fobizz sei.
Einheitliche Prüfkriterien habe es bei der Auswahl der Partnerunternehmen nicht gegeben, sagt Sanee-Khonsari. “Wir haben aber sowohl auf die didaktische und pädagogische Qualität geachtet als auch darauf, dass die Produkte datenschutzkonform sind.” Dabei habe man auf bereits vorhandene Gütesiegel oder den Entwicklungsprozess geschaut.
Zu den Partnern gehören beispielsweise “to teach”, eine Anwendung, mit der Lehrkräfte mithilfe Künstlicher Intelligenz Übungsaufgaben und Lerninhalte erstellen können oder der Carlsen Verlag, ein deutscher Kinder- und Jugendbuchverlag. Auch Nutzer, die keine Lizenz für Fobizz haben, können auf die externen Inhalte zugreifen. “Die Partnerunternehmen bieten kostenlose Probeversionen von 30 bis 90 Tagen an”, erklärt Sanee-Khonsari. Nach diesem Zeitraum wechseln Nutzer zu einer Basisversion – es drohe keine Abofalle.
Mit manchen Partnern, wie dem Mathematik-Lernsystem Bettermarks, bestehe nur eine Content-Partnerschaft. Das heißt, hier bekommen die Nutzer keinen Zugang zum gesamten Angebot, aber zumindest einzelne Inhalte zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus entwickelt Fobizz für die neu angedockten Anbieter Fortbildungen, die Lehrkräften mit deren Funktionen und Anwendungen vertraut machen sollen. Weitere Partnerschaften seien bereits in Planung, erfuhr Table.Briefings. vkr
Knapp 300 Personen aus Wissenschaft, Fachpraxis und von Fachverbänden fordern in einem offenen Brief, dass die politisch Verantwortlichen schnell Maßnahmen gegen die dramatische Lage in den Kitas ergreifen. “Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in Deutschland ist stark belastet und steht kurz vor dem Kollaps”, heißt es in dem Brief.
Pädagogische Fachkräfte in den Kitas gehörten zu den Berufsgruppen mit den meisten Krankentagen, insbesondere wegen Erkrankungen der Psyche, erklärte die Pädagogik-Professorin Rahel Dreyer. “Die psychische Gesundheit der Fachkräfte wirkt sich nachweislich auf die Gesundheit der Kinder aus.”
Dreyer ist eine von vier Personen, die den Aufruf gestartet haben. Es sind:
Insgesamt stellen sie und der breite Kreis der Unterstützer sechs Forderungen an die politisch Verantwortlichen. Dazu zählt, “den erreichten Stand der Investitionen in Qualität und Qualitätsentwicklung in den Ländern unter keinen Umständen zurückzufahren, sondern zusätzliche Mittel für weitere Qualitätsverbesserungen zu verwenden”. Zudem fordert die Initiative, in Bundesländern, in denen ein Rückgang der Kinderzahlen zu verzeichnen ist, die Situation zu nutzen, um den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern.
Und sie drängt darauf, “das im Koalitionsvertrag vereinbarte Qualitätsentwicklungsgesetz mit einer kontinuierlichen finanziellen Förderung des Bundes und einheitlichen Qualitätsstandards jetzt auf den Weg zu bringen”. Der Entwurf aus dem Bundesfamilienministerium von Lisa Paus hatte hier für viel Kritik gesorgt.
Der Termin der Veröffentlichung des Briefes ist nicht zufällig. “Wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, weil nun die Befassung mit dem geplanten Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz im Parlament ansteht und wir uns erhoffen, noch darauf Einfluss nehmen zu können”, sagte Dreyer Table.Briefings. Der aktuelle Gesetzentwurf sei sehr weit weg von dem, was sich die Koalition eigentlich vorgenommen hat und was eigentlich notwendig wäre.
Lesen Sie auch: Kita-Qualität – Warum Familienministerin Paus mit dem Koalitionsvertrag bricht
Zu Wochenbeginn hatte bereits die Kita-Kampagne “Jedes Kind zählt”, für die mehr als 220.000 Personen unterschrieben haben, ihre Sorge formuliert, erst im Petitionsausschuss des Bundestages angehört zu werden, wenn das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz Mitte Oktober möglicherweise bereits beschlossen worden ist. Dreyer kann die Sorge “absolut nachvollziehen”, erklärte sie. “Ich hoffe daher sehr, dass es gelingt, dass ein Anhörungstermin noch rechtzeitig vorher zustande kommt und auch der geplante Aktionstag am 20. September etwas bewirken wird.” Holger Schleper
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf für eine bundesweit einheitliche Ausbildung von Assistenzkräften in der Pflege verabschiedet (zum Download). Sie soll künftig 18 Monate dauern. Weder folgt die Ampel damit der Forderung nach 24 Monaten Ausbildungszeit des Deutsches Pflegerates, einem Dachverband großer Berufsverbände. Noch kommt sie den Arbeitgebern entgegen, die empfahlen, die Ausbildung auf ein Jahr zu verkürzen.
Lesen Sie auch: Pflegeassistenz: Was Verbände am Ampel-Plan für eine neue Ausbildung kritisieren
Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, sagte, die Regierung habe “die Chance verpasst, schnelle Entlastung für Pflegekräfte und pflegende Angehörige zu schaffen”. Aufgrund von fehlendem Personal stünden viele Familien unter großem Druck. “Es macht einen großen Unterschied, ob Hilfe nach 12 oder erst nach 18 Monaten verfügbar ist.”
Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, fürchtet hingegen, dass Azubis in 18 Monaten nicht “die notwendigen theoretischen und praktischen Kompetenzen” erwerben können. Langfristig werde das Gesetz zu hohen Kosten für Nachqualifizierungen führen, Pflegeassistenten könnten Pflegefachkräfte ansonsten nicht entlasten.
Ziel der Reform ist es, dass der Beruf attraktiver wird und Pflegeassistentinnen und -assistenten künftig neben der Pflegearbeit, die sie leisten, auch einen Teil der medizinischen Behandlungspflege übernehmen können. Das soll helfen, den Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern.
Künftig sollen außerdem alle Azubis vergütet werden. Nur die Hälfte hat bislang Anspruch auf eine Vergütung – das variiert in den 27 unterschiedlich geregelten Ausbildungen der Länder, die es laut Bundesinstitut für Berufsbildung gibt. Als Orientierungsgröße für eine künftige bundesweite Vergütung sprach Bundesfamilienministerin Lisa Paus von 1.000 Euro monatlich. Zugleich wies die Ministerin aber darauf hin, dass es nicht die Kompetenz der Bundesregierung sei, Ausbildungsvergütungen festzusetzen. Im neuen Entwurf ist von Mehrkosten in Höhe von etwa 95 Millionen Euro die Rede. Anna Parrisius
Die Hamburger Elterninitiative G9 Hamburg e.V. startet am 10. September erneut eine Unterschriftensammlung für die Rückkehr zu G9 an Hamburger Gymnasien. Anfang des Jahres hatte eine Volksinitiative mit knapp 14.000 Unterschriften die geforderten 10.000 deutlich übertroffen. Nun geht es im zweiten Schritt um ein Volksbegehren. Eintragen können sich alle Wahlberechtigten der Hansestadt, so Sammar Rath, eine der Initiatorinnen im Gespräch mit Table.Briefings. G9 Hamburg wolle den basisdemokratischen Weg nutzen, um den Gymnasialschülern wieder mehr Zeit zum Lernen zu verschaffen, für mehr Bildungsgerechtigkeit zwischen den G8- und G9-Ländern zu sorgen und die Spätfolgen der Pandemie im Bildungssystem zu kompensieren, so Rath.
Die Hamburger Schulbehörde sieht hingegen keinen Grund, den vor 14 Jahren vereinbarten Schulfrieden wieder aufzukündigen. Er habe erfolgreich verhindert, dass “Hamburg sich in endlosen und fruchtlosen Schulstrukurdebatten verstrickt”, so die Behörde auf Anfrage von Table.Briefings. Sie argumentiert, dass es in Hamburg bereits zwei gleichwertige Wege zum Abitur gebe. Wer mehr Zeit brauche oder wolle, könne eine der 87 Stadtteilschulen (davon 23 private) besuchen. In deren “Oberstufen können die Schülerinnen genau wie von der Initiative gewünscht, ein Abitur ablegen mit all den Vorteilen, die diese darin sieht”, so ein Sprecher. Damit habe in Hamburg jeder die Chance nach seiner Leistung und seinem Tempo ein Abitur zu machen.
Auch die Hamburger Elternkammer, in der sich Mütter und Väter von Kindern in allen Hamburger Schulformen organisiert haben, unterstützt die Initiative nicht. In einer Stellungnahme macht sie deutlich, dass sie “eine alleinige Konzentration auf die Gymnasien nicht als die Lösung für eine verbesserte Schulbildung in Hamburg” betrachte. Die Schülerinnen- und Schülerkammer der Hansestadt positionierte sich ebenfalls gegen das Volksbegehren. Mit einer Rückkehr zu G9 werde die Unterteilung von Gymnasien als Eliteschulen und der Stadtteilschulen als Schulen “für alle anderen” vorangetrieben, erklärte sie gegenüber der dpa.
Sammar Rath und ihr Verein halten hingegen an ihren Zielen fest. Ausgestattet mit Klemmbrettern werden sich etwa 100 ehrenamtliche Aktivisten bis zum 30. September vor Schulen und in Fußgängerzonen stellen und für mehr Zeit für Bildung werben, kündigt Rath an. Für ein erfolgreiches Volksbegehren, das dann im dritten Schritt eine Volksbefragung zur Folge hätte, liegt die Hürde nun ungleich höher. Ein Zwanzigstel der wahlberechtigten Hamburger muss unterzeichnen. Das entspricht derzeit rund 66.000 Bürgerinnen und Bürgern.
Konnte für die Volksinitiative noch die Online-Plattform Open Petition genutzt werden, ist dieser Weg nun versperrt. Für das vom Senat durchgeführte Volksbegehren müssen die Unterschriften physisch vorliegen, kritisiert Rath. “Das ist in einer digitalen Welt nur schwer nachzuvollziehen und für uns eine zusätzliche Hürde, die Eltern gut zu erreichen.” Allerdings ist auch eine Briefwahl möglich. Sandra Hermes
Rund 404 Millionen Schüler waren von Januar 2022 bis Juni 2024 von Schulschließungen aufgrund von Extremwetterereignissen betroffen. Das zeigt ein neuer Bericht der Weltbank (zum Download). Mindestens 81 Länder mussten demnach den Präsenzunterricht wegen Flutkatastrophen, Hitzewellen, Stürmen oder anderen Unwettern ausfallen lassen. Besonders stark traf es Niedriglohnländer. Sie verloren im Schnitt jährlich 18 Tage Unterricht. In Pakistan waren es in den eineinhalb untersuchten Jahren sogar 97 Tage – fast die Hälfte eines typischen Schuljahres. Einkommensstarke Länder verzeichneten hingegen im Schnitt nur 2,4 Tage Schulausfall im Jahr.
Auch wenn die Schulen geöffnet bleiben, können schon steigende Temperaturen negative Effekte auf den Lernerfolg eines Kindes haben. Für Brasilien beziffern die Forscher den Verlust für jene Schüler, die in der ärmeren Hälfte der brasilianischen Gemeinden leben, auf bis zu ein halbes Jahr Lernzeit. Auf lange Sicht könne das für die Schüler zu einem geringeren Einkommen und weniger Produktivität führen und Ungleichheiten verstärken. Auch zahlreiche andere Auswirkungen des Klimawandels können die Lernerfolge junger Menschen mindern, etwa Luftverschmutzung.
Trotz dieser negativen Auswirkungen spielt das Bildungssystem für die Klimapolitik bislang oft keine oder nur eine geringe Rolle. In einer Untersuchung von 14 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau bescheinigen die Autoren des Weltbankberichts nur vier Ländern, Bildungsmaßnahmen tiefergehend in ihre Klimapolitik einzubeziehen. Laut OECD entfielen 2020 nur etwa 1,3 Prozent der klimabezogenen bilateralen Entwicklungshilfe auf den Bildungssektor.
In einer Online-Umfrage unter 103 Bildungspolitiker aus 33 Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommensniveau sagten zwar 87 Prozent, Bildung könne dabei helfen, dass Schüler gegen den Klimawandel aktiv werden. Nur ein Drittel glaubt jedoch, dass ihr Bildungssystem die Schüler schon gut genug über den Klimawandel unterrichte.
“Die vielversprechende Nachricht ist, dass es viele kostengünstige Schritte gibt, die Regierungen ergreifen können, um Bildung und Lernen für den Klimaschutz nutzbar zu machen und gleichzeitig die Bildungssysteme an den Klimawandel anzupassen”, sagte Luis Benveniste, globaler Direktor für Bildung bei der Weltbank. Bereits 18,51 US-Dollar pro Kind könnten dabei helfen, dass Schüler trotz des Klimawandels gute Lernfortschritte machen. Einkommensschwache Länder müssten ihre Ausgaben pro Schüler dafür jedoch um rund ein Drittel steigern. Das Geld müsste etwa dafür eingesetzt werden, die Temperatur im Klassenzimmer zu senken, Möglichkeiten zum Fernunterricht zu erhöhen und die Ausbildung von Lehrkräften zu verbessern.
Der Bericht zeigt auch, dass viele junge Menschen sich Green Skills aneignen möchten. In einer Umfrage unter 17- bis 35-Jährigen in Angola, Bangladesch, China, Kolumbien, Indien, Kasachstan, dem Senegal und Tansania gaben fast zwei Drittel an, dass ihre Zukunft von Green Skills abhängt. Gleichzeitig denken 60 Prozent, in der Schule nicht genug über den Klimawandel gelernt zu haben. Anna Parrisius

Wer den Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Stephan Albani (CDU) besser kennenlernen möchte, der sollte mit seiner Homepage anfangen: “Albani in Aktion” – diesen Namen trägt eine Aktionsreihe, die man hier findet. Immer, wenn Stephan Albani “in Aktion” tritt, dann absolviert er eintägige Praktika in den unterschiedlichsten Berufen und berichtet darüber.
Auf den Fotos im Internet erscheint der Bundestagsabgeordnete als Paketbote, als Gebäudereiniger
oder als Maurer. Oder man kann beobachten, wie er als Hilfskraft im Verpflegungsamt der Bundeswehr in Oldenburg Mahlzeiten verpackt. Diese Bilder erzählen viel darüber, was für ein Politiker der 55-jährige Diplom-Physiker sein will: Nicht theoriegeleitet und abgehoben, sondern praxisnah und kompetent.
Auch im Gespräch mit dem gebürtigen Göttinger wird schnell klar, dass Albani sich gern als jemand darstellt, der die Ärmel hochkrempelt: “Geht nicht gibt’s nicht” sei so etwas wie sein Lebens- und Arbeitsmotto. Eines seiner “Herzensthemen”, sagt Albani, sei die “Stärkung der beruflichen Bildung”.
Seit 2018 ist der Physiker für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Berichterstatter für berufliche Bildung. “Ich habe einen tiefen Respekt vor der Leistungsfähigkeit eines jeden”, sagt er. “Mein großes Ziel ist, eine wirkliche und sachangemessene Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung zu erreichen, ohne sie gleich machen oder gar akademisieren zu wollen.”
Albani selbst standen in seiner beruflichen Karriere viele Wege offen. Schon als Student, der sich in den Semesterferien in einem Hamburger Medizintechnik-Unternehmen etwas dazuverdiente, habe er die Vorzüge eines “freiheitlichen Führungsstils” erfahren. “Jeder hat die Kompetenzen, die er sich erarbeitet hat, hieß es dort damals immer” – davon sei er sehr geprägt worden.
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer war dann nicht mehr weit. Nach seinem Physik-Studium arbeitete Albani zunächst in der medizinischen Forschung und gründete dann drei Firmen im Life-Sience-Sektor. Zum Beispiel war der Physiker Mitgründer des Hörzentrums Oldenburg GmbH, einem Unternehmen auf dem Gebiet der audiologischen Forschung und Hörsystemevaluation. Was ihn in die Politik zog, waren aber die Hindernisse in seiner Karriere, die er zum Beispiel im Zusammenhang mit seinen Firmengründungen erlebt habe, erzählt er im Gespräch: “Da gab es immer wieder Stolpersteine, hin und wieder auch mal eine Fußfessel. Diese Dinge verändern oder zumindest beeinflussen zu können, macht für mich den Reiz von Politik aus.”
2013 glückte dem CDU-Politiker etwas, woran viele scheitern – für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland zog er als politischer Quereinsteiger in den Bundestag ein. In den wissenschafts- und bildungspolitischen Debatten ist Albani seitdem eine feste Größe. Er ist Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
Albani plädiert dafür, den Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), der berufliche und akademische Bildungswege miteinander vergleichbar macht und Qualifikationen einordnet, zu verrechtlichen. Und er setzt sich für eine verbesserte Berufsorientierung ein, zuvorderst durch eine nationale Qualitätsoffensive Berufsorientierung, durch die mehr Jugendliche erreicht werden sollen.
Lesen Sie auch: Azubi-Campus: Wie die Unionsfraktion die berufliche Bildung stärken will
Daneben äußert Stephan Albani sich immer wieder kritisch zu Sparmaßnahmen im Wissenschaftsbetrieb “Wissenschaft und Innovation werden der Schlüssel zu vielen Herausforderungen sein, die wir gerade haben”. Statt zu kürzen, will Albani Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung bringen, eine Trennung zwischen Grundlagen- und angewandter Wissenschaft hält er für wenig sinnvoll. “Forschung – von der
Grundlagen- bis zur angewandten Forschung – kann, als Prozesskette verstanden, mittel- bis langfristig einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen”.
In der wissenschaftlichen Community bekomme er aktuell von einer “großen Unsicherheit” mit. “Diese Unsicherheit hat neben den Sparmaßnahmen auch mit den Gesetzesvorhaben zu tun, die, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die DATI oder das Startchancen-Programm viel zu lange gedauert haben.” Deren Ende, so Albani, “war immer wieder unklar und ist es leider auch noch immer.” Gabriele Voßkühler
Research.Table: Back to Berlin – Ein forschungspolitisches Update für den Herbst . Die Sommerpause ist so gut wie vorbei. Gesetze und Strategien wollen jetzt fortgeschrieben oder endlich verabschiedet werden. Weiter debattiert wird der Umgang mit Antisemitismus an Hochschulen – und in der Fördermittel-Affäre wird Bundesministerin Stark-Watzinger kommende Woche im Ausschuss befragt. Wir fassen für Sie zusammen, welche Themen aktuell im Fokus stehen und welche Entscheidungen in Kürze getroffen werden müssen. Mehr lesen Sie hier.
China.Table: Wie steht Xi Jinping zum Thema Bildung? Die Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas, Qiushi, veröffentlichte Anfang dieser Woche Xi Jinpings Regierungsphilosophie der Partei zum Thema Bildung und warnt darin vor einer Verwestlichung der Jugend. Die ideologische Erziehung in Chinas Schulen und Universitäten besteht aus Unterricht zur “Theorie des Marxismus” und der Theorie des “Sozialismus chinesischer Prägung” und dem Geschichtsunterricht. Xis Position lesen sie hier.
Research.Table: Edelgard Bulmahn sagt im Interview, dass die Exzellenzstrategie fortgesetzt werden und der Bund an der Finanzierung der Universitäten beteiligt werden soll. Alle reden über die Exzellenzstrategie, sie hat sie erfunden. Im Interview mit Table.Briefings erläutert Ex-Forschungsministerin Edelgard Bulmahn die Ziele und Erfolge des Wettbewerbs – und was sich im Wissenschaftssystem sonst noch ändern muss. Mehr lesen Sie hier.
Zeit: Warum niemand Schulleiter werden will. Viele Schulleiterstellen bleiben unbesetzt. Schulleiter und Lehrkräfte, die in Ermangelung eines Nachfolgers deren Aufgaben übernehmen, berichten vielfach von Überlastung. Es gebe viele bürokratische Aufgaben und vor allem Anforderungen, auf die ein Lehramtsstudium nicht vorbereite. Auch die Bezahlung ist kaum besser als die einer Lehrkraft ohne Leitungsverantwortung. (Und dann zeigte der Vater einer Viertklässlerin ihn an)
SZ: Gene und motivierte Lehrer können Schulnoten beeinflussen. Gute Schulnoten sind nicht nur ein Ergebnis von Intelligenz oder einem guten Elternhaus. Das zeigte eine neue Studie aus der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour. Ähnlich einflussreiche Faktoren seien auch Neugier, Motivation und Hartnäckigkeit. Zum Teil seien diese Faktoren auch genetisch bestimmt. Daneben könne die Motivation von Lehrern oder Eltern Kinder anstecken und ihnen so zu besseren Leistungen verhelfen. (Der Schlüssel zum Lernerfolg)
NOZ: Die Gewalt an Deutschlands Schulen hat deutlich zugenommen. Bundesweit habe sich die Zahl der gemeldeten Vorfälle von 21.570 im Jahr 2022 auf 27.470 im Jahr 2023 erhöht. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich dabei auf Zahlen aus den einzelnen Bundesländern. Die Autoren räumen ein, dass ein direkter Vergleich der Zahlen nur bedingt möglich sei. Denn in den Bundesländern gibt es “unterschiedliche Definitionen von Gewalt, variierende Meldepraktiken und unterschiedliche Datenerhebungsmethoden”. Einen Anstieg gebe es aber in allen Ländern. Besonders alarmierend sei die Entwicklung in Schleswig-Holstein mit einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent. (Immer mehr Gewalt an Schulen: In diesen Bundesländern ist die Lage am schlimmsten)
Stuttgarter Nachrichten: Berufsschulen im Ländle beklagen Schulabsentismus. Immer mehr Berufsschüler bleiben dem Unterricht fern, das ist laut Berufsschullehrerverband der Eindruck von Lehrkräften. Berufsschulpflichtige Jugendliche kämen nach Abschluss oder Abbruch der allgemeinbildenden Schule gar nicht an der Berufsschule an oder tauchten während des Schuljahres ab. Konkrete Zahlen nannte der Verband nicht. Als möglichen Grund nannte er Folgen der Pandemie und psychische Belastung. Für die Schulen brauche es mehr Unterstützung, um Jugendliche aufzufinden. (Berufsschullehrer registrieren Zunahme an Schulschwänzern)
Frankfurter Rundschau: Immer mehr Azubis müssen berufsferne Aufgaben übernehmen. Ihre Zahl stieg zuletzt auf 15,3 Prozent. Im Maler- und Lackiererhandwerk müssen sogar 38 Prozent in ihrem Betrieb häufig Aufgaben übernehmen, die nicht Teil ihrer Ausbildung sind. Dazu gehören gering qualifizierte Aufgaben oder Routinetätigkeiten wie Kaffee kochen oder den Müll entsorgen. Erfahrungen wie diese können die Unbeliebtheit der Ausbildung verstärken. (Selbst Schuld am Azubi-Mangel? Gen Z hat keine Lust auf entwürdigende Ausbildung)
Dlf: Wie gerecht sind Frankreichs Schulen? Die öffentlichen Schulen in Frankreich sollen jedem durch Anstrengung und Fleiß den sozialen Aufstieg ermöglichen. Doch ein Fünftel der französischen Schüler besucht trotzdem eine Privatschule. Denn insbesondere bildungsnahe Haushalte legen viel Wert auf die besten Schulen und Nachhilfe. Dies verfestigt soziale Unterschiede: Durchschnittlich erst nach sechs Generationen erreicht ein Mitglied einer einkommensschwachen Familie den durchschnittlichen französischen Lebensstandard. (Enttäuschtes Aufstiegsversprechen)
ist die Kultusministerkonferenz zukunftsfähig – und damit krisensicher – aufgestellt? Einen Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen beschloss die KMK eine Teilabkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Ein großer Schritt, sagt Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der A-Länder, im Interview mit Holger Schleper. Ginge es nach ihr, dürfte aber noch öfter nur ein Teil der Länder vorangehen. Zudem verrät sie, wie sie über das Vorgehen der Länder beim Startchancen-Programm denkt und was Kitas brauchen, um sozial gerechter zu werden.
Um Zukunft geht es auch in der Analyse meiner Kollegin Anna Parrisius. Allerdings legt sie den Fokus auf die berufliche Zukunft von Jugendlichen. Dafür wirft sie einen Blick in die Schweiz – wo berufliche Bildung ein deutlich besseres Image genießt als in Deutschland. Trotz zahlreicher Unterschiede zwischen den beiden Ländern, gibt es überraschend viele Impulse, die Deutschland übernehmen könnte.
Ich hoffe, auch Sie können interessante Impulse aus unserem Briefing mitnehmen.


Frau Hubig, die Kultusministerinnen und -minister haben am Montag beschlossen, dass es zumindest Teilbereiche gibt, für die das Prinzip der Einstimmigkeit in der KMK nicht mehr gelten muss. Sie sagten nach der Konferenz, die A-Länder hätten sich weitergehende Veränderungen vorstellen können. Welche?
Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem, was wir gemeinsam erreicht haben. Ein Beispiel, wo ich mir mehr hätte vorstellen können: dass künftig mit dem Mehrheitsprinzip auch beschlossen werden kann, neue Einrichtungen der KMK ins Leben zu rufen – nach einem vorausgegangenen Klärungsverfahren. An der Task Force Ukraine haben wir gesehen, dass es Situationen gibt, in denen wir sehr schnell und unbürokratisch handeln müssen. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn wir die Möglichkeit haben, Einrichtungen mit einer Mehrheit von 13 Ländern auf den Weg zu bringen. Auch für Zusammenschlüsse im Bereich der Digitalisierung oder zur Verbesserung von Bildungsstandards wäre es hilfreich, wenn mehrere Länder vorangehen können.
Mehrheitsentscheidungen kann es nun lediglich für Einrichtungen der KMK geben, die bereits bestehen. Wieso sperren sich Länder dagegen, dass dies auch für das Schaffen neuer Einrichtungen gilt?
Das hängt natürlich mit der Frage des Haushaltes der KMK zusammen, den die Länder gemeinsam tragen. Meine Wahrnehmung war, dass diejenigen, die den Weg nicht mitgehen wollten, um den Charakter der KMK als gleichwertiger Zusammenschluss aller Länder fürchten. Wenn man von der Einstimmigkeit abweicht, bedeutet das, auch gegen den Willen einzelner Länder etwas beschließen zu können. Das sehen nicht alle Länder gleichermaßen entspannt.
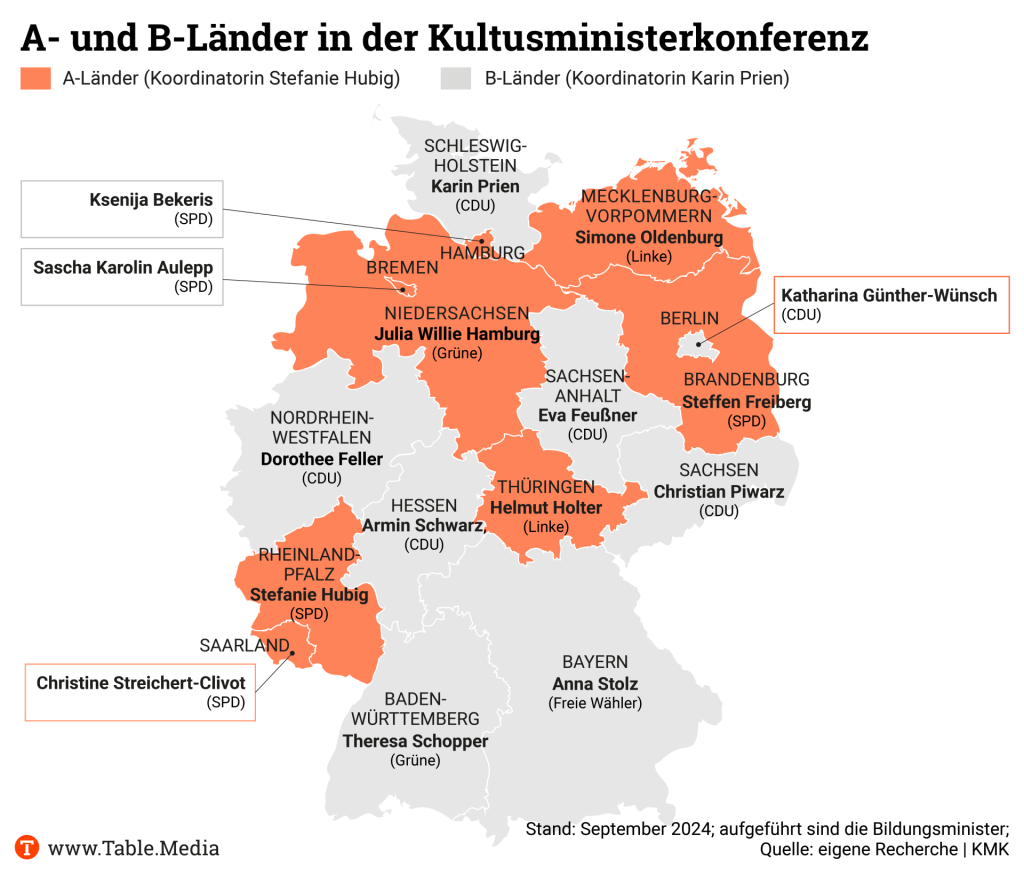
Also war die Sonder-KMK eine vertane Chance?
Nein. Man darf nicht verkennen, dass es wirklich ein großer Schritt ist, in bestimmten Kernbereichen von der Einstimmigkeit wegzugehen. Viele Augen waren am Montag auf die KMK gerichtet und es ist ein Erfolg, dass wir diesen wichtigen Schritt gemacht haben. Denn für mich ist das das Wichtigste: Wir stellen die KMK so auf, dass Einzelne sie nicht torpedieren können.
Also stimmt, was vielfach zu lesen war – gerade nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen: Die KMK wappnet sich gegen AfD und BSW?
Wir arbeiten schon lange an dem Thema, das reicht weit vor die Sondersitzung am Montag zurück. Grundsätzlich halte ich es für zentral, sich vorausschauend Gedanken darüber zu machen, wie sich ein Staat verändert und wie Institutionen verändert werden können, damit sie gewappnet sind gegen diejenigen, für die Demokratie nicht das zentrale Element ist. Eine Demokratie ist gut beraten, sich auch für stürmischere Zeiten zu rüsten. Wer zu spät kommt, den könnte das Schicksal bestrafen.
Braucht es grundsätzlich ein Mehr an Demokratiebildung?
Ja, natürlich. Wir haben jetzt bei den Wahlen gesehen, dass die unter 30-Jährigen in großer Zahl die AfD gewählt haben. Viele geben an, dass es ihnen egal sei, ob die Partei in Thüringen und Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft wird. Ich glaube, das hat sehr viel mit Bildung zu tun, mit Hintergrundwissen und der Herausforderung, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Das ist keine einfache Aufgabe. Trotzdem müssen und werden wir da dranbleiben. Die Schule ist der Ort, wo alle Kinder und Jugendlichen hingehen, und sie ist der Ort, wo sie die Heterogenität der Gesellschaft erleben und als Wert begreifen können.
Damit Schule gelingt, ist das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen grundlegend. Der Ampel-Koalitionsvertrag auf Bundesebene versprach hier spürbare Verbesserungen (hier zum Download, Seite 74), ebenso ein Beschluss der SPD Ende 2023 (hier zum Download, Seite 4). Wieso sehen wir davon nichts?
Wir arbeiten mit den Kommunen schon sehr gut im Bereich der Bildung zusammen, nehmen Sie beispielhaft die Digitalisierung und den Kita-Ausbau. Auch die Kommunen nehmen viel Geld in die Hand. Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass der Bund die Verantwortung, die er ja auch in der vorherigen Legislaturperiode übernommen hat, wieder stärker wahrnimmt. Der kooperative Föderalismus ist das richtige Modell. Aber dazu gehört es eben auch, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren.
Diskutieren Länder und BMBF gerade auf Augenhöhe?
Dass die Diskussionen um die Fortsetzung des Digitalpaktes und auch zum Startchancen-Programm schwierig waren und sind, ist kein Geheimnis. Es ist wichtig, dass man vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet und sich aufeinander verlassen kann. Wir sehen, denke ich, beiderseits die Nöte und auch die Schwierigkeiten in den jeweiligen politischen Rollen und auch die tatsächlichen Gegebenheiten.
Das Startchancen-Programm hat ein Volumen von 20 Milliarden Euro. Bund und Länder steuern je die Hälfte bei. Recherchen von Table.Briefings legen nahe, dass die Länder allerdings wenig frisches Geld in das Programm geben. Sie nutzen vorwiegend die Möglichkeit, laufende Maßnahmen anrechnen zu lassen.
Die Länder investieren viel in die Bildung, deshalb halte das nicht für ein Thema, das man skandalisieren kann. Als ich 2016 anfing, hatte das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz einen Haushalt von rund 4,2 Milliarden Euro, im nächsten Jahr liegt er bei mehr als 6,4 Milliarden Euro. Wir gehören damit zu den Ländern, die schon viel im Bereich der Bildungsgerechtigkeit getan haben, auch mit zusätzlichen Geldern. Diese Länder dürfen beim Startchancen-Programm nicht bestraft werden. In Rheinland-Pfalz etwa gibt es seit 2020 das Programm “S4 – Schule stärken, starke Schule’. Alle S4-Schulen werden jetzt zu Startchancen-Schulen. Das Startchancen-Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren und beginnt jetzt. In den aktuellen Länderhaushalten, darunter wie auch in Rheinland-Pfalz einige Doppelhaushalte, konnte noch keine Vorsorge getroffen werden. 2029 wird eine erste Bilanz gezogen, dann müssen Ländern und Kommunen die vereinbarten Summen auf den Tisch gelegt haben.
Lesen Sie auch: Startchancen – Warum das 20-Milliarden-Euro-Programm viel kleiner ausfällt
Die oft gehörte Formel “20 Milliarden Euro, zehn Jahre, 4.000 Schulen” suggeriert aber, dass hier frisches Geld in die Schulen fließt.
Tatsache ist: Am Ende nehmen wir zusammen wirklich 20 Milliarden Euro in die Hand. Das bedeutet, dass zum Beispiel Programme, die vielleicht sonst ausgelaufen wären, in den Ländern fortgesetzt werden. Wir finanzieren zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im Bereich der Schulsozialarbeit mit, ebenso bei Programmen für die Ferien, die sogar ausgebaut werden. Dieses Geld ist nicht fiktiv, es steckt in den Schulen, kommt Lehrerinnen, Lehrern und multiprofessionellen Teams zugute. Das Programm stärkt uns zudem den Rücken, denn trotz angespannter Haushaltslage ist vieles im Bildungsbereich unverzichtbar.
Braucht es auch ein Startchancen-Programm für Kitas?
Wir müssen auch bei den Kitas die Leistungen viel stärker von einem Sozialindex abhängig machen. Ich finde, dass man Kitas je nach sozialräumlicher Lage unterschiedlich behandeln sollte. Rheinland-Pfalz hat das schon getan und mit dem Kita-Gesetz 2021 ein Sozialraumbudget eingeführt. Damit finanziert das Land weiteres Personal mit, etwa für Kita-Sozialarbeit, interkulturelle Fachkräfte oder Französischkräfte. Ich glaube, dass wir genau diesen Weg weitergehen müssen.
Finden Sie, dass die Kitas grundsätzlich in Bildungsministerien gehören?
Ich finde ja, Kitas gehören in die Bildungsministerien. In Rheinland-Pfalz ist das seit 2016, mit meinem Amtsantritt, wieder der Fall. Und wir sind mit der KMK während meiner Präsidentschaft im Jahr 2020 einen eher unauffälligen, aber fast revolutionären Schritt gegangen, als wir beschlossen haben, auch die frühkindliche Bildung, den Übergang von der Kita in die Grundschule, mit in den Blick zu nehmen. Wir brauchen eine einheitliche Bildungskette. Kita ist keine Schule und Schule ist keine Kita. Aber die Systeme müssen sich annähern und verzahnen und dabei ihre Fachlichkeit behalten. Das als völlig selbstverständlich anzusehen, gelingt einfacher, wenn beide Systeme in einem Ministerium unter einem Dach sind und nicht in zwei getrennten Ministerien.

Angesichts unbesetzter Ausbildungsstellen in Deutschland und Jugendlichen, die gleichzeitig keine Lehre beginnen, stellt sich die Frage, wo es in der Ausbildung besser läuft. Helfen kann hier der Blick in die Schweiz. Dort lernt ein noch größerer Anteil der Azubis dual – und die Ausbildung hat Experten zufolge deutlich weniger unter der Pandemie gelitten. Insgesamt gilt die berufliche Bildung bei unseren Nachbarn als attraktiver.
Zwar gibt es auch in der Schweiz Passungsprobleme, wie hierzulande vor allem in der Gastronomie und der Baubranche. Zehn Prozent der Lehrstellen waren zuletzt unbesetzt. In Deutschland waren es laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2023 sogar 35 Prozent. Wie in Deutschland mache sich der demografische Wandel bemerkbar, sagt Sonja Engelage, Senior Researcherin der Abteilung Forschung und Entwicklung an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB). Er werde allerdings durch eine relativ hohe Migrationsquote abgefedert – allein 324.000 deutsche Staatsbürger lebten 2023 in der Schweiz.
Im Nachbarland beginnen mehr Jugendliche direkt eine Ausbildung: Über 60 Prozent der Jugendlichen starten laut EHB nach der neunten Klasse in eine Berufslehre. Nur ein Viertel gehe aufs Gymnasium und mache direkt die Matura, also das Abitur – da die Kantone lenkend eingreifen, etwa durch Aufnahmetests oder Lehrerempfehlungen. Zwar lassen sich Deutschland und die Schweiz nur begrenzt vergleichen – in Deutschland etwa machen direkt mehr Jugendliche das Abitur, fast die Hälfte eines Abiturientenjahrgangs beginnt nach Berechnungen des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie aber auch eine Lehre. Dennoch lassen sich Erfolgsfaktoren vom Schweizer Vorbild ableiten.
Lesen Sie auch: Zur Krise am Ausbildungsmarkt: Es braucht tiefergehende Analysen
“Deutschland hat seit den 1990er-Jahren stärker auf Akademisierung gesetzt, die Schweizer Politik hat der Berufsbildung einen hohen Stellenwert eingeräumt”, sagt Sonja Engelage. 2004 wurde gesetzlich festgeschrieben, dass Berufs- und Allgemeinbildung andersartig aber gleichwertig sind. “Bis heute setzen Politiker und Verbände sich dafür ein, dass die Berufsbildung nicht ,verakademisiert’ werden dürfe.” Für kritisch hält Engelage aber, dass beide Berufswege so auch gegeneinander ausgespielt würden.
Politiker wie der ehemalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann, von 2010 bis 2018 im Amt, verstünden es, das Image der Berufsbildung zu pflegen. Eine Initiative, die der Bund mit unterhält, verantwortet nationale Image-Kampagnen. “Regelmäßig werden hier im ganzen Land Plakate aufgehängt, die junge, fröhliche Menschen zeigen, die eine tolle Berufsausbildung machen”, sagt Engelage. Im Fernsehen gibt es Werbefilme für die Lehre. Ein Erfolgsfaktor: Die Werbung spricht auch Eltern an und vermittelt, dass ein Kind nicht aufs Gymnasium gehen muss, um erfolgreich zu sein.
Seit 30 Jahren können Schweizer begleitend zur Lehre oder im Anschluss eine Berufsmatura erwerben, mit der sie an einer Fachhochschule studieren können. Wer an die Universität will, kann in einer einjährigen “Passerelle” noch die eidgenössische Matura nachholen. In Deutschland gibt es zwar auch Möglichkeiten, Lehre und Abitur zu verbinden. Diese sind jedoch oft wenig bekannt und werden weniger genutzt.
Auf der anderen Seite gibt es auch in der Schweiz für Jugendliche, die nicht gleich den Weg in eine Ausbildung finden, sogenannte Brückenangebote. Anders als in Deutschland der Übergangssektor sind sie jedoch relativ effektiv. Die meisten Jugendlichen kommen nach einem Jahr in eine reguläre Berufsbildung, wozu Engelage zufolge Angebote mit vielen Praxiserfahrungen in Betrieben beitragen. “Für besonders erfolgreich halte ich aber eine verkürzte Berufsausbildung für Jugendliche, die sprachliche Probleme oder Lernschwierigkeiten haben.” Dieser vereinfachte Bildungsgang dauert zwei Jahre und wird für rund 60 Berufe angeboten, etwa in der Gastronomie und im Pflegebereich.
Das Besondere: Die Grundbildung findet überwiegend dual statt und endet mit einem anerkannten Abschluss, dem eidgenössischen Berufsattest. Danach können die Jugendlichen im erlernten Beruf arbeiten oder sie steigen noch in die reguläre Ausbildung ein, ein Lehrjahr können sie sich dann anrechnen lassen. “Das Credo lautet: Kein Abschluss ohne Anschluss.”
Die Vertragslösungsquote von Azubis ist in der Schweiz hoch: Im Schnitt liegt sie bei 20 Prozent. In Deutschland waren es 2022 sogar fast 30 Prozent. Sehr viele Jugendliche in der Schweiz, schätzungsweise 80 Prozent, beginnen allerdings schnell eine neue Lehre. In Deutschland sollen es weniger sein, laut Schätzungen mindestens 50 Prozent.
Ein möglicher Grund: In der Schweiz haben die Kantone die Lehraufsicht inne und sie haben Stellen für Ausbildungsberater oder Berufskommissare eingerichtet, die zwischen Lernenden und Betrieben vermitteln und den Jugendlichen auch helfen können, eine neue Lehrstelle oder einen neuen Betrieb zu finden. Zudem seien viele Betriebe bereit, Jugendliche aufzunehmen, sichtbar etwa in “Wir bilden aus”-Aufklebern an vielen Eingangstüren. “Es gibt hierzulande einen Betriebsstolz, dass die Ausbildung einfach dazugehört.” Das sei auch eine Folge der öffentlichkeitswirksamen Pflege der Berufsbildung.
Auch in der Schweiz fehlt Lehrpersonal, jedoch nicht in den Berufsfachschulen. Denn: Viele beruflich Tätige arbeiten nebenberuflich als Lehrkraft. “Es gibt ganz flexible Arbeitszeitmodelle und gute Möglichkeiten, zum Berufsfachschullehrdiplom zu kommen, auch für Nicht-Akademiker”, sagt Engelage. Neben diesen Rahmenbedingungen liegt es in ihren Augen vor allem an einer hohen Motivation vieler Praktiker, Wissen weiterzugeben.”Manche sehen es als zusätzliche, sicherer Verdienstquelle. Die meisten machen es aber aus einem großen Berufsstolz heraus.”
Fobizz, eine Plattform für Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte, ist eine Partnerschaft mit 13 EdTech-Anbietern eingegangen. Lehrkräfte, die sich bei Fobizz einloggen, haben über die Plattform ab sofort Zugang zu den Partnerunternehmen. Damit möchte Fobizz ein “EdTech-Ökosystem” schaffen, das mit Single Sign-On funktioniert.
“Es gibt bereits so viele tolle Inhalte und Programme, aber Lehrerinnen und Lehrer verbringen noch viel zu viel Zeit damit, diese zu suchen”, sagt Jeyran Sanee-Khonsari, Chief Strategy Officer bei Fobizz zu Table Briefings. Man wolle daher die Angebote bündeln und gleichzeitig kuratieren. “Unser Ziel ist es, möglichst viele Nutzungsanlässe abzudecken“, sagt Sanee-Khonsari. Gab es für einen Anwendungsbereich mehrere Wettbewerber, habe man nach internen Kriterien entschieden, wer die bessere Ergänzung für Fobizz sei.
Einheitliche Prüfkriterien habe es bei der Auswahl der Partnerunternehmen nicht gegeben, sagt Sanee-Khonsari. “Wir haben aber sowohl auf die didaktische und pädagogische Qualität geachtet als auch darauf, dass die Produkte datenschutzkonform sind.” Dabei habe man auf bereits vorhandene Gütesiegel oder den Entwicklungsprozess geschaut.
Zu den Partnern gehören beispielsweise “to teach”, eine Anwendung, mit der Lehrkräfte mithilfe Künstlicher Intelligenz Übungsaufgaben und Lerninhalte erstellen können oder der Carlsen Verlag, ein deutscher Kinder- und Jugendbuchverlag. Auch Nutzer, die keine Lizenz für Fobizz haben, können auf die externen Inhalte zugreifen. “Die Partnerunternehmen bieten kostenlose Probeversionen von 30 bis 90 Tagen an”, erklärt Sanee-Khonsari. Nach diesem Zeitraum wechseln Nutzer zu einer Basisversion – es drohe keine Abofalle.
Mit manchen Partnern, wie dem Mathematik-Lernsystem Bettermarks, bestehe nur eine Content-Partnerschaft. Das heißt, hier bekommen die Nutzer keinen Zugang zum gesamten Angebot, aber zumindest einzelne Inhalte zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus entwickelt Fobizz für die neu angedockten Anbieter Fortbildungen, die Lehrkräften mit deren Funktionen und Anwendungen vertraut machen sollen. Weitere Partnerschaften seien bereits in Planung, erfuhr Table.Briefings. vkr
Knapp 300 Personen aus Wissenschaft, Fachpraxis und von Fachverbänden fordern in einem offenen Brief, dass die politisch Verantwortlichen schnell Maßnahmen gegen die dramatische Lage in den Kitas ergreifen. “Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in Deutschland ist stark belastet und steht kurz vor dem Kollaps”, heißt es in dem Brief.
Pädagogische Fachkräfte in den Kitas gehörten zu den Berufsgruppen mit den meisten Krankentagen, insbesondere wegen Erkrankungen der Psyche, erklärte die Pädagogik-Professorin Rahel Dreyer. “Die psychische Gesundheit der Fachkräfte wirkt sich nachweislich auf die Gesundheit der Kinder aus.”
Dreyer ist eine von vier Personen, die den Aufruf gestartet haben. Es sind:
Insgesamt stellen sie und der breite Kreis der Unterstützer sechs Forderungen an die politisch Verantwortlichen. Dazu zählt, “den erreichten Stand der Investitionen in Qualität und Qualitätsentwicklung in den Ländern unter keinen Umständen zurückzufahren, sondern zusätzliche Mittel für weitere Qualitätsverbesserungen zu verwenden”. Zudem fordert die Initiative, in Bundesländern, in denen ein Rückgang der Kinderzahlen zu verzeichnen ist, die Situation zu nutzen, um den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern.
Und sie drängt darauf, “das im Koalitionsvertrag vereinbarte Qualitätsentwicklungsgesetz mit einer kontinuierlichen finanziellen Förderung des Bundes und einheitlichen Qualitätsstandards jetzt auf den Weg zu bringen”. Der Entwurf aus dem Bundesfamilienministerium von Lisa Paus hatte hier für viel Kritik gesorgt.
Der Termin der Veröffentlichung des Briefes ist nicht zufällig. “Wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, weil nun die Befassung mit dem geplanten Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz im Parlament ansteht und wir uns erhoffen, noch darauf Einfluss nehmen zu können”, sagte Dreyer Table.Briefings. Der aktuelle Gesetzentwurf sei sehr weit weg von dem, was sich die Koalition eigentlich vorgenommen hat und was eigentlich notwendig wäre.
Lesen Sie auch: Kita-Qualität – Warum Familienministerin Paus mit dem Koalitionsvertrag bricht
Zu Wochenbeginn hatte bereits die Kita-Kampagne “Jedes Kind zählt”, für die mehr als 220.000 Personen unterschrieben haben, ihre Sorge formuliert, erst im Petitionsausschuss des Bundestages angehört zu werden, wenn das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz Mitte Oktober möglicherweise bereits beschlossen worden ist. Dreyer kann die Sorge “absolut nachvollziehen”, erklärte sie. “Ich hoffe daher sehr, dass es gelingt, dass ein Anhörungstermin noch rechtzeitig vorher zustande kommt und auch der geplante Aktionstag am 20. September etwas bewirken wird.” Holger Schleper
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf für eine bundesweit einheitliche Ausbildung von Assistenzkräften in der Pflege verabschiedet (zum Download). Sie soll künftig 18 Monate dauern. Weder folgt die Ampel damit der Forderung nach 24 Monaten Ausbildungszeit des Deutsches Pflegerates, einem Dachverband großer Berufsverbände. Noch kommt sie den Arbeitgebern entgegen, die empfahlen, die Ausbildung auf ein Jahr zu verkürzen.
Lesen Sie auch: Pflegeassistenz: Was Verbände am Ampel-Plan für eine neue Ausbildung kritisieren
Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, sagte, die Regierung habe “die Chance verpasst, schnelle Entlastung für Pflegekräfte und pflegende Angehörige zu schaffen”. Aufgrund von fehlendem Personal stünden viele Familien unter großem Druck. “Es macht einen großen Unterschied, ob Hilfe nach 12 oder erst nach 18 Monaten verfügbar ist.”
Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, fürchtet hingegen, dass Azubis in 18 Monaten nicht “die notwendigen theoretischen und praktischen Kompetenzen” erwerben können. Langfristig werde das Gesetz zu hohen Kosten für Nachqualifizierungen führen, Pflegeassistenten könnten Pflegefachkräfte ansonsten nicht entlasten.
Ziel der Reform ist es, dass der Beruf attraktiver wird und Pflegeassistentinnen und -assistenten künftig neben der Pflegearbeit, die sie leisten, auch einen Teil der medizinischen Behandlungspflege übernehmen können. Das soll helfen, den Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern.
Künftig sollen außerdem alle Azubis vergütet werden. Nur die Hälfte hat bislang Anspruch auf eine Vergütung – das variiert in den 27 unterschiedlich geregelten Ausbildungen der Länder, die es laut Bundesinstitut für Berufsbildung gibt. Als Orientierungsgröße für eine künftige bundesweite Vergütung sprach Bundesfamilienministerin Lisa Paus von 1.000 Euro monatlich. Zugleich wies die Ministerin aber darauf hin, dass es nicht die Kompetenz der Bundesregierung sei, Ausbildungsvergütungen festzusetzen. Im neuen Entwurf ist von Mehrkosten in Höhe von etwa 95 Millionen Euro die Rede. Anna Parrisius
Die Hamburger Elterninitiative G9 Hamburg e.V. startet am 10. September erneut eine Unterschriftensammlung für die Rückkehr zu G9 an Hamburger Gymnasien. Anfang des Jahres hatte eine Volksinitiative mit knapp 14.000 Unterschriften die geforderten 10.000 deutlich übertroffen. Nun geht es im zweiten Schritt um ein Volksbegehren. Eintragen können sich alle Wahlberechtigten der Hansestadt, so Sammar Rath, eine der Initiatorinnen im Gespräch mit Table.Briefings. G9 Hamburg wolle den basisdemokratischen Weg nutzen, um den Gymnasialschülern wieder mehr Zeit zum Lernen zu verschaffen, für mehr Bildungsgerechtigkeit zwischen den G8- und G9-Ländern zu sorgen und die Spätfolgen der Pandemie im Bildungssystem zu kompensieren, so Rath.
Die Hamburger Schulbehörde sieht hingegen keinen Grund, den vor 14 Jahren vereinbarten Schulfrieden wieder aufzukündigen. Er habe erfolgreich verhindert, dass “Hamburg sich in endlosen und fruchtlosen Schulstrukurdebatten verstrickt”, so die Behörde auf Anfrage von Table.Briefings. Sie argumentiert, dass es in Hamburg bereits zwei gleichwertige Wege zum Abitur gebe. Wer mehr Zeit brauche oder wolle, könne eine der 87 Stadtteilschulen (davon 23 private) besuchen. In deren “Oberstufen können die Schülerinnen genau wie von der Initiative gewünscht, ein Abitur ablegen mit all den Vorteilen, die diese darin sieht”, so ein Sprecher. Damit habe in Hamburg jeder die Chance nach seiner Leistung und seinem Tempo ein Abitur zu machen.
Auch die Hamburger Elternkammer, in der sich Mütter und Väter von Kindern in allen Hamburger Schulformen organisiert haben, unterstützt die Initiative nicht. In einer Stellungnahme macht sie deutlich, dass sie “eine alleinige Konzentration auf die Gymnasien nicht als die Lösung für eine verbesserte Schulbildung in Hamburg” betrachte. Die Schülerinnen- und Schülerkammer der Hansestadt positionierte sich ebenfalls gegen das Volksbegehren. Mit einer Rückkehr zu G9 werde die Unterteilung von Gymnasien als Eliteschulen und der Stadtteilschulen als Schulen “für alle anderen” vorangetrieben, erklärte sie gegenüber der dpa.
Sammar Rath und ihr Verein halten hingegen an ihren Zielen fest. Ausgestattet mit Klemmbrettern werden sich etwa 100 ehrenamtliche Aktivisten bis zum 30. September vor Schulen und in Fußgängerzonen stellen und für mehr Zeit für Bildung werben, kündigt Rath an. Für ein erfolgreiches Volksbegehren, das dann im dritten Schritt eine Volksbefragung zur Folge hätte, liegt die Hürde nun ungleich höher. Ein Zwanzigstel der wahlberechtigten Hamburger muss unterzeichnen. Das entspricht derzeit rund 66.000 Bürgerinnen und Bürgern.
Konnte für die Volksinitiative noch die Online-Plattform Open Petition genutzt werden, ist dieser Weg nun versperrt. Für das vom Senat durchgeführte Volksbegehren müssen die Unterschriften physisch vorliegen, kritisiert Rath. “Das ist in einer digitalen Welt nur schwer nachzuvollziehen und für uns eine zusätzliche Hürde, die Eltern gut zu erreichen.” Allerdings ist auch eine Briefwahl möglich. Sandra Hermes
Rund 404 Millionen Schüler waren von Januar 2022 bis Juni 2024 von Schulschließungen aufgrund von Extremwetterereignissen betroffen. Das zeigt ein neuer Bericht der Weltbank (zum Download). Mindestens 81 Länder mussten demnach den Präsenzunterricht wegen Flutkatastrophen, Hitzewellen, Stürmen oder anderen Unwettern ausfallen lassen. Besonders stark traf es Niedriglohnländer. Sie verloren im Schnitt jährlich 18 Tage Unterricht. In Pakistan waren es in den eineinhalb untersuchten Jahren sogar 97 Tage – fast die Hälfte eines typischen Schuljahres. Einkommensstarke Länder verzeichneten hingegen im Schnitt nur 2,4 Tage Schulausfall im Jahr.
Auch wenn die Schulen geöffnet bleiben, können schon steigende Temperaturen negative Effekte auf den Lernerfolg eines Kindes haben. Für Brasilien beziffern die Forscher den Verlust für jene Schüler, die in der ärmeren Hälfte der brasilianischen Gemeinden leben, auf bis zu ein halbes Jahr Lernzeit. Auf lange Sicht könne das für die Schüler zu einem geringeren Einkommen und weniger Produktivität führen und Ungleichheiten verstärken. Auch zahlreiche andere Auswirkungen des Klimawandels können die Lernerfolge junger Menschen mindern, etwa Luftverschmutzung.
Trotz dieser negativen Auswirkungen spielt das Bildungssystem für die Klimapolitik bislang oft keine oder nur eine geringe Rolle. In einer Untersuchung von 14 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau bescheinigen die Autoren des Weltbankberichts nur vier Ländern, Bildungsmaßnahmen tiefergehend in ihre Klimapolitik einzubeziehen. Laut OECD entfielen 2020 nur etwa 1,3 Prozent der klimabezogenen bilateralen Entwicklungshilfe auf den Bildungssektor.
In einer Online-Umfrage unter 103 Bildungspolitiker aus 33 Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommensniveau sagten zwar 87 Prozent, Bildung könne dabei helfen, dass Schüler gegen den Klimawandel aktiv werden. Nur ein Drittel glaubt jedoch, dass ihr Bildungssystem die Schüler schon gut genug über den Klimawandel unterrichte.
“Die vielversprechende Nachricht ist, dass es viele kostengünstige Schritte gibt, die Regierungen ergreifen können, um Bildung und Lernen für den Klimaschutz nutzbar zu machen und gleichzeitig die Bildungssysteme an den Klimawandel anzupassen”, sagte Luis Benveniste, globaler Direktor für Bildung bei der Weltbank. Bereits 18,51 US-Dollar pro Kind könnten dabei helfen, dass Schüler trotz des Klimawandels gute Lernfortschritte machen. Einkommensschwache Länder müssten ihre Ausgaben pro Schüler dafür jedoch um rund ein Drittel steigern. Das Geld müsste etwa dafür eingesetzt werden, die Temperatur im Klassenzimmer zu senken, Möglichkeiten zum Fernunterricht zu erhöhen und die Ausbildung von Lehrkräften zu verbessern.
Der Bericht zeigt auch, dass viele junge Menschen sich Green Skills aneignen möchten. In einer Umfrage unter 17- bis 35-Jährigen in Angola, Bangladesch, China, Kolumbien, Indien, Kasachstan, dem Senegal und Tansania gaben fast zwei Drittel an, dass ihre Zukunft von Green Skills abhängt. Gleichzeitig denken 60 Prozent, in der Schule nicht genug über den Klimawandel gelernt zu haben. Anna Parrisius

Wer den Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Stephan Albani (CDU) besser kennenlernen möchte, der sollte mit seiner Homepage anfangen: “Albani in Aktion” – diesen Namen trägt eine Aktionsreihe, die man hier findet. Immer, wenn Stephan Albani “in Aktion” tritt, dann absolviert er eintägige Praktika in den unterschiedlichsten Berufen und berichtet darüber.
Auf den Fotos im Internet erscheint der Bundestagsabgeordnete als Paketbote, als Gebäudereiniger
oder als Maurer. Oder man kann beobachten, wie er als Hilfskraft im Verpflegungsamt der Bundeswehr in Oldenburg Mahlzeiten verpackt. Diese Bilder erzählen viel darüber, was für ein Politiker der 55-jährige Diplom-Physiker sein will: Nicht theoriegeleitet und abgehoben, sondern praxisnah und kompetent.
Auch im Gespräch mit dem gebürtigen Göttinger wird schnell klar, dass Albani sich gern als jemand darstellt, der die Ärmel hochkrempelt: “Geht nicht gibt’s nicht” sei so etwas wie sein Lebens- und Arbeitsmotto. Eines seiner “Herzensthemen”, sagt Albani, sei die “Stärkung der beruflichen Bildung”.
Seit 2018 ist der Physiker für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Berichterstatter für berufliche Bildung. “Ich habe einen tiefen Respekt vor der Leistungsfähigkeit eines jeden”, sagt er. “Mein großes Ziel ist, eine wirkliche und sachangemessene Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung zu erreichen, ohne sie gleich machen oder gar akademisieren zu wollen.”
Albani selbst standen in seiner beruflichen Karriere viele Wege offen. Schon als Student, der sich in den Semesterferien in einem Hamburger Medizintechnik-Unternehmen etwas dazuverdiente, habe er die Vorzüge eines “freiheitlichen Führungsstils” erfahren. “Jeder hat die Kompetenzen, die er sich erarbeitet hat, hieß es dort damals immer” – davon sei er sehr geprägt worden.
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer war dann nicht mehr weit. Nach seinem Physik-Studium arbeitete Albani zunächst in der medizinischen Forschung und gründete dann drei Firmen im Life-Sience-Sektor. Zum Beispiel war der Physiker Mitgründer des Hörzentrums Oldenburg GmbH, einem Unternehmen auf dem Gebiet der audiologischen Forschung und Hörsystemevaluation. Was ihn in die Politik zog, waren aber die Hindernisse in seiner Karriere, die er zum Beispiel im Zusammenhang mit seinen Firmengründungen erlebt habe, erzählt er im Gespräch: “Da gab es immer wieder Stolpersteine, hin und wieder auch mal eine Fußfessel. Diese Dinge verändern oder zumindest beeinflussen zu können, macht für mich den Reiz von Politik aus.”
2013 glückte dem CDU-Politiker etwas, woran viele scheitern – für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland zog er als politischer Quereinsteiger in den Bundestag ein. In den wissenschafts- und bildungspolitischen Debatten ist Albani seitdem eine feste Größe. Er ist Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
Albani plädiert dafür, den Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), der berufliche und akademische Bildungswege miteinander vergleichbar macht und Qualifikationen einordnet, zu verrechtlichen. Und er setzt sich für eine verbesserte Berufsorientierung ein, zuvorderst durch eine nationale Qualitätsoffensive Berufsorientierung, durch die mehr Jugendliche erreicht werden sollen.
Lesen Sie auch: Azubi-Campus: Wie die Unionsfraktion die berufliche Bildung stärken will
Daneben äußert Stephan Albani sich immer wieder kritisch zu Sparmaßnahmen im Wissenschaftsbetrieb “Wissenschaft und Innovation werden der Schlüssel zu vielen Herausforderungen sein, die wir gerade haben”. Statt zu kürzen, will Albani Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung bringen, eine Trennung zwischen Grundlagen- und angewandter Wissenschaft hält er für wenig sinnvoll. “Forschung – von der
Grundlagen- bis zur angewandten Forschung – kann, als Prozesskette verstanden, mittel- bis langfristig einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen”.
In der wissenschaftlichen Community bekomme er aktuell von einer “großen Unsicherheit” mit. “Diese Unsicherheit hat neben den Sparmaßnahmen auch mit den Gesetzesvorhaben zu tun, die, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die DATI oder das Startchancen-Programm viel zu lange gedauert haben.” Deren Ende, so Albani, “war immer wieder unklar und ist es leider auch noch immer.” Gabriele Voßkühler
Research.Table: Back to Berlin – Ein forschungspolitisches Update für den Herbst . Die Sommerpause ist so gut wie vorbei. Gesetze und Strategien wollen jetzt fortgeschrieben oder endlich verabschiedet werden. Weiter debattiert wird der Umgang mit Antisemitismus an Hochschulen – und in der Fördermittel-Affäre wird Bundesministerin Stark-Watzinger kommende Woche im Ausschuss befragt. Wir fassen für Sie zusammen, welche Themen aktuell im Fokus stehen und welche Entscheidungen in Kürze getroffen werden müssen. Mehr lesen Sie hier.
China.Table: Wie steht Xi Jinping zum Thema Bildung? Die Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas, Qiushi, veröffentlichte Anfang dieser Woche Xi Jinpings Regierungsphilosophie der Partei zum Thema Bildung und warnt darin vor einer Verwestlichung der Jugend. Die ideologische Erziehung in Chinas Schulen und Universitäten besteht aus Unterricht zur “Theorie des Marxismus” und der Theorie des “Sozialismus chinesischer Prägung” und dem Geschichtsunterricht. Xis Position lesen sie hier.
Research.Table: Edelgard Bulmahn sagt im Interview, dass die Exzellenzstrategie fortgesetzt werden und der Bund an der Finanzierung der Universitäten beteiligt werden soll. Alle reden über die Exzellenzstrategie, sie hat sie erfunden. Im Interview mit Table.Briefings erläutert Ex-Forschungsministerin Edelgard Bulmahn die Ziele und Erfolge des Wettbewerbs – und was sich im Wissenschaftssystem sonst noch ändern muss. Mehr lesen Sie hier.
Zeit: Warum niemand Schulleiter werden will. Viele Schulleiterstellen bleiben unbesetzt. Schulleiter und Lehrkräfte, die in Ermangelung eines Nachfolgers deren Aufgaben übernehmen, berichten vielfach von Überlastung. Es gebe viele bürokratische Aufgaben und vor allem Anforderungen, auf die ein Lehramtsstudium nicht vorbereite. Auch die Bezahlung ist kaum besser als die einer Lehrkraft ohne Leitungsverantwortung. (Und dann zeigte der Vater einer Viertklässlerin ihn an)
SZ: Gene und motivierte Lehrer können Schulnoten beeinflussen. Gute Schulnoten sind nicht nur ein Ergebnis von Intelligenz oder einem guten Elternhaus. Das zeigte eine neue Studie aus der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour. Ähnlich einflussreiche Faktoren seien auch Neugier, Motivation und Hartnäckigkeit. Zum Teil seien diese Faktoren auch genetisch bestimmt. Daneben könne die Motivation von Lehrern oder Eltern Kinder anstecken und ihnen so zu besseren Leistungen verhelfen. (Der Schlüssel zum Lernerfolg)
NOZ: Die Gewalt an Deutschlands Schulen hat deutlich zugenommen. Bundesweit habe sich die Zahl der gemeldeten Vorfälle von 21.570 im Jahr 2022 auf 27.470 im Jahr 2023 erhöht. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich dabei auf Zahlen aus den einzelnen Bundesländern. Die Autoren räumen ein, dass ein direkter Vergleich der Zahlen nur bedingt möglich sei. Denn in den Bundesländern gibt es “unterschiedliche Definitionen von Gewalt, variierende Meldepraktiken und unterschiedliche Datenerhebungsmethoden”. Einen Anstieg gebe es aber in allen Ländern. Besonders alarmierend sei die Entwicklung in Schleswig-Holstein mit einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent. (Immer mehr Gewalt an Schulen: In diesen Bundesländern ist die Lage am schlimmsten)
Stuttgarter Nachrichten: Berufsschulen im Ländle beklagen Schulabsentismus. Immer mehr Berufsschüler bleiben dem Unterricht fern, das ist laut Berufsschullehrerverband der Eindruck von Lehrkräften. Berufsschulpflichtige Jugendliche kämen nach Abschluss oder Abbruch der allgemeinbildenden Schule gar nicht an der Berufsschule an oder tauchten während des Schuljahres ab. Konkrete Zahlen nannte der Verband nicht. Als möglichen Grund nannte er Folgen der Pandemie und psychische Belastung. Für die Schulen brauche es mehr Unterstützung, um Jugendliche aufzufinden. (Berufsschullehrer registrieren Zunahme an Schulschwänzern)
Frankfurter Rundschau: Immer mehr Azubis müssen berufsferne Aufgaben übernehmen. Ihre Zahl stieg zuletzt auf 15,3 Prozent. Im Maler- und Lackiererhandwerk müssen sogar 38 Prozent in ihrem Betrieb häufig Aufgaben übernehmen, die nicht Teil ihrer Ausbildung sind. Dazu gehören gering qualifizierte Aufgaben oder Routinetätigkeiten wie Kaffee kochen oder den Müll entsorgen. Erfahrungen wie diese können die Unbeliebtheit der Ausbildung verstärken. (Selbst Schuld am Azubi-Mangel? Gen Z hat keine Lust auf entwürdigende Ausbildung)
Dlf: Wie gerecht sind Frankreichs Schulen? Die öffentlichen Schulen in Frankreich sollen jedem durch Anstrengung und Fleiß den sozialen Aufstieg ermöglichen. Doch ein Fünftel der französischen Schüler besucht trotzdem eine Privatschule. Denn insbesondere bildungsnahe Haushalte legen viel Wert auf die besten Schulen und Nachhilfe. Dies verfestigt soziale Unterschiede: Durchschnittlich erst nach sechs Generationen erreicht ein Mitglied einer einkommensschwachen Familie den durchschnittlichen französischen Lebensstandard. (Enttäuschtes Aufstiegsversprechen)
