Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.
Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.
Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.
Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu. Als Chefredakteur von Table.Briefings will ich Ihnen unser neues Produkt wärmstens ans Herz legen:
Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir mit dem CEO.Table die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive-Briefing für CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.
Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.
Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.
In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen. Und: Wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.
In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.
Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.
Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.
Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier.
Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
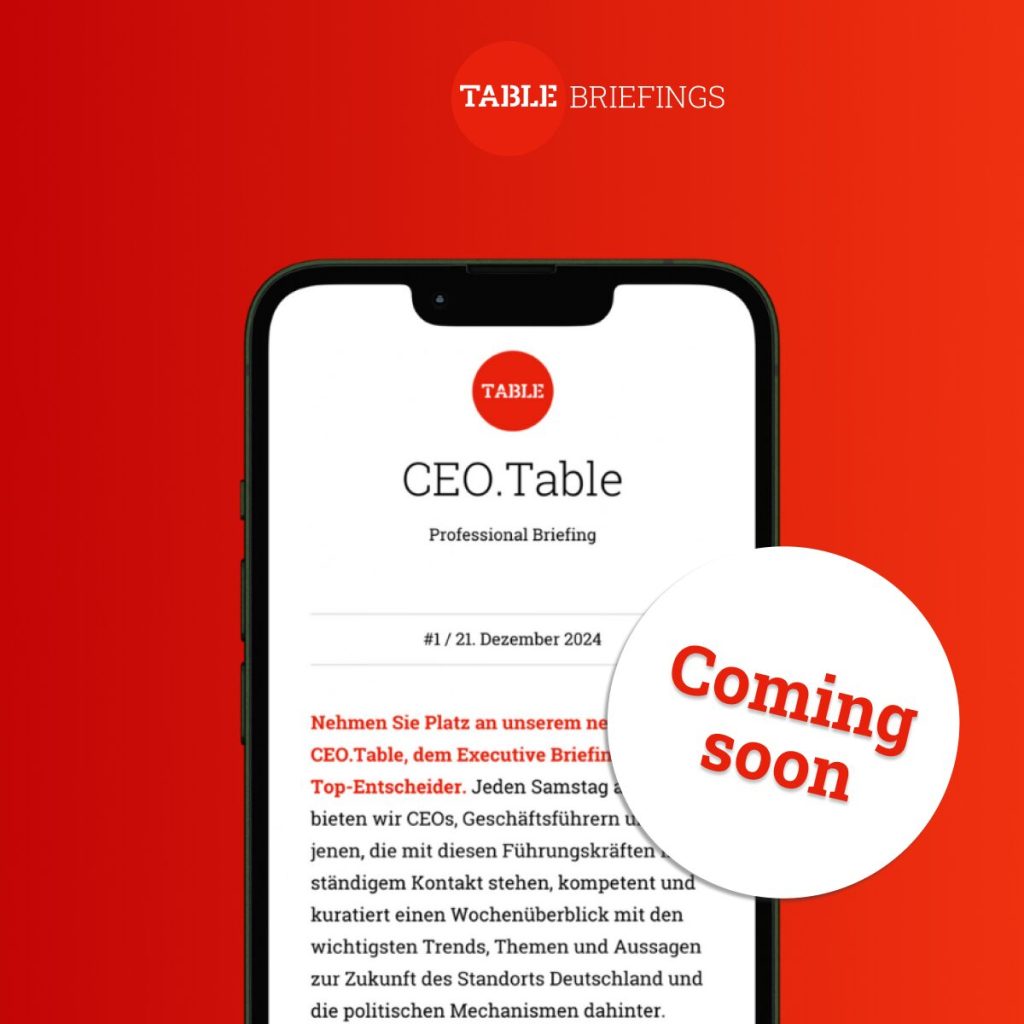

Mit der planmäßig verlorenen Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) tickt jetzt die Uhr. Der 23. Februar 2025 ist ausgemacht für den Tag, an dem sich das Land ein neues Parlament wählt. Seit diesem Dienstag ist auch bekannt, mit welchen Angeboten die drei Parteien, die halbwegs realistische Chancen auf das Kanzleramt haben, in den Wahlkampf ziehen werden. Wir haben die Wahlprogramme von Union, SPD und Grünen auf das Thema Bildung abgeklopft. Ein Überblick:
Union: Sie setzt vor allem auf “Wachstum, Investitionen, Freiräume für unsere Unternehmen und gute Arbeitsplätze”. Dafür will die Union Bürokratie abbauen und Unternehmenssteuern senken. Große Investitionen speziell in Bildung sieht das Programm nicht vor.
SPD: Mit einem “Zukunftspakt Bund” von Bund, Ländern und Kommunen soll unter anderem mehr Geld für Bildung bereitgestellt werden. Helfen soll eine Reform der Schuldenregel, mit der den Ländern mehr finanzieller Spielraum verschafft werden könne. Außerdem sollen “die höchsten Vermögen” stärker belastet werden. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer soll etwa angehoben werden, um mehr Geld in Bildung investieren zu können. Das Geld soll nach sozialen Indikatoren eingesetzt werden.
Grüne: Die Grünen gehen von einem Investitionsstau “im dreistelligen Milliardenbereich” aus. Abhilfe soll ein “Deutschlandfonds für Bund, Länder und Kommunen” schaffen. Daraus sollen auch Kitas und Schulen saniert und Forschung finanziert werden, die die “Technologien und den Wohlstand von morgen begründen”.
Daneben wird ein “Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung” zusammen mit Ländern und Kommunen vorgeschlagen, das bundesweit “für mehr Chancen- und Generationengerechtigkeit” sorgen soll. Mit dem Geld aus dem Programm sollen “moderne und barrierefreie Schulgebäude mit dichten Dächern, funktionierenden Toiletten und digital ausgestatteten Klassenräumen” bezahlt werden. Außerdem wollen die Grünen mehr Stellen für Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und Inklusion schaffen. Statt allein nach dem “Königsteiner Schlüssel”, soll die Finanzierung “stärker an den tatsächlichen Bedarfen” ausgerichtet werden.
Union: Sie will hier den Fokus neben der digitalen Infrastruktur und digitalen Lehr- und Lernprogramme auch auf die “forschungsbasierte Qualifizierung von Lehrkräften und Schulleitungen” legen. Datenschutz müsse “pragmatisch” gehandhabt werden.
SPD: Der Digitalpakt soll “fortgesetzt und inhaltlich weiterentwickelt” werden.
Grüne: Die Digitalisierung der Schulen wird “als Daueraufgabe von Bund, Ländern und Kommunen” verstanden, in die die Grünen weiter investieren wollen.
Union: Jedes Kind, das eingeschult wird, muss Deutsch können. Darum setzt die Union auf verpflichtende Sprachtests im Vorschulalter. Kinder mit Sprachproblemen will die Union zur Teilnahme an einem vorschulischen Programm in einer Kita, einem Kindergarten oder einer Vorschule “verpflichten“. Zudem will die Union einen “Neustart des erfolgreichen Bundesprogramms Sprach-Kitas” angehen. Die Bildungsforschung soll helfen, “einheitliche Standards zur flächendeckenden Diagnose des Entwicklungsstands aller Drei- bis Vierjährigen” zu schaffen.
SPD: Damit kein Kind ohne ausreichende Sprachkenntnisse in die Schule kommt, soll mit spätestens vier Jahren und zur Einschulung der Entwicklungsstand aller Kinder getestet werden. Wenn nötig, soll dann eine verbindliche Förderung angeboten werden.
Grüne: Sprachförderung soll als “durchgängiger Prozess” angelegt werden, der in der Kita beginnt und sich in der Schule fortsetzt. So soll erreicht werden, dass alle Kinder am Ende der Grundschule sicher lesen, schreiben und rechnen können.
Union: Mit einem nicht näher beschriebenen “Investitionsprogramm” soll Ländern und Kommunen mit dem Ausbau der Betreuungsplätze geholfen werden. Die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten soll verbessert werden.
SPD: Mit einem Startchancen-Programm für Kitas sollen Kitas in benachteiligten Lagen gefördert werden, ähnlich dem Startchancen-Programm für Schulen. Für beides sollen Bundesmittel bereitgestellt werden. Eine “verbindlich zwischen allen Bundesländern” zu vereinbarende Fachkräfteoffensive für Kitas und Schulen soll für den Ausbau von Ausbildungskapazitäten und eine “entlohnte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher” sorgen.
Grüne: Im Kita-Qualitätsgesetz sollen neue, bundesweite Qualitätsstandards festgeschrieben werden. Kitas mit einem “hohen Anteil sozio-ökonomisch benachteiligter Kinder” wollen die Grünen besonders unterstützen. Mit steuerlichen Anreizen sollen Unternehmer bewegt werden, “selbst oder in Kooperation” Kitaplätze zu schaffen.
Union: Will “Anstrengung und Leistung” wieder in den Mittelpunkt stellen, angefangen mit Kernfächern wie Mathematik und Deutsch “bis hin zu den Bundesjugendspielen”. Auf Bundesebene soll es ein “vergleichbares Abitur auf hohem Niveau” geben. “Wir setzen auf aussagekräftige und verbindliche Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebungen.”
SPD: keine spezifischen Angaben.
Grüne: keine spezifischen Angaben.
Union: Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen soll es “individuelle Bildungsmöglichkeiten” geben. Neben Inklusionsangeboten sieht die Union auch Förderschulen als Bestandteil der Bildungswelt. Menschen mit Behinderungen soll zudem der Zugang zu Ausbildung und Arbeit mit “passgenauen Impulsen für einen inklusiven Arbeitsmarkt” erleichtert werden. Dafür sollen die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt als auch Inklusionsbetriebe und Werkstätten gestärkt werden. Letztere böten einen “geschützten Raum”, um sich im Arbeitsleben zu erproben.
SPD: Wird nicht adressiert.
Grüne: Eine “Enquetekommission Inklusion” soll unter Beteiligung von Betroffenen Vorschläge erarbeiten. Das “heutige ausgrenzende Werkstättensystem” soll in Richtung Inklusionsunternehmen weiterentwickelt werden, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten, mindestens nach Mindestlohn entlohnt werden und Rentenansprüche erwerben können. An den Schulen soll es mehr Stellen für Inklusion geben.
Union: Berufliche und akademische Bildung gelten der Union als gleichwertig. Dafür sollen Bund und Länder den Deutschen Qualifikationsrahmen rechtlich verbindlich in einem Staatsvertrag verankern. Den Zugang zum höheren Dienst des Bundes soll auch für Bachelor-Absolventen mit Promotion oder mehrjähriger beruflicher Erfahrung möglich sein.
SPD: Die Ausbildungsgarantie und die Jugendberufsagenturen soll fortbestehen. Die Unternehmen wiederum “müssen ihrer Verantwortung für Ausbildung stärker gerecht werden”. Branchenbezogene Umlagefonds für gute Ausbildung “können dieses Ziel gewährleisten”.
Grüne: Die Grünen halten die berufliche Ausbildung oder ein Studium für “gleichwertige, starke Wege in die berufliche Zukunft”. Sie wollen zudem eine “solidarische Ausbildungsumlage” schaffen, um die “Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittlerer Betriebe zu fördern”. Zur Unterstützung des Handwerks soll die Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung weitergehen. “Außerdem stärken wir Ausbildungsverbünde”, wollen die Grünen schulgeldfreie Ausbildungen, eine “deutliche Anhebung” der Mindestausbildungsvergütung, den geförderten Führerscheinerwerb ermöglichen und eine Lösung
für ein Azubi-Deutschlandticket finden.
Union: Das BAföG soll laut Wahlprogramm “auskömmlich” sein. Die Beantragung soll “unbürokratischer und schneller” gehen. Es sollen Hinzuverdienstmöglichkeiten geschaffen werden. Den Gesetzesvollzug für das Auslands-BAföG “beschleunigen wir und verankern ihn zentral in bundeseigener Verwaltung”.
SPD: Mit einer weiteren BAföG-Reform soll die Höhe der Ausbildungsförderung “regelmäßig an die steigenden Lebenshaltungskosten” angepasst werden. Darüber hinaus soll die Bearbeitungszeit für BAföG-Anträge verkürzt werden.
Grüne: Das BAföG soll existenzsichernd sein, auch mit steigenden Lebenshaltungskosten. Die Freibeträge der elterlichen Einkommen sollen erhöht werden, um das BAföG für mehr Menschen zu öffnen. Für Berufstätige, die beispielsweise einen Meister machen wollen, soll das Aufstiegs-BAföG reformiert werden. Dann soll es das BAföG auch in Teilzeit geben.
Union:
Religion: Der Religionsunterricht wird als “unverzichtbar” eingestuft. Die Union will Religion als ordentliches Schulfach aufwerten.
Daten: Bund und Länder sollen ein “bundesweites Bildungsverlaufsregister über alle Stufen formaler Bildung” schaffen. Die Forschung soll Zugang zu den Daten bekommen. In einem ersten Schritt soll dafür eine “ländergemeinsame datenschutzkonforme Identifikationsnummer” für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt werden, auch Schüler-ID oder Statistik-ID genannt.
Social Media: Die Nutzung soll “schnellstmöglich” wissenschaftlich untersucht werden. Die Union will dann Vorschläge “zur Stärkung von Gesundheit- und Jugendmedienschutz” vorlegen.
Schwimmen: Am Ende der Grundschulzeit soll jedes Kind schwimmen können. Gemeinsam mit den Ländern will die Union eine bundesweite Aktion zum Schwimmenlernen aufsetzen.
Gendern: An Schulen und Universitäten soll auf die Gendersprache verzichtet werden. Ein angeblicher “Gender-Zwang aus ideologischen Gründen” wird abgelehnt. (In einer früheren Version des Textes hatten wir auch der SPD die Forderung nach einem Gender-Verbot zugewiesen. Das war falsch.)
SPD:
Verpflegung: In allen Bildungseinrichtungen soll es “kostenfreie Verpflegung” geben. Zusammen mit den Ländern soll allen Schülerinnen und Schülern “ein gesundes und kostenloses” Mittagessen angeboten werden.
SPD und Grüne:
Wohnen: Das Bundesprogramm Junges Wohnen soll fortgesetzt und aufgestockt werden, um bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende und Studierende zu schaffen.
Von Janna Degener-Storr
Ein Fünftel der Acht- bis 17-Jährigen geben im aktuellen Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung an, psychisch belastet zu sein. Andere Untersuchungen zeigen, dass gerade Berufsschüler im Vergleich zu Gleichaltrigen besonderen Belastungen ausgesetzt sind. In der Lehrkräftebefragung des Schulbarometers aus dem Frühjahr 2024 gaben zwölf Prozent der Lehrkräfte an dieser Schulform an, psychische Probleme oder Belastungen ihrer Schüler zu beobachten – an Gymnasien waren es sieben Prozent.
Eine Rolle spielen dabei neue Herausforderungen in der Ausbildung: Im Betrieb müssen die jungen Menschen acht Stunden am Tag arbeiten, gehen daneben in die Berufsschule. Bei einigen senkt das die schulischen Leistungen. Es bleibt weniger Zeit für Freunde und Ausgleich in der Freizeit, sagt Andrea Spies. Sie ist Vorsitzende der Sektion Schulpsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Eine niedrige Ausbildungsvergütung stehe oft dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und einer eigenen Wohnung entgegen. Die Azubis wohnen dann weiter zu Hause, was Spannungen in der Beziehung zu den Eltern befördert.
Zuletzt sei die Belastung noch gestiegen, meint Schulpsychologin Spies. Defizite im Umgang mit Herausforderungen hätten schon vor der Pandemie zugenommen. “Viele Jugendliche haben zum Beispiel Probleme damit, sich zu konzentrieren, sich selbst zu organisieren und Frustrationen auszuhalten.” Wenn in Kita, Grundschule, weiterführender Schule und Elternhaus kein guter Umgang mit Stress gelernt werde, wirke sich das bis ins Erwachsenenalter aus.
Auch Sven Mohr nimmt in der aktuellen Berufsschülergeneration eine hohe Belastung wahr, die sich nicht allein mit den “normalen” Herausforderungen des Erwachsenwerdens erklären lasse. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung und leitet das Regionale Berufsbildungszentrum in Flensburg.
Ein hoher Anteil der Jugendlichen, sagt Mohr, sei heute etwa im Autismus-Spektrum zu verorten. Andere strebten eine Geschlechtsumwandlung an oder hätten mit dem Wechsel zur Berufsschule ihr Coming Out. Einige litten unter früheren Mobbing-Erfahrungen.
Wie stark die psychische Belastung ist, hängt nach Einschätzung von Mohr auch am Berufszweig: Ein Risiko sei, wenn der Betrieb sich gar nicht oder wenig um den Azubi kümmert, wenn die Vergütung schlecht ist oder der Beruf wenig Anerkennung findet. Ein weiterer Grund für die höhere Belastung von Berufsschülern: Einige besuchen die berufsbildende Schule, um den Schulabschluss nachzuholen, den sie zuvor nicht geschafft haben, teilweise aufgrund längerer Krankheitsphasen.
Der Verein Kopfsachen entwickelt speziell für Berufsfachschulen ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit. Fünf Berufsschulen in Berlin, Köln und Hamburg testen gerade zwei je eintägige Workshops in Ausbildungsgängen für Sozialassistenten und Erzieher. Finanziert wird das Angebot von der Stiftung der Deutschen Bahn. Kopfsachen gibt es seit 2020. Der Verein richtet sich bisher mit Workshops zur mentalen Gesundheit an allgemeinbildende Schulen.
“An den Berufsschulen fördern wir zunächst Basiskompetenzen zu mentaler Gesundheit”, sagt Hendrikje Schmidt, Teamleiterin Produkte. “Dann geht es um individuelle Bedürfnisse und mögliche Coping-Strategien.” Eine Herausforderung sei, dass die Altersspanne oft groß, der Wissensstand sehr unterschiedlich sei.
Auch andere Programme für Schulen zur Förderung psychischer Gesundheit haben ihr Angebot auf Berufsschulen ausgeweitet, etwa MindMatters oder Verrückt? Na und!. Das Angebot You!Mynd richtet sich mit Lehr- und Lernmaterialien speziell an Azubis und unterstützt Lehrkräfte mit Psychoedukations-Seminaren.
Neuropsychologin Herta Flor hat gemeinsam mit Kollegen aus ganz Deutschland im Auftrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina schultypübergreifend internationale Studien zu solchen Programmen ausgewertet (zur Stellungnahme). Ihr Ergebnis: Es gibt bereits gut überprüfte und effektive Angebote zur psychischen Gesundheit für Schulen. “Wir waren positiv überrascht”, sagt die Seniorprofessorin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und an der Universität Heidelberg. Gerade in Deutschland kämen die Angebote aber noch nicht systematisch und flächendeckend zum Einsatz.
Lesen Sie auch: Leopoldina-Gutachten: Wieso das Bildungssystem gezielt Selbstregulation fördern sollte
Dass solche Angebote mehr Schulen erreichen, würde auch Andrea Spies vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen begrüßen. Allerdings hält die Schulpsychologin deren zeitliche Befristung für problematisch. Zudem seien sie meist nicht an schon bestehende Unterstützungsstrukturen in den Schulen, an Schulsozialarbeiter oder -psychologen, angeknüpft.
Für wesentlicher hält Spies eine Schulkultur, die Lehrkräften trotz des Lehrkräftemangels Freiräume für die Beziehungsarbeit mit Schülern im Alltag und in Krisen gibt. In Fällen von Mobbing müssten Lehrkräfte sofort eingreifen. Leidet ein Schüler unter einer psychischen Erkrankung, gelte es oft die Zeit zu überbrücken, bis ein Platz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten frei wird.
Mohr sagt, schon kleine Schritte könnten viel bewirken. Nachdem es an seiner Schule vor Jahren mehrerer Suizidfälle gegeben hatte, habe er ein Präventionskonzept entwickelt und dazu Hinweise auf jedes Klassenbuch geklebt. Etwa diesen: “Betroffene Person aus der Klasse nehmen und nicht mehr allein lassen. Die Betreuung der Klasse ist dabei zweitrangig.” Seither habe es an dem Berufsbildungszentrum keinen weiteren Suizidfall gegeben.
Hendrikje Schmidt vom Verein Kopfsachen hält es für wesentlich, die “Stützsysteme” der Jugendlichen zu stärken. Kopfsachen plant Workshops für Berufsschullehrkräfte. Auch Ausbildungsbetriebe könnten die mentale Gesundheit ihrer Azubis “entscheidend stärken”, sagt sie. Etwa wenn sich Azubis in ihrem Team sicher fühlen können, Fehler machen dürfen und mit ihrer Führungsperson auf Augenhöhe sind. Wichtig seien Ziele und Regelungen für mentale Gesundheit und klare Verantwortliche. “Je größer die Organisation ist, umso einfacher fällt es, das zu definieren”, sagt Schmidt. Aber viel habe auch mit der Kultur zu tun.
Wenn ein Azubi von psychischen Problemen berichte, sei es wichtig, aktiv zuzuhören, akzeptierend und offen damit umzugehen und Vertraulichkeit zu betonen. “Es geht darum, die Jugendlichen darin zu bestärken, sich Hilfe zu suchen, aber nicht selbst ihr Problem für sie zu lösen”, sagt Schmidt.
Der Bremer Staatsgerichtshof hat die umstrittene Ausbildungsumlage des Stadtstaats am Montag gebilligt. Gegen die Umlage hatten die Kammern des Handels, des Handwerks, der Rechtsanwälte und Apotheker sowie der Ärzte und Zahnärzte geklagt. Das sogenannte Ausbildungsunterstützungsfondsgesetz (AusbUFG) von 2023 entspricht damit der Landesverfassung von Bremen.
Ab dem kommenden Jahr müssen demnach alle Unternehmen in Bremen einen Beitrag zur Ausbildungsförderung zahlen. Die Höhe entspricht 0,27 Prozent des gesamten Arbeitnehmerbruttolohns eines Unternehmens pro Jahr. Lediglich Kleinstbetriebe sind davon ausgenommen. Das Geld wandert in einen Fonds, aus dem dann die Ausbildung von Azubis unterstützt wird. Pro Jahr und Azubi sollen dies 2.250 Euro sein.
Laut der Bremer Arbeitssenatorin Claudia Schilling (SPD) müsse ein Unternehmen mit fünf Beschäftigten und einem Azubi zwar rechnerisch 719 Euro pro Jahr in den Fonds einzahlen. Mit dem Geld aus dem Fonds aber werde das Unternehmen unterm Strich mit 1.531 Euro bedacht.
Das Geld soll Ausbildungsbetriebe entlasten und es ihnen leichter machen, Lehrstellen anzubieten. Aus dem Fonds sollen zudem Weiterbildungen für Ausbilder, Sprachkurse für zugewanderte Azubis, Nachhilfe in den Betrieben oder eine zentrale Einführungswoche für Auszubildende finanziert werden. Dies soll auch helfen, die hohe Abbrecherquote in Bremen zu senken.
Die Wirtschaftsverbände wandten sich mit ihrer Klage gegen die überbordende Bürokratie. Sie müssten nun einmal jährlich den Behörden die Zahl ihrer Auszubildenden und die Summe aller Jahresgehälter melden. Zudem ginge die Abgabe am eigentlichen Problem vorbei: Die Betriebe suchten dringend Azubis, könnten aber die Stellen nicht besetzen.
Laut einer Expertenkommission geht die Zahl der Ausbildungsplätze in Bremen seit Jahren zurück. Für 100 Bewerber gebe es rechnerisch nur 91 Plätze. Die Abbrecherquote von 31 Prozent liege in Bremen über dem Bundesdurchschnitt.
Das Argument der Umlagegegner, nur der Bund könne so eine Abgabe erlassen, verwarf das Gericht. Wenn der Bund nicht tätig werde, dürfe das Land handeln. Auch das Argument, die Handlungsfreiheit der Unternehmer werde unverhältnismäßig eingeschränkt, ließ das Gericht nicht gelten. Es bejahte zwar, dass der Schutzbereich der Handlungsfreiheit berührt sei, erklärte die Abgabe aber für verhältnismäßig und gerechtfertigt. Die Abgabe sei in ihrer Höhe überschaubar und sei mit der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, den Fachkräftemangel zu beheben, gut zu rechtfertigen. Die Unternehmen trügen hier eine besondere Verantwortung.
Das Gericht beseitigte auch eine Unklarheit darüber, ob sich möglicherweise die Kirchen als Arbeitgeber aus der Umlagepflicht herausziehen könnten. Aus Sicht des Gerichts seien vom Gesetzgeber alle privaten Arbeitgeber in Bremen gemeint. Kirchliche Arbeitgeber könnten sich lediglich auf die ideellen Bereiche ihres Handelns berufen, um der Abgabe zu entgehen. Kitas und Kliniken fielen nicht darunter. Eine Minderheit der Richter hatte an dieser Schlussfolgerung allerdings Zweifel geäußert. Das Urteil war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil zumindest SPD und Grüne die Forderung nach einer solchen Ausbildungsumlage in ihren Programmen für die kommende Bundestagswahl verankert haben. Thorsten Denkler
Die kostenlose schulische Lernförderung in Hamburg hat die Quote der Klassenwiederholungen gesenkt. Und die Zahl der Kinder gesenkt, die Gefahr laufen, nach der sechsten Klasse das Gymnasium verlassen zu müssen. Das geht aus einer Auswertung des Hamburger Institutes für Bildungsmonitoring und Qualitätssicherung (IFBQ) hervor, die die Hamburger Schulbehörde am Montag vorgelegt hat.
Demnach habe mit der gezielten Lernförderung die sogenannte Abschulung von knapp 1.000 gefährdeten Sechstklässlern an Gymnasien in 28 Prozent der Fälle verhindert werden können. Die Quote der Klassenwiederholungen sei seit dem Schuljahr 2021/22 von damals 1,7 auf jetzt 1,2 Prozent gesunken.
Im Schuljahr 2023/24 haben nach den Daten der Schulbehörde alle Hamburger Schulen die kostenlose Lernförderung angeboten. Es seien 12.000 Kurse mit rund 74.000 Teilnahmen zustande gekommen, die sich auf rund 30.000 Schülerinnen und Schüler verteilen. Das entspricht etwa 16 Prozent der gesamten Schülerschaft Hamburgs.
Hamburg hat dafür etwa 15 Millionen Euro aufgewendet. Die Förderung betraf vor allem die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Je nach Schulform nehmen bis zu 28 Prozent der Schülerinnen und Schüler freiwillig teil. Alle anderen werden dazu verpflichtet.
Über drei Schuljahre hinweg liegt die Quote derer, die ein Jahr nach einer Förderung in den Kernfächern erneut die Förderung in Anspruch genommen haben, zwischen zehn und 13 Prozent. Nach zwei Jahren sinkt die Quote auf sechs bis zehn Prozent. Hamburg bietet die kostenlose individuelle Lernförderung seit dem Schuljahr 2011/12 an. Sie ist nach wie vor ein bundesweit einmaliges Angebot. Thorsten Denkler
Wie Länder wie Chile, Dänemark, Estland, England, Kanada und die Schweiz Bildungsdaten zur Schulentwicklung nutzen und was Deutschland davon lernen kann, ist Fokus einer neuen Studie der Vodafone Stiftung und des Weizenbaum Instituts (zum Download). Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat für die Überblicksstudie mehrere Best-Practice-Beispiele analysiert. Alle sechs untersuchten Länder erzielten überdurchschnittliche Ergebnisse in der PISA-Vergleichsstudie.
Die betrachteten Länder erheben strategisch Bildungsdaten, etwa das Alter und die Kompetenzen von Lernenden oder Verwaltungsdaten zu finanziellen und technischen Ressourcen. Neben der Bewertung durch Lehrkräfte wird überprüft, ob die Kinder die vorgesehenen Lernziele erreicht haben.
Zudem berücksichtigen die Länder teilweise auch das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern. Dänemark etwa befragt Kinder und Jugendliche nach ihrer Zufriedenheit und in der kanadischen Provinz Ontario werden Fragen gestellt, die die Selbstreflexion der Jugendlichen anregen sollen.
Wie die Daten genutzt werden, unterscheidet sich stark je nach Land. Während die Leistungsdaten den Lehrern in Chile, England und Estland zur Verfügung stehen, um individuelle Förderung zu planen, bekommen in Dänemark nur die Schüler selbst Rückmeldung zu ihrem Lernstand.
Teilweise fließen die Daten zur Kompetenzerhebung in die Schulberichte ein oder werden schulscharf veröffentlicht. Damit ist zumindest ein Vergleich von Durchschnittswerten auf kommunaler oder nationaler Ebene möglich.
In vielen Ländern können die Daten auch für die Forschung genutzt werden. In England gibt beispielsweise das Administrative Data Research UK Forschenden einen Zugang zu Verwaltungsdaten. Und in Chile können Forscher mit Individualdaten von Lehrenden und Lernenden arbeiten – in einem Forschungszentrum, das an das Bildungsministerium angegliedert ist.
Basis für das effektive und datensichere Sammeln und Verwenden von Daten im Bildungssystem ist eine passende Infrastruktur. Hier sind Länder wie Estland und Dänemark im Vorteil, die bereits eine digitalisierte Verwaltung haben und wo jeder Bürger eine digitale ID hat.
Der Bildungsökonomin und Studienautorin Friederike Hertweck zufolge gibt es vieles, was Vorbildcharakter hat und sich auf Deutschland übertragen ließe. Die europäischen Beispiele sind laut der Studie zudem ein Beweis dafür, dass Bildungsdaten datenschutzkonform genutzt werden können. Regelmäßig aktualisierte Berichte und Bildungspläne könnten für mehr Transparenz und Bildungsgerechtigkeit sorgen – zumindest wenn sie zu gezielterer Förderung und Mittelvergabe führen. Vera Kraft
Im Februar 2025 beginnt an der Fachhochschule Mittelstand (FHM) der neue berufsbegleitende Masterstudiengang “MBA EdTech Management”. Ursprünglich war der Start bereits für diesen Herbst vorgesehen. Die Akkreditierung hat jedoch länger gedauert. Bislang gibt es 16 Interessenten für das Fernstudium an der privaten Hochschule in Bielefeld. Zielgruppe sind sowohl Gründer von Start-ups als auch Fachkräfte von etablierten Bildungsunternehmen und -verlagen.
Der MBA setze auf eine praxisnahe und unternehmerische Perspektive, sagt Tim Brüggemann, Leiter des Programms und Vizepräsident für Lehre an der Hochschule des Mittelstands. Es gehe nicht um die Umsetzung von Lehre mit Bildungstechnologien, sondern darum, wie sich Unternehmen transformieren und strategisch im Bildungsmarkt platzieren könnten.
Damit sich Beruf und Studium vereinen lassen, kombiniert der Studiengang asynchron aufbereiteten Content mit synchronen Live-Sessions. Thematisch soll es unter anderem um neue Formen des Lernens, Bildungsrecht und strategisches Management gehen. Wahlmodule ermöglichen zudem eine Spezialisierung auf Corporate Learning oder Start-up-Strategien. Außerdem gibt es Brüggemann zufolge Kooperationen mit Verbänden, Unternehmen und “führenden Köpfen der EdTech-Branche”.
Dieser Ansatz unterscheidet sich von bestehenden Angeboten, die stärker forschungsorientiert sind. An der Universität des Saarlands können Studierende etwa bereits seit 2012/13 einen Master of Science in EduTech absolvieren. Dieser Studiengang vereint Pädagogik mit Bildungs- und Computerwissenschaften. Er soll Kompetenzen vermitteln, um selbst neue Bildungstechnologien zu entwickeln und innovative Lernumgebungen zu gestalten.
Auch in Umfang und Kosten unterscheiden sich die Master-Angebote: Auf den Master of Science der Universität des Saarlands haben sich 428 Interessenten für das Wintersemester 2024/25 beworben. Rund 20 von ihnen haben einen Platz bekommen. Und während in Saarbrücken nur der Semesterbeitrag von rund 360 Euro anfällt, belaufen sich die Studiengebühren für den MBA an der FHM auf in Summe 14.300 Euro. Diese Kosten werden aber in der Regel von den Arbeitgebern übernommen. Vera Kraft
Christian Tischner (CDU) leitet das neue Bildungsministerium in Thüringen. Der Gymnasiallehrer für Geschichte und Sozialkunde aus dem Voigtland soll auch für Wissenschaft und Kultur zuständig sein. Neuer Staatssekretär soll der promovierte Pädagoge Bernd Uwe Althaus aus dem Eichsfeld werden. Er ist derzeit Leiter des staatlichen Schulamts in Nordthüringen. Als zweiter Staatssekretär wurde der Jenaer Chemie-Professor Ulrich Schubert bestellt.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an bildung.red@table.media!
Research.Table. Hochschulfinanzen: Die Zukunft wird aufgebraucht. An vielen Hochschulen werden die Mittel knapp. Stellen werden nicht besetzt und Rücklagen für Investitionen aufgelöst, um kurzfristig Finanzlöcher zu stopfen. Doch je länger die Sparhaushalte in Bund und Ländern andauern, desto größer wird der Druck, grundsätzlich etwas zu verändern. Mehr lesen Sie hier.
Research.Table. Bundestagswahl: So soll die Forschungspolitik von Union, SPD und Grünen aussehen. In Sachen Forschungspolitik bleiben die Wahlprogramme von Union, SPD und Grünen (liegen der Redaktion vorab vor) vage. Schwerpunktsetzungen sind in der Zusammenfassung der Papiere aber bereits zu erkennen. Wir fassen die Ideen aus den Wahlprogrammen für Sie zusammen. Mehr lesen Sie hier.
Research.Table. DHV fordert für neue Legislatur konstruktiveres Miteinander von Bund und Ländern. DHV-Präsident Lambert T. Koch begrüßt die Neuwahlen und nennt neue Karrierewege und die Hochschulsanierung als wichtige Themen, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht. Mehr lesen Sie hier.
Zeit: Führerschein-Zuschuss für Azubis. Robert Habeck schlug vor kurzem vor, mit einer Steuer für Superreiche die Schulsanierung zu finanzieren. Seine neue Idee soll nun Azubis zugutekommen: Sie sollen ihren Führerschein mit 1.000 Euro bezuschusst bekommen, wenn ihr Betrieb sich mit 500 Euro an den Führerscheinkosten beteiligen. Eine ähnliche Forderung gab es bereits von Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Die Kosten für Fahrstunden und -prüfung seien stark gestiegen. (Robert Habeck möchte mit Milliardärssteuer Schulen sanieren)
SZ: Ideen für moderne Schulen. An einer Realschule in München erproben Schulleitung und Lehrkräfte flexible Stundenpläne. Die Kinder und Jugendlichen können an manchen Tagen später zur Schule kommen oder früher gehen. Ein Großteil des Unterrichts besteht aus selbständigem Arbeiten. Zudem hat jeder Schüler einen Lehrer als Lerncoach, mit dem er wöchentliche Gespräche führt, um Fragen und individuelle Lernziele zu klären. (Warum sollen Kinder heute noch so lernen wie vor 100 Jahren?)
Spiegel: Computer-Unterricht statt Fremdsprache? Didaktik-Professor Torben Schmidt kritisiert den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) für dessen Vorschlag, statt der zweiten Fremdsprache Schüler lieber in digitaler Medienkompetenz zu unterrichten. Fremdsprachen seien ein wichtiges Mittel für den kulturellen Austausch. Zudem entstünden über das Lernen von Sprachen neuronale Verknüpfungen, die etwa auch im Alter fitter halten würden. Zudem sagt der KI-Experte, dass digitale Kompetenzen lieber fächerübergreifend vermittelt werden sollten statt in einem isolierten Fach. (Sollten Kinder eine zweite Fremdsprache lernen, Herr Schmidt?)
Welt: KI-Tutoren sollen Studium gerechter gestalten. Der CEO der privaten IU Internationalen Hochschule Sven Schütt berichtet, dass alle seine Studenten von einem KI-Tutor der Hochschule unterstützt werden. Diese persönlichen und einfach zugänglichen Bildungsmöglichkeiten seien entscheidend für die Demokratisierung der Bildung. Jedoch werde es so um so wichtiger, dass Lehrende auch als Mentoren für die Studierenden fungieren. Diese menschlichen Beziehungen seien mit KI nicht zu ersetzen. (Wenn wir künstliche Intelligenz klug einsetzen, machen wir Bildung gerechter)
ZDF: Schülerzeitungen und Demokratie. Schülerzeitungen sollen eigentlich ein Mittel der demokratischen Teilhabe sein, doch nur selten haben Lehrer die Kapazitäten, diese außerschulische Aktivität zu betreuen. Zum Teil werden die Zeitungen dann als Projektarbeit in den Schulunterricht überführt. Statt Papierzeitungen werden Podcast-Formate beliebter. Die Landesinformationsstelle Schülerzeitung in Mecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass die Zahl der Schülerzeitungen stabil bleibt. Jedoch gab es einen Rückgang während der Pandemie. (Wie geht es Deutschlands Schülerzeitungen?)
18. Dezember 2024, 9.30 Uhr, online
Livestream 91. Sitzung des Bildungs- und Forschungsausschusses
Auf der Tagesordnung steht unter anderem die gemeinsame Erklärung des BMBF und der Bildungsminister der Länder zum Digitalpakt 2.0. Die Ausschusssitzung wird auf www.bundestag.de übertragen. INFOS
16. Januar 2025, 12 Uhr bis 13 Uhr, online
Webinar CHEtalk feat. DUZ Spotlight: “Akademisierung der Therapieberufe – aktuelle Entwicklungen”
In Deutschland müssen angehende Logopäden oder Ergotherapeuten eine dreijährige Berufsausbildung an einer Berufsfachschule absolvieren – nur vereinzelt entstehen neue Angebote an Hochschulen. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hinterher, wenn es bei der Akademisierung der Therapieberufe geht. In diesem Webinar wird ein Blick in die Schweiz geworfen, wo diese Berufszweige bereits vollständig akademisiert sind, und zeigt so, was Deutschland in diesem Bereich von der Schweiz lernen könnte. Eine Anmeldung ist noch bis zum 15. Januar möglich. INFOS & ANMELDUNG
22. Januar 2025, 14 Uhr, Bremen
Tagung DILABoration – Teilhabe und digitale Bildung in Schule und Sozialraum
Das Forschungsprojekt “Digitalgestützte Bildungsnetze im Sozialraum elaborieren”, das unter anderem von der Universität Köln und dem Bremer M2C getragen wird, soll den Erfolg der Digital Impact Labs evaluieren. In dieser Abschlusstagung werden die Ergebnisse vorgestellt. Für die Teilnahme muss die Anmeldung bis zum 12. Januar erfolgen. INFOS & ANMELDUNG
24. Januar 2025, 15 Uhr bis 20 Uhr, online
Webinar IMPULSTAG DEMOKRATIEBILDUNG: Demokratie lernen – von Anfang an
Der Schulbuchverlag Mildenberger lädt zu diesem Webinar, um Möglichkeiten der Demokratiebildung in der Grundschule vorzustellen. So wird unter anderem Marina Weisband einen Vortrag über notwendige Gütekriterien in der Demokratiebildung halten und ihr Schulprojekt “aula” vorstellen. INFOS & ANMELDUNG
Deutschlands Wirtschaftsmodell befindet sich im globalen Stresstest – der Wohlstand wird neu verteilt, ganze Branchen sind im Umbruch, das industrielle Fundament bröckelt.
Was gestern als krisenfest galt, kann heute Auslaufmodell sein. Gestern Exportschlager, heute Ladenhüter.
Deutschland braucht eine Renaissance seiner ökonomischen Basis. Dazu muss sich unser Land neu erfinden. In keinem anderen OECD-Staat ist der Bildungsaufstieg so abhängig von der Herkunft, nirgendwo scheint der Weg zwischen der Forschungsexzellenz und der Dominanz auf den Märkten so weit. In kaum einem Industrieland müssen Selbstständige und Unternehmer so viele Vorgaben und Regeln befolgen. Nirgendwo ist Arbeit so kostenintensiv und Strom so teuer.
Die Kraftanstrengung für den Wiederaufstieg gelingt nur im Bündnis von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Mit unserem neuen CEO.Table liefern wir den publizistischen Beitrag dazu. Als Chefredakteur von Table.Briefings will ich Ihnen unser neues Produkt wärmstens ans Herz legen:
Ab diesem Samstag, 6 Uhr, starten wir mit dem CEO.Table die neue Samstags-Ausgabe von Table.Briefings – ein kostenloses Executive-Briefing für CEOs und alle, die mit ihnen zu tun haben.
Kompetent, kurz, klar. Wir analysieren jede Woche die wichtigsten Trends, Thesen und Themen aus den Chefetagen, Strategieabteilungen und Forschungsteams der Wirtschaft. Unser Redaktionsleiter Thilo Boss und sein Team kuratieren für Sie die Interviews, Reden und Vorträge der CEOs aus der vergangenen Woche und bietet Ihnen ein Best-of aus unseren Briefings China, Climate, Europe, ESG, Security, Africa, Agrifood, Bildung und Research.
Mit dem CEO.Index bewerten wir erstmals in einem Wirtschaftsmedium ganzheitlich die Leistungen von Managerinnen und Managern und verbinden betriebliche Kennziffern mit der öffentlichen Performance.
In der Rubrik CEO.Survey befragt das Forsa-Institut exklusiv Entscheider zu aktuellen Themen. Und: Wir nennen die Must Reads der Technologie- und IT-Publikationen. Dazu lesen Sie im CEO.Table regelmäßig die wichtigsten Personalmeldungen aus den Chefetagen der Republik, die branchenübergreifenden Benchmark-Geschichten und eine geopolitische Einordnung aktueller Krisen und Konflikte.
In unserer Rubrik CEO.Economist ordnen renommierte Wirtschaftswissenschaftler wie IfW-Präsident Moritz Schularick, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer und der Präsident des IWH Halle, Reint E. Gropp, die Lage des Landes ein.
Als Lizenznehmer gehören Sie zu den Persönlichkeiten, die für den nationalen Kraftakt zum ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands gebraucht werden.
Nehmen Sie deshalb bitte Platz an unserem CEO.Table und blicken mit uns in die Zukunft unserer Wirtschaftsnation.
Geben Sie mir gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Informationen über unser neues Angebot erhalten Sie hier.
Wenn Sie den CEO.Table nicht erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
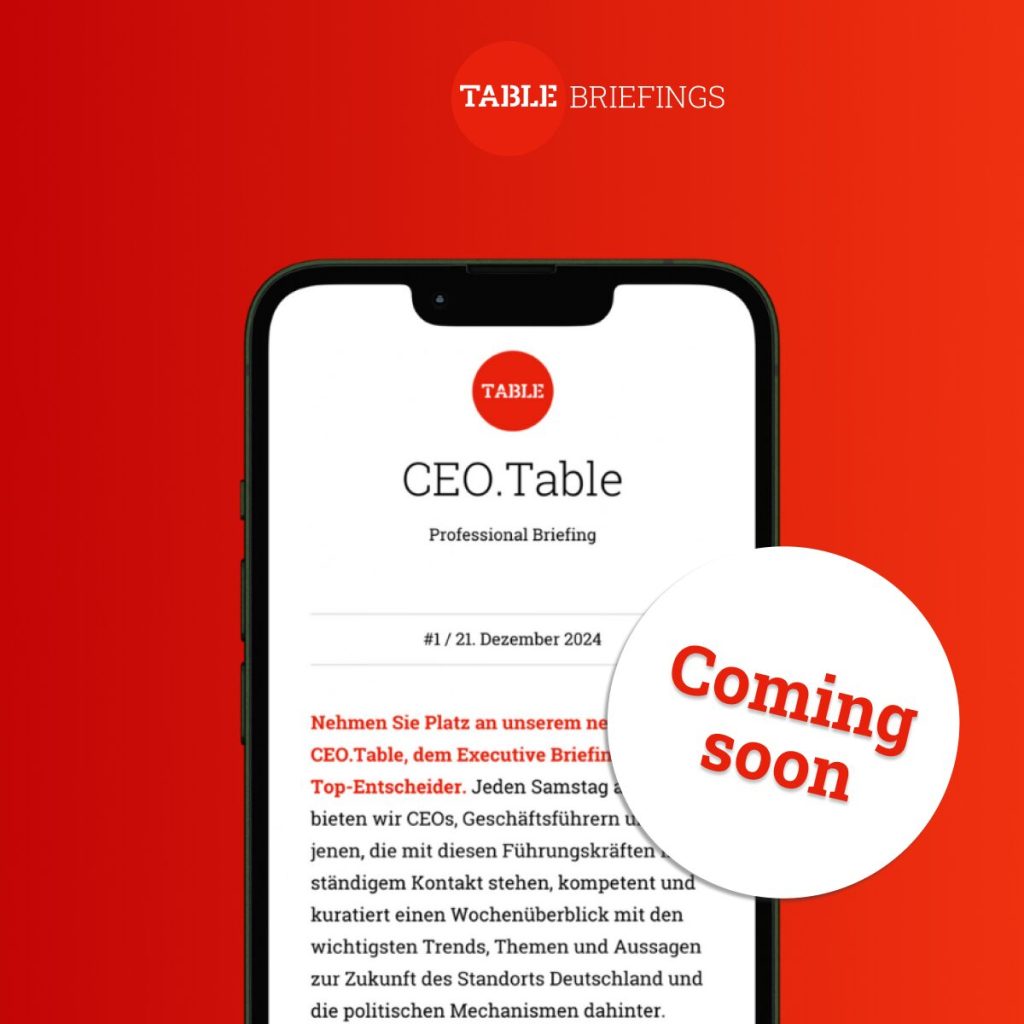

Mit der planmäßig verlorenen Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) tickt jetzt die Uhr. Der 23. Februar 2025 ist ausgemacht für den Tag, an dem sich das Land ein neues Parlament wählt. Seit diesem Dienstag ist auch bekannt, mit welchen Angeboten die drei Parteien, die halbwegs realistische Chancen auf das Kanzleramt haben, in den Wahlkampf ziehen werden. Wir haben die Wahlprogramme von Union, SPD und Grünen auf das Thema Bildung abgeklopft. Ein Überblick:
Union: Sie setzt vor allem auf “Wachstum, Investitionen, Freiräume für unsere Unternehmen und gute Arbeitsplätze”. Dafür will die Union Bürokratie abbauen und Unternehmenssteuern senken. Große Investitionen speziell in Bildung sieht das Programm nicht vor.
SPD: Mit einem “Zukunftspakt Bund” von Bund, Ländern und Kommunen soll unter anderem mehr Geld für Bildung bereitgestellt werden. Helfen soll eine Reform der Schuldenregel, mit der den Ländern mehr finanzieller Spielraum verschafft werden könne. Außerdem sollen “die höchsten Vermögen” stärker belastet werden. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer soll etwa angehoben werden, um mehr Geld in Bildung investieren zu können. Das Geld soll nach sozialen Indikatoren eingesetzt werden.
Grüne: Die Grünen gehen von einem Investitionsstau “im dreistelligen Milliardenbereich” aus. Abhilfe soll ein “Deutschlandfonds für Bund, Länder und Kommunen” schaffen. Daraus sollen auch Kitas und Schulen saniert und Forschung finanziert werden, die die “Technologien und den Wohlstand von morgen begründen”.
Daneben wird ein “Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung” zusammen mit Ländern und Kommunen vorgeschlagen, das bundesweit “für mehr Chancen- und Generationengerechtigkeit” sorgen soll. Mit dem Geld aus dem Programm sollen “moderne und barrierefreie Schulgebäude mit dichten Dächern, funktionierenden Toiletten und digital ausgestatteten Klassenräumen” bezahlt werden. Außerdem wollen die Grünen mehr Stellen für Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und Inklusion schaffen. Statt allein nach dem “Königsteiner Schlüssel”, soll die Finanzierung “stärker an den tatsächlichen Bedarfen” ausgerichtet werden.
Union: Sie will hier den Fokus neben der digitalen Infrastruktur und digitalen Lehr- und Lernprogramme auch auf die “forschungsbasierte Qualifizierung von Lehrkräften und Schulleitungen” legen. Datenschutz müsse “pragmatisch” gehandhabt werden.
SPD: Der Digitalpakt soll “fortgesetzt und inhaltlich weiterentwickelt” werden.
Grüne: Die Digitalisierung der Schulen wird “als Daueraufgabe von Bund, Ländern und Kommunen” verstanden, in die die Grünen weiter investieren wollen.
Union: Jedes Kind, das eingeschult wird, muss Deutsch können. Darum setzt die Union auf verpflichtende Sprachtests im Vorschulalter. Kinder mit Sprachproblemen will die Union zur Teilnahme an einem vorschulischen Programm in einer Kita, einem Kindergarten oder einer Vorschule “verpflichten“. Zudem will die Union einen “Neustart des erfolgreichen Bundesprogramms Sprach-Kitas” angehen. Die Bildungsforschung soll helfen, “einheitliche Standards zur flächendeckenden Diagnose des Entwicklungsstands aller Drei- bis Vierjährigen” zu schaffen.
SPD: Damit kein Kind ohne ausreichende Sprachkenntnisse in die Schule kommt, soll mit spätestens vier Jahren und zur Einschulung der Entwicklungsstand aller Kinder getestet werden. Wenn nötig, soll dann eine verbindliche Förderung angeboten werden.
Grüne: Sprachförderung soll als “durchgängiger Prozess” angelegt werden, der in der Kita beginnt und sich in der Schule fortsetzt. So soll erreicht werden, dass alle Kinder am Ende der Grundschule sicher lesen, schreiben und rechnen können.
Union: Mit einem nicht näher beschriebenen “Investitionsprogramm” soll Ländern und Kommunen mit dem Ausbau der Betreuungsplätze geholfen werden. Die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten soll verbessert werden.
SPD: Mit einem Startchancen-Programm für Kitas sollen Kitas in benachteiligten Lagen gefördert werden, ähnlich dem Startchancen-Programm für Schulen. Für beides sollen Bundesmittel bereitgestellt werden. Eine “verbindlich zwischen allen Bundesländern” zu vereinbarende Fachkräfteoffensive für Kitas und Schulen soll für den Ausbau von Ausbildungskapazitäten und eine “entlohnte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher” sorgen.
Grüne: Im Kita-Qualitätsgesetz sollen neue, bundesweite Qualitätsstandards festgeschrieben werden. Kitas mit einem “hohen Anteil sozio-ökonomisch benachteiligter Kinder” wollen die Grünen besonders unterstützen. Mit steuerlichen Anreizen sollen Unternehmer bewegt werden, “selbst oder in Kooperation” Kitaplätze zu schaffen.
Union: Will “Anstrengung und Leistung” wieder in den Mittelpunkt stellen, angefangen mit Kernfächern wie Mathematik und Deutsch “bis hin zu den Bundesjugendspielen”. Auf Bundesebene soll es ein “vergleichbares Abitur auf hohem Niveau” geben. “Wir setzen auf aussagekräftige und verbindliche Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebungen.”
SPD: keine spezifischen Angaben.
Grüne: keine spezifischen Angaben.
Union: Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen soll es “individuelle Bildungsmöglichkeiten” geben. Neben Inklusionsangeboten sieht die Union auch Förderschulen als Bestandteil der Bildungswelt. Menschen mit Behinderungen soll zudem der Zugang zu Ausbildung und Arbeit mit “passgenauen Impulsen für einen inklusiven Arbeitsmarkt” erleichtert werden. Dafür sollen die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt als auch Inklusionsbetriebe und Werkstätten gestärkt werden. Letztere böten einen “geschützten Raum”, um sich im Arbeitsleben zu erproben.
SPD: Wird nicht adressiert.
Grüne: Eine “Enquetekommission Inklusion” soll unter Beteiligung von Betroffenen Vorschläge erarbeiten. Das “heutige ausgrenzende Werkstättensystem” soll in Richtung Inklusionsunternehmen weiterentwickelt werden, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten, mindestens nach Mindestlohn entlohnt werden und Rentenansprüche erwerben können. An den Schulen soll es mehr Stellen für Inklusion geben.
Union: Berufliche und akademische Bildung gelten der Union als gleichwertig. Dafür sollen Bund und Länder den Deutschen Qualifikationsrahmen rechtlich verbindlich in einem Staatsvertrag verankern. Den Zugang zum höheren Dienst des Bundes soll auch für Bachelor-Absolventen mit Promotion oder mehrjähriger beruflicher Erfahrung möglich sein.
SPD: Die Ausbildungsgarantie und die Jugendberufsagenturen soll fortbestehen. Die Unternehmen wiederum “müssen ihrer Verantwortung für Ausbildung stärker gerecht werden”. Branchenbezogene Umlagefonds für gute Ausbildung “können dieses Ziel gewährleisten”.
Grüne: Die Grünen halten die berufliche Ausbildung oder ein Studium für “gleichwertige, starke Wege in die berufliche Zukunft”. Sie wollen zudem eine “solidarische Ausbildungsumlage” schaffen, um die “Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittlerer Betriebe zu fördern”. Zur Unterstützung des Handwerks soll die Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung weitergehen. “Außerdem stärken wir Ausbildungsverbünde”, wollen die Grünen schulgeldfreie Ausbildungen, eine “deutliche Anhebung” der Mindestausbildungsvergütung, den geförderten Führerscheinerwerb ermöglichen und eine Lösung
für ein Azubi-Deutschlandticket finden.
Union: Das BAföG soll laut Wahlprogramm “auskömmlich” sein. Die Beantragung soll “unbürokratischer und schneller” gehen. Es sollen Hinzuverdienstmöglichkeiten geschaffen werden. Den Gesetzesvollzug für das Auslands-BAföG “beschleunigen wir und verankern ihn zentral in bundeseigener Verwaltung”.
SPD: Mit einer weiteren BAföG-Reform soll die Höhe der Ausbildungsförderung “regelmäßig an die steigenden Lebenshaltungskosten” angepasst werden. Darüber hinaus soll die Bearbeitungszeit für BAföG-Anträge verkürzt werden.
Grüne: Das BAföG soll existenzsichernd sein, auch mit steigenden Lebenshaltungskosten. Die Freibeträge der elterlichen Einkommen sollen erhöht werden, um das BAföG für mehr Menschen zu öffnen. Für Berufstätige, die beispielsweise einen Meister machen wollen, soll das Aufstiegs-BAföG reformiert werden. Dann soll es das BAföG auch in Teilzeit geben.
Union:
Religion: Der Religionsunterricht wird als “unverzichtbar” eingestuft. Die Union will Religion als ordentliches Schulfach aufwerten.
Daten: Bund und Länder sollen ein “bundesweites Bildungsverlaufsregister über alle Stufen formaler Bildung” schaffen. Die Forschung soll Zugang zu den Daten bekommen. In einem ersten Schritt soll dafür eine “ländergemeinsame datenschutzkonforme Identifikationsnummer” für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt werden, auch Schüler-ID oder Statistik-ID genannt.
Social Media: Die Nutzung soll “schnellstmöglich” wissenschaftlich untersucht werden. Die Union will dann Vorschläge “zur Stärkung von Gesundheit- und Jugendmedienschutz” vorlegen.
Schwimmen: Am Ende der Grundschulzeit soll jedes Kind schwimmen können. Gemeinsam mit den Ländern will die Union eine bundesweite Aktion zum Schwimmenlernen aufsetzen.
Gendern: An Schulen und Universitäten soll auf die Gendersprache verzichtet werden. Ein angeblicher “Gender-Zwang aus ideologischen Gründen” wird abgelehnt. (In einer früheren Version des Textes hatten wir auch der SPD die Forderung nach einem Gender-Verbot zugewiesen. Das war falsch.)
SPD:
Verpflegung: In allen Bildungseinrichtungen soll es “kostenfreie Verpflegung” geben. Zusammen mit den Ländern soll allen Schülerinnen und Schülern “ein gesundes und kostenloses” Mittagessen angeboten werden.
SPD und Grüne:
Wohnen: Das Bundesprogramm Junges Wohnen soll fortgesetzt und aufgestockt werden, um bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende und Studierende zu schaffen.
Von Janna Degener-Storr
Ein Fünftel der Acht- bis 17-Jährigen geben im aktuellen Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung an, psychisch belastet zu sein. Andere Untersuchungen zeigen, dass gerade Berufsschüler im Vergleich zu Gleichaltrigen besonderen Belastungen ausgesetzt sind. In der Lehrkräftebefragung des Schulbarometers aus dem Frühjahr 2024 gaben zwölf Prozent der Lehrkräfte an dieser Schulform an, psychische Probleme oder Belastungen ihrer Schüler zu beobachten – an Gymnasien waren es sieben Prozent.
Eine Rolle spielen dabei neue Herausforderungen in der Ausbildung: Im Betrieb müssen die jungen Menschen acht Stunden am Tag arbeiten, gehen daneben in die Berufsschule. Bei einigen senkt das die schulischen Leistungen. Es bleibt weniger Zeit für Freunde und Ausgleich in der Freizeit, sagt Andrea Spies. Sie ist Vorsitzende der Sektion Schulpsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Eine niedrige Ausbildungsvergütung stehe oft dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und einer eigenen Wohnung entgegen. Die Azubis wohnen dann weiter zu Hause, was Spannungen in der Beziehung zu den Eltern befördert.
Zuletzt sei die Belastung noch gestiegen, meint Schulpsychologin Spies. Defizite im Umgang mit Herausforderungen hätten schon vor der Pandemie zugenommen. “Viele Jugendliche haben zum Beispiel Probleme damit, sich zu konzentrieren, sich selbst zu organisieren und Frustrationen auszuhalten.” Wenn in Kita, Grundschule, weiterführender Schule und Elternhaus kein guter Umgang mit Stress gelernt werde, wirke sich das bis ins Erwachsenenalter aus.
Auch Sven Mohr nimmt in der aktuellen Berufsschülergeneration eine hohe Belastung wahr, die sich nicht allein mit den “normalen” Herausforderungen des Erwachsenwerdens erklären lasse. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung und leitet das Regionale Berufsbildungszentrum in Flensburg.
Ein hoher Anteil der Jugendlichen, sagt Mohr, sei heute etwa im Autismus-Spektrum zu verorten. Andere strebten eine Geschlechtsumwandlung an oder hätten mit dem Wechsel zur Berufsschule ihr Coming Out. Einige litten unter früheren Mobbing-Erfahrungen.
Wie stark die psychische Belastung ist, hängt nach Einschätzung von Mohr auch am Berufszweig: Ein Risiko sei, wenn der Betrieb sich gar nicht oder wenig um den Azubi kümmert, wenn die Vergütung schlecht ist oder der Beruf wenig Anerkennung findet. Ein weiterer Grund für die höhere Belastung von Berufsschülern: Einige besuchen die berufsbildende Schule, um den Schulabschluss nachzuholen, den sie zuvor nicht geschafft haben, teilweise aufgrund längerer Krankheitsphasen.
Der Verein Kopfsachen entwickelt speziell für Berufsfachschulen ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit. Fünf Berufsschulen in Berlin, Köln und Hamburg testen gerade zwei je eintägige Workshops in Ausbildungsgängen für Sozialassistenten und Erzieher. Finanziert wird das Angebot von der Stiftung der Deutschen Bahn. Kopfsachen gibt es seit 2020. Der Verein richtet sich bisher mit Workshops zur mentalen Gesundheit an allgemeinbildende Schulen.
“An den Berufsschulen fördern wir zunächst Basiskompetenzen zu mentaler Gesundheit”, sagt Hendrikje Schmidt, Teamleiterin Produkte. “Dann geht es um individuelle Bedürfnisse und mögliche Coping-Strategien.” Eine Herausforderung sei, dass die Altersspanne oft groß, der Wissensstand sehr unterschiedlich sei.
Auch andere Programme für Schulen zur Förderung psychischer Gesundheit haben ihr Angebot auf Berufsschulen ausgeweitet, etwa MindMatters oder Verrückt? Na und!. Das Angebot You!Mynd richtet sich mit Lehr- und Lernmaterialien speziell an Azubis und unterstützt Lehrkräfte mit Psychoedukations-Seminaren.
Neuropsychologin Herta Flor hat gemeinsam mit Kollegen aus ganz Deutschland im Auftrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina schultypübergreifend internationale Studien zu solchen Programmen ausgewertet (zur Stellungnahme). Ihr Ergebnis: Es gibt bereits gut überprüfte und effektive Angebote zur psychischen Gesundheit für Schulen. “Wir waren positiv überrascht”, sagt die Seniorprofessorin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und an der Universität Heidelberg. Gerade in Deutschland kämen die Angebote aber noch nicht systematisch und flächendeckend zum Einsatz.
Lesen Sie auch: Leopoldina-Gutachten: Wieso das Bildungssystem gezielt Selbstregulation fördern sollte
Dass solche Angebote mehr Schulen erreichen, würde auch Andrea Spies vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen begrüßen. Allerdings hält die Schulpsychologin deren zeitliche Befristung für problematisch. Zudem seien sie meist nicht an schon bestehende Unterstützungsstrukturen in den Schulen, an Schulsozialarbeiter oder -psychologen, angeknüpft.
Für wesentlicher hält Spies eine Schulkultur, die Lehrkräften trotz des Lehrkräftemangels Freiräume für die Beziehungsarbeit mit Schülern im Alltag und in Krisen gibt. In Fällen von Mobbing müssten Lehrkräfte sofort eingreifen. Leidet ein Schüler unter einer psychischen Erkrankung, gelte es oft die Zeit zu überbrücken, bis ein Platz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten frei wird.
Mohr sagt, schon kleine Schritte könnten viel bewirken. Nachdem es an seiner Schule vor Jahren mehrerer Suizidfälle gegeben hatte, habe er ein Präventionskonzept entwickelt und dazu Hinweise auf jedes Klassenbuch geklebt. Etwa diesen: “Betroffene Person aus der Klasse nehmen und nicht mehr allein lassen. Die Betreuung der Klasse ist dabei zweitrangig.” Seither habe es an dem Berufsbildungszentrum keinen weiteren Suizidfall gegeben.
Hendrikje Schmidt vom Verein Kopfsachen hält es für wesentlich, die “Stützsysteme” der Jugendlichen zu stärken. Kopfsachen plant Workshops für Berufsschullehrkräfte. Auch Ausbildungsbetriebe könnten die mentale Gesundheit ihrer Azubis “entscheidend stärken”, sagt sie. Etwa wenn sich Azubis in ihrem Team sicher fühlen können, Fehler machen dürfen und mit ihrer Führungsperson auf Augenhöhe sind. Wichtig seien Ziele und Regelungen für mentale Gesundheit und klare Verantwortliche. “Je größer die Organisation ist, umso einfacher fällt es, das zu definieren”, sagt Schmidt. Aber viel habe auch mit der Kultur zu tun.
Wenn ein Azubi von psychischen Problemen berichte, sei es wichtig, aktiv zuzuhören, akzeptierend und offen damit umzugehen und Vertraulichkeit zu betonen. “Es geht darum, die Jugendlichen darin zu bestärken, sich Hilfe zu suchen, aber nicht selbst ihr Problem für sie zu lösen”, sagt Schmidt.
Der Bremer Staatsgerichtshof hat die umstrittene Ausbildungsumlage des Stadtstaats am Montag gebilligt. Gegen die Umlage hatten die Kammern des Handels, des Handwerks, der Rechtsanwälte und Apotheker sowie der Ärzte und Zahnärzte geklagt. Das sogenannte Ausbildungsunterstützungsfondsgesetz (AusbUFG) von 2023 entspricht damit der Landesverfassung von Bremen.
Ab dem kommenden Jahr müssen demnach alle Unternehmen in Bremen einen Beitrag zur Ausbildungsförderung zahlen. Die Höhe entspricht 0,27 Prozent des gesamten Arbeitnehmerbruttolohns eines Unternehmens pro Jahr. Lediglich Kleinstbetriebe sind davon ausgenommen. Das Geld wandert in einen Fonds, aus dem dann die Ausbildung von Azubis unterstützt wird. Pro Jahr und Azubi sollen dies 2.250 Euro sein.
Laut der Bremer Arbeitssenatorin Claudia Schilling (SPD) müsse ein Unternehmen mit fünf Beschäftigten und einem Azubi zwar rechnerisch 719 Euro pro Jahr in den Fonds einzahlen. Mit dem Geld aus dem Fonds aber werde das Unternehmen unterm Strich mit 1.531 Euro bedacht.
Das Geld soll Ausbildungsbetriebe entlasten und es ihnen leichter machen, Lehrstellen anzubieten. Aus dem Fonds sollen zudem Weiterbildungen für Ausbilder, Sprachkurse für zugewanderte Azubis, Nachhilfe in den Betrieben oder eine zentrale Einführungswoche für Auszubildende finanziert werden. Dies soll auch helfen, die hohe Abbrecherquote in Bremen zu senken.
Die Wirtschaftsverbände wandten sich mit ihrer Klage gegen die überbordende Bürokratie. Sie müssten nun einmal jährlich den Behörden die Zahl ihrer Auszubildenden und die Summe aller Jahresgehälter melden. Zudem ginge die Abgabe am eigentlichen Problem vorbei: Die Betriebe suchten dringend Azubis, könnten aber die Stellen nicht besetzen.
Laut einer Expertenkommission geht die Zahl der Ausbildungsplätze in Bremen seit Jahren zurück. Für 100 Bewerber gebe es rechnerisch nur 91 Plätze. Die Abbrecherquote von 31 Prozent liege in Bremen über dem Bundesdurchschnitt.
Das Argument der Umlagegegner, nur der Bund könne so eine Abgabe erlassen, verwarf das Gericht. Wenn der Bund nicht tätig werde, dürfe das Land handeln. Auch das Argument, die Handlungsfreiheit der Unternehmer werde unverhältnismäßig eingeschränkt, ließ das Gericht nicht gelten. Es bejahte zwar, dass der Schutzbereich der Handlungsfreiheit berührt sei, erklärte die Abgabe aber für verhältnismäßig und gerechtfertigt. Die Abgabe sei in ihrer Höhe überschaubar und sei mit der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, den Fachkräftemangel zu beheben, gut zu rechtfertigen. Die Unternehmen trügen hier eine besondere Verantwortung.
Das Gericht beseitigte auch eine Unklarheit darüber, ob sich möglicherweise die Kirchen als Arbeitgeber aus der Umlagepflicht herausziehen könnten. Aus Sicht des Gerichts seien vom Gesetzgeber alle privaten Arbeitgeber in Bremen gemeint. Kirchliche Arbeitgeber könnten sich lediglich auf die ideellen Bereiche ihres Handelns berufen, um der Abgabe zu entgehen. Kitas und Kliniken fielen nicht darunter. Eine Minderheit der Richter hatte an dieser Schlussfolgerung allerdings Zweifel geäußert. Das Urteil war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil zumindest SPD und Grüne die Forderung nach einer solchen Ausbildungsumlage in ihren Programmen für die kommende Bundestagswahl verankert haben. Thorsten Denkler
Die kostenlose schulische Lernförderung in Hamburg hat die Quote der Klassenwiederholungen gesenkt. Und die Zahl der Kinder gesenkt, die Gefahr laufen, nach der sechsten Klasse das Gymnasium verlassen zu müssen. Das geht aus einer Auswertung des Hamburger Institutes für Bildungsmonitoring und Qualitätssicherung (IFBQ) hervor, die die Hamburger Schulbehörde am Montag vorgelegt hat.
Demnach habe mit der gezielten Lernförderung die sogenannte Abschulung von knapp 1.000 gefährdeten Sechstklässlern an Gymnasien in 28 Prozent der Fälle verhindert werden können. Die Quote der Klassenwiederholungen sei seit dem Schuljahr 2021/22 von damals 1,7 auf jetzt 1,2 Prozent gesunken.
Im Schuljahr 2023/24 haben nach den Daten der Schulbehörde alle Hamburger Schulen die kostenlose Lernförderung angeboten. Es seien 12.000 Kurse mit rund 74.000 Teilnahmen zustande gekommen, die sich auf rund 30.000 Schülerinnen und Schüler verteilen. Das entspricht etwa 16 Prozent der gesamten Schülerschaft Hamburgs.
Hamburg hat dafür etwa 15 Millionen Euro aufgewendet. Die Förderung betraf vor allem die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Je nach Schulform nehmen bis zu 28 Prozent der Schülerinnen und Schüler freiwillig teil. Alle anderen werden dazu verpflichtet.
Über drei Schuljahre hinweg liegt die Quote derer, die ein Jahr nach einer Förderung in den Kernfächern erneut die Förderung in Anspruch genommen haben, zwischen zehn und 13 Prozent. Nach zwei Jahren sinkt die Quote auf sechs bis zehn Prozent. Hamburg bietet die kostenlose individuelle Lernförderung seit dem Schuljahr 2011/12 an. Sie ist nach wie vor ein bundesweit einmaliges Angebot. Thorsten Denkler
Wie Länder wie Chile, Dänemark, Estland, England, Kanada und die Schweiz Bildungsdaten zur Schulentwicklung nutzen und was Deutschland davon lernen kann, ist Fokus einer neuen Studie der Vodafone Stiftung und des Weizenbaum Instituts (zum Download). Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat für die Überblicksstudie mehrere Best-Practice-Beispiele analysiert. Alle sechs untersuchten Länder erzielten überdurchschnittliche Ergebnisse in der PISA-Vergleichsstudie.
Die betrachteten Länder erheben strategisch Bildungsdaten, etwa das Alter und die Kompetenzen von Lernenden oder Verwaltungsdaten zu finanziellen und technischen Ressourcen. Neben der Bewertung durch Lehrkräfte wird überprüft, ob die Kinder die vorgesehenen Lernziele erreicht haben.
Zudem berücksichtigen die Länder teilweise auch das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern. Dänemark etwa befragt Kinder und Jugendliche nach ihrer Zufriedenheit und in der kanadischen Provinz Ontario werden Fragen gestellt, die die Selbstreflexion der Jugendlichen anregen sollen.
Wie die Daten genutzt werden, unterscheidet sich stark je nach Land. Während die Leistungsdaten den Lehrern in Chile, England und Estland zur Verfügung stehen, um individuelle Förderung zu planen, bekommen in Dänemark nur die Schüler selbst Rückmeldung zu ihrem Lernstand.
Teilweise fließen die Daten zur Kompetenzerhebung in die Schulberichte ein oder werden schulscharf veröffentlicht. Damit ist zumindest ein Vergleich von Durchschnittswerten auf kommunaler oder nationaler Ebene möglich.
In vielen Ländern können die Daten auch für die Forschung genutzt werden. In England gibt beispielsweise das Administrative Data Research UK Forschenden einen Zugang zu Verwaltungsdaten. Und in Chile können Forscher mit Individualdaten von Lehrenden und Lernenden arbeiten – in einem Forschungszentrum, das an das Bildungsministerium angegliedert ist.
Basis für das effektive und datensichere Sammeln und Verwenden von Daten im Bildungssystem ist eine passende Infrastruktur. Hier sind Länder wie Estland und Dänemark im Vorteil, die bereits eine digitalisierte Verwaltung haben und wo jeder Bürger eine digitale ID hat.
Der Bildungsökonomin und Studienautorin Friederike Hertweck zufolge gibt es vieles, was Vorbildcharakter hat und sich auf Deutschland übertragen ließe. Die europäischen Beispiele sind laut der Studie zudem ein Beweis dafür, dass Bildungsdaten datenschutzkonform genutzt werden können. Regelmäßig aktualisierte Berichte und Bildungspläne könnten für mehr Transparenz und Bildungsgerechtigkeit sorgen – zumindest wenn sie zu gezielterer Förderung und Mittelvergabe führen. Vera Kraft
Im Februar 2025 beginnt an der Fachhochschule Mittelstand (FHM) der neue berufsbegleitende Masterstudiengang “MBA EdTech Management”. Ursprünglich war der Start bereits für diesen Herbst vorgesehen. Die Akkreditierung hat jedoch länger gedauert. Bislang gibt es 16 Interessenten für das Fernstudium an der privaten Hochschule in Bielefeld. Zielgruppe sind sowohl Gründer von Start-ups als auch Fachkräfte von etablierten Bildungsunternehmen und -verlagen.
Der MBA setze auf eine praxisnahe und unternehmerische Perspektive, sagt Tim Brüggemann, Leiter des Programms und Vizepräsident für Lehre an der Hochschule des Mittelstands. Es gehe nicht um die Umsetzung von Lehre mit Bildungstechnologien, sondern darum, wie sich Unternehmen transformieren und strategisch im Bildungsmarkt platzieren könnten.
Damit sich Beruf und Studium vereinen lassen, kombiniert der Studiengang asynchron aufbereiteten Content mit synchronen Live-Sessions. Thematisch soll es unter anderem um neue Formen des Lernens, Bildungsrecht und strategisches Management gehen. Wahlmodule ermöglichen zudem eine Spezialisierung auf Corporate Learning oder Start-up-Strategien. Außerdem gibt es Brüggemann zufolge Kooperationen mit Verbänden, Unternehmen und “führenden Köpfen der EdTech-Branche”.
Dieser Ansatz unterscheidet sich von bestehenden Angeboten, die stärker forschungsorientiert sind. An der Universität des Saarlands können Studierende etwa bereits seit 2012/13 einen Master of Science in EduTech absolvieren. Dieser Studiengang vereint Pädagogik mit Bildungs- und Computerwissenschaften. Er soll Kompetenzen vermitteln, um selbst neue Bildungstechnologien zu entwickeln und innovative Lernumgebungen zu gestalten.
Auch in Umfang und Kosten unterscheiden sich die Master-Angebote: Auf den Master of Science der Universität des Saarlands haben sich 428 Interessenten für das Wintersemester 2024/25 beworben. Rund 20 von ihnen haben einen Platz bekommen. Und während in Saarbrücken nur der Semesterbeitrag von rund 360 Euro anfällt, belaufen sich die Studiengebühren für den MBA an der FHM auf in Summe 14.300 Euro. Diese Kosten werden aber in der Regel von den Arbeitgebern übernommen. Vera Kraft
Christian Tischner (CDU) leitet das neue Bildungsministerium in Thüringen. Der Gymnasiallehrer für Geschichte und Sozialkunde aus dem Voigtland soll auch für Wissenschaft und Kultur zuständig sein. Neuer Staatssekretär soll der promovierte Pädagoge Bernd Uwe Althaus aus dem Eichsfeld werden. Er ist derzeit Leiter des staatlichen Schulamts in Nordthüringen. Als zweiter Staatssekretär wurde der Jenaer Chemie-Professor Ulrich Schubert bestellt.
Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an bildung.red@table.media!
Research.Table. Hochschulfinanzen: Die Zukunft wird aufgebraucht. An vielen Hochschulen werden die Mittel knapp. Stellen werden nicht besetzt und Rücklagen für Investitionen aufgelöst, um kurzfristig Finanzlöcher zu stopfen. Doch je länger die Sparhaushalte in Bund und Ländern andauern, desto größer wird der Druck, grundsätzlich etwas zu verändern. Mehr lesen Sie hier.
Research.Table. Bundestagswahl: So soll die Forschungspolitik von Union, SPD und Grünen aussehen. In Sachen Forschungspolitik bleiben die Wahlprogramme von Union, SPD und Grünen (liegen der Redaktion vorab vor) vage. Schwerpunktsetzungen sind in der Zusammenfassung der Papiere aber bereits zu erkennen. Wir fassen die Ideen aus den Wahlprogrammen für Sie zusammen. Mehr lesen Sie hier.
Research.Table. DHV fordert für neue Legislatur konstruktiveres Miteinander von Bund und Ländern. DHV-Präsident Lambert T. Koch begrüßt die Neuwahlen und nennt neue Karrierewege und die Hochschulsanierung als wichtige Themen, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht. Mehr lesen Sie hier.
Zeit: Führerschein-Zuschuss für Azubis. Robert Habeck schlug vor kurzem vor, mit einer Steuer für Superreiche die Schulsanierung zu finanzieren. Seine neue Idee soll nun Azubis zugutekommen: Sie sollen ihren Führerschein mit 1.000 Euro bezuschusst bekommen, wenn ihr Betrieb sich mit 500 Euro an den Führerscheinkosten beteiligen. Eine ähnliche Forderung gab es bereits von Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Die Kosten für Fahrstunden und -prüfung seien stark gestiegen. (Robert Habeck möchte mit Milliardärssteuer Schulen sanieren)
SZ: Ideen für moderne Schulen. An einer Realschule in München erproben Schulleitung und Lehrkräfte flexible Stundenpläne. Die Kinder und Jugendlichen können an manchen Tagen später zur Schule kommen oder früher gehen. Ein Großteil des Unterrichts besteht aus selbständigem Arbeiten. Zudem hat jeder Schüler einen Lehrer als Lerncoach, mit dem er wöchentliche Gespräche führt, um Fragen und individuelle Lernziele zu klären. (Warum sollen Kinder heute noch so lernen wie vor 100 Jahren?)
Spiegel: Computer-Unterricht statt Fremdsprache? Didaktik-Professor Torben Schmidt kritisiert den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) für dessen Vorschlag, statt der zweiten Fremdsprache Schüler lieber in digitaler Medienkompetenz zu unterrichten. Fremdsprachen seien ein wichtiges Mittel für den kulturellen Austausch. Zudem entstünden über das Lernen von Sprachen neuronale Verknüpfungen, die etwa auch im Alter fitter halten würden. Zudem sagt der KI-Experte, dass digitale Kompetenzen lieber fächerübergreifend vermittelt werden sollten statt in einem isolierten Fach. (Sollten Kinder eine zweite Fremdsprache lernen, Herr Schmidt?)
Welt: KI-Tutoren sollen Studium gerechter gestalten. Der CEO der privaten IU Internationalen Hochschule Sven Schütt berichtet, dass alle seine Studenten von einem KI-Tutor der Hochschule unterstützt werden. Diese persönlichen und einfach zugänglichen Bildungsmöglichkeiten seien entscheidend für die Demokratisierung der Bildung. Jedoch werde es so um so wichtiger, dass Lehrende auch als Mentoren für die Studierenden fungieren. Diese menschlichen Beziehungen seien mit KI nicht zu ersetzen. (Wenn wir künstliche Intelligenz klug einsetzen, machen wir Bildung gerechter)
ZDF: Schülerzeitungen und Demokratie. Schülerzeitungen sollen eigentlich ein Mittel der demokratischen Teilhabe sein, doch nur selten haben Lehrer die Kapazitäten, diese außerschulische Aktivität zu betreuen. Zum Teil werden die Zeitungen dann als Projektarbeit in den Schulunterricht überführt. Statt Papierzeitungen werden Podcast-Formate beliebter. Die Landesinformationsstelle Schülerzeitung in Mecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass die Zahl der Schülerzeitungen stabil bleibt. Jedoch gab es einen Rückgang während der Pandemie. (Wie geht es Deutschlands Schülerzeitungen?)
18. Dezember 2024, 9.30 Uhr, online
Livestream 91. Sitzung des Bildungs- und Forschungsausschusses
Auf der Tagesordnung steht unter anderem die gemeinsame Erklärung des BMBF und der Bildungsminister der Länder zum Digitalpakt 2.0. Die Ausschusssitzung wird auf www.bundestag.de übertragen. INFOS
16. Januar 2025, 12 Uhr bis 13 Uhr, online
Webinar CHEtalk feat. DUZ Spotlight: “Akademisierung der Therapieberufe – aktuelle Entwicklungen”
In Deutschland müssen angehende Logopäden oder Ergotherapeuten eine dreijährige Berufsausbildung an einer Berufsfachschule absolvieren – nur vereinzelt entstehen neue Angebote an Hochschulen. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hinterher, wenn es bei der Akademisierung der Therapieberufe geht. In diesem Webinar wird ein Blick in die Schweiz geworfen, wo diese Berufszweige bereits vollständig akademisiert sind, und zeigt so, was Deutschland in diesem Bereich von der Schweiz lernen könnte. Eine Anmeldung ist noch bis zum 15. Januar möglich. INFOS & ANMELDUNG
22. Januar 2025, 14 Uhr, Bremen
Tagung DILABoration – Teilhabe und digitale Bildung in Schule und Sozialraum
Das Forschungsprojekt “Digitalgestützte Bildungsnetze im Sozialraum elaborieren”, das unter anderem von der Universität Köln und dem Bremer M2C getragen wird, soll den Erfolg der Digital Impact Labs evaluieren. In dieser Abschlusstagung werden die Ergebnisse vorgestellt. Für die Teilnahme muss die Anmeldung bis zum 12. Januar erfolgen. INFOS & ANMELDUNG
24. Januar 2025, 15 Uhr bis 20 Uhr, online
Webinar IMPULSTAG DEMOKRATIEBILDUNG: Demokratie lernen – von Anfang an
Der Schulbuchverlag Mildenberger lädt zu diesem Webinar, um Möglichkeiten der Demokratiebildung in der Grundschule vorzustellen. So wird unter anderem Marina Weisband einen Vortrag über notwendige Gütekriterien in der Demokratiebildung halten und ihr Schulprojekt “aula” vorstellen. INFOS & ANMELDUNG
