stark schwankende Erzeugerpreise für Milch sind in regelmäßigen Abständen Thema in der Politik. Schon die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, Artikel 148 der Gemeinsamen Marktorganisation national umzusetzen, wenn sich an den Milchpreisen für Bauern nichts ändere. Nun will ihr Nachfolger Cem Özdemir (Grüne) die Lieferbeziehungen zwischen Molkereien und Milcherzeugern ändern.
Vertreter der Milchbranche sind gespalten in der Frage, ob der Staat eingreifen sollte. Gegen staatliche Eingriffe haben sich der Deutsche Bauernverband, der Milchindustrieverband und der Deutsche Raiffeisenverband ausgesprochen. Für die nationale Umsetzung des GMO-Artikels 148 plädieren die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, der Bund deutscher Milchviehhalter und das MEG Milch Board.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium erhofft sich “einen Impuls für eine stärkere Verbreitung von Festpreisen und Preisabsicherungsmodellen mit Mengenbezug” durch die nationale Umsetzung des GMO-Artikels 148. Das könne die Preisstabilität und damit die Planungssicherheit auf Erzeugerebene verbessern, teilt das BMEL Table.Briefings mit. “Das Preisrisiko wird dadurch fairer zwischen Erzeugern und Molkereien aufgeteilt”, so ein BMEL-Sprecher.
Mit Milchmarktexperte Prof. Holger Thiele, Vorstand des ife Instituts für Ernährungswirtschaft Kiel, haben wir im Interview über die Auswirkung staatlicher Eingriffe auf Erzeugerpreise für den Rohstoff Milch und Verbraucherpreise für Trinkmilch gesprochen.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!


Schon die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, Artikel 148 der Gemeinsamen Marktorganisation national umzusetzen, wenn sich an den Milchpreisen für Bauern nichts ändere. Nun will ihr Nachfolger Cem Özdemir (Grüne) die Lieferbeziehungen ändern. Wie bewerten Sie das?
Die Forderung nach einer Überprüfung der Preissysteme finde ich zwar sinnvoll, weil die Erzeugerpreise für Milch grundsätzlich zu stark schwanken. Aber schon seit Längerem plädiere ich eher dafür, für Teilmengen mit einem entsprechenden freiwilligen Risikomanagement der Molkereien darauf zu reagieren, anstatt staatlich einzugreifen. Viele Molkereien haben sich in Europa und auch hier auf den Weg gemacht. Die Umsetzung ist aber nicht so einfach, insbesondere weil stabile abgesicherte Preise üblicherweise nicht die höchsten Preise sind. Viele Milcherzeuger wählen dann häufig statt fixierter stabiler Milchpreise lieber die Aussicht auf einen höheren Preis, was möglicherweise aber nicht eintritt.
Aber das BMEL rechnet mit mehr Planungssicherheit für Milcherzeuger. Können Milcherzeuger ihre Produktion dadurch besser steuern?
Doch, es könnte tatsächlich dazu führen, dass Milchbauern beispielsweise ihre Produktionsmenge drosseln, sollte der voraus fixierte Milchpreis über einen längeren Zeitraum niedrig sein. Und das dürfte eintreten, weil sich durch die Vorausfixierung der Erzeugerpreise das Risiko der Molkereien erhöht.
Zwar können Milchbauern anschließend eine Nachzahlung erhalten. Aber diese Ausschüttung erfolgt deutlich nach der Anlieferung und zeitverzögert und bietet daher aus meiner Sicht keinen Anreiz zur Steigerung der Produktion.
Entsprechend planbar ist das aber nur, wenn die Höhe des Fixpreises über mehrere Monate im Voraus bekannt ist. Diese zeitliche Vorgabe macht der GMO-Artikel 148 aber gar nicht. Und: Je länger der Zeitraum der Vorausfixierung der Erzeugerpreise, desto geringer müsste aufgrund von Risikoabschlägen der Milcherzeugerpreis sein.
Nach dieser Logik dürfte sich auch nach nationaler Umsetzung des Artikels 148 nichts an Verbraucherpreisen für Frischmilch ändern. Richtig?
Genau. Ich bezweifle, dass die Milch im Kühlregal deswegen teurer wird. Ich rechne in diesem Szenario eher mit Erzeugerpreisen, die inklusive der Nachzahlung und den Absicherungskosten unter das aktuelle Niveau fallen. An den Preisen für Verbraucher dürfte sich darum kaum etwas ändern.
Übrigens, 2003 hat der EU-Agrarministerrat die Weichen für niedrige Erzeugerpreise selbst gestellt, indem er die festgelegten garantierten Mindestpreise für Milch (Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver) schrittweise abgesenkt hat.
Wird die Tendenz zu niedrigen Erzeugerpreisen für den Rohstoff Milch dadurch verschärft, dass die Hälfte der in Deutschland produzierten Milchmenge in den Export geht?
Wenn der Milchpreis auf dem Weltmarkt fällt oder steigt, beeinflusst dies das nationale Preisniveau für Erzeuger. Fällt der Weltmarktpreis, sinken die Absatzalternativen auf den internationalen Märkten für unsere Waren, und unsere Preise sinken. Steigt der Weltmarktpreis, steigen unsere alternativen Verkaufsmöglichkeiten und wir müssen nicht billiger im Inland verkaufen. Gleiches gilt auch für den Preiszusammenhang zu unserem EU-Handelspartner. Sinkende und steigende internationale Preise wirken sich dann auch auf die handelsüblichen Preise für Trinkmilch oder andere Milchprodukte aus. Dieses Phänomen ruft bei einigen Milcherzeugern großes Unwohlsein hervor, obwohl wir in der EU und in Deutschland seit 2007 mehrheitlich eher von höheren internationalen Preisen profitieren, aber gleichzeitig auch sehr viel höhere Preisschwankungen haben.
Folgt man Ihrer Argumentation, machen sich Lebensmitteleinzelhandel und Molkereien also gar nicht die Taschen auf Kosten der Milchbauern voll, richtig?
Nein, die Wettbewerbsintensität ist für alle sehr hoch und die Molkereien haben eine Sandwichposition zwischen Handel und Milcherzeugern. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die erhöhten Preisrisiken in der Wertschöpfungskette Milch nicht einseitig von den Milcherzeugern oder Molkereien getragen werden, sondern besser verteilt werden. Dass Preise zeitweise unterhalb der Summe aus variablen und fixen Kosten liegen, ist übrigens leider kein Spezifikum des Milchmarktes. Vorausgesetzt der Deckungsbeitrag ist positiv, macht es aus betriebswirtschaftlicher Sicht trotzdem Sinn, weiterhin Milch zu produzieren, um einen Teil der Fixkosten zu decken. Längerfristig müssen natürlich die Vollkosten gedeckt sein.
Trotzdem haben Vertreter der Milchindustrie darum gekämpft, dass Lieferanten von Frischwaren wie Milch im Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz bis zu einem Jahresumsatz von vier Milliarden Euro vor unfairen Praktiken des Lebensmitteleinzelhandels geschützt sind …
Nichtsdestotrotz hat das Thünen-Institut in einem vom BMEL in Auftrag gegebenen Gutachten zur Evaluierung der Lieferbeziehungen im Jahr 2023 festgestellt, dass es keine Dysfunktionalität, also kein Marktversagen, entlang der Wertschöpfungskette Milch gibt. Infolgedessen analysiert das Institut, staatliche Eingriffe in die Lieferbeziehungen seien nicht gerechtfertigt.
Milchbauern sitzen in Vorstandsgremien genossenschaftlicher Molkereien und sind bei den Festlegungen von Auszahlungspreisen üblicherweise dabei. Warum sind die Fronten zwischen AbL, BDM und MEG Milch Board auf der einen Seite und dem MIV, DBV, DRV auf der anderen Seite verhärtet?
Das ist wirklich fraglich, weil genossenschaftliche Molkereien demokratische Entscheidungsstrukturen haben. Entweder handelt es sich um eine Minderheit, die da aufbegehrt und die nationale Umsetzung von GMO-Artikel 148 fordert. Wenn es die Mehrheit wäre, die nicht gehört wird – was ich vor dem Hintergrund unserer Analysen bezweifle – dann kann es an mangelnder Entscheidungsfindung liegen. Aber: wenn einem Großteil der Milcherzeuger, die stimmberechtigtes Mitglied in einer Genossenschaft sind, etwas nicht gefällt, müssten sie es vom Prinzip her ändern können.
Führen wir die Diskussion an falscher Stelle und man müsste eigentlich dem Lebensmitteleinzelhandel gesetzlich vorschreiben, seinen Lieferanten fixe Preise weit im Voraus zuzusichern?
Das wäre ein massiver ordnungspolitischer Eingriff und würde nicht viel ändern, da rund 50 Prozent des in Deutschland produzierten Rohstoffs exportiert wird und unsere Preisschwankungen bisher nur zu einem kleinen Anteil durch unser Verhalten oder durch Maßnahmen im Inland bestimmt werden. Noch einmal: Der Haupteinfluss kommt aus dem EU-weiten und internationalen Milchprodukte-Handel, von dem wir sehr stark profitieren.
Angenommen, der Lebensmitteleinzelhandel würde fixe Preise im Voraus zusichern, ist davon auszugehen, dass dieser, ebenso wie es die vorgelagerte Stufe der Molkereien machen müsste, Risikoabschläge einbehält oder ebenfalls Preisabsicherungsmodelle umsetzen müsste. Verbraucher in Deutschland sind sehr preissensibel und der LEH steht, wie schon betont, unter einem enormen Wettbewerbsdruck.
Seit Dienstag verhandeln Delegierte von rund 180 Staaten im kanadischen Ottawa in der nunmehr vierten Runde über ein globales Abkommen gegen Plastikmüll. Die zweite und dritte Runde 2023 brachten nur wenige Fortschritte. In Paris ging es um Verfahrensfragen. In Nairobi verhandelte man in der Sache, aber es konnte weder der allererste Entwurf konsolidiert noch ein Mandat für Verhandlungen zwischen den Runden vereinbart werden. Das lag vor allem an der Blockade einiger Ölförderländer wie Saudi-Arabien, Iran und Russland. In Ottawa muss es deutlich vorangehen, damit ein Abkommen erreichbar bleibt.
Plastik hat enorm schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die menschliche Gesundheit. Das Material wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen, beinhaltet schädliche chemische Zusatzstoffe, gibt Mikro- und Nanoplastik ab und in vielen Ländern landet es als Müll auf dem Land oder im Wasser. Das Problem: Die Menge an produziertem Plastik hat sich laut OECD von 2000 bis 2019 auf 460 Millionen Tonnen verdoppelt. Die Organisation erwartet, dass sich das Aufkommen an Plastikabfall von 2019 bis 2060 fast verdreifachen wird. Gleichzeitig werde der Recyclinganteil von etwa neun auf 17 Prozent steigen. Damit ist die Welt beim Plastik noch weit von einer Kreislaufwirtschaft entfernt.
Die Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty fordert ein wirksames Ziel für die Minderung der Produktion von Primärplastik. Erst wenn sie um mehr als drei Prozent jährlich sänke, würde die Menge laut der Initiative von über 350 Wissenschaftlern tatsächlich abnehmen. Denn wegen der “kumulativen Natur” von Plastikverschmutzung könnten Technologien für Beseitigung und Recycling nicht genug für die Eindämmung der Negativfolgen leisten. “Das Ziel sollte also deutlich über drei Prozent liegen“, sagt Melanie Bergmann, Biologin am Alfred-Wegener-Institut und Teil des Zusammenschlusses sowie der deutschen Delegation.
Zwar sagt das Mandat, dass der gesamte Lebenszyklus von der Produktion bis zur Entsorgung berücksichtigt werden soll. Wie in den Verhandlungen die Schwerpunkte gesetzt werden sollen, ist aber unter den Staatenvertretern in Ottawa umstritten. Die High Ambition Coalition aus 64 Staaten, darunter Deutschland, spricht sich dafür aus, den gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen.
Dagegen versuchen einige Staaten mit starker Fossil-Industrie, den Fokus auf Recycling zu lenken, sagen Teilnehmer. Laut einer Studie der Universität Lund wollen die meisten Staaten zwar erklärtermaßen die Plastikverschmutzung beenden. Aber nur wenige äußerten sich bislang zur Notwendigkeit, die Produktion von Plastik zu reduzieren oder zu regulieren. Das fordern vor allem NGOs im Vorfeld der Ottawa-Runde.
So verlangt der WWF, “einem globalen und verbindlichen Verbot der schädlichsten und vermeidbaren Kunststoffe Vorrang einzuräumen“. Zudem müssten Anforderungen an das Produktdesign festgelegt werden, “um die Reduzierung, Wiederverwendung und das sichere Recycling aller Kunststoffprodukte zu gewährleisten”.
Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe, sagte Table.Briefings, die größte Lenkungswirkung bestehe für den europäischen Verband der Kunststofferzeuger darin, “dass das UN-Plastikabkommen Kunststoffabfälle als wertvollen Rohstoff behandelt” und Anreize für Wiederverwertung und Recycling schaffe.
Produkte sollten gleich so gestaltet werden, dass sie “am Ende ihrer Nutzung wieder konsequent in den Kreislauf zurückgeführt werden können”, sagt Bühler. “Verbote, Negativ-Listen und Produktionseinschränkungen, wie sie von einigen NGOs gefordert werden”, hält er für kontraproduktiv, weil der Bedarf an Plastik angesichts von Energiewende, Digitalisierung oder Gesundheit steige. Laut Doris Knoblauch, Co-Koordinatorin für Plastik am Ecologic Institute, braucht es aber “auch Investitionen für neue Geschäftsmodelle – etwa mit Blick auf Produktdesigns, die Recycling ermöglichen”.
Unterschiedliche Interessen verfolgen in der Frage auch die Länder des globalen Südens. “Hier wird es schwierig, denn unter den traditionellen Entwicklungsländern sind einige der größten Plastikproduzenten, etwa China. Gleichzeitig ist der Pro-Kopf-Konsum viel größer im globalen Norden“, sagt David Azoulay, geschäftsführender Anwalt vom Center for International Environmental Law in Genf. Zum Beispiel hat Ghana vergangenes Jahr eine globale Plastikabgabe für die Produzenten vorgeschlagen, um den Plastikmüll zu begrenzen.
Über die Frage der Finanzierung dürfte in Ottawa erneut gestritten werden. “Hier gibt es einen Konflikt, der sich immer mehr herauskristallisiert”, sagt die Wissenschaftlerin Bergmann. Denn der Aufbau einer funktionsfähigen Abfallwirtschaft und die Beseitigung von Plastik aus der Umwelt in besonders verschmutzten Regionen kostet viel Geld und stellt vor allem ärmere Länder vor enorme Herausforderungen. Plastics Europe spricht sich für eine Beteiligung der Hersteller an den Kosten für Entsorgung und Verwertung aus.
Nach Ansicht der meisten Akteure sollten die Verschmutzer zahlen. Aber wer ist das – der Produzent, die weiterverarbeitende Industrie oder der Konsument? Wie die Diskussionen ausgehen, hängt auch davon ab, wie die Teilnehmer letztlich die Verantwortung von Staaten, Produzenten und Konsumenten einschätzen. Es gebe Staaten wie Brasilien, die sich für das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung (aus dem Klima-Abkommen von Rio) einsetzen, heißt es von Beobachtern.
Ebenfalls umstritten ist, welche Verpflichtungen das Abkommen enthalten soll. Das Mandat sagt, dass das Abkommen verbindlich sein soll. Dies lässt aber Spielraum, um grundsätzliche Ziele oder spezifische Verpflichtungen festzulegen. Ein gutes Beispiel für den ersten Fall sei das Pariser-Klimaabkommen, sagt David Azoulay. “Das Abkommen ist rechtsverbindlich, aber was die Staaten tun sollten, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, ist eine Liste mit freiwilligen Maßnahmen”, erklärt der Experte für internationales Umweltrecht.
Beim Plastikabkommen könnten auch spezifische Verpflichtungen festgelegt werden – mit Maßnahmen, die alle umsetzen müssen, sagt Florian Titze, Senior Policy Advisor beim WWF Deutschland und bei den Verhandlungen vor Ort. “Darum wird aber sehr stark gestritten“, ergänzt er. Neben Staaten wie Saudi-Arabien und Iran drängten auch die USA auf ein Plastikabkommen im Paris-Stil – ohne strenge Verpflichtungen, sagt Azoulay.
Über all diesen Punkten schwebt die Frage, nach welchen Regeln die Staaten am Ende eine Entscheidung treffen können. “Das ist der Elefant im Raum”, sagt der Aktivist Titze. Das Problem: Laut den Verfahrensregeln, die 2022 beschlossen wurden, sollen Entscheidungen einvernehmlich fallen. Wenn alle Mittel erschöpft sind, soll aber auch eine Zweidrittelmehrheit reichen.
Bei der zweiten Verhandlungsrunde versuchte eine kleine Gruppe von Staaten, die Entscheidungsregeln neu zu diskutieren, um die Möglichkeit einer Mehrheitsentscheidung auszuschließen. Man einigte sich auf ein sogenanntes interpretatives Statement. Im Falle einer Abstimmung werde das Verhandlungskomitee eine mögliche Uneinigkeit berücksichtigen. Das Konsensprinzip fordern unter anderem Saudi-Arabien, Iran, Russland, Brasilien, China und Indien.
Aus juristischer Sicht seien die Verfahrensregeln zur vorläufigen Anwendung angenommen, weshalb auch abgestimmt werden könne, sagt der Jurist Azoulay. Trotzdem erwartet er aber nicht, dass es dazu kommt – vor allem wegen des Widerstands der genannten Staaten und der Tatsache, dass Staaten mit ehrgeizigen Zielen nicht bereit seien, sich mit den Verhinderungsstrategien auseinanderzusetzen. “Das ist bedauerlich, denn allein die Möglichkeit einer Abstimmung könnte zu Kompromissen führen. Um ein wirklich praktikables Abkommen durchzubekommen, muss es einen Weg geben, auf eine Entscheidung zu drängen”, betont Azoulay. Die Zeit ist knapp. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde findet Ende November im südkoreanischen Busan statt.
Das Europäische Parlament tagt diese Woche zum letzten Mal vor der Europawahl Anfang Juni in Straßburg. Es ist die letzte Chance, noch Gesetze zu verabschieden. Über eine Reihe von Agrar- und Ernährungsdossiers wird nun im Endspurt abgestimmt.
Final unter Dach und Fach gebracht werden sollen – bis auf die abschließende formale Zustimmung des Ministerrats – folgende Themen:
Die Zustimmung zu den Entlastungsvorschlägen der Kommission gilt als relativ sicher. Ein Gutachten des juristischen Dienstes im Parlament, das der Umweltausschuss angefordert hatte, steht dem nicht im Weg: Die Rechtsexperten haben nichts zu beanstanden. Spannend wird, ob Änderungsanträge durchkommen. Dann müssten die Mitgliedstaaten diese wortgleich akzeptieren, damit die Verabschiedung vor der Wahl möglich ist. Wahrscheinlichstes Szenario aber: Das Plenum stimmt ohne Änderungen zu, das Dossier wird rechtzeitig zum Wahlkampf verabschiedet.
Das Thema ist umstritten, und es liegen mehrere Änderungsanträge vor. Trotzdem ist die Zustimmung des Parlaments wahrscheinlich, weil es die letzte Chance ist, die Handelserleichterungen für die Ukraine vor Ablauf der bestehenden zu verlängern. Die Forderung des Parlaments, Schutzmaßnahmen auch für Getreide zu erlassen, ist zwar nicht Teil der Einigung. An anderer Stelle wurden Schutzmaßnahmen für Agrarprodukte aber auf Drängen mehrere Mitgliedstaaten noch einmal ausgeweitet. Das dürfte es Kritikern des Freihandels – vor allem Agrarpolitikern und Abgeordneten aus Ukraine-Anrainerstaaten – erleichtern, zuzustimmen.
Der Trilogeinigung über die Lieferkettenrichtlinie, deren Annahme im Rat über mehrere Wochen auf der Kippe stand, muss nun auch das Parlament noch formal zustimmen. Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis der Verhandlungen noch einmal deutlich entschärft, indem sie etwa den Anwendungsbereich verkleinert und die Risikosektoren gestrichen haben.
Die Einigung zwischen Rat und Parlament von Anfang März soll angenommen werden. Dass zwei kurzfristig eingereichte Änderungsanträge von Andreas Glück (FDP) noch angenommen werden, ist unwahrscheinlich. Glück möchte bestimmte Mehrwegziele für Verpackungen streichen, die Unternehmen für den Transport von Produkten zwischen ihren eigenen Standorten und innerhalb eines Mitgliedstaats verwenden. Vertreter der Mitgliedstaaten hatten das Verhandlungsergebnis bereits vor Ostern angenommen.
Die Zustimmung zur Trilogeinigung zwischen Rat und Parlament, die unter anderem die Schaffung eines Notfallteams gegen Pflanzenschädlinge vorsieht, gilt als sicher.
Folgende Dossiers werden nicht mehr vor der Wahl abgeschlossen, das Parlament will aber noch Zwischenschritte unternehmen:
Das Parlament hatte seine Verhandlungsposition im Januar angenommen. Mit einer erneuten Abstimmung soll diese festgezurrt werden und müsste so nicht mehr nach der EU-Wahl bestätigt werden. Davon, dass das gelingt, ist auszugehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten herrscht weiter Stillstand.
Das Parlament nimmt seine Verhandlungsposition an. Im Rat gibt es bisher kaum Fortschritte zum Thema, bis zur finalen Verabschiedung des Vorschlags kann es deshalb noch dauern. jd/leo
Am Mittwoch will das EU-Parlament seine Verhandlungsposition zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Saatgutverordnung annehmen. Pflanzenzucht- und Agrarverbände kritisieren vorab Änderungsvorschläge des EU-Agrarausschusses. Doch auch innerhalb der Branche herrscht keine Einigkeit. Mit der Verordnung soll eine Vielzahl verschiedener EU-Rechtsakte zusammengeführt und reformiert werden. An zwei Punkten entzünden sich die Meinungsverschiedenheiten:
Der Agrarausschuss fordert weitergehende Ausnahmen, die es Landwirten erlauben, begrenzte Mengen an Saatgut auszutauschen. Austausch und Verkauf sogenannter Erhaltungssorten sollen von Vorschriften ausgenommen werden, um Sortenvielfalt zu fördern.
Der Kleinbauernverband Via Campesina sieht das als “klare Verbesserung in Bezug auf die Rechte der Bauern am Saatgut”. Der EU-Bioverband IFOAM begrüßt, dass die genetische Vielfalt auf europäischen Äckern verbessert werde. Züchter und große Agrarverbände sehen das anders. Zusätzliche Ausnahmen brächten “großes Potenzial für Missbrauch und phytosanitäre Risiken”, warnen BDP, DRV und weitere deutsche Verbände in einem gemeinsamen Statement. Ähnliche Kritik kommt vom EU-Bauernverband Copa Cogeca.
Soll eine Sorte neu zugelassen werden, muss diese laut Verordnungsvorschlag mehr zu “nachhaltigem Anbau und Nutzung” (VSCU) beitragen als bestehende Sorten. Das umfasst Kriterien wie Ertrag, Schädlings- und Klimaresistenz und die effiziente Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Nährstoffe. Der AGRI-Ausschuss will hier lockern: Bei Gemüse- und Obstsorten soll die entsprechende Prüfung freiwillig sein, weil diese Sorten nicht Teil des bisherigen Kontrollsystems sind und dieses erst neu aufgebaut werden müsste.
Der BDP begrüßt das: Dass “neu zugelassene Sorten den Zielen einer nachhaltigen Landwirtschaft zuträglich sind”, sei ohnehin sichergestellt, meint Geschäftsführer Carl-Stephan Schäfer. Kritik kommt aus der Landwirtschaft. Angesichts des Klimawandels steige unter Landwirten “die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsbewertungen”, argumentiert Copa Cogeca. Der Verband pocht deshalb auf verpflichtende Tests auch für Gemüsesorten, könnte sich aber eine längere Übergangsphase vorstellen. Auch in Parlamentskreisen sowie beim EU-Saatgutverband Euroseeds sieht man das als möglichen Kompromiss.
Für die Plenarabstimmung hat die liberale Renew-Fraktion mehrere Anträge vorgelegt, die die umstrittenen AGRI-Vorschläge zurückdrehen würden. Gut informierte Kreise halten es für möglich, dass das im Plenum Erfolg hat. Obwohl das Parlament seine Verhandlungsposition am Mittwoch annehmen will, dürfte es bis zur Verabschiedung des Gesetzestexts noch dauern. Denn im Rat hat die politische Arbeit an dem Dossier noch nicht begonnen. jd
Immer wieder sind die Parteien der Ampel-Koalition uneins – auch, wenn es darum geht, wie Deutschland sich bei Abstimmungen zu EU-Dossiers positioniert. Ist die Bundesregierung gespalten, muss sie sich in Brüssel enthalten. Weil das in der Vergangenheit oft der Fall war, hat dieses Abstimmungsverhalten jetzt einen Namen – German Vote. Im Bereich Agrar- und Ernährung konnte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zuletzt vor allem mit der FDP oft nicht einigen: zum Beispiel bei der Deregulierung neuer Gentechniken oder der Zulassung von Glyphosat. Auch bei der Lieferkettenrichtlinie enthielt sich die Bundesregierung. Bei der Verpackungsverordnung einigten sich SPD, Grüne und FDP erst in letzter Minute.
Die Häufung von deutschen Enthaltungen über alle Politikfelder hinweg ist bemerkenswert, wie eine neue Datenbank zeigt. Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat darin das Abstimmungsverhalten der nationalen Regierungen in mehr als 1.300 öffentlichen Abstimmungen im EU-Rat seit 2009 erfasst. Der EU Council Monitor der SWP ist hier online verfügbar.
Die Datenbank zeigt, dass sich Deutschland im Laufe von gut 13 Jahren 34 Mal bei den Abstimmungen enthalten hat und 28 Mal dagegen votierte, also im Durchschnitt jeweils gut zweimal pro Jahr. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen häuften sich zur Mitte der Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel, den Höchstwert markiert das Jahr 2013 mit 14 solcher Vote.
Allerdings: Die Statistik erfasst nur formelle Abstimmungen im Rat. Über die verlängerte Zulassung von Glyphosat und Ausnahmeregelungen in der GAP für 2024 wurde aber in einem anderen Verfahren von Vertretern der Länder in den zuständigen Ausschüssen der Kommission abgestimmt. Diese Themen – zu beiden enthielt sich Deutschland – sind also nicht erfasst. Zudem erfasst die Datenbank aktuell nur Abstimmungen bis September 2023. Sie soll im weiteren Verlauf aktualisiert werden. tho/jd
Das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz (KLWG) von Bundesernährungsminister Cem Özdemir ist noch nicht tot, wie manche Beobachter aufgrund des monatelangen Stillstands annehmen, sondern soll noch vor der Sommerpause im Bundeskabinett beraten werden. Wie Table.Briefings aus den Koalitionsfraktionen erfuhr, soll es bereits Anfang März zwischen den Koalitionsparteien eine Verständigung gegeben haben, dass das Bundesernährungsministerium (BMEL) den vorliegenden Referentenentwurf nochmals überarbeiten und bis zur Sommerpause ins Kabinett einbringen soll.
Ein BMEL-Sprecher wollte zwar nicht bestätigen, dass es eine derartige Verständigung gegeben habe. Minister Özdemir sei aber regelmäßig mit SPD und FDP in Gesprächen über das KLWG. “Und wir sind optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen werden”, fügte er hinzu. Özdemir liege weiterhin viel daran, das Projekt zum Erfolg zu bringen. Beobachter räumen dem KLWG jedoch kaum Chancen auf Realisierung ein, wenn sich die Koalitionspartner nicht vor der Sommerpause noch auf einen Gesetzentwurf einigen.
Die FDP lehnt den vorliegenden Referentenentwurf bisher kategorisch ab. Sie kritisiert, dass er ein pauschales TV-Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel zu den Hauptsendezeiten beinhalte und nicht den Abmachungen im Koalitionsvertrag entspreche. Zuletzt hatten FDP-Politiker ihre Ablehnung noch vor zwei Wochen in einer Bundestagsdebatte zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung bekräftigt. Die SPD steht offiziell zu Özdemirs Referentenentwurf, wobei es auch ablehnende Stimmen vom Wirtschaftsflügel der Partei gibt. mo
Alkoholfreie Weine können in der EU derzeit nicht als ökologisch eingestuft werden, da Verfahren zur Entalkoholisierung nicht für die ökologische Weinerzeugung zugelassen sind. Das will die Europäische Kommission – zuständig in dieser Angelegenheit – nun ändern und die Möglichkeit der Vakuumdestillation prüfen, mit der Alkohol im Wein reduziert oder entfernt werden kann. Es werde zeitnah ein wissenschaftliches Gutachten einer Expertengruppe erwartet, das es ermöglichen werde, einen Rechtsvorschlag auf den Weg zu bringen, sagte Pierre Bascou von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der EU-Kommission Mitte April im AGRI-Ausschuss des EU-Parlaments.
Dass die Entalkoholisierung in der Öko-Verordnung bislang nicht erlaubt sei, könne man eigentlich niemandem erklären, meint Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er hatte deshalb bereits im März in Brüssel für eine “zeitgemäße und zielgerichtete Anpassung der Öko-Verordnung” geworben. Denn: “Dieser Schritt öffnet die Tür zu einem zusätzlichen wachsenden Markt, ist im Sinne des deutschen Weinbaus und stärkt ihn damit nachhaltig.”
Auch Kathrin Jäckel, Geschäftsführerin beim Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN), der viele Hersteller und Händler von alkoholfreiem Bio-Wein vertritt, moniert, dass die notwendigen Anpassungen des EU-Öko-Rechts von der EU-Kommission vernachlässigt wurden. “Diese Versäumnisse haben schwerwiegende Konsequenzen für die Hersteller*innen und Händler*innen von alkoholfreiem Bio-Wein und auch für die Verbraucher*innen, die die entsprechenden Produkte aktuell nicht mit einer Bio-Zertifizierung handeln dürfen”, sagt Jäckel.
Entstanden war das Problem Ende 2021, als die EU die Regulierungskompetenz für alkoholfreien Wein vom europäischen Lebensmittelrecht ins Weinrecht verlagerte. Alkoholfreier Bio-Wein durfte daraufhin nicht mehr verkauft werden. Deutsche Hersteller hatten deshalb begonnen, ihre Produkte als “alkoholfreie Getränke aus Bio-Wein” zu bezeichnen. Doch auch damit war zum Jahresbeginn Schluss, nachdem die EU die begriffliche Übergangslösung, die Deutschland im Alleingang gefunden hatte, als Marktverzerrung eingestuft hatte. heu
Äpfel und Rindfleisch aus Deutschland können künftig auch in China verzehrt werden. Entsprechende Erklärungen zur Aufhebung von Handelsbeschränkungen hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vergangene Woche während seiner China-Reise mit Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichnet. Beim Schweinefleisch, das Deutschland seit Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Jahr 2020 nicht mehr nach China exportieren darf, gelang Özdemir während der Reise jedoch kein Durchbruch. Der Grünen-Minister nannte dafür “außerlandwirtschaftliche” Gründe.
“Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht”, betonte Özdemir. Beim Schweinefleisch erfülle Deutschland hinsichtlich der ASP alle Anforderungen an Qualität und Sicherheit sowie Zuverlässigkeit bei der Lieferung.
Gespräche habe er in China vor allem mit seinem Amtskollegen Tang Renjian und Minister Yu Jianhua von der Hauptzolladministration der Volksrepublik geführt, ließ Özdemir nach seiner Rückkehr in Berlin wissen. Sein Resümee: “Es gibt eine hohe Wertschätzung für deutsche Produkte in China.” Deutsch gelte als Metapher für Qualität, so der Bundeslandwirtschaftsminister.
Dass die Handelsbeschränkungen für Rindfleisch infolge der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) nach 20 Jahren endlich ausgeräumt werden konnten, sei ein großer Erfolg, meint Özdemir weiter. Es sei zudem ein Quantensprung, dass es erstmals gemeinsame Regeln für die Ausfuhr von Äpfeln gebe. “Beim Export von Schweinefleisch werden wir die Gespräche fortsetzen”, kündigte er an. Und nicht nur dabei: “Wolle, Gerste, Lammfleisch und Geflügel stehen jetzt auch noch auf dem Zettel”.
Im Vorfeld der Reise war erwartet worden, dass Özdemir in Peking unter anderem die Aufhebung des chinesischen Importverbots für deutsches Schweinefleisch verhandeln wird. China hatte ebenso wie andere Länder 2021 die Einfuhren aufgrund der Afrikanischen Schweinepest ausgesetzt. Südkorea hatte den Handel bereits im Mai 2023 wieder zugelassen. heu
Der Agrarexperte Friedhelm Taube staunt über die Reaktion von Bauernpräsident Joachim Rukwied auf das Entlastungspaket für die Landwirte. Rukwied hatte von einem “Placebo” gesprochen und mit neuen Protesten gedroht. Taube sagte Table.Briefings, dass allein schon die Aussetzung der Pflicht zur Flächenstilllegung den Wegfall des Rabatts auf Agrardiesel kompensiere. Denn der Verlust der Dieselzuschüsse beläuft sich für einen 100-Hektar-Betrieb auf eine Mehrbelastung von etwa 2000 Euro pro Jahr, bei einem Einsatz von 80 Litern Diesel pro Hektar und rund 25 Cent Euro Rabatt pro Liter. Aufgewogen wird er durch das Aussetzen der eigentlich obligatorischen Vier-Prozent-Brache, die bei gleicher Betriebsgröße zu Mindereinnahmen von 2.000 bis 2.400 Euro führen würde.
Obendrauf erhalten die Landwirte nun weitere staatliche Zuwendungen. Durch Ersparnisse bei der Stromsteuer, eine geplante steuerliche Gewinnglättungsmöglichkeit sowie neue Förderungen der Länder für Versicherungen würde vielen Betrieben die Abschmelzung des Agrardiesel-Rabatts daher “deutlich überkompensiert”, kritisiert Taube. Dabei gehe es den Bauern prächtig. “Der Sektor verzeichnete allein durch die steigenden Preise für Land in den letzten 15 Jahren einen Vermögenszuwachs von 170 Milliarden Euro”, sagt der Forscher, der zehn Jahre lang zum Expertenrat des Bundeslandwirtschaftsministeriums gehörte – nämlich 10.000 Euro pro Hektar gerechnet auf 17 Millionen Hektar Agrarfläche.
Die von Cem Özdemir genehmigte Aussetzung der Brachen sei ein Kotau vor den Bauern. Denn aus wissenschaftlicher Sicht seien nicht nur vier, sondern mindestens zehn Prozent Brachfläche nötig, sagt Taube. Nur so bleibe die agrarische Insekten- und Vogelfauna erhalten sowie der “Gen-Flow” durch den Austausch von Wildtieren und Samen. Vor 2008 hätten die Landwirte freiwillig acht bis zehn Prozent ihrer Flächen brachgelegt: Weil die Preise ob der Überproduktion damals ins Bodenlose fielen. Ab
Trotz deutlicher Kritik von Grünen, Umweltschützern, aber auch Wissenschaftlern dürfte das EU-Parlament am heutigen Dienstag für die vorgeschlagenen Lockerungen bei der GAP stimmen. Dass sich das im Voraus so deutlich sagen lässt, liegt daran, dass die europäischen Liberalen, die Renew-Fraktion, den Schritt größtenteils unterstützen.
Die Ausnahmeregeln und Lockerungen, die die Kommission vorgeschlagen hat, brauche es, “um den Bedürfnissen der Landwirte gerecht zu werden“, sagt Valérie Hayer, seit Ende Januar Renew-Chefin, zu Table.Briefings. Zwar habe die laufende EU-Legislaturperiode mit einer Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) begonnen, “damit sie grüner wird und den Landwirten mehr Geld einbringt.” Heute befände man sich aber in der Umsetzungsphase und es seien Mängel aufgetaucht.
Bei der Europawahl tritt Hayer, deren Eltern selbst Landwirte sind, als Spitzenkandidatin von Renaissance an, der Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Anders als die deutsche FDP haben viele Renaissance-Abgeordnete in der Vergangenheit beispielsweise für das im Agrarsektor umstrittene Renaturierungsgesetz gestimmt. Dass sie bei der GAP wiederum auf die Bauern zugehen, dürfte auch am starken Einfluss der Bauernproteste in Frankreich liegen. Dem Vernehmen nach wird eine große Mehrheit der französischen Liberalen, die die größte nationale Delegation in Renew stellen, für die Lockerungen stimmen.
Trotzdem sollte der Green Deal “nicht gegen die Landwirtschaft ausgespielt” werden, betont Hayer. Das gelte auch für die nächste Amtszeit. Sie fordert, “eine umfassendere und strukturelle Überlegung” über die Zukunft der Landwirtschaft in Europa.
Freihandelsabkommen, die den Import von Agrarprodukten aus Ländern ermöglichen, in denen nicht dieselben Umweltauflagen wie im EU-Binnenmarkt gelten, sieht Hayer dagegen kritisch. Sie hält die Wut der Landwirte für berechtigt. “Was hier auf dem Spiel steht, ist die Frage der Vergütung und des fairen Wettbewerbs.”
Sie unterstützt deshalb die Idee gegenseitiger Umweltstandards, die im Brüsseler Jargon als “Spiegelklauseln” bezeichnet werden. Europäische Produktionsstandards, zum Beispiel zu Umwelt und Klima, würden dabei auch auf Importe angewendet. In diesem Sinne fordert Hayer eine “neue Generation” von Handelsabkommen, “die auf den Pariser Klimazielen und dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen”.
Das EU-Mercosur-Abkommen ist für sie kein solcher Deal der Zukunft, sondern ein “schlechtes Abkommen.” Anders als jenes mit Chile, das am 1. Mai in Kraft tritt. Das sei besser, so Hayer, weil es ein Kapitel zur Nachhaltigkeit von Nahrungsmittelsystemen enthält. cs/jd
21.04. – 24.04.2024 / Brüssel
Konferenz World Cocoa Conference 2024
Die Weltkakaokonferenz ist die führende Veranstaltung für den globalen Kakao- und Schokoladensektor, auf der alle Akteure der Kakaowertschöpfungskette – Regierungen, Kakaobauern, Genossenschaften, Exporteure, Händler, Hersteller, Marken, Einzelhändler, Finanzinstitute, Logistikunternehmen, internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Wissenschaftler usw. aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Meinungen auszutauschen und Lösungen für die Nachhaltigkeit des Sektors zu finden. INFO
23.04.2024 – 11.00 Uhr / online
Veröffentlichung EFSA Bericht Pestizidrückständen in Lebensmitteln
Die EFSA präsentiert ihren dreijährlichen Bericht zu Pestizidrückständen in Lebensmitteln. Ab 11 Uhr können dir Daten hier abgerufen werden. Studie
24.04.2024 – 12.00 – 14.00 Uhr / Brüssel
Plenartagung Europäisches Parlament Aussprache und Abstimmung zu NGT Pflanzen und zum Schutz vor Pflanzenschädlingen
Themen: GAP-Lockerungen & Ukraine-Handelserleichterungen, Lieferkettengesetz, Verpackungsverordnung, Verordnung zur Pflanzengesundheit, Saatgutverordnung, Neue Züchtungstechniken Tagesordnung
24.04.2024 – 14.00 – 15.30 Uhr / Rom, online
High-Level Event Launch on the Global Report on Food Crisis
2024 Global Report on Food Crises launch event in Rome. ANMELDUNG
24.04. – 25.04.2024 / Eichhof in Bad Hersfeld
Tagung 3. BZL-Bildungsforum: “Neue Formate in der landwirtschaftlichen Berufsbildung”
Von Nachhaltigkeit im Unterricht über die Motivation der Schülerschaft bis hin zur Drohnentechnik im Pflanzenbau – um “Neue Formate in der landwirtschaftlichen Berufsbildung” geht es beim 3. Bildungsforum für die berufliche Bildung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL). INFO & ANMELDUNG
25.04. – 26.04.2024 / Kaiserslautern
Konferenz Ergebniskonferenz der 36 vom BMEL geförderten KI-Projekte
Forscherinnen und Forscher haben KI-Anwendungen entwickelt, um die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen oder das Tierwohl automatisiert zu erfassen. Sie haben auch einen nachhaltigen Einkaufsassistenten oder einen digitalen Zwilling erstellt, um den Verderb von Lebensmitteln zu überwachen. Im Rahmen einer Ergebniskonferenz werden die Forschungserfolge der 36 Projekte vorgestellt. INFO & ANMELDUNG
26.04.2024 – 9.30 Uhr / Berlin
Plenarsitzung 1043. Sitzung des Bundesrates
TOP 35: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 in Bezug auf Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen für Klima, Umwelt und Tierwohl, Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung der GAP-Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen
TOP 36: Erste Verordnung zur Änderung der GAPInVeKoS-Verordnung TAGESORDNUNG
30.04.2024 – 8.30 – 14.30 Uhr / Tempelberg Steinhöfel
Tagung PATCHCROP Feldrobotik-Tag 2024
Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. zu diesem Tag rund um Feldroboter, Drohnen und andere Systeme aus dem Bereich Smart Farming. Am 30. April 2024 auf dem Gelände des Landschaftsexperimentes patchCROP in Tempelberg (Steinhöfel) erwartet Sie ein buntes Programm aus Vorträgen, Podiumsdiskussion und Felddemonstrationen. INFO & ANMELDUNG
03.05. – 12.05.2024 / Bezirksgärtnerei Charlottenburg-Wilmersdorf, Königsweg 6, 14193 Berlin
Aktionswoche des BMEL Torffrei gärtnern!
Mit torffreien Erden leisten Hobbygärtnernde einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Denn der Abbau und die Nutzung von Torf setzen klimaschädliches Kohlendioxid frei. Um weitere Pflanzenfreundinnen und -freunde für den Klimaschutz zu gewinnen, findet erstmals eine bundesweite Aktionswoche statt, bei der sich alles um das torffreie Gärtnern dreht. Gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft informiert das BMEL über die Vorteile und Besonderheiten der torffreien Pflanzenpflege. INFO
24.05. -25.05.2024 / Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg
Jahrestagung der Jungen DLG 2024 Landwirtschaft 2040 – Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Zukunft
Die Jahrestagung der Jungen DLG ist der zentrale Ort in Deutschland für Studierende, Berufseinsteiger und Young Professionals im Bereich Landwirtschaft und Agribusiness, um sich zu vernetzen, fortzubilden und miteinander Spaß zu haben. Dazu sind alle Interessierte (egal ob DLG-Mitglied, oder nicht) sehr herzlich eingeladen. INFO & ANMELDUNG
Der Spiegel: CDU und CSU wollen Importverbot für Lebensmittel aus Russland
Die CDU und CSU fordern im Bundestag ein Importverbot für Agrargüter aus Russland und Belarus, um die Kriegswirtschaft von Präsident Putin nicht mitzufinanzieren. Sie argumentieren, dass Russland gezielt Exporte, insbesondere von Getreide, nutzt, um Abhängigkeiten zu schaffen und Devisen für Kriegsgüter zu erwirtschaften. Die EU schlug statt eines Importverbots höhere Zölle auf die Einfuhr von Getreide vor. Die Union drängt darauf, nationale Maßnahmen zu ergreifen, falls es auf EU-Ebene keine Einigung gibt. Zum Artikel
Euractiv: Commission wants to ease rules on use of processed manure for farming
Die Europäische Kommission schlägt Änderungen der Nitrat-Richtlinie vor, um die Verwendung von Dünger aus Tierdung in der Landwirtschaft zu erleichtern. Ziel ist es, bio-basierte Düngemittel zu fördern und die Auswirkungen von volatilen Preisen für mineralische Düngemittel abzumildern. Diese Maßnahme erfolgt aufgrund von Forderungen einiger EU-Länder, “die Unterscheidung zwischen synthetischen Düngemitteln einerseits und Düngemitteln auf Güllebasis (wie RENURE und Gärreste) andererseits aufzuheben”. Umweltgruppen äußern Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität. Zum Artikel
Politco: ‘Insane’ and ‘dangerous’ to give up on EU nature law, says Belgian minister
Der belgische Umwelt- und Klimaminister Alain Maron setzt sich trotz starken Widerstands, unter anderem von seinem eigenen Premierminister, für die Genehmigung des Nature Restoration Laws ein. Maron bezeichnet es als “verrückt” und “gefährlich”, das Gesetz in diesem Stadium abzulehnen, und betont die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit im Rat. Die Gesetzgebung, die verbindliche Ziele zur Wiederherstellung von 20 Prozent der EU-Land- und Meeresflächen bis zum Ende des Jahrzehnts festlegt, ist Teil des EU Green Deal und hat politische Kontroversen ausgelöst. Zum Artikel
Tagesschau: NGO-Analyse: Zuckerzusatz in Babynahrung von Nestlé festgestellt
Die Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye fand heraus, dass Nestlé Babynahrung in Entwicklungsländern Zucker zusetzt. Dies betrifft unter anderem Milchpulver und Getreideprodukte. Gleiche Produkte auf dem europäischen Markt sind nicht mit Zucker versetzt. Nestlé streitet die Vorwürfe nicht ab. In einem Statement heißt es: “Wir entwickeln und reformulieren unsere Getreideprodukte für Säuglinge weiter, um den Gehalt an zugesetzten Zuckern weiter zu reduzieren, …” Zum Artikel
Studie: Prioritizing partners and products for the sustainability of the EU’s agri-food trade
Forschende der Universität Rostock untersuchten die Verbindung zwischen den Anforderungen an eine nachhaltige Produktion in Erzeugerländern, mit dem Verbrauchsverhalten und den Vorschriften in den Zielmärkten. Es wurden die Relevanz und die Hebelwirkung der EU-Pflanzenimporte in Bezug auf den Geldwert, den Fußabdruck und die Entwaldung analysiert. Die Studie identifiziert ein großes Potenzial für die EU, Handelsbeziehungen auszubauen und dabei Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette festzulegen. Zur Studie
Euractiv: Südafrika legt bei WHO Einspruch gegen EU-Zitrusfruchtbeschränkungen ein
Südafrika hat bei der WHO eine Beschwerde gegen die phytosanitären Handelsbestimmungen der EU eingereicht. Es geht darin um Regelungen zur Verhinderung der Einschleppung von der Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit (Citrus Black Spot, CBS) in die EU. CBS ist als für den Menschen unbedenklich eingestuft. Während Südafrika, als weltweit zweitgrößter Exporteur von Zitrusfrüchten, eine große finanzielle Belastung in den Regelungen sieht, fürchten europäische Zitrus-Bauern erhebliche Probleme beim Wegfall der Importregelungen, da sie befürchten, CBS könne sich in Europa verbreiten. Zum Artikel
Handelsblatt: Doch kein Resilienzbonus für heimische Solarindustrie
Das “Solarpaket I” soll voraussichtlich diese Woche vom Bundestag beschlossen werden. Die Ampel-Koalition hat sich auf diese Punkte geeinigt: Erleichterungen für Dachanlagen und Balkon-PV; mehr Freiflächen für Solarparks und schnellere Verfahren für Windräder und Stromnetze. Der von den Grünen gewünschte “Resilienzbonus” für heimische Hersteller fehlt. Stattdessen wird auf den Net Zero Industry Act (NZIA) auf EU-Ebene verwiesen. Dieser soll den fehlenden Bonus für lokale Produkte ausgleichen. Zum Artikel
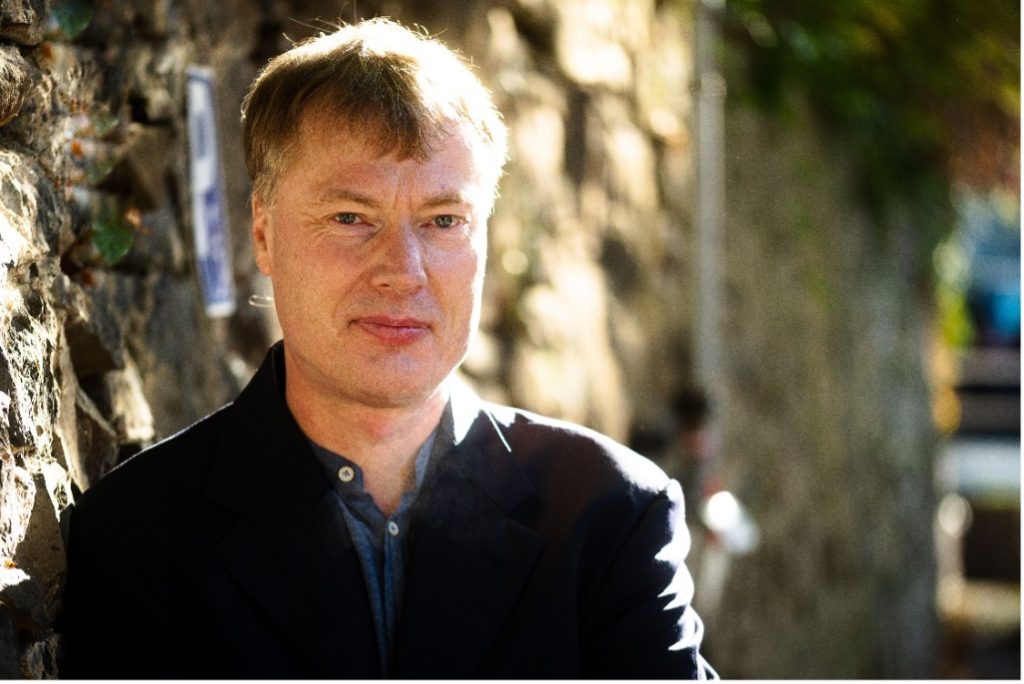
Der Kakaopreis erreicht Rekordhöhen, und zugleich wird der Kakao von Bäuerinnen und Bauern geerntet, die oft in tiefster Armut leben. Auch die Schokoladenpreise ziehen deutlich an. Doch Kakao macht nur einen kleinen Teil des Preises für Schokolade aus. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um endlich die massiven sozialen Probleme in der Lieferkette anzugehen.
Um das Jahr 2000 erreichten die Kakaopreise inflationsbereinigt einen historischen Tiefststand. Als Folge arbeiteten Studien zufolge zu Beginn des Jahrtausends rund zwei Millionen Kinder allein auf den Kakaoplantagen in der Côte d’Ivoire und Ghana. Immer noch gibt es Berichte über Sklavenarbeit von Kindern auf Kakaoplantagen.
Die letzte umfassende Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass weiterhin mindestens 1,5 Millionen Kinder in der Côte d’Ivoire und Ghana unter verbotenen Bedingungen arbeiten. Aus diesen beiden Ländern kommen rund 60 Prozent der Welternte, mehr als zehn Prozent stammen aus Nigeria und Kamerun, wo die Situation nicht besser ist.
Der Anbau von Kakao wird weiterhin von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dominiert, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Ernteerträge einfahren. Sie bewirtschaften in der Regel zwei bis vier Hektar und haben keinerlei Einfluss auf den Kakaopreis. Ist die Ernte gut, stürzt der Preis in den Keller, ist sie schlecht, geht der Preis in die Höhe.
2018 wurden die durchschnittlichen Einkommen der Kakao anbauenden Familien berechnet. Durchschnittlich lag ein existenzsicherndes Einkommen für Familien in der Côte d’Ivoire bei 6.517 US-Dollar pro Jahr, die realen Einkommen eines typischen Haushalts lagen jedoch nur bei 2.346 US-Dollar. Aufgrund der kleineren Familien und anderen Preisstruktur lag das existenzsichernde Einkommen in Ghana bei 4.742 US-Dollar, und die Einkommen typischer Haushalte betrugen 2.288 US-Dollar.
Organisationen der Bäuerinnen und Bauern, Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen verwiesen daher immer wieder auf die zwingende Notwendigkeit, die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern durch höhere Preise zu steigern.
Unternehmen wissen, dass darin der schnellste Weg zur deutlichen Linderung der sozialen Probleme in den Anbaugebieten liegt. Bislang wurde von Unternehmen jedoch immer wieder betont, “der Markt” mache den Preis, schließlich wird Kakao in London und New York an den Börsen gehandelt. Menschenrechtliche Aspekte spielen bei der Preisgestaltung keine Rolle.
Andererseits war und ist allen Schokoladenunternehmen klar, dass Kakao nur einen kleinen Teil der Kostenstruktur ihrer Lieferkette ausmacht. Bei einem Einkaufspreis auf dem Weltmarkt von 2.000 US-Dollar je Tonne Kakao, wie er über viele Jahre vorherrschte, lag bei Vollmilchschokolade mit einem Kakaoanteil von 30 Prozent der Preis für Kakao bei rund acht Cent je Tafel. Bei Schokoriegeln oder Schokoladenprodukten mit Füllungen ist der Kostenanteil des Kakaos noch bedeutend niedriger. Eine deutliche Erhöhung der Aufkaufpreise bei den Bäuerinnen und Bauern hätte somit nur zu einer moderaten Steigerung der Kosten für Schokoladenprodukte geführt.
Nun haben sich die Kakaopreise seit Frühjahr 2023 verdreifacht. Vor allem in Westafrika sind die Erntemengen deutlich gesunken. Ursache dafür ist unter anderem das regelmäßig wiederkehrende Klimaphänomen El Niño, das durch den Klimawandel verstärkt wird. Die weitgehende Entwaldung der Anbaugebiete in der Côte d’Ivoire und Ghana verschärft dort die Probleme. Durch massive Regenfälle Mitte 2023 sind große Flächen von Krankheiten befallen und die Bäume tragen wenige Früchte. Hinzu kommen strukturelle Probleme: Aufgrund der über Jahre niedrigen Kakaopreise fehlten vielen Bäuerinnen und Bauern die finanziellen Mittel, um ihre Plantagen optimal zu betreiben.
Die Schokoladenpreise steigen seit Monaten, wenn auch teilweise – angesichts des geringen Anteils der Kosten des Kakaos – in einem überraschend großen Umfang.
Nicht nur für die Côte d’Ivoire und Ghana, sondern auch für weitere Anbauländer liegen mittlerweile Kalkulationen existenzsichernder Einkommen vor. Aufgrund umfassender Datenerhebungen kennen die Unternehmen die durchschnittlichen Anbauflächen der Bäuerinnen und Bauern sowie die Produktivität je Hektar. Aufbauend auf diesen Daten müsste berechnet werden – und dies kann aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen nur innerhalb der einzelnen Unternehmen geschehen – welche Preise die Bäuerinnen und Bauern benötigen, sodass zumindest das Gros der Familien existenzsichernde Einkommen erreicht. Dies kann über garantierte Mindestpreise geschehen oder über Prämien, die bei fallenden Preisen erhöht und bei über eine gewisse Grenze steigenden Preisen gesenkt oder abgeschafft werden.
Einzelne Unternehmen zeigen, dass eine Kombination aus garantierten stabilen Preisen und langfristigen Lieferverträgen mit den Vereinigungen der Bäuerinnen und Bauern und Unterstützungsmaßnahmen zu einer massiven Reduzierung der Menschenrechtsverletzungen inklusive der Kinderarbeit führen können. Ein Beispiel dafür ist Tonys Chocolonely, ein niederländischer Konzern, der in den letzten Jahren schnell expandiert hat. Weitere Pilotprojekte großer Unternehmen zeigen, dass veränderte Lieferbeziehungen möglich sind und zu Verbesserungen führen. Dies sollte flächendeckend eingeführt werden.
Nur so werden die Unternehmen vor Klagen sicher sein. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz schreibt schließlich seit Anfang 2023 vor, dass große Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten mitverantwortlich sind. Auf EU-Ebene wurde kürzlich ein europäisches Lieferkettengesetz beschlossen. Um die Menschenrechte in den Lieferketten zu gewährleisten, braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, dass nach einigen guten Ernten die Preise nicht wieder ins Bodenlose fallen.
Die derzeit hohen Preise könnten es den Konzernen erleichtern, diese Maßnahmen einzuführen. Maßstab für die Preisgestaltung sollte nicht mehr der Preis an der Börse sein, sondern Zahlungen, die existenzsichernde Einkommen ermöglichen.
Friedel Hütz-Adams arbeitet seit 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das SÜDWIND-Institut. Er hat Studien zu verschiedensten Wertschöpfungsketten veröffentlicht, darunter während der vergangenen letzten Jahrzehnte etliche zum Thema Kakao. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss freiwillige Standards und gesetzliche Regulierungen zur Verantwortung der Wirtschaft für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards auf das Handeln von Unternehmen haben. Er arbeitet in mehreren Gremien mit, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten befassen, und ist unter anderem Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats der REWE-Group.
stark schwankende Erzeugerpreise für Milch sind in regelmäßigen Abständen Thema in der Politik. Schon die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, Artikel 148 der Gemeinsamen Marktorganisation national umzusetzen, wenn sich an den Milchpreisen für Bauern nichts ändere. Nun will ihr Nachfolger Cem Özdemir (Grüne) die Lieferbeziehungen zwischen Molkereien und Milcherzeugern ändern.
Vertreter der Milchbranche sind gespalten in der Frage, ob der Staat eingreifen sollte. Gegen staatliche Eingriffe haben sich der Deutsche Bauernverband, der Milchindustrieverband und der Deutsche Raiffeisenverband ausgesprochen. Für die nationale Umsetzung des GMO-Artikels 148 plädieren die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, der Bund deutscher Milchviehhalter und das MEG Milch Board.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium erhofft sich “einen Impuls für eine stärkere Verbreitung von Festpreisen und Preisabsicherungsmodellen mit Mengenbezug” durch die nationale Umsetzung des GMO-Artikels 148. Das könne die Preisstabilität und damit die Planungssicherheit auf Erzeugerebene verbessern, teilt das BMEL Table.Briefings mit. “Das Preisrisiko wird dadurch fairer zwischen Erzeugern und Molkereien aufgeteilt”, so ein BMEL-Sprecher.
Mit Milchmarktexperte Prof. Holger Thiele, Vorstand des ife Instituts für Ernährungswirtschaft Kiel, haben wir im Interview über die Auswirkung staatlicher Eingriffe auf Erzeugerpreise für den Rohstoff Milch und Verbraucherpreise für Trinkmilch gesprochen.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!


Schon die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, Artikel 148 der Gemeinsamen Marktorganisation national umzusetzen, wenn sich an den Milchpreisen für Bauern nichts ändere. Nun will ihr Nachfolger Cem Özdemir (Grüne) die Lieferbeziehungen ändern. Wie bewerten Sie das?
Die Forderung nach einer Überprüfung der Preissysteme finde ich zwar sinnvoll, weil die Erzeugerpreise für Milch grundsätzlich zu stark schwanken. Aber schon seit Längerem plädiere ich eher dafür, für Teilmengen mit einem entsprechenden freiwilligen Risikomanagement der Molkereien darauf zu reagieren, anstatt staatlich einzugreifen. Viele Molkereien haben sich in Europa und auch hier auf den Weg gemacht. Die Umsetzung ist aber nicht so einfach, insbesondere weil stabile abgesicherte Preise üblicherweise nicht die höchsten Preise sind. Viele Milcherzeuger wählen dann häufig statt fixierter stabiler Milchpreise lieber die Aussicht auf einen höheren Preis, was möglicherweise aber nicht eintritt.
Aber das BMEL rechnet mit mehr Planungssicherheit für Milcherzeuger. Können Milcherzeuger ihre Produktion dadurch besser steuern?
Doch, es könnte tatsächlich dazu führen, dass Milchbauern beispielsweise ihre Produktionsmenge drosseln, sollte der voraus fixierte Milchpreis über einen längeren Zeitraum niedrig sein. Und das dürfte eintreten, weil sich durch die Vorausfixierung der Erzeugerpreise das Risiko der Molkereien erhöht.
Zwar können Milchbauern anschließend eine Nachzahlung erhalten. Aber diese Ausschüttung erfolgt deutlich nach der Anlieferung und zeitverzögert und bietet daher aus meiner Sicht keinen Anreiz zur Steigerung der Produktion.
Entsprechend planbar ist das aber nur, wenn die Höhe des Fixpreises über mehrere Monate im Voraus bekannt ist. Diese zeitliche Vorgabe macht der GMO-Artikel 148 aber gar nicht. Und: Je länger der Zeitraum der Vorausfixierung der Erzeugerpreise, desto geringer müsste aufgrund von Risikoabschlägen der Milcherzeugerpreis sein.
Nach dieser Logik dürfte sich auch nach nationaler Umsetzung des Artikels 148 nichts an Verbraucherpreisen für Frischmilch ändern. Richtig?
Genau. Ich bezweifle, dass die Milch im Kühlregal deswegen teurer wird. Ich rechne in diesem Szenario eher mit Erzeugerpreisen, die inklusive der Nachzahlung und den Absicherungskosten unter das aktuelle Niveau fallen. An den Preisen für Verbraucher dürfte sich darum kaum etwas ändern.
Übrigens, 2003 hat der EU-Agrarministerrat die Weichen für niedrige Erzeugerpreise selbst gestellt, indem er die festgelegten garantierten Mindestpreise für Milch (Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver) schrittweise abgesenkt hat.
Wird die Tendenz zu niedrigen Erzeugerpreisen für den Rohstoff Milch dadurch verschärft, dass die Hälfte der in Deutschland produzierten Milchmenge in den Export geht?
Wenn der Milchpreis auf dem Weltmarkt fällt oder steigt, beeinflusst dies das nationale Preisniveau für Erzeuger. Fällt der Weltmarktpreis, sinken die Absatzalternativen auf den internationalen Märkten für unsere Waren, und unsere Preise sinken. Steigt der Weltmarktpreis, steigen unsere alternativen Verkaufsmöglichkeiten und wir müssen nicht billiger im Inland verkaufen. Gleiches gilt auch für den Preiszusammenhang zu unserem EU-Handelspartner. Sinkende und steigende internationale Preise wirken sich dann auch auf die handelsüblichen Preise für Trinkmilch oder andere Milchprodukte aus. Dieses Phänomen ruft bei einigen Milcherzeugern großes Unwohlsein hervor, obwohl wir in der EU und in Deutschland seit 2007 mehrheitlich eher von höheren internationalen Preisen profitieren, aber gleichzeitig auch sehr viel höhere Preisschwankungen haben.
Folgt man Ihrer Argumentation, machen sich Lebensmitteleinzelhandel und Molkereien also gar nicht die Taschen auf Kosten der Milchbauern voll, richtig?
Nein, die Wettbewerbsintensität ist für alle sehr hoch und die Molkereien haben eine Sandwichposition zwischen Handel und Milcherzeugern. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die erhöhten Preisrisiken in der Wertschöpfungskette Milch nicht einseitig von den Milcherzeugern oder Molkereien getragen werden, sondern besser verteilt werden. Dass Preise zeitweise unterhalb der Summe aus variablen und fixen Kosten liegen, ist übrigens leider kein Spezifikum des Milchmarktes. Vorausgesetzt der Deckungsbeitrag ist positiv, macht es aus betriebswirtschaftlicher Sicht trotzdem Sinn, weiterhin Milch zu produzieren, um einen Teil der Fixkosten zu decken. Längerfristig müssen natürlich die Vollkosten gedeckt sein.
Trotzdem haben Vertreter der Milchindustrie darum gekämpft, dass Lieferanten von Frischwaren wie Milch im Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz bis zu einem Jahresumsatz von vier Milliarden Euro vor unfairen Praktiken des Lebensmitteleinzelhandels geschützt sind …
Nichtsdestotrotz hat das Thünen-Institut in einem vom BMEL in Auftrag gegebenen Gutachten zur Evaluierung der Lieferbeziehungen im Jahr 2023 festgestellt, dass es keine Dysfunktionalität, also kein Marktversagen, entlang der Wertschöpfungskette Milch gibt. Infolgedessen analysiert das Institut, staatliche Eingriffe in die Lieferbeziehungen seien nicht gerechtfertigt.
Milchbauern sitzen in Vorstandsgremien genossenschaftlicher Molkereien und sind bei den Festlegungen von Auszahlungspreisen üblicherweise dabei. Warum sind die Fronten zwischen AbL, BDM und MEG Milch Board auf der einen Seite und dem MIV, DBV, DRV auf der anderen Seite verhärtet?
Das ist wirklich fraglich, weil genossenschaftliche Molkereien demokratische Entscheidungsstrukturen haben. Entweder handelt es sich um eine Minderheit, die da aufbegehrt und die nationale Umsetzung von GMO-Artikel 148 fordert. Wenn es die Mehrheit wäre, die nicht gehört wird – was ich vor dem Hintergrund unserer Analysen bezweifle – dann kann es an mangelnder Entscheidungsfindung liegen. Aber: wenn einem Großteil der Milcherzeuger, die stimmberechtigtes Mitglied in einer Genossenschaft sind, etwas nicht gefällt, müssten sie es vom Prinzip her ändern können.
Führen wir die Diskussion an falscher Stelle und man müsste eigentlich dem Lebensmitteleinzelhandel gesetzlich vorschreiben, seinen Lieferanten fixe Preise weit im Voraus zuzusichern?
Das wäre ein massiver ordnungspolitischer Eingriff und würde nicht viel ändern, da rund 50 Prozent des in Deutschland produzierten Rohstoffs exportiert wird und unsere Preisschwankungen bisher nur zu einem kleinen Anteil durch unser Verhalten oder durch Maßnahmen im Inland bestimmt werden. Noch einmal: Der Haupteinfluss kommt aus dem EU-weiten und internationalen Milchprodukte-Handel, von dem wir sehr stark profitieren.
Angenommen, der Lebensmitteleinzelhandel würde fixe Preise im Voraus zusichern, ist davon auszugehen, dass dieser, ebenso wie es die vorgelagerte Stufe der Molkereien machen müsste, Risikoabschläge einbehält oder ebenfalls Preisabsicherungsmodelle umsetzen müsste. Verbraucher in Deutschland sind sehr preissensibel und der LEH steht, wie schon betont, unter einem enormen Wettbewerbsdruck.
Seit Dienstag verhandeln Delegierte von rund 180 Staaten im kanadischen Ottawa in der nunmehr vierten Runde über ein globales Abkommen gegen Plastikmüll. Die zweite und dritte Runde 2023 brachten nur wenige Fortschritte. In Paris ging es um Verfahrensfragen. In Nairobi verhandelte man in der Sache, aber es konnte weder der allererste Entwurf konsolidiert noch ein Mandat für Verhandlungen zwischen den Runden vereinbart werden. Das lag vor allem an der Blockade einiger Ölförderländer wie Saudi-Arabien, Iran und Russland. In Ottawa muss es deutlich vorangehen, damit ein Abkommen erreichbar bleibt.
Plastik hat enorm schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die menschliche Gesundheit. Das Material wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen, beinhaltet schädliche chemische Zusatzstoffe, gibt Mikro- und Nanoplastik ab und in vielen Ländern landet es als Müll auf dem Land oder im Wasser. Das Problem: Die Menge an produziertem Plastik hat sich laut OECD von 2000 bis 2019 auf 460 Millionen Tonnen verdoppelt. Die Organisation erwartet, dass sich das Aufkommen an Plastikabfall von 2019 bis 2060 fast verdreifachen wird. Gleichzeitig werde der Recyclinganteil von etwa neun auf 17 Prozent steigen. Damit ist die Welt beim Plastik noch weit von einer Kreislaufwirtschaft entfernt.
Die Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty fordert ein wirksames Ziel für die Minderung der Produktion von Primärplastik. Erst wenn sie um mehr als drei Prozent jährlich sänke, würde die Menge laut der Initiative von über 350 Wissenschaftlern tatsächlich abnehmen. Denn wegen der “kumulativen Natur” von Plastikverschmutzung könnten Technologien für Beseitigung und Recycling nicht genug für die Eindämmung der Negativfolgen leisten. “Das Ziel sollte also deutlich über drei Prozent liegen“, sagt Melanie Bergmann, Biologin am Alfred-Wegener-Institut und Teil des Zusammenschlusses sowie der deutschen Delegation.
Zwar sagt das Mandat, dass der gesamte Lebenszyklus von der Produktion bis zur Entsorgung berücksichtigt werden soll. Wie in den Verhandlungen die Schwerpunkte gesetzt werden sollen, ist aber unter den Staatenvertretern in Ottawa umstritten. Die High Ambition Coalition aus 64 Staaten, darunter Deutschland, spricht sich dafür aus, den gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen.
Dagegen versuchen einige Staaten mit starker Fossil-Industrie, den Fokus auf Recycling zu lenken, sagen Teilnehmer. Laut einer Studie der Universität Lund wollen die meisten Staaten zwar erklärtermaßen die Plastikverschmutzung beenden. Aber nur wenige äußerten sich bislang zur Notwendigkeit, die Produktion von Plastik zu reduzieren oder zu regulieren. Das fordern vor allem NGOs im Vorfeld der Ottawa-Runde.
So verlangt der WWF, “einem globalen und verbindlichen Verbot der schädlichsten und vermeidbaren Kunststoffe Vorrang einzuräumen“. Zudem müssten Anforderungen an das Produktdesign festgelegt werden, “um die Reduzierung, Wiederverwendung und das sichere Recycling aller Kunststoffprodukte zu gewährleisten”.
Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe, sagte Table.Briefings, die größte Lenkungswirkung bestehe für den europäischen Verband der Kunststofferzeuger darin, “dass das UN-Plastikabkommen Kunststoffabfälle als wertvollen Rohstoff behandelt” und Anreize für Wiederverwertung und Recycling schaffe.
Produkte sollten gleich so gestaltet werden, dass sie “am Ende ihrer Nutzung wieder konsequent in den Kreislauf zurückgeführt werden können”, sagt Bühler. “Verbote, Negativ-Listen und Produktionseinschränkungen, wie sie von einigen NGOs gefordert werden”, hält er für kontraproduktiv, weil der Bedarf an Plastik angesichts von Energiewende, Digitalisierung oder Gesundheit steige. Laut Doris Knoblauch, Co-Koordinatorin für Plastik am Ecologic Institute, braucht es aber “auch Investitionen für neue Geschäftsmodelle – etwa mit Blick auf Produktdesigns, die Recycling ermöglichen”.
Unterschiedliche Interessen verfolgen in der Frage auch die Länder des globalen Südens. “Hier wird es schwierig, denn unter den traditionellen Entwicklungsländern sind einige der größten Plastikproduzenten, etwa China. Gleichzeitig ist der Pro-Kopf-Konsum viel größer im globalen Norden“, sagt David Azoulay, geschäftsführender Anwalt vom Center for International Environmental Law in Genf. Zum Beispiel hat Ghana vergangenes Jahr eine globale Plastikabgabe für die Produzenten vorgeschlagen, um den Plastikmüll zu begrenzen.
Über die Frage der Finanzierung dürfte in Ottawa erneut gestritten werden. “Hier gibt es einen Konflikt, der sich immer mehr herauskristallisiert”, sagt die Wissenschaftlerin Bergmann. Denn der Aufbau einer funktionsfähigen Abfallwirtschaft und die Beseitigung von Plastik aus der Umwelt in besonders verschmutzten Regionen kostet viel Geld und stellt vor allem ärmere Länder vor enorme Herausforderungen. Plastics Europe spricht sich für eine Beteiligung der Hersteller an den Kosten für Entsorgung und Verwertung aus.
Nach Ansicht der meisten Akteure sollten die Verschmutzer zahlen. Aber wer ist das – der Produzent, die weiterverarbeitende Industrie oder der Konsument? Wie die Diskussionen ausgehen, hängt auch davon ab, wie die Teilnehmer letztlich die Verantwortung von Staaten, Produzenten und Konsumenten einschätzen. Es gebe Staaten wie Brasilien, die sich für das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung (aus dem Klima-Abkommen von Rio) einsetzen, heißt es von Beobachtern.
Ebenfalls umstritten ist, welche Verpflichtungen das Abkommen enthalten soll. Das Mandat sagt, dass das Abkommen verbindlich sein soll. Dies lässt aber Spielraum, um grundsätzliche Ziele oder spezifische Verpflichtungen festzulegen. Ein gutes Beispiel für den ersten Fall sei das Pariser-Klimaabkommen, sagt David Azoulay. “Das Abkommen ist rechtsverbindlich, aber was die Staaten tun sollten, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, ist eine Liste mit freiwilligen Maßnahmen”, erklärt der Experte für internationales Umweltrecht.
Beim Plastikabkommen könnten auch spezifische Verpflichtungen festgelegt werden – mit Maßnahmen, die alle umsetzen müssen, sagt Florian Titze, Senior Policy Advisor beim WWF Deutschland und bei den Verhandlungen vor Ort. “Darum wird aber sehr stark gestritten“, ergänzt er. Neben Staaten wie Saudi-Arabien und Iran drängten auch die USA auf ein Plastikabkommen im Paris-Stil – ohne strenge Verpflichtungen, sagt Azoulay.
Über all diesen Punkten schwebt die Frage, nach welchen Regeln die Staaten am Ende eine Entscheidung treffen können. “Das ist der Elefant im Raum”, sagt der Aktivist Titze. Das Problem: Laut den Verfahrensregeln, die 2022 beschlossen wurden, sollen Entscheidungen einvernehmlich fallen. Wenn alle Mittel erschöpft sind, soll aber auch eine Zweidrittelmehrheit reichen.
Bei der zweiten Verhandlungsrunde versuchte eine kleine Gruppe von Staaten, die Entscheidungsregeln neu zu diskutieren, um die Möglichkeit einer Mehrheitsentscheidung auszuschließen. Man einigte sich auf ein sogenanntes interpretatives Statement. Im Falle einer Abstimmung werde das Verhandlungskomitee eine mögliche Uneinigkeit berücksichtigen. Das Konsensprinzip fordern unter anderem Saudi-Arabien, Iran, Russland, Brasilien, China und Indien.
Aus juristischer Sicht seien die Verfahrensregeln zur vorläufigen Anwendung angenommen, weshalb auch abgestimmt werden könne, sagt der Jurist Azoulay. Trotzdem erwartet er aber nicht, dass es dazu kommt – vor allem wegen des Widerstands der genannten Staaten und der Tatsache, dass Staaten mit ehrgeizigen Zielen nicht bereit seien, sich mit den Verhinderungsstrategien auseinanderzusetzen. “Das ist bedauerlich, denn allein die Möglichkeit einer Abstimmung könnte zu Kompromissen führen. Um ein wirklich praktikables Abkommen durchzubekommen, muss es einen Weg geben, auf eine Entscheidung zu drängen”, betont Azoulay. Die Zeit ist knapp. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde findet Ende November im südkoreanischen Busan statt.
Das Europäische Parlament tagt diese Woche zum letzten Mal vor der Europawahl Anfang Juni in Straßburg. Es ist die letzte Chance, noch Gesetze zu verabschieden. Über eine Reihe von Agrar- und Ernährungsdossiers wird nun im Endspurt abgestimmt.
Final unter Dach und Fach gebracht werden sollen – bis auf die abschließende formale Zustimmung des Ministerrats – folgende Themen:
Die Zustimmung zu den Entlastungsvorschlägen der Kommission gilt als relativ sicher. Ein Gutachten des juristischen Dienstes im Parlament, das der Umweltausschuss angefordert hatte, steht dem nicht im Weg: Die Rechtsexperten haben nichts zu beanstanden. Spannend wird, ob Änderungsanträge durchkommen. Dann müssten die Mitgliedstaaten diese wortgleich akzeptieren, damit die Verabschiedung vor der Wahl möglich ist. Wahrscheinlichstes Szenario aber: Das Plenum stimmt ohne Änderungen zu, das Dossier wird rechtzeitig zum Wahlkampf verabschiedet.
Das Thema ist umstritten, und es liegen mehrere Änderungsanträge vor. Trotzdem ist die Zustimmung des Parlaments wahrscheinlich, weil es die letzte Chance ist, die Handelserleichterungen für die Ukraine vor Ablauf der bestehenden zu verlängern. Die Forderung des Parlaments, Schutzmaßnahmen auch für Getreide zu erlassen, ist zwar nicht Teil der Einigung. An anderer Stelle wurden Schutzmaßnahmen für Agrarprodukte aber auf Drängen mehrere Mitgliedstaaten noch einmal ausgeweitet. Das dürfte es Kritikern des Freihandels – vor allem Agrarpolitikern und Abgeordneten aus Ukraine-Anrainerstaaten – erleichtern, zuzustimmen.
Der Trilogeinigung über die Lieferkettenrichtlinie, deren Annahme im Rat über mehrere Wochen auf der Kippe stand, muss nun auch das Parlament noch formal zustimmen. Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis der Verhandlungen noch einmal deutlich entschärft, indem sie etwa den Anwendungsbereich verkleinert und die Risikosektoren gestrichen haben.
Die Einigung zwischen Rat und Parlament von Anfang März soll angenommen werden. Dass zwei kurzfristig eingereichte Änderungsanträge von Andreas Glück (FDP) noch angenommen werden, ist unwahrscheinlich. Glück möchte bestimmte Mehrwegziele für Verpackungen streichen, die Unternehmen für den Transport von Produkten zwischen ihren eigenen Standorten und innerhalb eines Mitgliedstaats verwenden. Vertreter der Mitgliedstaaten hatten das Verhandlungsergebnis bereits vor Ostern angenommen.
Die Zustimmung zur Trilogeinigung zwischen Rat und Parlament, die unter anderem die Schaffung eines Notfallteams gegen Pflanzenschädlinge vorsieht, gilt als sicher.
Folgende Dossiers werden nicht mehr vor der Wahl abgeschlossen, das Parlament will aber noch Zwischenschritte unternehmen:
Das Parlament hatte seine Verhandlungsposition im Januar angenommen. Mit einer erneuten Abstimmung soll diese festgezurrt werden und müsste so nicht mehr nach der EU-Wahl bestätigt werden. Davon, dass das gelingt, ist auszugehen. Aufseiten der Mitgliedstaaten herrscht weiter Stillstand.
Das Parlament nimmt seine Verhandlungsposition an. Im Rat gibt es bisher kaum Fortschritte zum Thema, bis zur finalen Verabschiedung des Vorschlags kann es deshalb noch dauern. jd/leo
Am Mittwoch will das EU-Parlament seine Verhandlungsposition zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Saatgutverordnung annehmen. Pflanzenzucht- und Agrarverbände kritisieren vorab Änderungsvorschläge des EU-Agrarausschusses. Doch auch innerhalb der Branche herrscht keine Einigkeit. Mit der Verordnung soll eine Vielzahl verschiedener EU-Rechtsakte zusammengeführt und reformiert werden. An zwei Punkten entzünden sich die Meinungsverschiedenheiten:
Der Agrarausschuss fordert weitergehende Ausnahmen, die es Landwirten erlauben, begrenzte Mengen an Saatgut auszutauschen. Austausch und Verkauf sogenannter Erhaltungssorten sollen von Vorschriften ausgenommen werden, um Sortenvielfalt zu fördern.
Der Kleinbauernverband Via Campesina sieht das als “klare Verbesserung in Bezug auf die Rechte der Bauern am Saatgut”. Der EU-Bioverband IFOAM begrüßt, dass die genetische Vielfalt auf europäischen Äckern verbessert werde. Züchter und große Agrarverbände sehen das anders. Zusätzliche Ausnahmen brächten “großes Potenzial für Missbrauch und phytosanitäre Risiken”, warnen BDP, DRV und weitere deutsche Verbände in einem gemeinsamen Statement. Ähnliche Kritik kommt vom EU-Bauernverband Copa Cogeca.
Soll eine Sorte neu zugelassen werden, muss diese laut Verordnungsvorschlag mehr zu “nachhaltigem Anbau und Nutzung” (VSCU) beitragen als bestehende Sorten. Das umfasst Kriterien wie Ertrag, Schädlings- und Klimaresistenz und die effiziente Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Nährstoffe. Der AGRI-Ausschuss will hier lockern: Bei Gemüse- und Obstsorten soll die entsprechende Prüfung freiwillig sein, weil diese Sorten nicht Teil des bisherigen Kontrollsystems sind und dieses erst neu aufgebaut werden müsste.
Der BDP begrüßt das: Dass “neu zugelassene Sorten den Zielen einer nachhaltigen Landwirtschaft zuträglich sind”, sei ohnehin sichergestellt, meint Geschäftsführer Carl-Stephan Schäfer. Kritik kommt aus der Landwirtschaft. Angesichts des Klimawandels steige unter Landwirten “die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsbewertungen”, argumentiert Copa Cogeca. Der Verband pocht deshalb auf verpflichtende Tests auch für Gemüsesorten, könnte sich aber eine längere Übergangsphase vorstellen. Auch in Parlamentskreisen sowie beim EU-Saatgutverband Euroseeds sieht man das als möglichen Kompromiss.
Für die Plenarabstimmung hat die liberale Renew-Fraktion mehrere Anträge vorgelegt, die die umstrittenen AGRI-Vorschläge zurückdrehen würden. Gut informierte Kreise halten es für möglich, dass das im Plenum Erfolg hat. Obwohl das Parlament seine Verhandlungsposition am Mittwoch annehmen will, dürfte es bis zur Verabschiedung des Gesetzestexts noch dauern. Denn im Rat hat die politische Arbeit an dem Dossier noch nicht begonnen. jd
Immer wieder sind die Parteien der Ampel-Koalition uneins – auch, wenn es darum geht, wie Deutschland sich bei Abstimmungen zu EU-Dossiers positioniert. Ist die Bundesregierung gespalten, muss sie sich in Brüssel enthalten. Weil das in der Vergangenheit oft der Fall war, hat dieses Abstimmungsverhalten jetzt einen Namen – German Vote. Im Bereich Agrar- und Ernährung konnte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zuletzt vor allem mit der FDP oft nicht einigen: zum Beispiel bei der Deregulierung neuer Gentechniken oder der Zulassung von Glyphosat. Auch bei der Lieferkettenrichtlinie enthielt sich die Bundesregierung. Bei der Verpackungsverordnung einigten sich SPD, Grüne und FDP erst in letzter Minute.
Die Häufung von deutschen Enthaltungen über alle Politikfelder hinweg ist bemerkenswert, wie eine neue Datenbank zeigt. Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat darin das Abstimmungsverhalten der nationalen Regierungen in mehr als 1.300 öffentlichen Abstimmungen im EU-Rat seit 2009 erfasst. Der EU Council Monitor der SWP ist hier online verfügbar.
Die Datenbank zeigt, dass sich Deutschland im Laufe von gut 13 Jahren 34 Mal bei den Abstimmungen enthalten hat und 28 Mal dagegen votierte, also im Durchschnitt jeweils gut zweimal pro Jahr. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen häuften sich zur Mitte der Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel, den Höchstwert markiert das Jahr 2013 mit 14 solcher Vote.
Allerdings: Die Statistik erfasst nur formelle Abstimmungen im Rat. Über die verlängerte Zulassung von Glyphosat und Ausnahmeregelungen in der GAP für 2024 wurde aber in einem anderen Verfahren von Vertretern der Länder in den zuständigen Ausschüssen der Kommission abgestimmt. Diese Themen – zu beiden enthielt sich Deutschland – sind also nicht erfasst. Zudem erfasst die Datenbank aktuell nur Abstimmungen bis September 2023. Sie soll im weiteren Verlauf aktualisiert werden. tho/jd
Das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz (KLWG) von Bundesernährungsminister Cem Özdemir ist noch nicht tot, wie manche Beobachter aufgrund des monatelangen Stillstands annehmen, sondern soll noch vor der Sommerpause im Bundeskabinett beraten werden. Wie Table.Briefings aus den Koalitionsfraktionen erfuhr, soll es bereits Anfang März zwischen den Koalitionsparteien eine Verständigung gegeben haben, dass das Bundesernährungsministerium (BMEL) den vorliegenden Referentenentwurf nochmals überarbeiten und bis zur Sommerpause ins Kabinett einbringen soll.
Ein BMEL-Sprecher wollte zwar nicht bestätigen, dass es eine derartige Verständigung gegeben habe. Minister Özdemir sei aber regelmäßig mit SPD und FDP in Gesprächen über das KLWG. “Und wir sind optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen werden”, fügte er hinzu. Özdemir liege weiterhin viel daran, das Projekt zum Erfolg zu bringen. Beobachter räumen dem KLWG jedoch kaum Chancen auf Realisierung ein, wenn sich die Koalitionspartner nicht vor der Sommerpause noch auf einen Gesetzentwurf einigen.
Die FDP lehnt den vorliegenden Referentenentwurf bisher kategorisch ab. Sie kritisiert, dass er ein pauschales TV-Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel zu den Hauptsendezeiten beinhalte und nicht den Abmachungen im Koalitionsvertrag entspreche. Zuletzt hatten FDP-Politiker ihre Ablehnung noch vor zwei Wochen in einer Bundestagsdebatte zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung bekräftigt. Die SPD steht offiziell zu Özdemirs Referentenentwurf, wobei es auch ablehnende Stimmen vom Wirtschaftsflügel der Partei gibt. mo
Alkoholfreie Weine können in der EU derzeit nicht als ökologisch eingestuft werden, da Verfahren zur Entalkoholisierung nicht für die ökologische Weinerzeugung zugelassen sind. Das will die Europäische Kommission – zuständig in dieser Angelegenheit – nun ändern und die Möglichkeit der Vakuumdestillation prüfen, mit der Alkohol im Wein reduziert oder entfernt werden kann. Es werde zeitnah ein wissenschaftliches Gutachten einer Expertengruppe erwartet, das es ermöglichen werde, einen Rechtsvorschlag auf den Weg zu bringen, sagte Pierre Bascou von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der EU-Kommission Mitte April im AGRI-Ausschuss des EU-Parlaments.
Dass die Entalkoholisierung in der Öko-Verordnung bislang nicht erlaubt sei, könne man eigentlich niemandem erklären, meint Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er hatte deshalb bereits im März in Brüssel für eine “zeitgemäße und zielgerichtete Anpassung der Öko-Verordnung” geworben. Denn: “Dieser Schritt öffnet die Tür zu einem zusätzlichen wachsenden Markt, ist im Sinne des deutschen Weinbaus und stärkt ihn damit nachhaltig.”
Auch Kathrin Jäckel, Geschäftsführerin beim Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN), der viele Hersteller und Händler von alkoholfreiem Bio-Wein vertritt, moniert, dass die notwendigen Anpassungen des EU-Öko-Rechts von der EU-Kommission vernachlässigt wurden. “Diese Versäumnisse haben schwerwiegende Konsequenzen für die Hersteller*innen und Händler*innen von alkoholfreiem Bio-Wein und auch für die Verbraucher*innen, die die entsprechenden Produkte aktuell nicht mit einer Bio-Zertifizierung handeln dürfen”, sagt Jäckel.
Entstanden war das Problem Ende 2021, als die EU die Regulierungskompetenz für alkoholfreien Wein vom europäischen Lebensmittelrecht ins Weinrecht verlagerte. Alkoholfreier Bio-Wein durfte daraufhin nicht mehr verkauft werden. Deutsche Hersteller hatten deshalb begonnen, ihre Produkte als “alkoholfreie Getränke aus Bio-Wein” zu bezeichnen. Doch auch damit war zum Jahresbeginn Schluss, nachdem die EU die begriffliche Übergangslösung, die Deutschland im Alleingang gefunden hatte, als Marktverzerrung eingestuft hatte. heu
Äpfel und Rindfleisch aus Deutschland können künftig auch in China verzehrt werden. Entsprechende Erklärungen zur Aufhebung von Handelsbeschränkungen hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vergangene Woche während seiner China-Reise mit Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichnet. Beim Schweinefleisch, das Deutschland seit Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Jahr 2020 nicht mehr nach China exportieren darf, gelang Özdemir während der Reise jedoch kein Durchbruch. Der Grünen-Minister nannte dafür “außerlandwirtschaftliche” Gründe.
“Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht”, betonte Özdemir. Beim Schweinefleisch erfülle Deutschland hinsichtlich der ASP alle Anforderungen an Qualität und Sicherheit sowie Zuverlässigkeit bei der Lieferung.
Gespräche habe er in China vor allem mit seinem Amtskollegen Tang Renjian und Minister Yu Jianhua von der Hauptzolladministration der Volksrepublik geführt, ließ Özdemir nach seiner Rückkehr in Berlin wissen. Sein Resümee: “Es gibt eine hohe Wertschätzung für deutsche Produkte in China.” Deutsch gelte als Metapher für Qualität, so der Bundeslandwirtschaftsminister.
Dass die Handelsbeschränkungen für Rindfleisch infolge der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) nach 20 Jahren endlich ausgeräumt werden konnten, sei ein großer Erfolg, meint Özdemir weiter. Es sei zudem ein Quantensprung, dass es erstmals gemeinsame Regeln für die Ausfuhr von Äpfeln gebe. “Beim Export von Schweinefleisch werden wir die Gespräche fortsetzen”, kündigte er an. Und nicht nur dabei: “Wolle, Gerste, Lammfleisch und Geflügel stehen jetzt auch noch auf dem Zettel”.
Im Vorfeld der Reise war erwartet worden, dass Özdemir in Peking unter anderem die Aufhebung des chinesischen Importverbots für deutsches Schweinefleisch verhandeln wird. China hatte ebenso wie andere Länder 2021 die Einfuhren aufgrund der Afrikanischen Schweinepest ausgesetzt. Südkorea hatte den Handel bereits im Mai 2023 wieder zugelassen. heu
Der Agrarexperte Friedhelm Taube staunt über die Reaktion von Bauernpräsident Joachim Rukwied auf das Entlastungspaket für die Landwirte. Rukwied hatte von einem “Placebo” gesprochen und mit neuen Protesten gedroht. Taube sagte Table.Briefings, dass allein schon die Aussetzung der Pflicht zur Flächenstilllegung den Wegfall des Rabatts auf Agrardiesel kompensiere. Denn der Verlust der Dieselzuschüsse beläuft sich für einen 100-Hektar-Betrieb auf eine Mehrbelastung von etwa 2000 Euro pro Jahr, bei einem Einsatz von 80 Litern Diesel pro Hektar und rund 25 Cent Euro Rabatt pro Liter. Aufgewogen wird er durch das Aussetzen der eigentlich obligatorischen Vier-Prozent-Brache, die bei gleicher Betriebsgröße zu Mindereinnahmen von 2.000 bis 2.400 Euro führen würde.
Obendrauf erhalten die Landwirte nun weitere staatliche Zuwendungen. Durch Ersparnisse bei der Stromsteuer, eine geplante steuerliche Gewinnglättungsmöglichkeit sowie neue Förderungen der Länder für Versicherungen würde vielen Betrieben die Abschmelzung des Agrardiesel-Rabatts daher “deutlich überkompensiert”, kritisiert Taube. Dabei gehe es den Bauern prächtig. “Der Sektor verzeichnete allein durch die steigenden Preise für Land in den letzten 15 Jahren einen Vermögenszuwachs von 170 Milliarden Euro”, sagt der Forscher, der zehn Jahre lang zum Expertenrat des Bundeslandwirtschaftsministeriums gehörte – nämlich 10.000 Euro pro Hektar gerechnet auf 17 Millionen Hektar Agrarfläche.
Die von Cem Özdemir genehmigte Aussetzung der Brachen sei ein Kotau vor den Bauern. Denn aus wissenschaftlicher Sicht seien nicht nur vier, sondern mindestens zehn Prozent Brachfläche nötig, sagt Taube. Nur so bleibe die agrarische Insekten- und Vogelfauna erhalten sowie der “Gen-Flow” durch den Austausch von Wildtieren und Samen. Vor 2008 hätten die Landwirte freiwillig acht bis zehn Prozent ihrer Flächen brachgelegt: Weil die Preise ob der Überproduktion damals ins Bodenlose fielen. Ab
Trotz deutlicher Kritik von Grünen, Umweltschützern, aber auch Wissenschaftlern dürfte das EU-Parlament am heutigen Dienstag für die vorgeschlagenen Lockerungen bei der GAP stimmen. Dass sich das im Voraus so deutlich sagen lässt, liegt daran, dass die europäischen Liberalen, die Renew-Fraktion, den Schritt größtenteils unterstützen.
Die Ausnahmeregeln und Lockerungen, die die Kommission vorgeschlagen hat, brauche es, “um den Bedürfnissen der Landwirte gerecht zu werden“, sagt Valérie Hayer, seit Ende Januar Renew-Chefin, zu Table.Briefings. Zwar habe die laufende EU-Legislaturperiode mit einer Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) begonnen, “damit sie grüner wird und den Landwirten mehr Geld einbringt.” Heute befände man sich aber in der Umsetzungsphase und es seien Mängel aufgetaucht.
Bei der Europawahl tritt Hayer, deren Eltern selbst Landwirte sind, als Spitzenkandidatin von Renaissance an, der Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Anders als die deutsche FDP haben viele Renaissance-Abgeordnete in der Vergangenheit beispielsweise für das im Agrarsektor umstrittene Renaturierungsgesetz gestimmt. Dass sie bei der GAP wiederum auf die Bauern zugehen, dürfte auch am starken Einfluss der Bauernproteste in Frankreich liegen. Dem Vernehmen nach wird eine große Mehrheit der französischen Liberalen, die die größte nationale Delegation in Renew stellen, für die Lockerungen stimmen.
Trotzdem sollte der Green Deal “nicht gegen die Landwirtschaft ausgespielt” werden, betont Hayer. Das gelte auch für die nächste Amtszeit. Sie fordert, “eine umfassendere und strukturelle Überlegung” über die Zukunft der Landwirtschaft in Europa.
Freihandelsabkommen, die den Import von Agrarprodukten aus Ländern ermöglichen, in denen nicht dieselben Umweltauflagen wie im EU-Binnenmarkt gelten, sieht Hayer dagegen kritisch. Sie hält die Wut der Landwirte für berechtigt. “Was hier auf dem Spiel steht, ist die Frage der Vergütung und des fairen Wettbewerbs.”
Sie unterstützt deshalb die Idee gegenseitiger Umweltstandards, die im Brüsseler Jargon als “Spiegelklauseln” bezeichnet werden. Europäische Produktionsstandards, zum Beispiel zu Umwelt und Klima, würden dabei auch auf Importe angewendet. In diesem Sinne fordert Hayer eine “neue Generation” von Handelsabkommen, “die auf den Pariser Klimazielen und dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen”.
Das EU-Mercosur-Abkommen ist für sie kein solcher Deal der Zukunft, sondern ein “schlechtes Abkommen.” Anders als jenes mit Chile, das am 1. Mai in Kraft tritt. Das sei besser, so Hayer, weil es ein Kapitel zur Nachhaltigkeit von Nahrungsmittelsystemen enthält. cs/jd
21.04. – 24.04.2024 / Brüssel
Konferenz World Cocoa Conference 2024
Die Weltkakaokonferenz ist die führende Veranstaltung für den globalen Kakao- und Schokoladensektor, auf der alle Akteure der Kakaowertschöpfungskette – Regierungen, Kakaobauern, Genossenschaften, Exporteure, Händler, Hersteller, Marken, Einzelhändler, Finanzinstitute, Logistikunternehmen, internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Wissenschaftler usw. aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Meinungen auszutauschen und Lösungen für die Nachhaltigkeit des Sektors zu finden. INFO
23.04.2024 – 11.00 Uhr / online
Veröffentlichung EFSA Bericht Pestizidrückständen in Lebensmitteln
Die EFSA präsentiert ihren dreijährlichen Bericht zu Pestizidrückständen in Lebensmitteln. Ab 11 Uhr können dir Daten hier abgerufen werden. Studie
24.04.2024 – 12.00 – 14.00 Uhr / Brüssel
Plenartagung Europäisches Parlament Aussprache und Abstimmung zu NGT Pflanzen und zum Schutz vor Pflanzenschädlingen
Themen: GAP-Lockerungen & Ukraine-Handelserleichterungen, Lieferkettengesetz, Verpackungsverordnung, Verordnung zur Pflanzengesundheit, Saatgutverordnung, Neue Züchtungstechniken Tagesordnung
24.04.2024 – 14.00 – 15.30 Uhr / Rom, online
High-Level Event Launch on the Global Report on Food Crisis
2024 Global Report on Food Crises launch event in Rome. ANMELDUNG
24.04. – 25.04.2024 / Eichhof in Bad Hersfeld
Tagung 3. BZL-Bildungsforum: “Neue Formate in der landwirtschaftlichen Berufsbildung”
Von Nachhaltigkeit im Unterricht über die Motivation der Schülerschaft bis hin zur Drohnentechnik im Pflanzenbau – um “Neue Formate in der landwirtschaftlichen Berufsbildung” geht es beim 3. Bildungsforum für die berufliche Bildung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL). INFO & ANMELDUNG
25.04. – 26.04.2024 / Kaiserslautern
Konferenz Ergebniskonferenz der 36 vom BMEL geförderten KI-Projekte
Forscherinnen und Forscher haben KI-Anwendungen entwickelt, um die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen oder das Tierwohl automatisiert zu erfassen. Sie haben auch einen nachhaltigen Einkaufsassistenten oder einen digitalen Zwilling erstellt, um den Verderb von Lebensmitteln zu überwachen. Im Rahmen einer Ergebniskonferenz werden die Forschungserfolge der 36 Projekte vorgestellt. INFO & ANMELDUNG
26.04.2024 – 9.30 Uhr / Berlin
Plenarsitzung 1043. Sitzung des Bundesrates
TOP 35: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 in Bezug auf Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen für Klima, Umwelt und Tierwohl, Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung der GAP-Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen
TOP 36: Erste Verordnung zur Änderung der GAPInVeKoS-Verordnung TAGESORDNUNG
30.04.2024 – 8.30 – 14.30 Uhr / Tempelberg Steinhöfel
Tagung PATCHCROP Feldrobotik-Tag 2024
Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. zu diesem Tag rund um Feldroboter, Drohnen und andere Systeme aus dem Bereich Smart Farming. Am 30. April 2024 auf dem Gelände des Landschaftsexperimentes patchCROP in Tempelberg (Steinhöfel) erwartet Sie ein buntes Programm aus Vorträgen, Podiumsdiskussion und Felddemonstrationen. INFO & ANMELDUNG
03.05. – 12.05.2024 / Bezirksgärtnerei Charlottenburg-Wilmersdorf, Königsweg 6, 14193 Berlin
Aktionswoche des BMEL Torffrei gärtnern!
Mit torffreien Erden leisten Hobbygärtnernde einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Denn der Abbau und die Nutzung von Torf setzen klimaschädliches Kohlendioxid frei. Um weitere Pflanzenfreundinnen und -freunde für den Klimaschutz zu gewinnen, findet erstmals eine bundesweite Aktionswoche statt, bei der sich alles um das torffreie Gärtnern dreht. Gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft informiert das BMEL über die Vorteile und Besonderheiten der torffreien Pflanzenpflege. INFO
24.05. -25.05.2024 / Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg
Jahrestagung der Jungen DLG 2024 Landwirtschaft 2040 – Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Zukunft
Die Jahrestagung der Jungen DLG ist der zentrale Ort in Deutschland für Studierende, Berufseinsteiger und Young Professionals im Bereich Landwirtschaft und Agribusiness, um sich zu vernetzen, fortzubilden und miteinander Spaß zu haben. Dazu sind alle Interessierte (egal ob DLG-Mitglied, oder nicht) sehr herzlich eingeladen. INFO & ANMELDUNG
Der Spiegel: CDU und CSU wollen Importverbot für Lebensmittel aus Russland
Die CDU und CSU fordern im Bundestag ein Importverbot für Agrargüter aus Russland und Belarus, um die Kriegswirtschaft von Präsident Putin nicht mitzufinanzieren. Sie argumentieren, dass Russland gezielt Exporte, insbesondere von Getreide, nutzt, um Abhängigkeiten zu schaffen und Devisen für Kriegsgüter zu erwirtschaften. Die EU schlug statt eines Importverbots höhere Zölle auf die Einfuhr von Getreide vor. Die Union drängt darauf, nationale Maßnahmen zu ergreifen, falls es auf EU-Ebene keine Einigung gibt. Zum Artikel
Euractiv: Commission wants to ease rules on use of processed manure for farming
Die Europäische Kommission schlägt Änderungen der Nitrat-Richtlinie vor, um die Verwendung von Dünger aus Tierdung in der Landwirtschaft zu erleichtern. Ziel ist es, bio-basierte Düngemittel zu fördern und die Auswirkungen von volatilen Preisen für mineralische Düngemittel abzumildern. Diese Maßnahme erfolgt aufgrund von Forderungen einiger EU-Länder, “die Unterscheidung zwischen synthetischen Düngemitteln einerseits und Düngemitteln auf Güllebasis (wie RENURE und Gärreste) andererseits aufzuheben”. Umweltgruppen äußern Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität. Zum Artikel
Politco: ‘Insane’ and ‘dangerous’ to give up on EU nature law, says Belgian minister
Der belgische Umwelt- und Klimaminister Alain Maron setzt sich trotz starken Widerstands, unter anderem von seinem eigenen Premierminister, für die Genehmigung des Nature Restoration Laws ein. Maron bezeichnet es als “verrückt” und “gefährlich”, das Gesetz in diesem Stadium abzulehnen, und betont die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit im Rat. Die Gesetzgebung, die verbindliche Ziele zur Wiederherstellung von 20 Prozent der EU-Land- und Meeresflächen bis zum Ende des Jahrzehnts festlegt, ist Teil des EU Green Deal und hat politische Kontroversen ausgelöst. Zum Artikel
Tagesschau: NGO-Analyse: Zuckerzusatz in Babynahrung von Nestlé festgestellt
Die Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye fand heraus, dass Nestlé Babynahrung in Entwicklungsländern Zucker zusetzt. Dies betrifft unter anderem Milchpulver und Getreideprodukte. Gleiche Produkte auf dem europäischen Markt sind nicht mit Zucker versetzt. Nestlé streitet die Vorwürfe nicht ab. In einem Statement heißt es: “Wir entwickeln und reformulieren unsere Getreideprodukte für Säuglinge weiter, um den Gehalt an zugesetzten Zuckern weiter zu reduzieren, …” Zum Artikel
Studie: Prioritizing partners and products for the sustainability of the EU’s agri-food trade
Forschende der Universität Rostock untersuchten die Verbindung zwischen den Anforderungen an eine nachhaltige Produktion in Erzeugerländern, mit dem Verbrauchsverhalten und den Vorschriften in den Zielmärkten. Es wurden die Relevanz und die Hebelwirkung der EU-Pflanzenimporte in Bezug auf den Geldwert, den Fußabdruck und die Entwaldung analysiert. Die Studie identifiziert ein großes Potenzial für die EU, Handelsbeziehungen auszubauen und dabei Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette festzulegen. Zur Studie
Euractiv: Südafrika legt bei WHO Einspruch gegen EU-Zitrusfruchtbeschränkungen ein
Südafrika hat bei der WHO eine Beschwerde gegen die phytosanitären Handelsbestimmungen der EU eingereicht. Es geht darin um Regelungen zur Verhinderung der Einschleppung von der Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit (Citrus Black Spot, CBS) in die EU. CBS ist als für den Menschen unbedenklich eingestuft. Während Südafrika, als weltweit zweitgrößter Exporteur von Zitrusfrüchten, eine große finanzielle Belastung in den Regelungen sieht, fürchten europäische Zitrus-Bauern erhebliche Probleme beim Wegfall der Importregelungen, da sie befürchten, CBS könne sich in Europa verbreiten. Zum Artikel
Handelsblatt: Doch kein Resilienzbonus für heimische Solarindustrie
Das “Solarpaket I” soll voraussichtlich diese Woche vom Bundestag beschlossen werden. Die Ampel-Koalition hat sich auf diese Punkte geeinigt: Erleichterungen für Dachanlagen und Balkon-PV; mehr Freiflächen für Solarparks und schnellere Verfahren für Windräder und Stromnetze. Der von den Grünen gewünschte “Resilienzbonus” für heimische Hersteller fehlt. Stattdessen wird auf den Net Zero Industry Act (NZIA) auf EU-Ebene verwiesen. Dieser soll den fehlenden Bonus für lokale Produkte ausgleichen. Zum Artikel
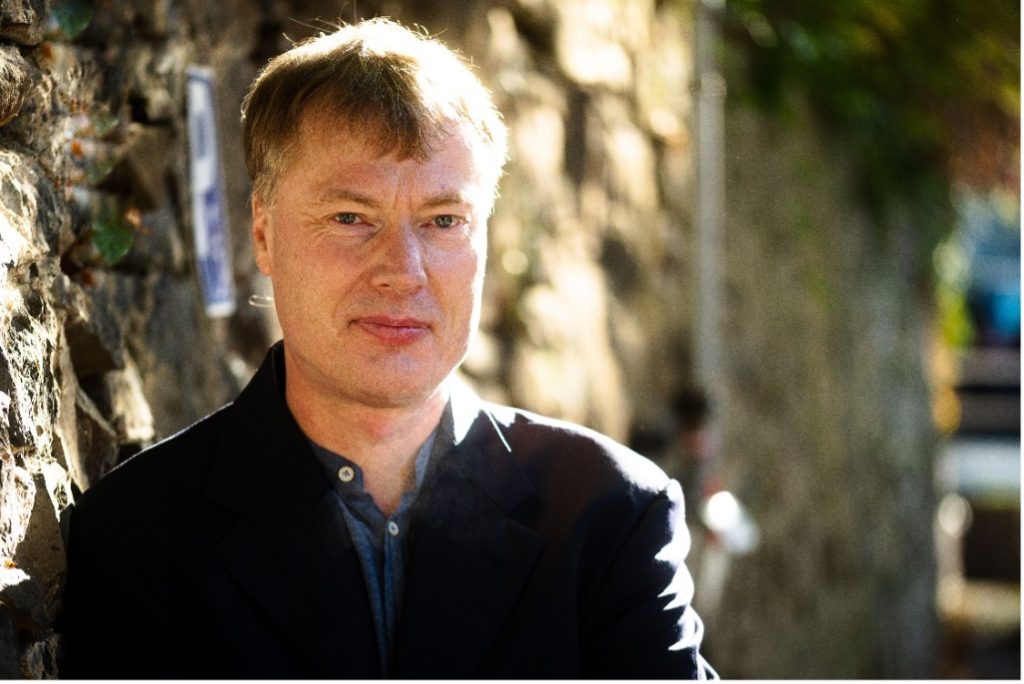
Der Kakaopreis erreicht Rekordhöhen, und zugleich wird der Kakao von Bäuerinnen und Bauern geerntet, die oft in tiefster Armut leben. Auch die Schokoladenpreise ziehen deutlich an. Doch Kakao macht nur einen kleinen Teil des Preises für Schokolade aus. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um endlich die massiven sozialen Probleme in der Lieferkette anzugehen.
Um das Jahr 2000 erreichten die Kakaopreise inflationsbereinigt einen historischen Tiefststand. Als Folge arbeiteten Studien zufolge zu Beginn des Jahrtausends rund zwei Millionen Kinder allein auf den Kakaoplantagen in der Côte d’Ivoire und Ghana. Immer noch gibt es Berichte über Sklavenarbeit von Kindern auf Kakaoplantagen.
Die letzte umfassende Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass weiterhin mindestens 1,5 Millionen Kinder in der Côte d’Ivoire und Ghana unter verbotenen Bedingungen arbeiten. Aus diesen beiden Ländern kommen rund 60 Prozent der Welternte, mehr als zehn Prozent stammen aus Nigeria und Kamerun, wo die Situation nicht besser ist.
Der Anbau von Kakao wird weiterhin von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dominiert, die mehr als 90 Prozent der weltweiten Ernteerträge einfahren. Sie bewirtschaften in der Regel zwei bis vier Hektar und haben keinerlei Einfluss auf den Kakaopreis. Ist die Ernte gut, stürzt der Preis in den Keller, ist sie schlecht, geht der Preis in die Höhe.
2018 wurden die durchschnittlichen Einkommen der Kakao anbauenden Familien berechnet. Durchschnittlich lag ein existenzsicherndes Einkommen für Familien in der Côte d’Ivoire bei 6.517 US-Dollar pro Jahr, die realen Einkommen eines typischen Haushalts lagen jedoch nur bei 2.346 US-Dollar. Aufgrund der kleineren Familien und anderen Preisstruktur lag das existenzsichernde Einkommen in Ghana bei 4.742 US-Dollar, und die Einkommen typischer Haushalte betrugen 2.288 US-Dollar.
Organisationen der Bäuerinnen und Bauern, Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen verwiesen daher immer wieder auf die zwingende Notwendigkeit, die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern durch höhere Preise zu steigern.
Unternehmen wissen, dass darin der schnellste Weg zur deutlichen Linderung der sozialen Probleme in den Anbaugebieten liegt. Bislang wurde von Unternehmen jedoch immer wieder betont, “der Markt” mache den Preis, schließlich wird Kakao in London und New York an den Börsen gehandelt. Menschenrechtliche Aspekte spielen bei der Preisgestaltung keine Rolle.
Andererseits war und ist allen Schokoladenunternehmen klar, dass Kakao nur einen kleinen Teil der Kostenstruktur ihrer Lieferkette ausmacht. Bei einem Einkaufspreis auf dem Weltmarkt von 2.000 US-Dollar je Tonne Kakao, wie er über viele Jahre vorherrschte, lag bei Vollmilchschokolade mit einem Kakaoanteil von 30 Prozent der Preis für Kakao bei rund acht Cent je Tafel. Bei Schokoriegeln oder Schokoladenprodukten mit Füllungen ist der Kostenanteil des Kakaos noch bedeutend niedriger. Eine deutliche Erhöhung der Aufkaufpreise bei den Bäuerinnen und Bauern hätte somit nur zu einer moderaten Steigerung der Kosten für Schokoladenprodukte geführt.
Nun haben sich die Kakaopreise seit Frühjahr 2023 verdreifacht. Vor allem in Westafrika sind die Erntemengen deutlich gesunken. Ursache dafür ist unter anderem das regelmäßig wiederkehrende Klimaphänomen El Niño, das durch den Klimawandel verstärkt wird. Die weitgehende Entwaldung der Anbaugebiete in der Côte d’Ivoire und Ghana verschärft dort die Probleme. Durch massive Regenfälle Mitte 2023 sind große Flächen von Krankheiten befallen und die Bäume tragen wenige Früchte. Hinzu kommen strukturelle Probleme: Aufgrund der über Jahre niedrigen Kakaopreise fehlten vielen Bäuerinnen und Bauern die finanziellen Mittel, um ihre Plantagen optimal zu betreiben.
Die Schokoladenpreise steigen seit Monaten, wenn auch teilweise – angesichts des geringen Anteils der Kosten des Kakaos – in einem überraschend großen Umfang.
Nicht nur für die Côte d’Ivoire und Ghana, sondern auch für weitere Anbauländer liegen mittlerweile Kalkulationen existenzsichernder Einkommen vor. Aufgrund umfassender Datenerhebungen kennen die Unternehmen die durchschnittlichen Anbauflächen der Bäuerinnen und Bauern sowie die Produktivität je Hektar. Aufbauend auf diesen Daten müsste berechnet werden – und dies kann aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen nur innerhalb der einzelnen Unternehmen geschehen – welche Preise die Bäuerinnen und Bauern benötigen, sodass zumindest das Gros der Familien existenzsichernde Einkommen erreicht. Dies kann über garantierte Mindestpreise geschehen oder über Prämien, die bei fallenden Preisen erhöht und bei über eine gewisse Grenze steigenden Preisen gesenkt oder abgeschafft werden.
Einzelne Unternehmen zeigen, dass eine Kombination aus garantierten stabilen Preisen und langfristigen Lieferverträgen mit den Vereinigungen der Bäuerinnen und Bauern und Unterstützungsmaßnahmen zu einer massiven Reduzierung der Menschenrechtsverletzungen inklusive der Kinderarbeit führen können. Ein Beispiel dafür ist Tonys Chocolonely, ein niederländischer Konzern, der in den letzten Jahren schnell expandiert hat. Weitere Pilotprojekte großer Unternehmen zeigen, dass veränderte Lieferbeziehungen möglich sind und zu Verbesserungen führen. Dies sollte flächendeckend eingeführt werden.
Nur so werden die Unternehmen vor Klagen sicher sein. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz schreibt schließlich seit Anfang 2023 vor, dass große Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten mitverantwortlich sind. Auf EU-Ebene wurde kürzlich ein europäisches Lieferkettengesetz beschlossen. Um die Menschenrechte in den Lieferketten zu gewährleisten, braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, dass nach einigen guten Ernten die Preise nicht wieder ins Bodenlose fallen.
Die derzeit hohen Preise könnten es den Konzernen erleichtern, diese Maßnahmen einzuführen. Maßstab für die Preisgestaltung sollte nicht mehr der Preis an der Börse sein, sondern Zahlungen, die existenzsichernde Einkommen ermöglichen.
Friedel Hütz-Adams arbeitet seit 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das SÜDWIND-Institut. Er hat Studien zu verschiedensten Wertschöpfungsketten veröffentlicht, darunter während der vergangenen letzten Jahrzehnte etliche zum Thema Kakao. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss freiwillige Standards und gesetzliche Regulierungen zur Verantwortung der Wirtschaft für die Einhaltung von Menschenrechtsstandards auf das Handeln von Unternehmen haben. Er arbeitet in mehreren Gremien mit, die sich mit Nachhaltigkeitsaspekten befassen, und ist unter anderem Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats der REWE-Group.
