auf ihrer zweitägigen Reise nach Westafrika hat sich Annalena Baerbock am Montag von der bisherigen deutschen Afrika-Politik distanziert. Ein Weiter so könne es nicht mehr geben, sagte die Außenministerin in Dakar mit Blick auf den Sahel. In dieser Ausgabe schauen wir darauf, wie es zu dieser Wende gekommen ist. Und noch etwas Bemerkenswertes ist geschehen: Häufig reist die Ministerin ohne die Begleitung deutscher Unternehmensvertreter. Das ist dieses Mal anders. Und dennoch sucht man die großen deutschen Konzerne vergeblich. Wir haben die Außenministerin auf dieser Reise begleitet.
Zudem erwarten Sie weitere spannende Analysen und News in dieser Ausgabe.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Zum Auftakt ihrer zweitägigen Westafrikareise zeigte sich Annalena Baerbock hinsichtlich der deutschen Politik in der Sahelzone selbstkritisch. “Wir können nicht weitermachen, als ob nichts geschehen wäre”, sagte die Außenministerin. Zugleich warnte sie vor einem kompletten Rückzug aus der Region. “Wir haben ein starkes Interesse an Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Westafrika. Weil die Sicherheit der Menschen uns wichtig ist. Aber auch, weil wir einen stabilen Nachbarkontinent wollen. Weil wir einander brauchen”, so Baerbock weiter.
Die Reise der Außenministerin nach Westafrika kommt rund eine Woche nach Bekanntwerden, dass die Bundeswehr nun doch aus Niger abziehen will. Jetzt lotet die Bundesregierung ihre Optionen in Westafrika neu aus. Ein Stabilitätsanker in der Region soll der Senegal bleiben – obwohl diese Vokabel – “Stabilitätsanker” – in Berlin inzwischen an Strahlkraft verloren hat und nur noch sehr vorsichtig gebraucht wird. Denn dass auch eine weitgehend gefestigte Demokratie wie der Senegal nicht vor Erschütterungen gefeit ist, zeigte sich jüngst: Die Verschiebung der Wahl auf den März 2024 hatte für reichlich Chaos gesorgt.
Dennoch habe sich die Demokratie im Senegal als wehrhaft erwiesen, lobte Baerbock. Für die Bundesregierung ist der Senegal am westlichen Rand der Sahelzone unverzichtbar. Doch weiterhin schwelt es: Eine für Montag angesetzte Regierungserklärung von Premierminister Ousmane Sonko wurde am Wochenende abgesagt. Hintergrund ist ein innenpolitischer Streit darüber, ob Sonko im Parlament sprechen soll.
Die Rolle Frankreichs, das vielfach als Ex-Kolonialmacht mit großem Machtanspruch in der Region kritisiert wird, ist der Bundesregierung durchaus bewusst. Offen thematisiert wird hingegen nicht, dass das geradezu aggressive Beharren von Präsident Macron auf einer Präsenz in Westafrika auch auf EU-Ebene für viel Reibung gesorgt hat. Deutschland liegt viel an einem geeinten Auftreten der EU. Gleichwohl zeigen sich bei Baerbocks Reise zaghafte Bemühungen, sich in der Realpolitik vom Hexagon abzusetzen. Denn das Scheitern Frankreichs im Sahel und der starke Imageverlust bieten Deutschland die Chance, sich als moderner europäischer Partner in Stellung zu bringen: mit einem Fokus auf Klimawandel, Dialog und Wirtschaft.
Nun soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Senegal nach Wunsch der Außenministerin gestärkt werden. Dafür hat die Außenministerin eine zehnköpfige Wirtschaftsdelegation mitgenommen. Die Unternehmen kommen vor allem aus den Bereichen Gesundheitstechnik und Erneuerbare Energie.
Alternative Energiequellen spielen in Senegal längst eine große Rolle. Im Mai dieses Jahres hat Dakar sein erstes Schnellbussystem, genannt Bus Rapid Transport (BRT), in Betrieb genommen. Die Busse werden allesamt elektrisch angetrieben. Für deutsche Unternehmen seien laut AA vor allem Folgeaufträge interessant, die im Rahmen des Netzausbaus mit Zubringerbussen möglich würden.
Der Blick auf die Liste der mitgereisten Unternehmen verrät allerdings, dass es offenbar weiterhin schwierig ist, große deutsche Konzerne für Delegationsreisen nach Afrika zu begeistern. Noch fehle die Afrika-Erfahrung in den Unternehmen. Zudem sei die Sprachbarriere ein Problem, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.
Auch die Umsetzung des BRT wurde international ausgeschrieben. Europäische Angebote blieben jedoch aus. Schließlich erhielt ein chinesisches Unternehmen den Zuschlag. Gleichzeitig sei aber das Interesse auf senegalesischer Seite groß, Kooperationen auszubauen. Deutschland profitiere von seinem guten Ruf.
Das Interesse an Deutschland und das neue deutsche Selbstbewusstsein zeigt sich indes auch am Goethe-Institut in der Stadt. Erst dadurch wurde ein Neubau, der 2025 bezogen werden soll, angestoßen. Diesen besuchte Baerbock am Montagabend. Das Goethe-Institut betreibt insgesamt sechs Einrichtungen in Westafrika. Mit dem geplanten Neubau will das Institut im Senegal sein Angebot ausbauen. Dabei fokussiert sich das Institut auf vier Schwerpunkte:
Das Goethe-Institut ist zudem für Kulturprojekte in Mauretanien, Gambia und Guinea-Bissau zuständig.
Am Dienstag, 16. Juli, wird die Außenministerin in die Elfenbeinküste weiterreisen. Dabei wird vor allem der Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelregion im Fokus stehen.
Die African Petroleum Production Organization (APPO) will eine aktivere Rolle in der Energiewirtschaft auf dem Kontinent spielen. Dazu hat sie die Africa Energy Bank (AEB) mit einem Startkapital von fünf Milliarden Dollar ausgestattet, um Energieprojekte in ganz Afrika zu finanzieren. Das Kapital zeichnen die APPO-Mitgliedsstaaten, nationale Öl- und Gasunternehmen und weitere, ungenannte Investoren.
Auf der 45. außerordentlichen Sitzung des APPO-Ministerrats in Abuja wurde zudem angekündigt, dass die Bank ihren Sitz in Lagos haben soll. Die APPO gründete die AEB mit Unterstützung der Afreximbank, um die Finanzierungsschwierigkeiten zu lösen, mit denen die afrikanische Öl- und Gasindustrie infolge der Energiewende zunehmend konfrontiert ist.
Viele europäische und amerikanische Geschäftsbanken finanzieren unter dem Druck der öffentlichen Meinung in ihren Heimatmärkten keine Projekte mehr in der fossilen Energiewirtschaft. Auch multilaterale und nationale Förderbanken aus dem Globalen Norden verfolgen eine ähnliche Kreditpolitik.
Dadurch ist es für Unternehmen aus dem afrikanischen Erdöl- und Erdgassektor schwieriger geworden, neue Projekte zu finanzieren, selbst wenn diese positiv zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen.
Die AEB soll anderen spezialisierten Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ähneln. Obwohl die Bank angibt, sich auf die Öl- und Gasindustrie zu konzentrieren, ist sie auch offen für Investitionen in anderen Energieformen, einschließlich erneuerbarer Energien.
Die Gründung der AEB in Nigeria sei ein Zeichen für eine potenziell transformative Entwicklung des afrikanischen Energiesektors, sagte Katlong Alex, Energieanalyst beim African Energy Council, zu Table.Briefings. Angesichts der zunehmenden Desinvestitionen in Öl und Gas aufgrund der Energiewende und der ESG-Vorgaben könne das Startkapital der AEB von fünf Milliarden Dollar dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die Energieprojekte in ganz Afrika behindert, zu schließen.
“Dieser Finanzschub könnte die Entwicklung kritischer Infrastruktur vorantreiben und zu einem besseren Zugang zu Elektrizität und erhöhter Energiesicherheit führen” sagte Alex weiter. “Während die Bank die Bedeutung von Öl und Gas anerkennt, ermöglicht ihre Offenheit für erneuerbare Energielösungen den afrikanischen Nationen zudem, einen ausgewogeneren Ansatz zu verfolgen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um sich an die globale Energiewende anzupassen und den Energiemix zu diversifizieren.”
Dass Nigeria den Hauptsitz der AEB beherbergt, könne die Position des Landes als regionaler Energieführer stärken und ihm möglicherweise mehr Einfluss bei der Gestaltung der Energiepolitik und der Anziehung von Investitionen geben werde, so Alex.
“Darüber hinaus könnte die AEB den Wissens- und Technologietransfer im Energiesektor erleichtern, insbesondere im Hinblick auf erneuerbare Energien, und so die Einführung sauberer Energielösungen in Afrika beschleunigen”, meint der Energieexperte.
Jide Pratt, Country Manager bei Trade Grid, sagte gegenüber Table.Briefings, dass die Africa Energy Bank in Nigeria die Energiesicherheit erhöhen werde. Afrika als Kontinent stehe mit der Gründung der Bank vor einem großen Sprung. “Die Bank verringert das Kreditrisiko auf dem Kontinent und trägt dazu bei, das Stigma oder den Rückzug Europas hinsichtlich der Finanzierung fossiler Brennstoffe in Afrika zu beseitigen”, fügte Pratt hinzu.
Allerdings müssen laut Alex mehrere Herausforderungen bewältigt werden, damit die AEB Erfolg hat. Obwohl fünf Milliarden Dollar ein beträchtlicher Betrag sei, reiche das Eigenkapital seiner Meinung nach möglicherweise nicht aus, um Afrikas enormen Energiebedarf langfristig zu decken.
“Daher hängt der Erfolg der AEB von der Gewinnung weiteren Kapitals und einem effizienten Management ab”, meint Alex. “Darüber hinaus muss der Rahmen der Bank zur Finanzierung risikoreicher Projekte sorgfältig geprüft werden. Die Abwägung des Risikos mit einer wirkungsvollen Projektauswahl wird die Effektivität der AEB sicherstellen.”
Eine starke Führung und transparente Abläufe seien laut Alex ebenfalls von entscheidender Bedeutung, damit die AEB Vertrauen gewinne und Investitionen anziehe. Klare Richtlinien und Kontrollmechanismen seien unerlässlich, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitteln sicherzustellen.
“Insgesamt stellt die Gründung der AEB eine vielversprechende Chance für Afrika dar”, schloss Alex. “Aber ihr Erfolg hängt davon ab, diese Herausforderungen zu überwinden und ihre Ressourcen effizient zu nutzen.”
Noch knapp ein halbes Jahr haben Händler und Produzenten von Erzeugnissen wie Kaffee, Kakao, Soja und Holz Zeit, sich vorzubereiten. Um diese Produkte auf dem EU-Markt zu verkaufen, müssen sie ab 2025 sicherstellen, dass diese nicht von nach 2020 entwaldeten Flächen stammen.
Der enge Zeitplan für die Umsetzung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) fordert viele Betroffene heraus. Zwar ist das Gesetz bereits vor einem Jahr in Kraft getreten. Doch Unternehmen und Verwaltung müssen Teams aufbauen, Prozesse entwickeln, digitale Tools für die Anwendung und Lösungen für die aufwendige Dokumentation finden – und die EU-Kommission hat entscheidende Informationen zur Umsetzung, wie das Länder-Benchmarking und bestimmte Leitlinien, teilweise noch gar nicht veröffentlicht.
Mit der Verordnung will die EU gegen die weltweite Entwaldung vorgehen, deren Hauptursache die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen ist. Hauptimportgut in diesem Zusammenhang ist Soja, das beispielsweise auf abgeholzten Regenwaldflächen in Südamerika angebaut wird und in Europa überwiegend als Tierfutter zum Einsatz kommt. Aber auch der Konsum von Palmöl, Kaffee und Schokolade tragen zur Entwaldung bei. Wälder spielen jedoch eine wichtige Rolle für die biologische Vielfalt und die Eindämmung des Klimawandels.
Viele Unternehmen sind gleich mehrfach von dem Gesetz betroffen – wenn sie mehrere dieser Erzeugnisse auf den Markt bringen. So zum Beispiel Tchibo und Melitta, die sowohl Kaffee als auch Kaffeefilter verkaufen. Letztere werden meist aus holzbasiertem Zellstoff hergestellt. Tchibo verkauft zudem auch Möbel.
Zukünftig müssen die Produzenten den Einkäufern in der EU über eine digitale Schnittstelle genaue GPS-Daten ihrer Anbaufläche mitliefern sowie eine Sorgfaltserklärung. Diese muss auch belegen, dass lokale Gesetze eingehalten wurden. Fehlen diese Daten, darf der Zoll die Lieferung nicht auf den EU-Markt lassen.
In kleinteiligen Lieferketten wie von Kaffee kann dies sehr schwierig werden, erklärt Pablo von Waldenfels, Direktor Unternehmensverantwortung bei Tchibo. Hinter dem Einkaufsvolumen von Tchibo stehe die Produktionsmenge von 75.000 Kaffeefarmern, in der Regel Kleinfarmer. Größere Farmen wie in Brasilien würden industriell betrieben und hätten bereits Erfahrung darin, bestimmte Auflagen einzuhalten und dies zu dokumentieren. “70 bis 80 Prozent der Farmen sind allerdings sehr klein, vielleicht so groß wie ein Fußballfeld, wie ein halbes, oder auch nur so groß wie ein Garten”, erklärt von Waldenfels. “Wenn die es nicht schaffen, die notwendigen Unterlagen heranzuschaffen, sind sie langfristig vom Kaffeeeinkauf aus Europa ausgeschlossen – nicht, weil sie Bäume fällen, sondern einfach nur, weil sie die Daten nicht bereitstellen können.”
Die Vorgaben führen zudem auf mehrfache Kontrollen innerhalb desselben Unternehmens hinaus, kritisiert Stefan Dierks, Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie bei der Melitta Gruppe. Die Daten der Farmer werden bereits vor Ankunft der Lieferung überprüft, jede Lieferung erhält eine EU-Referenznummer im digitalen System “Traces”. Werden später unterschiedliche Kaffeesorten gemischt, wiederholt sich dieser Prozess: Auch die Mischung braucht eine eigene Referenznummer. Wird diese dann zum Beispiel bei der Tochtergesellschaft Melitta Professional verkauft, muss dieser Unternehmensbereich nochmals alle Daten überprüfen. “Das ist reine Bürokratie und weder zielführend noch sinnvoll“, sagt Dierks.
Dierks koordiniert bei Melitta ein unternehmensweites Projektteam zur Anwendung der EUDR. Dieses tauscht sich unter anderem eng mit dem Deutschen Kaffeeverband aus. In dessen Auftrag wurde ein digitales Tool für den Kaffeesektor entwickelt, mit dem sich die Daten erfassen und im Hinblick auf das Entwaldungsrisiko überprüfen lassen. Hier soll auch eine Schnittstelle zum EU-System “Traces” geschaffen werden, das die Referenznummern erstellt. “Es braucht hier automatisierte Tools, mit reinem Personalaufwand ist das nicht machbar”, stellt Dierks fest.
Die Forderungen nach einem Aufschieben der Umsetzungsfrist kann er gut nachvollziehen. “Die Zeit zur Vorbereitung ist an vielen Stellen der Lieferketten zu kurz, insbesondere in manchen Kaffeeanbauregionen”, erklärt Dierks. “Da würde es tatsächlich helfen, die Anwendung um ein halbes Jahr zu verschieben.”
In jedem Mitgliedstaat überprüft eine nationale Behörde die Anwendung der neuen Regeln. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Dort leitet Annerose Lichtenstein seit Anfang Juni die Gruppe “Entwaldungsfreie Produkte, Holzhandel”. Das derzeit noch sechsköpfige Team soll in diesem Jahr auf insgesamt 36 Stellen erweitert werden, die Ausschreibungen und Einstellungen laufen zurzeit. Das sei jedoch noch lange nicht genug. “Es gibt unterschiedliche Schätzungen wie viele Kontrollen wir durchführen müssen – in jedem Fall wird es eine sehr hohe Anzahl sein”, erklärt sie. “Auch wenn wir diese Kontrollen mit einem hohen Automatisierungsgrad machen, ist das sehr viel Arbeit und bedarf Personal.”
Laut einer Zollauswertung gebe es geschätzt insgesamt 150.000 deutsche Verarbeiter und Händler, die von dem Gesetz betroffen sind, erzählt Lichtenstein. Für die inländischen Primärerzeuger werden voraussichtlich die Bundesländer zuständig sein.
Daraus ergeben sich laut Schätzungen zukünftig etwa 20 Millionen Meldungen über einzelne Erzeugnisse pro Jahr in “Traces”. Aus ihnen muss das Team in der BLE einzelne Marktteilnehmer auswählen. Die Behörde entwickelt zurzeit ein automatisiertes Verfahren, mit dem je nach Entwaldungsrisiko bestimmte Punkte vergeben werden. Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher eine Kontrolle. Dabei fallen bestimmte Risikofaktoren ins Gewicht: “Dort, wo die Erzeuger zumindest in der Nähe von Entwaldungsgebieten sind, und dort, wo es überhaupt große Waldgebiete gibt, ist das Risiko natürlich höher”, erklärt sie. Ihr Team überprüft dann in einem dreistufigen Verfahren die Sorgfaltserklärung sowie die Risikobewertung der Marktteilnehmer und deren Maßnahmen, um das Entwaldungsrisiko zu minimieren.
Was außerdem noch fehlt, ist ein deutsches Gesetz, das die nationale Anwendung regeln soll. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) arbeitet zurzeit daran. Laut Informationen von Table.Briefings soll es darin um die Zuständigkeiten von Bund und Ländern, die Befugnisse der Kontrollbehörden und um Straf- und Bußgeldvorschriften gehen. Außerdem wird darin das Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSiG) aufgehoben. Dieses setzt bislang die EU-Holzhandelsverordnung um, die mit der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte ebenfalls aufgehoben wird.
Das deutsche Gesetz soll laut BMEL bis zum 30. Dezember in Kraft treten – dem Tag, ab dem die EU-Verordnung angewendet werden muss.
Südafrikas neue Regierung will sich gegen eine geplante Überprüfung der bilateralen Beziehungen zwischen Südafrika und den USA durch den US-Senat wehren. Die Überprüfung könnte Südafrikas Zugang zum African Growth and Opportunity Act (AGOA) gefährden, der afrikanischen Ländern einen zollfreien Zugang zum US-Markt ermöglicht.
Eine südafrikanische Delegation wird vom 24. bis 26. Juli am AGOA-Forum in Washington DC teilnehmen, auch um Lobbyarbeit bei den US-Gesetzgebern zu leisten, wie Parks Tau, Minister für Handel, Industrie und Wettbewerb, ankündigte. “Wir beabsichtigen, mit Senatoren und Kongressmitgliedern darüber zu sprechen, welche Position wir als südafrikanische Regierung in einer ganzen Reihe von Fragen auf der Grundlage des AGOA-Gesetzes, aber auch unter Berücksichtigung der bilateralen Beziehungen einnehmen”, sagte er.
US-Abgeordnete hatten die Überprüfung der Beziehungen im Februar gefordert, nachdem Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs des Völkermords verklagt hatte. Sie verwiesen auch auf Südafrikas Bestreben, engere Beziehungen zu China und Russland zu knüpfen.
Die USA sind nach China der zweitgrößte Handelspartner Südafrikas. Der Handel zwischen den beiden Ländern belief sich im vergangenen Jahr auf 23,7 Milliarden Dollar. Südafrika lieferte im Rahmen des Abkommens hauptsächlich Autos und landwirtschaftliche Erzeugnisse. ajs
Royal Air Maroc ist afrikanischer Spitzenreiter bei den “World’s Best Regional Airlines 2024”, so kürzlich die britische Unternehmensberatung Skytrax. Die Airline schaffte es in dieser Kategorie unter die Top 10 weltweit (Platz 7). Lift und Airlink aus Südafrika zählen in diesem Jahr zu den besten Billig-Airlines in der Welt und sind die beiden besten in Afrika. Jonathan Ayache, CEO der Lift Company, sagte, das Unternehmen sei “absolut begeistert, unseren allerersten Skytrax Award zu erhalten.” Lift gibt es erst seit vier Jahren. Auch bei den “World’s Most Improved Airlines 2024” schnitten Lift und Airlink mit den Plätzen sieben und zehn sehr gut ab.
Skytrax bewertet jedes Jahr Fluggesellschaften und Flughäfen. 2024 wurden hierzu mehr als 21 Millionen Reisende aus über 100 Ländern nach ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Unter den “World Top 100 Airlines 2024” ist Ethiopian Airlines mit dem 36. Platz die beste Airline in Afrika – schon zum siebten Mal in Folge. Zudem bietet sie seit sechs Jahren die beste Business Class und Economy Class auf dem Kontinent an.
“Wir bleiben an der Spitze der Luftfahrtbranche, indem wir kontinuierlich Spitzentechnologien einsetzen, um das Erlebnis unserer Passagiere zu verbessern”, sagte MesfinTasew, CEO der Ethiopian Airlines Group. Royal Air Maroc ist zweitbeste Airline in Afrika (Platz 55 weltweit) und South African Airways erreichte den dritten Platz (69). Dieses Ranking wird weltweit seit Jahren von den Nahost-Airlines Qatar Airways und Emirates dominiert, die zusammen rund 60 Flughäfen auf dem afrikanischen Kontinent anfliegen.
South African wurde auch als “Cleanest Airline in Africa” gewählt und kam an zweiter Stelle in der Kategorie “Best Airline Staff in Africa“, gleich hinter Kenya Airways. Die besten Flughäfen in Afrika sind die drei südafrikanischen Hubs Kapstadt (Platz 54 weltweit), Durban (72) und Johannesburg (83). as
Die Militärjunta von Burkina Faso hat ein Verbot homosexueller Handlungen angekündigt. “Von nun an werden Homosexualität und damit verbundene Praktiken gesetzlich geahndet”, sagte Justizminister Edasso Rodrigue Bayala vergangene Woche der Nachrichtenagentur AFP. Er gab weder das Ausmaß des Verbots bekannt – ob es sich gegen die LGBTQ-Identität im Allgemeinen oder speziell gegen Personen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen richtet – noch die Strafen, die ein Verstoß nach sich ziehen könnte.
Obwohl LGBTQ-Identität in dem Sahelland nicht allgemein akzeptiert wird, war sie bisher nicht verboten: Burkina Faso zählte zu den 22 afrikanischen Staaten, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht kriminalisiert worden sind. Anders als viele ehemalige britische Kolonien hat das Land nach der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 keine Anti-Homosexualitätsgesetze geerbt.
Die burkinische Junta putschte sich 2022 an die Macht und orientiert das Land seither stärker an Russland. Die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht und zum Westen allgemein hat sie hingegen drastisch reduziert. In Russland sind homosexuelle Handlungen zwar seit 1993 entkriminalisiert. Präsident Wladimir Putin geht aber dennoch hart gegen die LGBTQ-Gemeinschaft vor und diffamiert die Gleichberechtigung Homosexueller als westliches Einflussstreben. Diese Behauptung findet auch in einigen afrikanischen Staaten Anklang.
Laut ILGA World Database werden derzeit in 61 Ländern einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen kriminalisiert, davon 32 in Afrika. Die Strafen reichen von Geld- und Freiheitsstrafen bis hin zur Todesstrafe. Während einige Länder gleichgeschlechtliche Beziehungen in den vergangenen Jahren entkriminalisiert haben, haben andere stattdessen Verbote erlassen. So hat etwa Uganda im Mai vergangenen Jahres eines der weltweit schärfsten Gesetze gegen LGBTQ-Personen verabschiedet. Als Reaktion darauf hat die Weltbank die Vergabe neuer Kredite an Uganda ausgesetzt. In Ghana wird trotz der Warnungen anderer Länder und internationaler Finanzinstitutionen ein drakonisches Gesetz zur Kriminalisierung von LGBTQ-Identität in Betracht gezogen. Die Tochter des kamerunischen Präsidenten, Brenda Biya, hat sich hingegen vor kurzem als lesbisch geoutet – trotz des Anti-LGBTQ-Gesetzes des Landes und der Gegenreaktionen ihrer Familie. ajs
Außenministerin Annalena Baerbock ist am gestrigen Montag zu einer zweitägigen Reise in den Senegal und in die Elfenbeinküste aufgebrochen. Neben dem Umgang mit den von Putschisten geführten Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso geht es auf Baerbocks Reise auch um das Knüpfen neuer wirtschaftlicher Beziehungen. Die Außenministerin wird deshalb auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Mit dabei sind:
ajs

Jeden Tag wächst die Weltbevölkerung um circa 200.000 Menschen, einmal im Jahr um fast die Einwohnerzahl Deutschlands. Das zeigen die aktuell veröffentlichten Berechnungen der Vereinten Nationen. Zwar bekommen weltweit Frauen durchschnittlich ein Kind weniger als 1990. Dennoch erreicht die Weltbevölkerung ihren Höhepunkt mit knapp mehr als zehn Milliarden Menschen voraussichtlich in den 2080er-Jahren.
Zwei Drittel dieses Bevölkerungswachstums findet in Entwicklungs- und Schwellenländern statt, in denen heute schon 80 Prozent der Weltbevölkerung leben. Besonders schnell wächst die Bevölkerung auf unserem Nachbarkontinent Afrika, die sich bis 2050 auf 2,4 Milliarden Menschen nahezu verdoppeln wird. Hier lebt mittlerweile die größte Jugendgeneration aller Zeiten!
All diese jungen Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde, mit ausreichend Essen, Schuldbildung, einer grundlegenden Gesundheitsversorgung. Das heißt auch: Für diese junge Generation werden Millionen neue Jobs benötigt. Das Bevölkerungswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern erfordern bis 2050 eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion um 50 Prozent und des Energiebedarfs um circa 70 Prozent. Das sind keine Randthemen, sondern globale Herausforderungen, die uns alle betreffen, und die zugleich große Chancen bieten.
In der aktuellen Debatte über die Entwicklungspolitik wird oft vergessen: Wir können dazu beitragen, dass diese Menschen eine gute Zukunft haben. Dass sie neue Unternehmen in ihrer Heimat gründen und mit uns Handel treiben. Es liegt an uns, wie wir auf diese Menschen zugehen. Ob wir sie ignorieren, oder aber ob wir gezielt in ihre Ausbildung und die wirtschaftliche Entwicklung in ihren Heimatländern investieren. Denn wir haben heute weltweit die Technologien und das Wissen, eine Welt ohne Hunger zu schaffen, erneuerbare Energien auszubauen und durch nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zur Lösung der globalen Herausforderungen beizutragen.
Denn in der Bevölkerungsentwicklung steckt die Chance einer demografischen Dividende: Über 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Ein unglaubliches Potential an Kreativität und Innovationskraft für die lokale Wirtschaft – und ein rapide wachsender Zukunftsmarkt auch für europäische Unternehmen.
Zu den Gestaltungsmöglichkeiten gehören auch die Stärkung von Frauen und Mädchen und eine nachhaltige Bevölkerungspolitik. Bleiben wir beim Beispiel Subsahara-Afrika, wo die Geburtenrate mit 4,6 Kindern pro Frau weiterhin hoch ist. Teenagerschwangerschaften sind ein besonderes Problem: Eines von zehn Mädchen bekommt sein erstes Kind im Alter zwischen 15 und 19 Jahren und in der Folge dann oft mehr Kinder, als es ernähren und großziehen kann. Für die meisten dieser jungen Frauen bedeutet dies das frühzeitige Ende der Schullaufbahn und damit auch einer zukunftssichernden Ausbildung, in der Konsequenz oft lebenslange Abhängigkeit und Armut.
Dass Frauen entscheiden, wann und wie viele Kinder sie bekommen möchten, ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Fast jede zehnte Frau hat keine Wahl, ob sie verhüten will oder nicht. Rund 40 Prozent aller Schwangerschaften in Entwicklungsländern sind ungeplant. Dabei würde eine nachhaltige Bevölkerungspolitik, die Frauen gezielt stärkt, ein enormes wirtschaftliches und gesellschaftliches Potential entfesseln.
Dass Maßnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungspolitik und die Stärkung von Frauen und Mädchen wirken, zeigt ebenfalls der aktuelle Bericht der Vereinten Nationen: In den vergangenen 30 Jahren ist die Müttersterblichkeit um ein Drittel zurückgegangen, die Zahl der Frauen, die verhüten, hat sich verdoppelt. Und 162 Länder haben Gesetze gegen häusliche Gewalt verabschiedet.
In die Stärkung von Frauen und Mädchen und in die gesamte Jugendgeneration in Afrika zu investieren, ist daher zukunftsgerichtete, sinnvolle Politik. Hier liegt der Schlüssel für die große Chance auf eine demografische Dividende und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung. Denn wir leben in einem globalen Dorf, wo alles mit allem verbunden ist: Handel, Klimaschutz, Vorsorge vor Pandemien.
Wir brauchen den entschlossenen Willen, mit unseren Partnerländern in Afrika gemeinsam in Bevölkerungspolitik, in Gesundheit und Bildung, in Ernährungssicherheit, in nachhaltige Energie sowie in gute Arbeitsplätze zu investieren. So schaffen wir gemeinsam Perspektiven für die größte Jugendgeneration aller Zeiten in ihrer Heimat und fördern zugleich einen nachhaltigen Entwicklungspfad in den Märkten der Zukunft. Das kommt nicht zuletzt auch unserer eigenen Wirtschaft zugute.
Gerd Müller leitet die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (Unido).Von 2013 bis 2021 war er Bundesentwicklungsminister (CSU). Jan Kreutzberg ist Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW).
Al Jazeera: Ruanda-Wahl im Schatten wachsender Spannungen mit DR Kongo. Während die Ruander an die Urnen gehen, um ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten zu wählen, bleiben die angespannten Beziehungen zum Nachbarland, der Demokratischen Republik Kongo, eine wachsende Herausforderung für beide Länder und die gesamte Region. Im Osten der DR Kongo verfolgen die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen eine tödliche Offensive gegen das kongolesische Militär, die zu einer massiven humanitären Krise geführt hat. Die eskalierenden Spannungen drohen, sich zu einem größeren regionalen Konflikt auszuweiten.
Reuters: Planmäßiger UN-Abzug aus DR Kongo unwahrscheinlich. Die kongolesische Außenministerin Therese Kayikwamba Wagner teilte am Samstag mit, es sei unwahrscheinlich, dass die UN-Friedenstruppen den vereinbarten Rückzug aus der konfliktgeplagten Provinz Nord-Kivu fortsetzen, solange ruandische Truppen in dem Gebiet sind. Einem neuen UN-Bericht zufolge kämpfen in Nord-Kivu 3.000 bis 4.000 ruandische Truppen gegen die kongolesische Armee und kontrollieren de facto auch die Operationen der M23-Rebellen. Die Kämpfe in der Provinz haben mehr als 1,7 Millionen Menschen zur Flucht veranlasst, womit sich die Gesamtzahl der binnenvertriebenen Kongolesen nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf die Rekordzahl von 7,2 Millionen erhöht.
The East African: USA besorgt über Konfliktmineralien im Ostkongo. Washington ist besorgt über die Gewinnung, den Transport und die Ausfuhr von Konfliktmineralien im Osten der DR Kongo. Sie habe zu einer Vielzahl von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit, schlimmsten Formen von Kinderarbeit sowie sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere in den handwerklichen Bergbaugebieten, geführt. “Die USA sind weiterhin besorgt über die Rolle, die der illegale Handel und die Ausbeutung bestimmter Mineralien, einschließlich Gold und Tantal, … bei der Finanzierung des Konflikts spielen,” heißt es in einer Erklärung der US-Regierung. In vielen Fällen werden diese Mineralien über Ruanda und Uganda geschmuggelt, bevor sie in die Verarbeitungsländer transportiert werden.
Bloomberg: Kenia stellt sich auf weitere Proteste ein. Kenianische Aktivisten haben für Dienstag zu weiteren Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen. Der Vorwurf: Sie habe es versäumt, die Sicherheitskräfte strafrechtlich zu verfolgen, die im Verdacht stehen, im vergangenen Monat mindestens 41 Menschen getötet zu haben, die gegen die geplante Steuererhöhung protestiert hatten. Präsident William Ruto hatte letzte Woche angekündigt, dass am Montag ein so genannter nationaler Dialog beginnen würde, um die Spannungen im Land zu entschärfen. Kenias größte Oppositionspartei ODM hat jedoch erklärt, es sei unklar, ob und wann die Gespräche, die politische Parteien, Gruppen der Zivilgesellschaft und Berufsverbände zusammenbringen sollen, stattfinden werden. Die Partei habe bislang keine Einladung erhalten, sagte der ODM-Generalsekretär.
Washington Post: Gambia bestätigt Verbot weiblicher Genitalverstümmelung. In einem wichtigen Sieg für die Verfechter von Frauenrechten in dem westafrikanischen Land haben Mitglieder der gambischen Nationalversammlung am gestrigen Montag einen Gesetzentwurf abgelehnt, mit dem das Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) aufgehoben worden wäre. Gambia hat FGM im Jahr 2015 unter Strafe gestellt. Religiöse Hardliner hatten in diesem Jahr versucht, das Verbot aufzuheben. Weltweit wird die Zahl der FGM-Opfer auf mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen geschätzt.
Financial Times: Eskom warnt vor erneuter Stromkrise. Das Versäumnis südafrikanischer Kommunen, Schulden in Milliardenhöhe bei dem staatlichen Stromversorger zu begleichen, bedrohe dessen Sanierungsbemühungen, warnt Eskom-Chef Dan Marokane. “Das ist ein großes Risiko für unser Geschäft. In vielen Fällen können sie es sich leisten, haben aber die Zahlung an Eskom nicht zur Priorität gemacht”, sagte er. Die härtere Gangart der neuen Regierung werde aber helfen, die Kultur der Nichtzahlung seitens der Kommunen zu ändern. Eskom hat erst kürzlich den Meilenstein von 100 Tagen ohne Stromausfälle überschritten.
BBC: Kostenlose Bildung in Sambia führt zu überfüllten Schulen. Sambia hat seit der Einführung der kostenlosen Bildung im Jahr 2021 mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Bildungssektor investiert. Seitdem konnten zwei Millionen zusätzliche Kinder zur Schule gehen. Doch die Überfüllung der Klassenzimmer beeinträchtigt die Qualität der Bildung. Die Regierung hat den Bau von mehr als 170 neuen Schulen angekündigt und sich verpflichtet, 55.000 neue Lehrer bis Ende 2026 anzuheuern, von denen 37.000 bereits eingestellt worden sind. Dies hat neue Arbeitsplätze geschaffen, aber auch zu einem Mangel an Unterkünften in ländlichen Gebieten geführt.
African Business: Afrikas Outsourcing-Boom. Einem neuen Bericht zufolge wird sich der Sektor des Business Process Outsourcing (BPO) in Afrika bis 2030 mehr als verdoppeln und mehr als 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Südafrika, Kenia und Ägypten werden davon in hohem Maße profitieren. Aber auch aufstrebende Digitalhubs wie Ghana, Äthiopien und Ruanda können mit beträchtlichem Wachstum rechnen. Grund für den erwarteten BPO-Boom sind einerseits Kostenvorteile, aber auch das Engagement einiger afrikanischer Regierungen.
All Africa: Senegals neuer Präsident umreißt seine Prioritäten. Nach 100 Tagen im Amt hat der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye seine Prioritäten dargelegt. Er kündigte unter anderem die Neuverhandlung von Verträgen über natürliche Ressourcen an und betonte die Bedeutung von Steuereinnahmen und deren nachhaltiger Allokation. Faye erklärte, er wolle den Rahmen der militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich neu definieren, ohne dass es zu einem “brutalen Bruch” komme, trotz der Reduktion französischer Truppen in Dakar in den letzten Monaten. Der Präsident erklärte auch, er denke darüber nach, wie er die Rolle eines neutralen Vermittlers zwischen der Ecowas und der Allianz der Sahelstaaten (AES) spielen könne.
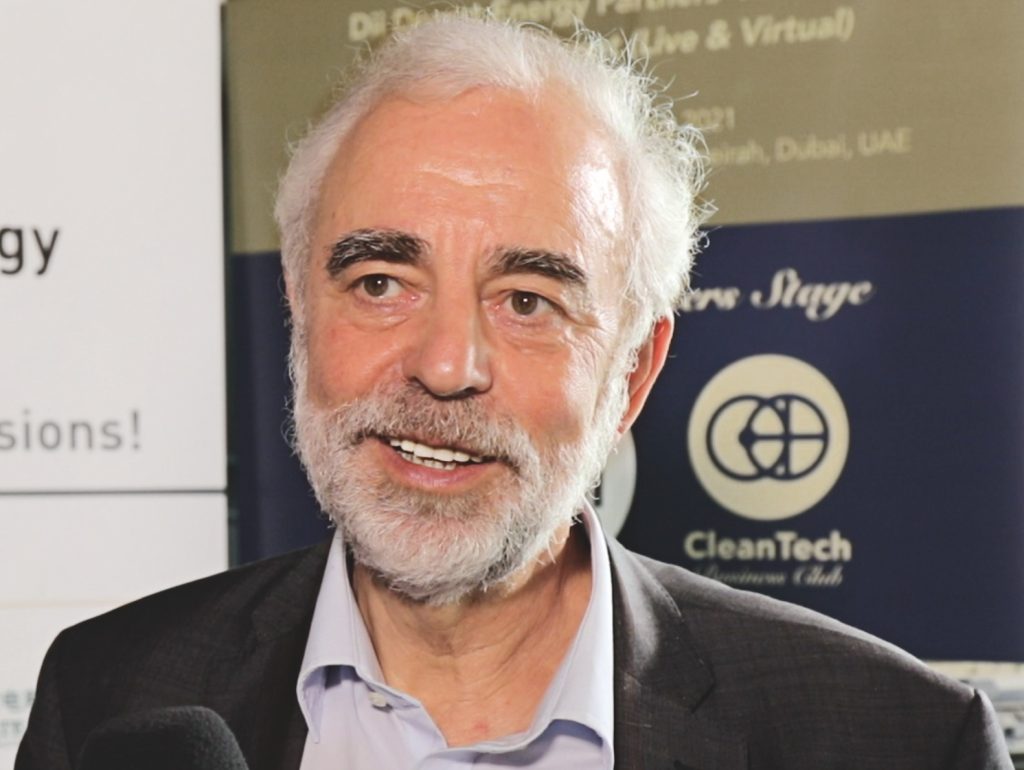
Es war eines der ambitioniertesten deutschen Industrieprojekte: Desertec sollte in großen Mengen Erneuerbare Energie in Nordafrika produzieren, die Stromnetze in Nordafrika miteinander verbinden und diese mit Europa. Desertec sollte bis zu 15 Prozent des Stroms in Europa produzieren. Dazu wären Investitionen gigantischen Ausmaßes von rund 400 Milliarden Euro notwendig gewesen. Doch das Projekt ist gescheitert.
Die gute Nachricht jedoch ist: Desertec lebt weiter. Und nicht nur das: Desertec ist heute größer als jemals zuvor. Paul van Son, der Niederländer, der die Desertec Industrial Initiative GmbH (DII) vorangetrieben hatte, ist dem Projekt treu geblieben. Allerdings hat sich Desertec grundlegend geändert. Unter neuem Namen ist Dii Desert Energy heute ein internationales Industrienetzwerk mit Sitz in Dubai.
Dort verfolgt van Son den Ursprungsgedanken von Desertec weiter, mit einem Unterschied: Dii ist heute mehr ein Thinktank, der Menschen, Länder und Märkte im Bereich saubere Energie miteinander verbinden will. Das Ziel ist immer noch: in den Wüsten emissionsfrei, verlässlich und kostengünstig Energie zu produzieren. Da sieht van Son Dii Desert Energy auf gutem Weg: “Die Länder der MENA-Region nutzen immer stärker ihr Potenzial für eine emissionsfreie Energieerzeugung”, sagt er.
Van Son hatte in Delft Engineering und Energiewirtschaft studiert und arbeitete dann für Siemens im Netzwerkbereich, anschließend für das Energieunternehmen Essent. Von 2009 an stand er der Desertec Industrial Initiative in München vor – bis diese fünf Jahre später auseinanderbrach, als viele Gesellschafter wie Siemens oder ABB ihr Engagement nicht verlängern wollten.
Doch RWE, das chinesische Unternehmen State Grid Corporation und Acwa Power aus Saudi-Arabien sind Dii Desert Energy auch nach Umbenennung und Umzug treu geblieben. Auch Thyssenkrupp ist bei dem Netzwerk in führender Rolle dabei. Zahlreiche Namen aus der deutschen Industrie sind dazugekommen oder haben sich der Initiative wieder angeschlossen: Eon, Bosch, Baywa, Siemens, Daimler Truck, Siemens Energy, Samson oder auch Roland Berger.
Vor allem ist Cornelius Matthes Paul van Son treu geblieben. Heute steht Matthes dem Netzwerk als CEO vor, van Son ist der Präsident. Matthes stand eine verheißungsvolle Karriere im Asset Management der Deutschen Bank in Aussicht. Doch die Chance, die Energiewende mitzugestalten, reizte ihn mehr als eine Karriere in der Bankenhierarchie. “Ohne grünen Wasserstoff aus den Wüstenländern würde die Energiewende hier nicht vorankommen”, meint denn auch Matthes.
Matthes ging den ganzen Weg mit allen Höhen und Tiefen an der Seite van Sons mit. So leitet er heute das Netzwerk in Dubai. Doch Paul van Son agiert in seiner Rolle als Präsident weiter – als Antreiber und als Visionär, der mit leiser Stimme, Freundlichkeit und Nachdruck immer wieder neue Ideen vorantreibt.
An diesem Wochenende, am 13. Juli, hat Dii Desert Energy sein fünfzehnjähriges Jubiläum gefeiert. “In unserer Gruppe wurden die ersten Diskussionen zum Projekt Neom Green Hydrogen geführt, das mit 8,4 Milliarden Dollar den Financial Close erreichte und nun gebaut wird”, sagte Matthes zu diesem Anlass. “Dabei wurden auch andere verrückte Ideen besprochen, von denen niemand gedacht hätte, dass sie jemals realisiert werden würden.”
Van Son und Matthes behaupten gar, dass Dii Desert Energy heute größer ist und größere Wirkung entfaltet hat, als es die Desertec Industrial Initiative jemals konnte. Matthes nennt nüchtern die Fakten: “Seit wir vor fünf Jahren die MENA Hydrogen Alliance ins Leben gerufen haben, hat die Industriegruppe und Denkfabrik Dii Desert Energy ein beeindruckendes Comeback erlebt: Von 20 Partnern im Jahr 2019 haben wir uns versechsfacht und sind nun auf mehr als 120 Partner aus 35 Ländern gewachsen.”
Allerdings legt Dii Desert Energy den Fokus neben Nordafrika stark auf den Nahen Osten. Und dennoch: Die alten Kooperationsländer von Desertec – Ägypten, Tunesien und Marokko – sind immer noch dabei. In wenigen Wochen wird van Son seinen 71. Geburtstag feiern. Doch in seiner Rolle als Präsident von Dii Desert Energy fühlt er sich offenbar weiterhin wohl. Es ist ein Leben für saubere Energie. Christian von Hiller

Die Basilika Notre-Dame-de-La-Paix in Yamoussoukro, der Verwaltungshauptstadt der Elfenbeinküste, ist von den Außenmaßen her das größte Gotteshaus der Welt. Dem Petersdom in Rom nachempfunden, wurde die römisch-katholische Kirche zwischen 1985 und 1988 errichtet und hat eine Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern. Papst Johannes Paul II. weihte die Basilika, die Platz für 18.000 Gläubige bietet, 1990 feierlich ein. Zu den regulären Messen kommen allerdings selten mehr als einige Hundert Menschen.
Außenministerin Annalena Baerbock ist diese Woche zu Gast in dem Land, das Alassane Ouattara seit 2010 regiert. Er wurde bereits 1990 von jenem Präsidenten zum Premierminister ernannt, der sich mit dieser Basilika ein Denkmal setzen wollte: Félix Houphouët-Boigny, der die Kirche in Yamoussoukro bauen ließ, seinem Geburtsort. Er war es auch, der den Umzug von der alten Hauptstadt Abidjan in die neue Hauptstadt betrieb. Eines der Glasmosaikfenster zeigt Houphouët-Boigny, wie er neben Jesus bei dessen triumphalen Einzug in Jerusalem niederkniet.
Der Marmor der Kirche kam aus Italien, die Glasmosaikfenster, insgesamt 8.500 Quadratmeter, aus Frankreich. So verwundert es nicht, dass die Baukosten rund 200 Millionen Euro betragen haben sollen. Manche gehen sogar vom Dreifachen aus. Kritiker sahen das Großprojekt angesichts der damaligen wirtschaftlichen und politischen Krise in Elfenbeinküste als reine Geldverschwendung an. Notre-Dame-de-La-Paix ist mit 158 Metern Höhe allerdings nur das zweithöchste Gotteshaus der Welt, auf Platz drei folgt der Kölner Dom. Spitzenreiter ist mit 161,53 Meter weiterhin das Ulmer Münster, das alle Gotteshäuser der Welt überragt. Auch dieses galt bei seiner Fertigstellung 1890 als Verschwendungsbau. as
auf ihrer zweitägigen Reise nach Westafrika hat sich Annalena Baerbock am Montag von der bisherigen deutschen Afrika-Politik distanziert. Ein Weiter so könne es nicht mehr geben, sagte die Außenministerin in Dakar mit Blick auf den Sahel. In dieser Ausgabe schauen wir darauf, wie es zu dieser Wende gekommen ist. Und noch etwas Bemerkenswertes ist geschehen: Häufig reist die Ministerin ohne die Begleitung deutscher Unternehmensvertreter. Das ist dieses Mal anders. Und dennoch sucht man die großen deutschen Konzerne vergeblich. Wir haben die Außenministerin auf dieser Reise begleitet.
Zudem erwarten Sie weitere spannende Analysen und News in dieser Ausgabe.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Zum Auftakt ihrer zweitägigen Westafrikareise zeigte sich Annalena Baerbock hinsichtlich der deutschen Politik in der Sahelzone selbstkritisch. “Wir können nicht weitermachen, als ob nichts geschehen wäre”, sagte die Außenministerin. Zugleich warnte sie vor einem kompletten Rückzug aus der Region. “Wir haben ein starkes Interesse an Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Westafrika. Weil die Sicherheit der Menschen uns wichtig ist. Aber auch, weil wir einen stabilen Nachbarkontinent wollen. Weil wir einander brauchen”, so Baerbock weiter.
Die Reise der Außenministerin nach Westafrika kommt rund eine Woche nach Bekanntwerden, dass die Bundeswehr nun doch aus Niger abziehen will. Jetzt lotet die Bundesregierung ihre Optionen in Westafrika neu aus. Ein Stabilitätsanker in der Region soll der Senegal bleiben – obwohl diese Vokabel – “Stabilitätsanker” – in Berlin inzwischen an Strahlkraft verloren hat und nur noch sehr vorsichtig gebraucht wird. Denn dass auch eine weitgehend gefestigte Demokratie wie der Senegal nicht vor Erschütterungen gefeit ist, zeigte sich jüngst: Die Verschiebung der Wahl auf den März 2024 hatte für reichlich Chaos gesorgt.
Dennoch habe sich die Demokratie im Senegal als wehrhaft erwiesen, lobte Baerbock. Für die Bundesregierung ist der Senegal am westlichen Rand der Sahelzone unverzichtbar. Doch weiterhin schwelt es: Eine für Montag angesetzte Regierungserklärung von Premierminister Ousmane Sonko wurde am Wochenende abgesagt. Hintergrund ist ein innenpolitischer Streit darüber, ob Sonko im Parlament sprechen soll.
Die Rolle Frankreichs, das vielfach als Ex-Kolonialmacht mit großem Machtanspruch in der Region kritisiert wird, ist der Bundesregierung durchaus bewusst. Offen thematisiert wird hingegen nicht, dass das geradezu aggressive Beharren von Präsident Macron auf einer Präsenz in Westafrika auch auf EU-Ebene für viel Reibung gesorgt hat. Deutschland liegt viel an einem geeinten Auftreten der EU. Gleichwohl zeigen sich bei Baerbocks Reise zaghafte Bemühungen, sich in der Realpolitik vom Hexagon abzusetzen. Denn das Scheitern Frankreichs im Sahel und der starke Imageverlust bieten Deutschland die Chance, sich als moderner europäischer Partner in Stellung zu bringen: mit einem Fokus auf Klimawandel, Dialog und Wirtschaft.
Nun soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Senegal nach Wunsch der Außenministerin gestärkt werden. Dafür hat die Außenministerin eine zehnköpfige Wirtschaftsdelegation mitgenommen. Die Unternehmen kommen vor allem aus den Bereichen Gesundheitstechnik und Erneuerbare Energie.
Alternative Energiequellen spielen in Senegal längst eine große Rolle. Im Mai dieses Jahres hat Dakar sein erstes Schnellbussystem, genannt Bus Rapid Transport (BRT), in Betrieb genommen. Die Busse werden allesamt elektrisch angetrieben. Für deutsche Unternehmen seien laut AA vor allem Folgeaufträge interessant, die im Rahmen des Netzausbaus mit Zubringerbussen möglich würden.
Der Blick auf die Liste der mitgereisten Unternehmen verrät allerdings, dass es offenbar weiterhin schwierig ist, große deutsche Konzerne für Delegationsreisen nach Afrika zu begeistern. Noch fehle die Afrika-Erfahrung in den Unternehmen. Zudem sei die Sprachbarriere ein Problem, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.
Auch die Umsetzung des BRT wurde international ausgeschrieben. Europäische Angebote blieben jedoch aus. Schließlich erhielt ein chinesisches Unternehmen den Zuschlag. Gleichzeitig sei aber das Interesse auf senegalesischer Seite groß, Kooperationen auszubauen. Deutschland profitiere von seinem guten Ruf.
Das Interesse an Deutschland und das neue deutsche Selbstbewusstsein zeigt sich indes auch am Goethe-Institut in der Stadt. Erst dadurch wurde ein Neubau, der 2025 bezogen werden soll, angestoßen. Diesen besuchte Baerbock am Montagabend. Das Goethe-Institut betreibt insgesamt sechs Einrichtungen in Westafrika. Mit dem geplanten Neubau will das Institut im Senegal sein Angebot ausbauen. Dabei fokussiert sich das Institut auf vier Schwerpunkte:
Das Goethe-Institut ist zudem für Kulturprojekte in Mauretanien, Gambia und Guinea-Bissau zuständig.
Am Dienstag, 16. Juli, wird die Außenministerin in die Elfenbeinküste weiterreisen. Dabei wird vor allem der Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelregion im Fokus stehen.
Die African Petroleum Production Organization (APPO) will eine aktivere Rolle in der Energiewirtschaft auf dem Kontinent spielen. Dazu hat sie die Africa Energy Bank (AEB) mit einem Startkapital von fünf Milliarden Dollar ausgestattet, um Energieprojekte in ganz Afrika zu finanzieren. Das Kapital zeichnen die APPO-Mitgliedsstaaten, nationale Öl- und Gasunternehmen und weitere, ungenannte Investoren.
Auf der 45. außerordentlichen Sitzung des APPO-Ministerrats in Abuja wurde zudem angekündigt, dass die Bank ihren Sitz in Lagos haben soll. Die APPO gründete die AEB mit Unterstützung der Afreximbank, um die Finanzierungsschwierigkeiten zu lösen, mit denen die afrikanische Öl- und Gasindustrie infolge der Energiewende zunehmend konfrontiert ist.
Viele europäische und amerikanische Geschäftsbanken finanzieren unter dem Druck der öffentlichen Meinung in ihren Heimatmärkten keine Projekte mehr in der fossilen Energiewirtschaft. Auch multilaterale und nationale Förderbanken aus dem Globalen Norden verfolgen eine ähnliche Kreditpolitik.
Dadurch ist es für Unternehmen aus dem afrikanischen Erdöl- und Erdgassektor schwieriger geworden, neue Projekte zu finanzieren, selbst wenn diese positiv zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen.
Die AEB soll anderen spezialisierten Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ähneln. Obwohl die Bank angibt, sich auf die Öl- und Gasindustrie zu konzentrieren, ist sie auch offen für Investitionen in anderen Energieformen, einschließlich erneuerbarer Energien.
Die Gründung der AEB in Nigeria sei ein Zeichen für eine potenziell transformative Entwicklung des afrikanischen Energiesektors, sagte Katlong Alex, Energieanalyst beim African Energy Council, zu Table.Briefings. Angesichts der zunehmenden Desinvestitionen in Öl und Gas aufgrund der Energiewende und der ESG-Vorgaben könne das Startkapital der AEB von fünf Milliarden Dollar dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die Energieprojekte in ganz Afrika behindert, zu schließen.
“Dieser Finanzschub könnte die Entwicklung kritischer Infrastruktur vorantreiben und zu einem besseren Zugang zu Elektrizität und erhöhter Energiesicherheit führen” sagte Alex weiter. “Während die Bank die Bedeutung von Öl und Gas anerkennt, ermöglicht ihre Offenheit für erneuerbare Energielösungen den afrikanischen Nationen zudem, einen ausgewogeneren Ansatz zu verfolgen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um sich an die globale Energiewende anzupassen und den Energiemix zu diversifizieren.”
Dass Nigeria den Hauptsitz der AEB beherbergt, könne die Position des Landes als regionaler Energieführer stärken und ihm möglicherweise mehr Einfluss bei der Gestaltung der Energiepolitik und der Anziehung von Investitionen geben werde, so Alex.
“Darüber hinaus könnte die AEB den Wissens- und Technologietransfer im Energiesektor erleichtern, insbesondere im Hinblick auf erneuerbare Energien, und so die Einführung sauberer Energielösungen in Afrika beschleunigen”, meint der Energieexperte.
Jide Pratt, Country Manager bei Trade Grid, sagte gegenüber Table.Briefings, dass die Africa Energy Bank in Nigeria die Energiesicherheit erhöhen werde. Afrika als Kontinent stehe mit der Gründung der Bank vor einem großen Sprung. “Die Bank verringert das Kreditrisiko auf dem Kontinent und trägt dazu bei, das Stigma oder den Rückzug Europas hinsichtlich der Finanzierung fossiler Brennstoffe in Afrika zu beseitigen”, fügte Pratt hinzu.
Allerdings müssen laut Alex mehrere Herausforderungen bewältigt werden, damit die AEB Erfolg hat. Obwohl fünf Milliarden Dollar ein beträchtlicher Betrag sei, reiche das Eigenkapital seiner Meinung nach möglicherweise nicht aus, um Afrikas enormen Energiebedarf langfristig zu decken.
“Daher hängt der Erfolg der AEB von der Gewinnung weiteren Kapitals und einem effizienten Management ab”, meint Alex. “Darüber hinaus muss der Rahmen der Bank zur Finanzierung risikoreicher Projekte sorgfältig geprüft werden. Die Abwägung des Risikos mit einer wirkungsvollen Projektauswahl wird die Effektivität der AEB sicherstellen.”
Eine starke Führung und transparente Abläufe seien laut Alex ebenfalls von entscheidender Bedeutung, damit die AEB Vertrauen gewinne und Investitionen anziehe. Klare Richtlinien und Kontrollmechanismen seien unerlässlich, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitteln sicherzustellen.
“Insgesamt stellt die Gründung der AEB eine vielversprechende Chance für Afrika dar”, schloss Alex. “Aber ihr Erfolg hängt davon ab, diese Herausforderungen zu überwinden und ihre Ressourcen effizient zu nutzen.”
Noch knapp ein halbes Jahr haben Händler und Produzenten von Erzeugnissen wie Kaffee, Kakao, Soja und Holz Zeit, sich vorzubereiten. Um diese Produkte auf dem EU-Markt zu verkaufen, müssen sie ab 2025 sicherstellen, dass diese nicht von nach 2020 entwaldeten Flächen stammen.
Der enge Zeitplan für die Umsetzung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) fordert viele Betroffene heraus. Zwar ist das Gesetz bereits vor einem Jahr in Kraft getreten. Doch Unternehmen und Verwaltung müssen Teams aufbauen, Prozesse entwickeln, digitale Tools für die Anwendung und Lösungen für die aufwendige Dokumentation finden – und die EU-Kommission hat entscheidende Informationen zur Umsetzung, wie das Länder-Benchmarking und bestimmte Leitlinien, teilweise noch gar nicht veröffentlicht.
Mit der Verordnung will die EU gegen die weltweite Entwaldung vorgehen, deren Hauptursache die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen ist. Hauptimportgut in diesem Zusammenhang ist Soja, das beispielsweise auf abgeholzten Regenwaldflächen in Südamerika angebaut wird und in Europa überwiegend als Tierfutter zum Einsatz kommt. Aber auch der Konsum von Palmöl, Kaffee und Schokolade tragen zur Entwaldung bei. Wälder spielen jedoch eine wichtige Rolle für die biologische Vielfalt und die Eindämmung des Klimawandels.
Viele Unternehmen sind gleich mehrfach von dem Gesetz betroffen – wenn sie mehrere dieser Erzeugnisse auf den Markt bringen. So zum Beispiel Tchibo und Melitta, die sowohl Kaffee als auch Kaffeefilter verkaufen. Letztere werden meist aus holzbasiertem Zellstoff hergestellt. Tchibo verkauft zudem auch Möbel.
Zukünftig müssen die Produzenten den Einkäufern in der EU über eine digitale Schnittstelle genaue GPS-Daten ihrer Anbaufläche mitliefern sowie eine Sorgfaltserklärung. Diese muss auch belegen, dass lokale Gesetze eingehalten wurden. Fehlen diese Daten, darf der Zoll die Lieferung nicht auf den EU-Markt lassen.
In kleinteiligen Lieferketten wie von Kaffee kann dies sehr schwierig werden, erklärt Pablo von Waldenfels, Direktor Unternehmensverantwortung bei Tchibo. Hinter dem Einkaufsvolumen von Tchibo stehe die Produktionsmenge von 75.000 Kaffeefarmern, in der Regel Kleinfarmer. Größere Farmen wie in Brasilien würden industriell betrieben und hätten bereits Erfahrung darin, bestimmte Auflagen einzuhalten und dies zu dokumentieren. “70 bis 80 Prozent der Farmen sind allerdings sehr klein, vielleicht so groß wie ein Fußballfeld, wie ein halbes, oder auch nur so groß wie ein Garten”, erklärt von Waldenfels. “Wenn die es nicht schaffen, die notwendigen Unterlagen heranzuschaffen, sind sie langfristig vom Kaffeeeinkauf aus Europa ausgeschlossen – nicht, weil sie Bäume fällen, sondern einfach nur, weil sie die Daten nicht bereitstellen können.”
Die Vorgaben führen zudem auf mehrfache Kontrollen innerhalb desselben Unternehmens hinaus, kritisiert Stefan Dierks, Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie bei der Melitta Gruppe. Die Daten der Farmer werden bereits vor Ankunft der Lieferung überprüft, jede Lieferung erhält eine EU-Referenznummer im digitalen System “Traces”. Werden später unterschiedliche Kaffeesorten gemischt, wiederholt sich dieser Prozess: Auch die Mischung braucht eine eigene Referenznummer. Wird diese dann zum Beispiel bei der Tochtergesellschaft Melitta Professional verkauft, muss dieser Unternehmensbereich nochmals alle Daten überprüfen. “Das ist reine Bürokratie und weder zielführend noch sinnvoll“, sagt Dierks.
Dierks koordiniert bei Melitta ein unternehmensweites Projektteam zur Anwendung der EUDR. Dieses tauscht sich unter anderem eng mit dem Deutschen Kaffeeverband aus. In dessen Auftrag wurde ein digitales Tool für den Kaffeesektor entwickelt, mit dem sich die Daten erfassen und im Hinblick auf das Entwaldungsrisiko überprüfen lassen. Hier soll auch eine Schnittstelle zum EU-System “Traces” geschaffen werden, das die Referenznummern erstellt. “Es braucht hier automatisierte Tools, mit reinem Personalaufwand ist das nicht machbar”, stellt Dierks fest.
Die Forderungen nach einem Aufschieben der Umsetzungsfrist kann er gut nachvollziehen. “Die Zeit zur Vorbereitung ist an vielen Stellen der Lieferketten zu kurz, insbesondere in manchen Kaffeeanbauregionen”, erklärt Dierks. “Da würde es tatsächlich helfen, die Anwendung um ein halbes Jahr zu verschieben.”
In jedem Mitgliedstaat überprüft eine nationale Behörde die Anwendung der neuen Regeln. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Dort leitet Annerose Lichtenstein seit Anfang Juni die Gruppe “Entwaldungsfreie Produkte, Holzhandel”. Das derzeit noch sechsköpfige Team soll in diesem Jahr auf insgesamt 36 Stellen erweitert werden, die Ausschreibungen und Einstellungen laufen zurzeit. Das sei jedoch noch lange nicht genug. “Es gibt unterschiedliche Schätzungen wie viele Kontrollen wir durchführen müssen – in jedem Fall wird es eine sehr hohe Anzahl sein”, erklärt sie. “Auch wenn wir diese Kontrollen mit einem hohen Automatisierungsgrad machen, ist das sehr viel Arbeit und bedarf Personal.”
Laut einer Zollauswertung gebe es geschätzt insgesamt 150.000 deutsche Verarbeiter und Händler, die von dem Gesetz betroffen sind, erzählt Lichtenstein. Für die inländischen Primärerzeuger werden voraussichtlich die Bundesländer zuständig sein.
Daraus ergeben sich laut Schätzungen zukünftig etwa 20 Millionen Meldungen über einzelne Erzeugnisse pro Jahr in “Traces”. Aus ihnen muss das Team in der BLE einzelne Marktteilnehmer auswählen. Die Behörde entwickelt zurzeit ein automatisiertes Verfahren, mit dem je nach Entwaldungsrisiko bestimmte Punkte vergeben werden. Je höher die Punktzahl, desto wahrscheinlicher eine Kontrolle. Dabei fallen bestimmte Risikofaktoren ins Gewicht: “Dort, wo die Erzeuger zumindest in der Nähe von Entwaldungsgebieten sind, und dort, wo es überhaupt große Waldgebiete gibt, ist das Risiko natürlich höher”, erklärt sie. Ihr Team überprüft dann in einem dreistufigen Verfahren die Sorgfaltserklärung sowie die Risikobewertung der Marktteilnehmer und deren Maßnahmen, um das Entwaldungsrisiko zu minimieren.
Was außerdem noch fehlt, ist ein deutsches Gesetz, das die nationale Anwendung regeln soll. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) arbeitet zurzeit daran. Laut Informationen von Table.Briefings soll es darin um die Zuständigkeiten von Bund und Ländern, die Befugnisse der Kontrollbehörden und um Straf- und Bußgeldvorschriften gehen. Außerdem wird darin das Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSiG) aufgehoben. Dieses setzt bislang die EU-Holzhandelsverordnung um, die mit der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte ebenfalls aufgehoben wird.
Das deutsche Gesetz soll laut BMEL bis zum 30. Dezember in Kraft treten – dem Tag, ab dem die EU-Verordnung angewendet werden muss.
Südafrikas neue Regierung will sich gegen eine geplante Überprüfung der bilateralen Beziehungen zwischen Südafrika und den USA durch den US-Senat wehren. Die Überprüfung könnte Südafrikas Zugang zum African Growth and Opportunity Act (AGOA) gefährden, der afrikanischen Ländern einen zollfreien Zugang zum US-Markt ermöglicht.
Eine südafrikanische Delegation wird vom 24. bis 26. Juli am AGOA-Forum in Washington DC teilnehmen, auch um Lobbyarbeit bei den US-Gesetzgebern zu leisten, wie Parks Tau, Minister für Handel, Industrie und Wettbewerb, ankündigte. “Wir beabsichtigen, mit Senatoren und Kongressmitgliedern darüber zu sprechen, welche Position wir als südafrikanische Regierung in einer ganzen Reihe von Fragen auf der Grundlage des AGOA-Gesetzes, aber auch unter Berücksichtigung der bilateralen Beziehungen einnehmen”, sagte er.
US-Abgeordnete hatten die Überprüfung der Beziehungen im Februar gefordert, nachdem Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs des Völkermords verklagt hatte. Sie verwiesen auch auf Südafrikas Bestreben, engere Beziehungen zu China und Russland zu knüpfen.
Die USA sind nach China der zweitgrößte Handelspartner Südafrikas. Der Handel zwischen den beiden Ländern belief sich im vergangenen Jahr auf 23,7 Milliarden Dollar. Südafrika lieferte im Rahmen des Abkommens hauptsächlich Autos und landwirtschaftliche Erzeugnisse. ajs
Royal Air Maroc ist afrikanischer Spitzenreiter bei den “World’s Best Regional Airlines 2024”, so kürzlich die britische Unternehmensberatung Skytrax. Die Airline schaffte es in dieser Kategorie unter die Top 10 weltweit (Platz 7). Lift und Airlink aus Südafrika zählen in diesem Jahr zu den besten Billig-Airlines in der Welt und sind die beiden besten in Afrika. Jonathan Ayache, CEO der Lift Company, sagte, das Unternehmen sei “absolut begeistert, unseren allerersten Skytrax Award zu erhalten.” Lift gibt es erst seit vier Jahren. Auch bei den “World’s Most Improved Airlines 2024” schnitten Lift und Airlink mit den Plätzen sieben und zehn sehr gut ab.
Skytrax bewertet jedes Jahr Fluggesellschaften und Flughäfen. 2024 wurden hierzu mehr als 21 Millionen Reisende aus über 100 Ländern nach ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Unter den “World Top 100 Airlines 2024” ist Ethiopian Airlines mit dem 36. Platz die beste Airline in Afrika – schon zum siebten Mal in Folge. Zudem bietet sie seit sechs Jahren die beste Business Class und Economy Class auf dem Kontinent an.
“Wir bleiben an der Spitze der Luftfahrtbranche, indem wir kontinuierlich Spitzentechnologien einsetzen, um das Erlebnis unserer Passagiere zu verbessern”, sagte MesfinTasew, CEO der Ethiopian Airlines Group. Royal Air Maroc ist zweitbeste Airline in Afrika (Platz 55 weltweit) und South African Airways erreichte den dritten Platz (69). Dieses Ranking wird weltweit seit Jahren von den Nahost-Airlines Qatar Airways und Emirates dominiert, die zusammen rund 60 Flughäfen auf dem afrikanischen Kontinent anfliegen.
South African wurde auch als “Cleanest Airline in Africa” gewählt und kam an zweiter Stelle in der Kategorie “Best Airline Staff in Africa“, gleich hinter Kenya Airways. Die besten Flughäfen in Afrika sind die drei südafrikanischen Hubs Kapstadt (Platz 54 weltweit), Durban (72) und Johannesburg (83). as
Die Militärjunta von Burkina Faso hat ein Verbot homosexueller Handlungen angekündigt. “Von nun an werden Homosexualität und damit verbundene Praktiken gesetzlich geahndet”, sagte Justizminister Edasso Rodrigue Bayala vergangene Woche der Nachrichtenagentur AFP. Er gab weder das Ausmaß des Verbots bekannt – ob es sich gegen die LGBTQ-Identität im Allgemeinen oder speziell gegen Personen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen richtet – noch die Strafen, die ein Verstoß nach sich ziehen könnte.
Obwohl LGBTQ-Identität in dem Sahelland nicht allgemein akzeptiert wird, war sie bisher nicht verboten: Burkina Faso zählte zu den 22 afrikanischen Staaten, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht kriminalisiert worden sind. Anders als viele ehemalige britische Kolonien hat das Land nach der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 keine Anti-Homosexualitätsgesetze geerbt.
Die burkinische Junta putschte sich 2022 an die Macht und orientiert das Land seither stärker an Russland. Die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht und zum Westen allgemein hat sie hingegen drastisch reduziert. In Russland sind homosexuelle Handlungen zwar seit 1993 entkriminalisiert. Präsident Wladimir Putin geht aber dennoch hart gegen die LGBTQ-Gemeinschaft vor und diffamiert die Gleichberechtigung Homosexueller als westliches Einflussstreben. Diese Behauptung findet auch in einigen afrikanischen Staaten Anklang.
Laut ILGA World Database werden derzeit in 61 Ländern einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen kriminalisiert, davon 32 in Afrika. Die Strafen reichen von Geld- und Freiheitsstrafen bis hin zur Todesstrafe. Während einige Länder gleichgeschlechtliche Beziehungen in den vergangenen Jahren entkriminalisiert haben, haben andere stattdessen Verbote erlassen. So hat etwa Uganda im Mai vergangenen Jahres eines der weltweit schärfsten Gesetze gegen LGBTQ-Personen verabschiedet. Als Reaktion darauf hat die Weltbank die Vergabe neuer Kredite an Uganda ausgesetzt. In Ghana wird trotz der Warnungen anderer Länder und internationaler Finanzinstitutionen ein drakonisches Gesetz zur Kriminalisierung von LGBTQ-Identität in Betracht gezogen. Die Tochter des kamerunischen Präsidenten, Brenda Biya, hat sich hingegen vor kurzem als lesbisch geoutet – trotz des Anti-LGBTQ-Gesetzes des Landes und der Gegenreaktionen ihrer Familie. ajs
Außenministerin Annalena Baerbock ist am gestrigen Montag zu einer zweitägigen Reise in den Senegal und in die Elfenbeinküste aufgebrochen. Neben dem Umgang mit den von Putschisten geführten Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso geht es auf Baerbocks Reise auch um das Knüpfen neuer wirtschaftlicher Beziehungen. Die Außenministerin wird deshalb auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Mit dabei sind:
ajs

Jeden Tag wächst die Weltbevölkerung um circa 200.000 Menschen, einmal im Jahr um fast die Einwohnerzahl Deutschlands. Das zeigen die aktuell veröffentlichten Berechnungen der Vereinten Nationen. Zwar bekommen weltweit Frauen durchschnittlich ein Kind weniger als 1990. Dennoch erreicht die Weltbevölkerung ihren Höhepunkt mit knapp mehr als zehn Milliarden Menschen voraussichtlich in den 2080er-Jahren.
Zwei Drittel dieses Bevölkerungswachstums findet in Entwicklungs- und Schwellenländern statt, in denen heute schon 80 Prozent der Weltbevölkerung leben. Besonders schnell wächst die Bevölkerung auf unserem Nachbarkontinent Afrika, die sich bis 2050 auf 2,4 Milliarden Menschen nahezu verdoppeln wird. Hier lebt mittlerweile die größte Jugendgeneration aller Zeiten!
All diese jungen Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde, mit ausreichend Essen, Schuldbildung, einer grundlegenden Gesundheitsversorgung. Das heißt auch: Für diese junge Generation werden Millionen neue Jobs benötigt. Das Bevölkerungswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern erfordern bis 2050 eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion um 50 Prozent und des Energiebedarfs um circa 70 Prozent. Das sind keine Randthemen, sondern globale Herausforderungen, die uns alle betreffen, und die zugleich große Chancen bieten.
In der aktuellen Debatte über die Entwicklungspolitik wird oft vergessen: Wir können dazu beitragen, dass diese Menschen eine gute Zukunft haben. Dass sie neue Unternehmen in ihrer Heimat gründen und mit uns Handel treiben. Es liegt an uns, wie wir auf diese Menschen zugehen. Ob wir sie ignorieren, oder aber ob wir gezielt in ihre Ausbildung und die wirtschaftliche Entwicklung in ihren Heimatländern investieren. Denn wir haben heute weltweit die Technologien und das Wissen, eine Welt ohne Hunger zu schaffen, erneuerbare Energien auszubauen und durch nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zur Lösung der globalen Herausforderungen beizutragen.
Denn in der Bevölkerungsentwicklung steckt die Chance einer demografischen Dividende: Über 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Ein unglaubliches Potential an Kreativität und Innovationskraft für die lokale Wirtschaft – und ein rapide wachsender Zukunftsmarkt auch für europäische Unternehmen.
Zu den Gestaltungsmöglichkeiten gehören auch die Stärkung von Frauen und Mädchen und eine nachhaltige Bevölkerungspolitik. Bleiben wir beim Beispiel Subsahara-Afrika, wo die Geburtenrate mit 4,6 Kindern pro Frau weiterhin hoch ist. Teenagerschwangerschaften sind ein besonderes Problem: Eines von zehn Mädchen bekommt sein erstes Kind im Alter zwischen 15 und 19 Jahren und in der Folge dann oft mehr Kinder, als es ernähren und großziehen kann. Für die meisten dieser jungen Frauen bedeutet dies das frühzeitige Ende der Schullaufbahn und damit auch einer zukunftssichernden Ausbildung, in der Konsequenz oft lebenslange Abhängigkeit und Armut.
Dass Frauen entscheiden, wann und wie viele Kinder sie bekommen möchten, ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Fast jede zehnte Frau hat keine Wahl, ob sie verhüten will oder nicht. Rund 40 Prozent aller Schwangerschaften in Entwicklungsländern sind ungeplant. Dabei würde eine nachhaltige Bevölkerungspolitik, die Frauen gezielt stärkt, ein enormes wirtschaftliches und gesellschaftliches Potential entfesseln.
Dass Maßnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungspolitik und die Stärkung von Frauen und Mädchen wirken, zeigt ebenfalls der aktuelle Bericht der Vereinten Nationen: In den vergangenen 30 Jahren ist die Müttersterblichkeit um ein Drittel zurückgegangen, die Zahl der Frauen, die verhüten, hat sich verdoppelt. Und 162 Länder haben Gesetze gegen häusliche Gewalt verabschiedet.
In die Stärkung von Frauen und Mädchen und in die gesamte Jugendgeneration in Afrika zu investieren, ist daher zukunftsgerichtete, sinnvolle Politik. Hier liegt der Schlüssel für die große Chance auf eine demografische Dividende und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung. Denn wir leben in einem globalen Dorf, wo alles mit allem verbunden ist: Handel, Klimaschutz, Vorsorge vor Pandemien.
Wir brauchen den entschlossenen Willen, mit unseren Partnerländern in Afrika gemeinsam in Bevölkerungspolitik, in Gesundheit und Bildung, in Ernährungssicherheit, in nachhaltige Energie sowie in gute Arbeitsplätze zu investieren. So schaffen wir gemeinsam Perspektiven für die größte Jugendgeneration aller Zeiten in ihrer Heimat und fördern zugleich einen nachhaltigen Entwicklungspfad in den Märkten der Zukunft. Das kommt nicht zuletzt auch unserer eigenen Wirtschaft zugute.
Gerd Müller leitet die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (Unido).Von 2013 bis 2021 war er Bundesentwicklungsminister (CSU). Jan Kreutzberg ist Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW).
Al Jazeera: Ruanda-Wahl im Schatten wachsender Spannungen mit DR Kongo. Während die Ruander an die Urnen gehen, um ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten zu wählen, bleiben die angespannten Beziehungen zum Nachbarland, der Demokratischen Republik Kongo, eine wachsende Herausforderung für beide Länder und die gesamte Region. Im Osten der DR Kongo verfolgen die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen eine tödliche Offensive gegen das kongolesische Militär, die zu einer massiven humanitären Krise geführt hat. Die eskalierenden Spannungen drohen, sich zu einem größeren regionalen Konflikt auszuweiten.
Reuters: Planmäßiger UN-Abzug aus DR Kongo unwahrscheinlich. Die kongolesische Außenministerin Therese Kayikwamba Wagner teilte am Samstag mit, es sei unwahrscheinlich, dass die UN-Friedenstruppen den vereinbarten Rückzug aus der konfliktgeplagten Provinz Nord-Kivu fortsetzen, solange ruandische Truppen in dem Gebiet sind. Einem neuen UN-Bericht zufolge kämpfen in Nord-Kivu 3.000 bis 4.000 ruandische Truppen gegen die kongolesische Armee und kontrollieren de facto auch die Operationen der M23-Rebellen. Die Kämpfe in der Provinz haben mehr als 1,7 Millionen Menschen zur Flucht veranlasst, womit sich die Gesamtzahl der binnenvertriebenen Kongolesen nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf die Rekordzahl von 7,2 Millionen erhöht.
The East African: USA besorgt über Konfliktmineralien im Ostkongo. Washington ist besorgt über die Gewinnung, den Transport und die Ausfuhr von Konfliktmineralien im Osten der DR Kongo. Sie habe zu einer Vielzahl von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit, schlimmsten Formen von Kinderarbeit sowie sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere in den handwerklichen Bergbaugebieten, geführt. “Die USA sind weiterhin besorgt über die Rolle, die der illegale Handel und die Ausbeutung bestimmter Mineralien, einschließlich Gold und Tantal, … bei der Finanzierung des Konflikts spielen,” heißt es in einer Erklärung der US-Regierung. In vielen Fällen werden diese Mineralien über Ruanda und Uganda geschmuggelt, bevor sie in die Verarbeitungsländer transportiert werden.
Bloomberg: Kenia stellt sich auf weitere Proteste ein. Kenianische Aktivisten haben für Dienstag zu weiteren Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen. Der Vorwurf: Sie habe es versäumt, die Sicherheitskräfte strafrechtlich zu verfolgen, die im Verdacht stehen, im vergangenen Monat mindestens 41 Menschen getötet zu haben, die gegen die geplante Steuererhöhung protestiert hatten. Präsident William Ruto hatte letzte Woche angekündigt, dass am Montag ein so genannter nationaler Dialog beginnen würde, um die Spannungen im Land zu entschärfen. Kenias größte Oppositionspartei ODM hat jedoch erklärt, es sei unklar, ob und wann die Gespräche, die politische Parteien, Gruppen der Zivilgesellschaft und Berufsverbände zusammenbringen sollen, stattfinden werden. Die Partei habe bislang keine Einladung erhalten, sagte der ODM-Generalsekretär.
Washington Post: Gambia bestätigt Verbot weiblicher Genitalverstümmelung. In einem wichtigen Sieg für die Verfechter von Frauenrechten in dem westafrikanischen Land haben Mitglieder der gambischen Nationalversammlung am gestrigen Montag einen Gesetzentwurf abgelehnt, mit dem das Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) aufgehoben worden wäre. Gambia hat FGM im Jahr 2015 unter Strafe gestellt. Religiöse Hardliner hatten in diesem Jahr versucht, das Verbot aufzuheben. Weltweit wird die Zahl der FGM-Opfer auf mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen geschätzt.
Financial Times: Eskom warnt vor erneuter Stromkrise. Das Versäumnis südafrikanischer Kommunen, Schulden in Milliardenhöhe bei dem staatlichen Stromversorger zu begleichen, bedrohe dessen Sanierungsbemühungen, warnt Eskom-Chef Dan Marokane. “Das ist ein großes Risiko für unser Geschäft. In vielen Fällen können sie es sich leisten, haben aber die Zahlung an Eskom nicht zur Priorität gemacht”, sagte er. Die härtere Gangart der neuen Regierung werde aber helfen, die Kultur der Nichtzahlung seitens der Kommunen zu ändern. Eskom hat erst kürzlich den Meilenstein von 100 Tagen ohne Stromausfälle überschritten.
BBC: Kostenlose Bildung in Sambia führt zu überfüllten Schulen. Sambia hat seit der Einführung der kostenlosen Bildung im Jahr 2021 mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Bildungssektor investiert. Seitdem konnten zwei Millionen zusätzliche Kinder zur Schule gehen. Doch die Überfüllung der Klassenzimmer beeinträchtigt die Qualität der Bildung. Die Regierung hat den Bau von mehr als 170 neuen Schulen angekündigt und sich verpflichtet, 55.000 neue Lehrer bis Ende 2026 anzuheuern, von denen 37.000 bereits eingestellt worden sind. Dies hat neue Arbeitsplätze geschaffen, aber auch zu einem Mangel an Unterkünften in ländlichen Gebieten geführt.
African Business: Afrikas Outsourcing-Boom. Einem neuen Bericht zufolge wird sich der Sektor des Business Process Outsourcing (BPO) in Afrika bis 2030 mehr als verdoppeln und mehr als 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Südafrika, Kenia und Ägypten werden davon in hohem Maße profitieren. Aber auch aufstrebende Digitalhubs wie Ghana, Äthiopien und Ruanda können mit beträchtlichem Wachstum rechnen. Grund für den erwarteten BPO-Boom sind einerseits Kostenvorteile, aber auch das Engagement einiger afrikanischer Regierungen.
All Africa: Senegals neuer Präsident umreißt seine Prioritäten. Nach 100 Tagen im Amt hat der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye seine Prioritäten dargelegt. Er kündigte unter anderem die Neuverhandlung von Verträgen über natürliche Ressourcen an und betonte die Bedeutung von Steuereinnahmen und deren nachhaltiger Allokation. Faye erklärte, er wolle den Rahmen der militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich neu definieren, ohne dass es zu einem “brutalen Bruch” komme, trotz der Reduktion französischer Truppen in Dakar in den letzten Monaten. Der Präsident erklärte auch, er denke darüber nach, wie er die Rolle eines neutralen Vermittlers zwischen der Ecowas und der Allianz der Sahelstaaten (AES) spielen könne.
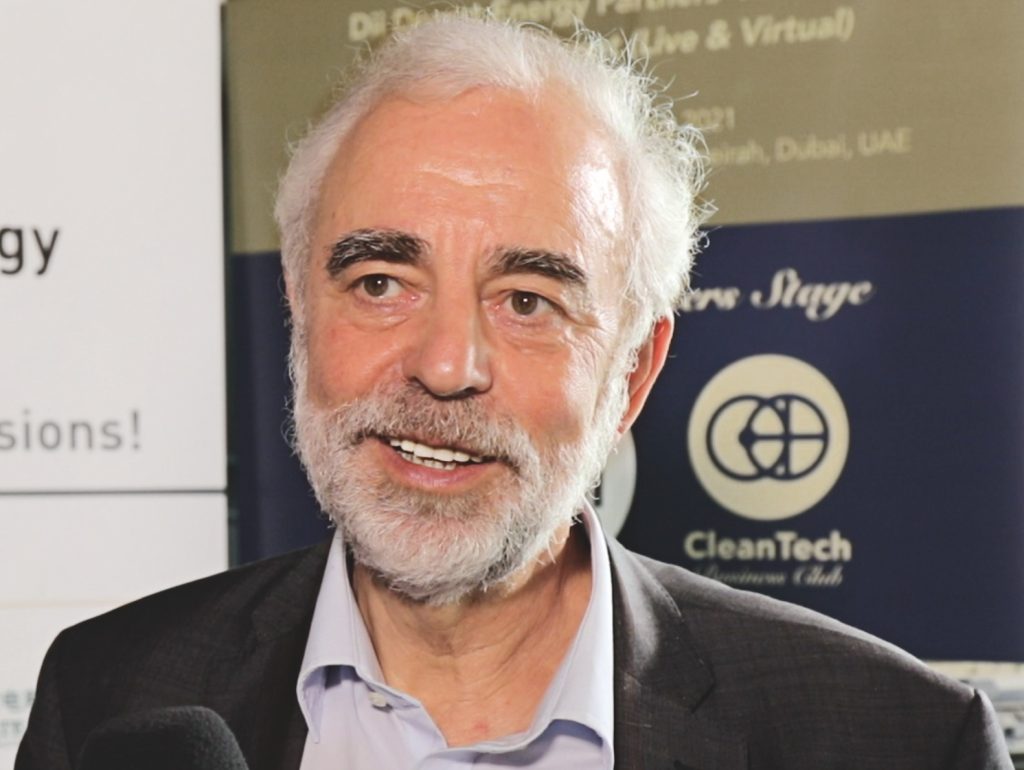
Es war eines der ambitioniertesten deutschen Industrieprojekte: Desertec sollte in großen Mengen Erneuerbare Energie in Nordafrika produzieren, die Stromnetze in Nordafrika miteinander verbinden und diese mit Europa. Desertec sollte bis zu 15 Prozent des Stroms in Europa produzieren. Dazu wären Investitionen gigantischen Ausmaßes von rund 400 Milliarden Euro notwendig gewesen. Doch das Projekt ist gescheitert.
Die gute Nachricht jedoch ist: Desertec lebt weiter. Und nicht nur das: Desertec ist heute größer als jemals zuvor. Paul van Son, der Niederländer, der die Desertec Industrial Initiative GmbH (DII) vorangetrieben hatte, ist dem Projekt treu geblieben. Allerdings hat sich Desertec grundlegend geändert. Unter neuem Namen ist Dii Desert Energy heute ein internationales Industrienetzwerk mit Sitz in Dubai.
Dort verfolgt van Son den Ursprungsgedanken von Desertec weiter, mit einem Unterschied: Dii ist heute mehr ein Thinktank, der Menschen, Länder und Märkte im Bereich saubere Energie miteinander verbinden will. Das Ziel ist immer noch: in den Wüsten emissionsfrei, verlässlich und kostengünstig Energie zu produzieren. Da sieht van Son Dii Desert Energy auf gutem Weg: “Die Länder der MENA-Region nutzen immer stärker ihr Potenzial für eine emissionsfreie Energieerzeugung”, sagt er.
Van Son hatte in Delft Engineering und Energiewirtschaft studiert und arbeitete dann für Siemens im Netzwerkbereich, anschließend für das Energieunternehmen Essent. Von 2009 an stand er der Desertec Industrial Initiative in München vor – bis diese fünf Jahre später auseinanderbrach, als viele Gesellschafter wie Siemens oder ABB ihr Engagement nicht verlängern wollten.
Doch RWE, das chinesische Unternehmen State Grid Corporation und Acwa Power aus Saudi-Arabien sind Dii Desert Energy auch nach Umbenennung und Umzug treu geblieben. Auch Thyssenkrupp ist bei dem Netzwerk in führender Rolle dabei. Zahlreiche Namen aus der deutschen Industrie sind dazugekommen oder haben sich der Initiative wieder angeschlossen: Eon, Bosch, Baywa, Siemens, Daimler Truck, Siemens Energy, Samson oder auch Roland Berger.
Vor allem ist Cornelius Matthes Paul van Son treu geblieben. Heute steht Matthes dem Netzwerk als CEO vor, van Son ist der Präsident. Matthes stand eine verheißungsvolle Karriere im Asset Management der Deutschen Bank in Aussicht. Doch die Chance, die Energiewende mitzugestalten, reizte ihn mehr als eine Karriere in der Bankenhierarchie. “Ohne grünen Wasserstoff aus den Wüstenländern würde die Energiewende hier nicht vorankommen”, meint denn auch Matthes.
Matthes ging den ganzen Weg mit allen Höhen und Tiefen an der Seite van Sons mit. So leitet er heute das Netzwerk in Dubai. Doch Paul van Son agiert in seiner Rolle als Präsident weiter – als Antreiber und als Visionär, der mit leiser Stimme, Freundlichkeit und Nachdruck immer wieder neue Ideen vorantreibt.
An diesem Wochenende, am 13. Juli, hat Dii Desert Energy sein fünfzehnjähriges Jubiläum gefeiert. “In unserer Gruppe wurden die ersten Diskussionen zum Projekt Neom Green Hydrogen geführt, das mit 8,4 Milliarden Dollar den Financial Close erreichte und nun gebaut wird”, sagte Matthes zu diesem Anlass. “Dabei wurden auch andere verrückte Ideen besprochen, von denen niemand gedacht hätte, dass sie jemals realisiert werden würden.”
Van Son und Matthes behaupten gar, dass Dii Desert Energy heute größer ist und größere Wirkung entfaltet hat, als es die Desertec Industrial Initiative jemals konnte. Matthes nennt nüchtern die Fakten: “Seit wir vor fünf Jahren die MENA Hydrogen Alliance ins Leben gerufen haben, hat die Industriegruppe und Denkfabrik Dii Desert Energy ein beeindruckendes Comeback erlebt: Von 20 Partnern im Jahr 2019 haben wir uns versechsfacht und sind nun auf mehr als 120 Partner aus 35 Ländern gewachsen.”
Allerdings legt Dii Desert Energy den Fokus neben Nordafrika stark auf den Nahen Osten. Und dennoch: Die alten Kooperationsländer von Desertec – Ägypten, Tunesien und Marokko – sind immer noch dabei. In wenigen Wochen wird van Son seinen 71. Geburtstag feiern. Doch in seiner Rolle als Präsident von Dii Desert Energy fühlt er sich offenbar weiterhin wohl. Es ist ein Leben für saubere Energie. Christian von Hiller

Die Basilika Notre-Dame-de-La-Paix in Yamoussoukro, der Verwaltungshauptstadt der Elfenbeinküste, ist von den Außenmaßen her das größte Gotteshaus der Welt. Dem Petersdom in Rom nachempfunden, wurde die römisch-katholische Kirche zwischen 1985 und 1988 errichtet und hat eine Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern. Papst Johannes Paul II. weihte die Basilika, die Platz für 18.000 Gläubige bietet, 1990 feierlich ein. Zu den regulären Messen kommen allerdings selten mehr als einige Hundert Menschen.
Außenministerin Annalena Baerbock ist diese Woche zu Gast in dem Land, das Alassane Ouattara seit 2010 regiert. Er wurde bereits 1990 von jenem Präsidenten zum Premierminister ernannt, der sich mit dieser Basilika ein Denkmal setzen wollte: Félix Houphouët-Boigny, der die Kirche in Yamoussoukro bauen ließ, seinem Geburtsort. Er war es auch, der den Umzug von der alten Hauptstadt Abidjan in die neue Hauptstadt betrieb. Eines der Glasmosaikfenster zeigt Houphouët-Boigny, wie er neben Jesus bei dessen triumphalen Einzug in Jerusalem niederkniet.
Der Marmor der Kirche kam aus Italien, die Glasmosaikfenster, insgesamt 8.500 Quadratmeter, aus Frankreich. So verwundert es nicht, dass die Baukosten rund 200 Millionen Euro betragen haben sollen. Manche gehen sogar vom Dreifachen aus. Kritiker sahen das Großprojekt angesichts der damaligen wirtschaftlichen und politischen Krise in Elfenbeinküste als reine Geldverschwendung an. Notre-Dame-de-La-Paix ist mit 158 Metern Höhe allerdings nur das zweithöchste Gotteshaus der Welt, auf Platz drei folgt der Kölner Dom. Spitzenreiter ist mit 161,53 Meter weiterhin das Ulmer Münster, das alle Gotteshäuser der Welt überragt. Auch dieses galt bei seiner Fertigstellung 1890 als Verschwendungsbau. as
