es kommt Bewegung in die deutsche Afrikapolitik. Bemerkenswert ist die Reise, die der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil nach Namibia, Südafrika und Ghana unternommen hat. Dabei wollte er jegliche Parallele zu Willy Brandts berühmter Nord-Süd-Kommission vermeiden. Ob ihm das gelungen ist, weiß Andreas Sieren, der Klingbeil in Johannesburg zum Interview getroffen hat.
Derweil geht die Diskussion weiter, wie sich die deutsche Afrikapolitik aufstellen soll. Dazu hat der CSU-Politiker Wolfgang Stefinger seine eigenen Vorstellungen, die er mit unserem Redakteur David Renke geteilt hat.
Und schließlich arbeitet das AA an neuen Leitlinien für die Afrika-Strategie der Bundesregierung. Wir stellen Ihnen Christoph Retzlaff, den Afrika-Chef im Auswärtigen Amt, vor.
In Sachen Afrika-Strategie ist Stihl schon weiter. Das schwäbische Familienunternehmen verfolgt mit großem Erfolg sein Engagement auf dem Kontinent. Wie Stihl es schafft, auch hochpreisige Garten- und Forstgeräte zwischen Algier und Kapstadt zu verkaufen, untersucht unser Redakteur Arne Schütte.
Daneben bieten wir Ihnen wieder interessante Nachrichten aus Afrika, über den Beginn des Ramadan, über Trends und neue Entwicklungen. Wir wünschen Ihnen eine angeregte Lektüre.


SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil war in der vergangenen Woche auf Afrikareise und hat mit seiner Delegation Namibia, Südafrika und Ghana besucht. “Wir haben zu wenig in persönlichen Austausch und Partnerschaften investiert”, sagte der SPD-Vorsitzende im Gespräch mit Table.Briefings. Korrespondent Andreas Sieren hat in Johannesburg mit Lars Klingbeil gesprochen.
Lassen Sie uns über die Klimapolitik sprechen. Afrika fehlt es an Geld, um bei diesem Thema voranzukommen. Wie soll Deutschland mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um den Klimawandel einzudämmen?
Klimapolitik ist ein gutes Beispiel, wo wir gut auf Augenhöhe kooperieren können. Was nicht funktioniert, ist, wenn wir als reicher Norden in Länder wie Südafrika kommen und sagen, Ihr müsst jetzt das oder das machen, weil wir uns gemeinsam ums Klima kümmern müssen. Auch die Länder des Globalen Südens – das war sehr deutlich in unseren Gesprächen – haben einen Wunsch und ein Recht auf eigene Entwicklung, auf Fortschritt und auf Wohlstand. Und dafür braucht man auch Geld. Deswegen müssen wir eine Win-Win-Situation schaffen.
Können Sie Beispiele nennen?
Das war so in Namibia mit grünem Wasserstoff, den wir für die Entwicklung unserer Industrie brauchen. Wir wollen Namibia unterstützen, damit dort gute Rahmenbedingungen entstehen. Das Gleiche gilt für Südafrika, wo wir bei der Entwicklung von neuer grüner Technologie helfen können. Das gibt diesen Ländern eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung und eine Perspektive. So entstehen hier Arbeitsplätze, was zu mehr Wohlstand führt. Und wir haben auch etwas davon. Für mich ist das sinnvolle Klimapolitik auf Augenhöhe, die man gemeinsam entwickeln kann.
China spielt bei der Entwicklung Afrikas seit Jahren eine zentrale Rolle. Wäre es nicht sinnvoll, einen trilateralen Zukunftsrat zwischen der SPD, dem ANC und der chinesischen KP ins Leben zu rufen?
Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Mir geht es aber hier um die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der SPD und dem ANC. Die SPD hat auch einen Dialog mit der Kommunistischen Partei (KP) Chinas, was unter Willy Brandt entstand. Aber für uns ist die KP keine Schwesterpartei. Die Beziehungen zum ANC sind auf einer anderen Ebene. Jetzt wollen wir diese Verbindung, die etwas geruht hat, wiederbeleben. Und natürlich wird es in dem Dialog auch um die Rolle Chinas gehen. Mir ist die deutsche und europäische Perspektive zu Südafrika und die Stärkung unserer Kooperation wichtig. Deswegen ist es zu früh, einen dritten Partner mit hineinzunehmen. Im vergangenen Jahr habe ich in Brasilien einen Parteiendialog mit der Arbeiterpartei (PT) unterzeichnet. Da geht es unter anderem um Energiepolitik und um eine gemeinsame Position bei der Klimakonferenz. Und so wächst Vertrauen. So etwas könnte ich mir auch mit dem ANC gut vorstellen. Aber geht es immer um beide Perspektiven und nicht um die Durchsetzung einer Meinung.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich vor der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen im vergangenen September für mehr Multilateralismus eingesetzt. Was ist seitdem passiert? Wie fließt das in eine SPD-ANC-Beziehung ein?
Ich finde, es gibt eine sehr klare Linie, die Kanzler Scholz seit dem ersten Tag seiner Amtszeit verfolgt. Wenn man zurückdenkt an den G7-Gipfel in Elmau 2022, wo er als Gastgeber den Senegal, Indien, Indonesien, Argentinien und Südafrika mit eingebunden hat. Das war ein Signal: Ihr gehört jetzt mit dazu. Wir, die G7, diskutieren mit Euch auf Augenhöhe. Ähnlich war es beim G20-Gipfel in Bali im selben Jahr, der sehr wichtig war, auch weil der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war. Kanzler Scholz ist viel gereist, nach Afrika, Lateinamerika und Asien und hatte zahlreiche Treffen in Berlin. Auch hier war sein Zeichen an den Globalen Süden: Ich nehme Euch ernst, und ich will mit Euch kooperieren. Insofern passiert sehr viel. Ich als Parteivorsitzender habe bei diesen Themen eine Schnittmenge mit ihm und ich helfe, dieses Vertrauen in die deutsche Demokratie zu stärken und einen dauerhaften Dialog mit dem Globalen Süden aufbauen.
Ihre Reise nach Afrika weckt natürlich Erinnerungen an Willy Brandt…
Überall, wo ich in der Welt unterwegs bin, merke ich, was für eine großartige Leistung Willy Brandt vor 50 Jahren vollbracht hat, überall Partnerschaften aufzubauen. Der ehemalige Präsident Südafrikas, Thabo Mbeki, hat mir von seinen zahlreichen Begegnungen mit Willy Brandt erzählt. Das hat er auch als Parteivorsitzender gemacht. Die SPD hat eine internationale Tradition, die ich wiederbeleben möchte. Und das hilft am Ende, dass sich Deutschland stark in der Welt präsentiert.
Ein neues Megaprojekt der nigerianisch-chinesischen Zusammenarbeit zeichnet sich am Horizont ab: Eine gigantische Batteriefabrik. Im vergangenen Winter unterzeichneten beide Länder ein Memorandum of Understanding am Rande der Internationalen Klimakonferenz in Dubai. Es geht um 150 Millionen US-Dollar. China steuert damit zielgerichtet auf einen Zukunftsmarkt zu, der in Afrikas bevölkerungsreichstem Land vieles ändern könnte: die Elektromobilität. “Elektromobilität könnte für Nigeria ein Game Changer werden”, so der auf Afrika-China-Beziehungen spezialisierte Politikwissenschaftler Tobi Oshodi von der Universität in Lagos kürzlich in einem Podcast. Denn die Kosten für Treibstoff, den die Ölnation bisher in großem Stil exportiert, sind enorm hoch. Noch mehr für die Endverbraucher, seit Präsident Bola Tinubu die Benzin-Subventionen gestrichen hat.
Bisher ist China vor allem in konventionelle Infrastruktur-Projekte als Geldgeber eingebunden, wie in den Bau von Brücken und Straßen. Nigeria ist eines der 145 Länder, die bisher bei Chinas “Neuer Seidenstraße”, der “Belt and Road Initiative” mitmachen. “Afrikanische Länder brauchen China”, sagt der Afrika-China-Experte Oshodi. In Nigeria ginge es vor allem um den Bau von Eisenbahnstrecken.
Ein Grund für das nigerianische Interesse auf die Schiene umzusteigen, war die Angst vor Überfällen bei Reisen auf der Straße. Inzwischen sind allerdings auch Züge von zum Teil terroristischen Angriffen betroffen. Chinas Top-Diplomat für Afrika-Fragen Wu Peng bekräftigte das chinesische Engagement beim Bau von Infrastruktur bei einem Besuch Ende Januar. In diesem Jahr will China zum neunten Mal zum Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) einladen. Wann und wo die Konferenz stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar. Für Nigeria bleiben Infrastruktur und Energie Kernthemen.
Auch für die deutsche Wirtschaft ist Nigeria ein wichtiger Markt. Dennoch gebe es bisher keine große Konkurrenz, so die Ökonomin Linda Maokomatanda vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. “Wenn wir uns ansehen, was Deutschland und China jeweils in Nigeria machen, dann gibt es da nicht viele Überschneidungen, denke ich. China ist sehr stark in der Bergbauindustrie und in Infrastruktur engagiert”, sagte Maokomatanda im Gespräch mit Table.Briefings.
Für deutsche Unternehmen liegt die Priorität erstmal woanders. “Nigeria ist wegen der schieren Größe der Märkte für Unternehmen interessant. Es ist im Prinzip erstmal egal, wo das Land liegt. Derzeit ist die Importquote für Produkte in allen Bereichen sehr hoch. Das heißt, es gibt viel zu verkaufen”, erläutert Timo Pleyer von der AHK in Lagos gegenüber Table.Briefings. Das Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen ist hoch. “Wir haben bei der AHK täglich Anfragen von KMUs, die in den nigerianischen Markt einsteigen wollen. Da geht es vor allem um die Bereiche Gesundheit und Energie“, sagt Pleyer.
“Deutsche Produkte und Dienstleistungen sind sehr speziell. Sie haben eine hohe Qualität, sind oftmals langlebiger und stehen natürlich im weltweiten Preiswettbewerb.” Aber auch in Nigeria gebe es dafür entsprechende Kundschaft. Dass deutsche Unternehmen in die Produktion einsteigen, sieht Pleyer erst mittel- und langfristig. “Genauso wie man erst irgendwo ein Häuschen mietet, statt sofort draufloszubauen.”
Nigeria hat aufgrund der schieren Größe des Marktes und des hohen Bedarfs in allen Bereichen Platz für viele Partner. Während Chinas Engagement in Afrika im Westen zum Teil mit Skepsis und Unverständnis beobachtet wird, kann Ökonomin Maokomatanda aufgrund ihrer Forschung von positiven Eindrücken afrikanischer Länder berichten: “Etwas, das afrikanische Partner in der Zusammenarbeit mit China schätzen können, ist die Transparenz. Es geht um eine reine Geschäftsbeziehung. Investitionen sind Investitionen, Entwicklungsprojekte sind Entwicklungsprojekte, Hilfsgelder sind Hilfsgelder.”
Nigeria versuche – wie viele afrikanische Länder – in seinen Finanzen unabhängiger zu werden. “Wir beobachten zum Beispiel, dass afrikanische Länder inzwischen auch Yen-Reserven halten, nicht nur US-Dollar. Das liegt auch daran, dass China seit 2020 seine Kredite in Yen ausgibt”, sagt Maokomatanda. Schulden bei China machten 2023 4,1 Prozent der nigerianischen Gesamtschulden aus (4,7 Milliarden von insgesammt 114 Milliarden US-Dollar), wie aus Behördenangaben hervorgeht, die das China-Global-South-Projekt zitiert.

Muss das Auswärtige Amt im Sinne der entwicklungspolitischen Zeitenwende mehr Führung in der EZ übernehmen?
Ich verstehe natürlich, dass ein Außenpolitiker gerne das Auswärtige Amt gestärkt sehen möchte. Meines Erachtens braucht es für eine echte Zeitenwende jedoch viel eher eine dringende Aufwertung des Entwicklungsministeriums. Nur mit einem starken Entwicklungsministerium können wir wirklich erfolgreich auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sein und diese vorantreiben. Es muss endlich klar sein, wer der Ansprechpartner für die Entwicklungsländer in Deutschland ist. Das ist nach wie vor die große Krux: Für die Staats- und Regierungschefs in den Entwicklungsländern gibt es nicht die eine Telefonnummer, die sie in Berlin anrufen können, wenn sie Unterstützung aus Deutschland und eine Zusammenarbeit mit Deutschland möchten. Deswegen ist es wichtig, dass das Entwicklungsministerium kein Anhängsel des Auswärtigen Amtes wird.
Gäbe es nicht diese eine Telefonnummer, wenn AA und BMZ unter einem Dach vereint würden?
Nein, die gibt es auch dann nicht. Denn es geht nicht nur um die Bereiche der Außenpolitik. Bei der Entwicklungspolitik spielen auch die Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Klima aber auch Landwirtschaft eine Rolle – die aktuell alle in verschiedenen Ministerien liegen. Auch das Bildungsministerium hat eine eigene Bildungsinitiative Afrika. Von daher ist die deutsche Entwicklungspolitik ein Stück weit zerfleddert. Zudem hat das Auswärtige Amt aus dem historischen Selbstverständnis eine ganz andere diplomatische Aufgabe als das Entwicklungsministerium. Das ermöglicht dem BMZ aber wiederum ganz andere Handlungsspielräume. Damit das Zusammenspiel funktioniert, müssen natürlich viele Dinge abgestimmt werden. Das hat sich auch die Ampel groß ins Stammbuch geschrieben. Doch wenn man allein auf die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine schaut, sieht man zwei Häuser, die sich nicht einigen können. Da ist wirklich noch viel zu tun.
Was bedeutet die von ihnen erwähnte Stärkung des BMZ konkret?
Der ganze Bereich der humanitären Hilfe, der seinerzeit unter Guido Westerwelle und Dirk Niebel ins Auswärtige Amt gegangen ist, gehört zurück ins Entwicklungsministerium. Wenn wir außerdem den Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wirklich mit Leben füllen und stärker ausbauen wollen, dann muss der Bereich der Außenwirtschaft, der mit den Entwicklungsländern zu tun hat, ins BMZ. Hinzu kommen die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Landwirtschaft. Es kann nicht sein, dass sich zig Minister in einem Land die Klinke in die Hand drücken und vor Ort nicht klar ist, wer eigentlich der Ansprechpartner in Deutschland ist. Alles, was mit Entwicklungsländern zu tun hat, egal in welchem Politikbereich, muss im Entwicklungsministerium gebündelt sein.
Braucht ein solches Superministerium nicht einen neuen Namen?
Ich persönlich könnte mir das Haus als Ministerium für Internationale Zusammenarbeit vorstellen. Am Namen soll es meines Erachtens aber nicht scheitern. Am Ende geht es um die Kompetenzen, die dieses Haus hat – und eine protokollarische Aufwertung. Wenn geplante Wirtschaftsdelegationen des BMZ wieder ausgeladen werden, weil ein protokollarisch höherstehendes Kabinettsmitglied das Flugzeug braucht, um nach Brüssel zu fliegen, muss sich die Regierung die Frage nach ihren Prioritäten stellen. Bislang ist Ministerin Schulze nicht einmal mit einer Wirtschaftsdelegation nach Afrika gereist.
Muss ein neues Ministerium für Internationale Zusammenarbeit mit einem größeres Budget ausgestattet werden?
Auf jeden Fall. Das ist jedoch ebenfalls wieder eine Frage der Prioritäten. Dass das Thema Wirtschaft keine große Rolle spielt, sehen wir an den Haushaltszahlen. Das Budget wird gekürzt und der Wirtschaftstitel im BMZ auch noch für Gewerkschaftsarbeit geöffnet. Das hat meines Erachtens mit Wirtschaftsförderung nicht viel zu tun. Wenn man es besser machen möchte, müssten die Mittel für die Außenwirtschaftsförderung aber auch beim Thema internationale Umwelt und Klima in den Haushalt des BMZ. Der Etat würde dann natürlich entsprechend steigen.
Wolfgang Stefinger sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag. Er ist Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zudem ist Stefinger seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe Südliches Afrika.
Stihl zählt zu den führenden Geräteherstellern für Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege sowie Bauwirtschaft. In seiner strategischen Ausrichtung setzt das Unternehmen schon lange auch auf das Potenzial Afrikas. So ist der älteste dokumentierte Vertrag mit einem Importeur in Gabun mehr als 60 Jahre alt, erzählt Johannes Wetzel, Abteilungsleiter Verkauf für Afrika und die französischen Überseegebiete, im Gespräch mit Table.Briefings. Das Engagement des schwäbischen Familienunternehmens auf dem Kontinent reiche sogar noch weiter zurück.
Heute kooperiert Stihl mit einer Vielzahl afrikanischer Importeure und betreibt Tochtergesellschaften in allen Regionen des Kontinents: zwei Vertriebsgesellschaften in Südafrika (seit 1997) und Kenia (2017) sowie drei Marketing- und Trainingszentren in Elfenbeinküste (2021), Marokko und Kamerun (beide seit 2023). “Es ist in fast jedem Land Afrikas möglich, Stihl-Produkte zu kaufen”, sagt Wetzel.
Zwar hat Stihl die kenianische Tochter 2022 von einer Marketing- zu einer Vertriebsgesellschaft umgewandelt. Doch seien eigene Vertriebsgesellschaften nicht unbedingt die bevorzugte Strategie, stellt Wetzel klar. “Wir wollen mit den lokalen Partnern arbeiten. Viele unserer Partner machen eine sehr gute Marktbearbeitung.” So betreibt die kenianische Tochtergesellschaft, ebenso wie die südafrikanische, auch weiterhin ein Trainingszentrum für Vertriebspartner und Kunden.
Stihls wohl bekanntestes Produkt – Motorsägen – sind zwar auch auf dem Kontinent ein Verkaufsschlager. “Aber das Wachstum liegt bei uns nicht mehr in der Säge”, sagt Wetzel. Stattdessen setzt Stihl darauf, Kleinbauern durch Produktivitätssteigerung aus der Subsistenzwirtschaft zu helfen. “Wir wollen Stihl in Afrika als die Marke für Kleinbauern etablieren.” In Indien sei dies schon erfolgreich gelungen.
Die angestrebte Mechanisierung der Kleinbauern erfordert eine angepasste Produktpalette. Zum einen bietet Stihl in Afrika mehr Produkte für Grünflächenpflege und Landwirtschaft an. Dazu zählen etwa Motorhacken und -sensen, Wasserpumpen, Erdbohr- und Sprühgeräte, aber auch Generatoren. Zum anderen müssen die Produkte besonderen Erfordernissen gerecht werden: “Robust, günstig und einfach zu reparieren muss es sein”, sagt Wetzel. “Wir nutzen zum Beispiel simple Zweitaktmotoren, die auch mit verunreinigtem Sprit und staubiger Luft gut klarkommen.”
Über die Trainingszentren schult Stihl Vertriebspartner und potenzielle Kunden im Umgang mit seinen Produkten. “Die Leute kommen nicht zu uns, sondern wir gehen mit den Teams, die wir vor Ort haben, raus zu den Farmern”, erzählt Wetzel. Auch die Reparatur und Wartung der Geräte wird vermittelt. Diese “Verkaufsunterstützungsmaßnahmen” bietet Stihl kostenfrei an.
Dass Stihls afrikanische Handelspartner auch in der Lage sein müssen, Reparaturen anzubieten, ist Teil des Vertriebskonzepts, denn “jede Maschine ist nur so gut wie ihr Service”. “Unsere Vertriebspartner müssen über eine Werkstatt und Techniker verfügen und an unser Ersatzteilsystem angebunden sein”, so Wetzel. Für die wichtigsten Ersatzteile gilt sogar eine Pflicht, sie vor Ort im Lager zu halten. Damit hebt sich Stihl von internationalen Konkurrenten ab, deren Kunden oft monatelang auf Ersatzteile warten müssen.
Wetzel betont, wie aufwändig die Arbeit auf dem Kontinent ist: “Man braucht schon eine gute Strategie für eine intensive Marktbearbeitung und die nötigen Ressourcen. Und man muss es sich leisten können, langfristig zu denken und strategisch vorzugehen.” Schließlich dauere vieles länger als geplant, meint Wetzel und erinnert an ein afrikanisches Sprichwort: “Die Europäer haben Uhren, die Afrikaner Zeit.”
Der Anteil des Afrikageschäfts an Stihls gesamtem Umsatz ist noch relativ gering. Trotzdem sei die Expansion richtig und vielversprechend, sagt Wetzel. Kein Unternehmen könne einen so wichtigen Zukunftsmarkt wie Afrika einfach ignorieren. “Deutsche Unternehmen, die in der Zukunft gut in Afrika aufgestellt sein wollen, müssen jetzt investieren.”
Schon allein das prognostizierte Bevölkerungswachstum verspreche großes Potenzial. “All diese Menschen müssen ernährt werden. Auch deshalb setzen wir auf eine Modernisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.” Aber auch andere Branchen seien vielversprechend: “Da wächst ein riesiger Markt heran. Mit den richtigen Produkten zum richtigen Preis könnten deutsche Unternehmen diese Nachfrage bedienen und zu Wohlstand und Wachstum Afrikas beitragen.”
Kaum hat Senegals Präsident Macky Sall den Termin für die Präsidentschaftswahl für den 24. März angesetzt, da steht er auch schon wieder unter Vorbehalt: Am Montag reichte die Partei PDS (Parti démocratique sénégalais) des abgelehnten Bewerbers Karim Wade Beschwerde vor dem Obersten Gerichtshof in Dakar ein. Der Verfassungsrat habe eine in der Verfassung festgelegte Frist nicht eingehalten, lautet der Vorwurf. Demnach müssen die Stimmberechtigten 81 Tage vor dem Abstimmungstermin zur Wahl aufgerufen werden. Außerdem müsse der Wahlkampf 21 Tage dauern.
Nach Angaben eines PDS-Sprechers sollte bis spätestens Dienstagmorgen außerdem ein Gesetzesvorschlag zur Auflösung des Verfassungsrates beim Parlamentspräsidenten vorgelegt werden. Es ist allerdings unklar, ob der Oberste Gerichtshof in dieser Frage überhaupt zuständig ist – oder ob die Entscheidungskompetenz in dieser Frage nicht alleinig beim Verfassungsrat liegt.
In der vergangenen Woche hatten sich Amtsinhaber Macky Sall und der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) auf den 24. März als Datum geeignet. Ursprünglich war der 25. Februar geplant gewesen, doch Sall hatte die Wahlen kurzfristig auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Dann sollte im Dezember gewählt werden. Diese Entscheidung kippte der Verfassungsrat im Nachgang.
Jetzt lässt Sall der Opposition extrem wenig Zeit, um sich in den wenigen Tagen bis zum Wahltermin zu formieren und sich um die Stimmen der Wähler zu bewerben. Mit seiner Taktik gefährdet Sall die gewachsenen Strukturen der Demokratie in diesem Land, das bisher stets als politischer Stabilitätsanker in Westafrika galt.
Der Wahlkampf für die verschobenen Präsidentschaftswahlen hat am Wochenende begonnen. Wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan fallen diese allerdings weniger pompös aus als üblich. Unter den 19 Kandidaten bewirbt sich nur eine Frau um das höchste Staatsamt im Senegal: Anta Babacar Ngom.
Für die verbotene Oppositionspartei Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité – Afrikanische Patrioten des Senegal für Arbeit, Anstand und Brüderlichkeit) tritt Diomaye Faye als Kandidat an. Wie der von den Wahlen ausgeschlossene populäre Parteichef Ousmane Sonko sitzt Faye im Gefängnis. Faye könnte jedoch bald freikommen: Vergangene Woche verabschiedete das Parlament ein von Macky Sall initiiertes Amnestiegesetz.
Kurz vor den Wahlen löste Noch-Präsident Sall am Donnerstag die Regierung auf und entließ den von ihm ausgesuchten Präsidentschaftskandidaten Amadou Ba aus seiner Rolle als Ministerpräsident. Nachfolger ist der bisherige Innenminister Sidiki Kaba. lcw
Die 14 Kraftwerke des staatlichen Stromunternehmens in Südafrika, Eskom, sind in einem desolaten Zustand. Zu diesem Schluss kommt ein unabhängiger Bericht von VGBE Energy, der jetzt veröffentlich wurde. Unzureichende Wartung der Kraftwerke, unterqualifizierte Mitarbeiter und eine niedrige Arbeitsmoral seien die Hauptgründe für den Verfall. Die Experten von VGBE, einem Konsortium deutscher Energieunternehmen mit Sitz in Essen, zeigen, wie jahrelanges Missmanagement bei Eskom das Land in eine schwere Energiekriese geführt hat. Sie empfehlen eine radikale Überarbeitung der komplexen und dysfunktionalen Struktur des Staatsunternehmens.
Knapp drei Monaten vor den Wahlen in Südafrika kommt der Bericht für die Regierungspartei ANC zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bereits im September vergangenen Jahres war die 600 Seiten dicke Analyse beim Finanzministerium eingereicht worden, blieb dort allerdings bis Anfang März unter Verschluss.
Seit Jahren gibt es am Kap unzureichende Stromversorgung. An der mehrmonatigen Untersuchung zu Beginn des vergangenen Jahres hatten Experten von RWE Technology International GmbH, Steag GmbH, KWS Energy Knowledge eG, und Dornier Power and Heat GmbH teilgenommen. Die Ingenieure hatten sich jedes Kraftwerk einzeln angesehen und Änderungsvorschläge empfohlen, um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Eskom sah den Bericht zum ersten Mal am 1. März, bestätigte aber umgehend die Unzulänglichkeiten und verwies auf seine eigenen Strategien, um diese zu beseitigen. Anfang März hat auch der neue CEO von Eskom, Dan Marokane, seine Arbeit aufgenommen und den VGBE-Bericht gelesen. Dieser soll jetzt zusätzlich zum “Operation Recovery Plan” von Eskom als Leitlinie für eine künftige stabile Stromversorgung am Kap dienen. CEO Marokane wurde vom Eskom-Aufsichtsrat angehalten, auch die deutschen Empfehlungen umzusetzen.
Auf die externe VGEB-Untersuchung hatte Finanzminister Enoch Godongwana als Teil eines umgerechnet 18 Milliarden Euro teuren Rettungspaketes für Eskom bestanden. “Die Empfehlung werden in die strategischen Plane von Eskom einfließen,” so der Minister. Samantha Graham, Schattenstromministerin der Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA), sprach von einer “realistischen Diagnose” der VGEB und plädierte für eine Dezentralisierung von Eskom, um die Managementverantwortung auf die Ebene der Kraftwerke zu verlagern. as
Der muslimische Fastenmonat Ramadan hat in vielen afrikanischen Ländern unter dem Eindruck hoher Inflation begonnen. Die zum Teil stark gestiegenen Preise für Lebensmittel üben hohen Druck auf das Budget vieler Familien aus. In Kenia lag die Teuerungsrate im Januar bei 5,9 Prozent, in Niger bei 6,9 Prozent, in Burkina Faso bei 4,3 Prozent und in Elfenbeinküste bei 3,1 Prozent. Für Lebensmittel liegt die Teuerung meistens weit über der allgemeinen Inflationsrate.
In den meisten Ländern mit muslimischer Tradition hat der Ramadan am Montag, 11. März begonnen, nur in Libyen und Marokko am heutigen Dienstag, 12. März. In diesem Jahr überschneidet sich der Ramadan mit der christlichen Fastenzeit, die Ende März mit dem Osterfest endet. Das Ende des Fastenmonats wird mit einem großen Fest, Aïd el-Fitr, gefeiert.
Bis etwa Mitte April bestimmt der Ramadan das Alltagsleben in Dutzenden afrikanischen Ländern. Das betrifft bevölkerungsreiche Länder mit großer muslimischen Gemeinschaften wie Nigeria und Ägypten – aber auch viele kleinere Länder in Westafrika und an der ostafrikanischen Küste: etwa die Sahel-Staaten und das regionale Banken- und Finanzzentrum Elfenbeinküste, sowie Somalia, Dschibuti und Äthiopien.
Der Ramadan ist ein Monat des Gebets, der Einkehr, der Besinnung und ausgiebiger Feste, die bis tief in die Nacht dauern können. Der Fastenmonat gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor: Haushalte kaufen große Mengen Nahrungsmittel für das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang ein. Typische Lebensmittel für diese Zeit sind Datteln, die zu Beginn des Fastenbrechens verzehrt werden und stark nachgefragt sind. Das Wort Ramadan leitet sich vom arabischen Wort ramida ab und bedeutet intensive Hitze, da das Fasten als eine gute Tat gilt, die Sünden verzehrt.
Außerdem werden zusätzliche Umsätze gemacht, da wohltätige muslimische Organisationen Lebensmittel für ärmere Menschen kaufen, um kostenlose Mahlzeiten für das Fastenbrechen bereitzustellen. In einigen Ländern gibt es auch die Tradition, innerhalb der Familien Geschenkkörbe zum Ramadan zu übergeben. Im mehrheitlich muslimischen Senegal kauft etwa die Schwiegertochter Geschenke für ihre Schwiegermutter, was zu großem familiären Druck führen kann.
Muslime arbeiten während des Ramadan wie gewöhnlich weiter. Üblicherweise entfallen in der Arbeitwelt jedoch Businesstreffen wie gemeinsame Mittagessen in dieser Zeit. Die Fastenzeit hat im Senegal auf Einfluss auf die kurzfristig angesetzte Wahlkampagne für die Präsidentschaftswahlen am 24. März. Große Vorwahlpartys entfallen. lcw

Die Welt schlittert in Richtung einer multipolaren Ordnung. Deutsche Regierungsvertreter reiben sich die Augen, weil viele afrikanische Staaten sich weigern, die russische Invasion in der Ukraine als rechtswidrig zu brandmarken. Seit dem Massaker der Hamas in Israel dürfte sich der Schlafsand in Schock verwandelt haben. Selbst Hage Geingob, der namibische Präsident, der wie ein Fels in der Brandung gegen innernamibische Kritik das 2021 paraphierte Versöhnungsabkommen mit Deutschland verteidigte, setzte im Januar 2024 einen Tweet ab, in dem er Deutschland rundheraus absprach, sich zur Genozid-Konvention äußern zu dürfen. Es fehle der Regierung an jeglicher Legitimität, weil sie nicht einmal in der Lage sei, den eigenen in Namibia begangenen Völkermord angemessen zu verarbeiten.
Vorangegangen war die Ankündigung Deutschlands, eine Drittintervention zum Verfahren gegen Israel vor dem IGH einzubringen. Anfang März hat Nicaragua den IGH Deutschland direkt angegriffen und wirft ihm vor, durch die Unterstützung Israels die Völkermord-Konvention zu verletzen. Die deutsche Aufarbeitung ihrer Kolonialgeschichte ist – gegenwärtig mehr denn je – mit dem politischen Weltgeschehen verknüpft und wird mit Argusaugen beobachtet.
Olaf Scholz hat zu Recht den Neuanfang mit Afrika ausgerufen. Der Kontinent spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer wertebasierten Weltordnung. Wollen wir kleinste gemeinsame Nenner – Menschenrechte, soziale Gleichheit, nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie – über die Turbulenzen in die Zukunft tragen, benötigen wir belastbare Netzwerke und Bündnisse. Und Deutschland benötigt Afrika und die Länder des Globalen Südens, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade jetzt darf kein Glas mehr zerschlagen werden. Seit Jahrzehnten baut sich die Kritik am postkolonialen Gebaren der westlichen Staaten auf wie ein Tsunami auf hoher See. Es ist klar, dass er irgendwann auf Land trifft, aber bisher stolpern die Ministerien noch eher durcheinander. Und ergehen sich teils in blindem Aktionismus.
Das Versöhnungsabkommen mit Namibia wird immer noch heftig kritisiert, ein Gerichtsverfahren ist anhängig vor dem namibischen High Court. Aber anstatt sich in Ruhe anzuschauen, welche rechtlichen Mindeststandards in Verhandlungen über Reparationen und Wiedergutmachung in kolonialen Kontexten gelten sollten, stürzt sich das grün geführte Außenministerium in die nächste Verhandlung mit Tansania. Als ob ein Trial and Error Prozess nicht ausgereicht hätte. Auch der wahrscheinlich in bester Absicht bei Hage Geingobs Staatsbegräbnis geäußerte Wunsch des deutschen Bundespräsidenten, sich bald entschuldigen zu können, wurde von Nachfahren wie Sima Luipert als unpassend und heuchlerisch gebrandmarkt. So wird es nicht funktionieren.
Es muss der Bundesregierung zugutegehalten werden, dass sie als erste Regierung weltweit einen Verhandlungsprozess mit einer ehemaligen Kolonie über Aufarbeitung und Wiedergutmachung begonnen hat. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass Fehler gemacht wurden. Zudem sind hochkomplexe völkerrechtliche Fragen zu klären: Wie genau können Beteiligungsrechte gewährleistet werden? Wenn sie sich völkergewohnheitsrechtlich zwar schon herauskonturiert haben, aber es wenig Praxiserfahrung dazu gibt? Wie kann bei der Bestimmung des vor 130 Jahren geltenden Rechts gewährleistet werden, dass keine rassistische Perspektive nachträglich aufgezwängt wird?
Diese Fragen betreffen den Kern der postkolonialen Kritiken an Europa. Und just deshalb dürfen sie nicht einfach abgetan werden. Ein Abkommen zur Versöhnung, das von einem beträchtlichen Teil der Betroffenen abgelehnt wird, kann sein Ziel nicht erreichen. Das unbeirrbare Festhalten daran gießt stattdessen Öl ins Feuer. So geht keine Kommunikation auf Augenhöhe, heißt es aus Afrika.
Um glaubhaft zu sein und so den Neuanfang mit Afrika auf ein belastbares Fundament stellen zu können, muss ein rechtliches Rahmenwerk zunächst in Deutschland und später auf Ebene der UN geschaffen werden, in dem kohärente Positionen auf diese hochkomplexen Fragen gefunden wurden. Positionen, die keinen kolonialen Rassismus reproduzieren, sondern ein leuchtendes Beispiel für die wertebasierte Weltordnung sind, für die die deutsche Bundesregierung weltweit werben möchte. Erst danach sollte der nächste Verhandlungsprozess mit Tansania starten.
Das Abkommen mit Namibia sollte nicht durchgesetzt, sondern durch Neuverhandlungen ersetzt werden – dieses Mal dann unter Einhaltung der im Rahmenwerk festgelegten Mindeststandards. Statt Worten Taten: so führt man.
Karina Theurer ist Völkerrechtlerin, lehrt Menschenrechtsdurchsetzung an der Humboldt-Universität zu Berlin und berät die Kanzlei Dr. Weder, Kauta & Hoveka im rechtlichen Verfahren gegen die deutsch-namibische Joint Declaration. Zuvor leitete sie das Institut für juristische Intervention des European Center for Constitutional and Human Rights und die Humboldt Law Clinic Grund-und Menschenrechte.
African Business: Ukrainische Charmeoffensive vor Selenskyjs Afrikareise. Inmitten des russischen Angriffskrieges sucht die Ukraine nach neuen Verbündeten in Afrika. Kiew verspricht mehr Getreide und Investitionen sowie die Eröffnung neuer Botschaften in Ruanda, Mosambik, Botswana, der DR Kongo, Elfenbeinküste, Ghana, Mauretanien, Tansania und Sudan. Präsident Wolodymyr Selenskyj plant außerdem einen historischen ersten Besuch in Südafrika.
The East African: AU unterstützt SADC-Truppen in DR Kongo. Die Afrikanische Union hat die Entsendung eines Truppenkontingents der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) in die Demokratische Republik Kongo gebilligt und sich damit über die Proteste Ruandas hinweggesetzt. Die SADC-Truppen sollen dazu beitragen, den schwer gebeutelten Osten des Landes zu befrieden. Sie ersetzen Soldaten der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC sowie der UN-Mission Monusco, die im Laufe des Jahres beendet wird.
Mail & Guardian: Ghanas Finanzministerium warnt vor Anti-LGBTQ-Gesetz. Das ghanaische Parlament hat in der vergangenen Woche einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Rechte von LGBTQ-Personen stark einschränkt. Der Vorstoß wurde international heftig kritisiert, unter anderem von Menschenrechtsaktivisten und dem US State Department. Nun warnt das Finanzministerium, das Gesetz könne dazu führen, dass das finanziell angeschlagene Land Milliarden von Dollar an Weltbankgeldern verliert.
Business Insider: Libyen könnte endlich Einheitsregierung bekommen. Bei einer Sitzung der Arabischen Liga am Sonntag in Ägypten stand auch die andauernde Krise in Libyen auf der Tagesordnung. Eine der vorgestellten Ideen sieht die Bildung einer einheitlichen Regierung vor, die nationale Wahlen für den Präsidenten und die Legislative durchführen soll. Nach der Hinrichtung des langjährigen Staatschefs Gaddafi im Jahr 2011 war in Libyen die staatliche Ordnung zusammengebrochen.
The Economist: Eine verpasste Chance zur Reform Tansanias. Präsidentin Samia Suluhu Hassan gilt als Reformerin – besonders im Vergleich zu ihrem Vorgänger Magufuli. Doch an die dringend nötige Reform der tansanischen Verfassung will sie sich bislang nicht wagen, auch aus politischem Kalkül. Die derzeitigen Gesetze verwischen die Grenzen zwischen Regierungspartei und dem Staat, und verleihen der Präsidentin weitreichende Befugnisse.
Washington Post: Nigeria kämpft mit Massenentführungen. In der vergangenen Woche sind in den nigerianischen Bundesstaaten Borno und Kaduna hunderte Personen von bewaffneten Milizen entführt worden. Bei den Entführten handelt es sich größtenteils um Frauen und Schulkinder. Der Vorfall in Borno scheint die größte Entführung durch islamistische Extremisten seit 2014 zu sein. Damals hatte Boko Haram 276 Mädchen entführt.
Financial Times: Erfolgreiche Ölbohrungen in Namibia beflügeln die Industrie. Shell, Total Energies und das portugiesische Unternehmen Galp haben in den vergangenen Jahren vor der Küste des südwestafrikanischen Landes eine Reihe von Erdöl- (und einige Gas-) Vorkommen entdeckt. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass dort Hunderte von Millionen Barrel förderbares Öl lagern könnten. Diese Erfolge werden die Ölindustrie höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, mehr in Exploration zu investieren.
Bloomberg: Macky Salls Versuch, den Senegal weiter zu regieren, war zum Scheitern verurteilt. Senegals Präsident leidet an einer altbekannten Krankheit, kommentiert der südafrikanische Kolumnist Justice Malala: dem Mythos des unentbehrlichen Mannes in Afrika. Mehrere demokratische afrikanische Führer, die sich beim Aufbau ihrer Wirtschaft und der Stärkung der Institutionen für Rechenschaftspflicht und Demokratie besonders hervorgetan haben, sind schon in dieselbe Falle getappt.
Africa Is A Country: “Nie wieder” muss für alle gelten. Die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner wurde 2020 als erste Afrikanerin mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. Aus Protest an der einseitigen Positionierung der deutschen Regierung im Nahost-Konflikt gibt die Autorin ihre Auszeichnung nun zurück. Deutsche Sühne für den Holocaust müsse auch den Schutz unschuldiger Palästinenser bedeuten, schreibt Wanner.

Deutschlands Afrikapolitik steht an einem Wendepunkt. Angesichts der zahlreichen Putschen im Sahel und der wankenden Demokratie im Senegal sucht die Bundesrepublik nach einem neuen Ansatz für die Krisenregion. Gleichzeitig wächst in einer multipolaren Welt das Potenzial neuer diplomatischer Konfliktlinien mit Afrika, wie zuletzt die scharfe Kritik Namibias an der deutschen Haltung im Gaza-Konflikt gezeigt hat. Christoph Retzlaff ist der Mann im Auswärtigen Amt, der eine Antwort darauf finden muss, wie Deutschland auch künftig mit seinem Nachbarkontinent zusammenarbeiten kann. Seit August 2022 ist er der Beauftragte für Subsahara-Afrika und den Sahel und wirbt für eine selbstbewusste deutsche Afrikapolitik.
“Wir dürfen und müssen uns nicht im globalen Wettkampf verstecken. Das bedeutet auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas verstärken. Entscheidend ist, wer im globalen Wettbewerb das bessere Angebot macht. Deutschland hat hier viel anzubieten”, sagt Retzlaff. Dazu gehöre allerdings auch, dass Deutschland gegenüber seinen afrikanischen Partnern seine Interessen klarer formuliert. Noch fehlt die ressortübergreifende Abstimmung in einer gemeinsamen Afrika-Strategie der verschiedenen Ministerien. Das soll sich mit der Novelle der afrikapolitischen Leitlinien noch in diesem Jahr ändern. Diese gelten – vom AA erarbeitet – maßgeblich für die gesamte Bundesregierung. Zuletzt wurden die Leitlinien 2019 erneuert und sind nicht einmal fünf Jahre später kaum noch zeitgemäß.
“Eine Zusammenarbeit, die auf Gebermentalität basiert, funktioniert nicht”, ist Retzlaff überzeugt. “Was wir anbieten, sind deshalb echte Partnerschaften, die auf gemeinsamen Interessen fußen. Auch deshalb ist es wichtig, unsere strategischen Interessen klar zu definieren. Dazu zählen zum Beispiel eine regelbasierte Weltordnung, die globale Energietransition, Migrationspartnerschaften sowie die Rohstoffversorgung.”
Schon vor seiner Position als Beauftragter für Subsahara-Afrika war Retzlaff eng mit Afrika verbunden. Sein “Erweckungserlebnis” für den Kontinent hatte der Stuttgarter, der am Sonntag, 10. März seinen 62. Geburtstag gefeiert hat, vor gut 30 Jahren, als er das erste Mal in Westafrika unterwegs war. Damals reiste er mit einem Geländewagen von Burkina Faso bis Mali – eine Tour, die heute aufgrund der Sicherheitslage nicht mehr möglich ist. Für Retzlaff war diese Reise der Beginn seiner Leidenschaft für den Nachbarkontinent Europas.
Nach Stationen an der Botschaft in Myanmar sowie der ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York wurde Retzlaff Ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Kairo. 2016 wechselte er als Botschafter nach Ghana und leitete die Botschaft in Accra fünf Jahre lang.
In dem westafrikanischen Land ist rund die Hälfte der Einwohner jünger als 21 Jahre. Vielleicht liegt Retzlaff auch deshalb die junge afrikanische Bevölkerung besonders am Herzen. Auch die Bundesregierung müsse hier mehr tun, ist Retzlaff überzeugt: “Wir müssen noch besser darin werden, die junge Generation zu erreichen.” Viele junge Afrikaner seien unzufrieden aufgrund fehlender wirtschaftlicher und sozialer Perspektiven, die ihnen die afrikanischen Eliten anbieten könnten. Gleichzeitig wirft die afrikanische Jugend diesen Eliten eine zu große Nähe zum Westen vor, den sie als postkolonialistisch wahrnehmen. Das musste insbesondere Frankreich in der Sahelzone mit den zahlreichen Umstürzen seit 2020 schmerzlich erkennen.
Die Entfremdung der Region zum Westen hat jedoch nicht nur kurzfristige Auswirkungen. Längst würde die junge afrikanische Elite nicht mehr im Westen ausgebildet, sondern in China, gibt Retzlaff zu bedenken. Denn China biete mehr und unkompliziertere Optionen für ein Stipendium. Von deutscher Seite müsse es gerade hier bessere Angebote geben.
Gleichzeitig bleiben in einer multipolaren Welt neue Konfliktlinien unausweichlich. Mit Blick auf den Gazakrieg hat die Bundesregierung das besonders im südlichen Afrika stark zu spüren bekommen. Anfang des Jahres hatte Namibias kürzlich verstorbener Präsident Hage Geingob Deutschlands Haltung im Gazakrieg scharf kritisiert und dabei auf den deutschen Genozid in Namibia verwiesen. Deutschland habe keine Lehren aus seiner kolonialen Geschichte gezogen, lautete Geingobs Vorwurf.
Retzlaff arbeitet federführend an der Aussöhnung zwischen Deutschland und Namibia und ruft zu Gelassenheit auf – und mehr gegenseitiges Verständnis: “Klar gibt es auch Themen, bei denen unsere afrikanischen Partner und wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Perspektiven haben. Es ist dann besonders wichtig, den jeweils anderen Standpunkt zu verstehen und respektvoll damit umzugehen. Man muss Meinungsverschiedenheiten eben auch mal aushalten.” David Renke
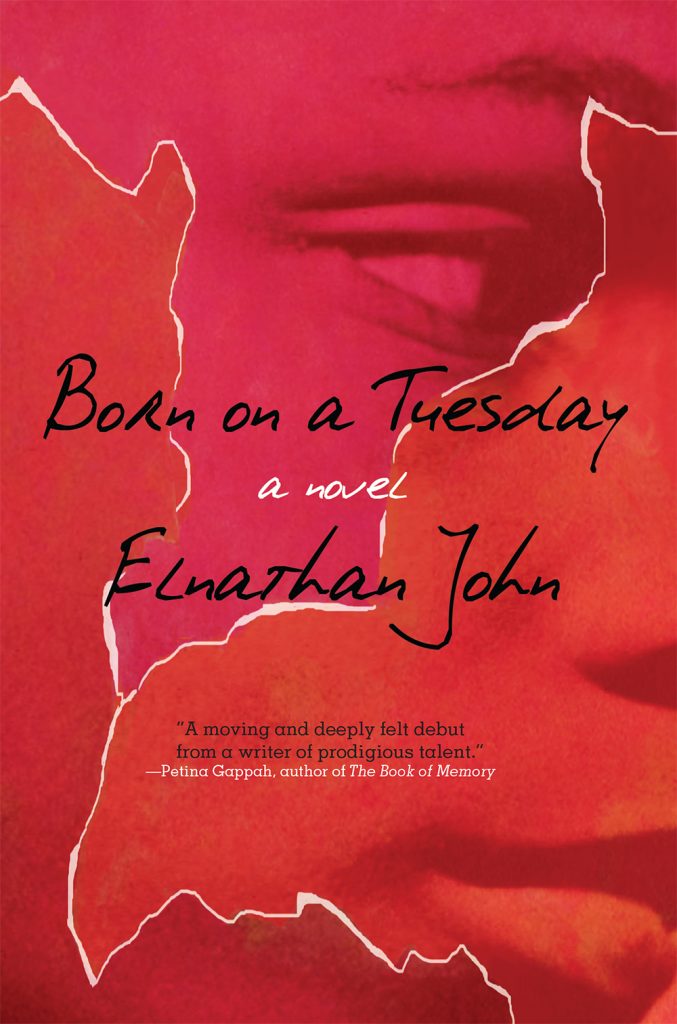
Literatur ist weit mehr als ein Sachbericht, aber sie kann die Leserschaft en passant über Geschichte, Kultur und Politik etwas lehren. Und so lohnt sich eine Lektüre des Debütromans von Elnathan John nicht allein, weil der Norden Nigerias mit zwei Massenentführungen wieder Schlagzeilen macht und es in “Born on a Tuesday” um diese turbulente Region geht. Die Lektüre lohnt sich abseits der Einblicke in religiös-fundamentalistische Tendenzen und die Verstrickung von Religion und Politik, weil “Born on a Tuesday” unter den namenlosen Vielen, die in den Nachrichten auftauchen, eine Geschichte herausgreift und ein fiktives Schicksal plastisch werden lässt.
Dantala heißt der Protagonist – und sein Name ist zugleich ein Nicht-Name. Denn das Wort, das dem Roman seinen Titel gibt, bedeutet: “an einem Dienstag geboren”. In der Ich-Form erzählt Dantala seine Geschichte. Er entwickelt sich vom ahnungslosen, kiffenden Koran-Schüler und bezahlten Schläger zu einem gewissenhaften, reflektierten und gläubigen jungen Mann – unter den Fittichen eines salafistischen Imams. Der wird im Buch zwar als konservativ, aber klug und gerecht dargestellt.
Johns Debütroman (2015), der auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist, versucht nicht, irgendjemanden oder irgendeine Religion zu verteidigen – oder zu verteufeln. Die Stärke von Dantalas Geschichte liegt in der unverblümten Sprache, gleichgültig ob es um Gewalt, die sexuelle Entwicklung des Protagonisten oder die Spannung zwischen muslimischen Glaubenssätzen und der unbarmherzigen Realität geht. John, der seit einigen Jahren in Berlin lebt und als Moderator und Satiriker arbeitet, spiegelt die innere Entwicklung seines Protagonisten in dessen sprachlichem Stil wider. Dantala, obgleich der mit dem Nicht-Namen, wird so für die Leser zu einem Jemanden. lcw
es kommt Bewegung in die deutsche Afrikapolitik. Bemerkenswert ist die Reise, die der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil nach Namibia, Südafrika und Ghana unternommen hat. Dabei wollte er jegliche Parallele zu Willy Brandts berühmter Nord-Süd-Kommission vermeiden. Ob ihm das gelungen ist, weiß Andreas Sieren, der Klingbeil in Johannesburg zum Interview getroffen hat.
Derweil geht die Diskussion weiter, wie sich die deutsche Afrikapolitik aufstellen soll. Dazu hat der CSU-Politiker Wolfgang Stefinger seine eigenen Vorstellungen, die er mit unserem Redakteur David Renke geteilt hat.
Und schließlich arbeitet das AA an neuen Leitlinien für die Afrika-Strategie der Bundesregierung. Wir stellen Ihnen Christoph Retzlaff, den Afrika-Chef im Auswärtigen Amt, vor.
In Sachen Afrika-Strategie ist Stihl schon weiter. Das schwäbische Familienunternehmen verfolgt mit großem Erfolg sein Engagement auf dem Kontinent. Wie Stihl es schafft, auch hochpreisige Garten- und Forstgeräte zwischen Algier und Kapstadt zu verkaufen, untersucht unser Redakteur Arne Schütte.
Daneben bieten wir Ihnen wieder interessante Nachrichten aus Afrika, über den Beginn des Ramadan, über Trends und neue Entwicklungen. Wir wünschen Ihnen eine angeregte Lektüre.


SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil war in der vergangenen Woche auf Afrikareise und hat mit seiner Delegation Namibia, Südafrika und Ghana besucht. “Wir haben zu wenig in persönlichen Austausch und Partnerschaften investiert”, sagte der SPD-Vorsitzende im Gespräch mit Table.Briefings. Korrespondent Andreas Sieren hat in Johannesburg mit Lars Klingbeil gesprochen.
Lassen Sie uns über die Klimapolitik sprechen. Afrika fehlt es an Geld, um bei diesem Thema voranzukommen. Wie soll Deutschland mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um den Klimawandel einzudämmen?
Klimapolitik ist ein gutes Beispiel, wo wir gut auf Augenhöhe kooperieren können. Was nicht funktioniert, ist, wenn wir als reicher Norden in Länder wie Südafrika kommen und sagen, Ihr müsst jetzt das oder das machen, weil wir uns gemeinsam ums Klima kümmern müssen. Auch die Länder des Globalen Südens – das war sehr deutlich in unseren Gesprächen – haben einen Wunsch und ein Recht auf eigene Entwicklung, auf Fortschritt und auf Wohlstand. Und dafür braucht man auch Geld. Deswegen müssen wir eine Win-Win-Situation schaffen.
Können Sie Beispiele nennen?
Das war so in Namibia mit grünem Wasserstoff, den wir für die Entwicklung unserer Industrie brauchen. Wir wollen Namibia unterstützen, damit dort gute Rahmenbedingungen entstehen. Das Gleiche gilt für Südafrika, wo wir bei der Entwicklung von neuer grüner Technologie helfen können. Das gibt diesen Ländern eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung und eine Perspektive. So entstehen hier Arbeitsplätze, was zu mehr Wohlstand führt. Und wir haben auch etwas davon. Für mich ist das sinnvolle Klimapolitik auf Augenhöhe, die man gemeinsam entwickeln kann.
China spielt bei der Entwicklung Afrikas seit Jahren eine zentrale Rolle. Wäre es nicht sinnvoll, einen trilateralen Zukunftsrat zwischen der SPD, dem ANC und der chinesischen KP ins Leben zu rufen?
Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Mir geht es aber hier um die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der SPD und dem ANC. Die SPD hat auch einen Dialog mit der Kommunistischen Partei (KP) Chinas, was unter Willy Brandt entstand. Aber für uns ist die KP keine Schwesterpartei. Die Beziehungen zum ANC sind auf einer anderen Ebene. Jetzt wollen wir diese Verbindung, die etwas geruht hat, wiederbeleben. Und natürlich wird es in dem Dialog auch um die Rolle Chinas gehen. Mir ist die deutsche und europäische Perspektive zu Südafrika und die Stärkung unserer Kooperation wichtig. Deswegen ist es zu früh, einen dritten Partner mit hineinzunehmen. Im vergangenen Jahr habe ich in Brasilien einen Parteiendialog mit der Arbeiterpartei (PT) unterzeichnet. Da geht es unter anderem um Energiepolitik und um eine gemeinsame Position bei der Klimakonferenz. Und so wächst Vertrauen. So etwas könnte ich mir auch mit dem ANC gut vorstellen. Aber geht es immer um beide Perspektiven und nicht um die Durchsetzung einer Meinung.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich vor der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen im vergangenen September für mehr Multilateralismus eingesetzt. Was ist seitdem passiert? Wie fließt das in eine SPD-ANC-Beziehung ein?
Ich finde, es gibt eine sehr klare Linie, die Kanzler Scholz seit dem ersten Tag seiner Amtszeit verfolgt. Wenn man zurückdenkt an den G7-Gipfel in Elmau 2022, wo er als Gastgeber den Senegal, Indien, Indonesien, Argentinien und Südafrika mit eingebunden hat. Das war ein Signal: Ihr gehört jetzt mit dazu. Wir, die G7, diskutieren mit Euch auf Augenhöhe. Ähnlich war es beim G20-Gipfel in Bali im selben Jahr, der sehr wichtig war, auch weil der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war. Kanzler Scholz ist viel gereist, nach Afrika, Lateinamerika und Asien und hatte zahlreiche Treffen in Berlin. Auch hier war sein Zeichen an den Globalen Süden: Ich nehme Euch ernst, und ich will mit Euch kooperieren. Insofern passiert sehr viel. Ich als Parteivorsitzender habe bei diesen Themen eine Schnittmenge mit ihm und ich helfe, dieses Vertrauen in die deutsche Demokratie zu stärken und einen dauerhaften Dialog mit dem Globalen Süden aufbauen.
Ihre Reise nach Afrika weckt natürlich Erinnerungen an Willy Brandt…
Überall, wo ich in der Welt unterwegs bin, merke ich, was für eine großartige Leistung Willy Brandt vor 50 Jahren vollbracht hat, überall Partnerschaften aufzubauen. Der ehemalige Präsident Südafrikas, Thabo Mbeki, hat mir von seinen zahlreichen Begegnungen mit Willy Brandt erzählt. Das hat er auch als Parteivorsitzender gemacht. Die SPD hat eine internationale Tradition, die ich wiederbeleben möchte. Und das hilft am Ende, dass sich Deutschland stark in der Welt präsentiert.
Ein neues Megaprojekt der nigerianisch-chinesischen Zusammenarbeit zeichnet sich am Horizont ab: Eine gigantische Batteriefabrik. Im vergangenen Winter unterzeichneten beide Länder ein Memorandum of Understanding am Rande der Internationalen Klimakonferenz in Dubai. Es geht um 150 Millionen US-Dollar. China steuert damit zielgerichtet auf einen Zukunftsmarkt zu, der in Afrikas bevölkerungsreichstem Land vieles ändern könnte: die Elektromobilität. “Elektromobilität könnte für Nigeria ein Game Changer werden”, so der auf Afrika-China-Beziehungen spezialisierte Politikwissenschaftler Tobi Oshodi von der Universität in Lagos kürzlich in einem Podcast. Denn die Kosten für Treibstoff, den die Ölnation bisher in großem Stil exportiert, sind enorm hoch. Noch mehr für die Endverbraucher, seit Präsident Bola Tinubu die Benzin-Subventionen gestrichen hat.
Bisher ist China vor allem in konventionelle Infrastruktur-Projekte als Geldgeber eingebunden, wie in den Bau von Brücken und Straßen. Nigeria ist eines der 145 Länder, die bisher bei Chinas “Neuer Seidenstraße”, der “Belt and Road Initiative” mitmachen. “Afrikanische Länder brauchen China”, sagt der Afrika-China-Experte Oshodi. In Nigeria ginge es vor allem um den Bau von Eisenbahnstrecken.
Ein Grund für das nigerianische Interesse auf die Schiene umzusteigen, war die Angst vor Überfällen bei Reisen auf der Straße. Inzwischen sind allerdings auch Züge von zum Teil terroristischen Angriffen betroffen. Chinas Top-Diplomat für Afrika-Fragen Wu Peng bekräftigte das chinesische Engagement beim Bau von Infrastruktur bei einem Besuch Ende Januar. In diesem Jahr will China zum neunten Mal zum Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) einladen. Wann und wo die Konferenz stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar. Für Nigeria bleiben Infrastruktur und Energie Kernthemen.
Auch für die deutsche Wirtschaft ist Nigeria ein wichtiger Markt. Dennoch gebe es bisher keine große Konkurrenz, so die Ökonomin Linda Maokomatanda vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. “Wenn wir uns ansehen, was Deutschland und China jeweils in Nigeria machen, dann gibt es da nicht viele Überschneidungen, denke ich. China ist sehr stark in der Bergbauindustrie und in Infrastruktur engagiert”, sagte Maokomatanda im Gespräch mit Table.Briefings.
Für deutsche Unternehmen liegt die Priorität erstmal woanders. “Nigeria ist wegen der schieren Größe der Märkte für Unternehmen interessant. Es ist im Prinzip erstmal egal, wo das Land liegt. Derzeit ist die Importquote für Produkte in allen Bereichen sehr hoch. Das heißt, es gibt viel zu verkaufen”, erläutert Timo Pleyer von der AHK in Lagos gegenüber Table.Briefings. Das Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen ist hoch. “Wir haben bei der AHK täglich Anfragen von KMUs, die in den nigerianischen Markt einsteigen wollen. Da geht es vor allem um die Bereiche Gesundheit und Energie“, sagt Pleyer.
“Deutsche Produkte und Dienstleistungen sind sehr speziell. Sie haben eine hohe Qualität, sind oftmals langlebiger und stehen natürlich im weltweiten Preiswettbewerb.” Aber auch in Nigeria gebe es dafür entsprechende Kundschaft. Dass deutsche Unternehmen in die Produktion einsteigen, sieht Pleyer erst mittel- und langfristig. “Genauso wie man erst irgendwo ein Häuschen mietet, statt sofort draufloszubauen.”
Nigeria hat aufgrund der schieren Größe des Marktes und des hohen Bedarfs in allen Bereichen Platz für viele Partner. Während Chinas Engagement in Afrika im Westen zum Teil mit Skepsis und Unverständnis beobachtet wird, kann Ökonomin Maokomatanda aufgrund ihrer Forschung von positiven Eindrücken afrikanischer Länder berichten: “Etwas, das afrikanische Partner in der Zusammenarbeit mit China schätzen können, ist die Transparenz. Es geht um eine reine Geschäftsbeziehung. Investitionen sind Investitionen, Entwicklungsprojekte sind Entwicklungsprojekte, Hilfsgelder sind Hilfsgelder.”
Nigeria versuche – wie viele afrikanische Länder – in seinen Finanzen unabhängiger zu werden. “Wir beobachten zum Beispiel, dass afrikanische Länder inzwischen auch Yen-Reserven halten, nicht nur US-Dollar. Das liegt auch daran, dass China seit 2020 seine Kredite in Yen ausgibt”, sagt Maokomatanda. Schulden bei China machten 2023 4,1 Prozent der nigerianischen Gesamtschulden aus (4,7 Milliarden von insgesammt 114 Milliarden US-Dollar), wie aus Behördenangaben hervorgeht, die das China-Global-South-Projekt zitiert.

Muss das Auswärtige Amt im Sinne der entwicklungspolitischen Zeitenwende mehr Führung in der EZ übernehmen?
Ich verstehe natürlich, dass ein Außenpolitiker gerne das Auswärtige Amt gestärkt sehen möchte. Meines Erachtens braucht es für eine echte Zeitenwende jedoch viel eher eine dringende Aufwertung des Entwicklungsministeriums. Nur mit einem starken Entwicklungsministerium können wir wirklich erfolgreich auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sein und diese vorantreiben. Es muss endlich klar sein, wer der Ansprechpartner für die Entwicklungsländer in Deutschland ist. Das ist nach wie vor die große Krux: Für die Staats- und Regierungschefs in den Entwicklungsländern gibt es nicht die eine Telefonnummer, die sie in Berlin anrufen können, wenn sie Unterstützung aus Deutschland und eine Zusammenarbeit mit Deutschland möchten. Deswegen ist es wichtig, dass das Entwicklungsministerium kein Anhängsel des Auswärtigen Amtes wird.
Gäbe es nicht diese eine Telefonnummer, wenn AA und BMZ unter einem Dach vereint würden?
Nein, die gibt es auch dann nicht. Denn es geht nicht nur um die Bereiche der Außenpolitik. Bei der Entwicklungspolitik spielen auch die Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Klima aber auch Landwirtschaft eine Rolle – die aktuell alle in verschiedenen Ministerien liegen. Auch das Bildungsministerium hat eine eigene Bildungsinitiative Afrika. Von daher ist die deutsche Entwicklungspolitik ein Stück weit zerfleddert. Zudem hat das Auswärtige Amt aus dem historischen Selbstverständnis eine ganz andere diplomatische Aufgabe als das Entwicklungsministerium. Das ermöglicht dem BMZ aber wiederum ganz andere Handlungsspielräume. Damit das Zusammenspiel funktioniert, müssen natürlich viele Dinge abgestimmt werden. Das hat sich auch die Ampel groß ins Stammbuch geschrieben. Doch wenn man allein auf die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine schaut, sieht man zwei Häuser, die sich nicht einigen können. Da ist wirklich noch viel zu tun.
Was bedeutet die von ihnen erwähnte Stärkung des BMZ konkret?
Der ganze Bereich der humanitären Hilfe, der seinerzeit unter Guido Westerwelle und Dirk Niebel ins Auswärtige Amt gegangen ist, gehört zurück ins Entwicklungsministerium. Wenn wir außerdem den Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wirklich mit Leben füllen und stärker ausbauen wollen, dann muss der Bereich der Außenwirtschaft, der mit den Entwicklungsländern zu tun hat, ins BMZ. Hinzu kommen die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Landwirtschaft. Es kann nicht sein, dass sich zig Minister in einem Land die Klinke in die Hand drücken und vor Ort nicht klar ist, wer eigentlich der Ansprechpartner in Deutschland ist. Alles, was mit Entwicklungsländern zu tun hat, egal in welchem Politikbereich, muss im Entwicklungsministerium gebündelt sein.
Braucht ein solches Superministerium nicht einen neuen Namen?
Ich persönlich könnte mir das Haus als Ministerium für Internationale Zusammenarbeit vorstellen. Am Namen soll es meines Erachtens aber nicht scheitern. Am Ende geht es um die Kompetenzen, die dieses Haus hat – und eine protokollarische Aufwertung. Wenn geplante Wirtschaftsdelegationen des BMZ wieder ausgeladen werden, weil ein protokollarisch höherstehendes Kabinettsmitglied das Flugzeug braucht, um nach Brüssel zu fliegen, muss sich die Regierung die Frage nach ihren Prioritäten stellen. Bislang ist Ministerin Schulze nicht einmal mit einer Wirtschaftsdelegation nach Afrika gereist.
Muss ein neues Ministerium für Internationale Zusammenarbeit mit einem größeres Budget ausgestattet werden?
Auf jeden Fall. Das ist jedoch ebenfalls wieder eine Frage der Prioritäten. Dass das Thema Wirtschaft keine große Rolle spielt, sehen wir an den Haushaltszahlen. Das Budget wird gekürzt und der Wirtschaftstitel im BMZ auch noch für Gewerkschaftsarbeit geöffnet. Das hat meines Erachtens mit Wirtschaftsförderung nicht viel zu tun. Wenn man es besser machen möchte, müssten die Mittel für die Außenwirtschaftsförderung aber auch beim Thema internationale Umwelt und Klima in den Haushalt des BMZ. Der Etat würde dann natürlich entsprechend steigen.
Wolfgang Stefinger sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag. Er ist Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zudem ist Stefinger seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe Südliches Afrika.
Stihl zählt zu den führenden Geräteherstellern für Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege sowie Bauwirtschaft. In seiner strategischen Ausrichtung setzt das Unternehmen schon lange auch auf das Potenzial Afrikas. So ist der älteste dokumentierte Vertrag mit einem Importeur in Gabun mehr als 60 Jahre alt, erzählt Johannes Wetzel, Abteilungsleiter Verkauf für Afrika und die französischen Überseegebiete, im Gespräch mit Table.Briefings. Das Engagement des schwäbischen Familienunternehmens auf dem Kontinent reiche sogar noch weiter zurück.
Heute kooperiert Stihl mit einer Vielzahl afrikanischer Importeure und betreibt Tochtergesellschaften in allen Regionen des Kontinents: zwei Vertriebsgesellschaften in Südafrika (seit 1997) und Kenia (2017) sowie drei Marketing- und Trainingszentren in Elfenbeinküste (2021), Marokko und Kamerun (beide seit 2023). “Es ist in fast jedem Land Afrikas möglich, Stihl-Produkte zu kaufen”, sagt Wetzel.
Zwar hat Stihl die kenianische Tochter 2022 von einer Marketing- zu einer Vertriebsgesellschaft umgewandelt. Doch seien eigene Vertriebsgesellschaften nicht unbedingt die bevorzugte Strategie, stellt Wetzel klar. “Wir wollen mit den lokalen Partnern arbeiten. Viele unserer Partner machen eine sehr gute Marktbearbeitung.” So betreibt die kenianische Tochtergesellschaft, ebenso wie die südafrikanische, auch weiterhin ein Trainingszentrum für Vertriebspartner und Kunden.
Stihls wohl bekanntestes Produkt – Motorsägen – sind zwar auch auf dem Kontinent ein Verkaufsschlager. “Aber das Wachstum liegt bei uns nicht mehr in der Säge”, sagt Wetzel. Stattdessen setzt Stihl darauf, Kleinbauern durch Produktivitätssteigerung aus der Subsistenzwirtschaft zu helfen. “Wir wollen Stihl in Afrika als die Marke für Kleinbauern etablieren.” In Indien sei dies schon erfolgreich gelungen.
Die angestrebte Mechanisierung der Kleinbauern erfordert eine angepasste Produktpalette. Zum einen bietet Stihl in Afrika mehr Produkte für Grünflächenpflege und Landwirtschaft an. Dazu zählen etwa Motorhacken und -sensen, Wasserpumpen, Erdbohr- und Sprühgeräte, aber auch Generatoren. Zum anderen müssen die Produkte besonderen Erfordernissen gerecht werden: “Robust, günstig und einfach zu reparieren muss es sein”, sagt Wetzel. “Wir nutzen zum Beispiel simple Zweitaktmotoren, die auch mit verunreinigtem Sprit und staubiger Luft gut klarkommen.”
Über die Trainingszentren schult Stihl Vertriebspartner und potenzielle Kunden im Umgang mit seinen Produkten. “Die Leute kommen nicht zu uns, sondern wir gehen mit den Teams, die wir vor Ort haben, raus zu den Farmern”, erzählt Wetzel. Auch die Reparatur und Wartung der Geräte wird vermittelt. Diese “Verkaufsunterstützungsmaßnahmen” bietet Stihl kostenfrei an.
Dass Stihls afrikanische Handelspartner auch in der Lage sein müssen, Reparaturen anzubieten, ist Teil des Vertriebskonzepts, denn “jede Maschine ist nur so gut wie ihr Service”. “Unsere Vertriebspartner müssen über eine Werkstatt und Techniker verfügen und an unser Ersatzteilsystem angebunden sein”, so Wetzel. Für die wichtigsten Ersatzteile gilt sogar eine Pflicht, sie vor Ort im Lager zu halten. Damit hebt sich Stihl von internationalen Konkurrenten ab, deren Kunden oft monatelang auf Ersatzteile warten müssen.
Wetzel betont, wie aufwändig die Arbeit auf dem Kontinent ist: “Man braucht schon eine gute Strategie für eine intensive Marktbearbeitung und die nötigen Ressourcen. Und man muss es sich leisten können, langfristig zu denken und strategisch vorzugehen.” Schließlich dauere vieles länger als geplant, meint Wetzel und erinnert an ein afrikanisches Sprichwort: “Die Europäer haben Uhren, die Afrikaner Zeit.”
Der Anteil des Afrikageschäfts an Stihls gesamtem Umsatz ist noch relativ gering. Trotzdem sei die Expansion richtig und vielversprechend, sagt Wetzel. Kein Unternehmen könne einen so wichtigen Zukunftsmarkt wie Afrika einfach ignorieren. “Deutsche Unternehmen, die in der Zukunft gut in Afrika aufgestellt sein wollen, müssen jetzt investieren.”
Schon allein das prognostizierte Bevölkerungswachstum verspreche großes Potenzial. “All diese Menschen müssen ernährt werden. Auch deshalb setzen wir auf eine Modernisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.” Aber auch andere Branchen seien vielversprechend: “Da wächst ein riesiger Markt heran. Mit den richtigen Produkten zum richtigen Preis könnten deutsche Unternehmen diese Nachfrage bedienen und zu Wohlstand und Wachstum Afrikas beitragen.”
Kaum hat Senegals Präsident Macky Sall den Termin für die Präsidentschaftswahl für den 24. März angesetzt, da steht er auch schon wieder unter Vorbehalt: Am Montag reichte die Partei PDS (Parti démocratique sénégalais) des abgelehnten Bewerbers Karim Wade Beschwerde vor dem Obersten Gerichtshof in Dakar ein. Der Verfassungsrat habe eine in der Verfassung festgelegte Frist nicht eingehalten, lautet der Vorwurf. Demnach müssen die Stimmberechtigten 81 Tage vor dem Abstimmungstermin zur Wahl aufgerufen werden. Außerdem müsse der Wahlkampf 21 Tage dauern.
Nach Angaben eines PDS-Sprechers sollte bis spätestens Dienstagmorgen außerdem ein Gesetzesvorschlag zur Auflösung des Verfassungsrates beim Parlamentspräsidenten vorgelegt werden. Es ist allerdings unklar, ob der Oberste Gerichtshof in dieser Frage überhaupt zuständig ist – oder ob die Entscheidungskompetenz in dieser Frage nicht alleinig beim Verfassungsrat liegt.
In der vergangenen Woche hatten sich Amtsinhaber Macky Sall und der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) auf den 24. März als Datum geeignet. Ursprünglich war der 25. Februar geplant gewesen, doch Sall hatte die Wahlen kurzfristig auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Dann sollte im Dezember gewählt werden. Diese Entscheidung kippte der Verfassungsrat im Nachgang.
Jetzt lässt Sall der Opposition extrem wenig Zeit, um sich in den wenigen Tagen bis zum Wahltermin zu formieren und sich um die Stimmen der Wähler zu bewerben. Mit seiner Taktik gefährdet Sall die gewachsenen Strukturen der Demokratie in diesem Land, das bisher stets als politischer Stabilitätsanker in Westafrika galt.
Der Wahlkampf für die verschobenen Präsidentschaftswahlen hat am Wochenende begonnen. Wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan fallen diese allerdings weniger pompös aus als üblich. Unter den 19 Kandidaten bewirbt sich nur eine Frau um das höchste Staatsamt im Senegal: Anta Babacar Ngom.
Für die verbotene Oppositionspartei Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité – Afrikanische Patrioten des Senegal für Arbeit, Anstand und Brüderlichkeit) tritt Diomaye Faye als Kandidat an. Wie der von den Wahlen ausgeschlossene populäre Parteichef Ousmane Sonko sitzt Faye im Gefängnis. Faye könnte jedoch bald freikommen: Vergangene Woche verabschiedete das Parlament ein von Macky Sall initiiertes Amnestiegesetz.
Kurz vor den Wahlen löste Noch-Präsident Sall am Donnerstag die Regierung auf und entließ den von ihm ausgesuchten Präsidentschaftskandidaten Amadou Ba aus seiner Rolle als Ministerpräsident. Nachfolger ist der bisherige Innenminister Sidiki Kaba. lcw
Die 14 Kraftwerke des staatlichen Stromunternehmens in Südafrika, Eskom, sind in einem desolaten Zustand. Zu diesem Schluss kommt ein unabhängiger Bericht von VGBE Energy, der jetzt veröffentlich wurde. Unzureichende Wartung der Kraftwerke, unterqualifizierte Mitarbeiter und eine niedrige Arbeitsmoral seien die Hauptgründe für den Verfall. Die Experten von VGBE, einem Konsortium deutscher Energieunternehmen mit Sitz in Essen, zeigen, wie jahrelanges Missmanagement bei Eskom das Land in eine schwere Energiekriese geführt hat. Sie empfehlen eine radikale Überarbeitung der komplexen und dysfunktionalen Struktur des Staatsunternehmens.
Knapp drei Monaten vor den Wahlen in Südafrika kommt der Bericht für die Regierungspartei ANC zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bereits im September vergangenen Jahres war die 600 Seiten dicke Analyse beim Finanzministerium eingereicht worden, blieb dort allerdings bis Anfang März unter Verschluss.
Seit Jahren gibt es am Kap unzureichende Stromversorgung. An der mehrmonatigen Untersuchung zu Beginn des vergangenen Jahres hatten Experten von RWE Technology International GmbH, Steag GmbH, KWS Energy Knowledge eG, und Dornier Power and Heat GmbH teilgenommen. Die Ingenieure hatten sich jedes Kraftwerk einzeln angesehen und Änderungsvorschläge empfohlen, um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Eskom sah den Bericht zum ersten Mal am 1. März, bestätigte aber umgehend die Unzulänglichkeiten und verwies auf seine eigenen Strategien, um diese zu beseitigen. Anfang März hat auch der neue CEO von Eskom, Dan Marokane, seine Arbeit aufgenommen und den VGBE-Bericht gelesen. Dieser soll jetzt zusätzlich zum “Operation Recovery Plan” von Eskom als Leitlinie für eine künftige stabile Stromversorgung am Kap dienen. CEO Marokane wurde vom Eskom-Aufsichtsrat angehalten, auch die deutschen Empfehlungen umzusetzen.
Auf die externe VGEB-Untersuchung hatte Finanzminister Enoch Godongwana als Teil eines umgerechnet 18 Milliarden Euro teuren Rettungspaketes für Eskom bestanden. “Die Empfehlung werden in die strategischen Plane von Eskom einfließen,” so der Minister. Samantha Graham, Schattenstromministerin der Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA), sprach von einer “realistischen Diagnose” der VGEB und plädierte für eine Dezentralisierung von Eskom, um die Managementverantwortung auf die Ebene der Kraftwerke zu verlagern. as
Der muslimische Fastenmonat Ramadan hat in vielen afrikanischen Ländern unter dem Eindruck hoher Inflation begonnen. Die zum Teil stark gestiegenen Preise für Lebensmittel üben hohen Druck auf das Budget vieler Familien aus. In Kenia lag die Teuerungsrate im Januar bei 5,9 Prozent, in Niger bei 6,9 Prozent, in Burkina Faso bei 4,3 Prozent und in Elfenbeinküste bei 3,1 Prozent. Für Lebensmittel liegt die Teuerung meistens weit über der allgemeinen Inflationsrate.
In den meisten Ländern mit muslimischer Tradition hat der Ramadan am Montag, 11. März begonnen, nur in Libyen und Marokko am heutigen Dienstag, 12. März. In diesem Jahr überschneidet sich der Ramadan mit der christlichen Fastenzeit, die Ende März mit dem Osterfest endet. Das Ende des Fastenmonats wird mit einem großen Fest, Aïd el-Fitr, gefeiert.
Bis etwa Mitte April bestimmt der Ramadan das Alltagsleben in Dutzenden afrikanischen Ländern. Das betrifft bevölkerungsreiche Länder mit großer muslimischen Gemeinschaften wie Nigeria und Ägypten – aber auch viele kleinere Länder in Westafrika und an der ostafrikanischen Küste: etwa die Sahel-Staaten und das regionale Banken- und Finanzzentrum Elfenbeinküste, sowie Somalia, Dschibuti und Äthiopien.
Der Ramadan ist ein Monat des Gebets, der Einkehr, der Besinnung und ausgiebiger Feste, die bis tief in die Nacht dauern können. Der Fastenmonat gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor: Haushalte kaufen große Mengen Nahrungsmittel für das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang ein. Typische Lebensmittel für diese Zeit sind Datteln, die zu Beginn des Fastenbrechens verzehrt werden und stark nachgefragt sind. Das Wort Ramadan leitet sich vom arabischen Wort ramida ab und bedeutet intensive Hitze, da das Fasten als eine gute Tat gilt, die Sünden verzehrt.
Außerdem werden zusätzliche Umsätze gemacht, da wohltätige muslimische Organisationen Lebensmittel für ärmere Menschen kaufen, um kostenlose Mahlzeiten für das Fastenbrechen bereitzustellen. In einigen Ländern gibt es auch die Tradition, innerhalb der Familien Geschenkkörbe zum Ramadan zu übergeben. Im mehrheitlich muslimischen Senegal kauft etwa die Schwiegertochter Geschenke für ihre Schwiegermutter, was zu großem familiären Druck führen kann.
Muslime arbeiten während des Ramadan wie gewöhnlich weiter. Üblicherweise entfallen in der Arbeitwelt jedoch Businesstreffen wie gemeinsame Mittagessen in dieser Zeit. Die Fastenzeit hat im Senegal auf Einfluss auf die kurzfristig angesetzte Wahlkampagne für die Präsidentschaftswahlen am 24. März. Große Vorwahlpartys entfallen. lcw

Die Welt schlittert in Richtung einer multipolaren Ordnung. Deutsche Regierungsvertreter reiben sich die Augen, weil viele afrikanische Staaten sich weigern, die russische Invasion in der Ukraine als rechtswidrig zu brandmarken. Seit dem Massaker der Hamas in Israel dürfte sich der Schlafsand in Schock verwandelt haben. Selbst Hage Geingob, der namibische Präsident, der wie ein Fels in der Brandung gegen innernamibische Kritik das 2021 paraphierte Versöhnungsabkommen mit Deutschland verteidigte, setzte im Januar 2024 einen Tweet ab, in dem er Deutschland rundheraus absprach, sich zur Genozid-Konvention äußern zu dürfen. Es fehle der Regierung an jeglicher Legitimität, weil sie nicht einmal in der Lage sei, den eigenen in Namibia begangenen Völkermord angemessen zu verarbeiten.
Vorangegangen war die Ankündigung Deutschlands, eine Drittintervention zum Verfahren gegen Israel vor dem IGH einzubringen. Anfang März hat Nicaragua den IGH Deutschland direkt angegriffen und wirft ihm vor, durch die Unterstützung Israels die Völkermord-Konvention zu verletzen. Die deutsche Aufarbeitung ihrer Kolonialgeschichte ist – gegenwärtig mehr denn je – mit dem politischen Weltgeschehen verknüpft und wird mit Argusaugen beobachtet.
Olaf Scholz hat zu Recht den Neuanfang mit Afrika ausgerufen. Der Kontinent spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer wertebasierten Weltordnung. Wollen wir kleinste gemeinsame Nenner – Menschenrechte, soziale Gleichheit, nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie – über die Turbulenzen in die Zukunft tragen, benötigen wir belastbare Netzwerke und Bündnisse. Und Deutschland benötigt Afrika und die Länder des Globalen Südens, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade jetzt darf kein Glas mehr zerschlagen werden. Seit Jahrzehnten baut sich die Kritik am postkolonialen Gebaren der westlichen Staaten auf wie ein Tsunami auf hoher See. Es ist klar, dass er irgendwann auf Land trifft, aber bisher stolpern die Ministerien noch eher durcheinander. Und ergehen sich teils in blindem Aktionismus.
Das Versöhnungsabkommen mit Namibia wird immer noch heftig kritisiert, ein Gerichtsverfahren ist anhängig vor dem namibischen High Court. Aber anstatt sich in Ruhe anzuschauen, welche rechtlichen Mindeststandards in Verhandlungen über Reparationen und Wiedergutmachung in kolonialen Kontexten gelten sollten, stürzt sich das grün geführte Außenministerium in die nächste Verhandlung mit Tansania. Als ob ein Trial and Error Prozess nicht ausgereicht hätte. Auch der wahrscheinlich in bester Absicht bei Hage Geingobs Staatsbegräbnis geäußerte Wunsch des deutschen Bundespräsidenten, sich bald entschuldigen zu können, wurde von Nachfahren wie Sima Luipert als unpassend und heuchlerisch gebrandmarkt. So wird es nicht funktionieren.
Es muss der Bundesregierung zugutegehalten werden, dass sie als erste Regierung weltweit einen Verhandlungsprozess mit einer ehemaligen Kolonie über Aufarbeitung und Wiedergutmachung begonnen hat. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass Fehler gemacht wurden. Zudem sind hochkomplexe völkerrechtliche Fragen zu klären: Wie genau können Beteiligungsrechte gewährleistet werden? Wenn sie sich völkergewohnheitsrechtlich zwar schon herauskonturiert haben, aber es wenig Praxiserfahrung dazu gibt? Wie kann bei der Bestimmung des vor 130 Jahren geltenden Rechts gewährleistet werden, dass keine rassistische Perspektive nachträglich aufgezwängt wird?
Diese Fragen betreffen den Kern der postkolonialen Kritiken an Europa. Und just deshalb dürfen sie nicht einfach abgetan werden. Ein Abkommen zur Versöhnung, das von einem beträchtlichen Teil der Betroffenen abgelehnt wird, kann sein Ziel nicht erreichen. Das unbeirrbare Festhalten daran gießt stattdessen Öl ins Feuer. So geht keine Kommunikation auf Augenhöhe, heißt es aus Afrika.
Um glaubhaft zu sein und so den Neuanfang mit Afrika auf ein belastbares Fundament stellen zu können, muss ein rechtliches Rahmenwerk zunächst in Deutschland und später auf Ebene der UN geschaffen werden, in dem kohärente Positionen auf diese hochkomplexen Fragen gefunden wurden. Positionen, die keinen kolonialen Rassismus reproduzieren, sondern ein leuchtendes Beispiel für die wertebasierte Weltordnung sind, für die die deutsche Bundesregierung weltweit werben möchte. Erst danach sollte der nächste Verhandlungsprozess mit Tansania starten.
Das Abkommen mit Namibia sollte nicht durchgesetzt, sondern durch Neuverhandlungen ersetzt werden – dieses Mal dann unter Einhaltung der im Rahmenwerk festgelegten Mindeststandards. Statt Worten Taten: so führt man.
Karina Theurer ist Völkerrechtlerin, lehrt Menschenrechtsdurchsetzung an der Humboldt-Universität zu Berlin und berät die Kanzlei Dr. Weder, Kauta & Hoveka im rechtlichen Verfahren gegen die deutsch-namibische Joint Declaration. Zuvor leitete sie das Institut für juristische Intervention des European Center for Constitutional and Human Rights und die Humboldt Law Clinic Grund-und Menschenrechte.
African Business: Ukrainische Charmeoffensive vor Selenskyjs Afrikareise. Inmitten des russischen Angriffskrieges sucht die Ukraine nach neuen Verbündeten in Afrika. Kiew verspricht mehr Getreide und Investitionen sowie die Eröffnung neuer Botschaften in Ruanda, Mosambik, Botswana, der DR Kongo, Elfenbeinküste, Ghana, Mauretanien, Tansania und Sudan. Präsident Wolodymyr Selenskyj plant außerdem einen historischen ersten Besuch in Südafrika.
The East African: AU unterstützt SADC-Truppen in DR Kongo. Die Afrikanische Union hat die Entsendung eines Truppenkontingents der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) in die Demokratische Republik Kongo gebilligt und sich damit über die Proteste Ruandas hinweggesetzt. Die SADC-Truppen sollen dazu beitragen, den schwer gebeutelten Osten des Landes zu befrieden. Sie ersetzen Soldaten der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC sowie der UN-Mission Monusco, die im Laufe des Jahres beendet wird.
Mail & Guardian: Ghanas Finanzministerium warnt vor Anti-LGBTQ-Gesetz. Das ghanaische Parlament hat in der vergangenen Woche einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Rechte von LGBTQ-Personen stark einschränkt. Der Vorstoß wurde international heftig kritisiert, unter anderem von Menschenrechtsaktivisten und dem US State Department. Nun warnt das Finanzministerium, das Gesetz könne dazu führen, dass das finanziell angeschlagene Land Milliarden von Dollar an Weltbankgeldern verliert.
Business Insider: Libyen könnte endlich Einheitsregierung bekommen. Bei einer Sitzung der Arabischen Liga am Sonntag in Ägypten stand auch die andauernde Krise in Libyen auf der Tagesordnung. Eine der vorgestellten Ideen sieht die Bildung einer einheitlichen Regierung vor, die nationale Wahlen für den Präsidenten und die Legislative durchführen soll. Nach der Hinrichtung des langjährigen Staatschefs Gaddafi im Jahr 2011 war in Libyen die staatliche Ordnung zusammengebrochen.
The Economist: Eine verpasste Chance zur Reform Tansanias. Präsidentin Samia Suluhu Hassan gilt als Reformerin – besonders im Vergleich zu ihrem Vorgänger Magufuli. Doch an die dringend nötige Reform der tansanischen Verfassung will sie sich bislang nicht wagen, auch aus politischem Kalkül. Die derzeitigen Gesetze verwischen die Grenzen zwischen Regierungspartei und dem Staat, und verleihen der Präsidentin weitreichende Befugnisse.
Washington Post: Nigeria kämpft mit Massenentführungen. In der vergangenen Woche sind in den nigerianischen Bundesstaaten Borno und Kaduna hunderte Personen von bewaffneten Milizen entführt worden. Bei den Entführten handelt es sich größtenteils um Frauen und Schulkinder. Der Vorfall in Borno scheint die größte Entführung durch islamistische Extremisten seit 2014 zu sein. Damals hatte Boko Haram 276 Mädchen entführt.
Financial Times: Erfolgreiche Ölbohrungen in Namibia beflügeln die Industrie. Shell, Total Energies und das portugiesische Unternehmen Galp haben in den vergangenen Jahren vor der Küste des südwestafrikanischen Landes eine Reihe von Erdöl- (und einige Gas-) Vorkommen entdeckt. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass dort Hunderte von Millionen Barrel förderbares Öl lagern könnten. Diese Erfolge werden die Ölindustrie höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, mehr in Exploration zu investieren.
Bloomberg: Macky Salls Versuch, den Senegal weiter zu regieren, war zum Scheitern verurteilt. Senegals Präsident leidet an einer altbekannten Krankheit, kommentiert der südafrikanische Kolumnist Justice Malala: dem Mythos des unentbehrlichen Mannes in Afrika. Mehrere demokratische afrikanische Führer, die sich beim Aufbau ihrer Wirtschaft und der Stärkung der Institutionen für Rechenschaftspflicht und Demokratie besonders hervorgetan haben, sind schon in dieselbe Falle getappt.
Africa Is A Country: “Nie wieder” muss für alle gelten. Die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner wurde 2020 als erste Afrikanerin mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. Aus Protest an der einseitigen Positionierung der deutschen Regierung im Nahost-Konflikt gibt die Autorin ihre Auszeichnung nun zurück. Deutsche Sühne für den Holocaust müsse auch den Schutz unschuldiger Palästinenser bedeuten, schreibt Wanner.

Deutschlands Afrikapolitik steht an einem Wendepunkt. Angesichts der zahlreichen Putschen im Sahel und der wankenden Demokratie im Senegal sucht die Bundesrepublik nach einem neuen Ansatz für die Krisenregion. Gleichzeitig wächst in einer multipolaren Welt das Potenzial neuer diplomatischer Konfliktlinien mit Afrika, wie zuletzt die scharfe Kritik Namibias an der deutschen Haltung im Gaza-Konflikt gezeigt hat. Christoph Retzlaff ist der Mann im Auswärtigen Amt, der eine Antwort darauf finden muss, wie Deutschland auch künftig mit seinem Nachbarkontinent zusammenarbeiten kann. Seit August 2022 ist er der Beauftragte für Subsahara-Afrika und den Sahel und wirbt für eine selbstbewusste deutsche Afrikapolitik.
“Wir dürfen und müssen uns nicht im globalen Wettkampf verstecken. Das bedeutet auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas verstärken. Entscheidend ist, wer im globalen Wettbewerb das bessere Angebot macht. Deutschland hat hier viel anzubieten”, sagt Retzlaff. Dazu gehöre allerdings auch, dass Deutschland gegenüber seinen afrikanischen Partnern seine Interessen klarer formuliert. Noch fehlt die ressortübergreifende Abstimmung in einer gemeinsamen Afrika-Strategie der verschiedenen Ministerien. Das soll sich mit der Novelle der afrikapolitischen Leitlinien noch in diesem Jahr ändern. Diese gelten – vom AA erarbeitet – maßgeblich für die gesamte Bundesregierung. Zuletzt wurden die Leitlinien 2019 erneuert und sind nicht einmal fünf Jahre später kaum noch zeitgemäß.
“Eine Zusammenarbeit, die auf Gebermentalität basiert, funktioniert nicht”, ist Retzlaff überzeugt. “Was wir anbieten, sind deshalb echte Partnerschaften, die auf gemeinsamen Interessen fußen. Auch deshalb ist es wichtig, unsere strategischen Interessen klar zu definieren. Dazu zählen zum Beispiel eine regelbasierte Weltordnung, die globale Energietransition, Migrationspartnerschaften sowie die Rohstoffversorgung.”
Schon vor seiner Position als Beauftragter für Subsahara-Afrika war Retzlaff eng mit Afrika verbunden. Sein “Erweckungserlebnis” für den Kontinent hatte der Stuttgarter, der am Sonntag, 10. März seinen 62. Geburtstag gefeiert hat, vor gut 30 Jahren, als er das erste Mal in Westafrika unterwegs war. Damals reiste er mit einem Geländewagen von Burkina Faso bis Mali – eine Tour, die heute aufgrund der Sicherheitslage nicht mehr möglich ist. Für Retzlaff war diese Reise der Beginn seiner Leidenschaft für den Nachbarkontinent Europas.
Nach Stationen an der Botschaft in Myanmar sowie der ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York wurde Retzlaff Ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Kairo. 2016 wechselte er als Botschafter nach Ghana und leitete die Botschaft in Accra fünf Jahre lang.
In dem westafrikanischen Land ist rund die Hälfte der Einwohner jünger als 21 Jahre. Vielleicht liegt Retzlaff auch deshalb die junge afrikanische Bevölkerung besonders am Herzen. Auch die Bundesregierung müsse hier mehr tun, ist Retzlaff überzeugt: “Wir müssen noch besser darin werden, die junge Generation zu erreichen.” Viele junge Afrikaner seien unzufrieden aufgrund fehlender wirtschaftlicher und sozialer Perspektiven, die ihnen die afrikanischen Eliten anbieten könnten. Gleichzeitig wirft die afrikanische Jugend diesen Eliten eine zu große Nähe zum Westen vor, den sie als postkolonialistisch wahrnehmen. Das musste insbesondere Frankreich in der Sahelzone mit den zahlreichen Umstürzen seit 2020 schmerzlich erkennen.
Die Entfremdung der Region zum Westen hat jedoch nicht nur kurzfristige Auswirkungen. Längst würde die junge afrikanische Elite nicht mehr im Westen ausgebildet, sondern in China, gibt Retzlaff zu bedenken. Denn China biete mehr und unkompliziertere Optionen für ein Stipendium. Von deutscher Seite müsse es gerade hier bessere Angebote geben.
Gleichzeitig bleiben in einer multipolaren Welt neue Konfliktlinien unausweichlich. Mit Blick auf den Gazakrieg hat die Bundesregierung das besonders im südlichen Afrika stark zu spüren bekommen. Anfang des Jahres hatte Namibias kürzlich verstorbener Präsident Hage Geingob Deutschlands Haltung im Gazakrieg scharf kritisiert und dabei auf den deutschen Genozid in Namibia verwiesen. Deutschland habe keine Lehren aus seiner kolonialen Geschichte gezogen, lautete Geingobs Vorwurf.
Retzlaff arbeitet federführend an der Aussöhnung zwischen Deutschland und Namibia und ruft zu Gelassenheit auf – und mehr gegenseitiges Verständnis: “Klar gibt es auch Themen, bei denen unsere afrikanischen Partner und wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Perspektiven haben. Es ist dann besonders wichtig, den jeweils anderen Standpunkt zu verstehen und respektvoll damit umzugehen. Man muss Meinungsverschiedenheiten eben auch mal aushalten.” David Renke
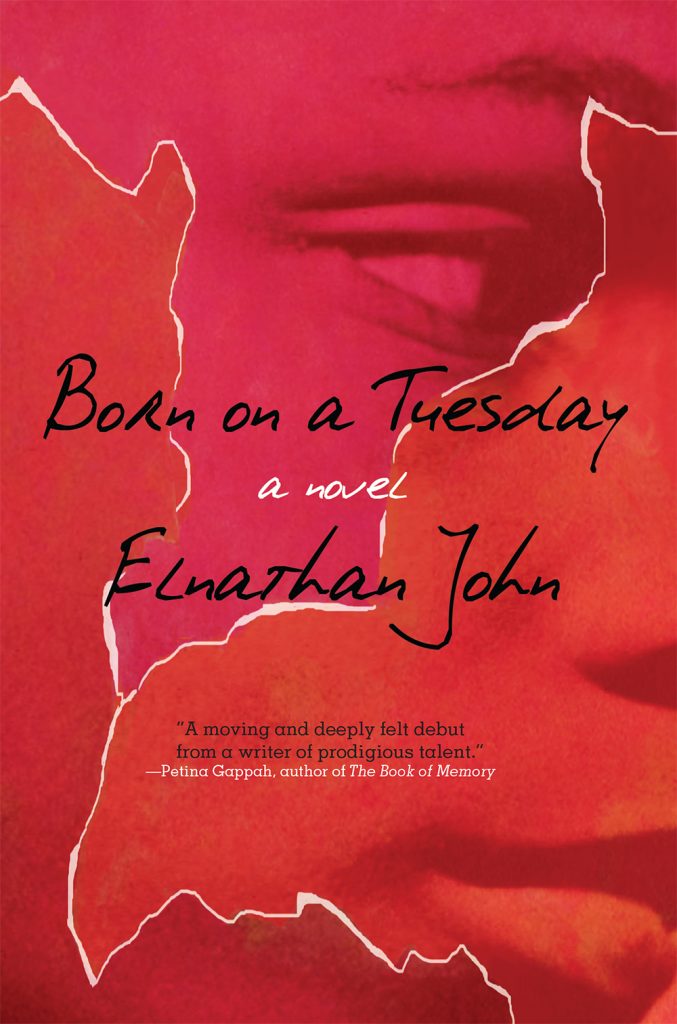
Literatur ist weit mehr als ein Sachbericht, aber sie kann die Leserschaft en passant über Geschichte, Kultur und Politik etwas lehren. Und so lohnt sich eine Lektüre des Debütromans von Elnathan John nicht allein, weil der Norden Nigerias mit zwei Massenentführungen wieder Schlagzeilen macht und es in “Born on a Tuesday” um diese turbulente Region geht. Die Lektüre lohnt sich abseits der Einblicke in religiös-fundamentalistische Tendenzen und die Verstrickung von Religion und Politik, weil “Born on a Tuesday” unter den namenlosen Vielen, die in den Nachrichten auftauchen, eine Geschichte herausgreift und ein fiktives Schicksal plastisch werden lässt.
Dantala heißt der Protagonist – und sein Name ist zugleich ein Nicht-Name. Denn das Wort, das dem Roman seinen Titel gibt, bedeutet: “an einem Dienstag geboren”. In der Ich-Form erzählt Dantala seine Geschichte. Er entwickelt sich vom ahnungslosen, kiffenden Koran-Schüler und bezahlten Schläger zu einem gewissenhaften, reflektierten und gläubigen jungen Mann – unter den Fittichen eines salafistischen Imams. Der wird im Buch zwar als konservativ, aber klug und gerecht dargestellt.
Johns Debütroman (2015), der auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist, versucht nicht, irgendjemanden oder irgendeine Religion zu verteidigen – oder zu verteufeln. Die Stärke von Dantalas Geschichte liegt in der unverblümten Sprache, gleichgültig ob es um Gewalt, die sexuelle Entwicklung des Protagonisten oder die Spannung zwischen muslimischen Glaubenssätzen und der unbarmherzigen Realität geht. John, der seit einigen Jahren in Berlin lebt und als Moderator und Satiriker arbeitet, spiegelt die innere Entwicklung seines Protagonisten in dessen sprachlichem Stil wider. Dantala, obgleich der mit dem Nicht-Namen, wird so für die Leser zu einem Jemanden. lcw
