die Absage der Präsidentschaftswahl im Senegal traf die Weltöffentlichkeit völlig unvorbereitet. Damit sorgt ein weiterer Staat in der Sahelzone für Instabilität – und die europäischen Diplomaten wissen nicht, wie sie mit dieser Krise umgehen sollen. Meine Kollegin Lucia Weiß, die in Dakar lebt und gerade mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Nigeria ist, und ich haben die neue Lage in der Region analysiert.
Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe ist Namibia. Unser Redakteur Arne Schütte hatte schon in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem Afrikawissenschaftler Henning Melber geführt. Darin geht es darum, wie die Bundesregierung immer wieder die Aussöhnung mit Namibia behindert. Und dann ist am Wochenende Staatspräsident Hage Geingob gestorben. David Renke stellt Ihnen seinen Nachfolger Nangolo Mbumba vor.
Darüber hinaus haben wir wieder interessante Analysen, News und viele andere Informationen für Sie zusammengetragen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Die Senegalesen werden sich erinnern, was sie am 3. Februar 2024 um 14 Uhr gemacht haben. Da trat Präsident Macky Sall vor die Mikrofone, mit zwei Stunden Verspätung. Nur wenige Minuten später teilte Sall in seiner Ansprache an die Nation die Verschiebung der Präsidentschaftswahl mit. Sie war für den 25. Februar geplant. Bemerkenswerterweise nahm Sall an keiner Stelle das Wort “reporter” – aufschieben – in den Mund.
Seit Wochen ist die Lage im Land angespannt. Der Oppositionspolitiker und Präsidentschaftskandidat Ousmane Sonko wurde inhaftiert. Lange war auch unklar, ob Macky Sall eine dritte Amtszeit anstrebt. Nur unter Druck hatte er verzichtet.
Und dennoch: Was an diesem Wochenende geschah, ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landes. Im Jahr 1960 löste es sich von Frankreich und wurde rasch ein viel gelobtes Vorbild für ganz Westafrika. Denn trotz aller politischer Krisen hat sich am Ende stets die Demokratie durchgesetzt. Dafür sorgte auch immer wieder der Druck der Straße. So verhinderten Massendemonstrationen im Jahr 2012, dass Salls Vorgänger Abdoulaye Wade für eine dritte Amtszeit antreten konnte.
Doch dieses Mal könnte es anders kommen. Mit Sorge vermerken die Beobachter der Geschehnisse, dass Sall zunächst kein Wort über ein Ersatzdatum verlor. Erst am Montagabend stimmte das Parlament im Senegal laut Berichten von RFI einem Gesetzesvorschlag zu, demnach die Wahlen auf den 15. Dezember verschoben werden. Zuvor soll die Polizei die Oppositionspolitiker des Saales verwiesen haben.
Dass Sall die Wahlen verschiebt, kommt einem politischen Erdbeben für die gesamte Region gleich. Diese ist durch den plötzlichen Austritt der drei Sahelländer Mali, Burkina Faso und Niger aus der Ecowas ohnehin geschwächt. Die Signalwirkung aus dem Senegal könnte noch nicht abzusehende Folgen haben.
Auch ist zu befürchten, dass sich im Senegal der Wettlauf um Rohstoffe wiederholen könnte: Denn vor der Küste des Landes entstehen große Bohrfelder für Erdöl und Erdgas. Die Förderung soll bald beginnen. Der zeitliche Zusammenfall zwischen Wahlaufschub und Beginn der Förderung löst Spekulationen aus. Hat Sall die Wahl abgeblasen, damit kein anderer Wahlsieger Zugriff auf die Rohstofferlöse bekommt?
So hatte die BBC berichtet, dass Macky Salls Bruder von den Funden profitiert. Der Präsident wies die Anschuldigung entrüstet zurück, dass sein Bruder in Korruptionsaffären verwickelt sei. Doch klar ist: Unregelmäßigkeiten sind aufgetreten. Sie sind bis heute nicht aufgeklärt.
Die westlichen Verbündeten Senegals wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Die EU betonte noch Mitte vergangene Woche zum Start ihrer Beobachtermission, wie sehr sie sich über die Demokratie im Senegal freue. “Wahlen sind immer ein bedeutender Tag für die Bevölkerung”, sagte Chefbeobachterin Malin Björk vor der Presse im Radisson Hotel in Dakar. Besorgte Nachfragen wurden diplomatisch weggelächelt, mit dem pauschalen Verweis, dass man auf einen transparenten und fairen Wahlprozess hoffe.
Dabei haben die Wahlbeobachter über Offensichtliches hinweggesehen. Diomaye Faye, der wichtigste Oppositionskandidat der aufgelösten Partei PASTEF, sitzt im Gefängnis – inwiefern unter diesen Umständen eine faire Kampagne möglich gewesen wäre, bleibt offen. Faye war als Ersatzkandidat für den bei der jungen Bevölkerung enorm populären Ousmane Sonko eingesetzt worden. Der wurde nach mehreren Gerichtsverfahren von einer Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen.
Sall begründete die Verschiebung der Wahlen – nur drei Wochen vor dem Termin – mit einem “offenen Konflikt” zwischen Legislative und Exekutive. Die Glaubwürdigkeit der Wahlen sei in Zweifel gezogen worden, sagte Sall in seiner Rede am Samstag. Die Bildung einer Untersuchungskommission sei ein offener Konflikt zwischen den Gewalten des Staates.
Die Bundesregierung zeigte sich ob dieser Entwicklungen alarmiert. “Die Situation im Senegal macht mir im Moment wirklich Sorgen”, sagte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Rande einer Reise nach Nigeria. “Dass die Wahlen jetzt wiederum verschoben wurden, ist kein gutes Signal.” Schulze verwies auf die Reaktion der Afrikanischen Union, die einen Zeitplan für faire und transparente Wahlen eingefordert hatte. “Das ist etwas, was ich unterstütze. Der Senegal ist eine Demokratie, die schon mehrfach Wechsel hatte, und wo das auch gut funktioniert hat. Das muss jetzt auch so weitergehen.”
Auch das Außenministerium teilte am Montag mit, die Situation genau zu beobachten. “Die Senegalesinnen und Senegalesen haben ein Recht, den Wahlprozess fortzusetzen und ihre politische Führung demokratisch zu bestimmen. Wir rufen alle politischen Kräfte dazu auf, diese gerade auch in herausfordernden Zeiten zu wahren”, sagte ein Sprecher des Ministeriums.
Der Senegal ist einer der wichtigsten Partner der Bundesregierung sowie der EU in der Region. So unterstützt Deutschland und Frankreich sowie weitere internationale Partner den Senegal mit einer Just Energy Transition Partnership (JETP). Deutschland ist zudem eines der wichtigsten Geberländer für den Senegal. Im vergangenen Jahr stellte die Bundesregierung laut BMZ 170 Millionen Euro für Entwicklungsprojekte im Senegal zur Verfügung.
Ironischerweise hatten Salls Anhänger auf diesen hingearbeitet, um ihn von einer Verschiebung zu überzeugen, wie Africa Intelligence schreibt. Das Parlament hatte diese Kommission durchgesetzt, um Zweifel an der Auswahl der Präsidentschaftskandidaten auszuräumen. Umstritten war vor allem der Ausschluss von Karim Wade, dem Sohn des ehemaligen Präsidenten Wade, der aus dem Ausland zurückkehrte. Ihm wurde vorgeworfen, eine doppelte Staatsangehörigkeit verschleiert zu haben.
Hinter dem Coup steht laut Africa Intelligence ein Machtkampf: Die Aussichten des Ministerpräsidenten Amadou Ba auf einen Sieg hatten sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Dabei wurde Ba von Noch-Präsident Sall ausgewählt. Besonders Wades Ausschluss brachte politische Solidaritätsverabredungen ins Wanken, die einen Sieg Bas absichern sollten – notfalls in einem zweiten Wahlgang. Zu hoch wurde das Risiko eingeschätzt von Salls Lager, dass Ba von Sonkos Bewegung geschlagen werden könnte.
Bislang sind die Ausschreitungen nach der Ankündigung, die Wahlen zu verschieben, noch vergleichsweise gering. Seit Jahren jedoch geht die Regierung zunehmend repressiv gegen die Opposition und Medien vor. Im vergangenen Jahr belegte der Senegal Platz 104 im Ranking von Reporter ohne Grenzen, das die Medienfreiheit einstuft. 2021 lag das Land noch auf Rang 49. Im März 2021 und Juni 2023 hatte die Regierung Salls zudem Proteste der Sonko-Bewegung blutig niedergeschlagen.
Die Absage der Präsidentschaftswahl im Senegal hat die Bundesregierung – wie auch wahrscheinlich andere Regierungen – unvermittelt getroffen. Ausgerechnet der Senegal. Das Land galt dem Westen stets als stabiles pluralistisches Land, in dem trotz aller Konflikte am Ende immer das Gute, die Demokratie, siegt.
Die Verschiebung einer Wahl ist auch für Afrika ungewöhnlich. Im Jahr 2015 hatte der damalige Präsident Nigerias, Goodluck Jonathan, die Präsidentschaftswahlen verschoben. Er begründete dies mit der schlechten Sicherheitslage im Nordosten aufgrund des islamistischen Terrors von Boko Haram. Doch die Opposition vermutete einen Winkelzug, durch den Jonathan seine Aussichten verbessern wollte. Auch die USA kritisierten den Aufschub.
Doch die für den 14. Februar 2015 vorgesehene Wahl fand sechs Wochen später am 28. und 29. März 2015 statt. Muhammadu Buhari, der schon von 1983 bis 1985 Präsident war, vereinte 53,96 Prozent der Stimmen auf sich. Jonathan gab sich klaglos geschlagen.
Im Senegal ist die Lage anders. Sall hat die Wahl abgesagt, ohne zunächst ein neues Datum zu nennen. Erst am Montag stimmte das Parlament unter Ausschluss der Opposition einer Wahlverschiebung bis Mitte Dezember zu. Die Begründung hat dennoch weit weniger Gewicht als vor neun Jahren in Nigeria. Damit steht die Vermutung im Raum, dass Sall einen Staatsstreich durchführen will, den Versuch, die Kontrolle über das Land zu übernehmen und die Instanzen der senegalesischen Demokratie bis auf Weiteres auszusetzen.
Auf einen Rückzug aus der Politik hatte der 62 Jahre alte Politiker bisher ohnehin keine Lust. Lange haderte er mit sich und strebte lange eine dritte Amtszeit an, die nach der Verfassung verboten wäre. Erst unter starkem Druck von allen Seiten schob Sall seinen Premierminister Amadou Ba vor.
Der Senegal zählt nur rund 18 Millionen Einwohner und ist mit knapp 200.000 Quadratkilometern nur etwas mehr als halb so groß wie Deutschland. Doch wirtschaftlich hat das Land Gewicht in der Region. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag Ende 2022 bei 27,7 Milliarden Dollar und liegt somit bei rund 1538 Dollar je Kopf. Damit ist der Senegal eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder in Westafrika und schließt zu den größeren Wirtschaftsnationen auf dem Kontinent auf. In Kenia liegt das BIP bei etwas mehr als 2000 Dollar je Kopf.
Auch bei den westlichen Gläubigern genießt der Senegal Ansehen. Die Ratingagentur Moody’s setzt das Credit Rating seit vielen Jahren auf Ba3 mit stabilem Ausblick und bestätigte die relativ gute Bonitätseinschätzung noch Mitte Dezember. S&P stuft Senegal seit mehr als 20 Jahren auf B+ mit stabilem Ausblick ein. Bisher haben beide Ratingagenturen keine Revision der Kreditwürdigkeit aufgrund der jüngsten Ereignisse angekündigt.
Wegen seiner politischen und wirtschaftlichen Stabilität spielt der Senegal eine wichtige, stabilisierende Rolle in der Sahelzone. Die gesamte Region vom Atlantik bis zum Mittelmeer und zum Roten Meer droht eine failed region zu werden. Libyen, Mali, Burkina Faso, Niger, die Zentralafrikanische Republik und der Sudan gelten schon als gefallene Staaten. Der Tschad und Mauretanien sind zumindest fragil.
Damit droht ein Zerfall der Staatlichkeit in einer Region, die größer ist als die gesamte Europäische Union und die politisch, wirtschaftlich und militärisch eine immer wichtigere Rolle spielt. Im Boden des Sahels liegen viele Rohstoffe, die Europa für die Energiewende braucht. Doch die legitimen Zentralregierungen kontrollieren nur noch einen kleinen Teil ihres Territoriums. Stammesfürsten, Warlords, islamistische Terrorgruppen oder auch kriminelle Bandenführer haben in weiten Teilen der Sahelzone weitgehend das Sagen. Sie finanzieren sich aus Rohstoff- und Goldvorkommen, aus dem Drogenschmuggel zwischen Lateinamerika und Europa sowie auch immer wieder aus Geiselnahmen.
Ein Zerfall des Staates droht im Falle Senegals nicht. Dagegen spricht schon, dass das Land historisch gefestigt ist. Staaten wie das Königreich Namandirou, das der Djolof oder das Ghana-Reich reichen zum Teil bis ins achte Jahrhundert zurück. Hinzu kommt, dass der Islam in seiner westafrikanischen Ausformung mit seinen einflussreichen Sufi-Brüderschaften Zusammenhalt in der Gesellschaft schafft. So hat die Mouridiyya mit seinem aktuellen Kalifen Serigne Mountakha Mbacké eine Bedeutung im Senegal, die kein Präsident ignorieren kann.
Doch für die Bundesregierung wie für Frankreich und die Europäische Union bricht ein weiteres Land weg, das sie zur “Vorzeigedemokratie” stilisiert hatten. Und genauso wie im Fall Nigers bricht dieses Narrativ nun zusammen.
Damit zeigt sich wieder, dass die Gleichung der deutschen Außenpolitik “Entwicklungshilfe schafft Stabilität und Demokratie” in der Sahelzone gescheitert ist. Rund 740 Millionen Euro deutsche Entwicklungshilfe flossen seit 2019 an Senegal, allein 170 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Ein Schwerpunkt dabei sind erneuerbare Energie im Rahmen der Just Energy Transition Partnership.
Diplomaten wie Entwicklungspolitiker müssen sich jedoch mit dem Gedanken anfreunden, dass sie sich in dieser Region zunehmend mit Regimen arrangieren müssen, die weder demokratisch legitimiert sind noch ihr Land wirklich kontrollieren.
Die deutschen Außenpolitiker müssen ein Konzept finden, dass es ihnen ermöglicht, jenseits der Orientierung an demokratischen Werten die Beziehungen zu dieser Region nicht ganz zu verlieren. Diese Krise der Diplomatie trifft nicht Deutschland allein. Die Afrika-Strategie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist weniger als ein Jahr alt und scheint heute aus einer anderen Zeit zu sein.
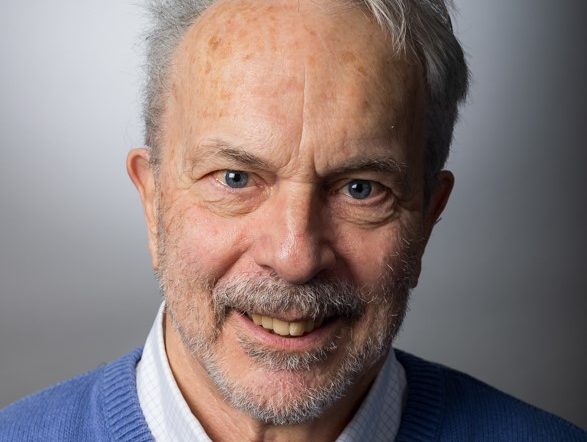
Professor Melber, im Prozess gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) will Deutschland an Israels Seite als Drittpartei intervenieren. Diese Nachricht hat in Namibia scharfe Reaktionen hervorgerufen. Der am Wochenende verstorbene Präsident Geingob warf Deutschland vor, Völkermord in Gaza zu unterstützen. Deutschland sei unfähig, aus der eigenen Geschichte zu lernen. Hat Sie die Härte der namibischen Reaktion überrascht?
Inhaltlich war diese Reaktion nicht überraschend, aber der sehr undiplomatische Ton hat mich doch erstaunt. Das zeigt deutlich den Ärger, den die am 12. Januar von Deutschland abgegebene Erklärung ausgelöst hat. An diesem Tag vor 120 Jahren begann der bewaffnete Widerstand der Herero, der im ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts endete. Dass das von deutscher Seite mit keinem Wort reflektiert wurde, zeugt von einer großen Unsensibilität, ja geradezu Ignoranz, gegenüber den Nachfahren der Opfer.
Und der Fauxpas vom 12. Januar ist längst kein Einzelfall: Zwei Wochen später, am Holocaust-Gedenktag, setzte sich die deutsche Botschaft in Windhoek mit einem Social-Media-Post ins nächste Fettnäpfchen. Der Opfer des Holocaust zu gedenken, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber auf den gleichen Tag fällt auch die erste Schließung deutscher Konzentrationslager im Land 1908 – von der Botschaft wird dies mit keinem Wort erwähnt. Ob Unwissenheit oder mangelnde Empathie, so kann eine deutsche Botschaft in Namibia nicht agieren.
Welche Reaktionen löst das in Namibia aus?
Die Menschen fühlen sich verletzt, gedemütigt und beleidigt. Vielleicht würde man auf deutscher Seite sagen: Stellt euch nicht so an, die Absicht war doch integer. Aber das verkennt völlig die Gefühle auf der namibischen Seite.
Es fängt schon damit an, dass Deutschland den Völkermord zwar eingesteht, dann aber die Form der Entschuldigung zum Verhandlungsgegenstand macht. Das ist aus Sicht der Nachfahren ein absoluter Affront.
Wer die deutsche Geschichte von innen her kennt und um die Befindlichkeiten weiß, der kann versuchen, zu verstehen und zu erklären. Das gilt aber nicht für jene, die diese Geschichte nur bedingt kennen. Sie wissen nicht um das Trauma derjenigen, die seit dem Holocaust in Deutschland geboren wurden und jetzt auch in der Politik maßgebliche Verantwortung tragen.
Ebenso wenig können die Deutschen verstehen, was in den Namibiern vorgeht, wenn diese mit der Relativierung des deutschen Genozids in Namibia konfrontiert werden. Das sind sozusagen zwei Puzzleteile, die sich gegenteilig gegenüberstehen.
Deutschland hat 2015 den Vorwurf des Völkermords akzeptiert. Ist das kein Fortschritt in der Aussöhnung?
Ja, Deutschland hat zugegeben, in Namibia einen Genozid verübt zu haben. Allerdings mit dem Zusatz “aus heutiger Sicht”, was nach namibischer Einschätzung eine weitere Relativierung ist. Begründet wird das mit dem Prinzip der Intertemporalität: Da der Genozid-Begriff erst mit der UN-Konvention von 1948 ins Völkerrecht einging, sei er im Fall Namibia nicht anwendbar.
Das ist allerdings eine sehr opportunistische Auslegung, denn auch der Holocaust wurde ja vor 1948 verübt. Und das führt natürlich in Namibia zu der Wahrnehmung: Ihr behandelt uns anders als die Opfer des Holocaust, den ihr auch begangen habt. Zugespitzt formuliert: Ihr diskriminiert uns rassistisch.
Hat der Vorfall also die Bemühungen der letzten Jahre um eine Aussöhnung zunichtegemacht?
Ich befürchte, ja. Offenbar stand man nach Nachverhandlungen im Dezember kurz vor einer Einigung. Die Rede war davon, die Kompensationsleistungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro um vermutlich eine weitere Milliarde zu erhöhen, davon, dass der Zuwendungszeitraum verkürzt wird, und dass die Begünstigten auch in der Diaspora leben können.
Doch nach der scharfen Kritik von Präsident Geingob scheint es sehr fraglich, dass die namibische Regierung eine gemeinsame Erklärung ohne Gesichtsverlust unterzeichnen kann. Geingobs Statement hat im Land große Zustimmung gefunden. Es fördert die antideutschen Ressentiments, die jederzeit abrufbar sind, insbesondere in einem solchen Fall.
Grundsätzlich fühlen sich viele Länder im Globalen Süden zunehmend brüskiert von der Doppelmoral des Westens. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Doppelmoral keinesfalls das Exklusivrecht des Westens ist, sondern leider in zunehmendem Maße die Außenpolitik fast aller Staaten charakterisiert. Das ändert aber nichts daran, dass die Ressentiments der Staaten des Globalen Südens weiter verfestigt werden.
Am 26. Januar hat der IGH Israel angeordnet, alle Handlungen zu verhindern, die als Völkermord betrachtet werden könnten. Welche Rolle spielt der IGH-Beschluss im deutsch-namibischen Streit?
Natürlich fühlt sich Namibia durch das Urteil bestätigt. Mit der gemeinsamen Erklärung zur Aussöhnung wird es allerdings kaum in Verbindung gebracht.
Ich denke, die Erklärung liegt erst einmal auf Eis. Die namibische Regierung wird sich überlegen, wie sie damit umgeht. Sie hat weitere Zugeständnisse ausgehandelt, weiß aber, dass das nicht die Kritik zum Verstummen bringt. Ich vermag nicht zu prognostizieren, zu welchem Ergebnis sie kommen wird und ob der plötzliche Tod Geingobs am 4. Februar die Sachlage ändert. Nangolo Mbumba war als Vize-Präsident mit der Aufsicht über die Verhandlungen betraut. Als nun wohl amtierender Präsident, der auch Gespräche mit den Ovaherero und Nama führte, hat er sicher ein gewichtiges Wort.
Wie lässt sich der deutsch-namibische Disput beilegen?
Wenn ich das wüsste, dann wäre ich vielleicht ein Diplomat. Ich denke, die beste Lösung wäre eine, die nicht von Deutschland kommt, sondern von Namibia. Das Land sollte darauf drängen, dass die in acht Jahren ausgehandelte Erklärung im augenblicklichen Kontext nicht adäquat ist und sich stattdessen um neue Verhandlungen bemühen.
Dann sollten auch die Vertretungen der Herero und der Nama mit am Tisch sitzen. Es wäre eine wichtige psychologische Komponente, dass die Nachfahren der Opfer dieses Genozids Auge in Auge mit den Nachfahren der Täter verhandeln. Ein solcher Neubeginn, der versucht, aus den Fehlern der letzten Jahre zu lernen, könnte eine historische Chance sein.
Henning Melber ist Politikwissenschaftler, Entwicklungssoziologe und Afrikawissenschaftler. Als Sohn deutscher Einwanderer kam er 1967 als Jugendlicher nach Namibia. 1974 trat er der Befreiungsbewegung SWAPO bei. Heute forscht er am Nordischen Afrika-Institut in Uppsala (Schweden). Zur Jahresmitte erscheint sein Buch “The Long Shadow of German Colonialism” im Londoner Verlag Hurst.
Die Wirtschaft in Subsahara-Afrika wird nach der jüngsten Prognose des IWF in diesem Jahr um nur 3,8 Prozent wachsen. Zuvor lag die Erwartung bei 4,0 Prozent. Dies geht aus dem jüngsten World Economic Outlook des IWF hervor. Die Senkung der Prognose ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die IWF-Volkswirte in Südafrika mit einer Abschwächung des Wachstums rechnen. Sie bemängeln “zunehmende logistische Einschränkungen für die Wirtschaftstätigkeit, vor allem im Transportwesen”.
Für Subsahara-Afrika dürfte das Wachstum im vergangenen Jahr bei 3,3 Prozent gelegen haben. Bis Ende 2024 könnte es auf 4,1 Prozent steigen. Damit liegen die Aussichten für den Kontinent zwar über dem globalen Durchschnitt. Doch liegt die Steigerung der Wirtschaftsleistung unter dem Wert, den der Kontinent erreichen müsste, um das Bevölkerungswachstum aufzufangen und eine positive Entwicklung auszulösen.
Dass es auch anders geht, zeigt die Region Emerging and Developing Asia. Zu dieser zählt der Währungsfonds unter anderem auch die beiden wirtschaftlichen Schwergewichte China und Indien. Emerging and Developing Asia erreichte laut IWF im vergangenen Jahr eine Wirtschaftssteigerung von 5,4 Prozent und könnte in diesem Jahr 5,2 Prozent erreichen.
Nicht nur in Südafrika – auf dem gesamten Kontinent leidet die Wirtschaft unter den zahlreichen Engpässen, die durch eine mangelnde Infrastruktur bedingt sind. Dadurch ist die Produktivität großer Teile der afrikanischen Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig. So beklagte jüngst auch Thomas Schäfer, CEO der Marke VW im Konzernvorstand des Autoherstellers, dass die VW-Fabrik in Südafrika angesichts der vielen Engpässe in der südafrikanischen Wirtschaft gegenüber den anderen VW-Werken nicht wettbewerbsfähig sei. VW unterhält seit 1951 ein Werk in Kariega in der Provinz Ostkap, das heute 3500 Menschen beschäftigt. Dort werden Motoren sowie die Modelle Polo Vivo, Polo und Polo GTI gefertigt. VW hat nach eigenen Angaben in Südafrika einen Gesamtmarktanteil von gut 22 Prozent.
Südafrika war lange der Wachstumsmotor des gesamten Kontinents. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Im Jahr 2022 lag die Wachstumsrate bei enttäuschenden 1,9 Prozent. Im vergangenen Jahr dürfte sie weiter auf 0,6 Prozent gefallen sein und in diesem Jahr laut IWF auf 1,0 Prozent nur leicht erholen. Für das kommende Jahr dürfte sich die Wirtschaftsleistung zwar auf 1,3 Prozent steigern, doch weiterhin unter dem Wert von 2022 liegen. Diese Wachstumsraten liegen weit unter dem Niveau, das Südafrika benötigt.
Nigeria dürfte in diesem Jahr 3,0 Prozent nach 2,8 Prozent im vergangenen Jahr erreichen. Wegen des starken Gewichts des Exports von Mineralöl und Erdgas hängt die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stark an den Weltmarktpreisen für Energie. Für Rohöl rechnet der IWF, dass die Notierungen in diesem Jahr 2,3 Prozent sinken nach einem Rückgang von 16 Prozent im vergangenen Jahr. Um den Zustand der nigerianischen Wirtschaft wirklich beurteilen zu können, müsste der Öl- und Gassektor aus dem BIP herausgerechnet werden. Leider nimmt der IWF diese Berechnungen nicht vor.
Das globale Wachstum schätzt der IWF für 2023 auf 3,1 Prozent. In diesem Jahr wird es voraussichtlich auf diesem Niveau bleiben. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber der Prognose vom Oktober, als die IWF-Volkswirte ein Weltwirtschaftswachstum von 2,9 Prozent erwartet hatten. Vor allem für die USA und China rechnen die Ökonomen in Washington mit einer stärkeren Erholung. Dennoch bleibt die Prognose unter dem langjährigen Durchschnitt für die Jahre 2000 bis 2019, als 3,8 Prozent jährlich erreicht worden sind.
Auch der Welthandel wird wachsen, aber unter seinem Trendwachstum bleiben. Für 2024 und 2025 rechnet der IWF mit 3,3 Prozent und 3,6 Prozent, während der langjährige Durchschnitt 4,9 Prozent beträgt. “Zunehmende Handelsverzerrungen und eine geoökonomische Fragmentierung werden voraussichtlich den Welthandel belasten”, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2022 haben die unterschiedlichen Länder 3.222 neue Handelsbeschränkungen eingeführt. 2023 waren es rund 3.300, während die Zahl im Jahr 2019 bei nur etwa 1.100 lag.
Der französische Fernsehsender Canal+ stößt auf Hindernisse bei der Übernahme des südafrikanischen Medienunternehmens MultiChoice. Ein von Canal+ vergangenen Donnerstag unterbreitetes Angebot hat MultiChoice abgelehnt. Der angebotene Kaufpreis lag bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Zu MultiChoice gehört der Video-on-Demand-Anbieter Showmax und vor allem DStv, der derzeit mit fast 90 Prozent Marktanteil wichtigste Pay-TV-Sender in Afrika. DStv überträgt auf dem Kontinent über Super Sport auch europäischen Livefußball, wie die Bundesliga oder die englische Premier League.
Canal+, ein Tochterunternehmen des französischen Medienkonzerns Vivendi, ist weniger am florierenden südafrikanischen Markt interessiert als an Expansionsmöglichkeiten auf dem Kontinent. Dazu braucht es MultiChoice. Derzeit ist Canal+ in 25 Ländern vertreten, hauptsächlich im frankophonen Afrika, wo es der stärkste Anbieter ist. Nun wirft der Sender ein Auge auf den englischsprachigen Teil des Kontinents, etwa auf Nigeria und Kenia.
Canal+ zählt rund acht Millionen Kunden in Afrika, MultiChoice 23,5 Millionen. Das südafrikanische Unternehmen verbessert gerade seinen Streaming-Service Showmax mit noch mehr Livefußball, lokalen Programmen und US-Serien. Showmax gehört zu einem Drittel dem US-Medienunternehmen Comcast, der Muttergesellschaft von NBC Universal und Sky in Großbritannien.
Die Offerte von Canal+ kam nach einem Jahr intensiver Verhandlungen. Zum Zeitpunkt des Angebots gehörten Canal+ 31,7 Prozent der MultiChoice-Aktien. Mittlerweile sind es mehr als 35 Prozent. Die Franzosen haben den MultiChoice-Aktionären 105 Rand (5,14 Euro) je Aktie angeboten. Das sind rund 40 Prozent über dem Vortagswert von 75 Rand. Das allerdings war dem Vorstand von MultiChoice zu wenig.
Aus Sicht von Canal+ wird die Medienbranche globaler und wettbewerbsintensiver. Wachsen oder untergehen lautet demnach die Alternative: “Damit MultiChoice in Afrika weiterhin erfolgreich sein kann, bedarf es einer Strategie, die seinen Umfang erweitert und die lokale und globale Expertise stärkt”, meint Maxime Saada, CEO von Canal+. “Zusammen mit Canal+ hätte MultiChoice die Ressourcen, in lokale afrikanische Talente und Geschichten sowie erstklassige Technologie zu investieren, um in Afrika zu wachsen und mit den globalen Streaming-Mediengiganten zu konkurrieren.”
Auch MultiChoice sieht Vorteile in einem Zusammenschluss und spricht von “erheblichen Synergien”. Das Management zögert jedoch. “Die Bewertung von MultiChoice schließt mögliche Synergien aus, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben könnten”, heißt es in einer Stellungnahme von MultiChoice. “Diese Synergien müssen in jedem fairen Angebot von Canal+ berücksichtigt werden.”
Das Unternehmen ist im Besitz des börsennotierten südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. In den sechs Monaten von März bis September 2023 verbuchte MultiChoice fünf Prozent weniger Einkommen aus seinem Kerngeschäft. Finanzschwache Konsumenten und die Konkurrenz von Anbietern wie Netflix, Amazon und Disney machen MultiChoice zu schaffen.
Marktkenner gehen davon aus, dass MultiChoice eher eine intensivere Kooperation mit Comcast anstrebt. Zudem gibt es für Canal+ eine hohe Hürde: Südafrikanisches Recht verbietet es, dass ausländische Unternehmen mehr als 20 Prozent der Stimmrechte an einem einheimischen Medienunternehmen halten. Bei der Zahl der Anteile hingegen gibt es keine Beschränkungen.
Für Peter Takaendesa von der Fondsgesellschaft Mergence Investment Managers könnte eine Lösung sein, dass Canal+ durch Aktionärsvereinbarungen faktisch die Kontrolle erlangt. “Die Parteien dieser Transaktion brauchen einander im Kampf gegen globale Streaming-Giganten, da sie Inhalte und Finanzkraft nutzen können.” Auch steht die Zustimmung der Wettbewerbskommission aus. In jüngster Vergangenheit hat sie im digitalen Sektor energischer gehandelt.
Der Bund hat im vergangenen Jahr Exporte im Wert von 18,4 Milliarden Euro mit Kreditgarantien abgesichert. Gefördert worden seien unter anderem Projekte in den Bereichen Wind- und Solarenergie sowie grüner Wasserstoff, teilte das Grünen-geführte Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. 2022 waren es früheren Angaben zufolge 14,9 Milliarden Euro.
Gut 80 Prozent der 2023 abgesicherten Geschäfte entfielen auf Schwellen- und Entwicklungsländer, so das Wirtschaftsministerium weiter. “Viele Geschäfte in diesen Ländern lassen sich nur mit staatlicher Unterstützung realisieren.” Gemessen am Volumen lagen Geschäfte mit der Türkei (2,79 Milliarden) ganz vorne. Auf Platz zwei und drei folgten 2023 allerdings mit Ägypten (2,49 Milliarden) und Angola (2,01 Milliarden) Euro zwei afrikanische Länder. Mexiko (1,21 Milliarden) und Saudi-Arabien (1,15 Milliarden) belegten Rang vier und fünf.
Zum Schutz deutscher Auslandsinvestitionen gegen politische Risiken wurden 2023 Garantien im Umfang von 1,5 Milliarden Euro (2022: 2,3 Milliarden Euro) übernommen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Zwei Drittel hätten erstmals eine Garantie erhalten, 70 Prozent der genehmigten Anträge entfielen auf kleine und mittelständische Unternehmen. Gemessen am Volumen ging es vor allem um Investitionen in Peru (880 Millionen Euro), Ägypten (265 Millionen), China (71 Millionen), Namibia (60 Millionen) und die Ukraine (55 Millionen).
Das Wirtschaftsministerium will bei seinen Exportgarantien mit verbesserten Konditionen gezielt Projekte unterstützen, die einen strategischen Wert haben, etwa bestimmte Lieferketten absichern oder die Rohstoff- und Energieabhängigkeit Deutschlands verringern. Auch beim Klimaschutz seien bessere Konditionen möglich. rtr/dre
Der Handel zwischen Afrika und China stieg 2023 auf einen neuen Rekord von 282,1 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 100 Millionen US-Dollar oder 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtete der englischsprachige chinesische Nachrichtensender CGTN mit Berufung auf das Handelsministerium der Volksrepublik China. Das Reich der Mitte ist demnach seit 15 aufeinanderfolgenden Jahren Afrikas größter bilateraler Handelspartner.
China exportierte 2023 Waren im Wert von 173 Milliarden US-Dollar nach Afrika, ein Zuwachs von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum importierte China Waren aus Afrika im Wert von 109 Milliarden US-Dollar, 6,7 Prozent weniger als 2022. Jedoch stieg das Handelsdefizit von Afrika gegenüber China von 46,9 Milliarden US-Dollar auf 64 Milliarden US-Dollar. Das bescheidene Wachstum des Handels mit Afrika ist auch ein Ausdruck des globalen Handels von China, das mit wirtschaftlichen Herausforderung zu kämpfen hat, darunter eine schwächelnde Wirtschaft und verhaltene globaler Nachfrage. Der Wert des gesamten Welthandels Chinas sank 2023 um fünf Prozent auf 5,93 Billionen US-Dollar. Auch bei Chinas wichtigsten Partnern in Afrika – Südafrika, Angola, Nigeria, Ägypten und der Demokratischen Republik Kongo – nahm der Handel ab, was mit sinkenden Rohstoffpreisen und verlangsamter Nachfrage aus China zusammenhängt. Das Handelsdefizit für Afrika möchte China mit vermehrten Agrarimporten aus Afrika auffangen.
Vertreter des Ministeriums hoben bei der Präsentation der Handelszahlen auch die Erfolge einer Pilotzone in der zentralchinesischen Provinz Hunan für das umfassende Wirtschafts- und Handelskooperationsprogramm zwischen China und Afrika hervor. So sollen die industriellen Vorteile der Region voll ausgeschöpft und ein Experimentierfeld für die lokale Zusammenarbeit mit Afrika geschaffen werden. “Bis 2027 soll die Pilotzone für vertiefte Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und Afrika zu einer offenen Kooperationsplattform mit globalem Einfluss werden”, so Jiang Wei, Direktor der Abteilung für Westasien und Afrika. “Bis 2035 wird sie hoffentlich zu einer Plattform mit umfangreichen Ressourcen und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.” Weitere Maßnahmen für die verbesserte Zusammenarbeit mit Afrika sollen in digitaler Wirtschaft und internationaler Logistik umgesetzt werden. as
Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sieht die Verzögerung bei der Verabschiedung der EU-Lieferketten-Richtlinie als Chance für die europäische Wirtschaft. “Viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, sehen durch die nationale und europäische Lieferkettengesetzgebung zusätzliche Risiken, Kosten und Bürokratie auf sich zukommen, wenn sie in Märkten außerhalb Europas aktiv werden”, sagte Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, laut einer Mitteilung, die Table.Media vorab vorliegt.
Die FDP hatte Ende vergangener Woche erklärt, den auf EU-Ebene bereits ausgehandelten Gesetzesentwurf zu einer EU-Lieferketten-Richtlinie nicht mittragen zu wollen. FDP-Justizminister Marco Buschmann bezeichnete diesen als “unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen”. Entwicklungsministerin Schulze hatte das Lieferkettengesetz hingegen verteidigt.
Laut dem Afrika-Verein könnten europäische Unternehmen mit der Lieferkettenverordnung in seiner jetzigen Gestaltung speziell in Afrika nicht mit anderen globalen Wettbewerbern konkurrieren, die mit deutlich niedrigeren Standards operieren. “Deshalb muss dringend darauf geachtet werden, dass Haftungsrisiken begrenzt und kostentreibende Bürokratie vermieden werden. Europäische Lieferkettengesetzgebung darf nicht dazu führen, dass wir im Ergebnis vor Ort mehr Kinderarbeit, niedrigere Sozialstandards und weniger Rücksicht auf Umwelt- und Klimaaspekte sehen”, so Kannengießer weiter. dre
Der kenianische Mobilfunkanbieter Safaricom, der dank M-Pesa ein führender Zahlungsverkehrsabwickler in Ostafrika ist, belastet derzeit die Aktienkurse an der Börse Nairobi. Seit Jahresanfang hat der marktbreite Aktienindex NSE ASI in Euro gerechnet rund 3,8 Prozent verloren. Die Safaricom-Aktie liegt seit Anfang 2024 mit 2,9 Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten summieren sich die Kursverluste auf 44,9 Prozent.
Dabei hatte sich die Börse Nairobi im Januar gut entwickelt. Die Banken Equity und Diamond Trust Kenya sowie der Zementhersteller Bamburi zogen die Notierungen nach oben. Doch die Verluste der Safaricom-Aktien wiegen schwer, macht das Unternehmen doch mit einem Börsenwert von umgerechnet 3,1 Milliarden Euro mehr als zwei Drittel der Marktkapitalisierung an der Börse Nairobi aus.
Vor allem der Markteinstieg in Äthiopien bereitet Safaricom so große Schwierigkeiten, dass bisher kein anderer Telekom-Anbieter den Kenianern nach Äthiopien gefolgt ist und den Staatskonzern Ethio Telecom herausfordern wollte.
Dabei warb die äthiopische Regierung um ausländische Investoren ursprünglich mit zollfreien Importen von Investitionsgütern und befristeten Steuerbefreiungen. Doch heute steht die Telekommunikation nicht mehr auf der staatlichen Liste der Investitionsbereiche, die Anspruch auf diese Steueranreize haben.
Seit Montag, 5. Februar, können zudem Safaricom-Kunden nicht mehr Geld von ihrem M-Pesa-Konto an Empfänger senden, die nicht bei Safaricom registriert sind – eine Kampfansage an die Konkurrenten Airtel und T-Kash. Es ist offen, wie diese Auseinandersetzung ausgeht. hlr

Deutschland werde künftig große Mengen Wasserstoff benötigen und viel davon auch aus Afrika importieren, so der Bundeskanzler im Herbst 2023 auf dem “Compact with Africa”-Gipfel in Berlin. Tatsächlich wären wir schlecht beraten, nur auf Partnerschaften mit den industrialisierten Ländern des “Globalen Nordens” zu setzen, um unseren Importbedarf zu decken und die Klimaziele zu erreichen. Denn ob wir die Klimakrise in den Griff bekommen, hängt auch davon ab, ob der afrikanische Kontinent die Schlüsselrolle spielen wird, die ihm zukommt.
Noch ist der CO₂-Ausstoß des Kontinents minimal, doch Afrikas Bevölkerungszahl wächst weiter und wird 2030 prognostizierte 1,7 Milliarden erreichen. Vielen Menschen wird dann noch immer der Zugang zu grundlegender Versorgung mit Elektrizität fehlen. Ohne attraktivere Alternativen werden die Regierungen Afrikas den Energiebedarf also auch aus fossilen Quellen decken – solange nötig. Für den Kampf gegen die Klimakrise und die etwas sperrig als “globale Transformation” bezeichnete wirtschaftliche Zeitenwende bedeutet das: Nicht Afrika braucht uns, sondern wir brauchen Afrika.
Sonne und Wind sind auf dem Kontinent im Übermaß vorhanden. Doch um fossile Energieträger restlos zu ersetzen, braucht es auch eine Alternative, grüne Energien zu speichern und zu transportieren. Diese Alternative ist der grüne Wasserstoff und seine Derivate. Kein Land mit Entwicklungsambitionen wird in Zukunft an der Wasserstofftechnologie vorbeikommen. Nur sie ermöglicht die Dekarbonisierung von Sektoren wie der Stahlindustrie und ermöglicht die Teilnahme am Energiemarkt der Zukunft.
Begreifen wir das als Chance: Der Wasserstoffhochlauf ermöglicht einen Markt mit viel mehr Akteuren und sehr viel fairerem Wettbewerb als bisher – und damit vielleicht einen noch größeren Entwicklungsfortschritt als das fossile Zeitalter.
Allein in Westafrika ist das Potenzial für grünen Wasserstoff mit bis zu 165.000 TWh jährlich 110-mal so groß wie der voraussichtliche Importbedarf Deutschlands im Jahr 2050. Zwar können und sollen nicht alle Länder Afrikas zu Exportnationen für Wasserstoff werden, aber mit ihrem Ressourcenreichtum entlang der H2-Lieferkette wären viele Länder natürliche Gewinner einer globalen Energiewende – wenn sie miteinbezogen werden.
Die genaue Ausgestaltung der Anlagen sollten wir dem Markt überlassen. Doch es ist Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen für private Investitionen zu verbessern. Der nötige Aufbau von Infrastruktur ist ohne umfangreiche Entwicklungszusammenarbeit nicht zu erreichen. Es werden neue Straßen, Häfen und Städte an Orten entstehen – so wie in dem kleinen Ort Lüderitz in Namibia. Dort soll sich die Einwohnerzahl mittelfristig verzehnfachen. Schon heute zieht der Ort Menschen in Aussicht auf Anstellung an.
All das muss auch zu einem Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit führen. Allzu häufig verharrt unsere Politik noch in zu vielen kleinen Projekten. Wir müssen unsere Scheu vor großen wirtschaftlichen Kooperationsprojekten verlieren und uns fragen, wie wir große Projekte wie Wasserstofffabriken oder Schiffsterminals so begleiten, dass sie Wohlstand und Wertschöpfung vor Ort auch für die Ärmsten der Gesellschaft garantieren. Ohne staatliche Absicherung, vielleicht sogar direkte Beteiligung auf beiden Seiten, wird das nicht funktionieren.
Dabei geht es nicht darum, einseitig die Bedürfnisse Europas zu befriedigen, sondern darum, gemeinsam eine neue Kooperationsebene für klimaresiliente Entwicklung zu erreichen. Es wäre klug, den Staaten des “Globalen Südens” ein überzeugendes Angebot zu machen, die Herausforderungen der Menschheit gemeinsam anzugehen und zu lösen.
Wenn diese Angebote gut ausgestaltet sind und Entwicklungspolitik diese Rolle bekommt, können “Energiepartnerschaften” echte Triple-Win-Chancen sein: für die Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit, unsere nationalen Klimaziele und die Bewältigung der Klimakrise weltweit. Doch die Zeit ist knapp und die Fehler der Vergangenheit können wir uns nicht mehr leisten. Von Anfang an müssen alle mit an Bord sein und “on the go” miteinander und voneinander lernen.
Till Mansmann ist entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Seit August 2022 ist Mansmann zudem Innovationsbeauftragter “Grüner Wasserstoff” im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
The Namibian: Präsident Geingob verstorben – Vize Mbumba übernimmt. Namibias Präsident Hage Geingob ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, nachdem er von einer Reise zur Krebsbehandlung aus den Vereinigten Staaten wiedergekehrt war. Vizepräsident Nangolo Mbumba wird die Amtsgeschäfte bis zum Ende von Geingobs Amtszeit im März 2025 übernehmen, sich dann aber selbst nicht zur Wahl stellen. Mbumba sagte, es sei beruhigend zu sehen, dass das Land in dieser schweren Zeit ruhig und stabil bleibe.
BBC: Drei Tote, Hunderte Verletzte nach Gasexplosion in Nairobi. Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist am Donnerstagabend im Bezirk Embakasi der kenianischen Hauptstadt explodiert. Der Lkw stand auf dem Parkplatz eines illegalen Gaswerks. Drei Anträge auf Baugenehmigung für den Bau einer Lager- und Abfüllanlage an diesem Standort waren abgelehnt worden, so die Aufsichtsbehörde Epra. Noch ist unklar, wie die Anlage dennoch in Betrieb sein konnte.
The Standard: Ruto – Ich werde gegen den Besitzer der Gasanlage vorgehen. Der kenianische Präsident William Ruto hat versprochen, entschieden gegen den Eigentümer der illegalen Flüssiggas-Anlage (LPG) vorzugehen. Die Explosion tötete mindestens drei Menschen. Mehr als 300 Menschen und Hunderte Bewohner des Mradi Estate im Bezirk Embakasi East wurden verletzt.
Wall Street Journal: Unrwa, Hamas und die “Völkermord”-Verleumdung gegen Israel. Südafrikas Gerichtsprozess vor dem Internationalen Gerichtshof gegen basiere auf Berichten von Gruppen mit Verbindungen zu Terrororganisationen, schreibt Naftali Balanson in einem Gastbeitrag. Der Autor ist Chief Operating Officer der Organisation NGO Monitor.
The East African: Versicherer distanzieren sich von EACOP. Insgesamt 28 Versicherer haben bisher erklärt, dass sie die East African Crude Oil Pipeline nicht versichern werden. Dies ist eine Reaktion auf die Kritik von Umweltaktivisten an dem Projekt. Nach Ansicht von Experten steht das Projekt damit auf der Kippe, da die lokalen Versicherer nicht mehr als 30 Prozent der für das Projekt erforderlichen Versicherung übernehmen können.
Financial Times: Riesige Kupfervorkommen in Sambia entdeckt. Ein Bergbau-Startup, das von Bill Gates und Jeff Bezos unterstützt wird, hat in Sambia das größte Kupfervorkommen seit einem Jahrhundert entdeckt. Das Unternehmen KoBold Metals geht davon aus, dass der Standort Mingomba in der nördlichen Provinz Copperbelt zu den drei besten hochgradigen Kupferminen der Welt gehören wird. Das bedeutet einen potenziellen Schub für die Bemühungen des Westens, seine Abhängigkeit von China bei wichtigen Metallen zu verringern.

Lange soll seine Amtszeit nicht dauern – das wollte Namibias neuer Präsident Nangolo Mbumba offenbar schnell geklärt wissen. Nach dem Tod seiner Vorgängers Hage Geingob am Sonntagmorgen, sagte Mbumba nach seiner Vereidigung im neuen Amt: “Ich werde bei den Wahlen nicht dabei sein. Also habt keine Panik.” Tatsächlich war Geingobs Nachfolge intern bereits geklärt. Im vergangenen Jahr hatte sich Namibias dominierende Regierungspartei Swapo auf die bisherige Außenministerin, Netumbo Nandi-Ndaitwah, als Nachfolgerin Geingobs geeinigt. Daran will sich Mbumba offenbar auch trotz seiner neuen Position halten. Mbumba ist – wie sein Vorgänger – mit 82 Jahren noch Teil der alten Politikgarde, die das Land seit der Unabhängigkeit 1990 anführte. Nandi-Ndaitwah wird nun die neue Vizepräsidentin.
Für Mbumba bleibt so also nur eine Interimsrolle als Präsident, denn die nächsten Präsidentschaftswahlen sind bereits für November dieses Jahres geplant. Die Amtszeit des nächsten Präsidenten beginnt dann im März 2025. Dennoch fällt Mbumba eine wichtige Rolle im Präsidentschaftswahlkampf zu. Denn die seit der Unabhängigkeit überwältigende politische Dominanz der Swapo bröckelt seit Jahren.
Die Jugend des Landes wünscht sich einen Generationenwechsel an der Spitze des Staates. Die Generation der Befreiungskämpfer ist in die Jahre gekommen und auch der respektierte Geingob schaffte es nicht, sein Versprechen vom steigenden Wohlstand umzusetzen. Jetzt muss die Swapo den Wahlkampf ohne ihren führenden Kopf Geingob bestreiten, den Mbumba am Sonntag als “eine Ikone des Befreiungskampfes und führenden Architekten unserer Verfassung” bezeichnete. Im Januar war bekannt geworden, dass Geingob an Krebs erkrankt war. Er hatte immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen.
Mbumbas Aufgabe wird es also sein, die Amtsgeschäfte so ruhig wie möglich zu führen. Nur so kann er Nandi-Ndaitwah die größtmögliche Rückendeckung im Wahlkampf geben. Seit Jahren verliert die Swapo durch große Korruptionsskandale an Rückhalt in der Bevölkerung. Diese sollen den Wahlkampf von Nandi-Ndaitwah nicht beeinflussen. Dass Mbumba über das nötige Durchhaltevermögen verfügt, hat er bewiesen.
Fast 20 Jahre lang gehörte er als Minister mit verschiedenen Fachbereichen den Kabinetten der ersten beiden Präsidenten Namibias, Sam Nujoma und Hifikepunye Pohamba an. 2012 legte Mbumba seinen Posten als Sicherheitsminister nieder, da er zum Generalsekretär seiner Partei aufstieg. Sechs Jahre später kehre Mbumba in die Regierung zurück – nun als Vize des dritten Präsidenten Geingob.
Geboren wurde Mbumba als Sohn zweier Lehrer in einem kleinen Ort im Norden Namibias. Bereits als junger Mann engagierte sich Mbumba in der Jugendorganisation der Swapo. Nachdem die südafrikanischen Behörden ihn mehrmals verhaftet hatten, floh Mbumba nach Sambia. Mithilfe eines Stipendiums der Vereinten Nationen konnte er in den USA studieren und schloss mit einem Master in Biologie an der University of Connecticut ab. Anschließend arbeitete er als Lehrer in New York, bevor er Ende der 1970er-Jahre nach Afrika zurückkehrte. Mitte der 1980er-Jahre wurde er persönlicher Sekretär von Präsident Nujoma und war wenige Jahre später an den Verhandlungen über die Unabhängigkeit Namibias beteiligt. Vor fünf Jahren verlieh ihm die University of Namibia den zeremoniellen Titel des “Kanzlers”.
Als Vizekanzler war Mbumba zudem einer der wichtigsten Berater Geingobs in vielen politischen Fragen – auch in der für Deutschland wichtigen Frage, wie das Land mit dem von den Deutschen begangenen Völkermord an den Herero und Nama umgehen sollte. Mbumba beaufsichtigte in den vergangenen Jahren die schwierigen Verhandlungen.
Die nach der “gemeinsamen Erklärung” 2021 aufgenommenen Nachverhandlungen hatten im Januar einen schweren Rückschlag erlitten, als Präsident Geingob die Bundesregierung für ihre Unterstützung Israels vor dem Internationalen Gerichtshof scharf kritisiert hatte. Dass die Verhandlungen mit Präsident Mbumba einfacher werden, ist eher unwahrscheinlich.
Mbumba hatte die vereinbarte Entschädigungssumme vor zwei Jahren scharf kritisiert. Die Bundesregierung hatte den Betrag von 1,1 Milliarden Euro zudem nicht als Entschädigung für den Völkermord, sondern als “Wiederaufbauhilfe” deklariert. Vielleicht macht der Wechsel an der namibischen Regierungsspitze aber auch einen Neustart der Verhandlungen möglich. David Renke

Was ist nur los mit ihm? Er ist eben alt geworden, sagen die einen. Nein, sagen die anderen. Da ist was ganz anderes im Busch: Jetzt ist er frisch verheiratet und hat einfach die Prioritäten nicht mehr im Blick, hat Kopf und Herz und woanders – Sadio Mané, Senegals Star-Stürmer.
Mané hat viele Fans beim diesjährigen Afrika-Cup schwer enttäuscht. Titelverteidiger Senegal flog schon im Achtelfinale raus, gegen das Gastgeberland Elfenbeinküste. Auf das erste Tor nach vier Minuten für die Senegalesen folgte fußballerisch wenig, klagten die Kommentatoren. Nach kräftezehrender Verlängerung im schwül-heißen Klima fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Als ein senegalesischer Spieler die Latte traf, war es vorbei.
Riesenenttäuschung im Senegal, vor den TV-Bildschirmen und beim Public Viewing an der Küstenstraße Corniche. Nach dem Spiel gehen die Leute erstmal frische Luft schnappen und zum Kiosk an der Ecke Snacks holen, traurige, lange Gesichter. Kollektive Trauer statt der Party, auf die sich schon viele gefreut hatten. Das Aus der Löwen von Trainer Cissé wird intensiv diskutiert, mit gedämpften Stimmen und gesenkten Köpfen. Wie konnte das passieren? Mané war einfach nicht präsent, hat Bälle verfehlt, aber auch der Schiedsrichter, der war parteiisch (und wurde nach dem Spiel suspendiert).
Im Senegal ist Fußball wirklich so etwas wie ein Nationalsport. Kein Streifen zwischen den Häusern, kein Strand, kein Fußballplatz, die nicht jeden Tag eifrig bespielt werden, von groß und klein. Noch allerdings sieht man im konservativen Senegal kaum Mädchen kicken.
In Dakar ist Sadio nicht zu entkommen, er macht Werbung für gefühlt alles, Pepsi, Telefontarife, Wasser, grinst breit von meterhohen Plakaten an der Straße, von Hauswänden, Afrika-Cup hin oder her.
Auf ihren Sadio sind die Senegalesen bisher sehr stolz gewesen, ein so bescheidener Mitbürger, der trotz viel Geld nie arrogant auftritt, die leisen Töne spielt und fußballerisch glänzt. Während seiner unglücklichen Zeit beim FC Bayern volles Verständnis in Manés Heimat Senegal: Die Bayern wussten den 31-Jährigen einfach nicht zu schätzen, haben ihn zu wenig unterstützt. lcw
die Absage der Präsidentschaftswahl im Senegal traf die Weltöffentlichkeit völlig unvorbereitet. Damit sorgt ein weiterer Staat in der Sahelzone für Instabilität – und die europäischen Diplomaten wissen nicht, wie sie mit dieser Krise umgehen sollen. Meine Kollegin Lucia Weiß, die in Dakar lebt und gerade mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Nigeria ist, und ich haben die neue Lage in der Region analysiert.
Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe ist Namibia. Unser Redakteur Arne Schütte hatte schon in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem Afrikawissenschaftler Henning Melber geführt. Darin geht es darum, wie die Bundesregierung immer wieder die Aussöhnung mit Namibia behindert. Und dann ist am Wochenende Staatspräsident Hage Geingob gestorben. David Renke stellt Ihnen seinen Nachfolger Nangolo Mbumba vor.
Darüber hinaus haben wir wieder interessante Analysen, News und viele andere Informationen für Sie zusammengetragen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Die Senegalesen werden sich erinnern, was sie am 3. Februar 2024 um 14 Uhr gemacht haben. Da trat Präsident Macky Sall vor die Mikrofone, mit zwei Stunden Verspätung. Nur wenige Minuten später teilte Sall in seiner Ansprache an die Nation die Verschiebung der Präsidentschaftswahl mit. Sie war für den 25. Februar geplant. Bemerkenswerterweise nahm Sall an keiner Stelle das Wort “reporter” – aufschieben – in den Mund.
Seit Wochen ist die Lage im Land angespannt. Der Oppositionspolitiker und Präsidentschaftskandidat Ousmane Sonko wurde inhaftiert. Lange war auch unklar, ob Macky Sall eine dritte Amtszeit anstrebt. Nur unter Druck hatte er verzichtet.
Und dennoch: Was an diesem Wochenende geschah, ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landes. Im Jahr 1960 löste es sich von Frankreich und wurde rasch ein viel gelobtes Vorbild für ganz Westafrika. Denn trotz aller politischer Krisen hat sich am Ende stets die Demokratie durchgesetzt. Dafür sorgte auch immer wieder der Druck der Straße. So verhinderten Massendemonstrationen im Jahr 2012, dass Salls Vorgänger Abdoulaye Wade für eine dritte Amtszeit antreten konnte.
Doch dieses Mal könnte es anders kommen. Mit Sorge vermerken die Beobachter der Geschehnisse, dass Sall zunächst kein Wort über ein Ersatzdatum verlor. Erst am Montagabend stimmte das Parlament im Senegal laut Berichten von RFI einem Gesetzesvorschlag zu, demnach die Wahlen auf den 15. Dezember verschoben werden. Zuvor soll die Polizei die Oppositionspolitiker des Saales verwiesen haben.
Dass Sall die Wahlen verschiebt, kommt einem politischen Erdbeben für die gesamte Region gleich. Diese ist durch den plötzlichen Austritt der drei Sahelländer Mali, Burkina Faso und Niger aus der Ecowas ohnehin geschwächt. Die Signalwirkung aus dem Senegal könnte noch nicht abzusehende Folgen haben.
Auch ist zu befürchten, dass sich im Senegal der Wettlauf um Rohstoffe wiederholen könnte: Denn vor der Küste des Landes entstehen große Bohrfelder für Erdöl und Erdgas. Die Förderung soll bald beginnen. Der zeitliche Zusammenfall zwischen Wahlaufschub und Beginn der Förderung löst Spekulationen aus. Hat Sall die Wahl abgeblasen, damit kein anderer Wahlsieger Zugriff auf die Rohstofferlöse bekommt?
So hatte die BBC berichtet, dass Macky Salls Bruder von den Funden profitiert. Der Präsident wies die Anschuldigung entrüstet zurück, dass sein Bruder in Korruptionsaffären verwickelt sei. Doch klar ist: Unregelmäßigkeiten sind aufgetreten. Sie sind bis heute nicht aufgeklärt.
Die westlichen Verbündeten Senegals wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Die EU betonte noch Mitte vergangene Woche zum Start ihrer Beobachtermission, wie sehr sie sich über die Demokratie im Senegal freue. “Wahlen sind immer ein bedeutender Tag für die Bevölkerung”, sagte Chefbeobachterin Malin Björk vor der Presse im Radisson Hotel in Dakar. Besorgte Nachfragen wurden diplomatisch weggelächelt, mit dem pauschalen Verweis, dass man auf einen transparenten und fairen Wahlprozess hoffe.
Dabei haben die Wahlbeobachter über Offensichtliches hinweggesehen. Diomaye Faye, der wichtigste Oppositionskandidat der aufgelösten Partei PASTEF, sitzt im Gefängnis – inwiefern unter diesen Umständen eine faire Kampagne möglich gewesen wäre, bleibt offen. Faye war als Ersatzkandidat für den bei der jungen Bevölkerung enorm populären Ousmane Sonko eingesetzt worden. Der wurde nach mehreren Gerichtsverfahren von einer Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen.
Sall begründete die Verschiebung der Wahlen – nur drei Wochen vor dem Termin – mit einem “offenen Konflikt” zwischen Legislative und Exekutive. Die Glaubwürdigkeit der Wahlen sei in Zweifel gezogen worden, sagte Sall in seiner Rede am Samstag. Die Bildung einer Untersuchungskommission sei ein offener Konflikt zwischen den Gewalten des Staates.
Die Bundesregierung zeigte sich ob dieser Entwicklungen alarmiert. “Die Situation im Senegal macht mir im Moment wirklich Sorgen”, sagte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Rande einer Reise nach Nigeria. “Dass die Wahlen jetzt wiederum verschoben wurden, ist kein gutes Signal.” Schulze verwies auf die Reaktion der Afrikanischen Union, die einen Zeitplan für faire und transparente Wahlen eingefordert hatte. “Das ist etwas, was ich unterstütze. Der Senegal ist eine Demokratie, die schon mehrfach Wechsel hatte, und wo das auch gut funktioniert hat. Das muss jetzt auch so weitergehen.”
Auch das Außenministerium teilte am Montag mit, die Situation genau zu beobachten. “Die Senegalesinnen und Senegalesen haben ein Recht, den Wahlprozess fortzusetzen und ihre politische Führung demokratisch zu bestimmen. Wir rufen alle politischen Kräfte dazu auf, diese gerade auch in herausfordernden Zeiten zu wahren”, sagte ein Sprecher des Ministeriums.
Der Senegal ist einer der wichtigsten Partner der Bundesregierung sowie der EU in der Region. So unterstützt Deutschland und Frankreich sowie weitere internationale Partner den Senegal mit einer Just Energy Transition Partnership (JETP). Deutschland ist zudem eines der wichtigsten Geberländer für den Senegal. Im vergangenen Jahr stellte die Bundesregierung laut BMZ 170 Millionen Euro für Entwicklungsprojekte im Senegal zur Verfügung.
Ironischerweise hatten Salls Anhänger auf diesen hingearbeitet, um ihn von einer Verschiebung zu überzeugen, wie Africa Intelligence schreibt. Das Parlament hatte diese Kommission durchgesetzt, um Zweifel an der Auswahl der Präsidentschaftskandidaten auszuräumen. Umstritten war vor allem der Ausschluss von Karim Wade, dem Sohn des ehemaligen Präsidenten Wade, der aus dem Ausland zurückkehrte. Ihm wurde vorgeworfen, eine doppelte Staatsangehörigkeit verschleiert zu haben.
Hinter dem Coup steht laut Africa Intelligence ein Machtkampf: Die Aussichten des Ministerpräsidenten Amadou Ba auf einen Sieg hatten sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Dabei wurde Ba von Noch-Präsident Sall ausgewählt. Besonders Wades Ausschluss brachte politische Solidaritätsverabredungen ins Wanken, die einen Sieg Bas absichern sollten – notfalls in einem zweiten Wahlgang. Zu hoch wurde das Risiko eingeschätzt von Salls Lager, dass Ba von Sonkos Bewegung geschlagen werden könnte.
Bislang sind die Ausschreitungen nach der Ankündigung, die Wahlen zu verschieben, noch vergleichsweise gering. Seit Jahren jedoch geht die Regierung zunehmend repressiv gegen die Opposition und Medien vor. Im vergangenen Jahr belegte der Senegal Platz 104 im Ranking von Reporter ohne Grenzen, das die Medienfreiheit einstuft. 2021 lag das Land noch auf Rang 49. Im März 2021 und Juni 2023 hatte die Regierung Salls zudem Proteste der Sonko-Bewegung blutig niedergeschlagen.
Die Absage der Präsidentschaftswahl im Senegal hat die Bundesregierung – wie auch wahrscheinlich andere Regierungen – unvermittelt getroffen. Ausgerechnet der Senegal. Das Land galt dem Westen stets als stabiles pluralistisches Land, in dem trotz aller Konflikte am Ende immer das Gute, die Demokratie, siegt.
Die Verschiebung einer Wahl ist auch für Afrika ungewöhnlich. Im Jahr 2015 hatte der damalige Präsident Nigerias, Goodluck Jonathan, die Präsidentschaftswahlen verschoben. Er begründete dies mit der schlechten Sicherheitslage im Nordosten aufgrund des islamistischen Terrors von Boko Haram. Doch die Opposition vermutete einen Winkelzug, durch den Jonathan seine Aussichten verbessern wollte. Auch die USA kritisierten den Aufschub.
Doch die für den 14. Februar 2015 vorgesehene Wahl fand sechs Wochen später am 28. und 29. März 2015 statt. Muhammadu Buhari, der schon von 1983 bis 1985 Präsident war, vereinte 53,96 Prozent der Stimmen auf sich. Jonathan gab sich klaglos geschlagen.
Im Senegal ist die Lage anders. Sall hat die Wahl abgesagt, ohne zunächst ein neues Datum zu nennen. Erst am Montag stimmte das Parlament unter Ausschluss der Opposition einer Wahlverschiebung bis Mitte Dezember zu. Die Begründung hat dennoch weit weniger Gewicht als vor neun Jahren in Nigeria. Damit steht die Vermutung im Raum, dass Sall einen Staatsstreich durchführen will, den Versuch, die Kontrolle über das Land zu übernehmen und die Instanzen der senegalesischen Demokratie bis auf Weiteres auszusetzen.
Auf einen Rückzug aus der Politik hatte der 62 Jahre alte Politiker bisher ohnehin keine Lust. Lange haderte er mit sich und strebte lange eine dritte Amtszeit an, die nach der Verfassung verboten wäre. Erst unter starkem Druck von allen Seiten schob Sall seinen Premierminister Amadou Ba vor.
Der Senegal zählt nur rund 18 Millionen Einwohner und ist mit knapp 200.000 Quadratkilometern nur etwas mehr als halb so groß wie Deutschland. Doch wirtschaftlich hat das Land Gewicht in der Region. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag Ende 2022 bei 27,7 Milliarden Dollar und liegt somit bei rund 1538 Dollar je Kopf. Damit ist der Senegal eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder in Westafrika und schließt zu den größeren Wirtschaftsnationen auf dem Kontinent auf. In Kenia liegt das BIP bei etwas mehr als 2000 Dollar je Kopf.
Auch bei den westlichen Gläubigern genießt der Senegal Ansehen. Die Ratingagentur Moody’s setzt das Credit Rating seit vielen Jahren auf Ba3 mit stabilem Ausblick und bestätigte die relativ gute Bonitätseinschätzung noch Mitte Dezember. S&P stuft Senegal seit mehr als 20 Jahren auf B+ mit stabilem Ausblick ein. Bisher haben beide Ratingagenturen keine Revision der Kreditwürdigkeit aufgrund der jüngsten Ereignisse angekündigt.
Wegen seiner politischen und wirtschaftlichen Stabilität spielt der Senegal eine wichtige, stabilisierende Rolle in der Sahelzone. Die gesamte Region vom Atlantik bis zum Mittelmeer und zum Roten Meer droht eine failed region zu werden. Libyen, Mali, Burkina Faso, Niger, die Zentralafrikanische Republik und der Sudan gelten schon als gefallene Staaten. Der Tschad und Mauretanien sind zumindest fragil.
Damit droht ein Zerfall der Staatlichkeit in einer Region, die größer ist als die gesamte Europäische Union und die politisch, wirtschaftlich und militärisch eine immer wichtigere Rolle spielt. Im Boden des Sahels liegen viele Rohstoffe, die Europa für die Energiewende braucht. Doch die legitimen Zentralregierungen kontrollieren nur noch einen kleinen Teil ihres Territoriums. Stammesfürsten, Warlords, islamistische Terrorgruppen oder auch kriminelle Bandenführer haben in weiten Teilen der Sahelzone weitgehend das Sagen. Sie finanzieren sich aus Rohstoff- und Goldvorkommen, aus dem Drogenschmuggel zwischen Lateinamerika und Europa sowie auch immer wieder aus Geiselnahmen.
Ein Zerfall des Staates droht im Falle Senegals nicht. Dagegen spricht schon, dass das Land historisch gefestigt ist. Staaten wie das Königreich Namandirou, das der Djolof oder das Ghana-Reich reichen zum Teil bis ins achte Jahrhundert zurück. Hinzu kommt, dass der Islam in seiner westafrikanischen Ausformung mit seinen einflussreichen Sufi-Brüderschaften Zusammenhalt in der Gesellschaft schafft. So hat die Mouridiyya mit seinem aktuellen Kalifen Serigne Mountakha Mbacké eine Bedeutung im Senegal, die kein Präsident ignorieren kann.
Doch für die Bundesregierung wie für Frankreich und die Europäische Union bricht ein weiteres Land weg, das sie zur “Vorzeigedemokratie” stilisiert hatten. Und genauso wie im Fall Nigers bricht dieses Narrativ nun zusammen.
Damit zeigt sich wieder, dass die Gleichung der deutschen Außenpolitik “Entwicklungshilfe schafft Stabilität und Demokratie” in der Sahelzone gescheitert ist. Rund 740 Millionen Euro deutsche Entwicklungshilfe flossen seit 2019 an Senegal, allein 170 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Ein Schwerpunkt dabei sind erneuerbare Energie im Rahmen der Just Energy Transition Partnership.
Diplomaten wie Entwicklungspolitiker müssen sich jedoch mit dem Gedanken anfreunden, dass sie sich in dieser Region zunehmend mit Regimen arrangieren müssen, die weder demokratisch legitimiert sind noch ihr Land wirklich kontrollieren.
Die deutschen Außenpolitiker müssen ein Konzept finden, dass es ihnen ermöglicht, jenseits der Orientierung an demokratischen Werten die Beziehungen zu dieser Region nicht ganz zu verlieren. Diese Krise der Diplomatie trifft nicht Deutschland allein. Die Afrika-Strategie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist weniger als ein Jahr alt und scheint heute aus einer anderen Zeit zu sein.
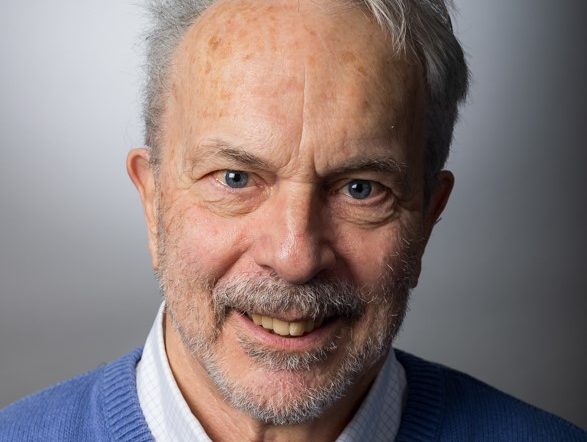
Professor Melber, im Prozess gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) will Deutschland an Israels Seite als Drittpartei intervenieren. Diese Nachricht hat in Namibia scharfe Reaktionen hervorgerufen. Der am Wochenende verstorbene Präsident Geingob warf Deutschland vor, Völkermord in Gaza zu unterstützen. Deutschland sei unfähig, aus der eigenen Geschichte zu lernen. Hat Sie die Härte der namibischen Reaktion überrascht?
Inhaltlich war diese Reaktion nicht überraschend, aber der sehr undiplomatische Ton hat mich doch erstaunt. Das zeigt deutlich den Ärger, den die am 12. Januar von Deutschland abgegebene Erklärung ausgelöst hat. An diesem Tag vor 120 Jahren begann der bewaffnete Widerstand der Herero, der im ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts endete. Dass das von deutscher Seite mit keinem Wort reflektiert wurde, zeugt von einer großen Unsensibilität, ja geradezu Ignoranz, gegenüber den Nachfahren der Opfer.
Und der Fauxpas vom 12. Januar ist längst kein Einzelfall: Zwei Wochen später, am Holocaust-Gedenktag, setzte sich die deutsche Botschaft in Windhoek mit einem Social-Media-Post ins nächste Fettnäpfchen. Der Opfer des Holocaust zu gedenken, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber auf den gleichen Tag fällt auch die erste Schließung deutscher Konzentrationslager im Land 1908 – von der Botschaft wird dies mit keinem Wort erwähnt. Ob Unwissenheit oder mangelnde Empathie, so kann eine deutsche Botschaft in Namibia nicht agieren.
Welche Reaktionen löst das in Namibia aus?
Die Menschen fühlen sich verletzt, gedemütigt und beleidigt. Vielleicht würde man auf deutscher Seite sagen: Stellt euch nicht so an, die Absicht war doch integer. Aber das verkennt völlig die Gefühle auf der namibischen Seite.
Es fängt schon damit an, dass Deutschland den Völkermord zwar eingesteht, dann aber die Form der Entschuldigung zum Verhandlungsgegenstand macht. Das ist aus Sicht der Nachfahren ein absoluter Affront.
Wer die deutsche Geschichte von innen her kennt und um die Befindlichkeiten weiß, der kann versuchen, zu verstehen und zu erklären. Das gilt aber nicht für jene, die diese Geschichte nur bedingt kennen. Sie wissen nicht um das Trauma derjenigen, die seit dem Holocaust in Deutschland geboren wurden und jetzt auch in der Politik maßgebliche Verantwortung tragen.
Ebenso wenig können die Deutschen verstehen, was in den Namibiern vorgeht, wenn diese mit der Relativierung des deutschen Genozids in Namibia konfrontiert werden. Das sind sozusagen zwei Puzzleteile, die sich gegenteilig gegenüberstehen.
Deutschland hat 2015 den Vorwurf des Völkermords akzeptiert. Ist das kein Fortschritt in der Aussöhnung?
Ja, Deutschland hat zugegeben, in Namibia einen Genozid verübt zu haben. Allerdings mit dem Zusatz “aus heutiger Sicht”, was nach namibischer Einschätzung eine weitere Relativierung ist. Begründet wird das mit dem Prinzip der Intertemporalität: Da der Genozid-Begriff erst mit der UN-Konvention von 1948 ins Völkerrecht einging, sei er im Fall Namibia nicht anwendbar.
Das ist allerdings eine sehr opportunistische Auslegung, denn auch der Holocaust wurde ja vor 1948 verübt. Und das führt natürlich in Namibia zu der Wahrnehmung: Ihr behandelt uns anders als die Opfer des Holocaust, den ihr auch begangen habt. Zugespitzt formuliert: Ihr diskriminiert uns rassistisch.
Hat der Vorfall also die Bemühungen der letzten Jahre um eine Aussöhnung zunichtegemacht?
Ich befürchte, ja. Offenbar stand man nach Nachverhandlungen im Dezember kurz vor einer Einigung. Die Rede war davon, die Kompensationsleistungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro um vermutlich eine weitere Milliarde zu erhöhen, davon, dass der Zuwendungszeitraum verkürzt wird, und dass die Begünstigten auch in der Diaspora leben können.
Doch nach der scharfen Kritik von Präsident Geingob scheint es sehr fraglich, dass die namibische Regierung eine gemeinsame Erklärung ohne Gesichtsverlust unterzeichnen kann. Geingobs Statement hat im Land große Zustimmung gefunden. Es fördert die antideutschen Ressentiments, die jederzeit abrufbar sind, insbesondere in einem solchen Fall.
Grundsätzlich fühlen sich viele Länder im Globalen Süden zunehmend brüskiert von der Doppelmoral des Westens. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Doppelmoral keinesfalls das Exklusivrecht des Westens ist, sondern leider in zunehmendem Maße die Außenpolitik fast aller Staaten charakterisiert. Das ändert aber nichts daran, dass die Ressentiments der Staaten des Globalen Südens weiter verfestigt werden.
Am 26. Januar hat der IGH Israel angeordnet, alle Handlungen zu verhindern, die als Völkermord betrachtet werden könnten. Welche Rolle spielt der IGH-Beschluss im deutsch-namibischen Streit?
Natürlich fühlt sich Namibia durch das Urteil bestätigt. Mit der gemeinsamen Erklärung zur Aussöhnung wird es allerdings kaum in Verbindung gebracht.
Ich denke, die Erklärung liegt erst einmal auf Eis. Die namibische Regierung wird sich überlegen, wie sie damit umgeht. Sie hat weitere Zugeständnisse ausgehandelt, weiß aber, dass das nicht die Kritik zum Verstummen bringt. Ich vermag nicht zu prognostizieren, zu welchem Ergebnis sie kommen wird und ob der plötzliche Tod Geingobs am 4. Februar die Sachlage ändert. Nangolo Mbumba war als Vize-Präsident mit der Aufsicht über die Verhandlungen betraut. Als nun wohl amtierender Präsident, der auch Gespräche mit den Ovaherero und Nama führte, hat er sicher ein gewichtiges Wort.
Wie lässt sich der deutsch-namibische Disput beilegen?
Wenn ich das wüsste, dann wäre ich vielleicht ein Diplomat. Ich denke, die beste Lösung wäre eine, die nicht von Deutschland kommt, sondern von Namibia. Das Land sollte darauf drängen, dass die in acht Jahren ausgehandelte Erklärung im augenblicklichen Kontext nicht adäquat ist und sich stattdessen um neue Verhandlungen bemühen.
Dann sollten auch die Vertretungen der Herero und der Nama mit am Tisch sitzen. Es wäre eine wichtige psychologische Komponente, dass die Nachfahren der Opfer dieses Genozids Auge in Auge mit den Nachfahren der Täter verhandeln. Ein solcher Neubeginn, der versucht, aus den Fehlern der letzten Jahre zu lernen, könnte eine historische Chance sein.
Henning Melber ist Politikwissenschaftler, Entwicklungssoziologe und Afrikawissenschaftler. Als Sohn deutscher Einwanderer kam er 1967 als Jugendlicher nach Namibia. 1974 trat er der Befreiungsbewegung SWAPO bei. Heute forscht er am Nordischen Afrika-Institut in Uppsala (Schweden). Zur Jahresmitte erscheint sein Buch “The Long Shadow of German Colonialism” im Londoner Verlag Hurst.
Die Wirtschaft in Subsahara-Afrika wird nach der jüngsten Prognose des IWF in diesem Jahr um nur 3,8 Prozent wachsen. Zuvor lag die Erwartung bei 4,0 Prozent. Dies geht aus dem jüngsten World Economic Outlook des IWF hervor. Die Senkung der Prognose ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die IWF-Volkswirte in Südafrika mit einer Abschwächung des Wachstums rechnen. Sie bemängeln “zunehmende logistische Einschränkungen für die Wirtschaftstätigkeit, vor allem im Transportwesen”.
Für Subsahara-Afrika dürfte das Wachstum im vergangenen Jahr bei 3,3 Prozent gelegen haben. Bis Ende 2024 könnte es auf 4,1 Prozent steigen. Damit liegen die Aussichten für den Kontinent zwar über dem globalen Durchschnitt. Doch liegt die Steigerung der Wirtschaftsleistung unter dem Wert, den der Kontinent erreichen müsste, um das Bevölkerungswachstum aufzufangen und eine positive Entwicklung auszulösen.
Dass es auch anders geht, zeigt die Region Emerging and Developing Asia. Zu dieser zählt der Währungsfonds unter anderem auch die beiden wirtschaftlichen Schwergewichte China und Indien. Emerging and Developing Asia erreichte laut IWF im vergangenen Jahr eine Wirtschaftssteigerung von 5,4 Prozent und könnte in diesem Jahr 5,2 Prozent erreichen.
Nicht nur in Südafrika – auf dem gesamten Kontinent leidet die Wirtschaft unter den zahlreichen Engpässen, die durch eine mangelnde Infrastruktur bedingt sind. Dadurch ist die Produktivität großer Teile der afrikanischen Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig. So beklagte jüngst auch Thomas Schäfer, CEO der Marke VW im Konzernvorstand des Autoherstellers, dass die VW-Fabrik in Südafrika angesichts der vielen Engpässe in der südafrikanischen Wirtschaft gegenüber den anderen VW-Werken nicht wettbewerbsfähig sei. VW unterhält seit 1951 ein Werk in Kariega in der Provinz Ostkap, das heute 3500 Menschen beschäftigt. Dort werden Motoren sowie die Modelle Polo Vivo, Polo und Polo GTI gefertigt. VW hat nach eigenen Angaben in Südafrika einen Gesamtmarktanteil von gut 22 Prozent.
Südafrika war lange der Wachstumsmotor des gesamten Kontinents. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Im Jahr 2022 lag die Wachstumsrate bei enttäuschenden 1,9 Prozent. Im vergangenen Jahr dürfte sie weiter auf 0,6 Prozent gefallen sein und in diesem Jahr laut IWF auf 1,0 Prozent nur leicht erholen. Für das kommende Jahr dürfte sich die Wirtschaftsleistung zwar auf 1,3 Prozent steigern, doch weiterhin unter dem Wert von 2022 liegen. Diese Wachstumsraten liegen weit unter dem Niveau, das Südafrika benötigt.
Nigeria dürfte in diesem Jahr 3,0 Prozent nach 2,8 Prozent im vergangenen Jahr erreichen. Wegen des starken Gewichts des Exports von Mineralöl und Erdgas hängt die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stark an den Weltmarktpreisen für Energie. Für Rohöl rechnet der IWF, dass die Notierungen in diesem Jahr 2,3 Prozent sinken nach einem Rückgang von 16 Prozent im vergangenen Jahr. Um den Zustand der nigerianischen Wirtschaft wirklich beurteilen zu können, müsste der Öl- und Gassektor aus dem BIP herausgerechnet werden. Leider nimmt der IWF diese Berechnungen nicht vor.
Das globale Wachstum schätzt der IWF für 2023 auf 3,1 Prozent. In diesem Jahr wird es voraussichtlich auf diesem Niveau bleiben. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber der Prognose vom Oktober, als die IWF-Volkswirte ein Weltwirtschaftswachstum von 2,9 Prozent erwartet hatten. Vor allem für die USA und China rechnen die Ökonomen in Washington mit einer stärkeren Erholung. Dennoch bleibt die Prognose unter dem langjährigen Durchschnitt für die Jahre 2000 bis 2019, als 3,8 Prozent jährlich erreicht worden sind.
Auch der Welthandel wird wachsen, aber unter seinem Trendwachstum bleiben. Für 2024 und 2025 rechnet der IWF mit 3,3 Prozent und 3,6 Prozent, während der langjährige Durchschnitt 4,9 Prozent beträgt. “Zunehmende Handelsverzerrungen und eine geoökonomische Fragmentierung werden voraussichtlich den Welthandel belasten”, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2022 haben die unterschiedlichen Länder 3.222 neue Handelsbeschränkungen eingeführt. 2023 waren es rund 3.300, während die Zahl im Jahr 2019 bei nur etwa 1.100 lag.
Der französische Fernsehsender Canal+ stößt auf Hindernisse bei der Übernahme des südafrikanischen Medienunternehmens MultiChoice. Ein von Canal+ vergangenen Donnerstag unterbreitetes Angebot hat MultiChoice abgelehnt. Der angebotene Kaufpreis lag bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Zu MultiChoice gehört der Video-on-Demand-Anbieter Showmax und vor allem DStv, der derzeit mit fast 90 Prozent Marktanteil wichtigste Pay-TV-Sender in Afrika. DStv überträgt auf dem Kontinent über Super Sport auch europäischen Livefußball, wie die Bundesliga oder die englische Premier League.
Canal+, ein Tochterunternehmen des französischen Medienkonzerns Vivendi, ist weniger am florierenden südafrikanischen Markt interessiert als an Expansionsmöglichkeiten auf dem Kontinent. Dazu braucht es MultiChoice. Derzeit ist Canal+ in 25 Ländern vertreten, hauptsächlich im frankophonen Afrika, wo es der stärkste Anbieter ist. Nun wirft der Sender ein Auge auf den englischsprachigen Teil des Kontinents, etwa auf Nigeria und Kenia.
Canal+ zählt rund acht Millionen Kunden in Afrika, MultiChoice 23,5 Millionen. Das südafrikanische Unternehmen verbessert gerade seinen Streaming-Service Showmax mit noch mehr Livefußball, lokalen Programmen und US-Serien. Showmax gehört zu einem Drittel dem US-Medienunternehmen Comcast, der Muttergesellschaft von NBC Universal und Sky in Großbritannien.
Die Offerte von Canal+ kam nach einem Jahr intensiver Verhandlungen. Zum Zeitpunkt des Angebots gehörten Canal+ 31,7 Prozent der MultiChoice-Aktien. Mittlerweile sind es mehr als 35 Prozent. Die Franzosen haben den MultiChoice-Aktionären 105 Rand (5,14 Euro) je Aktie angeboten. Das sind rund 40 Prozent über dem Vortagswert von 75 Rand. Das allerdings war dem Vorstand von MultiChoice zu wenig.
Aus Sicht von Canal+ wird die Medienbranche globaler und wettbewerbsintensiver. Wachsen oder untergehen lautet demnach die Alternative: “Damit MultiChoice in Afrika weiterhin erfolgreich sein kann, bedarf es einer Strategie, die seinen Umfang erweitert und die lokale und globale Expertise stärkt”, meint Maxime Saada, CEO von Canal+. “Zusammen mit Canal+ hätte MultiChoice die Ressourcen, in lokale afrikanische Talente und Geschichten sowie erstklassige Technologie zu investieren, um in Afrika zu wachsen und mit den globalen Streaming-Mediengiganten zu konkurrieren.”
Auch MultiChoice sieht Vorteile in einem Zusammenschluss und spricht von “erheblichen Synergien”. Das Management zögert jedoch. “Die Bewertung von MultiChoice schließt mögliche Synergien aus, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben könnten”, heißt es in einer Stellungnahme von MultiChoice. “Diese Synergien müssen in jedem fairen Angebot von Canal+ berücksichtigt werden.”
Das Unternehmen ist im Besitz des börsennotierten südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. In den sechs Monaten von März bis September 2023 verbuchte MultiChoice fünf Prozent weniger Einkommen aus seinem Kerngeschäft. Finanzschwache Konsumenten und die Konkurrenz von Anbietern wie Netflix, Amazon und Disney machen MultiChoice zu schaffen.
Marktkenner gehen davon aus, dass MultiChoice eher eine intensivere Kooperation mit Comcast anstrebt. Zudem gibt es für Canal+ eine hohe Hürde: Südafrikanisches Recht verbietet es, dass ausländische Unternehmen mehr als 20 Prozent der Stimmrechte an einem einheimischen Medienunternehmen halten. Bei der Zahl der Anteile hingegen gibt es keine Beschränkungen.
Für Peter Takaendesa von der Fondsgesellschaft Mergence Investment Managers könnte eine Lösung sein, dass Canal+ durch Aktionärsvereinbarungen faktisch die Kontrolle erlangt. “Die Parteien dieser Transaktion brauchen einander im Kampf gegen globale Streaming-Giganten, da sie Inhalte und Finanzkraft nutzen können.” Auch steht die Zustimmung der Wettbewerbskommission aus. In jüngster Vergangenheit hat sie im digitalen Sektor energischer gehandelt.
Der Bund hat im vergangenen Jahr Exporte im Wert von 18,4 Milliarden Euro mit Kreditgarantien abgesichert. Gefördert worden seien unter anderem Projekte in den Bereichen Wind- und Solarenergie sowie grüner Wasserstoff, teilte das Grünen-geführte Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. 2022 waren es früheren Angaben zufolge 14,9 Milliarden Euro.
Gut 80 Prozent der 2023 abgesicherten Geschäfte entfielen auf Schwellen- und Entwicklungsländer, so das Wirtschaftsministerium weiter. “Viele Geschäfte in diesen Ländern lassen sich nur mit staatlicher Unterstützung realisieren.” Gemessen am Volumen lagen Geschäfte mit der Türkei (2,79 Milliarden) ganz vorne. Auf Platz zwei und drei folgten 2023 allerdings mit Ägypten (2,49 Milliarden) und Angola (2,01 Milliarden) Euro zwei afrikanische Länder. Mexiko (1,21 Milliarden) und Saudi-Arabien (1,15 Milliarden) belegten Rang vier und fünf.
Zum Schutz deutscher Auslandsinvestitionen gegen politische Risiken wurden 2023 Garantien im Umfang von 1,5 Milliarden Euro (2022: 2,3 Milliarden Euro) übernommen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Zwei Drittel hätten erstmals eine Garantie erhalten, 70 Prozent der genehmigten Anträge entfielen auf kleine und mittelständische Unternehmen. Gemessen am Volumen ging es vor allem um Investitionen in Peru (880 Millionen Euro), Ägypten (265 Millionen), China (71 Millionen), Namibia (60 Millionen) und die Ukraine (55 Millionen).
Das Wirtschaftsministerium will bei seinen Exportgarantien mit verbesserten Konditionen gezielt Projekte unterstützen, die einen strategischen Wert haben, etwa bestimmte Lieferketten absichern oder die Rohstoff- und Energieabhängigkeit Deutschlands verringern. Auch beim Klimaschutz seien bessere Konditionen möglich. rtr/dre
Der Handel zwischen Afrika und China stieg 2023 auf einen neuen Rekord von 282,1 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 100 Millionen US-Dollar oder 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtete der englischsprachige chinesische Nachrichtensender CGTN mit Berufung auf das Handelsministerium der Volksrepublik China. Das Reich der Mitte ist demnach seit 15 aufeinanderfolgenden Jahren Afrikas größter bilateraler Handelspartner.
China exportierte 2023 Waren im Wert von 173 Milliarden US-Dollar nach Afrika, ein Zuwachs von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum importierte China Waren aus Afrika im Wert von 109 Milliarden US-Dollar, 6,7 Prozent weniger als 2022. Jedoch stieg das Handelsdefizit von Afrika gegenüber China von 46,9 Milliarden US-Dollar auf 64 Milliarden US-Dollar. Das bescheidene Wachstum des Handels mit Afrika ist auch ein Ausdruck des globalen Handels von China, das mit wirtschaftlichen Herausforderung zu kämpfen hat, darunter eine schwächelnde Wirtschaft und verhaltene globaler Nachfrage. Der Wert des gesamten Welthandels Chinas sank 2023 um fünf Prozent auf 5,93 Billionen US-Dollar. Auch bei Chinas wichtigsten Partnern in Afrika – Südafrika, Angola, Nigeria, Ägypten und der Demokratischen Republik Kongo – nahm der Handel ab, was mit sinkenden Rohstoffpreisen und verlangsamter Nachfrage aus China zusammenhängt. Das Handelsdefizit für Afrika möchte China mit vermehrten Agrarimporten aus Afrika auffangen.
Vertreter des Ministeriums hoben bei der Präsentation der Handelszahlen auch die Erfolge einer Pilotzone in der zentralchinesischen Provinz Hunan für das umfassende Wirtschafts- und Handelskooperationsprogramm zwischen China und Afrika hervor. So sollen die industriellen Vorteile der Region voll ausgeschöpft und ein Experimentierfeld für die lokale Zusammenarbeit mit Afrika geschaffen werden. “Bis 2027 soll die Pilotzone für vertiefte Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und Afrika zu einer offenen Kooperationsplattform mit globalem Einfluss werden”, so Jiang Wei, Direktor der Abteilung für Westasien und Afrika. “Bis 2035 wird sie hoffentlich zu einer Plattform mit umfangreichen Ressourcen und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.” Weitere Maßnahmen für die verbesserte Zusammenarbeit mit Afrika sollen in digitaler Wirtschaft und internationaler Logistik umgesetzt werden. as
Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sieht die Verzögerung bei der Verabschiedung der EU-Lieferketten-Richtlinie als Chance für die europäische Wirtschaft. “Viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, sehen durch die nationale und europäische Lieferkettengesetzgebung zusätzliche Risiken, Kosten und Bürokratie auf sich zukommen, wenn sie in Märkten außerhalb Europas aktiv werden”, sagte Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, laut einer Mitteilung, die Table.Media vorab vorliegt.
Die FDP hatte Ende vergangener Woche erklärt, den auf EU-Ebene bereits ausgehandelten Gesetzesentwurf zu einer EU-Lieferketten-Richtlinie nicht mittragen zu wollen. FDP-Justizminister Marco Buschmann bezeichnete diesen als “unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen”. Entwicklungsministerin Schulze hatte das Lieferkettengesetz hingegen verteidigt.
Laut dem Afrika-Verein könnten europäische Unternehmen mit der Lieferkettenverordnung in seiner jetzigen Gestaltung speziell in Afrika nicht mit anderen globalen Wettbewerbern konkurrieren, die mit deutlich niedrigeren Standards operieren. “Deshalb muss dringend darauf geachtet werden, dass Haftungsrisiken begrenzt und kostentreibende Bürokratie vermieden werden. Europäische Lieferkettengesetzgebung darf nicht dazu führen, dass wir im Ergebnis vor Ort mehr Kinderarbeit, niedrigere Sozialstandards und weniger Rücksicht auf Umwelt- und Klimaaspekte sehen”, so Kannengießer weiter. dre
Der kenianische Mobilfunkanbieter Safaricom, der dank M-Pesa ein führender Zahlungsverkehrsabwickler in Ostafrika ist, belastet derzeit die Aktienkurse an der Börse Nairobi. Seit Jahresanfang hat der marktbreite Aktienindex NSE ASI in Euro gerechnet rund 3,8 Prozent verloren. Die Safaricom-Aktie liegt seit Anfang 2024 mit 2,9 Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten summieren sich die Kursverluste auf 44,9 Prozent.
Dabei hatte sich die Börse Nairobi im Januar gut entwickelt. Die Banken Equity und Diamond Trust Kenya sowie der Zementhersteller Bamburi zogen die Notierungen nach oben. Doch die Verluste der Safaricom-Aktien wiegen schwer, macht das Unternehmen doch mit einem Börsenwert von umgerechnet 3,1 Milliarden Euro mehr als zwei Drittel der Marktkapitalisierung an der Börse Nairobi aus.
Vor allem der Markteinstieg in Äthiopien bereitet Safaricom so große Schwierigkeiten, dass bisher kein anderer Telekom-Anbieter den Kenianern nach Äthiopien gefolgt ist und den Staatskonzern Ethio Telecom herausfordern wollte.
Dabei warb die äthiopische Regierung um ausländische Investoren ursprünglich mit zollfreien Importen von Investitionsgütern und befristeten Steuerbefreiungen. Doch heute steht die Telekommunikation nicht mehr auf der staatlichen Liste der Investitionsbereiche, die Anspruch auf diese Steueranreize haben.
Seit Montag, 5. Februar, können zudem Safaricom-Kunden nicht mehr Geld von ihrem M-Pesa-Konto an Empfänger senden, die nicht bei Safaricom registriert sind – eine Kampfansage an die Konkurrenten Airtel und T-Kash. Es ist offen, wie diese Auseinandersetzung ausgeht. hlr

Deutschland werde künftig große Mengen Wasserstoff benötigen und viel davon auch aus Afrika importieren, so der Bundeskanzler im Herbst 2023 auf dem “Compact with Africa”-Gipfel in Berlin. Tatsächlich wären wir schlecht beraten, nur auf Partnerschaften mit den industrialisierten Ländern des “Globalen Nordens” zu setzen, um unseren Importbedarf zu decken und die Klimaziele zu erreichen. Denn ob wir die Klimakrise in den Griff bekommen, hängt auch davon ab, ob der afrikanische Kontinent die Schlüsselrolle spielen wird, die ihm zukommt.
Noch ist der CO₂-Ausstoß des Kontinents minimal, doch Afrikas Bevölkerungszahl wächst weiter und wird 2030 prognostizierte 1,7 Milliarden erreichen. Vielen Menschen wird dann noch immer der Zugang zu grundlegender Versorgung mit Elektrizität fehlen. Ohne attraktivere Alternativen werden die Regierungen Afrikas den Energiebedarf also auch aus fossilen Quellen decken – solange nötig. Für den Kampf gegen die Klimakrise und die etwas sperrig als “globale Transformation” bezeichnete wirtschaftliche Zeitenwende bedeutet das: Nicht Afrika braucht uns, sondern wir brauchen Afrika.
Sonne und Wind sind auf dem Kontinent im Übermaß vorhanden. Doch um fossile Energieträger restlos zu ersetzen, braucht es auch eine Alternative, grüne Energien zu speichern und zu transportieren. Diese Alternative ist der grüne Wasserstoff und seine Derivate. Kein Land mit Entwicklungsambitionen wird in Zukunft an der Wasserstofftechnologie vorbeikommen. Nur sie ermöglicht die Dekarbonisierung von Sektoren wie der Stahlindustrie und ermöglicht die Teilnahme am Energiemarkt der Zukunft.
Begreifen wir das als Chance: Der Wasserstoffhochlauf ermöglicht einen Markt mit viel mehr Akteuren und sehr viel fairerem Wettbewerb als bisher – und damit vielleicht einen noch größeren Entwicklungsfortschritt als das fossile Zeitalter.
Allein in Westafrika ist das Potenzial für grünen Wasserstoff mit bis zu 165.000 TWh jährlich 110-mal so groß wie der voraussichtliche Importbedarf Deutschlands im Jahr 2050. Zwar können und sollen nicht alle Länder Afrikas zu Exportnationen für Wasserstoff werden, aber mit ihrem Ressourcenreichtum entlang der H2-Lieferkette wären viele Länder natürliche Gewinner einer globalen Energiewende – wenn sie miteinbezogen werden.
Die genaue Ausgestaltung der Anlagen sollten wir dem Markt überlassen. Doch es ist Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen für private Investitionen zu verbessern. Der nötige Aufbau von Infrastruktur ist ohne umfangreiche Entwicklungszusammenarbeit nicht zu erreichen. Es werden neue Straßen, Häfen und Städte an Orten entstehen – so wie in dem kleinen Ort Lüderitz in Namibia. Dort soll sich die Einwohnerzahl mittelfristig verzehnfachen. Schon heute zieht der Ort Menschen in Aussicht auf Anstellung an.
All das muss auch zu einem Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit führen. Allzu häufig verharrt unsere Politik noch in zu vielen kleinen Projekten. Wir müssen unsere Scheu vor großen wirtschaftlichen Kooperationsprojekten verlieren und uns fragen, wie wir große Projekte wie Wasserstofffabriken oder Schiffsterminals so begleiten, dass sie Wohlstand und Wertschöpfung vor Ort auch für die Ärmsten der Gesellschaft garantieren. Ohne staatliche Absicherung, vielleicht sogar direkte Beteiligung auf beiden Seiten, wird das nicht funktionieren.
Dabei geht es nicht darum, einseitig die Bedürfnisse Europas zu befriedigen, sondern darum, gemeinsam eine neue Kooperationsebene für klimaresiliente Entwicklung zu erreichen. Es wäre klug, den Staaten des “Globalen Südens” ein überzeugendes Angebot zu machen, die Herausforderungen der Menschheit gemeinsam anzugehen und zu lösen.
Wenn diese Angebote gut ausgestaltet sind und Entwicklungspolitik diese Rolle bekommt, können “Energiepartnerschaften” echte Triple-Win-Chancen sein: für die Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit, unsere nationalen Klimaziele und die Bewältigung der Klimakrise weltweit. Doch die Zeit ist knapp und die Fehler der Vergangenheit können wir uns nicht mehr leisten. Von Anfang an müssen alle mit an Bord sein und “on the go” miteinander und voneinander lernen.
Till Mansmann ist entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Seit August 2022 ist Mansmann zudem Innovationsbeauftragter “Grüner Wasserstoff” im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
The Namibian: Präsident Geingob verstorben – Vize Mbumba übernimmt. Namibias Präsident Hage Geingob ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, nachdem er von einer Reise zur Krebsbehandlung aus den Vereinigten Staaten wiedergekehrt war. Vizepräsident Nangolo Mbumba wird die Amtsgeschäfte bis zum Ende von Geingobs Amtszeit im März 2025 übernehmen, sich dann aber selbst nicht zur Wahl stellen. Mbumba sagte, es sei beruhigend zu sehen, dass das Land in dieser schweren Zeit ruhig und stabil bleibe.
BBC: Drei Tote, Hunderte Verletzte nach Gasexplosion in Nairobi. Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist am Donnerstagabend im Bezirk Embakasi der kenianischen Hauptstadt explodiert. Der Lkw stand auf dem Parkplatz eines illegalen Gaswerks. Drei Anträge auf Baugenehmigung für den Bau einer Lager- und Abfüllanlage an diesem Standort waren abgelehnt worden, so die Aufsichtsbehörde Epra. Noch ist unklar, wie die Anlage dennoch in Betrieb sein konnte.
The Standard: Ruto – Ich werde gegen den Besitzer der Gasanlage vorgehen. Der kenianische Präsident William Ruto hat versprochen, entschieden gegen den Eigentümer der illegalen Flüssiggas-Anlage (LPG) vorzugehen. Die Explosion tötete mindestens drei Menschen. Mehr als 300 Menschen und Hunderte Bewohner des Mradi Estate im Bezirk Embakasi East wurden verletzt.
Wall Street Journal: Unrwa, Hamas und die “Völkermord”-Verleumdung gegen Israel. Südafrikas Gerichtsprozess vor dem Internationalen Gerichtshof gegen basiere auf Berichten von Gruppen mit Verbindungen zu Terrororganisationen, schreibt Naftali Balanson in einem Gastbeitrag. Der Autor ist Chief Operating Officer der Organisation NGO Monitor.
The East African: Versicherer distanzieren sich von EACOP. Insgesamt 28 Versicherer haben bisher erklärt, dass sie die East African Crude Oil Pipeline nicht versichern werden. Dies ist eine Reaktion auf die Kritik von Umweltaktivisten an dem Projekt. Nach Ansicht von Experten steht das Projekt damit auf der Kippe, da die lokalen Versicherer nicht mehr als 30 Prozent der für das Projekt erforderlichen Versicherung übernehmen können.
Financial Times: Riesige Kupfervorkommen in Sambia entdeckt. Ein Bergbau-Startup, das von Bill Gates und Jeff Bezos unterstützt wird, hat in Sambia das größte Kupfervorkommen seit einem Jahrhundert entdeckt. Das Unternehmen KoBold Metals geht davon aus, dass der Standort Mingomba in der nördlichen Provinz Copperbelt zu den drei besten hochgradigen Kupferminen der Welt gehören wird. Das bedeutet einen potenziellen Schub für die Bemühungen des Westens, seine Abhängigkeit von China bei wichtigen Metallen zu verringern.

Lange soll seine Amtszeit nicht dauern – das wollte Namibias neuer Präsident Nangolo Mbumba offenbar schnell geklärt wissen. Nach dem Tod seiner Vorgängers Hage Geingob am Sonntagmorgen, sagte Mbumba nach seiner Vereidigung im neuen Amt: “Ich werde bei den Wahlen nicht dabei sein. Also habt keine Panik.” Tatsächlich war Geingobs Nachfolge intern bereits geklärt. Im vergangenen Jahr hatte sich Namibias dominierende Regierungspartei Swapo auf die bisherige Außenministerin, Netumbo Nandi-Ndaitwah, als Nachfolgerin Geingobs geeinigt. Daran will sich Mbumba offenbar auch trotz seiner neuen Position halten. Mbumba ist – wie sein Vorgänger – mit 82 Jahren noch Teil der alten Politikgarde, die das Land seit der Unabhängigkeit 1990 anführte. Nandi-Ndaitwah wird nun die neue Vizepräsidentin.
Für Mbumba bleibt so also nur eine Interimsrolle als Präsident, denn die nächsten Präsidentschaftswahlen sind bereits für November dieses Jahres geplant. Die Amtszeit des nächsten Präsidenten beginnt dann im März 2025. Dennoch fällt Mbumba eine wichtige Rolle im Präsidentschaftswahlkampf zu. Denn die seit der Unabhängigkeit überwältigende politische Dominanz der Swapo bröckelt seit Jahren.
Die Jugend des Landes wünscht sich einen Generationenwechsel an der Spitze des Staates. Die Generation der Befreiungskämpfer ist in die Jahre gekommen und auch der respektierte Geingob schaffte es nicht, sein Versprechen vom steigenden Wohlstand umzusetzen. Jetzt muss die Swapo den Wahlkampf ohne ihren führenden Kopf Geingob bestreiten, den Mbumba am Sonntag als “eine Ikone des Befreiungskampfes und führenden Architekten unserer Verfassung” bezeichnete. Im Januar war bekannt geworden, dass Geingob an Krebs erkrankt war. Er hatte immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen.
Mbumbas Aufgabe wird es also sein, die Amtsgeschäfte so ruhig wie möglich zu führen. Nur so kann er Nandi-Ndaitwah die größtmögliche Rückendeckung im Wahlkampf geben. Seit Jahren verliert die Swapo durch große Korruptionsskandale an Rückhalt in der Bevölkerung. Diese sollen den Wahlkampf von Nandi-Ndaitwah nicht beeinflussen. Dass Mbumba über das nötige Durchhaltevermögen verfügt, hat er bewiesen.
Fast 20 Jahre lang gehörte er als Minister mit verschiedenen Fachbereichen den Kabinetten der ersten beiden Präsidenten Namibias, Sam Nujoma und Hifikepunye Pohamba an. 2012 legte Mbumba seinen Posten als Sicherheitsminister nieder, da er zum Generalsekretär seiner Partei aufstieg. Sechs Jahre später kehre Mbumba in die Regierung zurück – nun als Vize des dritten Präsidenten Geingob.
Geboren wurde Mbumba als Sohn zweier Lehrer in einem kleinen Ort im Norden Namibias. Bereits als junger Mann engagierte sich Mbumba in der Jugendorganisation der Swapo. Nachdem die südafrikanischen Behörden ihn mehrmals verhaftet hatten, floh Mbumba nach Sambia. Mithilfe eines Stipendiums der Vereinten Nationen konnte er in den USA studieren und schloss mit einem Master in Biologie an der University of Connecticut ab. Anschließend arbeitete er als Lehrer in New York, bevor er Ende der 1970er-Jahre nach Afrika zurückkehrte. Mitte der 1980er-Jahre wurde er persönlicher Sekretär von Präsident Nujoma und war wenige Jahre später an den Verhandlungen über die Unabhängigkeit Namibias beteiligt. Vor fünf Jahren verlieh ihm die University of Namibia den zeremoniellen Titel des “Kanzlers”.
Als Vizekanzler war Mbumba zudem einer der wichtigsten Berater Geingobs in vielen politischen Fragen – auch in der für Deutschland wichtigen Frage, wie das Land mit dem von den Deutschen begangenen Völkermord an den Herero und Nama umgehen sollte. Mbumba beaufsichtigte in den vergangenen Jahren die schwierigen Verhandlungen.
Die nach der “gemeinsamen Erklärung” 2021 aufgenommenen Nachverhandlungen hatten im Januar einen schweren Rückschlag erlitten, als Präsident Geingob die Bundesregierung für ihre Unterstützung Israels vor dem Internationalen Gerichtshof scharf kritisiert hatte. Dass die Verhandlungen mit Präsident Mbumba einfacher werden, ist eher unwahrscheinlich.
Mbumba hatte die vereinbarte Entschädigungssumme vor zwei Jahren scharf kritisiert. Die Bundesregierung hatte den Betrag von 1,1 Milliarden Euro zudem nicht als Entschädigung für den Völkermord, sondern als “Wiederaufbauhilfe” deklariert. Vielleicht macht der Wechsel an der namibischen Regierungsspitze aber auch einen Neustart der Verhandlungen möglich. David Renke

Was ist nur los mit ihm? Er ist eben alt geworden, sagen die einen. Nein, sagen die anderen. Da ist was ganz anderes im Busch: Jetzt ist er frisch verheiratet und hat einfach die Prioritäten nicht mehr im Blick, hat Kopf und Herz und woanders – Sadio Mané, Senegals Star-Stürmer.
Mané hat viele Fans beim diesjährigen Afrika-Cup schwer enttäuscht. Titelverteidiger Senegal flog schon im Achtelfinale raus, gegen das Gastgeberland Elfenbeinküste. Auf das erste Tor nach vier Minuten für die Senegalesen folgte fußballerisch wenig, klagten die Kommentatoren. Nach kräftezehrender Verlängerung im schwül-heißen Klima fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Als ein senegalesischer Spieler die Latte traf, war es vorbei.
Riesenenttäuschung im Senegal, vor den TV-Bildschirmen und beim Public Viewing an der Küstenstraße Corniche. Nach dem Spiel gehen die Leute erstmal frische Luft schnappen und zum Kiosk an der Ecke Snacks holen, traurige, lange Gesichter. Kollektive Trauer statt der Party, auf die sich schon viele gefreut hatten. Das Aus der Löwen von Trainer Cissé wird intensiv diskutiert, mit gedämpften Stimmen und gesenkten Köpfen. Wie konnte das passieren? Mané war einfach nicht präsent, hat Bälle verfehlt, aber auch der Schiedsrichter, der war parteiisch (und wurde nach dem Spiel suspendiert).
Im Senegal ist Fußball wirklich so etwas wie ein Nationalsport. Kein Streifen zwischen den Häusern, kein Strand, kein Fußballplatz, die nicht jeden Tag eifrig bespielt werden, von groß und klein. Noch allerdings sieht man im konservativen Senegal kaum Mädchen kicken.
In Dakar ist Sadio nicht zu entkommen, er macht Werbung für gefühlt alles, Pepsi, Telefontarife, Wasser, grinst breit von meterhohen Plakaten an der Straße, von Hauswänden, Afrika-Cup hin oder her.
Auf ihren Sadio sind die Senegalesen bisher sehr stolz gewesen, ein so bescheidener Mitbürger, der trotz viel Geld nie arrogant auftritt, die leisen Töne spielt und fußballerisch glänzt. Während seiner unglücklichen Zeit beim FC Bayern volles Verständnis in Manés Heimat Senegal: Die Bayern wussten den 31-Jährigen einfach nicht zu schätzen, haben ihn zu wenig unterstützt. lcw
