die Bundesregierung sieht sich innenpolitischem Druck ausgesetzt, die irreguläre Migration nach Deutschland zu reduzieren – und muss zugleich den Arbeitskräftemangel in der Republik mit Fachkräften aus dem Ausland lindern. Bei diesem Spagat sollen auch neue Migrationsabkommen mit drei afrikanischen Staaten helfen. Lucia Weiß und David Renke haben sich angeschaut, welche Rolle diese Länder tatsächlich bei der irregulären Migration spielen.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem die wichtigsten Köpfe der deutschsprachigen Afrikaszene aus dem Bereich Gesellschaft vor.
Daneben haben wir weitere interessante Analysen, News und Berichte für Sie.
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Migration war offenbar ein “großes Thema” bei den Gesprächen zwischen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita am vergangenen Freitag. Gleichzeitig forderte Bourita einen ganzheitlichen Ansatz, der Zusammenarbeit in den Fokus rücke. Abkommen, die sich einseitig nur auf die Rücknahme abgeschobener Ausländer konzentrieren, sind auch für die Bundesregierung nicht mehr zeitgemäß.
Deshalb setzt die Bundesregierung auch mit drei afrikanischen Ländern auf Migrationspartnerschaften, die gleichzeitig den Zugang für Fachkräfte aus Afrika nach Deutschland erleichtern sollen. Fraglich ist dabei allerdings, ob Abkommen mit Kenia, Marokko und Ghana tatsächlich dazu beitragen können, die irreguläre Migration zu verringern – ein Ziel, das die Bundesregierung ausdrücklich mit ihren Migrationsabkommen verfolgt. Der Blick in die Zahlen wirft Fragen auf.
Denn aus diesen Ländern suchen vergleichsweise wenig Menschen Schutz in Deutschland. So bekamen in allen drei Ländern deutlich mehr Menschen ein nationales Visum – Kategorie “D”, für langfristige Aufenthalte; im Gegensatz zu Kategorie “C”/Schengen-Visum, für kurzfristige Besuche und Urlaube – als sie Asylanträge stellten.
Für 2023 sah das nach Angaben des Auswärtigen Amtes und des BAMF wie folgt aus:
Das schlägt sich auch in den Zahlen der Abschiebungen von Menschen mit einem Pass aus diesen Ländern nieder. Ausführliche Angaben zu den aktuellen Zahlen hat die Bundesregierung im März in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion gemacht:
Weder Marokko noch Kenia oder Ghana gehören zu den 15 Ländern, in die die meisten Personen abgeschoben werden.
Vielversprechender sind die Migrationsabkommen jedoch hinsichtlich der Möglichkeiten, die die Länder für die Rekrutierung von Fachkräften für den deutschen Arbeitsmarkt liefern. Im Detail kommen zudem noch weitere Vorteile bei den einzelnen Ländern hinzu, die sie für die Migrationspartnerschaften prädestinieren. Während das Migrationsabkommen mit Marokko bereits im Januar unterzeichnet wurde, ist der Abschluss mit Kenia im September geplant. Wann ein Abkommen mit Ghana unterzeichnet werden könnte, ist laut Innenministerium noch nicht bekannt. Im März habe man eine weitere Verstetigung und Vertiefung der guten Zusammenarbeit verabredet, sagte ein BMI-Sprecher Table.Briefings auf Anfrage.
Das sind die Hintergründe für die Partnerschaften:
Marokko
Das nordafrikanische Land ist ein wichtiger Partner in Energiefragen für Deutschland. Jüngst unterzeichnete das BMZ eine Vereinbarung mit Marokko für eine neue Partnerschaft, um noch enger bei erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff zusammenzuarbeiten. Deutschland erhofft sich von Marokko auch Fachkräfte vor allem für Handwerksberufe, wie etwa Elektriker. Helfen bei der Vermittlung soll ein Migrationszentrum, so wie etwa auch in Nigeria.
Ghana
Auch in Ghana gibt es ein Migrationszentrum. Das westafrikanische Küstenland hat viel Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften, wie etwa die AHK beobachtet, die in Eigenregie versucht, Fachkräfte zu vermitteln. Bisher wandern junge Menschen regulär vor allem in anglophone Länder aus.
Kenia
Kenia gilt traditionell als einer der wichtigsten Verbündeten des Westens auf dem Kontinent. Für Deutschland ist Kenia insbesondere als afrikanischer Vorreiter beim Klimaschutz entscheidend. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Außenministerin Annalena Baerbock würdigten Kenias Rolle als Antreiber der Energiewende auf dem Kontinent bei ihren Besuchen in diesem und im vergangenen Jahr. Zudem sieht die Bundesregierung großes Potenzial bei der Anwerbung qualifizierter Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt.
Neben den neuen Migrationsabkommen gibt es im Übrigen weitere migrationsrelevante Abkommen mit afrikanischen Ländern. Dabei handelt es sich um klassische bilateralen Rückübernahmeabkommen. Mit folgenden afrikanischen Ländern hat Deutschland Rückübernahmeabkommen:
In Kenia mögen geplante Steuererhöhungen die Menschen auf die Straße treiben. Doch der IWF hält sein Vorgehen in Schuldenkrisen für gelungen. “Wenn Länder tatsächlich mit der Schuldentilgung ins Straucheln geraten, ist eine Umstrukturierung entscheidend, um den Schaden zu begrenzen”, schreibt Ceyla Pazarbasioglu, Leiterin der Strategie-Abteilung des IWF, nun in einem Blog. “Die Umstrukturierung sollte so schnell wie möglich erfolgen, denn Verzögerungen verschärfen die Notlage, indem sie die Anpassung erschweren und die Kosten für Schuldner und Gläubiger erhöhen.”
Das Common Framework, das Schuldner und Gläubiger an einen Tisch bringt, hätte erste Erfolge durch eine Verkürzung der Reaktionszeit verzeichnet. Als Beispiel nennt Pazarbasioglu Ghana. Hier sei in fünf Monaten eine Einigung erzielt worden. Damit hätten die Verhandlungen nur halb so lang gedauert wie im Tschad 2021 oder in Sambia 2022. Für Äthiopien rechnet die Volkswirtin mit einer noch kürzeren Zeitspanne.
“Diese Verbesserungen sind unter anderem deshalb möglich, weil die Beteiligten inzwischen mehr Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt haben, auch mit nicht-traditionellen staatlichen Gläubigern wie China, Indien und Saudi-Arabien”, schreibt Pazarbasioglu. Bewährt habe sich auch die Schaffung des Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR), der IWF, Weltbank und die Führung der G20 zusammenbringt.
Im Falle Kenias hat der IWF eine Sanierung des Staatshaushalts gefordert. Das Haushaltsdefizit lag 2023/2024 bei geschätzt 5,7 Prozent des BIP. Präsident William Ruto hat diverse Verbrauchsteuern erhöht und die Steuerbasis verbreitert. So beschloss er eine Kfz-Steuer von 2,5 Prozent und eine Steuer von 16 Prozent auf Brot. Die Brotsteuer trifft die Bevölkerung hart, obwohl Mais das Hauptnahrungsmittel in Kenia ist.
Die Steuererhöhungen haben heftige Unruhen ausgelöst. Dabei erzielte das Land wirtschaftspolitisch Fortschritte. Die wirtschaftliche Lage ist offenkundig besser als die Stimmung. So ist der Rendite-Spread zu US-Dollar-Anleihen von 14 Prozentpunkten vor rund zwei Jahren auf bis zu sechs Prozentpunkte gesunken.
Gleichzeitig reduziert der IWF die Erweiterte Fondsfazilität (EFF) und die Erweiterte Kreditfazilität (ECF) von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 971 Millionen. Dieser Betrag wird Kenia noch ausbezahlt. Die Reduzierung der Kreditaufnahme beim IWF soll das internationale Vertrauen in Kenia stärken.
Auch konnte die Regierung im Februar eine Euro-Anleihe vorzeitig zurückkaufen. Kenia erwarb 1,44 Milliarden US-Dollar der am 24. Juni fällig gewordenen Euro-Anleihe von zwei Milliarden US-Dollar. Dies war durch eine neue, erfolgreich platzierte internationale Anleiheemission möglich. Auch das ist ein Erfolg, den sich Kenia zugute halten kann.
“Die Aussicht auf zusätzliche Mittel von multilateralen Kreditgebern dürfte die externen Finanzierungsengpässe weiter verringern”, urteilt die Ratingagentur Fitch. So hat die Weltbank im Rahmen einer Transaktion zur Förderung der fiskalischen Nachhaltigkeit und der Entwicklung einer widerstandsfähigen Wachstumspolitik eine Finanzierung von 1,2 Milliarden Dollar genehmigt.
Die finanzielle Lage Kenias ist somit angespannt, aber längst nicht schlimm wie die Unruhen vermuten lassen. Im zurückgezogenen Haushaltsentwurf für 2024/2025 schätzte die Regierung, dass der Schuldendienst 5,5 Milliarden Dollar und damit 5,4 Prozent des BIP betragen wird. Vom Haushaltsjahr 2025 an dürfte der Schuldendienst sinken. Und dennoch: “Wir gehen davon aus, dass er in den Haushaltsjahren 2025 und 2027 immer noch mehr als drei Milliarden Dollar jährlich betragen wird”, schreibt Fitch weiter.
Dabei geht es nicht um Kenia allein. “Etwa 15 Prozent der Länder mit niedrigem Einkommen sind überschuldet, und weitere 40 Prozent sind stark überschuldet”, warnt Pazarbasioglu. “Die Länder mit niedrigem Einkommen müssen in den nächsten zwei Jahren noch immer jährlich etwa 60 Milliarden Dollar ihrer Auslandsschulden refinanzieren – ungefähr das Dreifache des Durchschnittswerts im Jahrzehnt bis 2020.”
Auch Aktieninvestoren werden vorsichtig. Der Renditeabstand zwischen den entwickelten Aktienmärkten und den Schwellenmärkten hat sich zuletzt ausgeweitet. “Wir sind fast wieder auf dem Tiefstand, der den Economist im Jahr 2000 dazu veranlasste, Afrika als ,den hoffnungslosen Kontinent’ zu bezeichnen”, meint Charlie Robertson, Leiter Makro-Strategie des Asset-Managers FIM Partners in London. “Das lässt darauf schließen, dass viele Märkte zwar alle schlechten Nachrichten eingepreist haben, von den vielen guten Nachrichten jedoch kaum etwas.”
Auch Dan Keeler, Gründer des Informationsdienstes Frontier Market News, ist positiv gestimmt: “Von der Bildung einer Koalitionsregierung in Südafrika über Währungsreformen in Nigeria und Ägypten bis hin zu Fortschritten bei den Schuldenverhandlungen in Sambia, Ghana und Äthiopien zeichnet sich ein vielversprechendes Bild ab, das die wirtschaftliche Erholung in vielen wichtigen Volkswirtschaften des Kontinents unterstützen sollte.”
In einem “Family Meeting”, wie besondere Staatsansprachen von Präsident Cyril Ramaphosa genannt werden, verkündigte dieser am späten Sonntagabend: Das neue Kabinett der siebten Regierung des demokratischen Südafrika steht. In der vergangenen Woche gab es Momente, da stand die neue aus elf Parteien bestehende “Regierung der nationalen Einheit” in Südafrika auf Messers Schneide und drohte auseinanderzubrechen, bevor sie ihre eigentliche Arbeit aufnehmen konnte. Die Kabinettsverhandlungen gestalteten sich zäh und langwierig. Mit elf Tagen waren sie die längsten in der Geschichte des Landes. Präsident Ramaphosa sprach diplomatisch von Zeit, die notwendig war, um die “Stabilität des neuen Kabinetts” sicherzustellen. Aber auch: Als “relativ junge Demokratie” könnten “wir stolz darauf sein”, in so kurzer Zeit eine Regierung aus so vielen Parteien zu bilden.
Es ging nicht nur um die Zahl der Ministerposten, um die die neue Regierungspartei und ehemalige Opposition Democratic Alliance (DA) mit dem African National Congress (ANC) feilschte, sondern auch um wichtige Ministerien. Bis zuletzt stand das Handels- und Industrieministerium im Zentrum der Verhandlungen. Die DA beanspruchte es für sich, da es zentral für die Wirtschaft Südafrikas ist, die dringend Reformen braucht. Am Ende jedoch musste sich die DA stattdessen mit dem Landwirtschaftsministerium zufriedengeben, das ihr Parteivorsitzender John Steenhuisen übernahm. Das Ressort Handel und Industrie ging hingegen an den ehemaligen Bürgermeister von Johannesburg, Parks Tau vom ANC.
Der ANC hatte trotz der Wahlschlappe nicht nachgegeben. Ramaphosa hat es geschaffte, die DA von zentralen und mächtigen Ministerien fernzuhalten, darunter Finanzen, Bergbau und das Außenministerium. Insgesamt bekam die DA sechs Kabinettsposten, weniger, als sie bis zuletzt gefordert hatte. Im Kabinett der dritten Ramaphosa-Regierung wird die DA folgende Ministerien leiten:
Nur das Innenministerium hat große politische Relevanz, da es für das chaotische Einwohnerregister und Immigration zuständig ist. Alle anderen Ministerien gelten als zweitrangig in Südafrika. Wichtigere Ministerien werden nur durch sechs stellvertretende Ministerposten abgedeckt, darunter Finanzen, Handel und Industrie, Energie und Strom, sowie Wasser und sanitäre Einrichtungen.
Entgegen langer Forderungen wurde das Kabinett nicht entschlackt, sondern ist sogar von 30 auf 32 Ministerien gewachsen, was im internationalen Durchschnitt als zu groß und aufgebläht gilt. Hinzu kommen 43 stellvertretende Minister. Mehr als 60 Prozent der Ministerposten gingen an den ANC, obwohl die Partei nur leicht mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen bekam. Unter den stellvertretenden Ministern gehören sogar mehr als 75 Prozent dem ANC an.
Unter den Ministern erscheinen viele Namen von bekannten ANC-Größen. Eine Reihe von ihnen konnten ihre Posten sogar verteidigen, etwa der stellvertretende Präsident, Paul Mashatile oder Stromminister Kgosientsho Ramokgopa, der jetzt auch für Energie zuständig ist, was zuvor ein separates Ministerium war. Eine Überraschung: Außenministerin Naledi Pandor hat sich wohl von der politischen Bühne verabschiedet und wird in Rente gehen. Ihren Posten übernahm der ehemalige Justizminister Ronald Lamola, mit 40 Jahren einer der jüngsten Kabinettsmitglieder und enger Verbündeter von Ramaphosa.
Die neue Regierung erscheint deswegen auch ein wenig wie eine Kabinettsumbildung, die erforderlich wurde, da neue Koalitionspartner bedient werden mussten. Neben dem ANC und der DA bekamen drei weitere Parteien innerhalb der “Regierung der nationalen Einheit” jeweils mindestens einen Ministerposten.
Die Economic Freedom Fighters (EFF), die nicht Teil der Regierungskoalition sind, hatten am Freitag sich noch in einem letzten Versuch angeboten, aber nur unter der Bedingung, dass es eine Regierung unter anderem ohne die DA gibt. Ursprünglich hatten sie gefordert, dass Ramaphosa nicht mehr Präsident ist.
Zum Zeitpunkt des neuen Koalitionsangebots aber hatten die DA und der ANC schon an den Feinheiten des neuen Kabinetts gefeilt. Die EFF wurde im Regen stehen gelassen. Diese sprach daraufhin von einer “imperialistischen, konterrevolutionären und weiß-rassistischen Agenda”.
Vor genau den Gefahren dieser populistischen Parolen hatte Gayton McKenzie, Parteivorsitzender der rechtsgerichteten Patriotic Alliance, gewarnt. Für seine Unterstützung der Koalition hatte er einen Ministerposten gefordert und bekam daraufhin Sport, Kunst und Kultur. Dass sein Leben noch einmal diese Wendung nimmt, ist vielleicht die größte Überraschung dieser Wahl. McKenzie ist ein ehemaliger Bankräuber, der deshalb 17 Jahre im Gefängnis saß.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze will erneut für das Präsidentenamt der Sahel-Allianz kandidieren. Dies erfuhr Table.Briefings exklusiv aus dem Entwicklungsministerium (BMZ). Demnach wird sich Entwicklungsministerin Svenja Schulze bei der Generalversammlung der Sahel-Allianz am 16. Juli 2024 in Berlin zur Wahl stellen. Als Vorsitzender des technischen Steuerungsgremiums kandidiert wieder Weltbank-Vizepräsident Ousmane Diagana. Vor knapp einem Jahr wurde Schulze in Nouakchott das erste Mal zur Präsidentin des Unterstützerbündnisses gewählt.
Bisher hatte Schulze in ihrer Präsidentschaft einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Bevölkerung im Sahel gelegt. “Ein gemeinsames Vorgehen ist wichtiger denn je, denn die Region ist zunehmend von dschihadistischem Terror, organisierter Kriminalität und der Klimakrise bedroht”, sagte ein BMZ-Sprecher gegenüber Table.Briefings.
Für die nächste Amtszeit wolle Schulze die Schaffung neuer Jobs, mehr Bildungsangebote für die junge Bevölkerung und für eine bessere Wasser- und Stromversorgung, gerade auch im ländlichen Raum, in den Fokus rücken. Zudem wolle Schulze stärker die südlich angrenzenden Küstenstaaten in Westafrika in den Blick nehmen. “Sie sind zunehmend vom Übergreifen dschihadistischer Gruppen aus dem Sahel bedroht. Das erfordert eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit im Kreis der Geber sowie mit den Partnerländern im Sahel und den Küstenstaaten”, so der Sprecher weiter.
Ziel der Allianz ist die nachhaltige Entwicklung der Länder in der Sahelzone. Die Sahel-Allianz ist die wichtigste entwicklungspolitische Plattform für die Region. Der Unterstützer-Verbund wurde 2017 gegründet. Die Initiativen und Investitionen der Sahel-Allianz-Mitglieder belaufen sich nach eigenen Angaben auf mehr als 28 Milliarden Euro. Gleichzeitig steht die Allianz nach den zahlreichen Militärputschen in der Region politisch unter Druck. Diese sollte ursprünglich eng mit den G5 Sahel zusammenarbeiten. Nachdem Mali die Gruppe 2022 verlassen hatte, waren im vergangenen Jahr auch Burkina Faso und Niger ausgetreten.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der schwierigen Umstände in der Region nutzte Schulze das Präsidentenamt in der vergangenen Amtsperiode über die Entwicklungspolitik hinaus auch symbolpolitisch. So war Schulze die erste europäische Ministerin, die nach dem Putsch nach Burkina Faso gereist ist und dort mit Mitgliedern der Junta gesprochen hat.
Das sind die 18 Mitglieder der Sahel-Allianz:
Hinzu kommen neun Beobachterstaaten. dre
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr gestalten sich laut einer Evaluierung des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums in weiten Teilen als effektiv. In dem Bericht von Ende Juni wird eine Diskrepanz zwischen den weit gefassten politischen Einsatzzielen und begrenzten militärischen Fähigkeiten bemängelt. Entsprechend fordern AA und BMVg in ihrer Evaluation künftige Einsätze “klarer entlang der sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands” zu priorisieren. Mit der Konzentration auf die Landes- und Bündnisverteidigung und dem Ende der großen Auslandseinsätze in Afghanistan und Mali rücken die Missionen der Bundeswehr im sogenannten internationalen Krisenmanagement in den Hintergrund.
Die Übersicht über die wichtigsten laufenden Auslandseinsätze mit Afrika-Bezug:
Die von der Europäischen Union geführte “militärische Krisenbewältigungsoperation im Mittelmeer” der European Naval Forces Mediterranean (EUNAVFOR MED) Irini soll in erster Linie das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Irini löste 2020 in dieser Aufgabe die vorherige EU-Mission Sophia ab, die am Streit der Mitgliedsstaaten über den Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten und Flüchtlingen zerbrochen war.
Militärisch beteiligt sich die Bundeswehr an der Mission aktuell nur mit Stabspersonal; zur Seeraumüberwachung stellt Deutschland ein ziviles Flugzeug zur Verfügung. Das Mandat (Bundestagsdrucksache 20/10508) wurde vom Bundestag zuletzt im März dieses Jahres verlängert.
Der von der EU geführte Einsatz im Roten Meer ist die jüngste Auslandsmission der Bundeswehr. Zusammen mit Schiffen anderer EU-Staaten und in Zusammenarbeit der von den USA geführten “Operation Prosperity Guardian” sollen Handelsschiffe vor den Angriffen der Huthi-Milizen im Jemen geschützt werden. Diese hatten im November vergangenen Jahres damit begonnen, als Unterstützung für die Hamas im Krieg mit Israel westliche Handelsschiffe auf dem Seeweg zum für den internationalen Handel wichtigen Suezkanal anzugreifen. Der Bundestag hatte das Mandat für die deutsche Beteiligung an der EU-Mission (Bundestagsdrucksache 20/10347) im Februar beschlossen.
Die UN-Mission im Südsudan entwickelte sich aus der vorangegangenen UN-Mission für den ganzen Sudan – nach Abspaltung des Südens bauten die Vereinten Nationen eine neue Operation auf, in der unter anderem Militärbeobachter eine friedliche Entwicklung vor dem Hintergrund innerer Spannungen im Land sicherstellen sollen. Derzeit sind zwölf deutsche Soldaten und Soldatinnen in dieser Mission; sowohl im Stab in der Hauptstadt Juba als auch als Beobachter in verschiedenen Teilen des Landes. Das Mandat des Bundestages (Bundestagsdrucksache 20/10160) wurde zuletzt Anfang dieses Jahres verlängert.
Seit 1991 soll die Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) ein Referendum zur Zukunft der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara umsetzen. Spätestens seit der Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump für Marokkos Gebietsansprüche auf die Westsahara scheint allerdings jegliche Aussicht auf eine Volksabstimmung unwahrscheinlich. Auch Alt-Bundespräsident Horst Köhler hatte sich eine Zeitlang für die UNO als Vermittler versucht – allerdings ohne Erfolg. Anfangs war Deutschland mit Polizisten des Bundesgrenzschutzes beteiligt, ehe 2013 die Bundeswehr diese Aufgabe übernahm. Aktuell beteiligt sie sich mit vier Offizieren an dieser Beobachtermission, sowohl im von der marokkanischen Armee kontrollierten Gebiet als auch im Bereich der Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario. Die Entsendung der deutschen Soldaten gilt nicht als mandatierungspflichtiger Einsatz, sodass ihn nur das Bundeskabinett und nicht das Parlament beschloss.
Zudem betreibt die Bundeswehr einen Luftwaffenstützpunkt in Niger. Bis Ende Mai war der Einsatz der 90 Soldaten über ein vom Bundestag genehmigtes Mandat für die Minusma-Mission abgedeckt. Bis mindestens August soll der Luftwaffenstützpunkt als sogenannte bemannte Cold Base weitergeführt werden. Dies hatte das BMVg in einem bilateralen Abkommen vereinbart. tw/dre
Die Europäische Investitionsbank in Luxemburg hat eine neue Strategie für ihr Fördergeschäft beschlossen. Demnach setzt sie künftig acht Schwerpunkte:
Für Unternehmen und Investoren, die in Afrika aktiv sind, ist besonders der erste Punkt wichtig, zum Teil auch der siebte. Künftig legt die EIB einen Schwerpunkt auf die Klimafinanzierung, in die “deutlich mehr als 50 Prozent” der EIB-Mittel fließen sollen. Das betrifft auch Unternehmen, die im afrikanischen Energiesektor aktiv sind. Denn auch hier verändert die EIB ihren Ansatz.
Bisher haben sich europäische Energieprojekte in Afrika häufig auf die Energieerzeugung beschränkt. Das will die EIB ändern. “Investitionen in die physische Infrastruktur, wie etwa Verbindungsleitungen, Netze, Energiespeicherung und erneuerbare Energien, werden verstärkt, ebenso wie die Unterstützung der biologischen Vielfalt, einer Kreislaufwirtschaft und naturbasierter Lösungen”, heißt es in dem Papier.
Neu ist ein weiterer Schwerpunkt auf die Wasserwirtschaft. Auch in der Vergangenheit hat die EIB Wasserprojekte finanziert. Das will sie nun ausbauen. “Das Wasserprogramm wird vorhandene Ressourcen für Investitionen in Infrastruktur und effiziente Wassermanagementtechnologien bündeln und verstärken, um den Klimawandel zu mildern und sich an Überschwemmungen, Dürren und den steigenden Meeresspiegel anzupassen”, heißt es in der neuen EIB-Strategie.
Wasserprojekte sind als Investitionsvorhaben in vielen Fällen schwer zu finanzieren, weil sie in der Regel zu geringe Erlöse generieren, um eine marktgerechte Rendite sicherzustellen.
Für Afrika-Investoren interessant ist auch Punkt 7. Bei Impact-Investitionen will die EIB bestehende Partnerschaften vertiefen, vor allem über strategische Allianzen und Großprojekte im Rahmen der Global-Gateway-Initiative der EU.
Bisher ist die EIB vor allem auf Europa beschränkt. Im vergangenen Jahr hat sie Finanzierung von knapp 88 Milliarden Euro ausgereicht. Davon waren 90 Prozent innerhalb der EU. Dennoch dürfte das Afrikageschäft eine größere Rolle einnehmen, als diese beiden Zahlen vermuten lassen.
So will die EIB die Vernetzung mit anderen Förderbanken vorantreiben und mehr “strategische globale Allianzen im Rahmen von Großprojekten mit anderen multilateralen und regionalen Finanzinstituten” eingehen. Finanzierungen sollen sich künftig “auf eine begrenzte Zahl strategischer Infrastrukturprojekte” konzentrieren. Auswahlkriterium ist, dass sie “den größten Einfluss auf die Versorgung von Millionen von Menschen mit Trinkwasser, Bewässerung und Sanitäreinrichtungen haben können”. hlr

Seit 2021 liegt das Abkommen zwischen Deutschland und Namibia zur Anerkennung des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts, an den Herero und Nama, auf Eis. Zu stark war die Kritik der Opferverbände in Namibia. Die dortige Regierung konnte das Abkommen nicht einfach durchdrücken. Nun gibt es einen neuen Versuch, mit minimalen Verbesserungen von deutscher Seite. Die beiden Hauptprobleme bleiben jedoch bestehen: die Intransparenz des Prozesses und die Ablehnung durch wesentliche Teile der Herero und Nama.
Deutschland hat offenbar nachgebessert, wie aus einer Bekanntmachung der namibischen Vizepräsidentin Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah vom 27. Juni 2024 hervorgeht. Sie hatte in ihrer Eröffnung gegenüber dem Chiefs Forum erklärt, dass Deutschland bereit sei, die 2021 ausgehandelte Summe von 1,1 Milliarden Euro zu erhöhen, allerdings ohne einen konkreten Betrag zu nennen. Statt auf 30 Jahre sollte nun ein – nicht spezifizierter – Teil vorab gezahlt werden. Auch in der Diaspora lebende Herero und Nama sollten davon profitieren können, aber im Grunde nur, wenn sie nach Namibia zurückkehrten. Die Zahlung werde nun auch nicht mehr als “Hilfe” oder “Zuschuss” bezeichnet, was in der Erklärung von 2021 für großen Ärger gesorgt hatte, sondern als “Sühne” beziehungsweise “Sühnefonds”. Der Genozid werde nun von Deutschland anerkannt, ohne den als Einschränkung empfundenen Zusatz “nach heutigem Verständnis” – 2021 hieß es noch, es handelte sich um Völkermord “nach heutigem Verständnis”.
Das Vorgehen, wie auch die Ergebnisse, werfen jedoch weiterhin Fragen auf:
Erstens, warum wird keine konkrete Summe benannt, um die nun erhöht wurde? Und warum werden nicht alle Fakten auf dem Tisch gelegt, auch nicht von deutscher Seite?
Wieso wird die Diaspora nur eingebunden, wenn sie nach Namibia zurückkehrt? Das ist das Gegenteil von Einbindung.
Warum wurde dies wieder intransparent hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, statt die Zivilgesellschaft in beiden Ländern endlich umfassend zu beteiligen? Der Eindruck bestätigt sich, dass die Bundesregierung ein Problem wegverhandeln will, ohne an einer wirklichen Aufarbeitung und Versöhnung, zu der auch die breite Aufklärung und Debatte gehören, interessiert zu sein.
Dazu passt auch das Zurückstufen und Ignorieren des Genozids in Deutschland selbst: Vor nur vier Wochen wurden die Opfer des Genozids an den Herero und Nama in der offiziellen Erinnerungspolitik des Hauses Roth als Opfer zweiter Klasse eingeordnet, die man im offiziellen Gedenkstättenprogramm nicht berücksichtigen müsste, zurückgesetzt hinter die Opfer der DDR-Diktatur.
In Hamburg läuft derzeit das Planungsverfahren für die Bebauung des zentralen deutschen Erinnerungsortes an den Genozid, den Baakenhafen, mit Luxuswohnungen, ohne dass offenbar von der für die Aufarbeitung des kolonialen Erbes zuständigen Kulturbehörde im Vorfeld Einwände geäußert worden wären. Es braucht dort aber neben einem Gedenkort auch ein Dokumentationszentrum zum Genozid, und man wäre interessiert zu erfahren, was die Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama für die Aufarbeitung in Deutschland bedeutet. Es handelt sich eben nicht (nur) um ein Thema der Außenpolitik.
Bemerkenswert ist aber auch der politische Druck, unter den Namibia sich offenbar gesetzt fühlt, beziehungsweise den die namibische Regierung aufbaut, um ihr Abkommen dieses Mal innenpolitisch durchzusetzen. Wenn die internationale Gemeinschaft schon unfähig sei, den israelischen “Genozid in Gaza” zu stoppen, wie sollte man da auf internationalen Druck hoffen, um einen Genozid, der 120 Jahre zurückliegt, zu sühnen, so die Vizepräsidentin.
Dies zeigt, in welch verfahrene Lage die deutsche Verhandlungsstrategie seit 2015 den Aussöhnungsprozess gebracht hat. Es ist Machtpolitik, und nur das. Die Bundesregierung müsste aber nun auch erklären, warum die Bezeichnung des Gaza-Krieges als genozidal in Deutschland geächtet und kritisiert wird, man aber mit einer namibischen Regierung, die dies offen sagt, und ja auch der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof beigetreten ist, zu einem Hinterzimmerdeal bereit ist. Oder ist das einer der Gründe für den Weg, alles hinter verschlossenen Türen zu regeln?
Es wäre besser und der Frage der Anerkennung und Versöhnung sehr viel zuträglicher, wenn all dies offen und transparent diskutiert würde. Aber um Versöhnung und Wiedergutmachung scheint es zuallerletzt zu gehen.
Prof. Dr. Jürgen Zimmerer ist Historiker und Afrikawissenschaftler an der Universität Hamburg.
Reuters: Türkei vermittelt zwischen Äthiopien und Somalia. Die Türkei hat mit der Vermittlung von Gesprächen zwischen Somalia und Äthiopien über ein Hafenabkommen begonnen, das Addis Abeba Anfang dieses Jahres mit der abtrünnigen Region Somaliland unterzeichnet hat. Äthiopien hatte angeboten, 20 Kilometer Küstenlinie von Somaliland zu pachten und im Gegenzug dessen Unabhängigkeit anzuerkennen, was die somalische Zentralregierung in Mogadischu erzürnte. Die Türkei ist seit 2011 ein enger Verbündeter Somalias. Vertreter Somalilands nehmen nicht an den Gesprächen teil.
Bloomberg: Ruto: “Kein Blut an meinen Händen”. Der kenianische Präsident William Ruto hat seine Entscheidung verteidigt, das Militär einzusetzen, um die landesweiten Proteste der vergangenen zwei Wochen zu unterdrücken, bei denen mindestens 24 Menschen ums Leben kamen. Er habe keine andere Wahl gehabt, sagte Ruto in einer Fernsehansprache. Die kenianische Polizei habe ihr Bestes getan, so der Präsident weiter. Seine Regierung werde den Einsatz von scharfer Munition gegen die Demonstranten untersuchen.
Business Insider: Nächster Generalstreik in Nigeria droht. Die Campaign for Democratic and Workers’ Rights (CDWR) in Nigeria hat die nigerianischen Gewerkschaften zu einem 48-stündigen Generalstreik und Massenprotesten aufgerufen, unter anderem um eine Erhöhung des Mindestlohns zu fordern. Die Gruppe verwies auf die jüngsten erfolgreichen Massenproteste in Kenia als Inspirationsquelle für die Nigerianer, um die Regierung zur Rücknahme unliebsamer politischer Maßnahmen zu zwingen.
The East African: Al-Shabaab richtet sich in Ostafrika ein. In den vergangenen 14 Jahren hat die Terrorgruppe al-Shabaab tödliche Terroranschläge in Somalia, Kenia und Uganda verübt, bei denen Hunderte getötet wurden. In jüngster Zeit hat die Gruppe eine pan-ostafrikanische Truppe aufgebaut und Verbindungen zu anderen Milizen wie den ugandischen Allied Democratic Forces (ADF) hergestellt. Die Afrikanische Union unterstützt die Schaffung einer neuen Truppe, die die mehr als 10.000 Atmis-Soldaten ersetzen soll, die in Somalia gegen al-Shabaab kämpfen und das Land bis Ende Dezember verlassen sollen.
Le Monde: M23 nimmt strategisch wichtigen Ort im Ostkongo ein. Die von Ruanda unterstützte Rebellenmiliz M23 hat in ihrem Konflikt mit den Regierungstruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo eine strategisch wichtige Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Kanyabayonga liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Goma, der Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, die von M23 umzingelt ist, und gilt als Riegel, der den Zugang zu den nördlich gelegenen Handelszentren Butembo und Beni kontrolliert. Die Stadt hat mehr als 60.000 Einwohner.
AP: Mauretaniens Präsident wiedergewählt. Der mauretanische Präsident Mohamed Ould Ghazouani ist bei Wahlen im Amt bestätigt worden. Obwohl seine Gegner ihm Korruption und Misswirtschaft vorwerfen, wird er von vielen Mauretaniern als Stabilitätsanker gesehen und ist weiterhin beliebt. Er hat das in der von Putschen und Gewalt heimgesuchten Sahelzone liegende Land als strategischen Verbündeten des Westens positioniert. Mauretanien ist reich an natürlichen Ressourcen wie Eisenerz, Kupfer, Zink, Phosphat, Gold, Erdöl und Erdgas. Bis zum Ende des Jahres soll die Gasproduktion anlaufen.
The Conversation: Warum Freiheitsbewegungen an Regierungsverantwortung scheitern. Afrikanische Freiheitsbewegungen haben die versprochene Emanzipation des Volkes nicht immer erreicht. Stattdessen übernahm oft eine neue Elite die Kontrolle über die Regierung, hauptsächlich zu ihrem eigenen Vorteil. Die wachsende Frustration der “Befreiten” hat die anfängliche Unterstützung ihrer Regierung oft untergraben, wie der Afrikawissenschaftler Henning Melber beschreibt. Das zeige sich auch am schwindenden Rückhalt für den ANC in Südafrika und Swapo in Namibia, meint er.


Asfa-Wossen Asserate – Berater / Buchautor
Seine Kaiserliche Hoheit, Prinz Asfa-Wossen Asserate, lässt sich nicht ohne seinen Vater verstehen. Leul Ras Asserate Kassa war nicht nur Mitglied der kaiserlichen Familie, sondern auch der letzte Präsident des kaiserlichen Kronrats. Prinz Asfa-Wossen besuchte die Deutsche Schule in Addis Abeba und begann nach dem Abitur ein Studium in Tübingen. Dort wurde er Mitglied des Corps Suevia. Der kommunistische Umsturz 1974 veränderte auch sein Leben tief. 1978 wurde er in Frankfurt mit einer Arbeit zur äthiopischen Geschichte promoviert. Heute ist er ein erfolgreicher Buchautor und als Berater gefragter denn je.

Oumar Diallo – Leiter Afrika-Haus Berlin
Das Afrika-Haus in Berlin ist längst eine feste Institution in Berlin – und Oumar Diallo ist ihr leitender Kopf. Der in Guinea geborene Soziologe eröffnete das Afrika-Haus in Berlin-Moabit vor über 30 Jahren. Mittlerweile ist es Veranstaltungsort und Debattenraum. Diallo ist dabei immer wieder pointierter Kommentator zeitgeschichtlicher Entwicklungen in Afrika und Deutschland.

Liz Shoo – Journalistin Deutsche Welle und WDR
Mit ihrer strahlend guten Laune und fundierten Moderationen ist Liz Shoo aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken, wenn es um Afrika geht. Ihre Kindheit hat sie in einem kleinen Ort in Bayern verbracht, bis ihr Vater nach bestandener Promotion mit der Familie zurück nach Tansania zog. Liz Shoo kehrte zum Studium zurück nach Deutschland und moderiert heute für die Deutsche Welle und den WDR.

Horst Köhler – ehemaliger Bundespräsident
Mit seiner Hinwendung zu Afrika hat Horst Köhler in den Jahren 2004 bis 2010 Zeichen gesetzt, als er als Bundespräsident den Kontinent in den Mittelpunkt seines Amtes stellte. Darüber wird jedoch leicht vergessen, dass Köhler schon zuvor vom Jahr 2000 an als Geschäftsführender Direktor des IWF Zeichen in Richtung Afrika gesetzt hat. Eine seiner ersten Handlungen beim IWF war eine Diskussion mit Popstar Bono über eine Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer. Im Sommer 2017 berief ihn UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zum Sondergesandten für Westsahara. Nach zwei Jahren legte Köhler das Mandat nieder.

Charles Huber – Schauspieler / Autor / ehemaliger MdB
Dank seiner Rolle in der Fernsehserie Der Alte wurde Charles Huber einem Millionenpublikum bekannt. Sein Vater war der senegalesische Diplomat Jean-Pierre Faye, ein Neffe des ersten senegalesischen Staatspräsidenten Léopold Sédar Senghor. Doch seinen Vater lernte Huber erst kennen, als er 28 Jahre alt war. Von 2013 bis 2017 war er Bundestagsabgeordneter (CDU) und siedelte danach für einige Jahre in den Senegal um. Dort beriet er auch den damaligen Präsidenten Macky Sall. Noch heute ist er ein wichtiger Fürsprecher Afrikas in Deutschland.

Nneka Egbuna – R&B-Sängerin
Im nigerianischen Bundesstaat Delta ist Nneka Egbuna im Jahr 1980 geboren und kam im Alter von etwa 20 Jahren nach Hamburg, um an der dortigen Universität Anthropologie und Archäologie zu studieren. Als Sängerin hatte sie ihren Durchbruch 2004, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. In ihren Texten verarbeitet sie ihre Kindheit in Nigeria und ihr Leben in Deutschland. Auf diese Weise ist sie eine kraftvolle Stimme der afrikanischen Diaspora in Deutschland und darüber hinaus. Zurzeit ist auf Tour und bis Ende September in Hannover, Darmstadt, Monheim und Karlsruhe zu hören.

Alpha Dia – Model
Mit seinen 32 Jahren gehört Alpha Dia zu den Erfolgreichsten seiner Branche: Dia ist eines der weltweit gefragtesten männlichen Models – und nutzt seine Reichweite auch für den guten Zweck. Im Senegal geboren, wächst Dia bei seinem Vater in Hamburg auf. Nach dem Abitur wird der junge Mann von Modelscouts entdeckt und schafft schließlich den Durchbruch, obwohl er als junger, schwarzer Mann bei deutschen Kunden zunächst auf Ablehnung stößt. Dia hat eine eigene Stiftung gegründet (Dia Foundation) und hilft damit benachteiligten Kindern im Senegal.

Volker Schütte – Honorarkonsul Südafrika in Bremen / Reederei-Unternehmer
Der Mann drängt sich nicht laut in die Öffentlichkeit. Und doch ist Volker Schütte einer der kraftvollsten Fürsprecher für Afrika. Er ist Geschäftsführer des traditionsreichen Hauses Louis Delius GmbH & Co. KG in Bremen und engagierter Honorarkonsul von Südafrika. Im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft ist er stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister.
Gernot Wagner – Honorarkonsul DR Kongo in Leipzig
Die DR Kongo hat in ihrem Leipziger Honorarkonsul Gernot Wagner einen leidenschaftlichen Repräsentanten gefunden. Wagner hat an der Universität Bergakademie Freiberg studiert und sich als Ingenieur eingehend mit den Bodenschätzen Afrikas befasst. Und immer wieder treibt er Investitionsprojekte in der DR Kongo voran. Wagner ist Mitglied im Verein der Freunde Marokkos, im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, des Mittelstandsverbands BVMW, im Außenwirtschaftsausschuss und Vorstandsmitglied der Mittelstandsallianz Afrika MAA.

Michael Rabbow – Gesundheitsexperte / Vorstandsmitglied Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft
Es gibt wenige in Deutschland, die sich mit einer derart großen Leidenschaft für Afrika engagieren, wie Michael Rabbow. Auch hat er mit Sicherheit eines der stabilsten Netzwerke, das vor allem deshalb hält, weil er seine Kontakte nie zu seinem Vorteil benutzt. Jahrelang hat der Mediziner in Namibia gelebt und sich dort für öffentliche Gesundheit eingesetzt. Heute ist er unter anderem im Kuratorium der Deutschen Afrika-Stiftung aktiv.
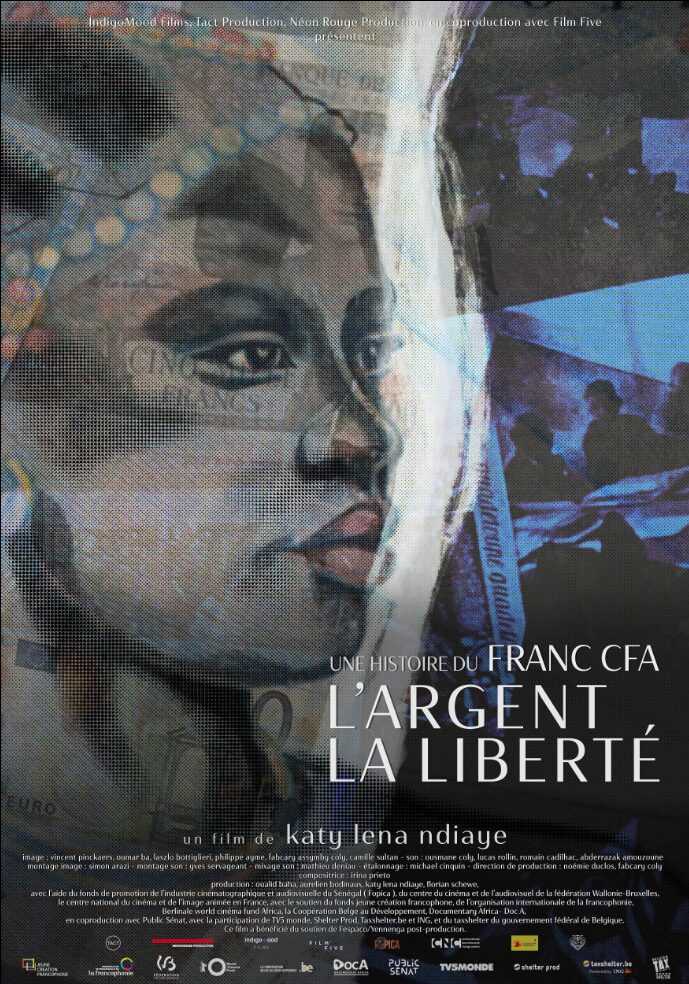
Leboon – Hört meine Geschichte!
Lepoon – Wir hören Deine Geschichte!
Das ist die klassische Eröffnungsformel auf Wolof, wenn jemand im Senegal eine Geschichte zu erzählen hat. Bis heute. Die senegalesische Regisseurin Katy Léna Ndiaye erzählt mit ihrem Film “L’argent, la liberté – Une histoire du Franc CFA” eine Geschichte, die ebenso ihre eigene wie die von rund 100 Millionen Menschen ist, die die Währung teilen. Derzeit läuft der Film von 2023, der auf einigen Festivals gastierte, in Dakar als Sondervorstellung im Kino.
Ndiaye, deren Familie aus dem Norden Senegals stammt, geht auf Spurensuche und stellt ihren Gesprächspartner die Frage: Was ist eigentlich eine Währung? Und was bedeutet, es keine volle Kontrolle über sie zu haben? Die Antworten liefern die in dieser Frage einschlägigen Experten, allesamt Kritiker des CFA. Zu Wort kommen etwa die senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr und Ndongo Samba Sylla oder der ehemalige beninische Premierminister und Investmentbanker Lionel Zinsou.
Der CFA sei, so der Schluss, vielmehr ein politisches Instrument der neokolonialen Kontrolle Frankreichs als ein ökonomisch sinnvolles Konstrukt.
Ndiayes Aufarbeitung ist mit 1 Stunde 45 Minuten etwas lang geraten. Die Stärke ihres Films, der mit ausschließlich natürlicher Belichtung, Close-ups und symbolisch aufgeladenen Bildern wie den von Norden nach Süden ziehenden Vögeln aufwartet, liegt in Ndiayes Zugang zu dem sperrigen Thema: Sie legt durch ihre filmische Herangehensweise bewusst offen, dass es sich beim CFA als vorteilhafte Lösung für alle um eine Erzählung, eine Fabulation, ein Märchen handelt. Und schlägt dem Publikum, aber insbesondere den Betroffen vor, stattdessen ein eigenes zu erfinden und zu erzählen. Es brauche eine ganzheitliche Vision einer Währung, die den Menschen in Afrika dient, sagt der Ökonom und Soziologe Martial Ze Belinga aus Kamerun am Ende des Films. lcw
die Bundesregierung sieht sich innenpolitischem Druck ausgesetzt, die irreguläre Migration nach Deutschland zu reduzieren – und muss zugleich den Arbeitskräftemangel in der Republik mit Fachkräften aus dem Ausland lindern. Bei diesem Spagat sollen auch neue Migrationsabkommen mit drei afrikanischen Staaten helfen. Lucia Weiß und David Renke haben sich angeschaut, welche Rolle diese Länder tatsächlich bei der irregulären Migration spielen.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem die wichtigsten Köpfe der deutschsprachigen Afrikaszene aus dem Bereich Gesellschaft vor.
Daneben haben wir weitere interessante Analysen, News und Berichte für Sie.
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Migration war offenbar ein “großes Thema” bei den Gesprächen zwischen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita am vergangenen Freitag. Gleichzeitig forderte Bourita einen ganzheitlichen Ansatz, der Zusammenarbeit in den Fokus rücke. Abkommen, die sich einseitig nur auf die Rücknahme abgeschobener Ausländer konzentrieren, sind auch für die Bundesregierung nicht mehr zeitgemäß.
Deshalb setzt die Bundesregierung auch mit drei afrikanischen Ländern auf Migrationspartnerschaften, die gleichzeitig den Zugang für Fachkräfte aus Afrika nach Deutschland erleichtern sollen. Fraglich ist dabei allerdings, ob Abkommen mit Kenia, Marokko und Ghana tatsächlich dazu beitragen können, die irreguläre Migration zu verringern – ein Ziel, das die Bundesregierung ausdrücklich mit ihren Migrationsabkommen verfolgt. Der Blick in die Zahlen wirft Fragen auf.
Denn aus diesen Ländern suchen vergleichsweise wenig Menschen Schutz in Deutschland. So bekamen in allen drei Ländern deutlich mehr Menschen ein nationales Visum – Kategorie “D”, für langfristige Aufenthalte; im Gegensatz zu Kategorie “C”/Schengen-Visum, für kurzfristige Besuche und Urlaube – als sie Asylanträge stellten.
Für 2023 sah das nach Angaben des Auswärtigen Amtes und des BAMF wie folgt aus:
Das schlägt sich auch in den Zahlen der Abschiebungen von Menschen mit einem Pass aus diesen Ländern nieder. Ausführliche Angaben zu den aktuellen Zahlen hat die Bundesregierung im März in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion gemacht:
Weder Marokko noch Kenia oder Ghana gehören zu den 15 Ländern, in die die meisten Personen abgeschoben werden.
Vielversprechender sind die Migrationsabkommen jedoch hinsichtlich der Möglichkeiten, die die Länder für die Rekrutierung von Fachkräften für den deutschen Arbeitsmarkt liefern. Im Detail kommen zudem noch weitere Vorteile bei den einzelnen Ländern hinzu, die sie für die Migrationspartnerschaften prädestinieren. Während das Migrationsabkommen mit Marokko bereits im Januar unterzeichnet wurde, ist der Abschluss mit Kenia im September geplant. Wann ein Abkommen mit Ghana unterzeichnet werden könnte, ist laut Innenministerium noch nicht bekannt. Im März habe man eine weitere Verstetigung und Vertiefung der guten Zusammenarbeit verabredet, sagte ein BMI-Sprecher Table.Briefings auf Anfrage.
Das sind die Hintergründe für die Partnerschaften:
Marokko
Das nordafrikanische Land ist ein wichtiger Partner in Energiefragen für Deutschland. Jüngst unterzeichnete das BMZ eine Vereinbarung mit Marokko für eine neue Partnerschaft, um noch enger bei erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff zusammenzuarbeiten. Deutschland erhofft sich von Marokko auch Fachkräfte vor allem für Handwerksberufe, wie etwa Elektriker. Helfen bei der Vermittlung soll ein Migrationszentrum, so wie etwa auch in Nigeria.
Ghana
Auch in Ghana gibt es ein Migrationszentrum. Das westafrikanische Küstenland hat viel Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften, wie etwa die AHK beobachtet, die in Eigenregie versucht, Fachkräfte zu vermitteln. Bisher wandern junge Menschen regulär vor allem in anglophone Länder aus.
Kenia
Kenia gilt traditionell als einer der wichtigsten Verbündeten des Westens auf dem Kontinent. Für Deutschland ist Kenia insbesondere als afrikanischer Vorreiter beim Klimaschutz entscheidend. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Außenministerin Annalena Baerbock würdigten Kenias Rolle als Antreiber der Energiewende auf dem Kontinent bei ihren Besuchen in diesem und im vergangenen Jahr. Zudem sieht die Bundesregierung großes Potenzial bei der Anwerbung qualifizierter Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt.
Neben den neuen Migrationsabkommen gibt es im Übrigen weitere migrationsrelevante Abkommen mit afrikanischen Ländern. Dabei handelt es sich um klassische bilateralen Rückübernahmeabkommen. Mit folgenden afrikanischen Ländern hat Deutschland Rückübernahmeabkommen:
In Kenia mögen geplante Steuererhöhungen die Menschen auf die Straße treiben. Doch der IWF hält sein Vorgehen in Schuldenkrisen für gelungen. “Wenn Länder tatsächlich mit der Schuldentilgung ins Straucheln geraten, ist eine Umstrukturierung entscheidend, um den Schaden zu begrenzen”, schreibt Ceyla Pazarbasioglu, Leiterin der Strategie-Abteilung des IWF, nun in einem Blog. “Die Umstrukturierung sollte so schnell wie möglich erfolgen, denn Verzögerungen verschärfen die Notlage, indem sie die Anpassung erschweren und die Kosten für Schuldner und Gläubiger erhöhen.”
Das Common Framework, das Schuldner und Gläubiger an einen Tisch bringt, hätte erste Erfolge durch eine Verkürzung der Reaktionszeit verzeichnet. Als Beispiel nennt Pazarbasioglu Ghana. Hier sei in fünf Monaten eine Einigung erzielt worden. Damit hätten die Verhandlungen nur halb so lang gedauert wie im Tschad 2021 oder in Sambia 2022. Für Äthiopien rechnet die Volkswirtin mit einer noch kürzeren Zeitspanne.
“Diese Verbesserungen sind unter anderem deshalb möglich, weil die Beteiligten inzwischen mehr Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt haben, auch mit nicht-traditionellen staatlichen Gläubigern wie China, Indien und Saudi-Arabien”, schreibt Pazarbasioglu. Bewährt habe sich auch die Schaffung des Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR), der IWF, Weltbank und die Führung der G20 zusammenbringt.
Im Falle Kenias hat der IWF eine Sanierung des Staatshaushalts gefordert. Das Haushaltsdefizit lag 2023/2024 bei geschätzt 5,7 Prozent des BIP. Präsident William Ruto hat diverse Verbrauchsteuern erhöht und die Steuerbasis verbreitert. So beschloss er eine Kfz-Steuer von 2,5 Prozent und eine Steuer von 16 Prozent auf Brot. Die Brotsteuer trifft die Bevölkerung hart, obwohl Mais das Hauptnahrungsmittel in Kenia ist.
Die Steuererhöhungen haben heftige Unruhen ausgelöst. Dabei erzielte das Land wirtschaftspolitisch Fortschritte. Die wirtschaftliche Lage ist offenkundig besser als die Stimmung. So ist der Rendite-Spread zu US-Dollar-Anleihen von 14 Prozentpunkten vor rund zwei Jahren auf bis zu sechs Prozentpunkte gesunken.
Gleichzeitig reduziert der IWF die Erweiterte Fondsfazilität (EFF) und die Erweiterte Kreditfazilität (ECF) von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 971 Millionen. Dieser Betrag wird Kenia noch ausbezahlt. Die Reduzierung der Kreditaufnahme beim IWF soll das internationale Vertrauen in Kenia stärken.
Auch konnte die Regierung im Februar eine Euro-Anleihe vorzeitig zurückkaufen. Kenia erwarb 1,44 Milliarden US-Dollar der am 24. Juni fällig gewordenen Euro-Anleihe von zwei Milliarden US-Dollar. Dies war durch eine neue, erfolgreich platzierte internationale Anleiheemission möglich. Auch das ist ein Erfolg, den sich Kenia zugute halten kann.
“Die Aussicht auf zusätzliche Mittel von multilateralen Kreditgebern dürfte die externen Finanzierungsengpässe weiter verringern”, urteilt die Ratingagentur Fitch. So hat die Weltbank im Rahmen einer Transaktion zur Förderung der fiskalischen Nachhaltigkeit und der Entwicklung einer widerstandsfähigen Wachstumspolitik eine Finanzierung von 1,2 Milliarden Dollar genehmigt.
Die finanzielle Lage Kenias ist somit angespannt, aber längst nicht schlimm wie die Unruhen vermuten lassen. Im zurückgezogenen Haushaltsentwurf für 2024/2025 schätzte die Regierung, dass der Schuldendienst 5,5 Milliarden Dollar und damit 5,4 Prozent des BIP betragen wird. Vom Haushaltsjahr 2025 an dürfte der Schuldendienst sinken. Und dennoch: “Wir gehen davon aus, dass er in den Haushaltsjahren 2025 und 2027 immer noch mehr als drei Milliarden Dollar jährlich betragen wird”, schreibt Fitch weiter.
Dabei geht es nicht um Kenia allein. “Etwa 15 Prozent der Länder mit niedrigem Einkommen sind überschuldet, und weitere 40 Prozent sind stark überschuldet”, warnt Pazarbasioglu. “Die Länder mit niedrigem Einkommen müssen in den nächsten zwei Jahren noch immer jährlich etwa 60 Milliarden Dollar ihrer Auslandsschulden refinanzieren – ungefähr das Dreifache des Durchschnittswerts im Jahrzehnt bis 2020.”
Auch Aktieninvestoren werden vorsichtig. Der Renditeabstand zwischen den entwickelten Aktienmärkten und den Schwellenmärkten hat sich zuletzt ausgeweitet. “Wir sind fast wieder auf dem Tiefstand, der den Economist im Jahr 2000 dazu veranlasste, Afrika als ,den hoffnungslosen Kontinent’ zu bezeichnen”, meint Charlie Robertson, Leiter Makro-Strategie des Asset-Managers FIM Partners in London. “Das lässt darauf schließen, dass viele Märkte zwar alle schlechten Nachrichten eingepreist haben, von den vielen guten Nachrichten jedoch kaum etwas.”
Auch Dan Keeler, Gründer des Informationsdienstes Frontier Market News, ist positiv gestimmt: “Von der Bildung einer Koalitionsregierung in Südafrika über Währungsreformen in Nigeria und Ägypten bis hin zu Fortschritten bei den Schuldenverhandlungen in Sambia, Ghana und Äthiopien zeichnet sich ein vielversprechendes Bild ab, das die wirtschaftliche Erholung in vielen wichtigen Volkswirtschaften des Kontinents unterstützen sollte.”
In einem “Family Meeting”, wie besondere Staatsansprachen von Präsident Cyril Ramaphosa genannt werden, verkündigte dieser am späten Sonntagabend: Das neue Kabinett der siebten Regierung des demokratischen Südafrika steht. In der vergangenen Woche gab es Momente, da stand die neue aus elf Parteien bestehende “Regierung der nationalen Einheit” in Südafrika auf Messers Schneide und drohte auseinanderzubrechen, bevor sie ihre eigentliche Arbeit aufnehmen konnte. Die Kabinettsverhandlungen gestalteten sich zäh und langwierig. Mit elf Tagen waren sie die längsten in der Geschichte des Landes. Präsident Ramaphosa sprach diplomatisch von Zeit, die notwendig war, um die “Stabilität des neuen Kabinetts” sicherzustellen. Aber auch: Als “relativ junge Demokratie” könnten “wir stolz darauf sein”, in so kurzer Zeit eine Regierung aus so vielen Parteien zu bilden.
Es ging nicht nur um die Zahl der Ministerposten, um die die neue Regierungspartei und ehemalige Opposition Democratic Alliance (DA) mit dem African National Congress (ANC) feilschte, sondern auch um wichtige Ministerien. Bis zuletzt stand das Handels- und Industrieministerium im Zentrum der Verhandlungen. Die DA beanspruchte es für sich, da es zentral für die Wirtschaft Südafrikas ist, die dringend Reformen braucht. Am Ende jedoch musste sich die DA stattdessen mit dem Landwirtschaftsministerium zufriedengeben, das ihr Parteivorsitzender John Steenhuisen übernahm. Das Ressort Handel und Industrie ging hingegen an den ehemaligen Bürgermeister von Johannesburg, Parks Tau vom ANC.
Der ANC hatte trotz der Wahlschlappe nicht nachgegeben. Ramaphosa hat es geschaffte, die DA von zentralen und mächtigen Ministerien fernzuhalten, darunter Finanzen, Bergbau und das Außenministerium. Insgesamt bekam die DA sechs Kabinettsposten, weniger, als sie bis zuletzt gefordert hatte. Im Kabinett der dritten Ramaphosa-Regierung wird die DA folgende Ministerien leiten:
Nur das Innenministerium hat große politische Relevanz, da es für das chaotische Einwohnerregister und Immigration zuständig ist. Alle anderen Ministerien gelten als zweitrangig in Südafrika. Wichtigere Ministerien werden nur durch sechs stellvertretende Ministerposten abgedeckt, darunter Finanzen, Handel und Industrie, Energie und Strom, sowie Wasser und sanitäre Einrichtungen.
Entgegen langer Forderungen wurde das Kabinett nicht entschlackt, sondern ist sogar von 30 auf 32 Ministerien gewachsen, was im internationalen Durchschnitt als zu groß und aufgebläht gilt. Hinzu kommen 43 stellvertretende Minister. Mehr als 60 Prozent der Ministerposten gingen an den ANC, obwohl die Partei nur leicht mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen bekam. Unter den stellvertretenden Ministern gehören sogar mehr als 75 Prozent dem ANC an.
Unter den Ministern erscheinen viele Namen von bekannten ANC-Größen. Eine Reihe von ihnen konnten ihre Posten sogar verteidigen, etwa der stellvertretende Präsident, Paul Mashatile oder Stromminister Kgosientsho Ramokgopa, der jetzt auch für Energie zuständig ist, was zuvor ein separates Ministerium war. Eine Überraschung: Außenministerin Naledi Pandor hat sich wohl von der politischen Bühne verabschiedet und wird in Rente gehen. Ihren Posten übernahm der ehemalige Justizminister Ronald Lamola, mit 40 Jahren einer der jüngsten Kabinettsmitglieder und enger Verbündeter von Ramaphosa.
Die neue Regierung erscheint deswegen auch ein wenig wie eine Kabinettsumbildung, die erforderlich wurde, da neue Koalitionspartner bedient werden mussten. Neben dem ANC und der DA bekamen drei weitere Parteien innerhalb der “Regierung der nationalen Einheit” jeweils mindestens einen Ministerposten.
Die Economic Freedom Fighters (EFF), die nicht Teil der Regierungskoalition sind, hatten am Freitag sich noch in einem letzten Versuch angeboten, aber nur unter der Bedingung, dass es eine Regierung unter anderem ohne die DA gibt. Ursprünglich hatten sie gefordert, dass Ramaphosa nicht mehr Präsident ist.
Zum Zeitpunkt des neuen Koalitionsangebots aber hatten die DA und der ANC schon an den Feinheiten des neuen Kabinetts gefeilt. Die EFF wurde im Regen stehen gelassen. Diese sprach daraufhin von einer “imperialistischen, konterrevolutionären und weiß-rassistischen Agenda”.
Vor genau den Gefahren dieser populistischen Parolen hatte Gayton McKenzie, Parteivorsitzender der rechtsgerichteten Patriotic Alliance, gewarnt. Für seine Unterstützung der Koalition hatte er einen Ministerposten gefordert und bekam daraufhin Sport, Kunst und Kultur. Dass sein Leben noch einmal diese Wendung nimmt, ist vielleicht die größte Überraschung dieser Wahl. McKenzie ist ein ehemaliger Bankräuber, der deshalb 17 Jahre im Gefängnis saß.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze will erneut für das Präsidentenamt der Sahel-Allianz kandidieren. Dies erfuhr Table.Briefings exklusiv aus dem Entwicklungsministerium (BMZ). Demnach wird sich Entwicklungsministerin Svenja Schulze bei der Generalversammlung der Sahel-Allianz am 16. Juli 2024 in Berlin zur Wahl stellen. Als Vorsitzender des technischen Steuerungsgremiums kandidiert wieder Weltbank-Vizepräsident Ousmane Diagana. Vor knapp einem Jahr wurde Schulze in Nouakchott das erste Mal zur Präsidentin des Unterstützerbündnisses gewählt.
Bisher hatte Schulze in ihrer Präsidentschaft einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Bevölkerung im Sahel gelegt. “Ein gemeinsames Vorgehen ist wichtiger denn je, denn die Region ist zunehmend von dschihadistischem Terror, organisierter Kriminalität und der Klimakrise bedroht”, sagte ein BMZ-Sprecher gegenüber Table.Briefings.
Für die nächste Amtszeit wolle Schulze die Schaffung neuer Jobs, mehr Bildungsangebote für die junge Bevölkerung und für eine bessere Wasser- und Stromversorgung, gerade auch im ländlichen Raum, in den Fokus rücken. Zudem wolle Schulze stärker die südlich angrenzenden Küstenstaaten in Westafrika in den Blick nehmen. “Sie sind zunehmend vom Übergreifen dschihadistischer Gruppen aus dem Sahel bedroht. Das erfordert eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit im Kreis der Geber sowie mit den Partnerländern im Sahel und den Küstenstaaten”, so der Sprecher weiter.
Ziel der Allianz ist die nachhaltige Entwicklung der Länder in der Sahelzone. Die Sahel-Allianz ist die wichtigste entwicklungspolitische Plattform für die Region. Der Unterstützer-Verbund wurde 2017 gegründet. Die Initiativen und Investitionen der Sahel-Allianz-Mitglieder belaufen sich nach eigenen Angaben auf mehr als 28 Milliarden Euro. Gleichzeitig steht die Allianz nach den zahlreichen Militärputschen in der Region politisch unter Druck. Diese sollte ursprünglich eng mit den G5 Sahel zusammenarbeiten. Nachdem Mali die Gruppe 2022 verlassen hatte, waren im vergangenen Jahr auch Burkina Faso und Niger ausgetreten.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der schwierigen Umstände in der Region nutzte Schulze das Präsidentenamt in der vergangenen Amtsperiode über die Entwicklungspolitik hinaus auch symbolpolitisch. So war Schulze die erste europäische Ministerin, die nach dem Putsch nach Burkina Faso gereist ist und dort mit Mitgliedern der Junta gesprochen hat.
Das sind die 18 Mitglieder der Sahel-Allianz:
Hinzu kommen neun Beobachterstaaten. dre
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr gestalten sich laut einer Evaluierung des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums in weiten Teilen als effektiv. In dem Bericht von Ende Juni wird eine Diskrepanz zwischen den weit gefassten politischen Einsatzzielen und begrenzten militärischen Fähigkeiten bemängelt. Entsprechend fordern AA und BMVg in ihrer Evaluation künftige Einsätze “klarer entlang der sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands” zu priorisieren. Mit der Konzentration auf die Landes- und Bündnisverteidigung und dem Ende der großen Auslandseinsätze in Afghanistan und Mali rücken die Missionen der Bundeswehr im sogenannten internationalen Krisenmanagement in den Hintergrund.
Die Übersicht über die wichtigsten laufenden Auslandseinsätze mit Afrika-Bezug:
Die von der Europäischen Union geführte “militärische Krisenbewältigungsoperation im Mittelmeer” der European Naval Forces Mediterranean (EUNAVFOR MED) Irini soll in erster Linie das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Irini löste 2020 in dieser Aufgabe die vorherige EU-Mission Sophia ab, die am Streit der Mitgliedsstaaten über den Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten und Flüchtlingen zerbrochen war.
Militärisch beteiligt sich die Bundeswehr an der Mission aktuell nur mit Stabspersonal; zur Seeraumüberwachung stellt Deutschland ein ziviles Flugzeug zur Verfügung. Das Mandat (Bundestagsdrucksache 20/10508) wurde vom Bundestag zuletzt im März dieses Jahres verlängert.
Der von der EU geführte Einsatz im Roten Meer ist die jüngste Auslandsmission der Bundeswehr. Zusammen mit Schiffen anderer EU-Staaten und in Zusammenarbeit der von den USA geführten “Operation Prosperity Guardian” sollen Handelsschiffe vor den Angriffen der Huthi-Milizen im Jemen geschützt werden. Diese hatten im November vergangenen Jahres damit begonnen, als Unterstützung für die Hamas im Krieg mit Israel westliche Handelsschiffe auf dem Seeweg zum für den internationalen Handel wichtigen Suezkanal anzugreifen. Der Bundestag hatte das Mandat für die deutsche Beteiligung an der EU-Mission (Bundestagsdrucksache 20/10347) im Februar beschlossen.
Die UN-Mission im Südsudan entwickelte sich aus der vorangegangenen UN-Mission für den ganzen Sudan – nach Abspaltung des Südens bauten die Vereinten Nationen eine neue Operation auf, in der unter anderem Militärbeobachter eine friedliche Entwicklung vor dem Hintergrund innerer Spannungen im Land sicherstellen sollen. Derzeit sind zwölf deutsche Soldaten und Soldatinnen in dieser Mission; sowohl im Stab in der Hauptstadt Juba als auch als Beobachter in verschiedenen Teilen des Landes. Das Mandat des Bundestages (Bundestagsdrucksache 20/10160) wurde zuletzt Anfang dieses Jahres verlängert.
Seit 1991 soll die Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) ein Referendum zur Zukunft der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara umsetzen. Spätestens seit der Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump für Marokkos Gebietsansprüche auf die Westsahara scheint allerdings jegliche Aussicht auf eine Volksabstimmung unwahrscheinlich. Auch Alt-Bundespräsident Horst Köhler hatte sich eine Zeitlang für die UNO als Vermittler versucht – allerdings ohne Erfolg. Anfangs war Deutschland mit Polizisten des Bundesgrenzschutzes beteiligt, ehe 2013 die Bundeswehr diese Aufgabe übernahm. Aktuell beteiligt sie sich mit vier Offizieren an dieser Beobachtermission, sowohl im von der marokkanischen Armee kontrollierten Gebiet als auch im Bereich der Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario. Die Entsendung der deutschen Soldaten gilt nicht als mandatierungspflichtiger Einsatz, sodass ihn nur das Bundeskabinett und nicht das Parlament beschloss.
Zudem betreibt die Bundeswehr einen Luftwaffenstützpunkt in Niger. Bis Ende Mai war der Einsatz der 90 Soldaten über ein vom Bundestag genehmigtes Mandat für die Minusma-Mission abgedeckt. Bis mindestens August soll der Luftwaffenstützpunkt als sogenannte bemannte Cold Base weitergeführt werden. Dies hatte das BMVg in einem bilateralen Abkommen vereinbart. tw/dre
Die Europäische Investitionsbank in Luxemburg hat eine neue Strategie für ihr Fördergeschäft beschlossen. Demnach setzt sie künftig acht Schwerpunkte:
Für Unternehmen und Investoren, die in Afrika aktiv sind, ist besonders der erste Punkt wichtig, zum Teil auch der siebte. Künftig legt die EIB einen Schwerpunkt auf die Klimafinanzierung, in die “deutlich mehr als 50 Prozent” der EIB-Mittel fließen sollen. Das betrifft auch Unternehmen, die im afrikanischen Energiesektor aktiv sind. Denn auch hier verändert die EIB ihren Ansatz.
Bisher haben sich europäische Energieprojekte in Afrika häufig auf die Energieerzeugung beschränkt. Das will die EIB ändern. “Investitionen in die physische Infrastruktur, wie etwa Verbindungsleitungen, Netze, Energiespeicherung und erneuerbare Energien, werden verstärkt, ebenso wie die Unterstützung der biologischen Vielfalt, einer Kreislaufwirtschaft und naturbasierter Lösungen”, heißt es in dem Papier.
Neu ist ein weiterer Schwerpunkt auf die Wasserwirtschaft. Auch in der Vergangenheit hat die EIB Wasserprojekte finanziert. Das will sie nun ausbauen. “Das Wasserprogramm wird vorhandene Ressourcen für Investitionen in Infrastruktur und effiziente Wassermanagementtechnologien bündeln und verstärken, um den Klimawandel zu mildern und sich an Überschwemmungen, Dürren und den steigenden Meeresspiegel anzupassen”, heißt es in der neuen EIB-Strategie.
Wasserprojekte sind als Investitionsvorhaben in vielen Fällen schwer zu finanzieren, weil sie in der Regel zu geringe Erlöse generieren, um eine marktgerechte Rendite sicherzustellen.
Für Afrika-Investoren interessant ist auch Punkt 7. Bei Impact-Investitionen will die EIB bestehende Partnerschaften vertiefen, vor allem über strategische Allianzen und Großprojekte im Rahmen der Global-Gateway-Initiative der EU.
Bisher ist die EIB vor allem auf Europa beschränkt. Im vergangenen Jahr hat sie Finanzierung von knapp 88 Milliarden Euro ausgereicht. Davon waren 90 Prozent innerhalb der EU. Dennoch dürfte das Afrikageschäft eine größere Rolle einnehmen, als diese beiden Zahlen vermuten lassen.
So will die EIB die Vernetzung mit anderen Förderbanken vorantreiben und mehr “strategische globale Allianzen im Rahmen von Großprojekten mit anderen multilateralen und regionalen Finanzinstituten” eingehen. Finanzierungen sollen sich künftig “auf eine begrenzte Zahl strategischer Infrastrukturprojekte” konzentrieren. Auswahlkriterium ist, dass sie “den größten Einfluss auf die Versorgung von Millionen von Menschen mit Trinkwasser, Bewässerung und Sanitäreinrichtungen haben können”. hlr

Seit 2021 liegt das Abkommen zwischen Deutschland und Namibia zur Anerkennung des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts, an den Herero und Nama, auf Eis. Zu stark war die Kritik der Opferverbände in Namibia. Die dortige Regierung konnte das Abkommen nicht einfach durchdrücken. Nun gibt es einen neuen Versuch, mit minimalen Verbesserungen von deutscher Seite. Die beiden Hauptprobleme bleiben jedoch bestehen: die Intransparenz des Prozesses und die Ablehnung durch wesentliche Teile der Herero und Nama.
Deutschland hat offenbar nachgebessert, wie aus einer Bekanntmachung der namibischen Vizepräsidentin Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah vom 27. Juni 2024 hervorgeht. Sie hatte in ihrer Eröffnung gegenüber dem Chiefs Forum erklärt, dass Deutschland bereit sei, die 2021 ausgehandelte Summe von 1,1 Milliarden Euro zu erhöhen, allerdings ohne einen konkreten Betrag zu nennen. Statt auf 30 Jahre sollte nun ein – nicht spezifizierter – Teil vorab gezahlt werden. Auch in der Diaspora lebende Herero und Nama sollten davon profitieren können, aber im Grunde nur, wenn sie nach Namibia zurückkehrten. Die Zahlung werde nun auch nicht mehr als “Hilfe” oder “Zuschuss” bezeichnet, was in der Erklärung von 2021 für großen Ärger gesorgt hatte, sondern als “Sühne” beziehungsweise “Sühnefonds”. Der Genozid werde nun von Deutschland anerkannt, ohne den als Einschränkung empfundenen Zusatz “nach heutigem Verständnis” – 2021 hieß es noch, es handelte sich um Völkermord “nach heutigem Verständnis”.
Das Vorgehen, wie auch die Ergebnisse, werfen jedoch weiterhin Fragen auf:
Erstens, warum wird keine konkrete Summe benannt, um die nun erhöht wurde? Und warum werden nicht alle Fakten auf dem Tisch gelegt, auch nicht von deutscher Seite?
Wieso wird die Diaspora nur eingebunden, wenn sie nach Namibia zurückkehrt? Das ist das Gegenteil von Einbindung.
Warum wurde dies wieder intransparent hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, statt die Zivilgesellschaft in beiden Ländern endlich umfassend zu beteiligen? Der Eindruck bestätigt sich, dass die Bundesregierung ein Problem wegverhandeln will, ohne an einer wirklichen Aufarbeitung und Versöhnung, zu der auch die breite Aufklärung und Debatte gehören, interessiert zu sein.
Dazu passt auch das Zurückstufen und Ignorieren des Genozids in Deutschland selbst: Vor nur vier Wochen wurden die Opfer des Genozids an den Herero und Nama in der offiziellen Erinnerungspolitik des Hauses Roth als Opfer zweiter Klasse eingeordnet, die man im offiziellen Gedenkstättenprogramm nicht berücksichtigen müsste, zurückgesetzt hinter die Opfer der DDR-Diktatur.
In Hamburg läuft derzeit das Planungsverfahren für die Bebauung des zentralen deutschen Erinnerungsortes an den Genozid, den Baakenhafen, mit Luxuswohnungen, ohne dass offenbar von der für die Aufarbeitung des kolonialen Erbes zuständigen Kulturbehörde im Vorfeld Einwände geäußert worden wären. Es braucht dort aber neben einem Gedenkort auch ein Dokumentationszentrum zum Genozid, und man wäre interessiert zu erfahren, was die Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama für die Aufarbeitung in Deutschland bedeutet. Es handelt sich eben nicht (nur) um ein Thema der Außenpolitik.
Bemerkenswert ist aber auch der politische Druck, unter den Namibia sich offenbar gesetzt fühlt, beziehungsweise den die namibische Regierung aufbaut, um ihr Abkommen dieses Mal innenpolitisch durchzusetzen. Wenn die internationale Gemeinschaft schon unfähig sei, den israelischen “Genozid in Gaza” zu stoppen, wie sollte man da auf internationalen Druck hoffen, um einen Genozid, der 120 Jahre zurückliegt, zu sühnen, so die Vizepräsidentin.
Dies zeigt, in welch verfahrene Lage die deutsche Verhandlungsstrategie seit 2015 den Aussöhnungsprozess gebracht hat. Es ist Machtpolitik, und nur das. Die Bundesregierung müsste aber nun auch erklären, warum die Bezeichnung des Gaza-Krieges als genozidal in Deutschland geächtet und kritisiert wird, man aber mit einer namibischen Regierung, die dies offen sagt, und ja auch der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof beigetreten ist, zu einem Hinterzimmerdeal bereit ist. Oder ist das einer der Gründe für den Weg, alles hinter verschlossenen Türen zu regeln?
Es wäre besser und der Frage der Anerkennung und Versöhnung sehr viel zuträglicher, wenn all dies offen und transparent diskutiert würde. Aber um Versöhnung und Wiedergutmachung scheint es zuallerletzt zu gehen.
Prof. Dr. Jürgen Zimmerer ist Historiker und Afrikawissenschaftler an der Universität Hamburg.
Reuters: Türkei vermittelt zwischen Äthiopien und Somalia. Die Türkei hat mit der Vermittlung von Gesprächen zwischen Somalia und Äthiopien über ein Hafenabkommen begonnen, das Addis Abeba Anfang dieses Jahres mit der abtrünnigen Region Somaliland unterzeichnet hat. Äthiopien hatte angeboten, 20 Kilometer Küstenlinie von Somaliland zu pachten und im Gegenzug dessen Unabhängigkeit anzuerkennen, was die somalische Zentralregierung in Mogadischu erzürnte. Die Türkei ist seit 2011 ein enger Verbündeter Somalias. Vertreter Somalilands nehmen nicht an den Gesprächen teil.
Bloomberg: Ruto: “Kein Blut an meinen Händen”. Der kenianische Präsident William Ruto hat seine Entscheidung verteidigt, das Militär einzusetzen, um die landesweiten Proteste der vergangenen zwei Wochen zu unterdrücken, bei denen mindestens 24 Menschen ums Leben kamen. Er habe keine andere Wahl gehabt, sagte Ruto in einer Fernsehansprache. Die kenianische Polizei habe ihr Bestes getan, so der Präsident weiter. Seine Regierung werde den Einsatz von scharfer Munition gegen die Demonstranten untersuchen.
Business Insider: Nächster Generalstreik in Nigeria droht. Die Campaign for Democratic and Workers’ Rights (CDWR) in Nigeria hat die nigerianischen Gewerkschaften zu einem 48-stündigen Generalstreik und Massenprotesten aufgerufen, unter anderem um eine Erhöhung des Mindestlohns zu fordern. Die Gruppe verwies auf die jüngsten erfolgreichen Massenproteste in Kenia als Inspirationsquelle für die Nigerianer, um die Regierung zur Rücknahme unliebsamer politischer Maßnahmen zu zwingen.
The East African: Al-Shabaab richtet sich in Ostafrika ein. In den vergangenen 14 Jahren hat die Terrorgruppe al-Shabaab tödliche Terroranschläge in Somalia, Kenia und Uganda verübt, bei denen Hunderte getötet wurden. In jüngster Zeit hat die Gruppe eine pan-ostafrikanische Truppe aufgebaut und Verbindungen zu anderen Milizen wie den ugandischen Allied Democratic Forces (ADF) hergestellt. Die Afrikanische Union unterstützt die Schaffung einer neuen Truppe, die die mehr als 10.000 Atmis-Soldaten ersetzen soll, die in Somalia gegen al-Shabaab kämpfen und das Land bis Ende Dezember verlassen sollen.
Le Monde: M23 nimmt strategisch wichtigen Ort im Ostkongo ein. Die von Ruanda unterstützte Rebellenmiliz M23 hat in ihrem Konflikt mit den Regierungstruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo eine strategisch wichtige Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Kanyabayonga liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Goma, der Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, die von M23 umzingelt ist, und gilt als Riegel, der den Zugang zu den nördlich gelegenen Handelszentren Butembo und Beni kontrolliert. Die Stadt hat mehr als 60.000 Einwohner.
AP: Mauretaniens Präsident wiedergewählt. Der mauretanische Präsident Mohamed Ould Ghazouani ist bei Wahlen im Amt bestätigt worden. Obwohl seine Gegner ihm Korruption und Misswirtschaft vorwerfen, wird er von vielen Mauretaniern als Stabilitätsanker gesehen und ist weiterhin beliebt. Er hat das in der von Putschen und Gewalt heimgesuchten Sahelzone liegende Land als strategischen Verbündeten des Westens positioniert. Mauretanien ist reich an natürlichen Ressourcen wie Eisenerz, Kupfer, Zink, Phosphat, Gold, Erdöl und Erdgas. Bis zum Ende des Jahres soll die Gasproduktion anlaufen.
The Conversation: Warum Freiheitsbewegungen an Regierungsverantwortung scheitern. Afrikanische Freiheitsbewegungen haben die versprochene Emanzipation des Volkes nicht immer erreicht. Stattdessen übernahm oft eine neue Elite die Kontrolle über die Regierung, hauptsächlich zu ihrem eigenen Vorteil. Die wachsende Frustration der “Befreiten” hat die anfängliche Unterstützung ihrer Regierung oft untergraben, wie der Afrikawissenschaftler Henning Melber beschreibt. Das zeige sich auch am schwindenden Rückhalt für den ANC in Südafrika und Swapo in Namibia, meint er.


Asfa-Wossen Asserate – Berater / Buchautor
Seine Kaiserliche Hoheit, Prinz Asfa-Wossen Asserate, lässt sich nicht ohne seinen Vater verstehen. Leul Ras Asserate Kassa war nicht nur Mitglied der kaiserlichen Familie, sondern auch der letzte Präsident des kaiserlichen Kronrats. Prinz Asfa-Wossen besuchte die Deutsche Schule in Addis Abeba und begann nach dem Abitur ein Studium in Tübingen. Dort wurde er Mitglied des Corps Suevia. Der kommunistische Umsturz 1974 veränderte auch sein Leben tief. 1978 wurde er in Frankfurt mit einer Arbeit zur äthiopischen Geschichte promoviert. Heute ist er ein erfolgreicher Buchautor und als Berater gefragter denn je.

Oumar Diallo – Leiter Afrika-Haus Berlin
Das Afrika-Haus in Berlin ist längst eine feste Institution in Berlin – und Oumar Diallo ist ihr leitender Kopf. Der in Guinea geborene Soziologe eröffnete das Afrika-Haus in Berlin-Moabit vor über 30 Jahren. Mittlerweile ist es Veranstaltungsort und Debattenraum. Diallo ist dabei immer wieder pointierter Kommentator zeitgeschichtlicher Entwicklungen in Afrika und Deutschland.

Liz Shoo – Journalistin Deutsche Welle und WDR
Mit ihrer strahlend guten Laune und fundierten Moderationen ist Liz Shoo aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken, wenn es um Afrika geht. Ihre Kindheit hat sie in einem kleinen Ort in Bayern verbracht, bis ihr Vater nach bestandener Promotion mit der Familie zurück nach Tansania zog. Liz Shoo kehrte zum Studium zurück nach Deutschland und moderiert heute für die Deutsche Welle und den WDR.

Horst Köhler – ehemaliger Bundespräsident
Mit seiner Hinwendung zu Afrika hat Horst Köhler in den Jahren 2004 bis 2010 Zeichen gesetzt, als er als Bundespräsident den Kontinent in den Mittelpunkt seines Amtes stellte. Darüber wird jedoch leicht vergessen, dass Köhler schon zuvor vom Jahr 2000 an als Geschäftsführender Direktor des IWF Zeichen in Richtung Afrika gesetzt hat. Eine seiner ersten Handlungen beim IWF war eine Diskussion mit Popstar Bono über eine Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer. Im Sommer 2017 berief ihn UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zum Sondergesandten für Westsahara. Nach zwei Jahren legte Köhler das Mandat nieder.

Charles Huber – Schauspieler / Autor / ehemaliger MdB
Dank seiner Rolle in der Fernsehserie Der Alte wurde Charles Huber einem Millionenpublikum bekannt. Sein Vater war der senegalesische Diplomat Jean-Pierre Faye, ein Neffe des ersten senegalesischen Staatspräsidenten Léopold Sédar Senghor. Doch seinen Vater lernte Huber erst kennen, als er 28 Jahre alt war. Von 2013 bis 2017 war er Bundestagsabgeordneter (CDU) und siedelte danach für einige Jahre in den Senegal um. Dort beriet er auch den damaligen Präsidenten Macky Sall. Noch heute ist er ein wichtiger Fürsprecher Afrikas in Deutschland.

Nneka Egbuna – R&B-Sängerin
Im nigerianischen Bundesstaat Delta ist Nneka Egbuna im Jahr 1980 geboren und kam im Alter von etwa 20 Jahren nach Hamburg, um an der dortigen Universität Anthropologie und Archäologie zu studieren. Als Sängerin hatte sie ihren Durchbruch 2004, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. In ihren Texten verarbeitet sie ihre Kindheit in Nigeria und ihr Leben in Deutschland. Auf diese Weise ist sie eine kraftvolle Stimme der afrikanischen Diaspora in Deutschland und darüber hinaus. Zurzeit ist auf Tour und bis Ende September in Hannover, Darmstadt, Monheim und Karlsruhe zu hören.

Alpha Dia – Model
Mit seinen 32 Jahren gehört Alpha Dia zu den Erfolgreichsten seiner Branche: Dia ist eines der weltweit gefragtesten männlichen Models – und nutzt seine Reichweite auch für den guten Zweck. Im Senegal geboren, wächst Dia bei seinem Vater in Hamburg auf. Nach dem Abitur wird der junge Mann von Modelscouts entdeckt und schafft schließlich den Durchbruch, obwohl er als junger, schwarzer Mann bei deutschen Kunden zunächst auf Ablehnung stößt. Dia hat eine eigene Stiftung gegründet (Dia Foundation) und hilft damit benachteiligten Kindern im Senegal.

Volker Schütte – Honorarkonsul Südafrika in Bremen / Reederei-Unternehmer
Der Mann drängt sich nicht laut in die Öffentlichkeit. Und doch ist Volker Schütte einer der kraftvollsten Fürsprecher für Afrika. Er ist Geschäftsführer des traditionsreichen Hauses Louis Delius GmbH & Co. KG in Bremen und engagierter Honorarkonsul von Südafrika. Im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft ist er stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister.
Gernot Wagner – Honorarkonsul DR Kongo in Leipzig
Die DR Kongo hat in ihrem Leipziger Honorarkonsul Gernot Wagner einen leidenschaftlichen Repräsentanten gefunden. Wagner hat an der Universität Bergakademie Freiberg studiert und sich als Ingenieur eingehend mit den Bodenschätzen Afrikas befasst. Und immer wieder treibt er Investitionsprojekte in der DR Kongo voran. Wagner ist Mitglied im Verein der Freunde Marokkos, im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, des Mittelstandsverbands BVMW, im Außenwirtschaftsausschuss und Vorstandsmitglied der Mittelstandsallianz Afrika MAA.

Michael Rabbow – Gesundheitsexperte / Vorstandsmitglied Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft
Es gibt wenige in Deutschland, die sich mit einer derart großen Leidenschaft für Afrika engagieren, wie Michael Rabbow. Auch hat er mit Sicherheit eines der stabilsten Netzwerke, das vor allem deshalb hält, weil er seine Kontakte nie zu seinem Vorteil benutzt. Jahrelang hat der Mediziner in Namibia gelebt und sich dort für öffentliche Gesundheit eingesetzt. Heute ist er unter anderem im Kuratorium der Deutschen Afrika-Stiftung aktiv.
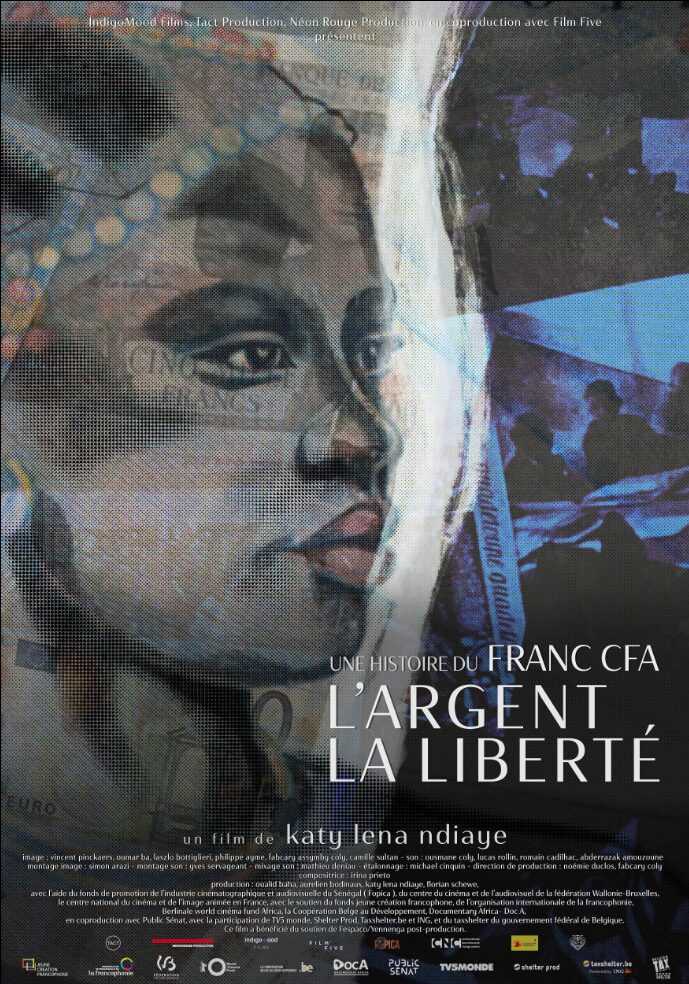
Leboon – Hört meine Geschichte!
Lepoon – Wir hören Deine Geschichte!
Das ist die klassische Eröffnungsformel auf Wolof, wenn jemand im Senegal eine Geschichte zu erzählen hat. Bis heute. Die senegalesische Regisseurin Katy Léna Ndiaye erzählt mit ihrem Film “L’argent, la liberté – Une histoire du Franc CFA” eine Geschichte, die ebenso ihre eigene wie die von rund 100 Millionen Menschen ist, die die Währung teilen. Derzeit läuft der Film von 2023, der auf einigen Festivals gastierte, in Dakar als Sondervorstellung im Kino.
Ndiaye, deren Familie aus dem Norden Senegals stammt, geht auf Spurensuche und stellt ihren Gesprächspartner die Frage: Was ist eigentlich eine Währung? Und was bedeutet, es keine volle Kontrolle über sie zu haben? Die Antworten liefern die in dieser Frage einschlägigen Experten, allesamt Kritiker des CFA. Zu Wort kommen etwa die senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr und Ndongo Samba Sylla oder der ehemalige beninische Premierminister und Investmentbanker Lionel Zinsou.
Der CFA sei, so der Schluss, vielmehr ein politisches Instrument der neokolonialen Kontrolle Frankreichs als ein ökonomisch sinnvolles Konstrukt.
Ndiayes Aufarbeitung ist mit 1 Stunde 45 Minuten etwas lang geraten. Die Stärke ihres Films, der mit ausschließlich natürlicher Belichtung, Close-ups und symbolisch aufgeladenen Bildern wie den von Norden nach Süden ziehenden Vögeln aufwartet, liegt in Ndiayes Zugang zu dem sperrigen Thema: Sie legt durch ihre filmische Herangehensweise bewusst offen, dass es sich beim CFA als vorteilhafte Lösung für alle um eine Erzählung, eine Fabulation, ein Märchen handelt. Und schlägt dem Publikum, aber insbesondere den Betroffen vor, stattdessen ein eigenes zu erfinden und zu erzählen. Es brauche eine ganzheitliche Vision einer Währung, die den Menschen in Afrika dient, sagt der Ökonom und Soziologe Martial Ze Belinga aus Kamerun am Ende des Films. lcw
