die Unionsparteien haben sich festgelegt: Friedrich Merz wird ihr Kanzlerkandidat bei den nächsten Wahlen. Afrikapolitisch hat sich der CDU-Chef bislang noch kaum hervorgetan. Dennoch lassen sich einige Rückschlüsse auf den Ansatz ziehen, die ein Kanzler Merz mit Blick auf den Nachbarkontinent verfolgen würde, etwa mit Blick auf die Außenwirtschaftspolitik. Unser Hauptstadtkorrespondent David Renke hat sich dieses Themas angenommen.
Außerdem blicken wir in dieser Ausgabe auf das Engagement deutscher Unternehmen in Ägypten, die Reisen, die US-Präsident Biden und JP Morgan-Boss Dimon nach Afrika planen und die Rückkehr des botswanischen Ex-Präsidenten aus dem Exil. Und wie immer haben wir auch aktuelle Nachrichten und weitere Berichte für Sie.
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Am Montag werden die Parteispitzen der CDU-/CSU-Schwesterparteien Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten küren. Unter den Entwicklungspolitikern der Unionsfraktion im Bundestag blickt man positiv auf die Entscheidung – und das, obwohl sich Merz in den vergangenen Jahren aus entwicklungspolitischen Debatten weitestgehend herausgehalten hat und auch beim Thema Afrika ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. Damit steht Merz im Gegensatz zu Scholz, der sich seit Beginn seiner Amtszeit um einen steten Austausch mit dem Nachbarkontinent bemüht. Nur über Umwege lässt sich ablesen, wie die Afrikapolitik eines möglichen Kanzlers Friedrich Merz aussehen könnte.
Denn mit ihrem Afrika-Strategiepapier hat die Union bereits im letzten Jahr die Leitlinien für die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten vorgestellt. An der Erarbeitung war Merz zwar nicht beteiligt, dennoch findet sich auch darin das außenpolitische Credo des CDU-Parteivorsitzenden wieder: ein stärkerer Fokus auf die deutschen Interessen. “Deutschland und die EU sind gefordert, ihre strategischen Interessen gegenüber den afrikanischen Partnern klar zu formulieren”, heißt es in dem Papier. Dabei komme der verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit, außen- und sicherheitspolitischen Interessen sowie der Reform multilateraler Kooperationsplattformen eine besondere Bedeutung zu.
Zudem fordert die Fraktion in dem Papier mehr deutsche Verantwortung bei multilateralen Einsätzen in Afrika – vor allem seitdem die Franzosen ihre militärische Präsenz im Sahel deutlich zurückfahren mussten.
Wirtschaftspolitisch will die Union private Investitionen in Afrika fördern. “Wer in Afrika Armut bekämpfen und Wohlstand schaffen will, der muss der Privatwirtschaft eine noch viel größere Aufmerksamkeit schenken und insbesondere den Aufbau von Wertschöpfungsketten vor Ort in den Blick nehmen”, heißt es in dem Strategiepapier.
Ob diese Ideen unter einem von Merz geführten Kanzleramt tatsächlich auch umgesetzt werden, ist allerdings unklar. Speziell vor dem Hintergrund, wie zerstritten die Partei zuletzt in der Debatte um die Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit war. Klar dürfte jedoch sein, dass das Thema, wie Migration begrenzt werden kann, für Merz im Fokus stehen wird.
Dabei macht die Zuwanderung aus Afrika nur einen kleinen Teil der Migration aus. Im vergangenen Jahr lag die Nettozuwanderung laut Statistischem Bundesamt bei 663.000 Menschen. Davon kamen netto 330.000 aus Europa, 287.000 aus Asien, doch nur 61.000 Menschen aus Afrika, während es in Richtung USA sogar eine Nettoabwanderung gab. Eine umfassende Afrika-Strategie lässt sich daher nicht auf das Thema Migration beschränken.
Dass jedoch die geopolitischen Realitäten und der weitere Aufstieg Chinas die Hinwendung zu anderen Partnern unumgänglich machten, ist Merz klar. “Wir überlassen Afrika zurzeit China”, sagte Merz während einer Diskussion im Rahmen des Tags der Konrad-Adenauer-Stiftung und kritisierte eine fehlende Afrika-Strategie der Europäischen Union. Tatsächlich findet die europäische Position selten einheitliche Positionen, um auf die Entwicklungen auf dem Kontinent zu reagieren.
Südafrika und andere Länder des Kontinents wenden sich stärker der Brics-Gruppe zu, und der Sahel droht, zu einer riesigen Failed Region vom Atlantik bis zum Roten Meer zu zerfallen. Trotz des Plädoyers bleiben Zweifel am tiefergehenden Interesse an den afrikanischen Staaten. Während der Diskussion unterlief Merz das Fettnäpfchen, Afrika als Land zu bezeichnen.
Dieser Realität muss sich auch Olaf Scholz seit Beginn seiner Amtszeit stellen und hat entsprechend immer wieder auf die Bedeutung Afrikas hingewiesen. Bemerkenswert ist allein die Zahl der Reisen, die der Kanzler auf den Nachbarkontinent in dieser Legislatur absolviert hat. Senegal, Niger, Südafrika, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Ghana besuchte Scholz allein in den vergangenen drei Jahren. Hinzu kommt formal noch Ägypten im Rahmen der Weltklimakonferenz 2022. Im Kanzleramt gilt die Devise, den Austausch mit Afrika zu verstetigen. Aus diesem Grund knüpfte Scholz auch an das Compact-with-Africa-Format an, das seine Vorgängerin Angela Merkel im Rahmen der G20 ins Leben gerufen hatte. Nach 2019 fand 2023 der Gipfel erneut in Berlin statt.
Scholz sieht die afrikanischen Länder als wichtige Partner in einer multipolaren Welt, deren Unterstützung sich Deutschland auch mit Blick auf die Zukunft sichern sollte. Entsprechend hat sich die Bundesregierung zuletzt vermehrt dafür eingesetzt, dass die afrikanischen Länder mehr Einfluss in den internationalen Organisationen bekommen. Dazu gehört die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 im vergangenen Jahr. Im UN-Sicherheitsrat fordert die Bundesregierung zwei ständige Sitze für afrikanische Staaten sowie einen zusätzlichen nicht-ständigen Sitz. Im April dieses Jahres hatte der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil weitere Ansätze für die “Demokratisierung der internationalen Ordnung” vorgestellt.
Trotz der Vielzahl der Initiativen musste sich der Kanzler immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, auf seinen Reisen in Afrika unkonkret zu bleiben. Gleich mehrmals sorgten seine Reisen auf den Kontinent zudem für Missverständnisse. Während seiner Reise in den Senegal geriet Scholz in Deutschland in die Kritik, da er angeblich Flüssiggaslieferungen nach Deutschland vereinbart habe. Mittlerweile liegen die Pläne auf Eis. Einen konkreten Deal hatte es offenbar ohnehin nie gegeben.
Ein weiteres Missverständnis hält sich auch seit einem Jahr hartnäckig mit Kenia. Dort verkündete Präsident William Ruto bereits mehrmals öffentlich, dass mit Unterzeichnung des Fachkräfteabkommens zwischen Deutschland und Kenia rund 250.000 Fachkräfte aus Kenia nach Deutschland kommen könnten. Zuletzt nannte Ruto die Zahl sogar nach der Unterzeichnung des Abkommens in der vergangenen Woche in Berlin. Die Bundesregierung dementierte dies und wies darauf hin, dass konkrete Zahlen überhaupt nicht in dem Abkommen festgeschrieben seien. Das allerdings ist nicht öffentlich zugänglich.
Politisch verlief die Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Ägypten erstaunlich ruhig. Deutschlands Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg oder die Lage der Zivilgesellschaft in Ägypten selbst hätten einige Ansatzpunkte für gegenseitige Kritik geliefert. Womöglich erklärt sich die demonstrative Einigkeit auch damit, dass Ägypten dringend auf Wirtschaftsaufträge angewiesen ist. Denn mit dem Gaza-Krieg ist auch der Verkehr im Suezkanal, einer wichtigen Einnahmequelle des Landes, stark zurückgegangen. Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Ägyptens, unter anderem auch mit großen Infrastrukturprojekten mit Leuchtturmcharakter.
Dazu zählt zum Beispiel der Ausbau des 2.000 Kilometer langen Streckennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge, das Ägyptens Metropolen verbinden soll. An dem Projekt beteiligt sind die Verkehrssparte von Siemens sowie die Deutsche Bahn. Das ambitionierte Ziel: Bis 2025 sollen superschnelle Züge 26 Millionen Menschen in den Großstädten Kairo und Alexandria verbinden. Anschließend soll eine Bahnverbindung die Reisezeit von Kairo nach Assuan von zwölf Stunden auf sechs verkürzen.
Das sind die Aktivitäten deutscher Unternehmen im Überblick:
Daneben begleitete Steinmeier noch das Rüstungsunternehmen Diehl Defence, das Medienberichten zufolge in der Vergangenheit das Luftverteidigungssystem IRIS-T an Ägypten geliefert haben soll. Eine Anfrage zu weiteren Geschäftsaktivitäten ließ das Unternehmen unbeantwortet. Das Start-up Avilus war ebenfalls Teil der Delegation. Dieses stellt medizinische Rettungsdrohnen nach militärischen Standards her.
Während Namibias Entscheidung, 723 Wildtiere zu keulen, international Proteste hervorrief, ist sie für Wildtierexperten im südlichen Afrika nicht überraschend gekommen. Politiker im südlichen Afrika plädieren schon lange für eine größere Souveränität im Management ihres Wildbestands. Sie argumentieren, dass die internationale Gemeinschaft ihre erfolgreichen Bemühungen um den Artenschutz – belegt durch die weltweit größte Elefantenpopulation mit mehr als 200.000 Tieren und andere stark gewachsene Wildtierarten – belohnen und nicht bestrafen sollte.
Namibia verteidigt die Keulung als notwendige Maßnahme zur Bekämpfung schwerer Dürre und einer Hungerkrise, die schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen – fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes – bedroht. Während einige diesen Ansatz als pragmatisch bezeichnen, argumentieren Vertreter von Tierschutzorganisationen, dass der Abschuss und die Keulung die Artenvielfalt gefährden könnten.
Die Tierschutz-Lobbyisten behaupten, die Freigabe von Trophäen würde die Wilderei fördern. Auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke will den Import von Jagdtrophäen nach Europa einschränken. Damit verfolgt sie offenbar das Ziel, die Jagd im südlichen Afrika uninteressanter zu machen.
Doch Länder wie Simbabwe und Botswana setzen sich seit langem für die Kontrolle ihrer Wildtierressourcen ein, besonders seit den umstrittenen Verkäufen von Elfenbein, die 1999 und 2008 durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) genehmigt wurden.
Die Elefantenpopulation in Simbabwe, die auf fast 100.000 Tiere geschätzt wird, übersteigt die Kapazität der Nationalparks, was zu einer schweren Belastung der Ökosysteme führt. Zusammen mit den unverkauften Vorräten an Elfenbein hat dies die Forderung nach einem kontrollierten Elfenbeinhandel ausgelöst, um Einnahmen für den Naturschutz zu generieren. Dieser Vorschlag wurde jedoch durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) blockiert.
Fulton Mangwanya, Direktor der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks), betont die finanziellen Schwierigkeiten. Der kontrollierte Verkauf des gelagerten Elfenbeins könne helfen, wichtige Ausgaben wie Ranger-Patrouillen, Ausrüstung und Initiativen für die Dorfgemeinschaften in der Region zu decken. Diese Aufgaben seien derzeit unterfinanziert.
In den vergangenen Wochen sind Dutzende Elefanten im Hwange-Nationalpark in Simbabwe verdurstet, wo 45.000 Elefanten auf solarbetriebene Bohrlöcher angewiesen sind, um Wasser zu bekommen. Durch El Niño und den Klimawandel verschärfte Dürren haben die Wasserquellen ausgetrocknet, sodass die 104 Bohrlöcher des Parks kaum noch den Bedarf von 200 Litern pro Elefant täglich decken.
Unter internationalem Druck, Elefanten zu schützen, schlug der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, Anfang des Jahres vor, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Die Deutschen sollten “mit den Tieren zusammenleben, so wie Sie es uns beibringen”, sagte Masisi der deutschen Zeitung Bild. “Das ist kein Witz.”
Dies war eine Antwort auf den Vorstoß der deutschen Umweltministerin Steffi Lemke, die Jagd im südlichen Afrika durch europäische Vorschriften einzuschränken. Nach diesem Streit war Masisi in Berlin und traf dort auch Lemke. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Doch seitdem hat Lemke ihre Forderung nicht mehr offiziell wiederholt.
Botswanas Minister für Wildtiere, Dumezweni Mthimkhulu, drohte im März damit, 10.000 Elefanten in den Londoner Hyde Park zu schicken, damit die Briten “einen Vorgeschmack auf das Leben mit ihnen” bekommen. Botswana hat zuvor bereits 8.000 Elefanten an das benachbarte Angola abgegeben und Hunderte weitere an Mosambik angeboten, um die Population zu reduzieren. Solche Umsiedlungen finden immer wieder statt, werfen jedoch eigene Probleme auf.
Während die Debatte weitergeht, kämpfen die Länder des südlichen Afrikas mit der Spannung zwischen der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts, der Bewältigung von Konflikten zwischen Mensch und Tier und der Finanzierung des Naturschutzes. “Naturschutz kostet Geld“, sagt der Chef von ZimParks, Mangwanya. “Ohne alternative Einnahmequellen bleiben uns nur sehr wenige Optionen.”
Bundeskanzler Scholz soll beim UN-Zukunftsgipfel am 22. September eine Eröffnungsrede in New York halten, wie es in einer Mitteilung hieß. Zusammen mit Namibia hat die Bundesregierung das Treffen vorbereitet, bei dem sich die Mitgliedsstaaten darüber verständigen wollen, wie globale Themen in Einklang mit der Agenda 2030 noch umgesetzt werden sollen.
Für Afrika wird es insbesondere um eine stärkere Rolle im UN-Sicherheitsrat gehen. Der vorab veröffentlichte Entwurf der Abschlusserklärung (4. Revision vom 13. September) legt einen Schwerpunkt auf die Reform des UN-Sicherheitsrates und die Anerkennung der historischen Sonderstellung Afrikas. Außerdem soll die Afrikanische Union bei ihren Friedensmissionen besser vom UN-Sicherheitsrat unterstützt werden.
Der UN-Sicherheitsrat hatte die Rolle Afrikas in dem Gremium zum ersten Mal überhaupt in ein einer Sitzung im August diskutiert, auf Vorschlag Sierra Leones, das zu der Zeit den Vorsitz führte.
Für eine Reform des Sicherheitsrates zugunsten Afrikas gibt es im Wesentlichen drei Positionen unterschiedlicher Ländergruppen:
Die Abschlusserklärung des Zukunftsgipfels, der am 23. September zu Ende gehen soll, hat keinen bindenden Charakter für die Unterzeichner. lcw
In den vergangenen zwei Jahren haben internationale Investoren angesichts weltweit gestiegener Zinsen in großem Umfang Kapital aus Afrika abgezogen. Doch nun nimmt das Interesse offenbar wieder zu. Jamie Dimon, der CEO der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Chase, hat angekündigt, im Oktober zu einer großen Afrika-Tour aufzubrechen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hat.
Auf dem Reiseprogramm stehen:
Ziel der Reise ist, dass JP Morgan mehr Geschäft auf dem afrikanischen Kontinent machen und dazu die Präsenz vor Ort erhöhen will. Während von deutscher Seite seit vielen Jahren kein Chef einer der größeren Banken Afrika besucht hat, wird dies Dimons schon zweiter Besuch in sieben Jahren sein.
Dimons Interesse an Afrika hat drei Gründe:
Lange unterhielt die US-Bank nur in Südafrika und Nigeria Regionalbüros. Nach einem Treffen im Februar 2023 mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto hat Dimon auch in Nairobi ein Büro eröffnet, das seine Adresse im GTC Office Tower im Stadtteil Westlands hat. Eine Ankündigung Dimons im Jahr 2018, auch in Ghana ein Regionalbüro zu eröffnen, ist bisher nicht realisiert.
Allerdings hat JP Morgan in Kenia noch keine Banklizenz von der Zentralbank erhalten, was die Geschäfte der US-Bank in der Region erschwert. Dies dürfte ein Gesprächsthema sein, wenn Dimon sich in Kenia mit Regierungsvertretern treffen wird. hlr
Die Schule der Gendarmerie sowie das Präsidententerminal und militärische Anlagen am Flughafen in Malis Hauptstadt Bamako – damit haben die Terroristen ausschließlich militärische beziehungsweise staatliche Ziele für ihren Anschlag am Dienstag ausgewählt. Die Al-Qaida nahestehende Gruppierung JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) hat den doppelten Anschlag für sich reklamiert.
Sich auf staatliche und militärische Einrichtungen zu beschränken, könne als positive Botschaft der Terroristen an die Bevölkerung verstanden werden, mutmaßte der Analyst Wassim Nasr im französischen Auslandssender France 24.
Gleichzeitig kann der jüngste Angriff aber auch als eine Warnung gelesen werden: “Die Dschihadisten haben gezeigt, dass sie jederzeit auch im Süden zuschlagen können und haben den Bewohnern Bamakos eindrucksvoll bewiesen, dass der Konflikt nicht weit weg ist“, sagte Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gegenüber Table.Briefings.
Die Regierungstruppen, die von russischen Kräften des Afrika-Korps (ehemals Wagner) unterstützt werden, sind momentan schwerpunktmäßig außerhalb Bamakos eingesetzt. “Insofern ist der Anschlag eine Taktik, um die Regierung dazu zu zwingen, mehr Truppen in die Hauptstadt zu verlegen und aus dem Zentrum und dem Norden abzuziehen”, so Laessing, der das Sahel-Programm der KAS in Bamako leitet.
Die Terroristen setzten am Flughafen mehrere Flugzeuge und eine Drohne in Brand, unter anderem den Jet von Präsident Goïta. Damit sollte die Junta blamiert werden, sagte Laessing.
Wie viele Todesopfer der Anschlag forderte, ist weiterhin unklar. Auf Propaganda-Kanälen der JNIM war von “mehreren hunderten feindlichen Kämpfern” die Rede, die getötet worden sein sollen. Die malische Regierung gab an, die Terroristen getötet zu haben.
Der Tag des Anschlags schien bewusst gewählt: Er fiel auf den 64. Geburtstag der Gendarmerie. In der Schule, die die Terroristen angriffen, warteten zudem einige Inhaftierte auf einen Prozess. Am Wochenende zuvor feierte die Regierung außerdem den ersten Jahrestag der Gründung der Allianz der Sahelstaaten (AES), gemeinsam mit Burkinas und Nigers militärischen Machthabern. Die AES hat sich zum Ziel gesetzt, den Terrorismus in der Region besser zu bekämpfen. Malis Präsident Goïta hatte in seiner Festtagsrede Erfolge beschrieben.
Das Auswärtige Amt verurteilte den Anschlag in einem Post auf der Plattform X und rief auf seiner Website zu Vorsicht am kommenden Wochenende auf, an dem in Mali der Nationalfeiertag begangen wird. Zudem steht in rund zwei Monaten mit der 30. Auflage der Foto-Biennale in Bamako ein Kulturevent an, das weit über die Region hinaus in Afrika Bedeutung hat.
Das russische Außenministerium schickte am Donnerstag einen Lufttransport mit Medikamenten und Nahrungsmitteln für die malischen Truppen nach Bamako, wie unter anderem das russische Auslandsmedium African Initiative berichtete. lcw
US-Präsident Joe Biden plant eine Reise nach Deutschland und Angola. Biden wird zunächst Berlin besuchen und dann nach Angola weiterreisen. Die fünftägige Reise wird voraussichtlich vom 10. bis 15. Oktober stattfinden. Noch ist nicht bekannt, wie viel Zeit Biden in jedem der beiden Länder verbringen wird.
Der Besuch in Angola ist die erste Visite eines US-Präsidenten in dem Land und Bidens erste Afrikareise südlich der Sahara. Zuletzt hatte Präsident Obama im Jahr 2015 ein Land südlich der Sahara besucht.
Biden hatte im vergangenen Jahr den angolanischen Präsidenten João Lourenço im Weißen Haus empfangen und versprochen, eine engere Partnerschaft mit den Demokratien in Afrika aufzubauen. Finanzministerin Janet Yellen und Vizepräsidentin Kamala Harris besuchten Afrika im Jahr 2023, Außenminister Antony Blinken dieses Jahr. Im September 2023 war Lloyd Austin als erster US-Verteidigungsminister nach Angola gereist.
Biden hatte schon im vergangenen Jahr eine Reise nach Angola geplant, diese aber wegen des Ausbruchs des Gaza-Kriegs verschoben. Der US-Präsident sah sich zuletzt vermehrter Kritik ausgesetzt, weil er den afrikanischen Kontinent nicht früher in seiner Amtszeit besucht hat, nachdem er im Dezember 2022 ein Gipfeltreffen zwischen den USA und den afrikanischen Staatsoberhäuptern in Washington ausrichtete.
Angola ist für Washington ein besonders wichtiger Partner auf dem Kontinent: Die USA (und die EU) unterstützen mit dem Lobito-Korridor ein Großprojekt, das die rohstoffreichen Gebiete DR Kongos und Sambias mit dem angolanischen Hafen Lobito auf dem Schienenweg verbindet, um die Überlastung der Straßen auf der Kupfer- und Kobaltroute zu umgehen und den Export in westlicher Richtung zu erleichtern. ajs

Spätestens mit dem Bericht der sogenannten “Süßmuth-Kommission” vor bald 25 Jahren war klar: Ab den 2020er Jahren wird die Alterung und Schrumpfung unseres Arbeitskräftepotenzials zu massiven Problemen führen. Heute ist das kein Szenario mehr, sondern harte Realität. Arbeitskräftemangel ist eine strukturelle Wachstumsbremse, die uns laut IW Köln allein im Jahr 2024 fast 50 Milliarden Euro an Produktionskapazität kosten wird. Längst reicht die Mobilisierung inländischer Potenziale nicht mehr aus, den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft zu decken. Ohne die aktuell zwölf Millionen oder 28 Prozent Beschäftigten mit Migrationshintergrund wären unsere Wirtschaft und unsere Sozialsysteme schon längst kollabiert. Und ohne Arbeitskräftemigration aus Afrika, die als Option lange vernachlässigt worden ist, wird es in Zukunft nicht gehen. Auf unserem Nachbarkontinent leben die jüngsten Bevölkerungen weltweit mit einem Durchschnittsalter von circa 18 Jahren. Dass darin für das “alte Europa” eine Chance liegt, die genutzt werden sollte, liegt auf der Hand.
Doch wie ist es mit Afrika? Kein Zweifel: Arbeitskräftemobilität und das demographische Gefälle ist auch eine Chance für afrikanische Volkswirtschaften.
Die klassische Verteilung – Afrika liefert die Rohstoffe, Europa verarbeitet und exportiert sie – ist überholt. Sie scheitert an den demographischen Verhältnissen genauso wie an der Notwendigkeit, industrielle Prozesse zu dekarbonisieren. Damit wächst die Notwendigkeiten zur Diversifizierung von Direktinvestitionen auch im Bereich der industriellen Verarbeitung in Richtung Afrika – und auch dies birgt gewaltige Chancen für die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent.
Fazit: Was in Europa eine gewaltige Herausforderung ist, bietet afrikanischen Volkswirtschaften große Entwicklungschancen. Andererseits kann Afrika mit seiner jungen Bevölkerung dazu beitragen, den demographischen Wandel in Deutschland und Europa zu bewältigen.
Christoph Kannengießer ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Um die Jahrtausendwende war er knapp fünf Jahre Geschäftsführer Arbeitsmarkt bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und als solcher Mitglied der von der Bundesregierung berufenen Zuwanderungskommission (sog. “Süßmuth-Kommission”).
The Guardian: Schläge und Vergewaltigungen durch EU-finanzierte Kräfte in Tunesien. Die harte Haltung Italiens in der Migrationsfrage betrachten einige europäische Politiker als positives Beispiel. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war eine treibende Kraft hinter der EU-Vereinbarung, die Brüssel veranlasste, Tunesien 89 Millionen Euro an migrationsbezogenen Geldern zuzusagen. Eine Untersuchung des Guardian zeigt jedoch, dass die EU-Mittel an Beamte gehen, die in schockierende Misshandlungen verwickelt sind: Die tunesische Nationalgarde beraubt, verprügelt und vergewaltigt Migranten. Auch setzt sie Frauen und Kinder in der Wüste ohne Nahrungsmittel und Wasser aus und arbeitet mit den Schmugglern zusammen, um Bootsfahrten für Migranten zu organisieren. Hochrangige Brüsseler Quellen geben zu, dass die EU von den Missbrauchsvorwürfen gegen die tunesischen Sicherheitskräfte weiß, aber in ihrer Verzweiflung ein Auge zudrückt. Es gibt sogar Pläne, mehr Geld nach Tunesien zu schicken, als öffentlich zugegeben wurde.
Le Monde: Hunderttausende im Sudan in Lebensgefahr. Hunderttausende von Menschenleben sind durch die Kämpfe in der belagerten Stadt al-Faschir im Sudan gefährdet, warnten hochrangige UN-Beamte am Mittwoch. “Hunderttausende von Zivilisten sind in al-Faschir eingeschlossen und sehen sich nun der Gefahr massiver Gewalt ausgesetzt”, sagte Martha Pobee, UN-Untergeneralsekretärin für Afrika, vor dem UN-Sicherheitsrat. “Hunderttausende von Menschen sind in unmittelbarer Gefahr, darunter mehr als 700.000 Vertriebene in und um al-Faschir”, fügte Joyce Msuya, amtierende Leiterin des UN-Büros für humanitäre Hilfe, hinzu. Experten des UN-Menschenrechtsrats forderten Anfang September die Entsendung einer unabhängigen Truppe zum Schutz der Zivilbevölkerung im Sudan. Die sudanesischen Kriegsparteien lehnen dies ab.
Haaretz: Israel rekrutiert afrikanische Asylsuchende für Gaza-Krieg. Die israelischen Sicherheitsbehörden rekrutieren afrikanische Asylbewerber für die Teilnahme an teilweise lebensgefährlichen Militäroperationen im Gaza-Streifen. Im Gegenzug wird ihnen ein dauerhafter Aufenthaltsstatus versprochen. Quellen im Verteidigungsministerium sagen inoffiziell, das Projekt werde in organisierter Weise und unter der Anleitung von Rechtsberatern des Ministeriums durchgeführt. Die interne Kritik an dieser Praxis werde unterdrückt. Bis heute wurde keinem Asylbewerber, der zu den Kriegsanstrengungen beigetragen hat, ein offizieller Status zuerkannt.
Financial Times: Russland und Ukraine unterstützen im Sudan dieselbe Seite. Russische und ukrainische Kämpfer unterstützen nach Angaben hochrangiger sudanesischer Geheimdienstoffiziere die Ausbildung der gleichen Seite im sudanesischen Bürgerkrieg. Sowohl pensionierte Piloten aus der Ukraine als auch Scharfschützen aus Russland arbeiten mit den sudanesischen Streitkräften von De-facto-Präsident General Abdel Fattah al-Burhan zusammen. Die Loyalität Russlands im Sudan war zunächst unklar, da das Land früher mit RSF-Chef Hemeti in Verbindung stand, der Moskau am Vorabend der russischen Invasion in der Ukraine besuchte und Geschäfte mit Wagner-Söldnern gemacht hatte. Die sudanesische Militärführung hat inzwischen davon gesprochen, die Pläne für den Bau eines russischen Marinestützpunkts am Roten Meer wieder aufleben zu lassen.
African Business: Tinubus Zufallsgewinnsteuer bringt nigerianische Banken in Aufruhr. Als die Regierung des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu im vergangenen Jahr den Naira abwertete, blieb nur ein Wirtschaftszweig davon weitgehend verschont: die Banken. Die vier größten Banken in Nigeria – Access Bank, Guaranty Trust, Zenith Bank und United Bank for Africa – konnten ihre Vorsteuergewinne 2023 auf 2,9 Billionen Naira (1,58 Milliarden Euro) mehr als verdoppeln. Nun soll rückwirkend eine Steuer von 70 Prozent auf die von den Banken nach der Abwertung erzielten Devisengewinne eingeführt werden. Unter den Führungskräften der Banken wird gemunkelt, dass man dagegen gerichtlich vorgehen will.
Jeune Afrique: Republik Kongo plant neues Wasserkraftwerk ab Januar. Die Regierung von Kongo-Brazzaville hat mit der China Overseas Infrastructure Development and Investment Corporation (Coidic) eine Absichtserklärung über den Bau des Sounda-Wasserkraftwerks im Süden des Landes unterzeichnet. Der Bau soll im Januar 2025 anlaufen. Der Damm wird 600 bis 800 Megawatt Strom erzeugen. Die Gesamtkosten werden auf 1.300 Milliarden CFA-Franc (1,9 Milliarden Euro) geschätzt, die von China vorfinanziert werden. Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960 hat Kongo bereits von drei von China auf seinem Boden errichteten Wasserkraftwerken profitiert.
Reuters: Singapurs GenZero arbeitet mit Ruanda an Projekten zum Kohlenstoffausgleich. Singapurs staatlich geförderte Investmentgesellschaft GenZero wird mit Ruanda bei Projekten zum Emissionsausgleich zusammenarbeiten, wie die Organisation am Donnerstag bekannt gab. “Wir werden in den kommenden Monaten potenzielle Projekte mit dem ruandischen Green Fund und der ruandischen Umweltbehörde prüfen, um festzustellen, ob sie für die Zusammenarbeit in Frage kommen”, sagte Frederick Teo, Geschäftsführer von GenZero. Länder wie Australien und Großbritannien haben die Verwendung von Ausgleichszahlungen, die weithin kritisiert wurden, zur Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele ausgeschlossen. Singapur hingegen verlässt sich darauf, weil dem Stadtstaat der Platz zum Bau von Großprojekten für erneuerbare Energien fehlt.
Semafor: Südafrika umwirbt Elon Musk. Die südafrikanische Regierung plant, die Gespräche mit Elon Musk über Investitionen in seinem Geburtsland zu intensivieren. Präsident Cyril Ramaphosa sagte kürzlich, er habe mit dem reichsten Mann der Welt telefoniert, nachdem Starlink, Musks Satelliteninternetdienst, sich an die Regierung gewandt hatte, um eine Genehmigung zu erhalten. Der Präsident freue sich auf weitere Gespräche mit Musk, da die Regierung ihre Bemühungen um Investitionen verstärken wolle, teilte Ramaphosas Sprecher mit. “Bei dem Gespräch ging es nicht nur um Starlink, sondern auch um eine breitere Palette von Investitionen, zu denen auch Tesla und Space X gehören könnten”, sagte er.
Britische Regierung: Förderung von Technologie und Wissenschaft in Ghana und Nigeria. Die britische Regierung hat am Dienstag angekündigt, Wirtschaftswachstum, Technologie und Wissenschaft in Ghana und Nigeria fördern zu wollen. Dafür stellt sie einen vergleichsweise geringen Betrag von 1,9 Millionen Pfund (2,3 Millionen Euro) bereit. Das Projekt ist Teil des Africa Technology and Innovation Partnerships Programme (UK-ATIP).

Ian Khama, Botswanas ehemaliger Präsident, ist nach dreijährigem Exil in sein Heimatland zurückgekehrt. Vergangene Woche überquerte er die Landgrenze mit dem Auto: “Ich bin von Südafrika aus nach Botswana eingereist und bin selbst gefahren”, erzählt Khama. Seit Dezember gibt es in Botswana einen Haftbefehl gegen Khama. Ihm werden 14 Vergehen vorgeworden, darunter Geldwäsche und illegaler Waffenbesitz, die Khama zurückweist und als “Schwindel” und Teil der politisch motivierten “Verfolgung” des aktuellen Staatspräsidenten Masisi bezeichnet.
Der Ex-Präsident Khama hatte die vergangenen Jahre in Südafrika und Eswatini verbracht – aus “Sicherheitsgründen”, wie er sagt. Nach seiner Rückkehr ging der 71-jährige sofort zum Amtsgericht in der Hauptstadt Gaborone, um einen Antrag auf Kaution zu stellen. Zuvor hatte Khamas Anwaltsteam seine Rückkehr angekündigt. Der Ex-Präsident kam jedoch zehn Tage früher und überraschte alle.
Richter Mareledi Dipate setzte den Haftbefehl aus, gewährte Khama eine einstweilige Freilassung auf Kaution und verfügte, dass er Montag, den 23. September, vor Gericht erscheinen soll. Khamas Anhänger skandierten: “Der General ist zurück.” Dieser war vor seiner Karriere in der Politik knapp ein Jahrzehnt als General Oberbefehlshaber der Botswana Defence Force (BDF), der Armee Botswanas.
Die Rückkehr Khamas erfolgte zu einem brisanten Zeitpunkt. In einigen Wochen, am 30. Oktober, wird in Botswana gewählt. Präsident Mokweetsi Masisi, stellvertretender Präsident unter Khama und dessen Nachfolger, strebt eine zweite Amtszeit von fünf Jahren an. Ursprünglich hatten die beiden ein gutes Verhältnis, zerstritten sich dann jedoch.
Khama wurde zum öffentlichen Kritiker Masisis. Kurz nach der Amtsübernahme hatte dieser einige wichtige politische Entscheidungen von Khama rückgängig gemacht, darunter das Verbot der Elefantenjagd. Auch setzte Masisi auf eine engere Zusammenarbeit mit China, was Khama kritisch sah. Monate später verließ Khama die langjährige Regierungspartei Botswana Democratic Party (BDP), die 1961 sein Vater Sir Seretse Khama und erster Präsidenten des Landes, mitgegründet hatte.
Seit 1965, einem Jahr vor der Unabhängigkeit von Botswana, ist die BDP ununterbrochen an der Macht und hat mithilfe der Diamantenindustrie einen stabilen demokratischen Staat mit gehobenen mittleren Einkommen aufgebaut. Doch seit einiger Zeit sind Risse sichtbar: Die Wirtschaft ist ins Stocken geraten, und es häuft sich der Unmut über Korruption und autoritäre Staatsführung.
“Botswana war seit der Unabhängigkeit eine Demokratie. Wir hatten einen sehr guten Ruf in Sachen Demokratie, wir waren ein leuchtendes Vorbild auf dem afrikanischen Kontinent, wir waren weltweit für unsere demokratischen Grundsätze bekannt”, so Khama. “Und dann kommt eines Tages dieser Mann und stellt einfach alles auf den Kopf.” Für ihn sei Masisi die “botswanische Version von Donald Trump”. 2019 wurde Khama Mitglied in der Botswana Patriotic Front (BPF), einer Absplitterung der BDP. Bei den Wahlen 2019 erreichten sie 4,3 Prozent.
Khama war von 2008 bis 2018 vierter Präsident des kleinen aber erfolgreichen Landes. Er hatte sich für eine Lösung der übermäßigen Abhängigkeit der Wirtschaft Botswanas von Diamanten und für Diversifizierung, etwa im Agrar- oder Tourismussektor, eingesetzt. Auch stand er kritisch dem ausufernden Alkoholgenuss gegenüber, der viele soziale Probleme verursacht.
Politische Führung lernte Khama über zehn Jahre als stellvertretender Präsident unter seinem Vorgänger Festus Mogae. Zuvor hatte er eine erfolgreiche Karriere im Militär absolviert. Ausgebildet wurde er an der renommierten Royal Military Academy Sandhurst in England, auch als Kampfpilot. 1977, im Alter von 24 Jahren, ernannte ihn sein Vater Sir Seretse zum Brigadegeneral.
Der Vater hatte 1948 im englischen Exil die weiße Engländerin Ruth Williams geheiratet, was zu den Hochzeiten der Apartheit im benachbarten Südafrika für Irritationen sorgte. Botswana war damals als Betschuanaland britisches Protektorat. Ende des 19. Jahrhundert hatte das Deutsche Reich auch Interesse an dem trockenen und leeren Landstrich gezeigt.
In England kam auch Ian Khama 1953 zur Welt, der seit seiner Kindheit nach westlichen Werten erzogen wurde. “Obwohl Khama darauf beharrt, dass er nie Präsident werden wollte, wurde er buchstäblich in die Macht hineingeboren“, schrieb 2019 die südafrikanische Wochenzeitung Mail & Guardian. Später als Politiker kritisierte er offen die autoritären Machthaber auf dem Kontinent wie Robert Mugabe in Simbabwe oder Umar al-Bashir im Sudan. Khama machte internationale Politik aus Botswana heraus. Reisen lag ihm nicht. Er hatte etwa nie an einem Treffen der Afrikanischen Union (AU) teilgenommen.
Neben Mauritius und den Seychellen gilt Botswana als Musterdemokratie in Afrika. Auch dazu hat Khama viel beigetragen. Das Land mit 2,5 Millionen Einwohnen wird regelmäßig unter den Top-5 des Ibrahim Index of African Governance gelistet. Den Index gibt es seit 2007. In den vergangenen Jahr ist Botswana von Platz drei auf Platz fünf abgerutscht. Im letzten Index von 2022 musste das Land Punkte im Bereich Sicherheit & Rechtsstaatlichkeit lassen. Andreas Sieren
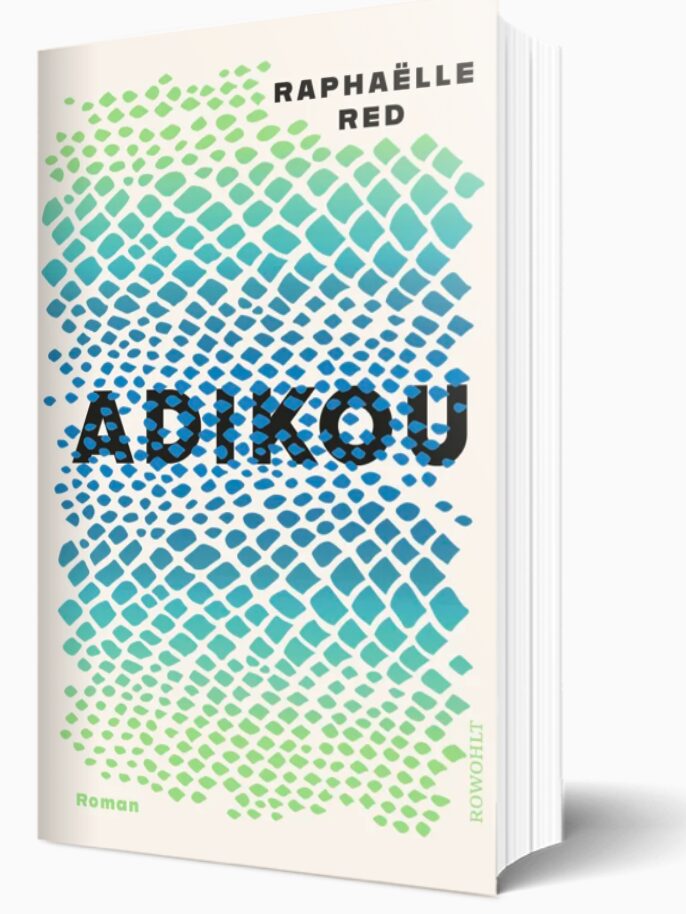
Romane der afrikanischen Diaspora scheinen sich zu einem eigenen Literaturgenre zu entwickeln. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Bücher junger Afrikanerinnen erschienen, die in Europa aufgewachsen sind und sich auf die Suche nach ihren Wurzeln in Afrika begeben.
Der erste Roman von Raphaëlle Red, der nun bei Rowohlt auch auf Deutsch erschienen ist, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach Togo reist und dort nach den verschwommenen Ursprüngen ihrer Familie sucht. Im Frühjahr hat die Autorin die französischsprachige Fassung in Frankreich veröffentlicht und nun die deutsche Übersetzung auch inhaltlich überarbeitet. Raphaëlle Red ist in Paris geboren und in Berlin aufgewachsen. Raphaëlle Red schreibt unprätentiös und doch sehr anschaulich, sodass eine Geschichte entstanden ist, in die sich der Leser gerne mitnehmen lässt. hlr
Raphaëlle Red: Adikou. Roman. Deutsche Fassung: Rowohlt Verlag, 2024, übersetzt von Patricia Klobusiczky, gebundene Ausgabe: 24 Euro, E-Book: 19,99 Euro.
die Unionsparteien haben sich festgelegt: Friedrich Merz wird ihr Kanzlerkandidat bei den nächsten Wahlen. Afrikapolitisch hat sich der CDU-Chef bislang noch kaum hervorgetan. Dennoch lassen sich einige Rückschlüsse auf den Ansatz ziehen, die ein Kanzler Merz mit Blick auf den Nachbarkontinent verfolgen würde, etwa mit Blick auf die Außenwirtschaftspolitik. Unser Hauptstadtkorrespondent David Renke hat sich dieses Themas angenommen.
Außerdem blicken wir in dieser Ausgabe auf das Engagement deutscher Unternehmen in Ägypten, die Reisen, die US-Präsident Biden und JP Morgan-Boss Dimon nach Afrika planen und die Rückkehr des botswanischen Ex-Präsidenten aus dem Exil. Und wie immer haben wir auch aktuelle Nachrichten und weitere Berichte für Sie.
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Am Montag werden die Parteispitzen der CDU-/CSU-Schwesterparteien Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten küren. Unter den Entwicklungspolitikern der Unionsfraktion im Bundestag blickt man positiv auf die Entscheidung – und das, obwohl sich Merz in den vergangenen Jahren aus entwicklungspolitischen Debatten weitestgehend herausgehalten hat und auch beim Thema Afrika ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. Damit steht Merz im Gegensatz zu Scholz, der sich seit Beginn seiner Amtszeit um einen steten Austausch mit dem Nachbarkontinent bemüht. Nur über Umwege lässt sich ablesen, wie die Afrikapolitik eines möglichen Kanzlers Friedrich Merz aussehen könnte.
Denn mit ihrem Afrika-Strategiepapier hat die Union bereits im letzten Jahr die Leitlinien für die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten vorgestellt. An der Erarbeitung war Merz zwar nicht beteiligt, dennoch findet sich auch darin das außenpolitische Credo des CDU-Parteivorsitzenden wieder: ein stärkerer Fokus auf die deutschen Interessen. “Deutschland und die EU sind gefordert, ihre strategischen Interessen gegenüber den afrikanischen Partnern klar zu formulieren”, heißt es in dem Papier. Dabei komme der verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit, außen- und sicherheitspolitischen Interessen sowie der Reform multilateraler Kooperationsplattformen eine besondere Bedeutung zu.
Zudem fordert die Fraktion in dem Papier mehr deutsche Verantwortung bei multilateralen Einsätzen in Afrika – vor allem seitdem die Franzosen ihre militärische Präsenz im Sahel deutlich zurückfahren mussten.
Wirtschaftspolitisch will die Union private Investitionen in Afrika fördern. “Wer in Afrika Armut bekämpfen und Wohlstand schaffen will, der muss der Privatwirtschaft eine noch viel größere Aufmerksamkeit schenken und insbesondere den Aufbau von Wertschöpfungsketten vor Ort in den Blick nehmen”, heißt es in dem Strategiepapier.
Ob diese Ideen unter einem von Merz geführten Kanzleramt tatsächlich auch umgesetzt werden, ist allerdings unklar. Speziell vor dem Hintergrund, wie zerstritten die Partei zuletzt in der Debatte um die Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit war. Klar dürfte jedoch sein, dass das Thema, wie Migration begrenzt werden kann, für Merz im Fokus stehen wird.
Dabei macht die Zuwanderung aus Afrika nur einen kleinen Teil der Migration aus. Im vergangenen Jahr lag die Nettozuwanderung laut Statistischem Bundesamt bei 663.000 Menschen. Davon kamen netto 330.000 aus Europa, 287.000 aus Asien, doch nur 61.000 Menschen aus Afrika, während es in Richtung USA sogar eine Nettoabwanderung gab. Eine umfassende Afrika-Strategie lässt sich daher nicht auf das Thema Migration beschränken.
Dass jedoch die geopolitischen Realitäten und der weitere Aufstieg Chinas die Hinwendung zu anderen Partnern unumgänglich machten, ist Merz klar. “Wir überlassen Afrika zurzeit China”, sagte Merz während einer Diskussion im Rahmen des Tags der Konrad-Adenauer-Stiftung und kritisierte eine fehlende Afrika-Strategie der Europäischen Union. Tatsächlich findet die europäische Position selten einheitliche Positionen, um auf die Entwicklungen auf dem Kontinent zu reagieren.
Südafrika und andere Länder des Kontinents wenden sich stärker der Brics-Gruppe zu, und der Sahel droht, zu einer riesigen Failed Region vom Atlantik bis zum Roten Meer zu zerfallen. Trotz des Plädoyers bleiben Zweifel am tiefergehenden Interesse an den afrikanischen Staaten. Während der Diskussion unterlief Merz das Fettnäpfchen, Afrika als Land zu bezeichnen.
Dieser Realität muss sich auch Olaf Scholz seit Beginn seiner Amtszeit stellen und hat entsprechend immer wieder auf die Bedeutung Afrikas hingewiesen. Bemerkenswert ist allein die Zahl der Reisen, die der Kanzler auf den Nachbarkontinent in dieser Legislatur absolviert hat. Senegal, Niger, Südafrika, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Ghana besuchte Scholz allein in den vergangenen drei Jahren. Hinzu kommt formal noch Ägypten im Rahmen der Weltklimakonferenz 2022. Im Kanzleramt gilt die Devise, den Austausch mit Afrika zu verstetigen. Aus diesem Grund knüpfte Scholz auch an das Compact-with-Africa-Format an, das seine Vorgängerin Angela Merkel im Rahmen der G20 ins Leben gerufen hatte. Nach 2019 fand 2023 der Gipfel erneut in Berlin statt.
Scholz sieht die afrikanischen Länder als wichtige Partner in einer multipolaren Welt, deren Unterstützung sich Deutschland auch mit Blick auf die Zukunft sichern sollte. Entsprechend hat sich die Bundesregierung zuletzt vermehrt dafür eingesetzt, dass die afrikanischen Länder mehr Einfluss in den internationalen Organisationen bekommen. Dazu gehört die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 im vergangenen Jahr. Im UN-Sicherheitsrat fordert die Bundesregierung zwei ständige Sitze für afrikanische Staaten sowie einen zusätzlichen nicht-ständigen Sitz. Im April dieses Jahres hatte der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil weitere Ansätze für die “Demokratisierung der internationalen Ordnung” vorgestellt.
Trotz der Vielzahl der Initiativen musste sich der Kanzler immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, auf seinen Reisen in Afrika unkonkret zu bleiben. Gleich mehrmals sorgten seine Reisen auf den Kontinent zudem für Missverständnisse. Während seiner Reise in den Senegal geriet Scholz in Deutschland in die Kritik, da er angeblich Flüssiggaslieferungen nach Deutschland vereinbart habe. Mittlerweile liegen die Pläne auf Eis. Einen konkreten Deal hatte es offenbar ohnehin nie gegeben.
Ein weiteres Missverständnis hält sich auch seit einem Jahr hartnäckig mit Kenia. Dort verkündete Präsident William Ruto bereits mehrmals öffentlich, dass mit Unterzeichnung des Fachkräfteabkommens zwischen Deutschland und Kenia rund 250.000 Fachkräfte aus Kenia nach Deutschland kommen könnten. Zuletzt nannte Ruto die Zahl sogar nach der Unterzeichnung des Abkommens in der vergangenen Woche in Berlin. Die Bundesregierung dementierte dies und wies darauf hin, dass konkrete Zahlen überhaupt nicht in dem Abkommen festgeschrieben seien. Das allerdings ist nicht öffentlich zugänglich.
Politisch verlief die Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Ägypten erstaunlich ruhig. Deutschlands Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg oder die Lage der Zivilgesellschaft in Ägypten selbst hätten einige Ansatzpunkte für gegenseitige Kritik geliefert. Womöglich erklärt sich die demonstrative Einigkeit auch damit, dass Ägypten dringend auf Wirtschaftsaufträge angewiesen ist. Denn mit dem Gaza-Krieg ist auch der Verkehr im Suezkanal, einer wichtigen Einnahmequelle des Landes, stark zurückgegangen. Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Ägyptens, unter anderem auch mit großen Infrastrukturprojekten mit Leuchtturmcharakter.
Dazu zählt zum Beispiel der Ausbau des 2.000 Kilometer langen Streckennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge, das Ägyptens Metropolen verbinden soll. An dem Projekt beteiligt sind die Verkehrssparte von Siemens sowie die Deutsche Bahn. Das ambitionierte Ziel: Bis 2025 sollen superschnelle Züge 26 Millionen Menschen in den Großstädten Kairo und Alexandria verbinden. Anschließend soll eine Bahnverbindung die Reisezeit von Kairo nach Assuan von zwölf Stunden auf sechs verkürzen.
Das sind die Aktivitäten deutscher Unternehmen im Überblick:
Daneben begleitete Steinmeier noch das Rüstungsunternehmen Diehl Defence, das Medienberichten zufolge in der Vergangenheit das Luftverteidigungssystem IRIS-T an Ägypten geliefert haben soll. Eine Anfrage zu weiteren Geschäftsaktivitäten ließ das Unternehmen unbeantwortet. Das Start-up Avilus war ebenfalls Teil der Delegation. Dieses stellt medizinische Rettungsdrohnen nach militärischen Standards her.
Während Namibias Entscheidung, 723 Wildtiere zu keulen, international Proteste hervorrief, ist sie für Wildtierexperten im südlichen Afrika nicht überraschend gekommen. Politiker im südlichen Afrika plädieren schon lange für eine größere Souveränität im Management ihres Wildbestands. Sie argumentieren, dass die internationale Gemeinschaft ihre erfolgreichen Bemühungen um den Artenschutz – belegt durch die weltweit größte Elefantenpopulation mit mehr als 200.000 Tieren und andere stark gewachsene Wildtierarten – belohnen und nicht bestrafen sollte.
Namibia verteidigt die Keulung als notwendige Maßnahme zur Bekämpfung schwerer Dürre und einer Hungerkrise, die schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen – fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes – bedroht. Während einige diesen Ansatz als pragmatisch bezeichnen, argumentieren Vertreter von Tierschutzorganisationen, dass der Abschuss und die Keulung die Artenvielfalt gefährden könnten.
Die Tierschutz-Lobbyisten behaupten, die Freigabe von Trophäen würde die Wilderei fördern. Auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke will den Import von Jagdtrophäen nach Europa einschränken. Damit verfolgt sie offenbar das Ziel, die Jagd im südlichen Afrika uninteressanter zu machen.
Doch Länder wie Simbabwe und Botswana setzen sich seit langem für die Kontrolle ihrer Wildtierressourcen ein, besonders seit den umstrittenen Verkäufen von Elfenbein, die 1999 und 2008 durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) genehmigt wurden.
Die Elefantenpopulation in Simbabwe, die auf fast 100.000 Tiere geschätzt wird, übersteigt die Kapazität der Nationalparks, was zu einer schweren Belastung der Ökosysteme führt. Zusammen mit den unverkauften Vorräten an Elfenbein hat dies die Forderung nach einem kontrollierten Elfenbeinhandel ausgelöst, um Einnahmen für den Naturschutz zu generieren. Dieser Vorschlag wurde jedoch durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) blockiert.
Fulton Mangwanya, Direktor der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks), betont die finanziellen Schwierigkeiten. Der kontrollierte Verkauf des gelagerten Elfenbeins könne helfen, wichtige Ausgaben wie Ranger-Patrouillen, Ausrüstung und Initiativen für die Dorfgemeinschaften in der Region zu decken. Diese Aufgaben seien derzeit unterfinanziert.
In den vergangenen Wochen sind Dutzende Elefanten im Hwange-Nationalpark in Simbabwe verdurstet, wo 45.000 Elefanten auf solarbetriebene Bohrlöcher angewiesen sind, um Wasser zu bekommen. Durch El Niño und den Klimawandel verschärfte Dürren haben die Wasserquellen ausgetrocknet, sodass die 104 Bohrlöcher des Parks kaum noch den Bedarf von 200 Litern pro Elefant täglich decken.
Unter internationalem Druck, Elefanten zu schützen, schlug der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, Anfang des Jahres vor, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Die Deutschen sollten “mit den Tieren zusammenleben, so wie Sie es uns beibringen”, sagte Masisi der deutschen Zeitung Bild. “Das ist kein Witz.”
Dies war eine Antwort auf den Vorstoß der deutschen Umweltministerin Steffi Lemke, die Jagd im südlichen Afrika durch europäische Vorschriften einzuschränken. Nach diesem Streit war Masisi in Berlin und traf dort auch Lemke. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Doch seitdem hat Lemke ihre Forderung nicht mehr offiziell wiederholt.
Botswanas Minister für Wildtiere, Dumezweni Mthimkhulu, drohte im März damit, 10.000 Elefanten in den Londoner Hyde Park zu schicken, damit die Briten “einen Vorgeschmack auf das Leben mit ihnen” bekommen. Botswana hat zuvor bereits 8.000 Elefanten an das benachbarte Angola abgegeben und Hunderte weitere an Mosambik angeboten, um die Population zu reduzieren. Solche Umsiedlungen finden immer wieder statt, werfen jedoch eigene Probleme auf.
Während die Debatte weitergeht, kämpfen die Länder des südlichen Afrikas mit der Spannung zwischen der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts, der Bewältigung von Konflikten zwischen Mensch und Tier und der Finanzierung des Naturschutzes. “Naturschutz kostet Geld“, sagt der Chef von ZimParks, Mangwanya. “Ohne alternative Einnahmequellen bleiben uns nur sehr wenige Optionen.”
Bundeskanzler Scholz soll beim UN-Zukunftsgipfel am 22. September eine Eröffnungsrede in New York halten, wie es in einer Mitteilung hieß. Zusammen mit Namibia hat die Bundesregierung das Treffen vorbereitet, bei dem sich die Mitgliedsstaaten darüber verständigen wollen, wie globale Themen in Einklang mit der Agenda 2030 noch umgesetzt werden sollen.
Für Afrika wird es insbesondere um eine stärkere Rolle im UN-Sicherheitsrat gehen. Der vorab veröffentlichte Entwurf der Abschlusserklärung (4. Revision vom 13. September) legt einen Schwerpunkt auf die Reform des UN-Sicherheitsrates und die Anerkennung der historischen Sonderstellung Afrikas. Außerdem soll die Afrikanische Union bei ihren Friedensmissionen besser vom UN-Sicherheitsrat unterstützt werden.
Der UN-Sicherheitsrat hatte die Rolle Afrikas in dem Gremium zum ersten Mal überhaupt in ein einer Sitzung im August diskutiert, auf Vorschlag Sierra Leones, das zu der Zeit den Vorsitz führte.
Für eine Reform des Sicherheitsrates zugunsten Afrikas gibt es im Wesentlichen drei Positionen unterschiedlicher Ländergruppen:
Die Abschlusserklärung des Zukunftsgipfels, der am 23. September zu Ende gehen soll, hat keinen bindenden Charakter für die Unterzeichner. lcw
In den vergangenen zwei Jahren haben internationale Investoren angesichts weltweit gestiegener Zinsen in großem Umfang Kapital aus Afrika abgezogen. Doch nun nimmt das Interesse offenbar wieder zu. Jamie Dimon, der CEO der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Chase, hat angekündigt, im Oktober zu einer großen Afrika-Tour aufzubrechen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hat.
Auf dem Reiseprogramm stehen:
Ziel der Reise ist, dass JP Morgan mehr Geschäft auf dem afrikanischen Kontinent machen und dazu die Präsenz vor Ort erhöhen will. Während von deutscher Seite seit vielen Jahren kein Chef einer der größeren Banken Afrika besucht hat, wird dies Dimons schon zweiter Besuch in sieben Jahren sein.
Dimons Interesse an Afrika hat drei Gründe:
Lange unterhielt die US-Bank nur in Südafrika und Nigeria Regionalbüros. Nach einem Treffen im Februar 2023 mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto hat Dimon auch in Nairobi ein Büro eröffnet, das seine Adresse im GTC Office Tower im Stadtteil Westlands hat. Eine Ankündigung Dimons im Jahr 2018, auch in Ghana ein Regionalbüro zu eröffnen, ist bisher nicht realisiert.
Allerdings hat JP Morgan in Kenia noch keine Banklizenz von der Zentralbank erhalten, was die Geschäfte der US-Bank in der Region erschwert. Dies dürfte ein Gesprächsthema sein, wenn Dimon sich in Kenia mit Regierungsvertretern treffen wird. hlr
Die Schule der Gendarmerie sowie das Präsidententerminal und militärische Anlagen am Flughafen in Malis Hauptstadt Bamako – damit haben die Terroristen ausschließlich militärische beziehungsweise staatliche Ziele für ihren Anschlag am Dienstag ausgewählt. Die Al-Qaida nahestehende Gruppierung JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) hat den doppelten Anschlag für sich reklamiert.
Sich auf staatliche und militärische Einrichtungen zu beschränken, könne als positive Botschaft der Terroristen an die Bevölkerung verstanden werden, mutmaßte der Analyst Wassim Nasr im französischen Auslandssender France 24.
Gleichzeitig kann der jüngste Angriff aber auch als eine Warnung gelesen werden: “Die Dschihadisten haben gezeigt, dass sie jederzeit auch im Süden zuschlagen können und haben den Bewohnern Bamakos eindrucksvoll bewiesen, dass der Konflikt nicht weit weg ist“, sagte Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gegenüber Table.Briefings.
Die Regierungstruppen, die von russischen Kräften des Afrika-Korps (ehemals Wagner) unterstützt werden, sind momentan schwerpunktmäßig außerhalb Bamakos eingesetzt. “Insofern ist der Anschlag eine Taktik, um die Regierung dazu zu zwingen, mehr Truppen in die Hauptstadt zu verlegen und aus dem Zentrum und dem Norden abzuziehen”, so Laessing, der das Sahel-Programm der KAS in Bamako leitet.
Die Terroristen setzten am Flughafen mehrere Flugzeuge und eine Drohne in Brand, unter anderem den Jet von Präsident Goïta. Damit sollte die Junta blamiert werden, sagte Laessing.
Wie viele Todesopfer der Anschlag forderte, ist weiterhin unklar. Auf Propaganda-Kanälen der JNIM war von “mehreren hunderten feindlichen Kämpfern” die Rede, die getötet worden sein sollen. Die malische Regierung gab an, die Terroristen getötet zu haben.
Der Tag des Anschlags schien bewusst gewählt: Er fiel auf den 64. Geburtstag der Gendarmerie. In der Schule, die die Terroristen angriffen, warteten zudem einige Inhaftierte auf einen Prozess. Am Wochenende zuvor feierte die Regierung außerdem den ersten Jahrestag der Gründung der Allianz der Sahelstaaten (AES), gemeinsam mit Burkinas und Nigers militärischen Machthabern. Die AES hat sich zum Ziel gesetzt, den Terrorismus in der Region besser zu bekämpfen. Malis Präsident Goïta hatte in seiner Festtagsrede Erfolge beschrieben.
Das Auswärtige Amt verurteilte den Anschlag in einem Post auf der Plattform X und rief auf seiner Website zu Vorsicht am kommenden Wochenende auf, an dem in Mali der Nationalfeiertag begangen wird. Zudem steht in rund zwei Monaten mit der 30. Auflage der Foto-Biennale in Bamako ein Kulturevent an, das weit über die Region hinaus in Afrika Bedeutung hat.
Das russische Außenministerium schickte am Donnerstag einen Lufttransport mit Medikamenten und Nahrungsmitteln für die malischen Truppen nach Bamako, wie unter anderem das russische Auslandsmedium African Initiative berichtete. lcw
US-Präsident Joe Biden plant eine Reise nach Deutschland und Angola. Biden wird zunächst Berlin besuchen und dann nach Angola weiterreisen. Die fünftägige Reise wird voraussichtlich vom 10. bis 15. Oktober stattfinden. Noch ist nicht bekannt, wie viel Zeit Biden in jedem der beiden Länder verbringen wird.
Der Besuch in Angola ist die erste Visite eines US-Präsidenten in dem Land und Bidens erste Afrikareise südlich der Sahara. Zuletzt hatte Präsident Obama im Jahr 2015 ein Land südlich der Sahara besucht.
Biden hatte im vergangenen Jahr den angolanischen Präsidenten João Lourenço im Weißen Haus empfangen und versprochen, eine engere Partnerschaft mit den Demokratien in Afrika aufzubauen. Finanzministerin Janet Yellen und Vizepräsidentin Kamala Harris besuchten Afrika im Jahr 2023, Außenminister Antony Blinken dieses Jahr. Im September 2023 war Lloyd Austin als erster US-Verteidigungsminister nach Angola gereist.
Biden hatte schon im vergangenen Jahr eine Reise nach Angola geplant, diese aber wegen des Ausbruchs des Gaza-Kriegs verschoben. Der US-Präsident sah sich zuletzt vermehrter Kritik ausgesetzt, weil er den afrikanischen Kontinent nicht früher in seiner Amtszeit besucht hat, nachdem er im Dezember 2022 ein Gipfeltreffen zwischen den USA und den afrikanischen Staatsoberhäuptern in Washington ausrichtete.
Angola ist für Washington ein besonders wichtiger Partner auf dem Kontinent: Die USA (und die EU) unterstützen mit dem Lobito-Korridor ein Großprojekt, das die rohstoffreichen Gebiete DR Kongos und Sambias mit dem angolanischen Hafen Lobito auf dem Schienenweg verbindet, um die Überlastung der Straßen auf der Kupfer- und Kobaltroute zu umgehen und den Export in westlicher Richtung zu erleichtern. ajs

Spätestens mit dem Bericht der sogenannten “Süßmuth-Kommission” vor bald 25 Jahren war klar: Ab den 2020er Jahren wird die Alterung und Schrumpfung unseres Arbeitskräftepotenzials zu massiven Problemen führen. Heute ist das kein Szenario mehr, sondern harte Realität. Arbeitskräftemangel ist eine strukturelle Wachstumsbremse, die uns laut IW Köln allein im Jahr 2024 fast 50 Milliarden Euro an Produktionskapazität kosten wird. Längst reicht die Mobilisierung inländischer Potenziale nicht mehr aus, den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft zu decken. Ohne die aktuell zwölf Millionen oder 28 Prozent Beschäftigten mit Migrationshintergrund wären unsere Wirtschaft und unsere Sozialsysteme schon längst kollabiert. Und ohne Arbeitskräftemigration aus Afrika, die als Option lange vernachlässigt worden ist, wird es in Zukunft nicht gehen. Auf unserem Nachbarkontinent leben die jüngsten Bevölkerungen weltweit mit einem Durchschnittsalter von circa 18 Jahren. Dass darin für das “alte Europa” eine Chance liegt, die genutzt werden sollte, liegt auf der Hand.
Doch wie ist es mit Afrika? Kein Zweifel: Arbeitskräftemobilität und das demographische Gefälle ist auch eine Chance für afrikanische Volkswirtschaften.
Die klassische Verteilung – Afrika liefert die Rohstoffe, Europa verarbeitet und exportiert sie – ist überholt. Sie scheitert an den demographischen Verhältnissen genauso wie an der Notwendigkeit, industrielle Prozesse zu dekarbonisieren. Damit wächst die Notwendigkeiten zur Diversifizierung von Direktinvestitionen auch im Bereich der industriellen Verarbeitung in Richtung Afrika – und auch dies birgt gewaltige Chancen für die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent.
Fazit: Was in Europa eine gewaltige Herausforderung ist, bietet afrikanischen Volkswirtschaften große Entwicklungschancen. Andererseits kann Afrika mit seiner jungen Bevölkerung dazu beitragen, den demographischen Wandel in Deutschland und Europa zu bewältigen.
Christoph Kannengießer ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Um die Jahrtausendwende war er knapp fünf Jahre Geschäftsführer Arbeitsmarkt bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und als solcher Mitglied der von der Bundesregierung berufenen Zuwanderungskommission (sog. “Süßmuth-Kommission”).
The Guardian: Schläge und Vergewaltigungen durch EU-finanzierte Kräfte in Tunesien. Die harte Haltung Italiens in der Migrationsfrage betrachten einige europäische Politiker als positives Beispiel. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war eine treibende Kraft hinter der EU-Vereinbarung, die Brüssel veranlasste, Tunesien 89 Millionen Euro an migrationsbezogenen Geldern zuzusagen. Eine Untersuchung des Guardian zeigt jedoch, dass die EU-Mittel an Beamte gehen, die in schockierende Misshandlungen verwickelt sind: Die tunesische Nationalgarde beraubt, verprügelt und vergewaltigt Migranten. Auch setzt sie Frauen und Kinder in der Wüste ohne Nahrungsmittel und Wasser aus und arbeitet mit den Schmugglern zusammen, um Bootsfahrten für Migranten zu organisieren. Hochrangige Brüsseler Quellen geben zu, dass die EU von den Missbrauchsvorwürfen gegen die tunesischen Sicherheitskräfte weiß, aber in ihrer Verzweiflung ein Auge zudrückt. Es gibt sogar Pläne, mehr Geld nach Tunesien zu schicken, als öffentlich zugegeben wurde.
Le Monde: Hunderttausende im Sudan in Lebensgefahr. Hunderttausende von Menschenleben sind durch die Kämpfe in der belagerten Stadt al-Faschir im Sudan gefährdet, warnten hochrangige UN-Beamte am Mittwoch. “Hunderttausende von Zivilisten sind in al-Faschir eingeschlossen und sehen sich nun der Gefahr massiver Gewalt ausgesetzt”, sagte Martha Pobee, UN-Untergeneralsekretärin für Afrika, vor dem UN-Sicherheitsrat. “Hunderttausende von Menschen sind in unmittelbarer Gefahr, darunter mehr als 700.000 Vertriebene in und um al-Faschir”, fügte Joyce Msuya, amtierende Leiterin des UN-Büros für humanitäre Hilfe, hinzu. Experten des UN-Menschenrechtsrats forderten Anfang September die Entsendung einer unabhängigen Truppe zum Schutz der Zivilbevölkerung im Sudan. Die sudanesischen Kriegsparteien lehnen dies ab.
Haaretz: Israel rekrutiert afrikanische Asylsuchende für Gaza-Krieg. Die israelischen Sicherheitsbehörden rekrutieren afrikanische Asylbewerber für die Teilnahme an teilweise lebensgefährlichen Militäroperationen im Gaza-Streifen. Im Gegenzug wird ihnen ein dauerhafter Aufenthaltsstatus versprochen. Quellen im Verteidigungsministerium sagen inoffiziell, das Projekt werde in organisierter Weise und unter der Anleitung von Rechtsberatern des Ministeriums durchgeführt. Die interne Kritik an dieser Praxis werde unterdrückt. Bis heute wurde keinem Asylbewerber, der zu den Kriegsanstrengungen beigetragen hat, ein offizieller Status zuerkannt.
Financial Times: Russland und Ukraine unterstützen im Sudan dieselbe Seite. Russische und ukrainische Kämpfer unterstützen nach Angaben hochrangiger sudanesischer Geheimdienstoffiziere die Ausbildung der gleichen Seite im sudanesischen Bürgerkrieg. Sowohl pensionierte Piloten aus der Ukraine als auch Scharfschützen aus Russland arbeiten mit den sudanesischen Streitkräften von De-facto-Präsident General Abdel Fattah al-Burhan zusammen. Die Loyalität Russlands im Sudan war zunächst unklar, da das Land früher mit RSF-Chef Hemeti in Verbindung stand, der Moskau am Vorabend der russischen Invasion in der Ukraine besuchte und Geschäfte mit Wagner-Söldnern gemacht hatte. Die sudanesische Militärführung hat inzwischen davon gesprochen, die Pläne für den Bau eines russischen Marinestützpunkts am Roten Meer wieder aufleben zu lassen.
African Business: Tinubus Zufallsgewinnsteuer bringt nigerianische Banken in Aufruhr. Als die Regierung des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu im vergangenen Jahr den Naira abwertete, blieb nur ein Wirtschaftszweig davon weitgehend verschont: die Banken. Die vier größten Banken in Nigeria – Access Bank, Guaranty Trust, Zenith Bank und United Bank for Africa – konnten ihre Vorsteuergewinne 2023 auf 2,9 Billionen Naira (1,58 Milliarden Euro) mehr als verdoppeln. Nun soll rückwirkend eine Steuer von 70 Prozent auf die von den Banken nach der Abwertung erzielten Devisengewinne eingeführt werden. Unter den Führungskräften der Banken wird gemunkelt, dass man dagegen gerichtlich vorgehen will.
Jeune Afrique: Republik Kongo plant neues Wasserkraftwerk ab Januar. Die Regierung von Kongo-Brazzaville hat mit der China Overseas Infrastructure Development and Investment Corporation (Coidic) eine Absichtserklärung über den Bau des Sounda-Wasserkraftwerks im Süden des Landes unterzeichnet. Der Bau soll im Januar 2025 anlaufen. Der Damm wird 600 bis 800 Megawatt Strom erzeugen. Die Gesamtkosten werden auf 1.300 Milliarden CFA-Franc (1,9 Milliarden Euro) geschätzt, die von China vorfinanziert werden. Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960 hat Kongo bereits von drei von China auf seinem Boden errichteten Wasserkraftwerken profitiert.
Reuters: Singapurs GenZero arbeitet mit Ruanda an Projekten zum Kohlenstoffausgleich. Singapurs staatlich geförderte Investmentgesellschaft GenZero wird mit Ruanda bei Projekten zum Emissionsausgleich zusammenarbeiten, wie die Organisation am Donnerstag bekannt gab. “Wir werden in den kommenden Monaten potenzielle Projekte mit dem ruandischen Green Fund und der ruandischen Umweltbehörde prüfen, um festzustellen, ob sie für die Zusammenarbeit in Frage kommen”, sagte Frederick Teo, Geschäftsführer von GenZero. Länder wie Australien und Großbritannien haben die Verwendung von Ausgleichszahlungen, die weithin kritisiert wurden, zur Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele ausgeschlossen. Singapur hingegen verlässt sich darauf, weil dem Stadtstaat der Platz zum Bau von Großprojekten für erneuerbare Energien fehlt.
Semafor: Südafrika umwirbt Elon Musk. Die südafrikanische Regierung plant, die Gespräche mit Elon Musk über Investitionen in seinem Geburtsland zu intensivieren. Präsident Cyril Ramaphosa sagte kürzlich, er habe mit dem reichsten Mann der Welt telefoniert, nachdem Starlink, Musks Satelliteninternetdienst, sich an die Regierung gewandt hatte, um eine Genehmigung zu erhalten. Der Präsident freue sich auf weitere Gespräche mit Musk, da die Regierung ihre Bemühungen um Investitionen verstärken wolle, teilte Ramaphosas Sprecher mit. “Bei dem Gespräch ging es nicht nur um Starlink, sondern auch um eine breitere Palette von Investitionen, zu denen auch Tesla und Space X gehören könnten”, sagte er.
Britische Regierung: Förderung von Technologie und Wissenschaft in Ghana und Nigeria. Die britische Regierung hat am Dienstag angekündigt, Wirtschaftswachstum, Technologie und Wissenschaft in Ghana und Nigeria fördern zu wollen. Dafür stellt sie einen vergleichsweise geringen Betrag von 1,9 Millionen Pfund (2,3 Millionen Euro) bereit. Das Projekt ist Teil des Africa Technology and Innovation Partnerships Programme (UK-ATIP).

Ian Khama, Botswanas ehemaliger Präsident, ist nach dreijährigem Exil in sein Heimatland zurückgekehrt. Vergangene Woche überquerte er die Landgrenze mit dem Auto: “Ich bin von Südafrika aus nach Botswana eingereist und bin selbst gefahren”, erzählt Khama. Seit Dezember gibt es in Botswana einen Haftbefehl gegen Khama. Ihm werden 14 Vergehen vorgeworden, darunter Geldwäsche und illegaler Waffenbesitz, die Khama zurückweist und als “Schwindel” und Teil der politisch motivierten “Verfolgung” des aktuellen Staatspräsidenten Masisi bezeichnet.
Der Ex-Präsident Khama hatte die vergangenen Jahre in Südafrika und Eswatini verbracht – aus “Sicherheitsgründen”, wie er sagt. Nach seiner Rückkehr ging der 71-jährige sofort zum Amtsgericht in der Hauptstadt Gaborone, um einen Antrag auf Kaution zu stellen. Zuvor hatte Khamas Anwaltsteam seine Rückkehr angekündigt. Der Ex-Präsident kam jedoch zehn Tage früher und überraschte alle.
Richter Mareledi Dipate setzte den Haftbefehl aus, gewährte Khama eine einstweilige Freilassung auf Kaution und verfügte, dass er Montag, den 23. September, vor Gericht erscheinen soll. Khamas Anhänger skandierten: “Der General ist zurück.” Dieser war vor seiner Karriere in der Politik knapp ein Jahrzehnt als General Oberbefehlshaber der Botswana Defence Force (BDF), der Armee Botswanas.
Die Rückkehr Khamas erfolgte zu einem brisanten Zeitpunkt. In einigen Wochen, am 30. Oktober, wird in Botswana gewählt. Präsident Mokweetsi Masisi, stellvertretender Präsident unter Khama und dessen Nachfolger, strebt eine zweite Amtszeit von fünf Jahren an. Ursprünglich hatten die beiden ein gutes Verhältnis, zerstritten sich dann jedoch.
Khama wurde zum öffentlichen Kritiker Masisis. Kurz nach der Amtsübernahme hatte dieser einige wichtige politische Entscheidungen von Khama rückgängig gemacht, darunter das Verbot der Elefantenjagd. Auch setzte Masisi auf eine engere Zusammenarbeit mit China, was Khama kritisch sah. Monate später verließ Khama die langjährige Regierungspartei Botswana Democratic Party (BDP), die 1961 sein Vater Sir Seretse Khama und erster Präsidenten des Landes, mitgegründet hatte.
Seit 1965, einem Jahr vor der Unabhängigkeit von Botswana, ist die BDP ununterbrochen an der Macht und hat mithilfe der Diamantenindustrie einen stabilen demokratischen Staat mit gehobenen mittleren Einkommen aufgebaut. Doch seit einiger Zeit sind Risse sichtbar: Die Wirtschaft ist ins Stocken geraten, und es häuft sich der Unmut über Korruption und autoritäre Staatsführung.
“Botswana war seit der Unabhängigkeit eine Demokratie. Wir hatten einen sehr guten Ruf in Sachen Demokratie, wir waren ein leuchtendes Vorbild auf dem afrikanischen Kontinent, wir waren weltweit für unsere demokratischen Grundsätze bekannt”, so Khama. “Und dann kommt eines Tages dieser Mann und stellt einfach alles auf den Kopf.” Für ihn sei Masisi die “botswanische Version von Donald Trump”. 2019 wurde Khama Mitglied in der Botswana Patriotic Front (BPF), einer Absplitterung der BDP. Bei den Wahlen 2019 erreichten sie 4,3 Prozent.
Khama war von 2008 bis 2018 vierter Präsident des kleinen aber erfolgreichen Landes. Er hatte sich für eine Lösung der übermäßigen Abhängigkeit der Wirtschaft Botswanas von Diamanten und für Diversifizierung, etwa im Agrar- oder Tourismussektor, eingesetzt. Auch stand er kritisch dem ausufernden Alkoholgenuss gegenüber, der viele soziale Probleme verursacht.
Politische Führung lernte Khama über zehn Jahre als stellvertretender Präsident unter seinem Vorgänger Festus Mogae. Zuvor hatte er eine erfolgreiche Karriere im Militär absolviert. Ausgebildet wurde er an der renommierten Royal Military Academy Sandhurst in England, auch als Kampfpilot. 1977, im Alter von 24 Jahren, ernannte ihn sein Vater Sir Seretse zum Brigadegeneral.
Der Vater hatte 1948 im englischen Exil die weiße Engländerin Ruth Williams geheiratet, was zu den Hochzeiten der Apartheit im benachbarten Südafrika für Irritationen sorgte. Botswana war damals als Betschuanaland britisches Protektorat. Ende des 19. Jahrhundert hatte das Deutsche Reich auch Interesse an dem trockenen und leeren Landstrich gezeigt.
In England kam auch Ian Khama 1953 zur Welt, der seit seiner Kindheit nach westlichen Werten erzogen wurde. “Obwohl Khama darauf beharrt, dass er nie Präsident werden wollte, wurde er buchstäblich in die Macht hineingeboren“, schrieb 2019 die südafrikanische Wochenzeitung Mail & Guardian. Später als Politiker kritisierte er offen die autoritären Machthaber auf dem Kontinent wie Robert Mugabe in Simbabwe oder Umar al-Bashir im Sudan. Khama machte internationale Politik aus Botswana heraus. Reisen lag ihm nicht. Er hatte etwa nie an einem Treffen der Afrikanischen Union (AU) teilgenommen.
Neben Mauritius und den Seychellen gilt Botswana als Musterdemokratie in Afrika. Auch dazu hat Khama viel beigetragen. Das Land mit 2,5 Millionen Einwohnen wird regelmäßig unter den Top-5 des Ibrahim Index of African Governance gelistet. Den Index gibt es seit 2007. In den vergangenen Jahr ist Botswana von Platz drei auf Platz fünf abgerutscht. Im letzten Index von 2022 musste das Land Punkte im Bereich Sicherheit & Rechtsstaatlichkeit lassen. Andreas Sieren
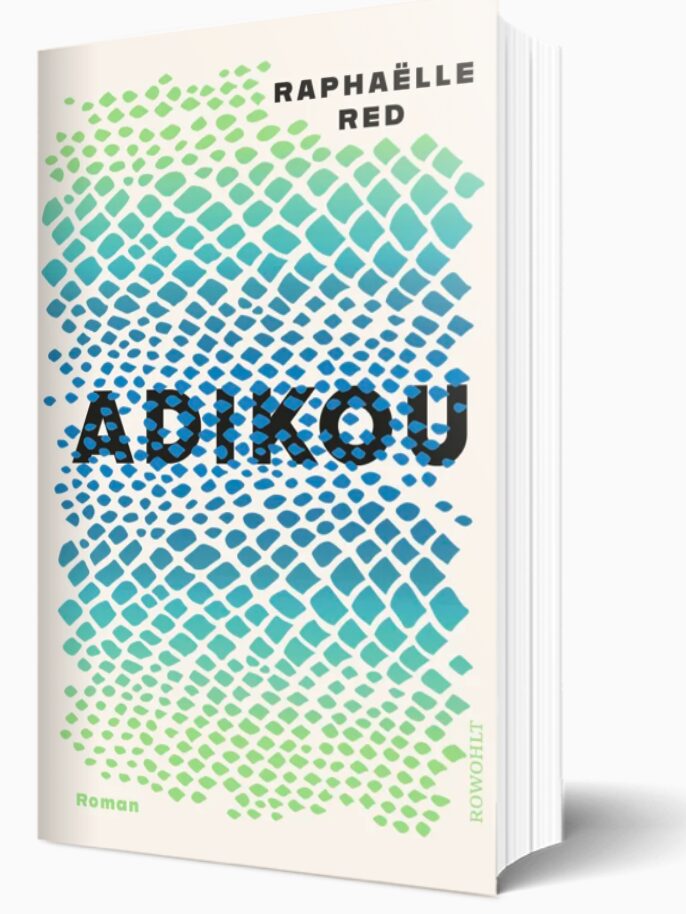
Romane der afrikanischen Diaspora scheinen sich zu einem eigenen Literaturgenre zu entwickeln. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Bücher junger Afrikanerinnen erschienen, die in Europa aufgewachsen sind und sich auf die Suche nach ihren Wurzeln in Afrika begeben.
Der erste Roman von Raphaëlle Red, der nun bei Rowohlt auch auf Deutsch erschienen ist, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach Togo reist und dort nach den verschwommenen Ursprüngen ihrer Familie sucht. Im Frühjahr hat die Autorin die französischsprachige Fassung in Frankreich veröffentlicht und nun die deutsche Übersetzung auch inhaltlich überarbeitet. Raphaëlle Red ist in Paris geboren und in Berlin aufgewachsen. Raphaëlle Red schreibt unprätentiös und doch sehr anschaulich, sodass eine Geschichte entstanden ist, in die sich der Leser gerne mitnehmen lässt. hlr
Raphaëlle Red: Adikou. Roman. Deutsche Fassung: Rowohlt Verlag, 2024, übersetzt von Patricia Klobusiczky, gebundene Ausgabe: 24 Euro, E-Book: 19,99 Euro.
