wenige Tage vor den Wahlen in den USA hat Kamala Harris das Team vorgestellt, das im Falle ihres Wahlsieges die künftige US-Afrika-Politik erarbeiten soll. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Köpfe vor und schauen darauf, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Afrika unter einer Präsidentin Kamala Harris entwickeln könnten.
In Botswana wurde bereits gewählt. Am vergangenen Mittwoch haben gut eine Million Wähler ihre Stimme abgegeben. Warum die Stimmung in dem afrikanischen Vorzeigeland aktuell gedrückt ist, erklärt unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren.
Zudem blicken wir in dieser auf die Ergebnisse des aktuellen Ibrahim Index of African Governance – dieser stellt den afrikanischen Ländern ein eher durchwachsenes Zeugnis aus.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Vizepräsidentin Kamala Harris, Kandidatin der Demokraten, ein 25-köpfiges Afrika-Beraterteam vorgestellt. Dieses soll nach Informationen des US-Mediums Semafor im Falle eines Wahlsiegs der Vizepräsidentin eine umfassende neue Afrika-Politik erarbeiten. Leiter des Teams soll demnach der ehemalige US-Justizminister Eric Holder werden. Die Afrikaexperten Witney Schneidman und Gabrielle Posner sollen das Team als Koordinatoren unterstützen. Ergänzt wird das Team durch Diplomaten, ehemalige Regierungsbeamte, Experten für Entwicklungsfinanzierung sowie Vorsitzende diasporischer Organisationen. Der Schritt des Harris-Teams kann als Signal gewertet werden, dass Afrika in einer möglichen Harris-Regierung einen größeren Stellenwert einnehmen soll.
Unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama wurde Holder als erster Afroamerikaner Justizminister. Das Ministerium führte Holder von 2009 bis 2015 und galt damals als unerbittlicher Verfolger von Whistleblowern. Nach seiner Zeit als Justizminister kehrte Holder als Rechtsberater in die Wirtschaftskanzlei Covington & Burling zurück. Zudem ist Holder in die Wahlkampagne von Harris involviert. Nach Reuters-Informationen war Holder für den Auswahlprozess möglicher Kandidaten für den “Running Mate” zuständig.
Schneidman war Stellvertreter des Vize-Unterstaatssekretärs für afrikanische Angelegenheiten (Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs) in der Regierung von Bill Clinton. In den 1990er-Jahren war Schneidman zudem Südafrika-Analyst im Bureau of Intelligence and Research, dem Nachrichtendiensts des US-Außenministeriums. Damals beobachtete Schneidman den politischen Übergang nach dem Ende der Apartheid. 2022 heuerte ihn die US-Entwicklungsorganisation USAID als Koordinator für Prosper Africa an. Die Initiative soll den Handel zwischen den USA und den afrikanischen Ländern ankurbeln und US-Investitionen in Afrika fördern. Prosper Africa rief der ehemalige Präsident Donald Trump ins Leben.
Posner ist Senior Associate bei der Strategieberatung Albright Stonebridge Group, die die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright gegründet hatte. Zuvor hat Posner in Kenia als Beraterin unter anderem für afrikanische NGOs und Parlamente gearbeitet.
Bislang war die US-Afrikapolitik in erster Linie auf Sicherheitsaspekte beschränkt. Zwar hatte Obama 2013 unter dem Namen Power Africa ein großes Elektrifizierungsprogramm zugunsten Afrikas angekündigt. Doch die Realisierung blieb weit hinter dem Versprechen zurück. Beide Nachfolger Obamas, weder Trump noch Biden, haben Afrika in ihren Amtszeiten besucht. Im Falle Bidens soll sich dies allerdings noch ändern. In der ersten Dezemberwoche will der 81-Jährige nach Angaben des Weißen Hauses Angola besuchen. Die Reise wurde – ebenso wie sein Deutschland-Besuch – Anfang des Monats verschoben. Grund war Hurrikan Milton, der über Florida hinweg zog.
Bei den Gesprächen in Angola soll neben der vertieften Zusammenarbeit bei den Themen Sicherheit, Gesundheit und wirtschaftlichen Partnerschaften auch der Lobito-Korridor im Mittelpunkt stehen. Dieser ist eines der zentralen Infrastrukturprojekte, die die Biden-Regierung in Afrika vorantreibt. Bislang ist Harris also noch die ranghöchste Vertreterin der US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die den Kontinent besucht hat. Im vergangenen Jahr besuchte Harris Ghana, Tansania und Sambia.
Trotz der mangelnden Präsidentenbesuche in Afrika in den vergangenen Jahren ist das Thema insbesondere während der Biden-Administration stärker in den Fokus gerückt. So hat die Biden-Regierung 2022 nach acht Jahren erneut einen USA-Afrika-Gipfel ausgerichtet. Zuvor hatte Biden eine eigene US-Strategie für Subsahara-Afrika vorgestellt. Zudem haben die USA die afrikanischen Länder dabei unterstützt, mehr Mitsprache in internationalen Organisationen zu bekommen. Anders als Trump war Biden in seiner Afrika-Politik weniger auf Konfrontationskurs mit China gegangen. Experten erwarten, dass Harris diesen Schwerpunkt auf Multilateralismus fortführen wird.
Ob das neue Afrika-Team der Vizepräsidentin aber überhaupt in Aktion treten wird, ist bislang offen. Die Abstimmung über die US-Präsidentschaft dürfte die knappste seit Jahren werden. Laut den Umfrageexperten von FiveThirtyEight liegt Harris landesweit hauchdünn vor Donald Trump. In den entscheidenden Swing States liegen die Kandidaten allerdings gleichauf. Zuletzt hatte die Vizepräsidentin in den Umfragen leicht verloren.
Am Mittwoch haben etwas mehr als eine Million Wähler in Botswana gewählt. Präsident Mokgweetsi Masisi, seit mehr als sechs Jahren in Amt, strebt eine zweite Amtszeit an. Ob er im Amt bleiben kann, entscheidet, ob seine Partei, die Botswana Democratic Party (BDP), die Mehrheit der Stimmen behält. Medienberichten zufolge dürfte die Wahl enger als gedacht ausgehen. Demnach hat die bisherige Oppositionspartei Umbrella for Democratic Change (UDC) 27 der insgesamt 61 zur Wahl stehenden Parlamentssitzen gewonnen. Bei insgesamt 31 gewonnenen Sitzen, könnte die UDC den Präsidenten stellen. Es wäre das erste Mal seit der Unabhängigkeit, dass nicht die BDP den Präsidenten stellen würde. Erste vorläufige Ergebnisse werden an diesem Freitag im Laufe des Tages erwartet. Ganz überraschend sind die Entwicklungen allerdings nicht.
Botswana ist eine der ältesten und stabilsten Demokratien in der Region. Seit Jahren kann sich das Land im Ibrahim Index of African Governance (IIAG), der die Regierungsführung in Afrika bewertet, unter den Top Fünf platzieren. Es gibt jedoch einen “alarmierenden Trend”: Botswana ist im Index drei Plätze nach hinten gerutscht. Schon deswegen wird die Wahl mit Interesse im Ausland verfolgt.
Vor allem die schnell steigende Arbeitslosenrate von 27,6 Prozent, die unter jungen Menschen noch viel höher ist, macht dem Land zu schaffen. Sie ist eine der höchsten in der Welt. Fast 40 Prozent der Bevölkerung sehen keine Perspektive bei der Jobsuche. Botswanas wirtschaftlichen Erfolge, die sich vor allem aus der Diamantenproduktion speisen, haben sich nicht gleichmäßig unter der Bevölkerung verteilt. Mit einem Gini-Index, der wirtschaftliche Ungleichheit misst, von 53,2 Prozent ist Botswana eines der Länder mit der höchsten Einkommensungleichheit in der Welt, fast ein Fünftel der Bevölkerung lebt in Armut. Die Wähler werfen der Regierung Korruption vor und fordern mehr Transparenz. Es sei nicht immer klar, wo die Staatseinnahmen hingeflossen sind.
Im Vorfeld der Wahlen waren denn auch Diamanten wieder ein zentrales Thema. Seit die Diamantenindustrie schwächelt, stottert auch die Wirtschaft des Landes und die Menschen werden unzufrieden. Noch heute machen Diamanten rund die Hälfte der Staatseinnahmen und 80 Prozent aller Exporte aus. Doch seit dem Einbruch des Diamantenpreises von mehr als 30 Prozent im vergangenen Jahr und der Konkurrenz durch synthetische Diamanten steht die Regierung in Gaborone unter Druck.
Trotz der aktuellen Krise war die Diamantenindustrie entscheidend für die Entwicklung des Landes. Zwischen 1965 und 1995 wuchs die Wirtschaft jedes Jahr im Schnitt über neun Prozent: die höchste Wachstumsrate in der Welt. Das Land gilt als Entwicklungsmodell mit moderner Infrastruktur, das in gute Bildung und flächendeckende Gesundheitsversorgung erfolgreich investiert hat. Die Regierung verfolgt eine umsichtige makroökonomische Politik, abgefedert von soliden Wirtschaftsinstitutionen. Industrielle Entwicklung hat bislang kaum funktioniert, nach wie vor ist die Service-Industrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Aber auch Präsident Masisi ist sich bewusst, dass eine Diversifizierung der Wirtschaft dringend notwendig ist “Botswanas Abhängigkeit von Diamanten und ein vom öffentlichen Sektor getragenes Modell haben die Wirtschaft mit der Zeit anfällig für externe Schocks gemacht“, urteilt die Weltbank. Seit 2022 ist das Wirtschaftswachstum des Landes von 5,5 Prozent auf ein Prozent in diesem Jahr gefallen, soll sich aber 2025 wieder erholen, so der Internationale Währungsfonds (IWF).
Doch so leicht gestaltet sich die Diversifizierung nicht. Versuche, die Landwirtschaft in Gang zu bringen, kommen nur langsam voran. Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigte sich im August, als Masisi das Importverbot von Frischprodukten wie Früchte aus dem benachbarten Südafrika verlängern ließ, um lokalen Produzenten unter die Arme zu greifen. Botswana leidet zudem derzeit unter einer extremen Trockenheit – keine idealen Bedingungen für eine Landwirtschaft. Wie die Wahlen auch ausgehen, es gibt viel politische Arbeit, um Botswana weiterhin auf einem stabilen und demokratischen Kurs zu halten und seinen Bewohner Jobs in Zukunft zu bieten.
Das Ergebnis des in der vergangenen Woche vorgestellten Ibrahim Index of African Governance (IIAG) über die Regierungsführung in Afrika ist durchwachsen. Nach Fortschritten ist seit 2022 der Trend zu mehr politischer Mitbestimmung in Afrika ins Stocken geraten. Der IIAG gilt als Gradmesser von Regierungsführung, die sich in Afrika eigentlich stetig verbessert hat. Für fast die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents hat sich Partizipationsmöglichkeiten in den vergangenen zehn Jahren jedoch verschlechtert. “Die Hauptursache dafür ist eine sich verschärfende Sicherheitskrise und ein schrumpfendes partizipatives Umfeld fast auf dem gesamten Kontinent”, schreibt der britisch-sudanesische Unternehmer und Philanthrop Mo Ibrahim im Vorwort des IIAG, dessen Stiftung den Bericht alle zwei Jahre herausgibt.
Für Ibrahim sind die Ergebnisse auch ein Spiegel dessen, was sich auf globaler Ebene abspielt. “Eskalierende Konflikte und zunehmendes Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen sind nicht spezifisch für Afrika: Wir sehen sie überall auf der Welt. Aber in Afrika ist dies besonders besorgniserregend, weil es die Fortschritte bedroht, die wir in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt haben.” In Afrika hat Populismus und Autoritarismus zugenommen.
Doch es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. Von den 54 Staaten Afrikas hat sich in 33 Ländern, in denen etwas mehr als die Bevölkerung des Kontinents lebt, die Regierungsführung verbessert. Am meisten haben die Seychellen zugelegt, aber auch vor allem Marokko, Angola oder Somalia. Letzteres liegt gleichwohl weiterhin auf Platz 53 der insgesamt 54 Länder. Das Schlusslicht bildet der Südsudan.
Seit 2007 veröffentlicht die Mo Ibrahim Foundation den IIAG, der die Regierungsführung jedes afrikanischen Landes im letzten verfügbaren Zehnjahreszeitraum bewertet. Regierungsführung ist hier definiert als die Bereitstellung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen öffentlichen Güter, die jeder Bürger von seiner Regierung erwarten darf. Der IIAG 2024 deckt das Jahrzehnt 2014 bis 2023 ab und untersucht insgesamt 96 Indikatoren, organisiert in vier Hauptkategorien:
Die fünf besten Länder in diesem Jahr sind die Seychellen, Mauritius, Kapverden, Südafrika und Botswana. Vor allem Mauritius, die Seychellen und Botswana gelten seit Jahren als Musterkandidaten bei Regierungsführung in Afrika. Die Seychellen machen einen großen Sprung von Platz 7 im Jahr 2014 und setzen sich zum ersten Mal an die Spitze des Indexes. Mauritius muss seinen Spitzenplatz im Vergleich mit 2014 hingegen abgeben und kommt auf den zweiten Rang. Botswana rutscht sogar vom zweiten auf den fünften Rang. Auch in Namibia, das auf Platz 6 liegt, verschlechterte sich laut Bericht die Regierungsführung.
Der Präsident von den Seychellen, Wavel Ramkalawan, hingegen, zeigte sich mit dem Top-Ergebnis für sein Land zufrieden. “Wir haben gute Nachrichten erhalten, dass die Seychellen im Index den ersten Platz in Afrika belegen, was sehr wichtig ist, da wir eine Autorität in Afrika sind”, sagte Ramkalawan.
In 13 Ländern, in denen über ein Fünftel der Bevölkerung des Kontinents lebt, gab es im Laufe des Jahrzehnts Fortschritte. Dabei hat sich das Tempo dieser Fortschritte seit 2019 sogar noch beschleunigt. Bemerkenswert: Die Länder sind über den gesamten Kontinent verstreut. In elf Ländern, in denen fast ein Drittel der Bevölkerung lebt, hat sich die Lage seit 2014 verschlechtert, und das Tempo dieser Entwicklung nimmt in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sogar noch zu. Auch hier gibt es keine geografischen Schwerpunkte. Tunesien erlebte den größten Abstieg. Gegenüber 2014 rutschte das Land von Platz 6 auf 9.
In Unterkategorien, wie Infrastruktur, Gleichberechtigung von Frauen, Umweltschutz, Gesundheitswesen oder Bildung gab es in der vergangenen zehn Jahren auf dem Kontinent teilweise starke Verbesserungen. Vor allem bei der Infrastrukturentwicklung hat Afrika Fortschritte gemacht und Menschen an mobile Kommunikation, das Internet, aber auch Strom und Wasser angeschlossen. Der gleiche erfreuliche Aufwärtstrend gilt für Gleichberechtigung von Frauen. “In diesen beiden Bereichen leben rund 95 Prozent der Bürger Afrikas in einem Land, in dem das im Jahr 2023 erreichte Niveau weit besser ist als 2014”, heißt es in dem IIAG. Interessant: Die größte Volkswirtschaft auf dem Kontinent, Südafrika, hat bei Infrastrukturentwicklung massive Probleme.
Gleichzeitig verschlechtern sich jedoch alle Unterkategorien im Zusammenhang mit Sicherheit und Demokratie im Laufe des Jahrzehnts. Bei Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Partizipation, Transparenz und Inklusion sind Kategorien gibt es massive Defizite, wobei die Rückgänge in den Unterkategorien Sicherheit und Partizipation die stärksten Einbrüche zu verzeichnen haben. “Über 77 Prozent der Bürger Afrikas leben in einem Land, in dem das im Jahr 2023 in diesen beiden Bereichen erreichte Niveau schlechter ist als 2014”, so der Bericht.
“Es ist nicht gut”, sagte Ibrahim vor der Veröffentlichung des IIAG, “wenn sich die Regierungsführung verschlechtert, wenn es Korruption gibt, wenn es Ausgrenzung gibt, werden die Menschen zu den Waffen greifen.” Ibrahim verwies auf den Zusammenhang zwischen schlechter Regierungsführung und zunehmender Gewalt und sprach von “einem riesigen Spektrum an Instabilität und Konflikten“, wie etwa der Krieg im Sudan und die Putsche in West- und Zentralafrika.
Von den drei Brics-Ländern ist Südafrika (Platz 4) das Land mit der besten Regierung, gefolgt von Ägypten (24) und Äthiopien (29), wobei die beiden letzteren Staaten, anders als Südafrika, sich im Aufwärtstrend befinden. Das Gleiche gilt für wichtige Volkswirtschaften des Kontinents wie Marokko (8) und Algerien (18). In Nigeria (33) hingegen lässt die Regierungsführung nach. Kenia (10) hat sich stark verbessert. Doch diese kommen nicht immer bei den Bürgern an. Trotz der Fortschritte “fühlen sich viele Menschen in Afrika abgehängt, da sie in ihrem täglichen Leben keine greifbaren Verbesserungen wahrnehmen oder zumindest ihre Erwartungen nicht erfüllt werden”, so Mo Ibrahim.
Die Marktteilnehmer am kenianischen Anleihemarkt haben am Donnerstag mit Verkäufen auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs reagiert. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist dadurch von 16,82 Prozent auf 17,48 Prozent in die Höhe gegangen.
Ungeachtet dieses scharfen Renditeanstiegs am langen Ende waren zu Wochenbeginn kenianische T-Bills mit maximal zwölfmonatiger Laufzeit mit 357,3 Prozent überzeichnet. Diese beiden Bewegungen zeigen, dass sich Anleiheinvestoren Kenias angesichts der Unsicherheiten um den Staatshaushalt aus risikoreichen Positionen zurückziehen und kurze Laufzeiten bevorzugen. So hat sich die Rendite zweijähriger Schuldtitel am Donnerstag nur leicht von 16,54 Prozent auf 16,68 Prozent erhöht.
Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Entscheidung eines Berufungsgerichts aufgehoben. Dieses hatte das Gesetz zum Staatshaushalt 2023 nachträglich für verfassungswidrig und damit für nichtig erklärt. Diese Aufhebung stützt die Finanzpolitik von Staatspräsident William Ruto, nachdem dieser unter dem Druck von Protesten den Haushaltsentwurf für 2025 zurückziehen musste.
Das Gesetz zum Staatshaushalt 2023 wurde vor Gericht angefochten, nachdem Ruto es unter anderem dazu genutzt hatte, um die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu verdoppeln, eine Wohnungssteuer einzuführen und den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer anzuheben. Diese Steuererhöhungen lösten erheblichen Widerstand in der Bevölkerung aus. In diesem Jahr wollte Ruto weitere Steuererhöhungen durchsetzen, zog aber den Entwurf für den Haushalt 2025 zurück, obwohl das Parlament diesen bereits beschlossen hatte.
Im Juni dieses Jahres lag die Auslandsverschuldung Kenias nach Daten des CEIC bei 39,8 Milliarden US-Dollar, nachdem sie ein Jahr zuvor 38,9 Milliarden Dollar betragen hatte. Die Schuldenquote lag im vergangenen Jahr bei 68,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was für ein Schwellenland im Vergleich zu seiner Schuldentragfähigkeit relativ viel ist.
Die Schwierigkeiten, eine Sanierung der Staatsfinanzen durchzusetzen, verzögerte bereits die Auszahlung einer Kredittranche durch den IWF. Am Mittwoch hat der IWF bekanntgegeben, dass der Exekutivrat die siebte und achte Überprüfung des kenianischen Programms gebilligt hat.
Damit erhält die kenianische Regierung Zugang zu einer Kredittranche von 605,7 Millionen Dollar. 485,5 Millionen Dollar fließen im Rahmen einer Extended Fund Facility (EFF) und einer Extended Credit Facility (ECF), weitere 120,2 Millionen Dollar im Rahmen einer Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Insgesamt soll Kenia durch die EFF und ECF rund 3,61 Milliarden Dollar erhalten, von denen 3,12 Milliarden Dollar zur Auszahlung genehmigt worden sind. Die RSF liegt insgesamt bei 541,3 Millionen Dollar, von denen 180,4 Millionen Dollar genehmigt sind. Damit kann Kenia vom IWF insgesamt mit rund 4,2 Milliarden Dollar rechnen.
Im Juni hatten der IWF und die kenianische Regierung schon eine Einigung über die siebte Überprüfung des Kreditprogramms angekündigt. Doch der Abschluss der Überprüfung auf IWF-Vorstandsebene und die anschließende Auszahlung wurden durch die tödlichen Proteste zunächst gestört. hlr
Am Montag bricht Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu einer mehrtägigen Afrikareise auf. Wie sein Sprecher am Mittwoch mitteilte, wird Özdemir zunächst nach Äthiopien und anschließend nach Sambia reisen. Zentraler Aspekt während des Besuchs des Ministers in Addis Abeba soll neben bilateralen Gesprächen die Einrichtung eines agrarpolitischen Dialogs mit der Afrikanischen Union (AU) sein. In dem Format sollen politische Leitlinien für klimaresistente Produktion für alle AU-Mitgliedsländer erarbeitet werden.
Zudem wird Özdemir an gleich zwei Konferenzen in der äthiopischen Hauptstadt teilnehmen. Das African Youth Agribusiness Forum soll den Austausch zwischen jungen Menschen aus den afrikanischen Ländern und Deutschland im Ernährungssektor fördern. Bei der Konferenz “A world without hunger is possible”, die von der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ausgerichtet wird, steht das Thema Ernährungssicherheit im Mittelpunkt.
In Sambia will sich Özdemir neben seinem sambischen Amtskollegen Reuben Phiri auch mit dem Präsidenten Hakainde Hichilema treffen. Zudem steht ein Besuch des von der Bundesregierung geförderten Deutsch-Sambischen Agrartrainings- und Wissenszentrums sowie der Agrarfakultät der Universität Sambia auf dem Programm. Der Landwirtschaftsminister wird auf seiner Reise von Unternehmen aus der Agrarwirtschaft begleitet. dre
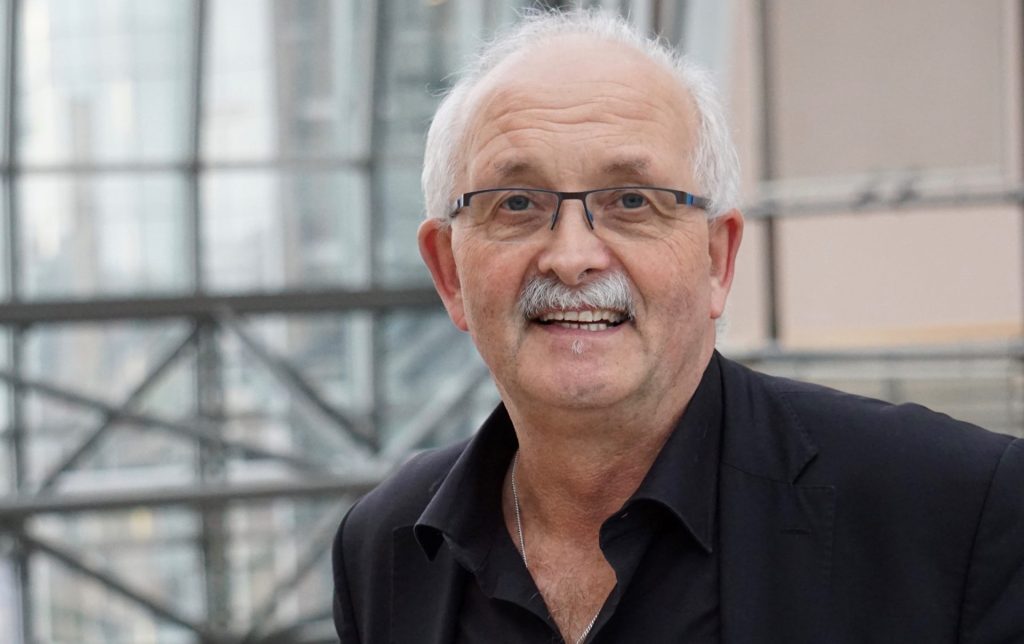
Josef Síkela, ein ehemaliger tschechischer Banker, soll im neuen Mandat Kommissar für Internationale Partnerschaften werden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat für ihn bereits einen Missionsbrief verfasst, in dem sie eine grundlegende Kursänderung für die Entwicklungspolitik der EU beschreibt.
Um die erwünschte “neue ökonomische Außenpolitik” zu fundieren, sollen die Mittel für die Global-Gateway-Initiative aufgestockt werden. Im Fokus dabei: die ökonomischen Eigeninteressen Europas. Ein Konzept, so die Lesart, das ebenfalls dem Wunsch der Entwicklungsländer nach mehr wirtschaftlicher Prosperität entspricht. Jozef Síkela, der bei der österreichischen Erste Group erfolgreich aufgestiegen ist, scheint mit seinem beruflichen Hintergrund wie geschaffen für den Job.
Schon heute ist ein zunehmend wachsender Anteil des 79,5 Milliarden Euro schweren siebenjährigen Topfs für Entwicklungspartnerschaft für Global-Gateway-Projekte vorgesehen. Die bisherigen Erfolge sind allerdings fragwürdig, wirtschaftlich wie entwicklungspolitisch, so das Fazit einer aktuellen Studie von Oxfam, Counterbalance und Eurodad.
Kein Zweifel, Infrastrukturinvestitionen spielen in vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle bei der Förderung integrativen Wachstums, der Verringerung der Armut und der Minderung von Ungleichheiten. Dennoch sind nicht alle Investitionen immer vorteilhaft für alle, wie die eklatante Ungleichverteilung des Reichtums und die fortschreitende Verarmung weiter Teile des Globalen Südens unterstreicht.
Statt alte Fehler zu wiederholen und auf vermeintliche Trickle-down-Erfolge zu setzten, sollte sich eine ehrliche Diskussion deshalb lieber auf die folgenden Fragen konzentrieren:
Führt die proklamierte Investitionsorientierung in der Tat zu einer Vertiefung nachhaltiger Wertschöpfungsketten in den Partnerländern oder kaschiert sie lediglich den Hunger des Nordens nach kritischen Rohstoffen vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund? Eine ernsthaft am gegenseitigen Nutzen orientierte Strategie wird ohne eine Stärkung der Schlüsselfaktoren Bildung und Gesundheit kaum auskommen. Kollektive Güter zugunsten breiter Bevölkerungsschichten, die Bekämpfung von Klimawandel und Ungleichheit sind es, die aus privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Investitionen erst gesellschaftliche Erfolge und soziale Stabilität erwachsen lassen. Beides sind dringend benötigte Voraussetzungen, um eine eigenständige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Bleibt die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 der UN die zentrale Kompassnadel, die mit Global Gateway effektiver wird oder läutet die “neue ökonomische Außenpolitik” eine Abkehr davon ein? Die Antwort auf diese Frage kann nicht durch verbale Bekenntnisse gegeben werden. Sie ist in der Konzeption der Projektlinien und den Modalitäten ihrer Umsetzung angelegt. Sind die Projekte anschlussfähig im Sinne einer selbsttragenden Entwicklung unserer Partnerländer, werden zivilgesellschaftliche Akteure hinreichend einbezogen und gibt es – neben der einflussreichen aus Unternehmensvertretern bestehenden Business Advisory Group – eine Stärkung bislang randständiger parlamentarischer Beteiligung?
Gute Partnerschaftsarbeit muss man an ihren Ergebnissen messen können. Die scheidende EU-Kommission hat deshalb bereits Instrumente etabliert – insbesondere den Inequality Marker – die helfen, sicherzustellen, dass Investitionen den schwächeren Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Diese Mechanismen müssen gestärkt und erweitert werden, auch weil eine Messbarkeit der Resultate den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der EU entspricht.
Will Síkela Erfolg haben, braucht Global Gateway 2.0 eine auf nachhaltige Zukunft gestellte konzeptionelle Ausrichtung, mehr Transparenz und demokratischere Beteiligungsverfahren. Nur dann würde ein solcher Ansatz der EU im geopolitischen Kontext wirklich helfen, sich im Globalen Süden zu profilieren. Anstelle Chinas Einfluss mit einer europäischen Kopie hinterher zu eifern, würde Europa seine komparativen Vorteile dort ausspielen, wo sie liegen: in der Beförderung gesellschaftlichen Fortschritts, der auf Eigenkompetenz, integrativem Wachstum und sozialer Teilhabe beruht – Werte unseres europäischen Sozialmodells, die in weiten Teilen der Welt weiterhin für Hoffnung und Erwartung stehen.
Semafor: Investmentfonds will Start-ups finanzieren. Der senegalesischen Investorin Fatoumata Ba ist es gelungen, einen Investmentfonds mit einem Volumen von 78 Millionen Dollar aufzubauen. Nun sollen afrikanische Start-ups Investitionen in Höhe von bis zu fünf Millionen Dollar erhalten können, um ihr Wachstum zu finanzieren. (“Senegalese investor raises one of Africa’s largest female-led funds for startups “)
Spiegel: TV-Ausfall. China hat die vor zehn Jahren versprochenen 10.000 Fernseher mitsamt Satellitenanlagen in Afrika ausgeliefert. Das Land wollte so seinen Einfluss auf die Bevölkerung ausweiten. Doch viele Geräte sind entweder schon wieder kaputt oder können wegen des Strommangels nur selten in Betrieb genommen werden. (“Warum China 10.000 afrikanischen Dörfern Fernseher spendierte”)
Deutsche Welle: Südafrika streitet über Russlandpolitik. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt in Südafrikas Koalitionsregierung für Unruhe. Präsident Cyril Ramaphosa vom ANC nannte Wladimir Putin beim Brics-Gipfel einen “geschätzten Freund”, was Unmut beim Koalitionspartner DA auslöste. Als Reaktion unterzeichnete DA-Innenminister Leon Schreiber eine Vereinbarung über visafreie Einreise für ukrainische Diplomaten. (“Südafrika: Einheitsregierung streitet über Ukraine-Abkommen”)
Reuters: Zweifel an niedrigerer Inflationsrate. Südafrikas Finanzminister Enoch Godongwana ist nicht von der Zentralbank des Landes vorgeschlagenen Senkung des Inflationsziels überzeugt. Eine niedrigere Inflationsrate könnte schmerzhafte wirtschaftliche Folgen haben. (“Exclusive: South African finance minister not yet convinced on lowering inflation target”)
NZZ: Neue strategische Partnerschaften aus pragmatischen Gründen. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zeigt, dass die Zusammenarbeit der beiden Länder im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in Migrationsfragen, immer enger wird. Doch Macron hofft auch auf eine engere militärische Zusammenarbeit im Rahmen neuer “strategischer Partnerschaften”. (“Macron in Marokko: Der französische Präsident hofiert den König – und verärgert Algerien”)
Financial Times: Eigene Ratingagentur für Afrika. Mehrere afrikanische Staaten fühlen sich bei der Kreditvergabe benachteiligt und fordern die Einrichtung einer afrikanischen Ratingagentur. Diese könnte durch einen besseren Zugriff auf aktuelle Daten Vorteile bieten. Allerdings besteht auch die Gefahr, durch Gefälligkeitsratings Vertrauen zu verspielen. (“Does Africa need its own credit rating agency?”)
Guardian: Genetische Vielfalt nutzen. Der in Südafrika arbeitende Chemiker Professor Kelly Chibale kritisiert, dass die Welt nicht die genetische Vielfalt Afrikas nutzt. So sei die genetische Vielfalt der Afrikaner ein Vorteil bei der Entwicklung von Medikamenten. (“People didn’t believe Africa could be a source of innovation’: how the continent holds the key to future drug research”)
Africa News: Milizionäre legen die Waffen nieder. In der Demokratischen Republik Kongo haben Hunderte ehemalige Milizionäre ihre Waffen niedergelegt und versuchen, sich in das zivile Leben zu integrieren. Sie arbeiten zum Teil an der Entwicklung von Dörfern mit, die sie früher terrorisiert haben. (“Former militia members seek peace and reintegration in DRC”)
KfW-Studie: Nutzen der Entwicklungszusammenarbeit. Laut einer Studie der KfW trägt die EZ zum Wohlstand in Deutschland bei. Demnach steigen pro investiertem Euro in die EZ die Exporte um 0,36 Euro. Zudem würden 139.000 heimische Arbeitsplätze gesichert. (Deutsche EZ – Wie wirkt sie sich auf deutsche Exporte und Beschäftigung aus?)

Kaum eine Nachricht beschäftigte die marokkanische Öffentlichkeit in dieser Woche so sehr, wie der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Rabat – der erste offizielle Staatsbesuch in Marokko in der siebenjährigen Amtszeit des Franzosen. Lange herrschte Eiszeit zwischen Paris und Rabat, doch seit Juli dieses Jahres, als Macron implizit die Unterstützung der marokkanischen Pläne für die Westsahara ankündigte, ist Tauwetter angesagt. Entsprechend “royal” wurde der französische Präsident vor Ort empfangen, hieß es in den marokkanischen Medien. Deren eigentlicher Star während dieser Tage war indes ihr eigener König: Mohammed VI.
Denn für einheimische Zeitungen, wie etwa “Aujourdhui Le Maroc” haben vor allem “die vielen Impulse, die Seine Exzellenz für die nationale Sache lieferte” zur “neuen Dynamik” in der Westsahara-Frage und den marokkanisch-französischen Beziehungen geführt. Dass Macron für die Annäherung an Rabat noch ganz andere, pragmatische, Gründe hat und Entgegenkommen bei der Migrationsfrage erwartet, davon war in den nationalen Medien weniger die Rede.
“Was man von der Rede Macrons vor dem marokkanischen Parlament in Erinnerung behalten muss”, wie “Le Matin” titelte, sei vielmehr “die Hommage an seine Majestät König Mohammed VI. und die Moderne Marokkos“. So habe Macron den König als “die Kontinuität einer der ältesten Dynastien der Welt und eines der Gesichter der industriellen und technologischen Moderne” beschrieben. Seit seiner Thronbesteigung vor mehr als 25 Jahren sei es dem marokkanischen Souverän gelungen, sein Land auf den Weg der Modernisierung zu führen und dabei seine Traditionen und Stabilität zu bewahren.
Modernisierung und Tradition, Sanftmut und Willensstärke, Weltoffenheit und autoritäre Führung – seit der Übernahme des Throns von seinem Vater Hassan II im Jahr 1999 bewegt sich Mohammed VI tatsächlich zwischen den Polen. Auf Fotos zeigte sich der junge König Jetski fahrend, sportlich aktiv und volksnah. Doch bis heute gibt er keine Radio-Interviews, wie etwa Younes Bahmedi, Chef des Senders “Hit Radio” bezeugt: “Und wir haben es bisher auch nicht gewagt, eine solche Anfrage an das Königshaus zu stellen.” Dass seine Exzellenz “sehr pädagogisch gehaltene Ansprachen” der Interaktion mit der Öffentlichkeit vorzieht, weiß auch der Chefredakteur von Jeune Afrique, Francois Soudan. Vor der Kamera lese er lieber vom Blatt ab, anstatt einen Teleprompter zu benutzen. Soudan: “Der König ist nicht der Präsident, und er versteht sich weder als Politiker noch als Diplomat. Er hat Medienwirksamkeit nicht nötig.”
Das wurde auch 2009 deutlich, als die Zeitschrift “Tel Quel” eine Umfrage zur Beliebtheit des Königs gestartet hatte. 91 Prozent der Bevölkerung sprachen ihm ihre ungeteilte Zustimmung aus. Die Folge: Der Druck der Ausgabe mit den Ergebnissen wurde verboten. Positiv oder nicht, ein König muss sich keiner öffentlichen Bewertung stellen!
Stärke und Stolz – das sind wiederkehrende Motive bei Mohammed VI, wie nach dem Erdbeben am 8. September vergangenen Jahres. So lehnte der König Hilfsangebote von Frankreich und Deutschland vor dem Hintergrund diverser diplomatischer Verstimmungen zunächst ab. Gleichzeitig setzte er durch, dass schon einen Monat nach der Katastrophe die Vollversammlung der Weltbank im vom Beben ebenfalls betroffenen Marrakesch wie geplant stattfand: eine Demonstration marokkanischer Stärke vor den Augen der Weltöffentlichkeit.
Modernisierung der Wirtschaft, Investitionen in Infrastruktur, Industrie, Tourismus und den Sport, all das wird mit der Amtszeit Mohammed VI verbunden. Hinzu kommt, im Vergleich zur Regierungszeit seines Vaters, eine, relative Verbesserung der Menschenrechtssituation und erhöhte politische Partizipation. Wenn es um zentrale Fragen geht, stößt letztere aber auch schnell wieder an ihre Grenzen. Außenpolitik, Verteidigung und religiöse Angelegenheiten, all das bleibt unter direkter Kontrolle des Königs. Auch von wirklicher Pressefreiheit kann nicht die Rede sein. Zudem bestimmen soziale Spannungen, die Armut der Landbevölkerung und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit das Bild.
Als “komplexe Figur” schildert denn auch der gerade erst veröffentlichte Dokumentarfilm “Le parcours d’un roi” des französischen Fernsehsenders Public Sénat die Person Mohammed VI. Deren Vielschichtigkeit, so die Autoren, sei am besten mit diesen beiden Worten zu erfassen: Soft Power. Monika Hoegen

Jetzt ist er auch endlich in Kinos auf dem Kontinent zu sehen: Abderrahmane Sissakos Film “Black Tea”, der Anfang des Jahres im Rennen um einen Goldenen Bären in Berlin angetreten war. Erzählt wird ein Ausschnitt aus dem Leben von Aya (Nina Mélo) und ihrem Chef, dem Teeladenbesitzer Cai (Hang Chang). Sie ist aus der Elfenbeinküste nach China gekommen, genauer gesagt in die Hafen- und Handelsstadt Guangzhou – nachdem ihr Traum von einer Hochzeit geplatzt ist, beziehungsweise sich der Heiratskandidat als keine gute Wahl entpuppt hat.
“Black Tea” kreist um die gemeinsame Leidenschaft der Protagonisten für die Teekultur in China. Sie sei in ihrem Auftreten so vielfältig, eindringlich und bleibend wie das Aroma des schwarzen Tees, sagt Cai einmal zu seiner Angestellten und Angebeteten Aya, da pflücken sie Teeblätter im Feld. Der charmante Cai ist verheiratet, hat in der Vergangenheit in seiner Zeit auf den Kapverden ein uneheliches Kind gezeugt.
“Black Tea” ist filmisch bezaubernd, mit einer behutsamen Kameraführung, immer sehr nah an den Menschen und der langsamen Entwicklung des Plots folgend – der keine hohen moralischen Botschaften bereithält und auch kein eindeutiges Ende. Um Politik geht es kaum, nur am Rande wird auf die Diskriminierung von afrikanischen Menschen in Guangzhou verwiesen.
Meistens wird Mandarin im Film gesprochen, Untertitel auf Französisch laufen mit. Die sorgt zusätzlich dafür, dass Zuschauende ganz eintauchen und keine künstliche Distanz zum Gezeigten entsteht. Es ist gut, dass Sissokos Film nun auch in Afrika gezeigt wird – außer im Senegal, in der Elfenbeinküste, Kamerun, Algerien und Marokko – und damit dort, wo die Lebenserfahrung der Menschen Berührungspunkte mit den Protagonisten hat. “Black Tea” bietet ein Bild der Afrika-China-Beziehungen auf zwischenmenschlicher, nahbarer Ebene, jenseits der sonst vorherrschenden politischen Diskurse darüber. lcw
wenige Tage vor den Wahlen in den USA hat Kamala Harris das Team vorgestellt, das im Falle ihres Wahlsieges die künftige US-Afrika-Politik erarbeiten soll. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Köpfe vor und schauen darauf, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Afrika unter einer Präsidentin Kamala Harris entwickeln könnten.
In Botswana wurde bereits gewählt. Am vergangenen Mittwoch haben gut eine Million Wähler ihre Stimme abgegeben. Warum die Stimmung in dem afrikanischen Vorzeigeland aktuell gedrückt ist, erklärt unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren.
Zudem blicken wir in dieser auf die Ergebnisse des aktuellen Ibrahim Index of African Governance – dieser stellt den afrikanischen Ländern ein eher durchwachsenes Zeugnis aus.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Vizepräsidentin Kamala Harris, Kandidatin der Demokraten, ein 25-köpfiges Afrika-Beraterteam vorgestellt. Dieses soll nach Informationen des US-Mediums Semafor im Falle eines Wahlsiegs der Vizepräsidentin eine umfassende neue Afrika-Politik erarbeiten. Leiter des Teams soll demnach der ehemalige US-Justizminister Eric Holder werden. Die Afrikaexperten Witney Schneidman und Gabrielle Posner sollen das Team als Koordinatoren unterstützen. Ergänzt wird das Team durch Diplomaten, ehemalige Regierungsbeamte, Experten für Entwicklungsfinanzierung sowie Vorsitzende diasporischer Organisationen. Der Schritt des Harris-Teams kann als Signal gewertet werden, dass Afrika in einer möglichen Harris-Regierung einen größeren Stellenwert einnehmen soll.
Unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama wurde Holder als erster Afroamerikaner Justizminister. Das Ministerium führte Holder von 2009 bis 2015 und galt damals als unerbittlicher Verfolger von Whistleblowern. Nach seiner Zeit als Justizminister kehrte Holder als Rechtsberater in die Wirtschaftskanzlei Covington & Burling zurück. Zudem ist Holder in die Wahlkampagne von Harris involviert. Nach Reuters-Informationen war Holder für den Auswahlprozess möglicher Kandidaten für den “Running Mate” zuständig.
Schneidman war Stellvertreter des Vize-Unterstaatssekretärs für afrikanische Angelegenheiten (Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs) in der Regierung von Bill Clinton. In den 1990er-Jahren war Schneidman zudem Südafrika-Analyst im Bureau of Intelligence and Research, dem Nachrichtendiensts des US-Außenministeriums. Damals beobachtete Schneidman den politischen Übergang nach dem Ende der Apartheid. 2022 heuerte ihn die US-Entwicklungsorganisation USAID als Koordinator für Prosper Africa an. Die Initiative soll den Handel zwischen den USA und den afrikanischen Ländern ankurbeln und US-Investitionen in Afrika fördern. Prosper Africa rief der ehemalige Präsident Donald Trump ins Leben.
Posner ist Senior Associate bei der Strategieberatung Albright Stonebridge Group, die die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright gegründet hatte. Zuvor hat Posner in Kenia als Beraterin unter anderem für afrikanische NGOs und Parlamente gearbeitet.
Bislang war die US-Afrikapolitik in erster Linie auf Sicherheitsaspekte beschränkt. Zwar hatte Obama 2013 unter dem Namen Power Africa ein großes Elektrifizierungsprogramm zugunsten Afrikas angekündigt. Doch die Realisierung blieb weit hinter dem Versprechen zurück. Beide Nachfolger Obamas, weder Trump noch Biden, haben Afrika in ihren Amtszeiten besucht. Im Falle Bidens soll sich dies allerdings noch ändern. In der ersten Dezemberwoche will der 81-Jährige nach Angaben des Weißen Hauses Angola besuchen. Die Reise wurde – ebenso wie sein Deutschland-Besuch – Anfang des Monats verschoben. Grund war Hurrikan Milton, der über Florida hinweg zog.
Bei den Gesprächen in Angola soll neben der vertieften Zusammenarbeit bei den Themen Sicherheit, Gesundheit und wirtschaftlichen Partnerschaften auch der Lobito-Korridor im Mittelpunkt stehen. Dieser ist eines der zentralen Infrastrukturprojekte, die die Biden-Regierung in Afrika vorantreibt. Bislang ist Harris also noch die ranghöchste Vertreterin der US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die den Kontinent besucht hat. Im vergangenen Jahr besuchte Harris Ghana, Tansania und Sambia.
Trotz der mangelnden Präsidentenbesuche in Afrika in den vergangenen Jahren ist das Thema insbesondere während der Biden-Administration stärker in den Fokus gerückt. So hat die Biden-Regierung 2022 nach acht Jahren erneut einen USA-Afrika-Gipfel ausgerichtet. Zuvor hatte Biden eine eigene US-Strategie für Subsahara-Afrika vorgestellt. Zudem haben die USA die afrikanischen Länder dabei unterstützt, mehr Mitsprache in internationalen Organisationen zu bekommen. Anders als Trump war Biden in seiner Afrika-Politik weniger auf Konfrontationskurs mit China gegangen. Experten erwarten, dass Harris diesen Schwerpunkt auf Multilateralismus fortführen wird.
Ob das neue Afrika-Team der Vizepräsidentin aber überhaupt in Aktion treten wird, ist bislang offen. Die Abstimmung über die US-Präsidentschaft dürfte die knappste seit Jahren werden. Laut den Umfrageexperten von FiveThirtyEight liegt Harris landesweit hauchdünn vor Donald Trump. In den entscheidenden Swing States liegen die Kandidaten allerdings gleichauf. Zuletzt hatte die Vizepräsidentin in den Umfragen leicht verloren.
Am Mittwoch haben etwas mehr als eine Million Wähler in Botswana gewählt. Präsident Mokgweetsi Masisi, seit mehr als sechs Jahren in Amt, strebt eine zweite Amtszeit an. Ob er im Amt bleiben kann, entscheidet, ob seine Partei, die Botswana Democratic Party (BDP), die Mehrheit der Stimmen behält. Medienberichten zufolge dürfte die Wahl enger als gedacht ausgehen. Demnach hat die bisherige Oppositionspartei Umbrella for Democratic Change (UDC) 27 der insgesamt 61 zur Wahl stehenden Parlamentssitzen gewonnen. Bei insgesamt 31 gewonnenen Sitzen, könnte die UDC den Präsidenten stellen. Es wäre das erste Mal seit der Unabhängigkeit, dass nicht die BDP den Präsidenten stellen würde. Erste vorläufige Ergebnisse werden an diesem Freitag im Laufe des Tages erwartet. Ganz überraschend sind die Entwicklungen allerdings nicht.
Botswana ist eine der ältesten und stabilsten Demokratien in der Region. Seit Jahren kann sich das Land im Ibrahim Index of African Governance (IIAG), der die Regierungsführung in Afrika bewertet, unter den Top Fünf platzieren. Es gibt jedoch einen “alarmierenden Trend”: Botswana ist im Index drei Plätze nach hinten gerutscht. Schon deswegen wird die Wahl mit Interesse im Ausland verfolgt.
Vor allem die schnell steigende Arbeitslosenrate von 27,6 Prozent, die unter jungen Menschen noch viel höher ist, macht dem Land zu schaffen. Sie ist eine der höchsten in der Welt. Fast 40 Prozent der Bevölkerung sehen keine Perspektive bei der Jobsuche. Botswanas wirtschaftlichen Erfolge, die sich vor allem aus der Diamantenproduktion speisen, haben sich nicht gleichmäßig unter der Bevölkerung verteilt. Mit einem Gini-Index, der wirtschaftliche Ungleichheit misst, von 53,2 Prozent ist Botswana eines der Länder mit der höchsten Einkommensungleichheit in der Welt, fast ein Fünftel der Bevölkerung lebt in Armut. Die Wähler werfen der Regierung Korruption vor und fordern mehr Transparenz. Es sei nicht immer klar, wo die Staatseinnahmen hingeflossen sind.
Im Vorfeld der Wahlen waren denn auch Diamanten wieder ein zentrales Thema. Seit die Diamantenindustrie schwächelt, stottert auch die Wirtschaft des Landes und die Menschen werden unzufrieden. Noch heute machen Diamanten rund die Hälfte der Staatseinnahmen und 80 Prozent aller Exporte aus. Doch seit dem Einbruch des Diamantenpreises von mehr als 30 Prozent im vergangenen Jahr und der Konkurrenz durch synthetische Diamanten steht die Regierung in Gaborone unter Druck.
Trotz der aktuellen Krise war die Diamantenindustrie entscheidend für die Entwicklung des Landes. Zwischen 1965 und 1995 wuchs die Wirtschaft jedes Jahr im Schnitt über neun Prozent: die höchste Wachstumsrate in der Welt. Das Land gilt als Entwicklungsmodell mit moderner Infrastruktur, das in gute Bildung und flächendeckende Gesundheitsversorgung erfolgreich investiert hat. Die Regierung verfolgt eine umsichtige makroökonomische Politik, abgefedert von soliden Wirtschaftsinstitutionen. Industrielle Entwicklung hat bislang kaum funktioniert, nach wie vor ist die Service-Industrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Aber auch Präsident Masisi ist sich bewusst, dass eine Diversifizierung der Wirtschaft dringend notwendig ist “Botswanas Abhängigkeit von Diamanten und ein vom öffentlichen Sektor getragenes Modell haben die Wirtschaft mit der Zeit anfällig für externe Schocks gemacht“, urteilt die Weltbank. Seit 2022 ist das Wirtschaftswachstum des Landes von 5,5 Prozent auf ein Prozent in diesem Jahr gefallen, soll sich aber 2025 wieder erholen, so der Internationale Währungsfonds (IWF).
Doch so leicht gestaltet sich die Diversifizierung nicht. Versuche, die Landwirtschaft in Gang zu bringen, kommen nur langsam voran. Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigte sich im August, als Masisi das Importverbot von Frischprodukten wie Früchte aus dem benachbarten Südafrika verlängern ließ, um lokalen Produzenten unter die Arme zu greifen. Botswana leidet zudem derzeit unter einer extremen Trockenheit – keine idealen Bedingungen für eine Landwirtschaft. Wie die Wahlen auch ausgehen, es gibt viel politische Arbeit, um Botswana weiterhin auf einem stabilen und demokratischen Kurs zu halten und seinen Bewohner Jobs in Zukunft zu bieten.
Das Ergebnis des in der vergangenen Woche vorgestellten Ibrahim Index of African Governance (IIAG) über die Regierungsführung in Afrika ist durchwachsen. Nach Fortschritten ist seit 2022 der Trend zu mehr politischer Mitbestimmung in Afrika ins Stocken geraten. Der IIAG gilt als Gradmesser von Regierungsführung, die sich in Afrika eigentlich stetig verbessert hat. Für fast die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents hat sich Partizipationsmöglichkeiten in den vergangenen zehn Jahren jedoch verschlechtert. “Die Hauptursache dafür ist eine sich verschärfende Sicherheitskrise und ein schrumpfendes partizipatives Umfeld fast auf dem gesamten Kontinent”, schreibt der britisch-sudanesische Unternehmer und Philanthrop Mo Ibrahim im Vorwort des IIAG, dessen Stiftung den Bericht alle zwei Jahre herausgibt.
Für Ibrahim sind die Ergebnisse auch ein Spiegel dessen, was sich auf globaler Ebene abspielt. “Eskalierende Konflikte und zunehmendes Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen sind nicht spezifisch für Afrika: Wir sehen sie überall auf der Welt. Aber in Afrika ist dies besonders besorgniserregend, weil es die Fortschritte bedroht, die wir in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt haben.” In Afrika hat Populismus und Autoritarismus zugenommen.
Doch es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. Von den 54 Staaten Afrikas hat sich in 33 Ländern, in denen etwas mehr als die Bevölkerung des Kontinents lebt, die Regierungsführung verbessert. Am meisten haben die Seychellen zugelegt, aber auch vor allem Marokko, Angola oder Somalia. Letzteres liegt gleichwohl weiterhin auf Platz 53 der insgesamt 54 Länder. Das Schlusslicht bildet der Südsudan.
Seit 2007 veröffentlicht die Mo Ibrahim Foundation den IIAG, der die Regierungsführung jedes afrikanischen Landes im letzten verfügbaren Zehnjahreszeitraum bewertet. Regierungsführung ist hier definiert als die Bereitstellung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen öffentlichen Güter, die jeder Bürger von seiner Regierung erwarten darf. Der IIAG 2024 deckt das Jahrzehnt 2014 bis 2023 ab und untersucht insgesamt 96 Indikatoren, organisiert in vier Hauptkategorien:
Die fünf besten Länder in diesem Jahr sind die Seychellen, Mauritius, Kapverden, Südafrika und Botswana. Vor allem Mauritius, die Seychellen und Botswana gelten seit Jahren als Musterkandidaten bei Regierungsführung in Afrika. Die Seychellen machen einen großen Sprung von Platz 7 im Jahr 2014 und setzen sich zum ersten Mal an die Spitze des Indexes. Mauritius muss seinen Spitzenplatz im Vergleich mit 2014 hingegen abgeben und kommt auf den zweiten Rang. Botswana rutscht sogar vom zweiten auf den fünften Rang. Auch in Namibia, das auf Platz 6 liegt, verschlechterte sich laut Bericht die Regierungsführung.
Der Präsident von den Seychellen, Wavel Ramkalawan, hingegen, zeigte sich mit dem Top-Ergebnis für sein Land zufrieden. “Wir haben gute Nachrichten erhalten, dass die Seychellen im Index den ersten Platz in Afrika belegen, was sehr wichtig ist, da wir eine Autorität in Afrika sind”, sagte Ramkalawan.
In 13 Ländern, in denen über ein Fünftel der Bevölkerung des Kontinents lebt, gab es im Laufe des Jahrzehnts Fortschritte. Dabei hat sich das Tempo dieser Fortschritte seit 2019 sogar noch beschleunigt. Bemerkenswert: Die Länder sind über den gesamten Kontinent verstreut. In elf Ländern, in denen fast ein Drittel der Bevölkerung lebt, hat sich die Lage seit 2014 verschlechtert, und das Tempo dieser Entwicklung nimmt in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sogar noch zu. Auch hier gibt es keine geografischen Schwerpunkte. Tunesien erlebte den größten Abstieg. Gegenüber 2014 rutschte das Land von Platz 6 auf 9.
In Unterkategorien, wie Infrastruktur, Gleichberechtigung von Frauen, Umweltschutz, Gesundheitswesen oder Bildung gab es in der vergangenen zehn Jahren auf dem Kontinent teilweise starke Verbesserungen. Vor allem bei der Infrastrukturentwicklung hat Afrika Fortschritte gemacht und Menschen an mobile Kommunikation, das Internet, aber auch Strom und Wasser angeschlossen. Der gleiche erfreuliche Aufwärtstrend gilt für Gleichberechtigung von Frauen. “In diesen beiden Bereichen leben rund 95 Prozent der Bürger Afrikas in einem Land, in dem das im Jahr 2023 erreichte Niveau weit besser ist als 2014”, heißt es in dem IIAG. Interessant: Die größte Volkswirtschaft auf dem Kontinent, Südafrika, hat bei Infrastrukturentwicklung massive Probleme.
Gleichzeitig verschlechtern sich jedoch alle Unterkategorien im Zusammenhang mit Sicherheit und Demokratie im Laufe des Jahrzehnts. Bei Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Partizipation, Transparenz und Inklusion sind Kategorien gibt es massive Defizite, wobei die Rückgänge in den Unterkategorien Sicherheit und Partizipation die stärksten Einbrüche zu verzeichnen haben. “Über 77 Prozent der Bürger Afrikas leben in einem Land, in dem das im Jahr 2023 in diesen beiden Bereichen erreichte Niveau schlechter ist als 2014”, so der Bericht.
“Es ist nicht gut”, sagte Ibrahim vor der Veröffentlichung des IIAG, “wenn sich die Regierungsführung verschlechtert, wenn es Korruption gibt, wenn es Ausgrenzung gibt, werden die Menschen zu den Waffen greifen.” Ibrahim verwies auf den Zusammenhang zwischen schlechter Regierungsführung und zunehmender Gewalt und sprach von “einem riesigen Spektrum an Instabilität und Konflikten“, wie etwa der Krieg im Sudan und die Putsche in West- und Zentralafrika.
Von den drei Brics-Ländern ist Südafrika (Platz 4) das Land mit der besten Regierung, gefolgt von Ägypten (24) und Äthiopien (29), wobei die beiden letzteren Staaten, anders als Südafrika, sich im Aufwärtstrend befinden. Das Gleiche gilt für wichtige Volkswirtschaften des Kontinents wie Marokko (8) und Algerien (18). In Nigeria (33) hingegen lässt die Regierungsführung nach. Kenia (10) hat sich stark verbessert. Doch diese kommen nicht immer bei den Bürgern an. Trotz der Fortschritte “fühlen sich viele Menschen in Afrika abgehängt, da sie in ihrem täglichen Leben keine greifbaren Verbesserungen wahrnehmen oder zumindest ihre Erwartungen nicht erfüllt werden”, so Mo Ibrahim.
Die Marktteilnehmer am kenianischen Anleihemarkt haben am Donnerstag mit Verkäufen auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs reagiert. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist dadurch von 16,82 Prozent auf 17,48 Prozent in die Höhe gegangen.
Ungeachtet dieses scharfen Renditeanstiegs am langen Ende waren zu Wochenbeginn kenianische T-Bills mit maximal zwölfmonatiger Laufzeit mit 357,3 Prozent überzeichnet. Diese beiden Bewegungen zeigen, dass sich Anleiheinvestoren Kenias angesichts der Unsicherheiten um den Staatshaushalt aus risikoreichen Positionen zurückziehen und kurze Laufzeiten bevorzugen. So hat sich die Rendite zweijähriger Schuldtitel am Donnerstag nur leicht von 16,54 Prozent auf 16,68 Prozent erhöht.
Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Entscheidung eines Berufungsgerichts aufgehoben. Dieses hatte das Gesetz zum Staatshaushalt 2023 nachträglich für verfassungswidrig und damit für nichtig erklärt. Diese Aufhebung stützt die Finanzpolitik von Staatspräsident William Ruto, nachdem dieser unter dem Druck von Protesten den Haushaltsentwurf für 2025 zurückziehen musste.
Das Gesetz zum Staatshaushalt 2023 wurde vor Gericht angefochten, nachdem Ruto es unter anderem dazu genutzt hatte, um die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu verdoppeln, eine Wohnungssteuer einzuführen und den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer anzuheben. Diese Steuererhöhungen lösten erheblichen Widerstand in der Bevölkerung aus. In diesem Jahr wollte Ruto weitere Steuererhöhungen durchsetzen, zog aber den Entwurf für den Haushalt 2025 zurück, obwohl das Parlament diesen bereits beschlossen hatte.
Im Juni dieses Jahres lag die Auslandsverschuldung Kenias nach Daten des CEIC bei 39,8 Milliarden US-Dollar, nachdem sie ein Jahr zuvor 38,9 Milliarden Dollar betragen hatte. Die Schuldenquote lag im vergangenen Jahr bei 68,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was für ein Schwellenland im Vergleich zu seiner Schuldentragfähigkeit relativ viel ist.
Die Schwierigkeiten, eine Sanierung der Staatsfinanzen durchzusetzen, verzögerte bereits die Auszahlung einer Kredittranche durch den IWF. Am Mittwoch hat der IWF bekanntgegeben, dass der Exekutivrat die siebte und achte Überprüfung des kenianischen Programms gebilligt hat.
Damit erhält die kenianische Regierung Zugang zu einer Kredittranche von 605,7 Millionen Dollar. 485,5 Millionen Dollar fließen im Rahmen einer Extended Fund Facility (EFF) und einer Extended Credit Facility (ECF), weitere 120,2 Millionen Dollar im Rahmen einer Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Insgesamt soll Kenia durch die EFF und ECF rund 3,61 Milliarden Dollar erhalten, von denen 3,12 Milliarden Dollar zur Auszahlung genehmigt worden sind. Die RSF liegt insgesamt bei 541,3 Millionen Dollar, von denen 180,4 Millionen Dollar genehmigt sind. Damit kann Kenia vom IWF insgesamt mit rund 4,2 Milliarden Dollar rechnen.
Im Juni hatten der IWF und die kenianische Regierung schon eine Einigung über die siebte Überprüfung des Kreditprogramms angekündigt. Doch der Abschluss der Überprüfung auf IWF-Vorstandsebene und die anschließende Auszahlung wurden durch die tödlichen Proteste zunächst gestört. hlr
Am Montag bricht Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu einer mehrtägigen Afrikareise auf. Wie sein Sprecher am Mittwoch mitteilte, wird Özdemir zunächst nach Äthiopien und anschließend nach Sambia reisen. Zentraler Aspekt während des Besuchs des Ministers in Addis Abeba soll neben bilateralen Gesprächen die Einrichtung eines agrarpolitischen Dialogs mit der Afrikanischen Union (AU) sein. In dem Format sollen politische Leitlinien für klimaresistente Produktion für alle AU-Mitgliedsländer erarbeitet werden.
Zudem wird Özdemir an gleich zwei Konferenzen in der äthiopischen Hauptstadt teilnehmen. Das African Youth Agribusiness Forum soll den Austausch zwischen jungen Menschen aus den afrikanischen Ländern und Deutschland im Ernährungssektor fördern. Bei der Konferenz “A world without hunger is possible”, die von der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ausgerichtet wird, steht das Thema Ernährungssicherheit im Mittelpunkt.
In Sambia will sich Özdemir neben seinem sambischen Amtskollegen Reuben Phiri auch mit dem Präsidenten Hakainde Hichilema treffen. Zudem steht ein Besuch des von der Bundesregierung geförderten Deutsch-Sambischen Agrartrainings- und Wissenszentrums sowie der Agrarfakultät der Universität Sambia auf dem Programm. Der Landwirtschaftsminister wird auf seiner Reise von Unternehmen aus der Agrarwirtschaft begleitet. dre
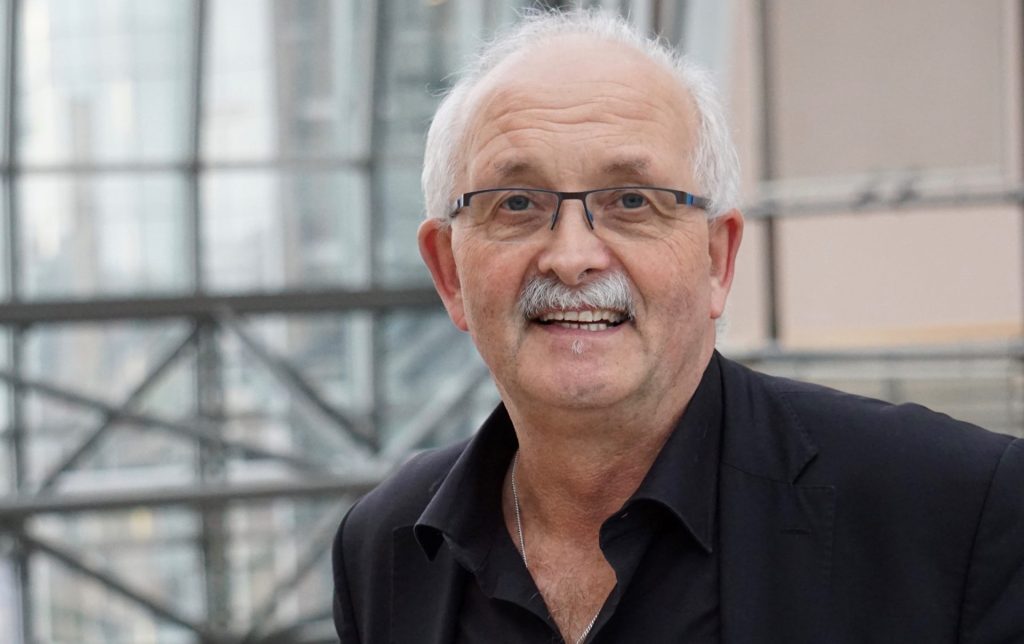
Josef Síkela, ein ehemaliger tschechischer Banker, soll im neuen Mandat Kommissar für Internationale Partnerschaften werden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat für ihn bereits einen Missionsbrief verfasst, in dem sie eine grundlegende Kursänderung für die Entwicklungspolitik der EU beschreibt.
Um die erwünschte “neue ökonomische Außenpolitik” zu fundieren, sollen die Mittel für die Global-Gateway-Initiative aufgestockt werden. Im Fokus dabei: die ökonomischen Eigeninteressen Europas. Ein Konzept, so die Lesart, das ebenfalls dem Wunsch der Entwicklungsländer nach mehr wirtschaftlicher Prosperität entspricht. Jozef Síkela, der bei der österreichischen Erste Group erfolgreich aufgestiegen ist, scheint mit seinem beruflichen Hintergrund wie geschaffen für den Job.
Schon heute ist ein zunehmend wachsender Anteil des 79,5 Milliarden Euro schweren siebenjährigen Topfs für Entwicklungspartnerschaft für Global-Gateway-Projekte vorgesehen. Die bisherigen Erfolge sind allerdings fragwürdig, wirtschaftlich wie entwicklungspolitisch, so das Fazit einer aktuellen Studie von Oxfam, Counterbalance und Eurodad.
Kein Zweifel, Infrastrukturinvestitionen spielen in vielen Entwicklungsländern eine entscheidende Rolle bei der Förderung integrativen Wachstums, der Verringerung der Armut und der Minderung von Ungleichheiten. Dennoch sind nicht alle Investitionen immer vorteilhaft für alle, wie die eklatante Ungleichverteilung des Reichtums und die fortschreitende Verarmung weiter Teile des Globalen Südens unterstreicht.
Statt alte Fehler zu wiederholen und auf vermeintliche Trickle-down-Erfolge zu setzten, sollte sich eine ehrliche Diskussion deshalb lieber auf die folgenden Fragen konzentrieren:
Führt die proklamierte Investitionsorientierung in der Tat zu einer Vertiefung nachhaltiger Wertschöpfungsketten in den Partnerländern oder kaschiert sie lediglich den Hunger des Nordens nach kritischen Rohstoffen vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund? Eine ernsthaft am gegenseitigen Nutzen orientierte Strategie wird ohne eine Stärkung der Schlüsselfaktoren Bildung und Gesundheit kaum auskommen. Kollektive Güter zugunsten breiter Bevölkerungsschichten, die Bekämpfung von Klimawandel und Ungleichheit sind es, die aus privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Investitionen erst gesellschaftliche Erfolge und soziale Stabilität erwachsen lassen. Beides sind dringend benötigte Voraussetzungen, um eine eigenständige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Bleibt die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 der UN die zentrale Kompassnadel, die mit Global Gateway effektiver wird oder läutet die “neue ökonomische Außenpolitik” eine Abkehr davon ein? Die Antwort auf diese Frage kann nicht durch verbale Bekenntnisse gegeben werden. Sie ist in der Konzeption der Projektlinien und den Modalitäten ihrer Umsetzung angelegt. Sind die Projekte anschlussfähig im Sinne einer selbsttragenden Entwicklung unserer Partnerländer, werden zivilgesellschaftliche Akteure hinreichend einbezogen und gibt es – neben der einflussreichen aus Unternehmensvertretern bestehenden Business Advisory Group – eine Stärkung bislang randständiger parlamentarischer Beteiligung?
Gute Partnerschaftsarbeit muss man an ihren Ergebnissen messen können. Die scheidende EU-Kommission hat deshalb bereits Instrumente etabliert – insbesondere den Inequality Marker – die helfen, sicherzustellen, dass Investitionen den schwächeren Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Diese Mechanismen müssen gestärkt und erweitert werden, auch weil eine Messbarkeit der Resultate den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der EU entspricht.
Will Síkela Erfolg haben, braucht Global Gateway 2.0 eine auf nachhaltige Zukunft gestellte konzeptionelle Ausrichtung, mehr Transparenz und demokratischere Beteiligungsverfahren. Nur dann würde ein solcher Ansatz der EU im geopolitischen Kontext wirklich helfen, sich im Globalen Süden zu profilieren. Anstelle Chinas Einfluss mit einer europäischen Kopie hinterher zu eifern, würde Europa seine komparativen Vorteile dort ausspielen, wo sie liegen: in der Beförderung gesellschaftlichen Fortschritts, der auf Eigenkompetenz, integrativem Wachstum und sozialer Teilhabe beruht – Werte unseres europäischen Sozialmodells, die in weiten Teilen der Welt weiterhin für Hoffnung und Erwartung stehen.
Semafor: Investmentfonds will Start-ups finanzieren. Der senegalesischen Investorin Fatoumata Ba ist es gelungen, einen Investmentfonds mit einem Volumen von 78 Millionen Dollar aufzubauen. Nun sollen afrikanische Start-ups Investitionen in Höhe von bis zu fünf Millionen Dollar erhalten können, um ihr Wachstum zu finanzieren. (“Senegalese investor raises one of Africa’s largest female-led funds for startups “)
Spiegel: TV-Ausfall. China hat die vor zehn Jahren versprochenen 10.000 Fernseher mitsamt Satellitenanlagen in Afrika ausgeliefert. Das Land wollte so seinen Einfluss auf die Bevölkerung ausweiten. Doch viele Geräte sind entweder schon wieder kaputt oder können wegen des Strommangels nur selten in Betrieb genommen werden. (“Warum China 10.000 afrikanischen Dörfern Fernseher spendierte”)
Deutsche Welle: Südafrika streitet über Russlandpolitik. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt in Südafrikas Koalitionsregierung für Unruhe. Präsident Cyril Ramaphosa vom ANC nannte Wladimir Putin beim Brics-Gipfel einen “geschätzten Freund”, was Unmut beim Koalitionspartner DA auslöste. Als Reaktion unterzeichnete DA-Innenminister Leon Schreiber eine Vereinbarung über visafreie Einreise für ukrainische Diplomaten. (“Südafrika: Einheitsregierung streitet über Ukraine-Abkommen”)
Reuters: Zweifel an niedrigerer Inflationsrate. Südafrikas Finanzminister Enoch Godongwana ist nicht von der Zentralbank des Landes vorgeschlagenen Senkung des Inflationsziels überzeugt. Eine niedrigere Inflationsrate könnte schmerzhafte wirtschaftliche Folgen haben. (“Exclusive: South African finance minister not yet convinced on lowering inflation target”)
NZZ: Neue strategische Partnerschaften aus pragmatischen Gründen. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zeigt, dass die Zusammenarbeit der beiden Länder im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in Migrationsfragen, immer enger wird. Doch Macron hofft auch auf eine engere militärische Zusammenarbeit im Rahmen neuer “strategischer Partnerschaften”. (“Macron in Marokko: Der französische Präsident hofiert den König – und verärgert Algerien”)
Financial Times: Eigene Ratingagentur für Afrika. Mehrere afrikanische Staaten fühlen sich bei der Kreditvergabe benachteiligt und fordern die Einrichtung einer afrikanischen Ratingagentur. Diese könnte durch einen besseren Zugriff auf aktuelle Daten Vorteile bieten. Allerdings besteht auch die Gefahr, durch Gefälligkeitsratings Vertrauen zu verspielen. (“Does Africa need its own credit rating agency?”)
Guardian: Genetische Vielfalt nutzen. Der in Südafrika arbeitende Chemiker Professor Kelly Chibale kritisiert, dass die Welt nicht die genetische Vielfalt Afrikas nutzt. So sei die genetische Vielfalt der Afrikaner ein Vorteil bei der Entwicklung von Medikamenten. (“People didn’t believe Africa could be a source of innovation’: how the continent holds the key to future drug research”)
Africa News: Milizionäre legen die Waffen nieder. In der Demokratischen Republik Kongo haben Hunderte ehemalige Milizionäre ihre Waffen niedergelegt und versuchen, sich in das zivile Leben zu integrieren. Sie arbeiten zum Teil an der Entwicklung von Dörfern mit, die sie früher terrorisiert haben. (“Former militia members seek peace and reintegration in DRC”)
KfW-Studie: Nutzen der Entwicklungszusammenarbeit. Laut einer Studie der KfW trägt die EZ zum Wohlstand in Deutschland bei. Demnach steigen pro investiertem Euro in die EZ die Exporte um 0,36 Euro. Zudem würden 139.000 heimische Arbeitsplätze gesichert. (Deutsche EZ – Wie wirkt sie sich auf deutsche Exporte und Beschäftigung aus?)

Kaum eine Nachricht beschäftigte die marokkanische Öffentlichkeit in dieser Woche so sehr, wie der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Rabat – der erste offizielle Staatsbesuch in Marokko in der siebenjährigen Amtszeit des Franzosen. Lange herrschte Eiszeit zwischen Paris und Rabat, doch seit Juli dieses Jahres, als Macron implizit die Unterstützung der marokkanischen Pläne für die Westsahara ankündigte, ist Tauwetter angesagt. Entsprechend “royal” wurde der französische Präsident vor Ort empfangen, hieß es in den marokkanischen Medien. Deren eigentlicher Star während dieser Tage war indes ihr eigener König: Mohammed VI.
Denn für einheimische Zeitungen, wie etwa “Aujourdhui Le Maroc” haben vor allem “die vielen Impulse, die Seine Exzellenz für die nationale Sache lieferte” zur “neuen Dynamik” in der Westsahara-Frage und den marokkanisch-französischen Beziehungen geführt. Dass Macron für die Annäherung an Rabat noch ganz andere, pragmatische, Gründe hat und Entgegenkommen bei der Migrationsfrage erwartet, davon war in den nationalen Medien weniger die Rede.
“Was man von der Rede Macrons vor dem marokkanischen Parlament in Erinnerung behalten muss”, wie “Le Matin” titelte, sei vielmehr “die Hommage an seine Majestät König Mohammed VI. und die Moderne Marokkos“. So habe Macron den König als “die Kontinuität einer der ältesten Dynastien der Welt und eines der Gesichter der industriellen und technologischen Moderne” beschrieben. Seit seiner Thronbesteigung vor mehr als 25 Jahren sei es dem marokkanischen Souverän gelungen, sein Land auf den Weg der Modernisierung zu führen und dabei seine Traditionen und Stabilität zu bewahren.
Modernisierung und Tradition, Sanftmut und Willensstärke, Weltoffenheit und autoritäre Führung – seit der Übernahme des Throns von seinem Vater Hassan II im Jahr 1999 bewegt sich Mohammed VI tatsächlich zwischen den Polen. Auf Fotos zeigte sich der junge König Jetski fahrend, sportlich aktiv und volksnah. Doch bis heute gibt er keine Radio-Interviews, wie etwa Younes Bahmedi, Chef des Senders “Hit Radio” bezeugt: “Und wir haben es bisher auch nicht gewagt, eine solche Anfrage an das Königshaus zu stellen.” Dass seine Exzellenz “sehr pädagogisch gehaltene Ansprachen” der Interaktion mit der Öffentlichkeit vorzieht, weiß auch der Chefredakteur von Jeune Afrique, Francois Soudan. Vor der Kamera lese er lieber vom Blatt ab, anstatt einen Teleprompter zu benutzen. Soudan: “Der König ist nicht der Präsident, und er versteht sich weder als Politiker noch als Diplomat. Er hat Medienwirksamkeit nicht nötig.”
Das wurde auch 2009 deutlich, als die Zeitschrift “Tel Quel” eine Umfrage zur Beliebtheit des Königs gestartet hatte. 91 Prozent der Bevölkerung sprachen ihm ihre ungeteilte Zustimmung aus. Die Folge: Der Druck der Ausgabe mit den Ergebnissen wurde verboten. Positiv oder nicht, ein König muss sich keiner öffentlichen Bewertung stellen!
Stärke und Stolz – das sind wiederkehrende Motive bei Mohammed VI, wie nach dem Erdbeben am 8. September vergangenen Jahres. So lehnte der König Hilfsangebote von Frankreich und Deutschland vor dem Hintergrund diverser diplomatischer Verstimmungen zunächst ab. Gleichzeitig setzte er durch, dass schon einen Monat nach der Katastrophe die Vollversammlung der Weltbank im vom Beben ebenfalls betroffenen Marrakesch wie geplant stattfand: eine Demonstration marokkanischer Stärke vor den Augen der Weltöffentlichkeit.
Modernisierung der Wirtschaft, Investitionen in Infrastruktur, Industrie, Tourismus und den Sport, all das wird mit der Amtszeit Mohammed VI verbunden. Hinzu kommt, im Vergleich zur Regierungszeit seines Vaters, eine, relative Verbesserung der Menschenrechtssituation und erhöhte politische Partizipation. Wenn es um zentrale Fragen geht, stößt letztere aber auch schnell wieder an ihre Grenzen. Außenpolitik, Verteidigung und religiöse Angelegenheiten, all das bleibt unter direkter Kontrolle des Königs. Auch von wirklicher Pressefreiheit kann nicht die Rede sein. Zudem bestimmen soziale Spannungen, die Armut der Landbevölkerung und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit das Bild.
Als “komplexe Figur” schildert denn auch der gerade erst veröffentlichte Dokumentarfilm “Le parcours d’un roi” des französischen Fernsehsenders Public Sénat die Person Mohammed VI. Deren Vielschichtigkeit, so die Autoren, sei am besten mit diesen beiden Worten zu erfassen: Soft Power. Monika Hoegen

Jetzt ist er auch endlich in Kinos auf dem Kontinent zu sehen: Abderrahmane Sissakos Film “Black Tea”, der Anfang des Jahres im Rennen um einen Goldenen Bären in Berlin angetreten war. Erzählt wird ein Ausschnitt aus dem Leben von Aya (Nina Mélo) und ihrem Chef, dem Teeladenbesitzer Cai (Hang Chang). Sie ist aus der Elfenbeinküste nach China gekommen, genauer gesagt in die Hafen- und Handelsstadt Guangzhou – nachdem ihr Traum von einer Hochzeit geplatzt ist, beziehungsweise sich der Heiratskandidat als keine gute Wahl entpuppt hat.
“Black Tea” kreist um die gemeinsame Leidenschaft der Protagonisten für die Teekultur in China. Sie sei in ihrem Auftreten so vielfältig, eindringlich und bleibend wie das Aroma des schwarzen Tees, sagt Cai einmal zu seiner Angestellten und Angebeteten Aya, da pflücken sie Teeblätter im Feld. Der charmante Cai ist verheiratet, hat in der Vergangenheit in seiner Zeit auf den Kapverden ein uneheliches Kind gezeugt.
“Black Tea” ist filmisch bezaubernd, mit einer behutsamen Kameraführung, immer sehr nah an den Menschen und der langsamen Entwicklung des Plots folgend – der keine hohen moralischen Botschaften bereithält und auch kein eindeutiges Ende. Um Politik geht es kaum, nur am Rande wird auf die Diskriminierung von afrikanischen Menschen in Guangzhou verwiesen.
Meistens wird Mandarin im Film gesprochen, Untertitel auf Französisch laufen mit. Die sorgt zusätzlich dafür, dass Zuschauende ganz eintauchen und keine künstliche Distanz zum Gezeigten entsteht. Es ist gut, dass Sissokos Film nun auch in Afrika gezeigt wird – außer im Senegal, in der Elfenbeinküste, Kamerun, Algerien und Marokko – und damit dort, wo die Lebenserfahrung der Menschen Berührungspunkte mit den Protagonisten hat. “Black Tea” bietet ein Bild der Afrika-China-Beziehungen auf zwischenmenschlicher, nahbarer Ebene, jenseits der sonst vorherrschenden politischen Diskurse darüber. lcw
