lange galt Afrika in Deutschland als der vergessene Kontinent. Das ist vorbei.
Am Sonntag ist Bundeskanzler Scholz nach Ghana und Nigeria aufgebrochen, Bundespräsident Steinmeier reist diese Woche nach Tansania und Sambia, Bundesinnenministerin Faeser nach Marokko. Der Fächer der Themen ist weit gespannt. Stefan Braun, Redaktionsleiter von Berlin.Table, begleitet den Kanzler auf seinem Flug nach Nigeria und Ghana und berichtet von dort.
Die EU-Kommission hatte zu ihrem ersten Global Gateway Forum nach Brüssel geladen, eine Art Gegenveranstaltung zum Belt and Road Forum, das kürzlich in Peking stattfand. Unser Korrespondent Andreas Sieren berichtet, wie diese Initiative in Afrika aufgenommen wurde. Das Echo entspricht sicher nicht dem, was die Kommission hören wollte.
Frankreich hatte sich so sehr den Titel für die Rugby-WM gewünscht, die dort ausgetragen wurde. Doch Südafrika hat die Franzosen im Viertelfinale besiegt und sich dann im Finale sensationell gegen Neuseeland durchgesetzt. Andreas Sieren präsentiert uns einen Ausnahmespieler der Springböcke und wie dieser Titel das ganze Land verändert.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit diesen Artikeln und weiteren spannenden Analysen, News und einer internationalen Presseschau.

Seit Jahren fordern Afrikas Regierungschefs, Europa solle eine eigene Initiative starten, statt Chinas Belt and Road Initiative (BRI) pauschal zu kritisieren. Die Länder wollen ein alternatives Angebot, um ihre Interessen entsprechend verhandeln zu können. Doch als vergangene Woche die Europäische Kommission zum 1. Global Gateway-Forum nach Brüssel einlud, war das Interesse in Afrika gering.
Während auf dem 3. Belt and Road-Forum, das schon zehnjähriges Jubiläum feierte, fünf wichtige Staats- und Regierungschefs aus Afrika vertreten waren, darunter Ägypten und Äthiopien, kamen nach Brüssel nur die Staatsoberhäupter von den Komoren, Mauretanien, Namibia, Senegal und Somalia. Offensichtlich finden sie die Angebote nicht attraktiv genug.
In China präsentierte Präsident Xi Jingping selbstbewusst die Erfolge und definierte die Ziele für die kommende Dekade, in Brüssel tat sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedoch schwer, die Vorzüge des Global Gateway zu verdeutlichen. Das hat gleich mehrere Gründe. Es fehlen attraktive Projekte. Es ist zudem schwierig, in der EU Einigkeit darüber zu finden, was gemacht werden soll. Und die Umsetzung ist vergleichsweise teuer und langsam. Staats- und Privatunternehmen arbeiten bei der Finanzierung nicht so effizient zusammen wie in China. Und am Ende zeigt sich: Die EU will das gleiche wie die Chinesen – wie die Afrikaner feststellen. Sie will möglichst günstig an Afrikas Bodenschätze für die europäische Industrie.
Global Gateway, fast zwei Jahre alt, bietet wenig überzeugende Projekte. Die Initiative versteht sich als “globale Konnektivitätsstrategie”, die bis 2027 rund 300 Milliarden Euro für wichtige Infrastrukturprojekte mobilisieren möchte, die Hälfte davon in Afrika. Im Dezember 2021 vorgestellt, konzentriert sie sich auf Energie und Klima, Digitales, Transport, Gesundheit, sowie Bildung und Forschung. Der Schwerpunkt liegt besonders auf nachhaltiger und moderner Infrastruktur. Die EU möchte ihr Engagement weltweit bündeln und strategisch aufstellen.
Doch bereits vor knapp einem Jahr räumte eine Sprecherin der EU, Ana Pisonera, ein: “Zu diesem Zeitpunkt verfügen wir nicht über eine Liste vordefinierter Global Gateway-Projekte. Wir treiben Projekte und Flaggschiffprogramme mit unseren Partnerländern im Rahmen von Global Gateway voran, die auf fortlaufender Basis vereinbart werden.” Daran hat sich bis heute wenig geändert. Aber das ist den Afrikanern zu wenig, vor allem angesichts des erhobenen Zeigefingers, den von der Leyen sich nicht verkneifen konnte. “Bei Global Gateway geht es darum, den Ländern eine Wahl zu geben, und zwar eine bessere Wahl”, meinte die EU-Präsidentin. Bei Investitionen aus anderen Ländern warnte sie vor dem Kleingedruckten, “verbunden mit einem sehr hohen Preis”. Doch die Angebote der Chinesen schlecht zu reden, reiche den Afrikanern längst nicht mehr, nicht zuletzt, weil die EU-Projekte “länger brauchen, bis sie zum Leben erwachen, es viel Bürokratie gibt und die Kontrolle über die Ausgaben streng ist”, schreibt die North Africa Post.
Die EU ist zudem viel zu zerstritten, wie der vor einigen Tagen stattgefundene EU-Nahost-Gipfel zeigte, der mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten hervorbrachte. Das weithin beschworene “Team Europe” kommt nur langsam in Fahrt. Während die Chinesen seit Jahren mit sichtbaren Bauprojekten, darunter Eisenbahnlinien und Seehäfen, in Afrika weltweit Aufmerksamkeit erregen, sind EU-Interventionen kaum sichtbar. Hinzu kommt: Die meisten der in Brüssel gefeierten Projekte sind nicht neu und existieren teilweise schon seit Jahren. Hierzu zählen Projekte für erneuerbaren Wasserstoff und nachhaltige Wertschöpfungsketten bei Rohstoffen in Namibia, grüne Energie, nachhaltigen Verkehr, digitale Konnektivität auf den Kapverdischen Inseln und frühkindliche Entwicklung in Ruanda. In Sambia sollen die Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe verbessert werden und an neue Verkehrskorridore, etwa den Lobito-Korridor, angebunden werden.
Immerhin gibt es seit März bei Global Gateway eine Liste mit 83 Leuchtturmprojekten, allerdings mit wenig Details. Die EU solle “auf ihre Prinzipien setzen”, findet Ulrich Ackermann vom Maschinenbauverband VDMA. Dazu gehöre “eine transparente und an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Ausschreibung der Projekte, eine Vorab-Berechnung der Rentabilität der Investitionen sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption.” Vor allem sollten “international anerkannte technische Standards gelten”.
Europäische Infrastruktur ist auch teuer, was die Afrikaner skeptisch macht. Europäische Unternehmen können mit der Konkurrenz aus China, Indien oder der Türkei preislich kaum mithalten, ohne dass die Qualität deutlich besser ist. Offiziell liegt bei Global Gateway der Schwerpunkt auf Klima und Infrastruktur. Eine Studie von Ende 2022 zeigt jedoch, worum es der EU wirklich geht: der Sicherung von Rohstoffen, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa wichtig sind. Hierzu haben die Forscher in Afrika elf “strategische Transportkorridore” für den Kontinent identifiziert: “Die EU-Afrika Strategischen Korridore sollen die Stärkung und Schaffung von Wertschöpfungsketten und territorialer Organisation unterstützen und sowohl ländliche als auch städtische Gebiete umfassen.”

Das klingt sinnvoll, fehlt bisher in Afrika und ist daher auch willkommen. Doch tatsächlich möchten die Europäer genau das, was sie seit Jahren China vorwerfen: sich strategischen Zugang zu afrikanischen Rohstoffen schaffen. Und dafür braucht es Infrastruktur. Die EU steht unter Druck, weil sie bei Rohstoffen für Hightech sehr abhängig von den Chinesen ist, die sich diese seit Jahrzehnten systematisch sichern.
Afrika hingegen braucht Infrastruktur für das Wirtschaftswachstum. Nach Schätzungen der African Development Bank fehlen auf dem Kontinent dazu jährlich bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Sowohl die Agenda 2063 der Afrikanischen Union als auch die kürzlich ins Leben gerufene Afrikanische Freihandelszone setzen sich für Infrastrukturentwicklung ein. Die G7-Staaten betreiben seit einigen Jahren die wenig erfolgreiche Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), die Infrastrukturprojekte in den Ländern des Globalen Südens finanzieren soll und auch von Global Gateway unterstützt wird.
Die elf von der EU identifizierten Wirtschaftskorridore befinden sich zum Großteil im östlichen und westlichen Afrika. Aber auch im südlichen Afrika sollen sie zum Beispiel Walvis Bay in Namibia mit Maputo in Mosambik verbinden, seit Jahren als Transkalahari-Korridor bekannt, der vor allem im Osten für den Abtransport von Kohle benutzt wird. Wichtiger noch ist der Durban-Lusaka-Korridor, der das bedeutendste Kupferbergbaugebiet des Kontinents an den wichtigsten Hafen anschließt. Der Copperbelt im sambisch-kongolesischen Grenzgebiet ist das größte Industriegebiet in Subsahara-Afrika außerhalb von Südafrika. Aus EU-Botschaftskreisen in Pretoria ist zu hören, dass Gespräche über diesen Wirtschaftskorridor, auf dem auch Johannesburg und Pretoria liegen, bereits geführt werden. Immerhin.
Das Gebäude ist unscheinbar, nichts Spektakuläres, ein paar gepflegte flache Hütten mitten in der Millionen-Metropole Lagos. Eingeklemmt zwischen Baustellen, Märkten, einer Kaserne. Und das in einer Stadt, die zu den größten der Welt zählt. Man muss den Ort hier schon sehr entschlossen suchen, um ihn auch zu finden.
Heute ist der deutsche Kanzler hier zu Gast. Das Zentrum für Migration, Re-Integration und Entwicklung, so klein es ist, kümmert sich um ein für Deutschland großes Thema. In der Sache und in der politischen Bedeutung. Olaf Scholz spricht hier mit Menschen, die als Flüchtlinge in Deutschland abgelehnt wurden, mühsam zurückkehrten und an diesem kleinen Ort, gesponsert und organisiert auch durch die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ, Hilfe und Ausbildung bekommen. Das Ziel: sie befähigen, sich in Nigeria wieder einzugliedern.
Das klingt schön – und ist gekoppelt mit dem großen Thema, wie Deutschland all jene wieder zurückschicken kann, die in Deutschland kein Asyl bekommen haben. Scholz hat da zuletzt einen schärferen Ton angeschlagen. Die hohe Zahl an zu versorgenden Flüchtlingen in Deutschland hat das politische Klima verändert, die gegen Flüchtlinge agitierende AfD gestärkt und jetzt für eine Dringlichkeit gesorgt, das Problem neu anzugehen.
Auf der dreitägigen Afrika-Reise ist dem Kanzler anzumerken, wie sehr ihm das Thema mittlerweile auf den Nägeln brennt. Jahrelange Streitereien in Europa, mit Brüssel und in Deutschland haben ihm offenbar vor Augen geführt, dass er selbst zum Antreiber werden muss.
In Lagos immerhin sieht die Sache lösbar aus. Scholz kann hinter verschlossenen Türen mit einigen sprechen, denen die Rückkehr gelungen ist. Ein Schritt allerdings, der auch mit Scham behaftet sein kann. Immerhin haben sie ihr ursprüngliches Ziel nicht erreicht: ein Leben in Europa. Für Scholz aber steht im Vordergrund, dass es möglich ist: Ablehnen, wenn kein Asylgrund vorhanden ist, dann nach Hause schicken – und dort wieder integrieren. Aus Sicht des Kanzlers eine gute Geschichte. “Ermutigend” nennt er diese Geschichten.
Allerdings muss man festhalten, dass das Zentrum seit 2018 gerade gut 4000 solcher Schicksale positiv befördern konnte. Zuhause in Deutschland sind derzeit gut 13.500 Menschen registriert, die als abgelehnte Asylbewerber aus Nigeria keine Aufenthaltsgenehmigung mehr haben und doch noch da sind. Ein Großteil von ihnen (ca. 12.500) haben keine gültigen Papiere, und Nigeria nimmt sie aus diesem Grund bislang nicht auf.
Am Sonntag hat Präsident Bola Ahmed Tinubu zwar zugesagt, dass man hier kooperationsbereit sei, “wenn das wirklich unsere Leute sind” und “wenn sie sich gut benommen haben”. Um das aber überprüfen zu können, bräuchte Berlin ständig einen nigerianischen Beamten in Deutschland – was bisher nicht passiert ist. Wenn es also konkret wird, wird’s schwierig. Scholz hat sich gleichwohl vorgenommen, an der Stelle sehr hartnäckig zu bleiben. In Lagos sagt er, in seinem Gespräch mit dem Präsidenten seien beide “sehr klar” gewesen. Deshalb gehe er davon aus, dass das jetzt klappt.
Dabei weiß er, dass sich durch die politische Großwetterlage die Verhältnisse massiv geändert haben. Mit Forderungen allein erreicht er nichts mehr. Dem Partner muss schon auch was geboten werden.
Das heißt: Deutschland muss und will Fachkräfte anwerben. Doch was leicht klingt, ist alles andere als einfach: Wer soll das in einem Land wie Nigeria organisieren? Hier kommt wieder das Migrationszentrum in Lagos ins Spiel. Wenn es nach dem Willen des Kanzlers geht, sollen hier künftig nicht nur Menschen zurückkehren, sondern sich von hier aus auch auf den Weg machen. Aus einer Tür sollen zwei werden, so lautet die Hoffnung.
Allein: Die Details sind noch nicht geklärt, nur der Wille ist mittlerweile eindeutig. In Deutschland, aber auch in Nigeria. Präsident Bola Ahmed Tinubu sagte am Montag, in seinem Land gebe es 15 Millionen junge Menschen, die auf der Stelle bereit seien, mit Ausbildung etwas Neues zu beginnen. Aus diesem großen Kreis einen Pool auszusuchen und für sie die richtigen, also legalen Wege zu schaffen, wird eine Mammutaufgabe.
Zumal sich dabei zeigt, wie sehr auf dem Weg dorthin alte Begrifflichkeiten und Strukturen im Weg stehen. Das fängt bei Wörtern wie Sicheres Herkunftsland, Sicherer Drittstaat, Rückführungsabkommen und Migrationsabkommen an. Sie alle schwirren nach wie vor durch die Debatten und Pläne, ob nun in Berlin oder Brüssel. Auf Scholzens Reise wird klar, dass der Kanzler beim Beispiel Nigeria abwarten möchte, was Brüssel mit dem Land gerade verhandelt. Wie es heißt, seien die Gespräche kurz vor dem Abschluss.
Allerdings hat das ganze einen Haken: Während Deutschland Nigeria direkt anbieten kann, in einem Abkommen Zuwanderung und Rücknahme gleichzeitig zu regeln, damit es erkennbar auf beiden Seiten Gewinner gibt, muss sich die EU auf Verhandlungen über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber beschränken. Das ist, noch dazu in der veränderten politischen Stimmungslage mit selbstbewussten afrikanischen Staaten, schwerer geworden – und kann höchstens mit Zugeständnissen an anderer Stelle gekoppelt werden – seien es Geldzahlungen, Hilfen für den jeweiligen Grenzschutz oder ähnliches.
Aus diesem Grund wächst in Berlin die Sorge, dass die EU-Verhandlungen zwar bald abgeschlossen werden, aber das Ergebnis beim Thema Rückführung und Abschiebung nicht hart genug ausfällt. Was dann aus Sicht der Regierung nur heißen kann, weitere Verhandlungen zu führen. Der Kanzler nämlich weiß, dass er was liefern muss. So, wie es derzeit ist, kann es auch aus seiner Perspektive nicht mehr bleiben.
Bitter dabei: Noch gibt es Widersprüche, auch im eigenen Handeln. So ist in Lagos zu erfahren, dass sich das Migrationszentrum aktuell nicht mehr um Rückkehrer kümmert, weil es dafür formal nicht mehr zuständig ist. Das Zentrum als Projekt der GIZ untersteht dem BMZ, aber seit Beginn dieser Legislatur untersteht die Politik rund um die Rückkehrer dem Bundesinnenministerium.
Außerdem sind die Mittel ausgerechnet jetzt um mehr als die Hälfte gekürzt worden. Das, so steht zu vermuten, müsste sich wieder ändern, will man an der Stelle Erfolg haben. Bislang ist das kleine Migrationszentrum in der Riesenstadt Lagos ein Hoffnungsschimmer, eine Idee, eine Blaupause für die Zukunft. Mehr aber auch nicht.
Achim Becker, INZAG Germany GmbH, Geschäftsführer
Carl Heinrich Bruhn, CHB Investment Holding GmbH, Geschäftsführer
Sabine Dall’Omo, Siemens AG, Geschäftsführerin für Subsahara-Afrika, Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V.
Oliver Haeggberg, GeoScan GmbH, Geschäftsführer
Tim Oliver Holt, Siemens Energy AG, Mitglied des Vorstands
Miguel López, Thyssen Krupp AG, Vorstandsvorsitzender
Tobias Meyer, DHL Group, Vorstandsvorsitzender
Günther Mull, DERMALOG Identification Systems GmbH, Geschäftsführer
Nicolas Rohrer, Asantys Systems GmbH, Eigentümer und Geschäftsführer
Ralf Wintergerst, Giesecke+Devrient GmbH, Vorstandsvorsitzender
Rasmus Woermann, C. Woermann GmbH & Co. KG, Geschäftsführender Gesellschafter
Hamed Beheshti, Boreal Light GmbH, Geschäftsführer
Heike Bergmann,Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, Senior Vice President
Martina Biene, Volkswagen Group South Africa, Vorsitzende der Geschäftsführung
Johannes Frühauf, SSF Ingenieure AG, Director International
Hakan Gürdal, Heidelberg Materials AG, Mitglied des Vorstands
Susanne Haus, Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Präsidentin
Kazuyuki Marukawa, Taniobis GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung
Chiara-Felicitas Otto, Exficon GmbH, Geschäftsführerin
Armando Koerig Gessinger, Wingcopter GmbH, Chief Sales Officer
Klaus Richter, Inros Lackner SE, Geschäftsführender Direktor
Neset Tükenmez, Aerodata AG, Vorstandsvorsitzender
Seit geraumer Zeit sind internationale Flüge von und nach Afrika wieder voll besetzt und es sind viele Geschäftsleute, die sich in den Maschinen befinden. Gleichzeitig schießen Hotelbuchungen wieder nach oben. Laut World Travel and Tourism Council hat 2022 der Reise- und Tourismussektor 7,6 Prozent zum globalen BIP beigetragen, ein Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und nur 23 Prozent unter dem Jahr 2019. Auch das zeigt die wichtige Stellung von Geschäftsreisen, vor allem in Afrika. “Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Anerkennung des Potenzials Afrikas als Drehscheibe für internationale Konferenzen, Tagungen und Firmenveranstaltungen wider”, sagt Devi Paulsen-Abbott, Chair der Association of African Exhibition Organizers.
So schätzt der World Travel and Tourism Council in einer neuen Studie, dass weltweit der Anteil von Geschäftsreisen bei den Besuchern besonders in afrikanischen Metropolen stark zulegen wird. Die Studie berechnet die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahr 2032. Unter den ersten fünf Städten sind allein drei aus Afrika, mit der nigerianischen Metropole Lagos an erster Stelle, gefolgt von Kapstadt, Riad, Johannesburg und Singapur. Als erste europäische Stadt befindet sich Amsterdam auf Platz sechs.
Metropolen in Afrika haben jüngst vor allem in Infrastruktur investiert, darunter in moderne Flughäfen, Konferenzzentren und Top-Hotels. Diese neuen Einrichtungen erlauben es, große Tagungen und Ausstellungen zu organisieren, wie etwa beim 15. Brics-Gipfel in Johannesburg oder beim ersten Afrika-Klimagipfel in Nairobi, wo jeweils mehrere Tausend Delegierte teilnahmen. Auch haben viele globale Airlines ihre Netzwerke ausgebaut und Flüge nach Afrika aufgestockt, darunter die beiden Branchengrößen aus dem Nahen Osten, Qatar Airways und Emirates.
Emirates fliegt Kenia 24-mal die Woche an, nach Südafrika (Johannesburg, Kapstadt und Durban) sind es sogar 42 Flüge. Die Emirates-Hubs in Nairobi und Johannesburg stellen bequeme Verbindungen zu kleineren Destinationen her. Trotz der Krise in der Sahelzone gilt Afrika zudem als politisch stabiler, was sich auch positiv auf das Ausrichten von Business Events auswirkt, sowohl bei Organisatoren als auch Teilnehmern. Mit dem Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern wollen viele Unternehmen in Afrika investieren, was auch Geschäftsreisen fördert.
Nairobi wurde viermal hintereinander als Africas Leading Business Travel Destination der World Travel Awards ausgezeichnet. Zu den Nominierungen standen neben der kenianischen Hauptstadt auch Accra, Durban, Johannesburg, Kairo, Kapstadt, Kigali, Lagos und Pretoria zur Wahl. In Südafrika, führende Wirtschaftsmacht auf dem Kontinent, gibt es neue Trends bei Geschäftsreisen, die auch in anderen Ländern zu beobachten sind. Demnach versuchen Geschäftsleute länger an ihren Zielorten zu bleiben und bringen dort mehr Termine unter. Flüge werden zunehmend bei Premium-Fluglinien gebucht und vor Ort werden luxuriösere Hotels gebucht.
Angesichts der steigenden Reisekosten müssen Geschäftsleute jedoch effizienter unterwegs sein. Bonnie Smith, General Manager von Corporate Traveller, hat erkannt, dass “Geschäftsreisende seltener verreisen, aber mehr Geld ausgeben.” Branchenexperten gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt und Afrika auf dem besten Weg ist, ein erstklassiges Ziel für internationale Geschäftsveranstaltungen zu werden. Regierungen und Tourismusbehörden auf dem gesamten Kontinent erkennen das Potenzial des Geschäftstourismus und arbeiten aktiv daran, mehr Kongresse anzuziehen.
Hotelketten bereiten sich bereits auf den möglichen Ansturm vor. Laut einer Studie der W-Hospitality Group wurden 2023 gegenüber dem Vorjahr in Afrika 27 Prozent mehr Hotelbetten gesichert, damit die am zweitschnellsten wachsende Region weltweit. Der Bedarf an mehr Kapazität wurde vor allem durch große Konferenzen angetrieben.
Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat ein neues ökonomisches Beratungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklungspolitik gegründet, das in der vergangenen Woche erstmals zusammengetroffen ist. Das Netzwerk soll für die Entwicklungspolitik relevante ökonomische Fragestellungen identifizieren und Empfehlungen für die strategische Ausrichtung des BMZ erarbeiten. Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Empfehlungen sollen künftig gezielter in entwicklungspolitische Prozesse einfließen. Zu den wichtigsten Themen des Netzwerks zählen die sozial-ökologische Wirtschaftstransformation, die Krisenbewältigung sowie die wachsende Ungleichheit, wie eine BMZ-Sprecherin auf Table.Media-Anfrage erklärte.
In dem Netzwerk kommen künftig zehn Ökonomen sowie themenbezogen verschiedene Experten aus dem globalen Süden zusammen. Es ist geplant, eine Sitzung des Netzwerks pro Halbjahr zu veranstalten.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Beratungsnetzwerks sind:
Zudem wirken auch Vorstandsmitglieder von GIZ (Anna Sophie Herken und Ingrid-Gabriela Hoven) sowie KfW (Christiane Laibach) im Netzwerk mit. ajs
Am 14. November wird im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin eine neu gegründete Wirtschaftsinitiative mit Fokus auf Afrika vorgestellt. Die Initiative mit dem Namen Rethinking Africa (RTA) fordert eine Neujustierung der Handelsbeziehungen mit dem Nachbarkontinent. Über die direkte Vernetzung von afrikanischen und europäischen Wirtschaftspartnern soll den Akteuren der Zugang zu Kapital erleichtert werden. Über gesteigerte Wertschätzung vor Ort sollen in Afrika nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die politische Stabilität in den betreffenden Ländern.
An der Initiative beteiligt sind unter anderem der Unternehmer Holger Bingmann, der bis 2020 Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) war und nun RTA-Geschäftsführer ist, sowie Stefan Liebing, Unternehmensberater und bis zum Frühjahr Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Auch der einstige parlamentarische Staatssekretär im BMZ Norbert Barthle (CDU) und die ehemalige Außenministerin Malis, Kamissa Camara, unterstützen die Initiative.
Rethinking Africa ist nach der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (Safri), dem Afrika-Verein, Africa First des Münchner Unternehmers Martin Schoeller sowie Africa Connect des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft bereits die fünfte deutsche Wirtschaftsinitiative in Richtung Afrika. ajs
Nigeria muss keine Entschädigung an die Rohstoffgesellschaft P&ID zahlen. Dies entschied ein Londoner Gericht in der vergangenen Woche in dem seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem westafrikanischen Land und dem Konzern mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Die Forderung von 11 Milliarden US-Dollar hatte auch ein Risiko für die nigerianische Wirtschaft dargestellt, denn der Betrag entspricht immerhin einem Drittel der nigerianischen Devisenreserven.
P&ID hatte 2017 erfolgreich gegen Nigeria geklagt und Schadensersatz in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen. Nigeria hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt mit der Begründung, P&ID habe sich den betreffenden Erdgas-Auftrag durch Korruption erschlichen und niemals die Absicht gehabt, den Auftrag zu erfüllen. Nun hat ein Gericht zugunsten der Regierung entschieden: P&ID hat keinen Anspruch auf die Entschädigungszahlung, die inzwischen mit Zinsen auf 11 Milliarden Dollar gestiegen war.
Helen Taylor, leitende Rechtsforscherin bei der Anti-Korruptionsgruppe Spotlight on Corruption, sagte der Financial Times: “Die Bedeutung des heutigen Urteils für das nigerianische Volk kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die wirtschaftlichen Aussichten eines ganzen Landes waren durch einen fehlerhaften Schiedsspruch für ein Gasprojekt, das auf Bestechung und Lügen aufgebaut war, in Geiselhaft genommen worden.”
P&ID kann noch Berufung gegen das Urteil einlegen. ajs
Die Bürgerkriegsparteien im Sudan haben nach vier Monaten Unterbrechung wieder Gespräche über einen Waffenstillstand aufgenommen. Das teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit. Die Gespräche seien unter Vermittlung der USA, Saudi-Arabiens, und der ostafrikanischen Regionalorganisation Intergovernmental Authority on Development (IGAD) gemeinsam mit der Afrikanischen Union arrangiert worden.
Die wiederaufgenommenen Gespräche sollen auch die Lieferung humanitärer Hilfe erleichtern und dauerhafte Friedensverhandlungen auf den Weg bringen, sagte Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums.
Vergangene Woche hatten die RSF noch die strategisch wichtige Stadt Nyala eingenommen, wie beide Kriegsparteien bestätigten. Die von Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, geführten Rapid Support Forces und die Armee unter dem Kommando von Abdel Fattah al-Burhan bekämpfen sich seit April dieses Jahres. Rund sechs Millionen Menschen wurden seitdem vertrieben, Tausende getötet.
Die USA und Saudi-Arabien vermitteln in dem Konflikt, hatten die Gespräche jedoch im Juni ausgesetzt, nachdem ausgehandelte Feuerpausen mehrfach verletzt wurden. Im Mai hatte die Militärjunta den deutschen UN-Sondergesandten in Khartum, Volker Perthes, zur unerwünschten Person erklärt. Perthes wurde jetzt von UN-Generalsekretär António Guterres mit der Erarbeitung des Strategic Review der Irak-Mission beauftragt. bub

Die Rolle Afrikas in einem geopolitisch und geoökonomisch relevanteren Kontext ist beachtlich. Das Umfeld für globale Kooperationsanstrengungen ist deutlich schwieriger geworden. Akteure im Globalen Süden und nicht zuletzt auf dem afrikanischen Kontinent sind in geopolitischen Konflikten nicht mehr nur Teilnehmende am Rande, sondern sehr viel stärker Gestalter. Sie formulieren eigene Forderungen und sind zugleich umworben durch westliche Länder, China und Russland.
Die erfolgreichen Militärputsche im Niger, Gabun, in Mali und Burkina Faso stellen für die dortigen Bevölkerungen eine einschneidende Kehrtwende in den vergangenen Wochen bzw. Jahren dar. Relevante afrikanische Akteure wie die AU und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben das illegitime Vorgehen gegen demokratisch gewählte Regierungen verurteilt. Aus europäischer Sicht bedeuten die Umstürze ebenfalls einen massiven Rückschritt. Die Putsche dürften insgesamt mit deutlich mehr Instabilität und destruktivem Wettbewerb externer Akteure auf dem afrikanischen Kontinent verbunden sein.
Ehemalige Kolonien Frankreichs sind von diesem Trend der Instabilität besonders betroffen. Die postkoloniale Politik Frankreichs zur Zementierung ungleicher Beziehungen hat über Jahrzehnte eine solche Eskalation der Verhältnisse mit ermöglicht. Andere europäische Partner und die EU haben sich hiervon nicht ausreichend abgesetzt. Dies ist in Teilen einer unzureichenden eigenständigen Strategiefähigkeit zu afrikabezogenen Themen (einschließlich der Expertise aus den Ländern / aus der Region) geschuldet. Dies gilt für die Entwicklungspolitik, aber ebenso für die Außen- und Sicherheitspolitik und andere Politikfelder.
Entwicklungspolitik ist nicht das einzige Instrument zur Ausgestaltung der Beziehungen mit Partnern auf dem afrikanischen Kontinent. Gleichwohl ist das Politikfeld weiterhin einerseits ein Ausweis internationaler Glaubwürdigkeit (beispielsweise bei der Frage: Erfüllen OECD-Länder die von ihnen gemachten entwicklungspolitischen Zusagen?) und andererseits ein Ansatz, mit dem überhaupt an internationalen Problemen konkret gearbeitet werden kann. Entwicklungspolitik ist in der Lage, mit handfesten Maßnahmen die Bekämpfung von lokalen oder auch globalen Problemen anzugehen, sei es, Gesundheitsversorgung dort zu verbessern, wo schwache Gesundheitssysteme bestehen (wie etwa Ebola zu begegnen) oder die Transformation zugunsten erneuerbarer Energien zu unterstützen und zu beschleunigen.
Instrumente der Entwicklungspolitik sind stark vergünstigte öffentliche Mittel oder Zuschüsse, die dort eingesetzt werden können, wo andere Ressourcen (etwa Zugang zu internationalen Kapitalmärkten zu vertretbaren Konditionen) nicht zur Verfügung stehen oder sich als nicht profitabel genug erweisen. Auch mit großen und wirtschaftlich relativ starken Entwicklungsländern bieten sich Gestaltungsmöglichkeiten über die Entwicklungspolitik, wie das Beispiel Südafrika zeigt. Falsch wäre es, entwicklungspolitische Gestaltungsmöglichkeiten Deutschlands, der EU und der gesamten OECD zu unter- oder auch zu überschätzen. Entwicklungspolitik kann genauso wenig Garantien für Kooperationsziele (etwa Stabilisierung von Ländern oder Regionen) geben wie andere Politikfelder. Gleichwohl zeigt gerade China, wie stark die Ausstrahlung von Entwicklungsinitiativen sein kann.
China wird in dieser Hinsicht für viele Entwicklungsländer – von Tansania bis Südafrika – weiter eine enorm wichtige Rolle spielen. Russland hat bei öffentlichen und privaten Entwicklungsinvestitionen wenig vorzuweisen; dies zeigte sich letztlich auch beim zweiten russisch-afrikanischen Gipfel in St. Petersburg im Juli 2023. Russland setzt vor allem destruktives Vorgehen als spoiler ein – Militärkooperationen (von Waffenlieferungen bis hin zum Einsatz der Wagner-Söldner) sowie Instrumentalisierung von Nahrungsmitteln und Dünger.
All dies zeigt, dass deutsche und europäische Entwicklungspolitik grundsätzlich über ein relevantes Potential verfügt, um an der Neuausrichtung der Beziehungen mit afrikanischen Partnern mitzuwirken. Europa sollte noch sehr viel stärker Teil einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dynamik auf dem afrikanischen Kontinent sein – Entwicklungspolitik ist dabei ein zentrales Element.
Prof. Stephan Klingebiel ist Forschungsprogrammleiter am German Institute of Development and Sustainability (IDOS) in Bonn. Zugleich ist er Gastprofessor an der Ewha Womans University in Seoul und an der Universität Turin. Von 2007 bis 2011 hat er das Büro der KfW-Entwicklungsbank in Ruanda geleitet.
New York Times: Die Welt wird afrikanischer. Im Jahr 2050 wird jeder vierte Mensch auf der Erde Afrikaner sein – ein Wandel, der sich bereits jetzt abzeichnet: in der Musik, die die Welt hört, in Filmen, in der Mode und in der Politik. Er zeigt sich an den Wellen junger Menschen, die alles riskieren, um auszuwandern, und an den Dilemmata derjenigen, die bleiben. Im ersten Teil einer Serie über Afrikas Heranwachsende untersucht die Zeitung, wie die Jugend nicht nur den Kontinent verändert.
The Economist: Senegals Präsident fragt, ob Demokratie in Afrikas “Putschgürtel” funktionieren kann. Im Gespräch mit der britischen Wochenzeitung wirft Macky Sall die Frage auf, ob Demokratie nach westlichen Vorstellungen das richtige Rezept für die fragile Sahelzone sein kann. Seine Kritik: Die wirkliche Macht in der Region werde oft nicht von gewählten Vertretern ausgeübt, und die Konzentration auf Wahlen habe nicht zu Stabilität geführt.
Al Jazeera: Demokratie in Afrika ist keine westliche Zumutung. Ruandas Präsident Kagame und Guineas Militärmachthaber Doumbouya seien nicht ehrlich, wenn sie die Demokratie als eine Zumutung bezeichnen, schreibt der Kolumnist Tafi Mhaka. Die Afrikaner liebten die Demokratie und wollten, dass sie funktioniert.
Addis Standard: Gespräche über Nilstaudamm ohne Ergebnis beendet. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Äthiopien, Sudan und Ägypten über den Grand Ethiopian Renaissance Dam ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die jüngsten Verhandlungen sind Teil der seit mehr als zehn Jahren andauernden Gespräche zwischen den drei Ländern des Nilbeckens über den Staudamm. Die nächste Gesprächsrunde wird im Dezember in Addis Abeba stattfinden.
Mail & Guardian: Südafrika will bei AGOA-Forum Handel mit USA intensivieren. Der US-amerikanische African Growth and Opportunity Act (AGOA), der afrikanischen Ländern präferentiellen Handelszugang zum amerikanischen Markt ermöglicht, soll 2025 auslaufen. Beim Johannesburger AGOA-Forum in dieser Woche werben die afrikanischen Staaten um eine Verlängerung um weitere zehn Jahre.
Bloomberg: Südafrikas Regierungspartei ANC verliert Unterstützung. Laut neuen Umfrageergebnissen unterstützen nur noch 45 Prozent der Südafrikaner den ANC. Seit dem Ende der Apartheid regiert die Partei mit absoluter Mehrheit. Nun droht ihr Verlust bei den Wahlen im nächsten Jahr. Anhaltende Korruptionsskandale und ein Jahr mit den schlimmsten Stromausfällen aller Zeiten haben die Unterstützung der Regierung untergraben.
Reuters: Namibia stoppt Lithiumexporte eines chinesischen Unternehmens. Die namibische Regierung hat die Polizei angewiesen, Xinfeng Investments daran zu hindern, Lithiumerz innerhalb des Landes zu transportieren und zu exportieren. Namibia wirft dem chinesischen Bergbauunternehmen vor, gegen das Ausfuhrverbot für kritische Mineralien zu verstoßen.
Semafor: Kenianische Unternehmen verzichten auf M-Pesa. Kleine Unternehmen in Kenia lehnen zunehmend Zahlungen mit mobilem Geld zugunsten von Bargeld ab, um aggressiven Maßnahmen zur Einhaltung der Steuervorschriften zu entgehen. Die Regierung von Präsident William Ruto will die Steuereinnahmen erhöhen und hat zu diesem Zweck 1.400 paramilitärisch ausgebildete Beamte der kenianischen Steuerbehörde im ganzen Land eingesetzt.
All Africa: Ruanda bei Rechtsstaatlichkeit an der Spitze Afrikas. In dem vom World Justice Project veröffentlichten Rule of Law Index nimmt Ruanda zum dritten Mal den Spitzenplatz unter den Nationen Subsahara-Afrikas ein, gefolgt von Namibia und Mauritius. Südafrika schafft es nur auf Platz fünf.

Als Siya Kolisi den Webb Ellis Cup, die Siegestrophäe der Rugby-Weltmeisterschaft, für sein Team am Abend des 28. Oktober in den kalten und regnerischen Nachthimmel von Paris hob, stand der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa an seiner Seite. Ramaphosa jubelte als Nächster mit dem Pokal in den Händen. Auch er trug wie sein Team ein grünes Nationalshirt, fiel jedoch mit einem Schal auf, der bunt in den Farben Südafrikas leuchtete. “South Africa, World Champion”, schallte es durch das Stadion.
Gerade hatte Südafrikas Rugby-Team, die Springboks, die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal hintereinander gewonnen, 2019 und jetzt, beide Male angeführt von Siya Kolisi. Nicht nur führte der 32 Jahre alte, großgewachsene Captain sein Team erfolgreich zum Sieg über die All Blacks aus Neuseeland, er sieht auch wie kein anderer die Verbindung zwischen dem Team, Südafrika und dessen Bewohnern. “Menschen, die nicht aus Südafrika kommen, verstehen nicht, was das für unser Land bedeutet. Es geht nicht nur um das Spiel. Unser Land macht so viel durch”, meint Kolisi kurz nach dem Spiel. Mit vier Titeln ist Südafrika jetzt Rekordweltmeister, und Kolisi erst der zweite Rugby-Spieler überhaupt, der als Captain den Weltmeistertitel erfolgreich verteidigte.
Siya Kolisi hat das Feingefühl, Dinge im Kontext zu sehen, ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. Nach dem gewonnenen Finale zeigte er Respekt vor dem Gegner Neuseeland: “Sie haben uns unter so viel Druck gesetzt.” Dann erst kam das Lob für die eigenen Spieler, auf die er stolz sei. Das Spiel wurde mit einem Punkt gewonnen, denkbar knapp im Rugby, genauso wie das Halbfinale gegen England und das Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich. “Ihr Umgang mit Widrigkeiten zeichnet sie aus”, schrieb die Zeitung Daily Maverick über die Springboks – und meinte auch vor allem Captain Kolisi.
Kolisi kommt, wie viele seiner Mitspieler, aus ärmlichen Verhältnissen, was ihn sehr geprägt hat. Seine Mutter war erst 16 Jahre alt, als er 1991 auf die Welt kam. Sein Vater war gerade erst mit der Schule fertig. Nelson Mandela war erst ein gutes Jahr zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Südafrikas Apartheid befand sich in den Endzügen, und in diesen unruhigen Zeiten ging es dem Großteil der Bevölkerung wirtschaftlich schlecht. Damals repräsentierte das grüne Rugby-Nationaltrikot eine Welt, die Weißen vorbehalten war.
Kolisi hingegen wuchs im schwarzen Zwide-Township, einem der größten im Land, am Rande der Hafenstadt Port Elizabeth in der Provinz Eastern Cape, auf. Es war eine Kindheit der Entbehrungen, bei der Hunger auf der Tagesordnung stand. Gewalt war ebenfalls allgegenwärtig. Jungen wie er schnüffelten Benzin und dealten mit Drogen. Als Kolisi zehn Jahre alt war, starb seine Großmutter, die ihn praktisch großgezogen hatte. Ein harter Schlag.
Rugby wurde zu Kolisis Flucht aus dem Elend, sowohl mental als auch physisch. Im Alter von zwölf Jahren fiel er bei einem Turnier auf, was ihm ein Stipendium in der exklusiven Grey High School einbrachte. Drei Jahre später starb seine Mutter. Doch Kolisi ließ sich nicht unterkriegen. Zunächst musste er Englisch lernen und suchte dann den Erfolg als Rugby-Spieler, den er schließlich in der Provinz Westkap fand. Es hätte auch eine Karriere als Gangster im Township werden können. Stattdessen gelang ihm der Aufstieg aus der Armut zum nationalen Superstar.
Der erste Einsatz für die Springboks kam 2013, im Alter von 22 Jahren. Und auf Anhieb wurde er Man of the Match. Zwei Jahre später spielte er seine erste Weltmeisterschaft. Fünf Jahre später wurde er erster schwarzer Kapitän des Nationalteams, ein Novum in der 126 Jahre währenden Rugby-Geschichte des Landes. Diesen Aufstieg entgegen allen Widrigkeiten beschrieb Kolisis Biografie “Against All Odds“, die 2019 pünktlich zur Rugby-WM in Japan veröffentlicht wurde. Die Springboks krönten das Turnier mit ihrem dritten Weltmeistertitel. Bei der WM 1995, die Südafrika gewann, hatten erstmals Schwarze im Team gespielt, und der damalige Präsident Nelson Mandela sah die Springboks als Beispiel nationaler Versöhnung.
Für Kolisi lief es allerdings nicht immer so gradlinig. Nicht selten während seiner aktiven Karriere flüchtete er sich in Alkohol, wenn Dinge nicht so liefen, wie er es wollte, und er verbrachte viel Zeit in Nachtclubs. Erst seine Frau Rachel, die er 2016 heiratete und mit der er zwei Kinder hat, erinnerte Kolisi daran, dass er ein Vorbild sei und sich dementsprechend benehmen sollte. Der Rugby-Spieler wurde gläubiger Katholik. Während der Covid-Pandemie gründete er die Kolisi Foundation, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Viele seiner Mitspieler machen es ähnlich, und versuchen zu helfen, wo sie können.
Klub-Rugby spielt Kolisi jetzt bei Racing 92 in Nanterre, einem Vorort von Paris. Noch Anfang 2023 litt er an einer schweren Knieverletzung. Doch er schaffte es, rechtzeitig für die Weltmeisterschaft wieder fit zu werden. Und im Kollektiv stellte sich der Erfolg ein: “Sobald wir zusammenarbeiten, ist alles möglich, gleichgültig in welchem Bereich – auf dem Spielfeld, in den Büros, zeigt sich, was wir können. Ich bin diesem Team dankbar, ich bin so stolz darauf”, meinte Kolisi nach dem WM-Triumph. Andreas Sieren
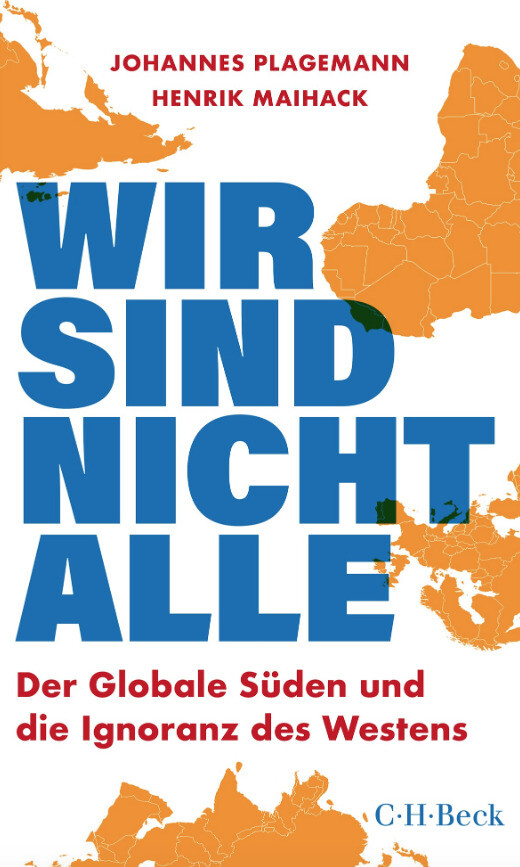
Die Beziehungen zwischen Europa, Nordamerika und dem Rest der Welt beschäftigt zurzeit einige Autoren. Die Politikwissenschaftler Henrik Maihack und Johannes Plagemann haben nun ihre Sicht vorgelegt. Maihack leitet bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung das Ressort Afrika. Plagemann arbeitete 2015 und 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, als der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Außenministerium leitete. Heute arbeitet Plagemann beim Thinktank German Institute for Global and Area Studies (Giga).
Kenntnisreich führen die beiden Autoren durch die Veränderungen, die die Beziehungen zwischen Europa und USA – im Buch als “der Westen” bezeichnet – und den aufstrebenden Staaten in Asien und Afrika verändern. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass wir uns in einer multipolaren Welt befinden und dass diese dem Westen nicht nur Nachteile bringt. Allerdings muss der Westen bei allem Wunsch nach Demokratisierung anerkennen, dass viele Staaten in diversen Formen von Autokratien regiert werden. Die beiden Autoren gehen sehr analytisch vor und erliegen nicht der Versuchung, in der einen oder anderen Richtung leichten Thesen zu folgen. Am Ende steht ein moderates Plädoyer für ein stärkeres Miteinander.
Der Sinn des Titels “Wir sind nicht alle” erschließt sich allerdings auch nach der Lektüre nicht. Zunächst kam in den Sinn, dass damit gemeint sein könnte, wir seien noch nicht erledigt. Wahrscheinlich soll der Titel jedoch ausdrücken, dass wir im Westen nicht mehr für die Welt sprechen können. Diese Aussage wäre jedoch für das Publikum, an das sich dieses Buch richtet, etwas zu offensichtlich. Das Buch bietet geopolitisch Interessierten jedenfalls viele interessante Gedanken. hlr
Johannes Plagemann, Henrik Maihack: Wir sind nicht alle. Der Globale Süden und die Ignoranz des Westen. Verlag C.H. Beck, München, September 2023, 249 Seiten, 18 Euro.
lange galt Afrika in Deutschland als der vergessene Kontinent. Das ist vorbei.
Am Sonntag ist Bundeskanzler Scholz nach Ghana und Nigeria aufgebrochen, Bundespräsident Steinmeier reist diese Woche nach Tansania und Sambia, Bundesinnenministerin Faeser nach Marokko. Der Fächer der Themen ist weit gespannt. Stefan Braun, Redaktionsleiter von Berlin.Table, begleitet den Kanzler auf seinem Flug nach Nigeria und Ghana und berichtet von dort.
Die EU-Kommission hatte zu ihrem ersten Global Gateway Forum nach Brüssel geladen, eine Art Gegenveranstaltung zum Belt and Road Forum, das kürzlich in Peking stattfand. Unser Korrespondent Andreas Sieren berichtet, wie diese Initiative in Afrika aufgenommen wurde. Das Echo entspricht sicher nicht dem, was die Kommission hören wollte.
Frankreich hatte sich so sehr den Titel für die Rugby-WM gewünscht, die dort ausgetragen wurde. Doch Südafrika hat die Franzosen im Viertelfinale besiegt und sich dann im Finale sensationell gegen Neuseeland durchgesetzt. Andreas Sieren präsentiert uns einen Ausnahmespieler der Springböcke und wie dieser Titel das ganze Land verändert.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit diesen Artikeln und weiteren spannenden Analysen, News und einer internationalen Presseschau.

Seit Jahren fordern Afrikas Regierungschefs, Europa solle eine eigene Initiative starten, statt Chinas Belt and Road Initiative (BRI) pauschal zu kritisieren. Die Länder wollen ein alternatives Angebot, um ihre Interessen entsprechend verhandeln zu können. Doch als vergangene Woche die Europäische Kommission zum 1. Global Gateway-Forum nach Brüssel einlud, war das Interesse in Afrika gering.
Während auf dem 3. Belt and Road-Forum, das schon zehnjähriges Jubiläum feierte, fünf wichtige Staats- und Regierungschefs aus Afrika vertreten waren, darunter Ägypten und Äthiopien, kamen nach Brüssel nur die Staatsoberhäupter von den Komoren, Mauretanien, Namibia, Senegal und Somalia. Offensichtlich finden sie die Angebote nicht attraktiv genug.
In China präsentierte Präsident Xi Jingping selbstbewusst die Erfolge und definierte die Ziele für die kommende Dekade, in Brüssel tat sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedoch schwer, die Vorzüge des Global Gateway zu verdeutlichen. Das hat gleich mehrere Gründe. Es fehlen attraktive Projekte. Es ist zudem schwierig, in der EU Einigkeit darüber zu finden, was gemacht werden soll. Und die Umsetzung ist vergleichsweise teuer und langsam. Staats- und Privatunternehmen arbeiten bei der Finanzierung nicht so effizient zusammen wie in China. Und am Ende zeigt sich: Die EU will das gleiche wie die Chinesen – wie die Afrikaner feststellen. Sie will möglichst günstig an Afrikas Bodenschätze für die europäische Industrie.
Global Gateway, fast zwei Jahre alt, bietet wenig überzeugende Projekte. Die Initiative versteht sich als “globale Konnektivitätsstrategie”, die bis 2027 rund 300 Milliarden Euro für wichtige Infrastrukturprojekte mobilisieren möchte, die Hälfte davon in Afrika. Im Dezember 2021 vorgestellt, konzentriert sie sich auf Energie und Klima, Digitales, Transport, Gesundheit, sowie Bildung und Forschung. Der Schwerpunkt liegt besonders auf nachhaltiger und moderner Infrastruktur. Die EU möchte ihr Engagement weltweit bündeln und strategisch aufstellen.
Doch bereits vor knapp einem Jahr räumte eine Sprecherin der EU, Ana Pisonera, ein: “Zu diesem Zeitpunkt verfügen wir nicht über eine Liste vordefinierter Global Gateway-Projekte. Wir treiben Projekte und Flaggschiffprogramme mit unseren Partnerländern im Rahmen von Global Gateway voran, die auf fortlaufender Basis vereinbart werden.” Daran hat sich bis heute wenig geändert. Aber das ist den Afrikanern zu wenig, vor allem angesichts des erhobenen Zeigefingers, den von der Leyen sich nicht verkneifen konnte. “Bei Global Gateway geht es darum, den Ländern eine Wahl zu geben, und zwar eine bessere Wahl”, meinte die EU-Präsidentin. Bei Investitionen aus anderen Ländern warnte sie vor dem Kleingedruckten, “verbunden mit einem sehr hohen Preis”. Doch die Angebote der Chinesen schlecht zu reden, reiche den Afrikanern längst nicht mehr, nicht zuletzt, weil die EU-Projekte “länger brauchen, bis sie zum Leben erwachen, es viel Bürokratie gibt und die Kontrolle über die Ausgaben streng ist”, schreibt die North Africa Post.
Die EU ist zudem viel zu zerstritten, wie der vor einigen Tagen stattgefundene EU-Nahost-Gipfel zeigte, der mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten hervorbrachte. Das weithin beschworene “Team Europe” kommt nur langsam in Fahrt. Während die Chinesen seit Jahren mit sichtbaren Bauprojekten, darunter Eisenbahnlinien und Seehäfen, in Afrika weltweit Aufmerksamkeit erregen, sind EU-Interventionen kaum sichtbar. Hinzu kommt: Die meisten der in Brüssel gefeierten Projekte sind nicht neu und existieren teilweise schon seit Jahren. Hierzu zählen Projekte für erneuerbaren Wasserstoff und nachhaltige Wertschöpfungsketten bei Rohstoffen in Namibia, grüne Energie, nachhaltigen Verkehr, digitale Konnektivität auf den Kapverdischen Inseln und frühkindliche Entwicklung in Ruanda. In Sambia sollen die Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe verbessert werden und an neue Verkehrskorridore, etwa den Lobito-Korridor, angebunden werden.
Immerhin gibt es seit März bei Global Gateway eine Liste mit 83 Leuchtturmprojekten, allerdings mit wenig Details. Die EU solle “auf ihre Prinzipien setzen”, findet Ulrich Ackermann vom Maschinenbauverband VDMA. Dazu gehöre “eine transparente und an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Ausschreibung der Projekte, eine Vorab-Berechnung der Rentabilität der Investitionen sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption.” Vor allem sollten “international anerkannte technische Standards gelten”.
Europäische Infrastruktur ist auch teuer, was die Afrikaner skeptisch macht. Europäische Unternehmen können mit der Konkurrenz aus China, Indien oder der Türkei preislich kaum mithalten, ohne dass die Qualität deutlich besser ist. Offiziell liegt bei Global Gateway der Schwerpunkt auf Klima und Infrastruktur. Eine Studie von Ende 2022 zeigt jedoch, worum es der EU wirklich geht: der Sicherung von Rohstoffen, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa wichtig sind. Hierzu haben die Forscher in Afrika elf “strategische Transportkorridore” für den Kontinent identifiziert: “Die EU-Afrika Strategischen Korridore sollen die Stärkung und Schaffung von Wertschöpfungsketten und territorialer Organisation unterstützen und sowohl ländliche als auch städtische Gebiete umfassen.”

Das klingt sinnvoll, fehlt bisher in Afrika und ist daher auch willkommen. Doch tatsächlich möchten die Europäer genau das, was sie seit Jahren China vorwerfen: sich strategischen Zugang zu afrikanischen Rohstoffen schaffen. Und dafür braucht es Infrastruktur. Die EU steht unter Druck, weil sie bei Rohstoffen für Hightech sehr abhängig von den Chinesen ist, die sich diese seit Jahrzehnten systematisch sichern.
Afrika hingegen braucht Infrastruktur für das Wirtschaftswachstum. Nach Schätzungen der African Development Bank fehlen auf dem Kontinent dazu jährlich bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Sowohl die Agenda 2063 der Afrikanischen Union als auch die kürzlich ins Leben gerufene Afrikanische Freihandelszone setzen sich für Infrastrukturentwicklung ein. Die G7-Staaten betreiben seit einigen Jahren die wenig erfolgreiche Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), die Infrastrukturprojekte in den Ländern des Globalen Südens finanzieren soll und auch von Global Gateway unterstützt wird.
Die elf von der EU identifizierten Wirtschaftskorridore befinden sich zum Großteil im östlichen und westlichen Afrika. Aber auch im südlichen Afrika sollen sie zum Beispiel Walvis Bay in Namibia mit Maputo in Mosambik verbinden, seit Jahren als Transkalahari-Korridor bekannt, der vor allem im Osten für den Abtransport von Kohle benutzt wird. Wichtiger noch ist der Durban-Lusaka-Korridor, der das bedeutendste Kupferbergbaugebiet des Kontinents an den wichtigsten Hafen anschließt. Der Copperbelt im sambisch-kongolesischen Grenzgebiet ist das größte Industriegebiet in Subsahara-Afrika außerhalb von Südafrika. Aus EU-Botschaftskreisen in Pretoria ist zu hören, dass Gespräche über diesen Wirtschaftskorridor, auf dem auch Johannesburg und Pretoria liegen, bereits geführt werden. Immerhin.
Das Gebäude ist unscheinbar, nichts Spektakuläres, ein paar gepflegte flache Hütten mitten in der Millionen-Metropole Lagos. Eingeklemmt zwischen Baustellen, Märkten, einer Kaserne. Und das in einer Stadt, die zu den größten der Welt zählt. Man muss den Ort hier schon sehr entschlossen suchen, um ihn auch zu finden.
Heute ist der deutsche Kanzler hier zu Gast. Das Zentrum für Migration, Re-Integration und Entwicklung, so klein es ist, kümmert sich um ein für Deutschland großes Thema. In der Sache und in der politischen Bedeutung. Olaf Scholz spricht hier mit Menschen, die als Flüchtlinge in Deutschland abgelehnt wurden, mühsam zurückkehrten und an diesem kleinen Ort, gesponsert und organisiert auch durch die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ, Hilfe und Ausbildung bekommen. Das Ziel: sie befähigen, sich in Nigeria wieder einzugliedern.
Das klingt schön – und ist gekoppelt mit dem großen Thema, wie Deutschland all jene wieder zurückschicken kann, die in Deutschland kein Asyl bekommen haben. Scholz hat da zuletzt einen schärferen Ton angeschlagen. Die hohe Zahl an zu versorgenden Flüchtlingen in Deutschland hat das politische Klima verändert, die gegen Flüchtlinge agitierende AfD gestärkt und jetzt für eine Dringlichkeit gesorgt, das Problem neu anzugehen.
Auf der dreitägigen Afrika-Reise ist dem Kanzler anzumerken, wie sehr ihm das Thema mittlerweile auf den Nägeln brennt. Jahrelange Streitereien in Europa, mit Brüssel und in Deutschland haben ihm offenbar vor Augen geführt, dass er selbst zum Antreiber werden muss.
In Lagos immerhin sieht die Sache lösbar aus. Scholz kann hinter verschlossenen Türen mit einigen sprechen, denen die Rückkehr gelungen ist. Ein Schritt allerdings, der auch mit Scham behaftet sein kann. Immerhin haben sie ihr ursprüngliches Ziel nicht erreicht: ein Leben in Europa. Für Scholz aber steht im Vordergrund, dass es möglich ist: Ablehnen, wenn kein Asylgrund vorhanden ist, dann nach Hause schicken – und dort wieder integrieren. Aus Sicht des Kanzlers eine gute Geschichte. “Ermutigend” nennt er diese Geschichten.
Allerdings muss man festhalten, dass das Zentrum seit 2018 gerade gut 4000 solcher Schicksale positiv befördern konnte. Zuhause in Deutschland sind derzeit gut 13.500 Menschen registriert, die als abgelehnte Asylbewerber aus Nigeria keine Aufenthaltsgenehmigung mehr haben und doch noch da sind. Ein Großteil von ihnen (ca. 12.500) haben keine gültigen Papiere, und Nigeria nimmt sie aus diesem Grund bislang nicht auf.
Am Sonntag hat Präsident Bola Ahmed Tinubu zwar zugesagt, dass man hier kooperationsbereit sei, “wenn das wirklich unsere Leute sind” und “wenn sie sich gut benommen haben”. Um das aber überprüfen zu können, bräuchte Berlin ständig einen nigerianischen Beamten in Deutschland – was bisher nicht passiert ist. Wenn es also konkret wird, wird’s schwierig. Scholz hat sich gleichwohl vorgenommen, an der Stelle sehr hartnäckig zu bleiben. In Lagos sagt er, in seinem Gespräch mit dem Präsidenten seien beide “sehr klar” gewesen. Deshalb gehe er davon aus, dass das jetzt klappt.
Dabei weiß er, dass sich durch die politische Großwetterlage die Verhältnisse massiv geändert haben. Mit Forderungen allein erreicht er nichts mehr. Dem Partner muss schon auch was geboten werden.
Das heißt: Deutschland muss und will Fachkräfte anwerben. Doch was leicht klingt, ist alles andere als einfach: Wer soll das in einem Land wie Nigeria organisieren? Hier kommt wieder das Migrationszentrum in Lagos ins Spiel. Wenn es nach dem Willen des Kanzlers geht, sollen hier künftig nicht nur Menschen zurückkehren, sondern sich von hier aus auch auf den Weg machen. Aus einer Tür sollen zwei werden, so lautet die Hoffnung.
Allein: Die Details sind noch nicht geklärt, nur der Wille ist mittlerweile eindeutig. In Deutschland, aber auch in Nigeria. Präsident Bola Ahmed Tinubu sagte am Montag, in seinem Land gebe es 15 Millionen junge Menschen, die auf der Stelle bereit seien, mit Ausbildung etwas Neues zu beginnen. Aus diesem großen Kreis einen Pool auszusuchen und für sie die richtigen, also legalen Wege zu schaffen, wird eine Mammutaufgabe.
Zumal sich dabei zeigt, wie sehr auf dem Weg dorthin alte Begrifflichkeiten und Strukturen im Weg stehen. Das fängt bei Wörtern wie Sicheres Herkunftsland, Sicherer Drittstaat, Rückführungsabkommen und Migrationsabkommen an. Sie alle schwirren nach wie vor durch die Debatten und Pläne, ob nun in Berlin oder Brüssel. Auf Scholzens Reise wird klar, dass der Kanzler beim Beispiel Nigeria abwarten möchte, was Brüssel mit dem Land gerade verhandelt. Wie es heißt, seien die Gespräche kurz vor dem Abschluss.
Allerdings hat das ganze einen Haken: Während Deutschland Nigeria direkt anbieten kann, in einem Abkommen Zuwanderung und Rücknahme gleichzeitig zu regeln, damit es erkennbar auf beiden Seiten Gewinner gibt, muss sich die EU auf Verhandlungen über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber beschränken. Das ist, noch dazu in der veränderten politischen Stimmungslage mit selbstbewussten afrikanischen Staaten, schwerer geworden – und kann höchstens mit Zugeständnissen an anderer Stelle gekoppelt werden – seien es Geldzahlungen, Hilfen für den jeweiligen Grenzschutz oder ähnliches.
Aus diesem Grund wächst in Berlin die Sorge, dass die EU-Verhandlungen zwar bald abgeschlossen werden, aber das Ergebnis beim Thema Rückführung und Abschiebung nicht hart genug ausfällt. Was dann aus Sicht der Regierung nur heißen kann, weitere Verhandlungen zu führen. Der Kanzler nämlich weiß, dass er was liefern muss. So, wie es derzeit ist, kann es auch aus seiner Perspektive nicht mehr bleiben.
Bitter dabei: Noch gibt es Widersprüche, auch im eigenen Handeln. So ist in Lagos zu erfahren, dass sich das Migrationszentrum aktuell nicht mehr um Rückkehrer kümmert, weil es dafür formal nicht mehr zuständig ist. Das Zentrum als Projekt der GIZ untersteht dem BMZ, aber seit Beginn dieser Legislatur untersteht die Politik rund um die Rückkehrer dem Bundesinnenministerium.
Außerdem sind die Mittel ausgerechnet jetzt um mehr als die Hälfte gekürzt worden. Das, so steht zu vermuten, müsste sich wieder ändern, will man an der Stelle Erfolg haben. Bislang ist das kleine Migrationszentrum in der Riesenstadt Lagos ein Hoffnungsschimmer, eine Idee, eine Blaupause für die Zukunft. Mehr aber auch nicht.
Achim Becker, INZAG Germany GmbH, Geschäftsführer
Carl Heinrich Bruhn, CHB Investment Holding GmbH, Geschäftsführer
Sabine Dall’Omo, Siemens AG, Geschäftsführerin für Subsahara-Afrika, Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V.
Oliver Haeggberg, GeoScan GmbH, Geschäftsführer
Tim Oliver Holt, Siemens Energy AG, Mitglied des Vorstands
Miguel López, Thyssen Krupp AG, Vorstandsvorsitzender
Tobias Meyer, DHL Group, Vorstandsvorsitzender
Günther Mull, DERMALOG Identification Systems GmbH, Geschäftsführer
Nicolas Rohrer, Asantys Systems GmbH, Eigentümer und Geschäftsführer
Ralf Wintergerst, Giesecke+Devrient GmbH, Vorstandsvorsitzender
Rasmus Woermann, C. Woermann GmbH & Co. KG, Geschäftsführender Gesellschafter
Hamed Beheshti, Boreal Light GmbH, Geschäftsführer
Heike Bergmann,Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, Senior Vice President
Martina Biene, Volkswagen Group South Africa, Vorsitzende der Geschäftsführung
Johannes Frühauf, SSF Ingenieure AG, Director International
Hakan Gürdal, Heidelberg Materials AG, Mitglied des Vorstands
Susanne Haus, Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Präsidentin
Kazuyuki Marukawa, Taniobis GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung
Chiara-Felicitas Otto, Exficon GmbH, Geschäftsführerin
Armando Koerig Gessinger, Wingcopter GmbH, Chief Sales Officer
Klaus Richter, Inros Lackner SE, Geschäftsführender Direktor
Neset Tükenmez, Aerodata AG, Vorstandsvorsitzender
Seit geraumer Zeit sind internationale Flüge von und nach Afrika wieder voll besetzt und es sind viele Geschäftsleute, die sich in den Maschinen befinden. Gleichzeitig schießen Hotelbuchungen wieder nach oben. Laut World Travel and Tourism Council hat 2022 der Reise- und Tourismussektor 7,6 Prozent zum globalen BIP beigetragen, ein Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und nur 23 Prozent unter dem Jahr 2019. Auch das zeigt die wichtige Stellung von Geschäftsreisen, vor allem in Afrika. “Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Anerkennung des Potenzials Afrikas als Drehscheibe für internationale Konferenzen, Tagungen und Firmenveranstaltungen wider”, sagt Devi Paulsen-Abbott, Chair der Association of African Exhibition Organizers.
So schätzt der World Travel and Tourism Council in einer neuen Studie, dass weltweit der Anteil von Geschäftsreisen bei den Besuchern besonders in afrikanischen Metropolen stark zulegen wird. Die Studie berechnet die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahr 2032. Unter den ersten fünf Städten sind allein drei aus Afrika, mit der nigerianischen Metropole Lagos an erster Stelle, gefolgt von Kapstadt, Riad, Johannesburg und Singapur. Als erste europäische Stadt befindet sich Amsterdam auf Platz sechs.
Metropolen in Afrika haben jüngst vor allem in Infrastruktur investiert, darunter in moderne Flughäfen, Konferenzzentren und Top-Hotels. Diese neuen Einrichtungen erlauben es, große Tagungen und Ausstellungen zu organisieren, wie etwa beim 15. Brics-Gipfel in Johannesburg oder beim ersten Afrika-Klimagipfel in Nairobi, wo jeweils mehrere Tausend Delegierte teilnahmen. Auch haben viele globale Airlines ihre Netzwerke ausgebaut und Flüge nach Afrika aufgestockt, darunter die beiden Branchengrößen aus dem Nahen Osten, Qatar Airways und Emirates.
Emirates fliegt Kenia 24-mal die Woche an, nach Südafrika (Johannesburg, Kapstadt und Durban) sind es sogar 42 Flüge. Die Emirates-Hubs in Nairobi und Johannesburg stellen bequeme Verbindungen zu kleineren Destinationen her. Trotz der Krise in der Sahelzone gilt Afrika zudem als politisch stabiler, was sich auch positiv auf das Ausrichten von Business Events auswirkt, sowohl bei Organisatoren als auch Teilnehmern. Mit dem Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern wollen viele Unternehmen in Afrika investieren, was auch Geschäftsreisen fördert.
Nairobi wurde viermal hintereinander als Africas Leading Business Travel Destination der World Travel Awards ausgezeichnet. Zu den Nominierungen standen neben der kenianischen Hauptstadt auch Accra, Durban, Johannesburg, Kairo, Kapstadt, Kigali, Lagos und Pretoria zur Wahl. In Südafrika, führende Wirtschaftsmacht auf dem Kontinent, gibt es neue Trends bei Geschäftsreisen, die auch in anderen Ländern zu beobachten sind. Demnach versuchen Geschäftsleute länger an ihren Zielorten zu bleiben und bringen dort mehr Termine unter. Flüge werden zunehmend bei Premium-Fluglinien gebucht und vor Ort werden luxuriösere Hotels gebucht.
Angesichts der steigenden Reisekosten müssen Geschäftsleute jedoch effizienter unterwegs sein. Bonnie Smith, General Manager von Corporate Traveller, hat erkannt, dass “Geschäftsreisende seltener verreisen, aber mehr Geld ausgeben.” Branchenexperten gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt und Afrika auf dem besten Weg ist, ein erstklassiges Ziel für internationale Geschäftsveranstaltungen zu werden. Regierungen und Tourismusbehörden auf dem gesamten Kontinent erkennen das Potenzial des Geschäftstourismus und arbeiten aktiv daran, mehr Kongresse anzuziehen.
Hotelketten bereiten sich bereits auf den möglichen Ansturm vor. Laut einer Studie der W-Hospitality Group wurden 2023 gegenüber dem Vorjahr in Afrika 27 Prozent mehr Hotelbetten gesichert, damit die am zweitschnellsten wachsende Region weltweit. Der Bedarf an mehr Kapazität wurde vor allem durch große Konferenzen angetrieben.
Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat ein neues ökonomisches Beratungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklungspolitik gegründet, das in der vergangenen Woche erstmals zusammengetroffen ist. Das Netzwerk soll für die Entwicklungspolitik relevante ökonomische Fragestellungen identifizieren und Empfehlungen für die strategische Ausrichtung des BMZ erarbeiten. Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Empfehlungen sollen künftig gezielter in entwicklungspolitische Prozesse einfließen. Zu den wichtigsten Themen des Netzwerks zählen die sozial-ökologische Wirtschaftstransformation, die Krisenbewältigung sowie die wachsende Ungleichheit, wie eine BMZ-Sprecherin auf Table.Media-Anfrage erklärte.
In dem Netzwerk kommen künftig zehn Ökonomen sowie themenbezogen verschiedene Experten aus dem globalen Süden zusammen. Es ist geplant, eine Sitzung des Netzwerks pro Halbjahr zu veranstalten.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Beratungsnetzwerks sind:
Zudem wirken auch Vorstandsmitglieder von GIZ (Anna Sophie Herken und Ingrid-Gabriela Hoven) sowie KfW (Christiane Laibach) im Netzwerk mit. ajs
Am 14. November wird im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin eine neu gegründete Wirtschaftsinitiative mit Fokus auf Afrika vorgestellt. Die Initiative mit dem Namen Rethinking Africa (RTA) fordert eine Neujustierung der Handelsbeziehungen mit dem Nachbarkontinent. Über die direkte Vernetzung von afrikanischen und europäischen Wirtschaftspartnern soll den Akteuren der Zugang zu Kapital erleichtert werden. Über gesteigerte Wertschätzung vor Ort sollen in Afrika nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die politische Stabilität in den betreffenden Ländern.
An der Initiative beteiligt sind unter anderem der Unternehmer Holger Bingmann, der bis 2020 Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) war und nun RTA-Geschäftsführer ist, sowie Stefan Liebing, Unternehmensberater und bis zum Frühjahr Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Auch der einstige parlamentarische Staatssekretär im BMZ Norbert Barthle (CDU) und die ehemalige Außenministerin Malis, Kamissa Camara, unterstützen die Initiative.
Rethinking Africa ist nach der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (Safri), dem Afrika-Verein, Africa First des Münchner Unternehmers Martin Schoeller sowie Africa Connect des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft bereits die fünfte deutsche Wirtschaftsinitiative in Richtung Afrika. ajs
Nigeria muss keine Entschädigung an die Rohstoffgesellschaft P&ID zahlen. Dies entschied ein Londoner Gericht in der vergangenen Woche in dem seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem westafrikanischen Land und dem Konzern mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Die Forderung von 11 Milliarden US-Dollar hatte auch ein Risiko für die nigerianische Wirtschaft dargestellt, denn der Betrag entspricht immerhin einem Drittel der nigerianischen Devisenreserven.
P&ID hatte 2017 erfolgreich gegen Nigeria geklagt und Schadensersatz in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen. Nigeria hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt mit der Begründung, P&ID habe sich den betreffenden Erdgas-Auftrag durch Korruption erschlichen und niemals die Absicht gehabt, den Auftrag zu erfüllen. Nun hat ein Gericht zugunsten der Regierung entschieden: P&ID hat keinen Anspruch auf die Entschädigungszahlung, die inzwischen mit Zinsen auf 11 Milliarden Dollar gestiegen war.
Helen Taylor, leitende Rechtsforscherin bei der Anti-Korruptionsgruppe Spotlight on Corruption, sagte der Financial Times: “Die Bedeutung des heutigen Urteils für das nigerianische Volk kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die wirtschaftlichen Aussichten eines ganzen Landes waren durch einen fehlerhaften Schiedsspruch für ein Gasprojekt, das auf Bestechung und Lügen aufgebaut war, in Geiselhaft genommen worden.”
P&ID kann noch Berufung gegen das Urteil einlegen. ajs
Die Bürgerkriegsparteien im Sudan haben nach vier Monaten Unterbrechung wieder Gespräche über einen Waffenstillstand aufgenommen. Das teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit. Die Gespräche seien unter Vermittlung der USA, Saudi-Arabiens, und der ostafrikanischen Regionalorganisation Intergovernmental Authority on Development (IGAD) gemeinsam mit der Afrikanischen Union arrangiert worden.
Die wiederaufgenommenen Gespräche sollen auch die Lieferung humanitärer Hilfe erleichtern und dauerhafte Friedensverhandlungen auf den Weg bringen, sagte Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums.
Vergangene Woche hatten die RSF noch die strategisch wichtige Stadt Nyala eingenommen, wie beide Kriegsparteien bestätigten. Die von Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, geführten Rapid Support Forces und die Armee unter dem Kommando von Abdel Fattah al-Burhan bekämpfen sich seit April dieses Jahres. Rund sechs Millionen Menschen wurden seitdem vertrieben, Tausende getötet.
Die USA und Saudi-Arabien vermitteln in dem Konflikt, hatten die Gespräche jedoch im Juni ausgesetzt, nachdem ausgehandelte Feuerpausen mehrfach verletzt wurden. Im Mai hatte die Militärjunta den deutschen UN-Sondergesandten in Khartum, Volker Perthes, zur unerwünschten Person erklärt. Perthes wurde jetzt von UN-Generalsekretär António Guterres mit der Erarbeitung des Strategic Review der Irak-Mission beauftragt. bub

Die Rolle Afrikas in einem geopolitisch und geoökonomisch relevanteren Kontext ist beachtlich. Das Umfeld für globale Kooperationsanstrengungen ist deutlich schwieriger geworden. Akteure im Globalen Süden und nicht zuletzt auf dem afrikanischen Kontinent sind in geopolitischen Konflikten nicht mehr nur Teilnehmende am Rande, sondern sehr viel stärker Gestalter. Sie formulieren eigene Forderungen und sind zugleich umworben durch westliche Länder, China und Russland.
Die erfolgreichen Militärputsche im Niger, Gabun, in Mali und Burkina Faso stellen für die dortigen Bevölkerungen eine einschneidende Kehrtwende in den vergangenen Wochen bzw. Jahren dar. Relevante afrikanische Akteure wie die AU und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben das illegitime Vorgehen gegen demokratisch gewählte Regierungen verurteilt. Aus europäischer Sicht bedeuten die Umstürze ebenfalls einen massiven Rückschritt. Die Putsche dürften insgesamt mit deutlich mehr Instabilität und destruktivem Wettbewerb externer Akteure auf dem afrikanischen Kontinent verbunden sein.
Ehemalige Kolonien Frankreichs sind von diesem Trend der Instabilität besonders betroffen. Die postkoloniale Politik Frankreichs zur Zementierung ungleicher Beziehungen hat über Jahrzehnte eine solche Eskalation der Verhältnisse mit ermöglicht. Andere europäische Partner und die EU haben sich hiervon nicht ausreichend abgesetzt. Dies ist in Teilen einer unzureichenden eigenständigen Strategiefähigkeit zu afrikabezogenen Themen (einschließlich der Expertise aus den Ländern / aus der Region) geschuldet. Dies gilt für die Entwicklungspolitik, aber ebenso für die Außen- und Sicherheitspolitik und andere Politikfelder.
Entwicklungspolitik ist nicht das einzige Instrument zur Ausgestaltung der Beziehungen mit Partnern auf dem afrikanischen Kontinent. Gleichwohl ist das Politikfeld weiterhin einerseits ein Ausweis internationaler Glaubwürdigkeit (beispielsweise bei der Frage: Erfüllen OECD-Länder die von ihnen gemachten entwicklungspolitischen Zusagen?) und andererseits ein Ansatz, mit dem überhaupt an internationalen Problemen konkret gearbeitet werden kann. Entwicklungspolitik ist in der Lage, mit handfesten Maßnahmen die Bekämpfung von lokalen oder auch globalen Problemen anzugehen, sei es, Gesundheitsversorgung dort zu verbessern, wo schwache Gesundheitssysteme bestehen (wie etwa Ebola zu begegnen) oder die Transformation zugunsten erneuerbarer Energien zu unterstützen und zu beschleunigen.
Instrumente der Entwicklungspolitik sind stark vergünstigte öffentliche Mittel oder Zuschüsse, die dort eingesetzt werden können, wo andere Ressourcen (etwa Zugang zu internationalen Kapitalmärkten zu vertretbaren Konditionen) nicht zur Verfügung stehen oder sich als nicht profitabel genug erweisen. Auch mit großen und wirtschaftlich relativ starken Entwicklungsländern bieten sich Gestaltungsmöglichkeiten über die Entwicklungspolitik, wie das Beispiel Südafrika zeigt. Falsch wäre es, entwicklungspolitische Gestaltungsmöglichkeiten Deutschlands, der EU und der gesamten OECD zu unter- oder auch zu überschätzen. Entwicklungspolitik kann genauso wenig Garantien für Kooperationsziele (etwa Stabilisierung von Ländern oder Regionen) geben wie andere Politikfelder. Gleichwohl zeigt gerade China, wie stark die Ausstrahlung von Entwicklungsinitiativen sein kann.
China wird in dieser Hinsicht für viele Entwicklungsländer – von Tansania bis Südafrika – weiter eine enorm wichtige Rolle spielen. Russland hat bei öffentlichen und privaten Entwicklungsinvestitionen wenig vorzuweisen; dies zeigte sich letztlich auch beim zweiten russisch-afrikanischen Gipfel in St. Petersburg im Juli 2023. Russland setzt vor allem destruktives Vorgehen als spoiler ein – Militärkooperationen (von Waffenlieferungen bis hin zum Einsatz der Wagner-Söldner) sowie Instrumentalisierung von Nahrungsmitteln und Dünger.
All dies zeigt, dass deutsche und europäische Entwicklungspolitik grundsätzlich über ein relevantes Potential verfügt, um an der Neuausrichtung der Beziehungen mit afrikanischen Partnern mitzuwirken. Europa sollte noch sehr viel stärker Teil einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dynamik auf dem afrikanischen Kontinent sein – Entwicklungspolitik ist dabei ein zentrales Element.
Prof. Stephan Klingebiel ist Forschungsprogrammleiter am German Institute of Development and Sustainability (IDOS) in Bonn. Zugleich ist er Gastprofessor an der Ewha Womans University in Seoul und an der Universität Turin. Von 2007 bis 2011 hat er das Büro der KfW-Entwicklungsbank in Ruanda geleitet.
New York Times: Die Welt wird afrikanischer. Im Jahr 2050 wird jeder vierte Mensch auf der Erde Afrikaner sein – ein Wandel, der sich bereits jetzt abzeichnet: in der Musik, die die Welt hört, in Filmen, in der Mode und in der Politik. Er zeigt sich an den Wellen junger Menschen, die alles riskieren, um auszuwandern, und an den Dilemmata derjenigen, die bleiben. Im ersten Teil einer Serie über Afrikas Heranwachsende untersucht die Zeitung, wie die Jugend nicht nur den Kontinent verändert.
The Economist: Senegals Präsident fragt, ob Demokratie in Afrikas “Putschgürtel” funktionieren kann. Im Gespräch mit der britischen Wochenzeitung wirft Macky Sall die Frage auf, ob Demokratie nach westlichen Vorstellungen das richtige Rezept für die fragile Sahelzone sein kann. Seine Kritik: Die wirkliche Macht in der Region werde oft nicht von gewählten Vertretern ausgeübt, und die Konzentration auf Wahlen habe nicht zu Stabilität geführt.
Al Jazeera: Demokratie in Afrika ist keine westliche Zumutung. Ruandas Präsident Kagame und Guineas Militärmachthaber Doumbouya seien nicht ehrlich, wenn sie die Demokratie als eine Zumutung bezeichnen, schreibt der Kolumnist Tafi Mhaka. Die Afrikaner liebten die Demokratie und wollten, dass sie funktioniert.
Addis Standard: Gespräche über Nilstaudamm ohne Ergebnis beendet. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Äthiopien, Sudan und Ägypten über den Grand Ethiopian Renaissance Dam ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die jüngsten Verhandlungen sind Teil der seit mehr als zehn Jahren andauernden Gespräche zwischen den drei Ländern des Nilbeckens über den Staudamm. Die nächste Gesprächsrunde wird im Dezember in Addis Abeba stattfinden.
Mail & Guardian: Südafrika will bei AGOA-Forum Handel mit USA intensivieren. Der US-amerikanische African Growth and Opportunity Act (AGOA), der afrikanischen Ländern präferentiellen Handelszugang zum amerikanischen Markt ermöglicht, soll 2025 auslaufen. Beim Johannesburger AGOA-Forum in dieser Woche werben die afrikanischen Staaten um eine Verlängerung um weitere zehn Jahre.
Bloomberg: Südafrikas Regierungspartei ANC verliert Unterstützung. Laut neuen Umfrageergebnissen unterstützen nur noch 45 Prozent der Südafrikaner den ANC. Seit dem Ende der Apartheid regiert die Partei mit absoluter Mehrheit. Nun droht ihr Verlust bei den Wahlen im nächsten Jahr. Anhaltende Korruptionsskandale und ein Jahr mit den schlimmsten Stromausfällen aller Zeiten haben die Unterstützung der Regierung untergraben.
Reuters: Namibia stoppt Lithiumexporte eines chinesischen Unternehmens. Die namibische Regierung hat die Polizei angewiesen, Xinfeng Investments daran zu hindern, Lithiumerz innerhalb des Landes zu transportieren und zu exportieren. Namibia wirft dem chinesischen Bergbauunternehmen vor, gegen das Ausfuhrverbot für kritische Mineralien zu verstoßen.
Semafor: Kenianische Unternehmen verzichten auf M-Pesa. Kleine Unternehmen in Kenia lehnen zunehmend Zahlungen mit mobilem Geld zugunsten von Bargeld ab, um aggressiven Maßnahmen zur Einhaltung der Steuervorschriften zu entgehen. Die Regierung von Präsident William Ruto will die Steuereinnahmen erhöhen und hat zu diesem Zweck 1.400 paramilitärisch ausgebildete Beamte der kenianischen Steuerbehörde im ganzen Land eingesetzt.
All Africa: Ruanda bei Rechtsstaatlichkeit an der Spitze Afrikas. In dem vom World Justice Project veröffentlichten Rule of Law Index nimmt Ruanda zum dritten Mal den Spitzenplatz unter den Nationen Subsahara-Afrikas ein, gefolgt von Namibia und Mauritius. Südafrika schafft es nur auf Platz fünf.

Als Siya Kolisi den Webb Ellis Cup, die Siegestrophäe der Rugby-Weltmeisterschaft, für sein Team am Abend des 28. Oktober in den kalten und regnerischen Nachthimmel von Paris hob, stand der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa an seiner Seite. Ramaphosa jubelte als Nächster mit dem Pokal in den Händen. Auch er trug wie sein Team ein grünes Nationalshirt, fiel jedoch mit einem Schal auf, der bunt in den Farben Südafrikas leuchtete. “South Africa, World Champion”, schallte es durch das Stadion.
Gerade hatte Südafrikas Rugby-Team, die Springboks, die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal hintereinander gewonnen, 2019 und jetzt, beide Male angeführt von Siya Kolisi. Nicht nur führte der 32 Jahre alte, großgewachsene Captain sein Team erfolgreich zum Sieg über die All Blacks aus Neuseeland, er sieht auch wie kein anderer die Verbindung zwischen dem Team, Südafrika und dessen Bewohnern. “Menschen, die nicht aus Südafrika kommen, verstehen nicht, was das für unser Land bedeutet. Es geht nicht nur um das Spiel. Unser Land macht so viel durch”, meint Kolisi kurz nach dem Spiel. Mit vier Titeln ist Südafrika jetzt Rekordweltmeister, und Kolisi erst der zweite Rugby-Spieler überhaupt, der als Captain den Weltmeistertitel erfolgreich verteidigte.
Siya Kolisi hat das Feingefühl, Dinge im Kontext zu sehen, ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. Nach dem gewonnenen Finale zeigte er Respekt vor dem Gegner Neuseeland: “Sie haben uns unter so viel Druck gesetzt.” Dann erst kam das Lob für die eigenen Spieler, auf die er stolz sei. Das Spiel wurde mit einem Punkt gewonnen, denkbar knapp im Rugby, genauso wie das Halbfinale gegen England und das Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich. “Ihr Umgang mit Widrigkeiten zeichnet sie aus”, schrieb die Zeitung Daily Maverick über die Springboks – und meinte auch vor allem Captain Kolisi.
Kolisi kommt, wie viele seiner Mitspieler, aus ärmlichen Verhältnissen, was ihn sehr geprägt hat. Seine Mutter war erst 16 Jahre alt, als er 1991 auf die Welt kam. Sein Vater war gerade erst mit der Schule fertig. Nelson Mandela war erst ein gutes Jahr zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Südafrikas Apartheid befand sich in den Endzügen, und in diesen unruhigen Zeiten ging es dem Großteil der Bevölkerung wirtschaftlich schlecht. Damals repräsentierte das grüne Rugby-Nationaltrikot eine Welt, die Weißen vorbehalten war.
Kolisi hingegen wuchs im schwarzen Zwide-Township, einem der größten im Land, am Rande der Hafenstadt Port Elizabeth in der Provinz Eastern Cape, auf. Es war eine Kindheit der Entbehrungen, bei der Hunger auf der Tagesordnung stand. Gewalt war ebenfalls allgegenwärtig. Jungen wie er schnüffelten Benzin und dealten mit Drogen. Als Kolisi zehn Jahre alt war, starb seine Großmutter, die ihn praktisch großgezogen hatte. Ein harter Schlag.
Rugby wurde zu Kolisis Flucht aus dem Elend, sowohl mental als auch physisch. Im Alter von zwölf Jahren fiel er bei einem Turnier auf, was ihm ein Stipendium in der exklusiven Grey High School einbrachte. Drei Jahre später starb seine Mutter. Doch Kolisi ließ sich nicht unterkriegen. Zunächst musste er Englisch lernen und suchte dann den Erfolg als Rugby-Spieler, den er schließlich in der Provinz Westkap fand. Es hätte auch eine Karriere als Gangster im Township werden können. Stattdessen gelang ihm der Aufstieg aus der Armut zum nationalen Superstar.
Der erste Einsatz für die Springboks kam 2013, im Alter von 22 Jahren. Und auf Anhieb wurde er Man of the Match. Zwei Jahre später spielte er seine erste Weltmeisterschaft. Fünf Jahre später wurde er erster schwarzer Kapitän des Nationalteams, ein Novum in der 126 Jahre währenden Rugby-Geschichte des Landes. Diesen Aufstieg entgegen allen Widrigkeiten beschrieb Kolisis Biografie “Against All Odds“, die 2019 pünktlich zur Rugby-WM in Japan veröffentlicht wurde. Die Springboks krönten das Turnier mit ihrem dritten Weltmeistertitel. Bei der WM 1995, die Südafrika gewann, hatten erstmals Schwarze im Team gespielt, und der damalige Präsident Nelson Mandela sah die Springboks als Beispiel nationaler Versöhnung.
Für Kolisi lief es allerdings nicht immer so gradlinig. Nicht selten während seiner aktiven Karriere flüchtete er sich in Alkohol, wenn Dinge nicht so liefen, wie er es wollte, und er verbrachte viel Zeit in Nachtclubs. Erst seine Frau Rachel, die er 2016 heiratete und mit der er zwei Kinder hat, erinnerte Kolisi daran, dass er ein Vorbild sei und sich dementsprechend benehmen sollte. Der Rugby-Spieler wurde gläubiger Katholik. Während der Covid-Pandemie gründete er die Kolisi Foundation, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Viele seiner Mitspieler machen es ähnlich, und versuchen zu helfen, wo sie können.
Klub-Rugby spielt Kolisi jetzt bei Racing 92 in Nanterre, einem Vorort von Paris. Noch Anfang 2023 litt er an einer schweren Knieverletzung. Doch er schaffte es, rechtzeitig für die Weltmeisterschaft wieder fit zu werden. Und im Kollektiv stellte sich der Erfolg ein: “Sobald wir zusammenarbeiten, ist alles möglich, gleichgültig in welchem Bereich – auf dem Spielfeld, in den Büros, zeigt sich, was wir können. Ich bin diesem Team dankbar, ich bin so stolz darauf”, meinte Kolisi nach dem WM-Triumph. Andreas Sieren
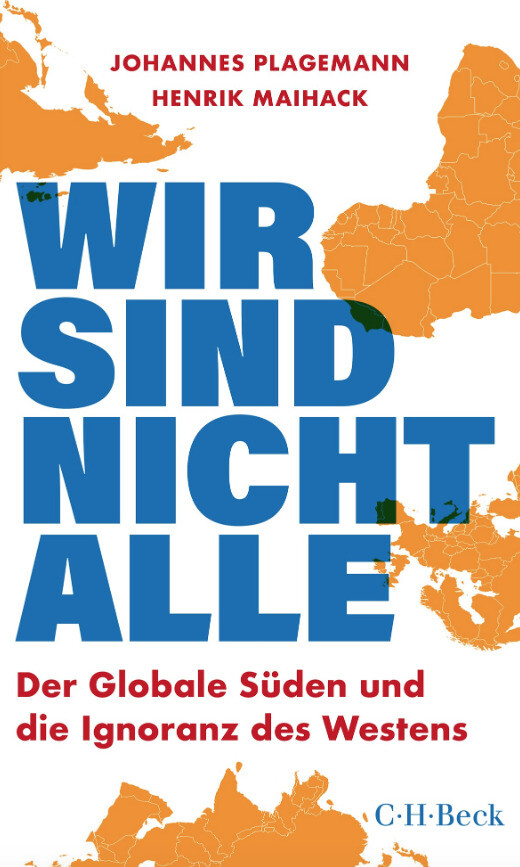
Die Beziehungen zwischen Europa, Nordamerika und dem Rest der Welt beschäftigt zurzeit einige Autoren. Die Politikwissenschaftler Henrik Maihack und Johannes Plagemann haben nun ihre Sicht vorgelegt. Maihack leitet bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung das Ressort Afrika. Plagemann arbeitete 2015 und 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, als der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Außenministerium leitete. Heute arbeitet Plagemann beim Thinktank German Institute for Global and Area Studies (Giga).
Kenntnisreich führen die beiden Autoren durch die Veränderungen, die die Beziehungen zwischen Europa und USA – im Buch als “der Westen” bezeichnet – und den aufstrebenden Staaten in Asien und Afrika verändern. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass wir uns in einer multipolaren Welt befinden und dass diese dem Westen nicht nur Nachteile bringt. Allerdings muss der Westen bei allem Wunsch nach Demokratisierung anerkennen, dass viele Staaten in diversen Formen von Autokratien regiert werden. Die beiden Autoren gehen sehr analytisch vor und erliegen nicht der Versuchung, in der einen oder anderen Richtung leichten Thesen zu folgen. Am Ende steht ein moderates Plädoyer für ein stärkeres Miteinander.
Der Sinn des Titels “Wir sind nicht alle” erschließt sich allerdings auch nach der Lektüre nicht. Zunächst kam in den Sinn, dass damit gemeint sein könnte, wir seien noch nicht erledigt. Wahrscheinlich soll der Titel jedoch ausdrücken, dass wir im Westen nicht mehr für die Welt sprechen können. Diese Aussage wäre jedoch für das Publikum, an das sich dieses Buch richtet, etwas zu offensichtlich. Das Buch bietet geopolitisch Interessierten jedenfalls viele interessante Gedanken. hlr
Johannes Plagemann, Henrik Maihack: Wir sind nicht alle. Der Globale Süden und die Ignoranz des Westen. Verlag C.H. Beck, München, September 2023, 249 Seiten, 18 Euro.
