schon die 50. Ausgabe. Im Januar dieses Jahres ist der Africa.Table gestartet, als wöchentliches Professional Briefing von Table.Media zu Politik, Wirtschaft und Unternehmen in Afrika. Doch auf dem Kontinent ist so viel geschehen, dass wir immer wieder Spezialausgaben veröffentlicht haben, sodass wir schon nach weniger als neun Monaten unsere Ausgabe Nummer 50 erreicht haben. Wenn Sie mit uns Ihre Einschätzung unserer Arbeit teilen wollen, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung, nehmen uns Ihre Kritik zu Herzen und freuen uns über Lob.
Im November wird in Berlin eine Konferenz zur Bewertung der G20-Initiative Compact with Africa stattfinden. Diese 2017 gegründete Initiative soll reformorientierte Staaten in Afrika darin unterstützen, private Investitionen anzuziehen und die dazu notwendigen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Wir ziehen schon jetzt ein erstes Fazit im Rahmen einer Diskussion, die wir gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft am morgigen Mittwoch, 11. Oktober um 8.30 Uhr veranstalten. Dabei diskutiere ich mit I.E. Gina Ama Blay, Botschafterin der Republik Ghana, S.E. Igor César, Botschafter der Republik Ruanda, Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Dr. Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG) im Table.Media-Café in Berlin. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Sie können noch digital dabei sein. Dazu müssen Sie sich nur hier anmelden.
Neben einer Analyse zum bisher Erreichten bei Compact with Africa bieten wir wieder spannende Berichte, Porträts, Standpunkte und einen Ausblick auf die Jahrestagung von IWF und Weltbank, die diese Woche in Marrakesch stattfindet.

Am 20. November findet in Berlin die G20 Compact with Africa-Chancellors’ Conference statt. Für den 16. November ist ein virtuelles Treffen der Africa Advisory Group angesetzt. Im Vorfeld dieser wichtigen Konferenz lädt Table.Media gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft in englischer Sprache zum Table.Live Briefing Africa Insight! X Africa.Table – What is the status quo and what are the expectations for the G20 Compact with Africa conference?
Sollten Sie sich für eine digitale Teilnahme an der Veranstaltung am Mittwoch, 11. Oktober von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr interessieren, können Sie sich heute noch hier anmelden. An der Diskussion nehmen teil: Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana), Igor César (Botschafter von Ruanda), Christoph Kannengießer (Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft), Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG).
Der G20 Compact with Africa (CwA) wurde 2017 unter der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Ziel ist, durch bessere Rahmenbedingungen mehr private Investitionen in diese Länder anzuziehen.
Zwölf Länder haben sich der Initiative bisher angeschlossen: Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ägypten, Äthiopien, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Auf der Website von Compact with Africa heißt es dazu: “Die CwA ist nachfrageorientiert und steht allen afrikanischen Ländern offen, die sich selbst für die Teilnahme an der Initiative entscheiden.” Bisher ist allerdings kein Land südlich des Äquators Compact with Africa beigetreten.
Die Weltbank wertet die Initiative als Erfolg. Die CwA-Länder verzeichneten eine stärkere wirtschaftliche Erholung als die afrikanischen Länder, die der Initiative nicht beigetreten sind. Allerdings könne dieser Erfolg nicht ausschließlich CwA zugeschrieben werden. “CwA-Länder, die aufgrund früherer Reformen historisch gesehen offener für Handel und ausländische Direktinvestitionen waren, profitierten überproportional von der starken Erholung nach der Pandemie”, heißt es im Compact Monitoring Report, den die Africa Advisory Group im Juni veröffentlicht hat. Den Bericht haben bei der Weltbank Vincent Palmade, Chefvolkswirt für Afrika, sowie die Volkswirtinnen Claudia Garcia Gonzalez und Nadege D. Yameogo verfasst.
Im vergangenen Jahr stieg das Wirtschaftswachstum der CwA-Länder von 4,9 auf 5,4 Prozent und sei damit doppelt so hoch ausgefallen wie das Wachstum der afrikanischen Länder, die nicht dem CwA beigetreten sind. Allerdings sind die beiden größten Volkswirtschaften Afrikas, Nigeria und Südafrika, stark von Rohstoffexporten abhängig, deren Preise in den vergangenen Jahren besonders volatil waren.
Die Ankündigungen ausländischer Direktinvestitionen in CwA-Länder erhöhten sich im Jahr 2022 dem Bericht zufolge fast um das Sechsfache auf 133 Milliarden Dollar und übertrafen damit das Niveau vor der Pandemie von etwa 80 Milliarden Dollar. Dem stehen 58 Milliarden Dollar für den Rest Afrikas gegenüber, die sich bis 2022 nur verdoppelt haben.
Sorgen bereitet in den CwA-Ländern der rapide Anstieg der Staatsschulden. Im Zuge der Corona-Pandemie stieg das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt von 68 Prozent im Jahr 2019 auf 77 Prozent im vergangenen Jahr. In den afrikanischen Nicht-CwA-Ländern stieg die Schuldenquote nur auf 54 Prozent. Dies legt nahe, dass die CwA-Länder die Verbesserung ihres Rufs durch den Beitritt zu Compact with Africa genutzt haben, um sich stärker zu verschulden. Mit diesen Schuldenquoten liegen die afrikanischen Regierungen deutlich unter dem Niveau der meisten europäischen Staaten. Allerdings ist die Schuldentragfähigkeit afrikanischer Regierungen in der Regel geringer, beispielsweise aufgrund einer kleineren Steuerbasis.
Entscheidend für den Erfolg der Initiative Compact with Africa wird die Frage sein, ob es gelingt, die Rahmenbedingungen in den teilnehmenden Ländern so zu verbessern, dass sich das Geschäftsklima dort dauerhaft verbessert. Auch in diesem Punkt sehen die Weltbank-Volkswirte Fortschritte. “Die CwA-Länder machten weiterhin große Fortschritte bei ihren Reformverpflichtungen von 2018 und fügen neue Reforminitiativen in den makroökonomischen, geschäftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen hinzu – besonders zur Förderung grüner privater Investitionen”, heißt es in dem Bericht.
Die Diaspora am Horn von Afrika gilt mehr als anderswo als “fünfte Gewalt” – gleich nach der Macht der Medien. Ihr Einfluss beruht darauf, dass sie über gebildete Menschen und die finanzielle Kraft verfügt, um nicht nur einen friedlichen, sondern auch einen bewaffneten Kampf zu unterstützen.
Die Diaspora aus Somalia, Eritrea und Äthiopien wird auf rund 5,3 Millionen Menschen weltweit geschätzt. In den anhaltenden bewaffneten Kämpfen am Horn von Afrika sticht Äthiopien hervor, weil dessen Diaspora aktiv Menschen und Ressourcen für den Widerstand gegen die Regierung mobilisiert.
Die Mobilisierung der Diaspora habe tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf soziale, wirtschaftliche und politische Prozesse, heißt es in einer Studie, die Andrea Warnecke und Clara Schmitz-Pranghe für das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) durchgeführt haben. Allerdings, fügen sie hinzu, “ist die Frage nach konstruktivem oder dekonstruktivem Diaspora-Engagement in vielen Fällen eine Frage der Perspektive und bis zu einem gewissen Grad auch der Prioritäten angesichts der zahlreichen Konfliktsituationen in Äthiopien.”
Der Beitrag der Diaspora zu ihren jeweiligen Heimatländern wird häufig unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet, etwa durch Geldüberweisungen. Terrence Lyons, außerordentlicher Professor für Konfliktanalyse und -beilegung an der George Mason University in den USA, stellte schon 2009 in einer Studie fest, dass die äthiopische Diaspora “eine Schlüsselrolle in den Konflikten in ihrem Heimatland spielt, zum Teil, weil sie wichtige finanzielle Unterstützung leistet.”
Mehr als ein Jahrzehnt später ist die Situation unverändert. Markus Rudolf, ein in Berlin lebender Forscher im Bereich Migration und Diaspora, stimmte im Gespräch mit Table.Media zwar zu, dass die Diaspora den bewaffneten Kampf finanziell unterstütze. Es gebe aber kaum konkrete Beweise dafür, dass mit dem Geld Waffen gekauft worden seien.
Diaspora-Gruppen, die durch Konflikte entstanden sind und durch traumatische Erinnerungen zusammengehalten werden, neigten dazu, weniger Kompromisse einzugehen und daher die Langwierigkeit von Konflikten zu verstärken und zu verschärfen, meint dagegen Terrence Lyons.
Seenaa Jimjimo, eine in den USA ansässige Oromo-Unterstützerin, die Lyons Position teilt, sagte zu Table.Media, dass die Unterstützung des bewaffneten Kampfes dann entstehe, wenn die Regierungen sich den Beschwerden der Menschen gegenüber taub stellten und versuchten, sie mit Kugeln zu lösen. “Wenn man also versucht, das Problem ausschließlich mit Waffen zu lösen, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Diaspora organisiert, um mit Gewalt und Waffen Veränderungen herbeizuführen”, so Jimjimo.
Solomon Getahun, ein Wissenschaftler für die Geschichte der äthiopischen Diaspora an der Central Michigan University in den USA, teilt Seenaas Argument. In Anbetracht des jahrzehntelangen Kampfes der Oromo-Befreiungsarmee in Oromia, des jüngsten Krieges in Tigray und des andauernden Konflikts zwischen den Amhara-Fano-Milizionären und der Regierung “ist es sehr schwierig zu sagen, dass die Diaspora den bewaffneten Kampf nicht unterstützt”, sagte er im Gespräch mit Table.Media.
Ein Beleg dafür ist ein Facebook-Post des in den USA lebenden Amhara-Aktivisten Abebe Gellaw, der mehr als 230.000 Follower hat. In einem Beitrag vom 7. August 2023 bewunderte Abebe den Erfolg der Fano-Milizen und schrieb: “Es ist wichtig, sie zu unterstützen und zu halten, bis die Ziele erreicht sind. … Die Sicherung einer besseren Zukunft für das Amhara-Volk und den Rest Äthiopiens muss um jeden Preis erreicht werden. Jetzt oder nie!”
In Anbetracht dieser finanziellen und emotionalen Unterstützung für den bewaffneten Kampf in Oromia und den Amhara-Staaten sei die Beschreibung der Diaspora als fünfte Gewalt nicht weit von der Realität entfernt, sagte Seenaa. Für sie liegt der Schlüssel für eine friedliche Lösung bei der Regierung. Diese solle die Forderungen der Menschen anhören und eine Lösung auf dem Verhandlungsweg finden, von der alle Parteien profitierten.
In seinem Telefongespräch mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed am 28. September über die bewaffneten Kämpfe in den beiden Staaten betonte US-Außenminister Antony Blinken auch “die Notwendigkeit, eine friedliche Lösung durch politischen Dialog zu fördern.” Das Fehlen einer solchen Lösung kann die Diaspora nicht davon abhalten, bewaffnete Kämpfe zu unterstützen.
Die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs), traten Anfang 2016 als überarbeitete Fassung der Millennium Development Goals (MDGs) in Kraft und sind für 15 Jahre bis 2030 gültig. Sie sind in Deutschland auch als “Agenda 2030” bekannt. Anders als die MDGs, die sich vor allem an Entwicklungsländer gerichtet hatten, gelten die SDGs auch für die entwickelten Staaten. Die ehemals acht MDGs wurden auf 17 SDGs erweitert, mit einem neuen Schwerpunkt auf wirtschaftliche Entwicklung, Klimaziele und nachhaltige Städte. Der Fokus verlagerte sich zudem von der sozialen Entwicklung zur Nachhaltigkeit.
Zur Halbzeit, nach siebeneinhalb Jahren, sind die Ergebnisse ernüchternd. Nur 15 Prozent der SDG-Ziele sind auf Kurs. Rund die Hälfte ist entweder mäßig oder stark vom Ziel abgekommen. Und bei einem Drittel gibt es keine Bewegung oder sogar Rückschritte gegenüber 2015. Laut Weltbank leben zehn Prozent der Weltbevölkerung mit Hunger, ein Großteil davon in Afrika. Rund ein Drittel aller weltweiten Konflikte finden auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die Entwicklungsbedingungen sind für zwei Drittel der afrikanischen Staaten unzureichend. “Ich fordere daher die Regierungen auf, unverzüglich Maßnahmen zur Rettung der SDGs zu ergreifen”, plädierte UNO-Generalsekretär, Antonio Guterres, kürzlich auf der UN-Vollversammlung in New York.
Es mangelt an Wirtschaftskraft und damit an Geld, um die Realisierung der SDGs zu finanzieren. Die Folgen der Covid-19-Pandemie, der Ukrainekrieg, die globale Klimakrise, steigende Lebenshaltungskosten und hohe Zinsen – all das hat dazu beigetragen, dass nach UN-Angaben jährlich geschätzte 3,9 Billionen Dollar global für die SDGs fehlen. Das macht sich besonders in Afrika bemerkbar, wo bewaffnete Konflikte zugenommen haben und gleichzeitig die Ernährungssicherheit abgenommen hat.
Afrikanischen Staaten macht zudem die drückende Schuldenlast zu schaffen. Der Anteil von Schulden am BIP hat sich laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in der vergangenen Dekade von durchschnittlich 30 auf fast 60 Prozent in Subsahara-Afrika verdoppelt. Es droht eine akute Schuldenkrise. Hinzu kommt das ohnehin niedrige Niveau der Entwicklung auf dem Kontinent, sei es bei Bildung, Gesundheitsversorgung oder Infrastruktur, auch wenn es positive Beispiele gibt, unter anderem Tunesien, Ghana und Südafrika.
2022 flossen 34 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe nach Afrika. Das sind 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Für die Umsetzung der SDGs in Afrika bis 2030 werden jedoch laut der Afrikanischen Union (AU) und der OECD jährlich 194 Milliarden Dollar benötigt.
Afrika steht allerdings seit Jahren der Official Development Assistance (ODA) skeptisch gegenüber und beklagt, dass die Hilfe Korruption und Konflikte fördert, schwache Regierungen stützt, Investitionen blockiert und Abhängigkeiten schafft, wie es die sambische Ökonomin Dambisa Moyo in ihrem Bestseller “Dead Aid” beschrieben hat. Moyo hat sich in ihrem 2009 erschienenen Buch für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum eingesetzt, das auf die Mobilisierung inländischer Ressourcen setzt und Auslandsinvestitionen anzieht.
Nun mehren sich die Stimmen in Afrika, die mehr direkte Finanzhilfe fordern: “Finanzspritzen sind der Schlüssel, und wir können es uns nach all diesen mehrfachen Schocks nicht leisten, noch mehr Schulden zu machen”, sagte Hala El Said Younes, Ägyptens Ministerin für Planung und wirtschaftliche Entwicklung, beim Sustainable Development Impact Meeting des World Economic Forum in New York im September. “Wir brauchen also mehr Investitionen, wir brauchen mehr konzessionäre Finanzierung.” Das heißt Asien, der Nahe Osten und der Westen müssen ran.
Auch bei der UN ist man sich im Klaren darüber, dass ein Schuldenerlass ein wichtiger Weg zur Finanzierung der SDGs ist, vor allem da afrikanische Regierungen in der Regel schlechtere Konditionen für Kredite bekommen. Bei der G20, die die Afrikanische Union bei ihrem Gipfel in Indien im September aufgenommen hat, ist Schuldenerlass ein zentrales Thema. In Afrika konnten bisher Äthiopien, der Tschad, Sambia und zuletzt Ghana davon profitieren.
Auf der UN-Vollversammlung in New York im September fasste der nigerianische Präsident Bola Tinubu zusammen, was Afrika braucht: “Direktinvestitionen wohlhabender Nationen in kritische Industrien, die Öffnung ihrer Häfen für zusätzliche und größere Mengen hochwertiger afrikanischer Exportgüter sowie ein beträchtlicher Schuldenerlass sind wichtige Aspekte der von uns angestrebten Zusammenarbeit.”
Auch die Bundesregierung will mit ihrer vor kurzem vorgestellten neuen Afrika-Strategie auf eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft setzen und den Fokus verstärkt auf die SDGs richten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze warb für Deutschland als Partner in der Entwicklung, bekam aber vor allem aus der Wirtschaft skeptische Resonanz. Inwieweit sich die Strategie im Wettbewerb mit anderen Staaten, vor allem mit den Brics-Ländern China, Indien und Russland, durchsetzen wird, muss sich noch zeigen. Klar ist: Sie warten nicht auf Deutschland.
Zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die in dieser Woche in Marrakesch stattfindet, werden offizielle Delegationen aus 189 Mitgliedsländern erwartet, um angesichts der wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen globale Wirtschaftsfragen, Entwicklungsprobleme und Finanzierungsstrategien zu erörtern. Es ist das erste Treffen auf dem afrikanischen Kontinent in 50 Jahren.
In der Woche vor der Tagung hat die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgieva Subsahara-Afrika einen dritten Sitz im Exekutivdirektorium des Fonds zugesagt. Auch die Weltbank hat angekündigt, dass sie einen dritten Sitz für afrikanische Länder in ihrem Vorstand einrichten wird. Die Entscheidung soll in Marrakesch offiziell bekanntgegeben werden.
Neben der Erholung der Weltwirtschaft wird Afrika laut Georgieva eines der Hauptthemen sein. Sie verwies auf die Schwierigkeiten, mit denen die afrikanischen Länder konfrontiert sind, insbesondere im Hinblick auf die physische Konnektivität zwischen den Ländern und die Beseitigung von Handelsbarrieren.
Auch die Neuverhandlung der IWF-Quoten, von denen etwa die Stimmrechte der Mitgliedsstaaten abhängen, steht an, bleibt aber in geopolitische Fragen verstrickt. Die Überprüfung der Quoten sei wichtig, um “das derzeitige wirtschaftliche Gewicht der Mitgliedsländer, einschließlich Chinas” zu spiegeln, sagte Georgieva. Die USA bevorzugen hingegen eine Erhöhung, die allen Mitgliedern im Verhältnis zu ihrem bestehenden Quotenanteil zuteil wird. Bei einer gleichmäßigeren Umverteilung auf Grundlage des wirtschaftlichen Gewichts würden auch die europäischen Länder verlieren.
Die diesjährige Tagung wird sich auf sechs Hauptthemen konzentrieren:
Besonders die Länder des globalen Südens hatten zuletzt auf eine Reform der globalen Finanzarchitektur gedrängt. Schon auf dem Pariser Klimafinanzgipfel im Juni hatten Vertreter afrikanischer Staaten mehr Mitspracherecht gefordert. Dabei geht es etwa um eine Umschuldung, die hoch verschuldeten Ländern wie Sambia oder Ghana mehr Spielraum und Liquidität verschafft. Zudem fordern die Länder vom Westen, endlich seine früheren Versprechen hinsichtlich der Klimafinanzierung einzuhalten und neue Möglichkeiten für grüne Investitionen zu schaffen.
So forderte der erste Africa Climate Summit der Afrikanischen Union (AU) Anfang September in Nairobi die Umleitung von mindestens 100 Milliarden Dollar an IWF-Sonderziehungsrechten (SZR) nach Afrika über Institutionen wie die Afrikanische Entwicklungsbank. Die AU forderte den IWF außerdem auf, mindestens 650 Milliarden Dollar an neuen SZR zu begeben.
Im Marrakescher Tagungsprogramm sind 19 Minister und Zentralbankgouverneure aus 14 afrikanischen Staaten angekündigt. Aus Deutschland wird Finanzminister Lindner zur Tagung reisen. Laut Programm nimmt er am Donnerstag an einer Paneldiskussion mit dem Titel “Boosting Growth with Domestic Resources: How to Pay for It All” teil, unter anderem mit dem ägyptischen Finanzminister. ajs
Äthiopien hat angekündigt, dass Russland eine Produktionsstätte für Lada-Fahrzeuge in dem ostafrikanischen Land bauen möchte. Laut dem äthiopischen Botschafter in Moskau, Ugala Uriat, ist Lada bereits eine Partnerschaft mit einer Firma in Äthiopien eingegangen, um den afrikanischen Automarkt zu entwickeln.
Lada ist die wichtigste Marke des staatlichen russischen Automobilherstellers AvtoVAZ, der im ersten Halbjahr 2023 ein Wachstum von 92,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr meldete, nachdem der Automarkt in Russland im vergangenen Jahr zusammengebrochen war. Insgesamt wurden 143.618 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich: Škoda hat im gleichen Zeitraum 432.200 Autos verkauft, ein Zuwachs von 20 Prozent.
Die Ankündigung kommt nur etwas mehr als einen Monat nach dem 15. Brics-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg, bei dem Äthiopien als eines der sechs neuen Mitglieder im Klub der aufstrebenden Wirtschaftsmächte bestätigt wurde. Das andere afrikanische Land ist Ägypten.
Äthiopien gilt als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas mit einer starken Mittelschicht. Die Weltbank schätzt, dass 2023 das BIP-Wachstum 4,2 Prozent betragen wird. Das ostafrikanische Land ist auch Mitglied im Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), einer regionalen Wirtschaftsgemeinschaft mit 640 Millionen Menschen und einem BIP von 918 Milliarden Dollar. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed traf Wladimir Putin beim 2. Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg, wo beide Länder engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbarten.
Die russischen Fahrzeuge sollen neben Äthiopien die Automärkte im benachbarten Kenia, Somalia, Sudan und Südsudan bedienen. Es sollen speziell für afrikanische Bedingungen angepasste SUVs gebaut werden. Bisher wurde noch kein Datum genannt, wann die Produktion beginnen soll. Auch das Produktionsvolumen der neuen Fabrik ist nicht bekannt. “Wir werden in naher Zukunft russische Lada-Autos in Nachbarländern sehen”, so Botschafter Uriat. Zwei weitere russische Autobauer führen bereits Gespräche mit äthiopischen Firmen, um vor Ort zu produzieren. as
Deutschland will weitere 40 Millionen Euro für den Ausbau sozialer Sicherung in der Sahel-Region einsetzen. Das teilte Entwicklungsministerin Svenja Schulze bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Unicef-Direktorin für Sozialpolitik, Natalia Winder Rossi, und dem Generaldirektor des mauretanischen Sozialregisters, Ahmed Salem Ould Bede, am Freitag in Berlin mit. “Wir haben durch Corona gelernt: Wo es soziale Sicherung gibt, kommen die Menschen besser durch die Krise. Das gilt genauso für den Umgang mit Klimaschocks wie Dürren und Überschwemmungen”, sagte Schulze. Soziale Sicherheit könne im besten Fall verhindern, dass eine Krise die nächste erzeuge. “Darum sind soziale Sicherungssysteme für mich eine Priorität, die ich auf allen Ebenen vorantreibe.”
Besonders in den Fokus rückt Mauretanien, das die Ministerin im August besucht hatte. “Mauretanien ist ein Land, das viele Flüchtlinge aufnimmt und integriert – vor allen Dingen aus dem Nachbarland Mali.” Das Land verdiene daher die Solidarität der Weltgemeinschaft. Aus Deutschland soll es mehr Geld für Projekte des Flüchtlingshilfswerks UNHCR geben, versprach die Ministerin.
Seit 2019 hat die Bundesrepublik nach Angaben des BMZ insgesamt 340 Millionen Euro in die soziale Sicherung im Sahel investiert. Deutschland arbeitet dabei insbesondere mit Unicef, dem Welternährungsprogramm (WFP), der Weltbank und dem UNHCR zusammen. Seit dem Putsch im Niger im Juli dieses Jahres hat die Bundesregierung die Zahlung von Entwicklungsgeldern über staatliche Stellen des westafrikanischen Landes eingestellt. Die Bevölkerung im Niger werde direkt über WFP und Unicef versorgt, so das Ministerium.
Insgesamt haben lediglich zwölf Prozent der Einwohner in der Sahelzone Zugang zu sozialen Sicherungssystemen. Auch das sei mit einer der Gründe für die Instabilität der Region, sagte Schulze. Die Ministerin ist seit Juli Präsidentin der Sahel-Allianz. Neben Mauretanien und dem Niger gehören auch Mali, Burkina Faso und der Tschad zu dem Staatenbündnis. Vor gut einer Woche hatte das BMZ bekannt gegeben, die regionale westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas mit zusätzlichen 81 Millionen Euro unterstützen zu wollen. dre
Nigerias Präsident Bola Tinuba hat angesichts der Protestwelle im Land eingelenkt. Er stimmte einer Erhöhung der Gehälter zu und konnte so den Streik der Staatsbediensteten vorläufig beenden und eine drohende Schließung der Behörden abwenden. Der Staat ist mit etwa 725.000 offiziell Angestellten größter Arbeitgeber im Land. Die Gehälter steigen um umgerechnet rund 30 Euro monatlich für sechs Monate. Zusätzlich erhalten 12 Millionen Haushalte in prekären Verhältnissen eine Einmalzahlung von umgerechnet 9,80 Euro für drei Monate.
Tinubu wurde am 29. Mai in sein Amt eingesetzt. Seitdem hat er einige unpopuläre Maßnahmen ergriffen, um die schwierige Wirtschaftslage unter Kontrolle zu bringen. Die Inflation stieg von 24,1 Prozent im Juli auf 25,8 Prozent im August. In der hohen Teuerungsrate spiegelt sich die Abschaffung der Subventionen auf Kraftstoffe. Die Kerninflation, bei der die Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, lag im August bei 21,5 Prozent.
Die Staatsschulden lagen im zweiten Quartal laut Debt Management Office bei 107 Milliarden Euro. Patience Oniha, die Leiterin der Schuldenbehörde, kündigte am Donnerstag an, eine schariakonforme Sukuk-Anleihe im Volumen von umgerechnet 187 Millionen Euro zu begeben. Die Emission ist ein zehnjähriger Forward Al Ijarah mit einem Mietzins von 15,75 Prozent und ist ähnlich ausgestattet wie der vorherige Sukuk. Bei einem Forward Al Ijarah wird die Anleihe auf klar spezifizierte Vermögenswerte begeben, die noch hergestellt werden müssen, mit Blick auf eine spätere Lieferung dieser Vermögenswerte.
Da die Staatseinnahmen stark von fossilen Kraftstoffen abhängen, hatte Tinubu auch die Leitung des Ministeriums für Mineralölrohstoffe übernommen. Angesichts der ständig sabotierten Ölförderung wird eine wesentliche Aufgabe für ihn sein, die Gasressourcen des Landes besser zu nutzen. Bisher wird Erdgas hauptsächlich direkt an den Ölförderfeldern vor der Küste abgefackelt. Die Gasreserven des Landes dagegen bleiben weitgehend unerforscht.
Eine Regierungsbildung in Nigeria ist komplexer als in Deutschland, da Nigeria 36 Bundesstaaten hat, die in der Regierung qua Verfassung berücksichtigt werden müssen. So hat Tinubu ein Kabinett mit 20 Ministerien gebildet. Unter anderem hat er als Minister unterhalb sich selbst im Ministerium für Mineralölrohstoffe zwei Unterminister berufen, Ministers of State genannt. Einer davon ist, wie in der vergangenen Woche berichtet, der Minister of State (Gas) Petroleum Resources Ekperipe Ekpo. Der andere ist der Minister of State (Oil) Petroleum Resources unter Heineken Lokpobiri. Der Rang dieser beiden Ministers of State entspricht dem eines deutschen Staatssekretärs, da sie direkt dem Minister, Präsident Tinubu, unterstellt sind.
Anders als in der vergangenen Woche berichtet, ist in Nigeria kein eigenständiges Gasministerium geschaffen worden. Maßgeblich für die Umsetzung der nationalen Erdöl- und Erdgaspolitik ist der staatseigene Konzern NNPC Ltd. (National Nigerian Petroleum Corporation) in Abuja. Die NNPC betreut auch die Joint Ventures mit Shell, Agip, Exxon Mobil, Total Energies und Chevron. Chevron vertritt zudem die Interessen von Texaco im nigerianischen Ölsektor. hlr
Das Wirtschaftswachstum in Subsahara-Afrika wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,5 Prozent verlangsamen. Im Jahr zuvor lag der Zuwachs bei 3,6 Prozent. In den Jahren 2024 und 2025 wird die Region voraussichtlich um 3,7 und 4,1 Prozent wachsen. Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Weltbank-Report mit dem Titel “Africa’s Pulse: Delivering Growth to People through Better Jobs” hervor.
Demnach belasten die fortwährenden Schwierigkeiten der großen Volkswirtschaften Afrikas die Wirtschaftsleistung des Kontinents. So wird etwa das BIP Südafrikas in diesem Jahr voraussichtlich um nur 0,5 Prozent wachsen, da Energie- und Transportengpässe anhalten. Für die Subregion Östliches und Südliches Afrika erwarten die Weltbank-Ökonomen ein Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent (gegenüber 3,5 Prozent im Jahr 2022). Die Subregion West- und Zentralafrika dagegen könnte in diesem Jahr voraussichtlich um 3,3 Prozent wachsen (gegenüber 3,8 Prozent im Jahr 2022).
Auch die Konflikte und die Gewalt in der Region belasten die Wirtschaftstätigkeit. Die zunehmende Fragilität könnte durch Klimaschocks noch verstärkt werden, so die Autoren des Reports.
Trotz der regionalen Schwierigkeiten gibt es auch “Inseln der Resilienz”. Laut Report wird die Wirtschaftsleistung der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC in diesem Jahr um 4,9 Prozent wachsen, während die acht Staaten der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion UEMOA einen Zuwachs von 5,1 Prozent verzeichnen werden.
Die Verschuldung in der Region ist nach wie vor hoch, und das Risiko von Zahlungsschwierigkeiten hat sich seit der Corona-Pandemie verschärft. Steigende Schuldendienstquoten, die im Jahr 2022 in der Region bei schwindelerregenden 31 Prozent der Einnahmen lagen, zehren die Ressourcen, die zur Unterstützung öffentlicher Investitionen und für Sozialprogramme zur Verfügung stehen.
Mit Blick auf die Bekämpfung von Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen zeichnet der Report ein betrübliches Bild. Demnach hat das Wirtschaftswachstum der vergangenen 20 Jahre in der Region nicht genug Jobs für die steigende Zahl der Menschen geschaffen. Die Armutsquote ist in diesem Jahr auf 37,2 Prozent zwar leicht gefallen. Zum Vergleich, im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie lag die Quote aber bei einem Höchstwert von 37,6 Prozent. Hingegen ist die absolute Zahl der Armen gestiegen, von 433 Millionen im Jahr 2020 auf 462 Millionen im laufenden Jahr. Bis 2025 wird diese Zahl voraussichtlich um weitere zehn Millionen wachsen.
Um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, ist laut Weltbank ein Umfeld nötig, das den Markteintritt, die Stabilität und das Wachstum von Unternehmen erleichtert. Arbeitnehmer müssten entsprechend der Nachfrage der Unternehmen ausgebildet werden. Eine Strategie, die Unternehmenswachstum ermöglicht und hochwertige Arbeitsplätze schafft, sollte den Autoren zufolge auf den folgenden Säulen ruhen:
Auch die Umsetzung der Afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) berge Potenzial für künftiges Wirtschaftswachstum. Allerdings sei die Bilanz bei der Umsetzung von Handelsabkommen in der Region nicht sehr gut. Zudem bestünden weiterhin erhebliche regulatorische Unstimmigkeiten und nichttarifäre Handelshemmnisse. ajs

Die Zeiten werden auch für Afrika schwieriger. Nach einem Jahrzehnt der Chancen sind die Folgen diverser Krisen zunehmend spürbar. Inflation und deutlich gestiegene Staatsverschuldung als Folge der Corona-Krise schränken die Handlungsfähigkeit vieler Staaten ein. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steigen Lebensmittel- und Energiepreise weiter. Unerwartete Trockenphasen und Klimawandel erschweren landwirtschaftliche Produktion. Es ist bedauerlich, aber nicht zu leugnen: Während weiterhin spannende Chancen für unternehmerisches Engagement auf dem Kontinent bestehen, sind die Nischen kleiner geworden, und die Zahl der attraktiven Zielländer für Investitionen ist zurückgegangen.
Dabei bräuchte Afrika nichts dringender als Wirtschaftswachstum und Investitionen aus dem Ausland. Unzufriedene junge Bevölkerungsgruppen, die keine Perspektive für sich sehen, sind der beste Nährboden für Populisten und Extremisten. Ohne die Unterstützung dieser Gruppe wären auch die Militärputsche kaum möglich gewesen, die inzwischen mehr als eine Handvoll Länder ereilt haben. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Zahl der Flüchtlinge, die aus Afrika ankommen, gerade jetzt steigt.
Da sollte es für die deutsche Entwicklungspolitik wohl selbstverständlich sein, alles zu tun, um private Investitionen hiesiger Unternehmen in Afrika anzureizen, die zumindest einen Beitrag leisten können zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum. Auch weiterhin sind einige hundert deutsche Unternehmen auf dem Kontinent aktiv, neue Firmen erschließen die neuen Märkte, die den Zugang zu einer interessanten Mittelschicht versprechen und deren infrastrukturelle Grundlagen auch durch Technologie aus Deutschland geschaffen werden können. Dafür braucht es vor allem Risikoabsicherung. Viele Unternehmer, die vielversprechende Projekte verfolgen, scheitern an der Finanzierung. Banken müssen sich wegen regulatorischer Vorgaben zunehmend risikoavers verhalten. Investitionen in Afrika werden daher immer schwieriger zu finanzieren.
Wenn es also politischer Wille ist, dass solche Investitionen stattfinden und Stabilität schaffen, dann muss die Bundesregierung Konzernen und Mittelstand dabei helfen, indem sie ihnen einen Teil der Risiken durch Garantien und Versicherungen abnimmt. Da solche Projekte einen positiven entwicklungspolitischen Effekt haben, wäre es sinnvoll, mehr Entwicklungsgeld für die Risikoabsicherung privaten Kapitals einzusetzen anstatt für traditionelle Entwicklungsprojekte, deren langfristiger Nutzen in vielen Fällen zumindest zu hinterfragen ist.
Was das Entwicklungsministerium in der vergangenen Woche als eine neue “Partnerschaft für Transformation” verkündet hat, macht allerdings einigermaßen ratlos. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Entwicklungsfragen solle auf eine neue Basis gestellt werden. Ausweislich der Pressemitteilung die zuerst genannte Neuerung: Künftig sollen in “Netzwerken und Steuerungsgruppen” weitere Akteure wie Gewerkschaften, Unternehmerinnen und internationale Zivilgesellschaft einen breiteren Raum einnehmen. Inhaltlich solle eine Fokussierung auf Dekarbonisierungsprojekte sowie Umwelt- und Sozialstandards von Unternehmen erfolgen. Und schließlich ist eine Reorganisation der zahlreichen deutschen Beratungsstellen geplant, die immer wieder parallel beauftragt waren, Unternehmen den Zugang zu Afrika zu erklären.
Das alles kann man machen. Es wird nur an keiner Stelle dafür sorgen, dass in Afrika mehr Arbeitsplätze entstehen oder dringend erforderliches Wirtschaftswachstum beschleunigt wird. Die dafür notwendigen Maßnahmen finden weder im aktuellen Papier des Ministeriums noch im Koalitionsvertrag statt. Allen Beteiligten ist bekannt, was getan werden muss, damit eine Chance besteht, zur Verbesserung der Lage in Afrika beizutragen. Und dennoch scheint nichts davon in die Pläne des Ministeriums Eingang gefunden zu haben.
Risikofonds, Versicherungen und neue Garantieinstrumente zu schaffen und die Bedingungen für bestehende Instrumente zu verbessern, wäre ein wichtiger Schritt. Nicht zu vergessen: Unternehmer nicht durch zusätzliche Bürokratie zu belasten. Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz etwa sorgt bereits jetzt dafür, dass Handel und Investitionen in Entwicklungsländern zurückgehen, weil die Unternehmen keine Möglichkeit sehen, den bürokratischen Berichtspflichten gerecht zu werden. Eine Pausierung dieses neuen Regelwerks würde nicht einmal Kosten verursachen, aber sicher der Entwicklung in Afrika helfen.
Angesichts der riesigen Herausforderungen, die derzeit in Afrika entstehen, kann man nur fragen: Ist der Plan zur Zusammenarbeit deutscher Entwicklungspolitik mit der Wirtschaft ernsthaft alles, was uns einfällt? Nacharbeiten und Korrekturen werden dringend empfohlen.
Prof. Dr. Stefan Liebing ist Geschäftsführer der Conjuncta GmbH und Honorarprofessor am “Centre for Business and Technology in Africa” der Hochschule Flensburg.
Africa Intelligence: Mosambik wirbt bei der EU um Waffen. Die mosambikanische Regierung hofft, künftig letale Waffen zur Bekämpfung der Islamisten in der Provinz Cabo Delgado zu erhalten. Die EU hat bereits Ausrüstung im Wert von rund 80 Millionen Euro geliefert. Außerdem unterstützt die EU das Kontingent der ruandischen Armee vor Ort mit 20 Millionen und die SADC-Mission SAMIM mit 15 Millionen Euro.
Africa Intelligence: Ecowas verärgert über Vermittlungsbemühungen der USA und Algeriens. Die Versuche der USA, zwischen Ecowas und der nigrischen Junta zu vermitteln, haben einige westafrikanische Länder irritiert. Eine Situation, die durch die parallelen Bemühungen Algeriens nicht verbessert wurde.
African Business: Schweizer Pionier der Kohlenstoffabscheidung sieht Chancen in Kenia. Das Schweizer Unternehmen Climeworks hat angekündigt, Optionen für eine Großanlage in Kenia zu prüfen. Damit ist das Land auf bestem Wege ein Zentrum für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu werden.
dpa-AFX: Sibanye-Stillwater genehmigt zweite Phase des Lithium-Projekts in Finnland. Der südafrikanische Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater treibt den Abbau von Lithium in Finnland voran. Sibanye will nun mit dem Bau des Konzentrators beginnen und den Tagebau Syväjärvi in Päiväneva entwickeln. Das aktualisierte Kapital für das gesamte Keliber-Projekt wird nun auf 656 Millionen Euro (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt. Das Projekt dürfte somit die größte afrikanische Investition in Europa sein.
Bloomberg: DR Kongo plant neue Route für Kupferexporte. Ein 850 Millionen Dollar teures Straßenbauprojekt, das die Kupfer- und Kobaltminen in der DR Kongo über Sambia mit einem ostafrikanischen Hafen verbindet, wird die bisherige Strecke um mehr als 240 Kilometer verkürzen. Das in Mauritius ansässige Unternehmen GED Africa, das vom ungarischen Baukonzern Duna Aszfalt unterstützt wird, wird die Straße bauen.
Arab Reporters for Investigative Journalism: Eine blutige Route durch Libyen. Eine Untersuchung deckt auf, wie Netzwerke von Menschenschmugglern und Reisebüros Syrer ausbeuten, die nach Europa auswandern wollen. Die Migranten werden mit Flügen nach Libyen gebracht, die in Zusammenarbeit mit der militärischen Investitionsbehörde der libyschen Nationalarmee unter dem Kommando des Warlords Khalifa Haftar durchgeführt werden.
El País: Der letzte europäische Vorposten für afrikanische Flüchtlinge. El Hierro, die westlichste der spanischen Kanarischen Inseln vor der afrikanischen Atlantikküste, hat innerhalb von zwei Tagen über 1200 Menschen aufgenommen, die vor der instabilen Lage in Senegal, Mali und Gambia flohen.
BBC: Mauritius hebt Gesetz aus der Kolonialzeit gegen LGBT auf. Das oberste Gericht von Mauritius hat gleichgeschlechtlichen Sex entkriminalisiert und erklärt, das Verbot entspreche eher den kolonialen als den einheimischen Werten. Das Urteil fällt in eine Zeit, in der in einigen afrikanischen Staaten die Gesetze gegen LGBT-Personen verschärft werden.
FAZ: Ex-CDU-Abgeordneter Huber zu postkolonialer Ausbeutung. In einem Interview kritisiert Charles Huber den postkolonialen Blick Europas auf Afrika. Bis heute setze man auf Abhängigkeit, nehme das Leid der Menschen in Kauf. Deutschland habe zwar seine Holocaust-, nicht aber seine Kolonialvergangenheit aufgearbeitet. Huber berät heute die Regierung Senegals. Der Schauspieler, von 2013 bis 2017 Mitglied im Bundestag, verließ die CDU im Jahr 2019, weil der Afrikabeauftragte der damaligen Kanzlerin Merkel, Günter Nooke, aus Hubers Sicht die Kolonialzeit verharmlost habe.

In Südafrika galt VW-Vorstand Thomas Schäfer als “der, der Chancen ermöglicht”. So oder so ähnlich würde er sich wohl auch gerne in seiner neuen Position als Vorsitzender der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI) sehen. Seit vergangenem Mittwoch steht Schäfer an der Spitze der Initiative und beerbt damit den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der B. Braun Melsungen AG, Heinz-Walter Große, der seit 2015 Vorsitzender der Initiative war. Einfach ist der Job nicht. Denn es gilt die vier Trägerverbände, die hinter der SAFRI-Initiative stehen, immer wieder aufs Neue zu einen. Zwar bringt BDI, BGE, DIHK und den Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft das Ziel zusammen, die deutsche Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken. Bei den Details kommt es jedoch immer wieder zu Reibereien.
Mit Schäfer an der Spitze – so scheinen sich aber alle einig zu sein – hat die Initiative ein exzellentes Aushängeschild gewinnen können. Denn mit Schäfer wird die SAFRI nicht nur von einem Top-Manager des größten deutschen Dax-Konzerns vertreten, Schäfer ist gleichzeitig ausgewiesener Afrika-Kenner. Wie sehr dem 53-Jährigen der Kontinent am Herzen liegt, hört man auch bei seiner Antrittsrede am Mittwoch im Haus der Deutschen Wirtschaft heraus: “Eigentlich hatten meine Frau und ich geplant, den Rest unseres Lebens in Südafrika zu verbringen. Das ist jetzt erst einmal nicht so.” Mehr als zehn Jahre hat Schäfer, der mit einer Südafrikanerin verheiratet ist, auf dem Kontinent gelebt.
Die erste Station auf dem Kontinent machte Schäfer noch für seinen alten Arbeitgeber Daimler. Nach dem Wechsel zu VW vor gut 10 Jahren folgte – nach einem Zwischenstopp in Deutschland – 2015 der zweite Aufenthalt in Südafrika als Vorsitzender der Volkswagen Group South Africa. In dieser Zeit war Schäfer maßgeblich an dem Aufbau des Afrikageschäfts von VW beteiligt. Schäfer erweiterte das Vertriebsnetzwerk und baute die Produktionsstandorte der Wolfsburger in Kenia und Ruanda, aber auch Nigeria und Ghana auf. 2020 kehrte Schäfer nach Europa zurück und wurde zunächst Vorstandsvorsitzender bei Škoda, seit 2022 ist er CEO der Pkw-Sparte bei Volkswagen sowie Leiter der Markengruppe Core.
Vielleicht ist Schäfer auch gerade deshalb ein Realist beim Thema Afrika. “Viele deutsche Leitmedien schreiben immer vom afrikanischen Traum. Für mich ist es kein Traum, es ist harte Arbeit. Diese Arbeit lohnt sich aber”, ist Schäfer überzeugt. Noch sei es ein weiter Weg für Subsahara-Afrika, bis es sich als global-wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort etabliert. Dennoch gebe es rasante Entwicklungen auf dem Kontinent, die es zu nutzen gelte. Als VW-Chef setzt Schäfer dabei wenig überraschend auf das Auto: “Die Automobilindustrie ist Treiber wirtschaftlicher Entwicklung.” Das Auto stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und wirtschaftliche Chancen für den Einzelnen. In Afrika, wo das Auto mangels Alternativen als das wichtigste Verkehrsmittel gilt, hat diese Ansicht durchaus noch Bestand.
Ein Grund für den Optimismus bei den vier Trägerverbänden dürfte außerdem sein, dass Schäfer auch die Verbandsarbeit kennt. In seiner Zeit in Südafrika war Schäfer Präsident der African Association of Automotive Manufacturers (AAAM), die sich zum Ziel gesetzt hat, regionale Wertschöpfungsketten für die Autoindustrie in Afrika aufzubauen. “Mit Thomas Schäfer kommt der richtige Mann zur richtigen Zeit”, ist Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, daher überzeugt.
Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit als SAFRI-Vorsitzender will “der neue im Team”, wie sich Schäfer selbst bezeichnet, den Ausbau des Handels zwischen Afrika und Deutschland stellen. Zudem soll der Bildungs- und Wissensaustausch gefördert und die sozial-ökologischen Herausforderungen “angegangen” werden. Und Schäfer hat auch einen Auftrag an die Politik, wenn gleich er diese nicht direkt nennt: “Es kann nur gelingen, wenn wir die vielen Institutionen, die sich bei uns mit Afrika beschäftigen, sortieren und eine verständliche Struktur mit klaren Zuständigkeiten schaffen.” Das bekämen andere deutlich besser hin als Deutschland.
Auch der Auftrag an Schäfer ist klar. “Wir wollen die Zusammenarbeit mit Afrika auf ein neues Level heben“, sagt Matthias Wachter, Abteilungsleiter für internationale Kooperationen beim BDI. Die erste Möglichkeit dafür bietet sich für Schäfer beim vierten G20-Investitionsgipfel “Compact with Africa”, der am 20. November in Berlin stattfindet. David Renke
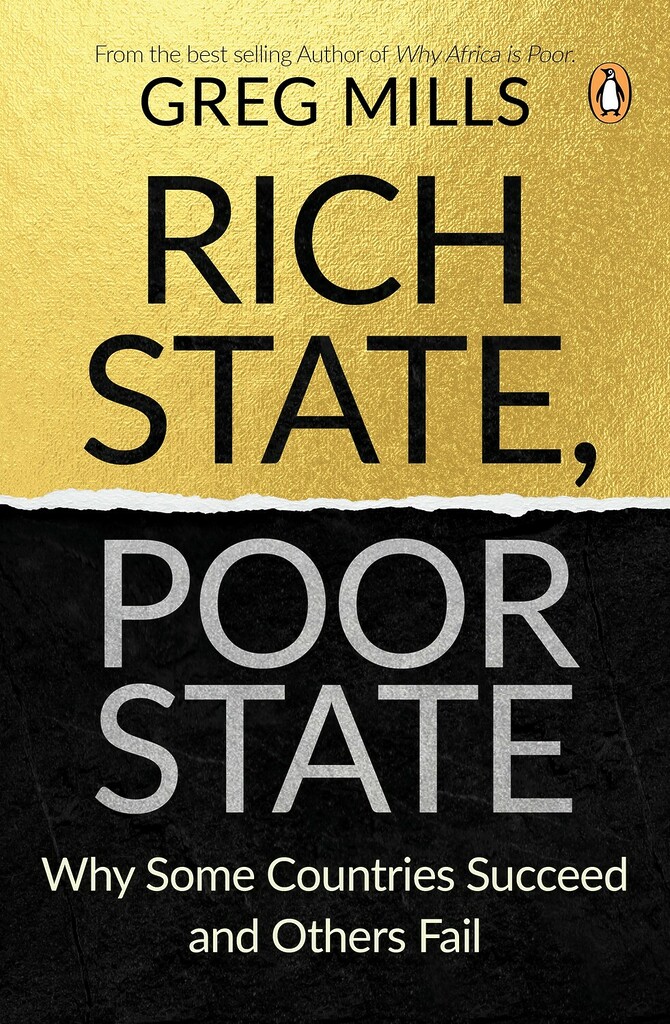
Warum sind Länder erfolgreich und steigen auf, während andere in der gleichen Lage wirtschaftlich stagnieren? Diese Frage beantwortet der südafrikanische Wissenschaftler und Bestsellerautor Greg Mills in seinem neuen Buch “Rich State, Poor State” in weltweiten Fallbeispielen. Dabei versucht er, Lehren für Afrika zu ziehen. Und er kommt zu überraschenden Ergebnissen.
Warum muss etwa in Togo trotz eines funktionierenden Seehafens und von China aufgebauter Infrastruktur ein Großteil der Bevölkerung täglich ums Überleben kämpfen, fragt sich Mills zu Recht. Seine Antwort ist einfach und überzeugend: weil Vetternwirtschaft die Interessen der politischen Elite bedient, anstatt Entwicklung für die breite Masse zu fördern. Togo ist ein “Poor State”. “Die Kosten des Verhaltens der jeweiligen Eliten sind in Afrika enorm”, schreibt der Autor. Mills zieht Vergleiche zu anderen Ländern in der Welt, etwa Vietnam, Mexiko oder die baltischen Staaten, die er alle zu den “Rich States” zählt – auch, wenn es zum Teil noch Entwicklungsländer sind.
Im Spannungsfeld zwischen Rich und Poor States verortet Mills Südafrika und nennt das Land dabei ein “Paradox”. Die Republik am Kap verfügt über wirtschaftliche Branchen, etwa das Bankenwesen oder die Autoindustrie, die international wettbewerbsfähig sind. Doch nicht nur Branchen, sondern auch Regionen wie die Westkapprovinz gelten als Erfolgsgeschichte. Andererseits leben die Hälfte der Südafrikaner unterhalb der Armutsgrenze und ein Großteil der Infrastruktur ist in einem katastrophalen Zustand. Südafrika sei “halb leer im Hinblick auf die wirtschaftliche Befreiung, und halb voll im Hinblick auf die Befreiung politischer Entscheidungen”, resümiert Mills.
“Rich State, Poor State” ist ein spannendes und gut recherchiertes Buch, das von den über Jahre gesammelten persönlichen Begegnungen Mills’ lebt und die Entwicklung Afrikas in eine globale Perspektive setzt. Der Blick über den Tellerrand tut Afrika gut und zeigt, wie wichtig es ist, sich Best Practices weltweit anzuschauen, um global wettbewerbsfähig zu werden. Ein solches selbstkritisches Buch würde Europa auch gutstehen. as
Greg Mills: Rich State, Poor State. Why Some Countries Succeed and Others Fail. Penguin Random House South Africa, September 2023.
schon die 50. Ausgabe. Im Januar dieses Jahres ist der Africa.Table gestartet, als wöchentliches Professional Briefing von Table.Media zu Politik, Wirtschaft und Unternehmen in Afrika. Doch auf dem Kontinent ist so viel geschehen, dass wir immer wieder Spezialausgaben veröffentlicht haben, sodass wir schon nach weniger als neun Monaten unsere Ausgabe Nummer 50 erreicht haben. Wenn Sie mit uns Ihre Einschätzung unserer Arbeit teilen wollen, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung, nehmen uns Ihre Kritik zu Herzen und freuen uns über Lob.
Im November wird in Berlin eine Konferenz zur Bewertung der G20-Initiative Compact with Africa stattfinden. Diese 2017 gegründete Initiative soll reformorientierte Staaten in Afrika darin unterstützen, private Investitionen anzuziehen und die dazu notwendigen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Wir ziehen schon jetzt ein erstes Fazit im Rahmen einer Diskussion, die wir gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft am morgigen Mittwoch, 11. Oktober um 8.30 Uhr veranstalten. Dabei diskutiere ich mit I.E. Gina Ama Blay, Botschafterin der Republik Ghana, S.E. Igor César, Botschafter der Republik Ruanda, Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Dr. Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG) im Table.Media-Café in Berlin. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Sie können noch digital dabei sein. Dazu müssen Sie sich nur hier anmelden.
Neben einer Analyse zum bisher Erreichten bei Compact with Africa bieten wir wieder spannende Berichte, Porträts, Standpunkte und einen Ausblick auf die Jahrestagung von IWF und Weltbank, die diese Woche in Marrakesch stattfindet.

Am 20. November findet in Berlin die G20 Compact with Africa-Chancellors’ Conference statt. Für den 16. November ist ein virtuelles Treffen der Africa Advisory Group angesetzt. Im Vorfeld dieser wichtigen Konferenz lädt Table.Media gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft in englischer Sprache zum Table.Live Briefing Africa Insight! X Africa.Table – What is the status quo and what are the expectations for the G20 Compact with Africa conference?
Sollten Sie sich für eine digitale Teilnahme an der Veranstaltung am Mittwoch, 11. Oktober von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr interessieren, können Sie sich heute noch hier anmelden. An der Diskussion nehmen teil: Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana), Igor César (Botschafter von Ruanda), Christoph Kannengießer (Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft), Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG).
Der G20 Compact with Africa (CwA) wurde 2017 unter der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Ziel ist, durch bessere Rahmenbedingungen mehr private Investitionen in diese Länder anzuziehen.
Zwölf Länder haben sich der Initiative bisher angeschlossen: Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ägypten, Äthiopien, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Auf der Website von Compact with Africa heißt es dazu: “Die CwA ist nachfrageorientiert und steht allen afrikanischen Ländern offen, die sich selbst für die Teilnahme an der Initiative entscheiden.” Bisher ist allerdings kein Land südlich des Äquators Compact with Africa beigetreten.
Die Weltbank wertet die Initiative als Erfolg. Die CwA-Länder verzeichneten eine stärkere wirtschaftliche Erholung als die afrikanischen Länder, die der Initiative nicht beigetreten sind. Allerdings könne dieser Erfolg nicht ausschließlich CwA zugeschrieben werden. “CwA-Länder, die aufgrund früherer Reformen historisch gesehen offener für Handel und ausländische Direktinvestitionen waren, profitierten überproportional von der starken Erholung nach der Pandemie”, heißt es im Compact Monitoring Report, den die Africa Advisory Group im Juni veröffentlicht hat. Den Bericht haben bei der Weltbank Vincent Palmade, Chefvolkswirt für Afrika, sowie die Volkswirtinnen Claudia Garcia Gonzalez und Nadege D. Yameogo verfasst.
Im vergangenen Jahr stieg das Wirtschaftswachstum der CwA-Länder von 4,9 auf 5,4 Prozent und sei damit doppelt so hoch ausgefallen wie das Wachstum der afrikanischen Länder, die nicht dem CwA beigetreten sind. Allerdings sind die beiden größten Volkswirtschaften Afrikas, Nigeria und Südafrika, stark von Rohstoffexporten abhängig, deren Preise in den vergangenen Jahren besonders volatil waren.
Die Ankündigungen ausländischer Direktinvestitionen in CwA-Länder erhöhten sich im Jahr 2022 dem Bericht zufolge fast um das Sechsfache auf 133 Milliarden Dollar und übertrafen damit das Niveau vor der Pandemie von etwa 80 Milliarden Dollar. Dem stehen 58 Milliarden Dollar für den Rest Afrikas gegenüber, die sich bis 2022 nur verdoppelt haben.
Sorgen bereitet in den CwA-Ländern der rapide Anstieg der Staatsschulden. Im Zuge der Corona-Pandemie stieg das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt von 68 Prozent im Jahr 2019 auf 77 Prozent im vergangenen Jahr. In den afrikanischen Nicht-CwA-Ländern stieg die Schuldenquote nur auf 54 Prozent. Dies legt nahe, dass die CwA-Länder die Verbesserung ihres Rufs durch den Beitritt zu Compact with Africa genutzt haben, um sich stärker zu verschulden. Mit diesen Schuldenquoten liegen die afrikanischen Regierungen deutlich unter dem Niveau der meisten europäischen Staaten. Allerdings ist die Schuldentragfähigkeit afrikanischer Regierungen in der Regel geringer, beispielsweise aufgrund einer kleineren Steuerbasis.
Entscheidend für den Erfolg der Initiative Compact with Africa wird die Frage sein, ob es gelingt, die Rahmenbedingungen in den teilnehmenden Ländern so zu verbessern, dass sich das Geschäftsklima dort dauerhaft verbessert. Auch in diesem Punkt sehen die Weltbank-Volkswirte Fortschritte. “Die CwA-Länder machten weiterhin große Fortschritte bei ihren Reformverpflichtungen von 2018 und fügen neue Reforminitiativen in den makroökonomischen, geschäftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen hinzu – besonders zur Förderung grüner privater Investitionen”, heißt es in dem Bericht.
Die Diaspora am Horn von Afrika gilt mehr als anderswo als “fünfte Gewalt” – gleich nach der Macht der Medien. Ihr Einfluss beruht darauf, dass sie über gebildete Menschen und die finanzielle Kraft verfügt, um nicht nur einen friedlichen, sondern auch einen bewaffneten Kampf zu unterstützen.
Die Diaspora aus Somalia, Eritrea und Äthiopien wird auf rund 5,3 Millionen Menschen weltweit geschätzt. In den anhaltenden bewaffneten Kämpfen am Horn von Afrika sticht Äthiopien hervor, weil dessen Diaspora aktiv Menschen und Ressourcen für den Widerstand gegen die Regierung mobilisiert.
Die Mobilisierung der Diaspora habe tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf soziale, wirtschaftliche und politische Prozesse, heißt es in einer Studie, die Andrea Warnecke und Clara Schmitz-Pranghe für das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) durchgeführt haben. Allerdings, fügen sie hinzu, “ist die Frage nach konstruktivem oder dekonstruktivem Diaspora-Engagement in vielen Fällen eine Frage der Perspektive und bis zu einem gewissen Grad auch der Prioritäten angesichts der zahlreichen Konfliktsituationen in Äthiopien.”
Der Beitrag der Diaspora zu ihren jeweiligen Heimatländern wird häufig unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet, etwa durch Geldüberweisungen. Terrence Lyons, außerordentlicher Professor für Konfliktanalyse und -beilegung an der George Mason University in den USA, stellte schon 2009 in einer Studie fest, dass die äthiopische Diaspora “eine Schlüsselrolle in den Konflikten in ihrem Heimatland spielt, zum Teil, weil sie wichtige finanzielle Unterstützung leistet.”
Mehr als ein Jahrzehnt später ist die Situation unverändert. Markus Rudolf, ein in Berlin lebender Forscher im Bereich Migration und Diaspora, stimmte im Gespräch mit Table.Media zwar zu, dass die Diaspora den bewaffneten Kampf finanziell unterstütze. Es gebe aber kaum konkrete Beweise dafür, dass mit dem Geld Waffen gekauft worden seien.
Diaspora-Gruppen, die durch Konflikte entstanden sind und durch traumatische Erinnerungen zusammengehalten werden, neigten dazu, weniger Kompromisse einzugehen und daher die Langwierigkeit von Konflikten zu verstärken und zu verschärfen, meint dagegen Terrence Lyons.
Seenaa Jimjimo, eine in den USA ansässige Oromo-Unterstützerin, die Lyons Position teilt, sagte zu Table.Media, dass die Unterstützung des bewaffneten Kampfes dann entstehe, wenn die Regierungen sich den Beschwerden der Menschen gegenüber taub stellten und versuchten, sie mit Kugeln zu lösen. “Wenn man also versucht, das Problem ausschließlich mit Waffen zu lösen, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Diaspora organisiert, um mit Gewalt und Waffen Veränderungen herbeizuführen”, so Jimjimo.
Solomon Getahun, ein Wissenschaftler für die Geschichte der äthiopischen Diaspora an der Central Michigan University in den USA, teilt Seenaas Argument. In Anbetracht des jahrzehntelangen Kampfes der Oromo-Befreiungsarmee in Oromia, des jüngsten Krieges in Tigray und des andauernden Konflikts zwischen den Amhara-Fano-Milizionären und der Regierung “ist es sehr schwierig zu sagen, dass die Diaspora den bewaffneten Kampf nicht unterstützt”, sagte er im Gespräch mit Table.Media.
Ein Beleg dafür ist ein Facebook-Post des in den USA lebenden Amhara-Aktivisten Abebe Gellaw, der mehr als 230.000 Follower hat. In einem Beitrag vom 7. August 2023 bewunderte Abebe den Erfolg der Fano-Milizen und schrieb: “Es ist wichtig, sie zu unterstützen und zu halten, bis die Ziele erreicht sind. … Die Sicherung einer besseren Zukunft für das Amhara-Volk und den Rest Äthiopiens muss um jeden Preis erreicht werden. Jetzt oder nie!”
In Anbetracht dieser finanziellen und emotionalen Unterstützung für den bewaffneten Kampf in Oromia und den Amhara-Staaten sei die Beschreibung der Diaspora als fünfte Gewalt nicht weit von der Realität entfernt, sagte Seenaa. Für sie liegt der Schlüssel für eine friedliche Lösung bei der Regierung. Diese solle die Forderungen der Menschen anhören und eine Lösung auf dem Verhandlungsweg finden, von der alle Parteien profitierten.
In seinem Telefongespräch mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed am 28. September über die bewaffneten Kämpfe in den beiden Staaten betonte US-Außenminister Antony Blinken auch “die Notwendigkeit, eine friedliche Lösung durch politischen Dialog zu fördern.” Das Fehlen einer solchen Lösung kann die Diaspora nicht davon abhalten, bewaffnete Kämpfe zu unterstützen.
Die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs), traten Anfang 2016 als überarbeitete Fassung der Millennium Development Goals (MDGs) in Kraft und sind für 15 Jahre bis 2030 gültig. Sie sind in Deutschland auch als “Agenda 2030” bekannt. Anders als die MDGs, die sich vor allem an Entwicklungsländer gerichtet hatten, gelten die SDGs auch für die entwickelten Staaten. Die ehemals acht MDGs wurden auf 17 SDGs erweitert, mit einem neuen Schwerpunkt auf wirtschaftliche Entwicklung, Klimaziele und nachhaltige Städte. Der Fokus verlagerte sich zudem von der sozialen Entwicklung zur Nachhaltigkeit.
Zur Halbzeit, nach siebeneinhalb Jahren, sind die Ergebnisse ernüchternd. Nur 15 Prozent der SDG-Ziele sind auf Kurs. Rund die Hälfte ist entweder mäßig oder stark vom Ziel abgekommen. Und bei einem Drittel gibt es keine Bewegung oder sogar Rückschritte gegenüber 2015. Laut Weltbank leben zehn Prozent der Weltbevölkerung mit Hunger, ein Großteil davon in Afrika. Rund ein Drittel aller weltweiten Konflikte finden auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die Entwicklungsbedingungen sind für zwei Drittel der afrikanischen Staaten unzureichend. “Ich fordere daher die Regierungen auf, unverzüglich Maßnahmen zur Rettung der SDGs zu ergreifen”, plädierte UNO-Generalsekretär, Antonio Guterres, kürzlich auf der UN-Vollversammlung in New York.
Es mangelt an Wirtschaftskraft und damit an Geld, um die Realisierung der SDGs zu finanzieren. Die Folgen der Covid-19-Pandemie, der Ukrainekrieg, die globale Klimakrise, steigende Lebenshaltungskosten und hohe Zinsen – all das hat dazu beigetragen, dass nach UN-Angaben jährlich geschätzte 3,9 Billionen Dollar global für die SDGs fehlen. Das macht sich besonders in Afrika bemerkbar, wo bewaffnete Konflikte zugenommen haben und gleichzeitig die Ernährungssicherheit abgenommen hat.
Afrikanischen Staaten macht zudem die drückende Schuldenlast zu schaffen. Der Anteil von Schulden am BIP hat sich laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in der vergangenen Dekade von durchschnittlich 30 auf fast 60 Prozent in Subsahara-Afrika verdoppelt. Es droht eine akute Schuldenkrise. Hinzu kommt das ohnehin niedrige Niveau der Entwicklung auf dem Kontinent, sei es bei Bildung, Gesundheitsversorgung oder Infrastruktur, auch wenn es positive Beispiele gibt, unter anderem Tunesien, Ghana und Südafrika.
2022 flossen 34 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe nach Afrika. Das sind 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Für die Umsetzung der SDGs in Afrika bis 2030 werden jedoch laut der Afrikanischen Union (AU) und der OECD jährlich 194 Milliarden Dollar benötigt.
Afrika steht allerdings seit Jahren der Official Development Assistance (ODA) skeptisch gegenüber und beklagt, dass die Hilfe Korruption und Konflikte fördert, schwache Regierungen stützt, Investitionen blockiert und Abhängigkeiten schafft, wie es die sambische Ökonomin Dambisa Moyo in ihrem Bestseller “Dead Aid” beschrieben hat. Moyo hat sich in ihrem 2009 erschienenen Buch für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum eingesetzt, das auf die Mobilisierung inländischer Ressourcen setzt und Auslandsinvestitionen anzieht.
Nun mehren sich die Stimmen in Afrika, die mehr direkte Finanzhilfe fordern: “Finanzspritzen sind der Schlüssel, und wir können es uns nach all diesen mehrfachen Schocks nicht leisten, noch mehr Schulden zu machen”, sagte Hala El Said Younes, Ägyptens Ministerin für Planung und wirtschaftliche Entwicklung, beim Sustainable Development Impact Meeting des World Economic Forum in New York im September. “Wir brauchen also mehr Investitionen, wir brauchen mehr konzessionäre Finanzierung.” Das heißt Asien, der Nahe Osten und der Westen müssen ran.
Auch bei der UN ist man sich im Klaren darüber, dass ein Schuldenerlass ein wichtiger Weg zur Finanzierung der SDGs ist, vor allem da afrikanische Regierungen in der Regel schlechtere Konditionen für Kredite bekommen. Bei der G20, die die Afrikanische Union bei ihrem Gipfel in Indien im September aufgenommen hat, ist Schuldenerlass ein zentrales Thema. In Afrika konnten bisher Äthiopien, der Tschad, Sambia und zuletzt Ghana davon profitieren.
Auf der UN-Vollversammlung in New York im September fasste der nigerianische Präsident Bola Tinubu zusammen, was Afrika braucht: “Direktinvestitionen wohlhabender Nationen in kritische Industrien, die Öffnung ihrer Häfen für zusätzliche und größere Mengen hochwertiger afrikanischer Exportgüter sowie ein beträchtlicher Schuldenerlass sind wichtige Aspekte der von uns angestrebten Zusammenarbeit.”
Auch die Bundesregierung will mit ihrer vor kurzem vorgestellten neuen Afrika-Strategie auf eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft setzen und den Fokus verstärkt auf die SDGs richten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze warb für Deutschland als Partner in der Entwicklung, bekam aber vor allem aus der Wirtschaft skeptische Resonanz. Inwieweit sich die Strategie im Wettbewerb mit anderen Staaten, vor allem mit den Brics-Ländern China, Indien und Russland, durchsetzen wird, muss sich noch zeigen. Klar ist: Sie warten nicht auf Deutschland.
Zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die in dieser Woche in Marrakesch stattfindet, werden offizielle Delegationen aus 189 Mitgliedsländern erwartet, um angesichts der wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen globale Wirtschaftsfragen, Entwicklungsprobleme und Finanzierungsstrategien zu erörtern. Es ist das erste Treffen auf dem afrikanischen Kontinent in 50 Jahren.
In der Woche vor der Tagung hat die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgieva Subsahara-Afrika einen dritten Sitz im Exekutivdirektorium des Fonds zugesagt. Auch die Weltbank hat angekündigt, dass sie einen dritten Sitz für afrikanische Länder in ihrem Vorstand einrichten wird. Die Entscheidung soll in Marrakesch offiziell bekanntgegeben werden.
Neben der Erholung der Weltwirtschaft wird Afrika laut Georgieva eines der Hauptthemen sein. Sie verwies auf die Schwierigkeiten, mit denen die afrikanischen Länder konfrontiert sind, insbesondere im Hinblick auf die physische Konnektivität zwischen den Ländern und die Beseitigung von Handelsbarrieren.
Auch die Neuverhandlung der IWF-Quoten, von denen etwa die Stimmrechte der Mitgliedsstaaten abhängen, steht an, bleibt aber in geopolitische Fragen verstrickt. Die Überprüfung der Quoten sei wichtig, um “das derzeitige wirtschaftliche Gewicht der Mitgliedsländer, einschließlich Chinas” zu spiegeln, sagte Georgieva. Die USA bevorzugen hingegen eine Erhöhung, die allen Mitgliedern im Verhältnis zu ihrem bestehenden Quotenanteil zuteil wird. Bei einer gleichmäßigeren Umverteilung auf Grundlage des wirtschaftlichen Gewichts würden auch die europäischen Länder verlieren.
Die diesjährige Tagung wird sich auf sechs Hauptthemen konzentrieren:
Besonders die Länder des globalen Südens hatten zuletzt auf eine Reform der globalen Finanzarchitektur gedrängt. Schon auf dem Pariser Klimafinanzgipfel im Juni hatten Vertreter afrikanischer Staaten mehr Mitspracherecht gefordert. Dabei geht es etwa um eine Umschuldung, die hoch verschuldeten Ländern wie Sambia oder Ghana mehr Spielraum und Liquidität verschafft. Zudem fordern die Länder vom Westen, endlich seine früheren Versprechen hinsichtlich der Klimafinanzierung einzuhalten und neue Möglichkeiten für grüne Investitionen zu schaffen.
So forderte der erste Africa Climate Summit der Afrikanischen Union (AU) Anfang September in Nairobi die Umleitung von mindestens 100 Milliarden Dollar an IWF-Sonderziehungsrechten (SZR) nach Afrika über Institutionen wie die Afrikanische Entwicklungsbank. Die AU forderte den IWF außerdem auf, mindestens 650 Milliarden Dollar an neuen SZR zu begeben.
Im Marrakescher Tagungsprogramm sind 19 Minister und Zentralbankgouverneure aus 14 afrikanischen Staaten angekündigt. Aus Deutschland wird Finanzminister Lindner zur Tagung reisen. Laut Programm nimmt er am Donnerstag an einer Paneldiskussion mit dem Titel “Boosting Growth with Domestic Resources: How to Pay for It All” teil, unter anderem mit dem ägyptischen Finanzminister. ajs
Äthiopien hat angekündigt, dass Russland eine Produktionsstätte für Lada-Fahrzeuge in dem ostafrikanischen Land bauen möchte. Laut dem äthiopischen Botschafter in Moskau, Ugala Uriat, ist Lada bereits eine Partnerschaft mit einer Firma in Äthiopien eingegangen, um den afrikanischen Automarkt zu entwickeln.
Lada ist die wichtigste Marke des staatlichen russischen Automobilherstellers AvtoVAZ, der im ersten Halbjahr 2023 ein Wachstum von 92,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr meldete, nachdem der Automarkt in Russland im vergangenen Jahr zusammengebrochen war. Insgesamt wurden 143.618 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich: Škoda hat im gleichen Zeitraum 432.200 Autos verkauft, ein Zuwachs von 20 Prozent.
Die Ankündigung kommt nur etwas mehr als einen Monat nach dem 15. Brics-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg, bei dem Äthiopien als eines der sechs neuen Mitglieder im Klub der aufstrebenden Wirtschaftsmächte bestätigt wurde. Das andere afrikanische Land ist Ägypten.
Äthiopien gilt als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas mit einer starken Mittelschicht. Die Weltbank schätzt, dass 2023 das BIP-Wachstum 4,2 Prozent betragen wird. Das ostafrikanische Land ist auch Mitglied im Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), einer regionalen Wirtschaftsgemeinschaft mit 640 Millionen Menschen und einem BIP von 918 Milliarden Dollar. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed traf Wladimir Putin beim 2. Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg, wo beide Länder engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbarten.
Die russischen Fahrzeuge sollen neben Äthiopien die Automärkte im benachbarten Kenia, Somalia, Sudan und Südsudan bedienen. Es sollen speziell für afrikanische Bedingungen angepasste SUVs gebaut werden. Bisher wurde noch kein Datum genannt, wann die Produktion beginnen soll. Auch das Produktionsvolumen der neuen Fabrik ist nicht bekannt. “Wir werden in naher Zukunft russische Lada-Autos in Nachbarländern sehen”, so Botschafter Uriat. Zwei weitere russische Autobauer führen bereits Gespräche mit äthiopischen Firmen, um vor Ort zu produzieren. as
Deutschland will weitere 40 Millionen Euro für den Ausbau sozialer Sicherung in der Sahel-Region einsetzen. Das teilte Entwicklungsministerin Svenja Schulze bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Unicef-Direktorin für Sozialpolitik, Natalia Winder Rossi, und dem Generaldirektor des mauretanischen Sozialregisters, Ahmed Salem Ould Bede, am Freitag in Berlin mit. “Wir haben durch Corona gelernt: Wo es soziale Sicherung gibt, kommen die Menschen besser durch die Krise. Das gilt genauso für den Umgang mit Klimaschocks wie Dürren und Überschwemmungen”, sagte Schulze. Soziale Sicherheit könne im besten Fall verhindern, dass eine Krise die nächste erzeuge. “Darum sind soziale Sicherungssysteme für mich eine Priorität, die ich auf allen Ebenen vorantreibe.”
Besonders in den Fokus rückt Mauretanien, das die Ministerin im August besucht hatte. “Mauretanien ist ein Land, das viele Flüchtlinge aufnimmt und integriert – vor allen Dingen aus dem Nachbarland Mali.” Das Land verdiene daher die Solidarität der Weltgemeinschaft. Aus Deutschland soll es mehr Geld für Projekte des Flüchtlingshilfswerks UNHCR geben, versprach die Ministerin.
Seit 2019 hat die Bundesrepublik nach Angaben des BMZ insgesamt 340 Millionen Euro in die soziale Sicherung im Sahel investiert. Deutschland arbeitet dabei insbesondere mit Unicef, dem Welternährungsprogramm (WFP), der Weltbank und dem UNHCR zusammen. Seit dem Putsch im Niger im Juli dieses Jahres hat die Bundesregierung die Zahlung von Entwicklungsgeldern über staatliche Stellen des westafrikanischen Landes eingestellt. Die Bevölkerung im Niger werde direkt über WFP und Unicef versorgt, so das Ministerium.
Insgesamt haben lediglich zwölf Prozent der Einwohner in der Sahelzone Zugang zu sozialen Sicherungssystemen. Auch das sei mit einer der Gründe für die Instabilität der Region, sagte Schulze. Die Ministerin ist seit Juli Präsidentin der Sahel-Allianz. Neben Mauretanien und dem Niger gehören auch Mali, Burkina Faso und der Tschad zu dem Staatenbündnis. Vor gut einer Woche hatte das BMZ bekannt gegeben, die regionale westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas mit zusätzlichen 81 Millionen Euro unterstützen zu wollen. dre
Nigerias Präsident Bola Tinuba hat angesichts der Protestwelle im Land eingelenkt. Er stimmte einer Erhöhung der Gehälter zu und konnte so den Streik der Staatsbediensteten vorläufig beenden und eine drohende Schließung der Behörden abwenden. Der Staat ist mit etwa 725.000 offiziell Angestellten größter Arbeitgeber im Land. Die Gehälter steigen um umgerechnet rund 30 Euro monatlich für sechs Monate. Zusätzlich erhalten 12 Millionen Haushalte in prekären Verhältnissen eine Einmalzahlung von umgerechnet 9,80 Euro für drei Monate.
Tinubu wurde am 29. Mai in sein Amt eingesetzt. Seitdem hat er einige unpopuläre Maßnahmen ergriffen, um die schwierige Wirtschaftslage unter Kontrolle zu bringen. Die Inflation stieg von 24,1 Prozent im Juli auf 25,8 Prozent im August. In der hohen Teuerungsrate spiegelt sich die Abschaffung der Subventionen auf Kraftstoffe. Die Kerninflation, bei der die Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, lag im August bei 21,5 Prozent.
Die Staatsschulden lagen im zweiten Quartal laut Debt Management Office bei 107 Milliarden Euro. Patience Oniha, die Leiterin der Schuldenbehörde, kündigte am Donnerstag an, eine schariakonforme Sukuk-Anleihe im Volumen von umgerechnet 187 Millionen Euro zu begeben. Die Emission ist ein zehnjähriger Forward Al Ijarah mit einem Mietzins von 15,75 Prozent und ist ähnlich ausgestattet wie der vorherige Sukuk. Bei einem Forward Al Ijarah wird die Anleihe auf klar spezifizierte Vermögenswerte begeben, die noch hergestellt werden müssen, mit Blick auf eine spätere Lieferung dieser Vermögenswerte.
Da die Staatseinnahmen stark von fossilen Kraftstoffen abhängen, hatte Tinubu auch die Leitung des Ministeriums für Mineralölrohstoffe übernommen. Angesichts der ständig sabotierten Ölförderung wird eine wesentliche Aufgabe für ihn sein, die Gasressourcen des Landes besser zu nutzen. Bisher wird Erdgas hauptsächlich direkt an den Ölförderfeldern vor der Küste abgefackelt. Die Gasreserven des Landes dagegen bleiben weitgehend unerforscht.
Eine Regierungsbildung in Nigeria ist komplexer als in Deutschland, da Nigeria 36 Bundesstaaten hat, die in der Regierung qua Verfassung berücksichtigt werden müssen. So hat Tinubu ein Kabinett mit 20 Ministerien gebildet. Unter anderem hat er als Minister unterhalb sich selbst im Ministerium für Mineralölrohstoffe zwei Unterminister berufen, Ministers of State genannt. Einer davon ist, wie in der vergangenen Woche berichtet, der Minister of State (Gas) Petroleum Resources Ekperipe Ekpo. Der andere ist der Minister of State (Oil) Petroleum Resources unter Heineken Lokpobiri. Der Rang dieser beiden Ministers of State entspricht dem eines deutschen Staatssekretärs, da sie direkt dem Minister, Präsident Tinubu, unterstellt sind.
Anders als in der vergangenen Woche berichtet, ist in Nigeria kein eigenständiges Gasministerium geschaffen worden. Maßgeblich für die Umsetzung der nationalen Erdöl- und Erdgaspolitik ist der staatseigene Konzern NNPC Ltd. (National Nigerian Petroleum Corporation) in Abuja. Die NNPC betreut auch die Joint Ventures mit Shell, Agip, Exxon Mobil, Total Energies und Chevron. Chevron vertritt zudem die Interessen von Texaco im nigerianischen Ölsektor. hlr
Das Wirtschaftswachstum in Subsahara-Afrika wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,5 Prozent verlangsamen. Im Jahr zuvor lag der Zuwachs bei 3,6 Prozent. In den Jahren 2024 und 2025 wird die Region voraussichtlich um 3,7 und 4,1 Prozent wachsen. Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Weltbank-Report mit dem Titel “Africa’s Pulse: Delivering Growth to People through Better Jobs” hervor.
Demnach belasten die fortwährenden Schwierigkeiten der großen Volkswirtschaften Afrikas die Wirtschaftsleistung des Kontinents. So wird etwa das BIP Südafrikas in diesem Jahr voraussichtlich um nur 0,5 Prozent wachsen, da Energie- und Transportengpässe anhalten. Für die Subregion Östliches und Südliches Afrika erwarten die Weltbank-Ökonomen ein Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent (gegenüber 3,5 Prozent im Jahr 2022). Die Subregion West- und Zentralafrika dagegen könnte in diesem Jahr voraussichtlich um 3,3 Prozent wachsen (gegenüber 3,8 Prozent im Jahr 2022).
Auch die Konflikte und die Gewalt in der Region belasten die Wirtschaftstätigkeit. Die zunehmende Fragilität könnte durch Klimaschocks noch verstärkt werden, so die Autoren des Reports.
Trotz der regionalen Schwierigkeiten gibt es auch “Inseln der Resilienz”. Laut Report wird die Wirtschaftsleistung der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC in diesem Jahr um 4,9 Prozent wachsen, während die acht Staaten der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion UEMOA einen Zuwachs von 5,1 Prozent verzeichnen werden.
Die Verschuldung in der Region ist nach wie vor hoch, und das Risiko von Zahlungsschwierigkeiten hat sich seit der Corona-Pandemie verschärft. Steigende Schuldendienstquoten, die im Jahr 2022 in der Region bei schwindelerregenden 31 Prozent der Einnahmen lagen, zehren die Ressourcen, die zur Unterstützung öffentlicher Investitionen und für Sozialprogramme zur Verfügung stehen.
Mit Blick auf die Bekämpfung von Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen zeichnet der Report ein betrübliches Bild. Demnach hat das Wirtschaftswachstum der vergangenen 20 Jahre in der Region nicht genug Jobs für die steigende Zahl der Menschen geschaffen. Die Armutsquote ist in diesem Jahr auf 37,2 Prozent zwar leicht gefallen. Zum Vergleich, im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie lag die Quote aber bei einem Höchstwert von 37,6 Prozent. Hingegen ist die absolute Zahl der Armen gestiegen, von 433 Millionen im Jahr 2020 auf 462 Millionen im laufenden Jahr. Bis 2025 wird diese Zahl voraussichtlich um weitere zehn Millionen wachsen.
Um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, ist laut Weltbank ein Umfeld nötig, das den Markteintritt, die Stabilität und das Wachstum von Unternehmen erleichtert. Arbeitnehmer müssten entsprechend der Nachfrage der Unternehmen ausgebildet werden. Eine Strategie, die Unternehmenswachstum ermöglicht und hochwertige Arbeitsplätze schafft, sollte den Autoren zufolge auf den folgenden Säulen ruhen:
Auch die Umsetzung der Afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) berge Potenzial für künftiges Wirtschaftswachstum. Allerdings sei die Bilanz bei der Umsetzung von Handelsabkommen in der Region nicht sehr gut. Zudem bestünden weiterhin erhebliche regulatorische Unstimmigkeiten und nichttarifäre Handelshemmnisse. ajs

Die Zeiten werden auch für Afrika schwieriger. Nach einem Jahrzehnt der Chancen sind die Folgen diverser Krisen zunehmend spürbar. Inflation und deutlich gestiegene Staatsverschuldung als Folge der Corona-Krise schränken die Handlungsfähigkeit vieler Staaten ein. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steigen Lebensmittel- und Energiepreise weiter. Unerwartete Trockenphasen und Klimawandel erschweren landwirtschaftliche Produktion. Es ist bedauerlich, aber nicht zu leugnen: Während weiterhin spannende Chancen für unternehmerisches Engagement auf dem Kontinent bestehen, sind die Nischen kleiner geworden, und die Zahl der attraktiven Zielländer für Investitionen ist zurückgegangen.
Dabei bräuchte Afrika nichts dringender als Wirtschaftswachstum und Investitionen aus dem Ausland. Unzufriedene junge Bevölkerungsgruppen, die keine Perspektive für sich sehen, sind der beste Nährboden für Populisten und Extremisten. Ohne die Unterstützung dieser Gruppe wären auch die Militärputsche kaum möglich gewesen, die inzwischen mehr als eine Handvoll Länder ereilt haben. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Zahl der Flüchtlinge, die aus Afrika ankommen, gerade jetzt steigt.
Da sollte es für die deutsche Entwicklungspolitik wohl selbstverständlich sein, alles zu tun, um private Investitionen hiesiger Unternehmen in Afrika anzureizen, die zumindest einen Beitrag leisten können zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum. Auch weiterhin sind einige hundert deutsche Unternehmen auf dem Kontinent aktiv, neue Firmen erschließen die neuen Märkte, die den Zugang zu einer interessanten Mittelschicht versprechen und deren infrastrukturelle Grundlagen auch durch Technologie aus Deutschland geschaffen werden können. Dafür braucht es vor allem Risikoabsicherung. Viele Unternehmer, die vielversprechende Projekte verfolgen, scheitern an der Finanzierung. Banken müssen sich wegen regulatorischer Vorgaben zunehmend risikoavers verhalten. Investitionen in Afrika werden daher immer schwieriger zu finanzieren.
Wenn es also politischer Wille ist, dass solche Investitionen stattfinden und Stabilität schaffen, dann muss die Bundesregierung Konzernen und Mittelstand dabei helfen, indem sie ihnen einen Teil der Risiken durch Garantien und Versicherungen abnimmt. Da solche Projekte einen positiven entwicklungspolitischen Effekt haben, wäre es sinnvoll, mehr Entwicklungsgeld für die Risikoabsicherung privaten Kapitals einzusetzen anstatt für traditionelle Entwicklungsprojekte, deren langfristiger Nutzen in vielen Fällen zumindest zu hinterfragen ist.
Was das Entwicklungsministerium in der vergangenen Woche als eine neue “Partnerschaft für Transformation” verkündet hat, macht allerdings einigermaßen ratlos. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Entwicklungsfragen solle auf eine neue Basis gestellt werden. Ausweislich der Pressemitteilung die zuerst genannte Neuerung: Künftig sollen in “Netzwerken und Steuerungsgruppen” weitere Akteure wie Gewerkschaften, Unternehmerinnen und internationale Zivilgesellschaft einen breiteren Raum einnehmen. Inhaltlich solle eine Fokussierung auf Dekarbonisierungsprojekte sowie Umwelt- und Sozialstandards von Unternehmen erfolgen. Und schließlich ist eine Reorganisation der zahlreichen deutschen Beratungsstellen geplant, die immer wieder parallel beauftragt waren, Unternehmen den Zugang zu Afrika zu erklären.
Das alles kann man machen. Es wird nur an keiner Stelle dafür sorgen, dass in Afrika mehr Arbeitsplätze entstehen oder dringend erforderliches Wirtschaftswachstum beschleunigt wird. Die dafür notwendigen Maßnahmen finden weder im aktuellen Papier des Ministeriums noch im Koalitionsvertrag statt. Allen Beteiligten ist bekannt, was getan werden muss, damit eine Chance besteht, zur Verbesserung der Lage in Afrika beizutragen. Und dennoch scheint nichts davon in die Pläne des Ministeriums Eingang gefunden zu haben.
Risikofonds, Versicherungen und neue Garantieinstrumente zu schaffen und die Bedingungen für bestehende Instrumente zu verbessern, wäre ein wichtiger Schritt. Nicht zu vergessen: Unternehmer nicht durch zusätzliche Bürokratie zu belasten. Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz etwa sorgt bereits jetzt dafür, dass Handel und Investitionen in Entwicklungsländern zurückgehen, weil die Unternehmen keine Möglichkeit sehen, den bürokratischen Berichtspflichten gerecht zu werden. Eine Pausierung dieses neuen Regelwerks würde nicht einmal Kosten verursachen, aber sicher der Entwicklung in Afrika helfen.
Angesichts der riesigen Herausforderungen, die derzeit in Afrika entstehen, kann man nur fragen: Ist der Plan zur Zusammenarbeit deutscher Entwicklungspolitik mit der Wirtschaft ernsthaft alles, was uns einfällt? Nacharbeiten und Korrekturen werden dringend empfohlen.
Prof. Dr. Stefan Liebing ist Geschäftsführer der Conjuncta GmbH und Honorarprofessor am “Centre for Business and Technology in Africa” der Hochschule Flensburg.
Africa Intelligence: Mosambik wirbt bei der EU um Waffen. Die mosambikanische Regierung hofft, künftig letale Waffen zur Bekämpfung der Islamisten in der Provinz Cabo Delgado zu erhalten. Die EU hat bereits Ausrüstung im Wert von rund 80 Millionen Euro geliefert. Außerdem unterstützt die EU das Kontingent der ruandischen Armee vor Ort mit 20 Millionen und die SADC-Mission SAMIM mit 15 Millionen Euro.
Africa Intelligence: Ecowas verärgert über Vermittlungsbemühungen der USA und Algeriens. Die Versuche der USA, zwischen Ecowas und der nigrischen Junta zu vermitteln, haben einige westafrikanische Länder irritiert. Eine Situation, die durch die parallelen Bemühungen Algeriens nicht verbessert wurde.
African Business: Schweizer Pionier der Kohlenstoffabscheidung sieht Chancen in Kenia. Das Schweizer Unternehmen Climeworks hat angekündigt, Optionen für eine Großanlage in Kenia zu prüfen. Damit ist das Land auf bestem Wege ein Zentrum für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu werden.
dpa-AFX: Sibanye-Stillwater genehmigt zweite Phase des Lithium-Projekts in Finnland. Der südafrikanische Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater treibt den Abbau von Lithium in Finnland voran. Sibanye will nun mit dem Bau des Konzentrators beginnen und den Tagebau Syväjärvi in Päiväneva entwickeln. Das aktualisierte Kapital für das gesamte Keliber-Projekt wird nun auf 656 Millionen Euro (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt. Das Projekt dürfte somit die größte afrikanische Investition in Europa sein.
Bloomberg: DR Kongo plant neue Route für Kupferexporte. Ein 850 Millionen Dollar teures Straßenbauprojekt, das die Kupfer- und Kobaltminen in der DR Kongo über Sambia mit einem ostafrikanischen Hafen verbindet, wird die bisherige Strecke um mehr als 240 Kilometer verkürzen. Das in Mauritius ansässige Unternehmen GED Africa, das vom ungarischen Baukonzern Duna Aszfalt unterstützt wird, wird die Straße bauen.
Arab Reporters for Investigative Journalism: Eine blutige Route durch Libyen. Eine Untersuchung deckt auf, wie Netzwerke von Menschenschmugglern und Reisebüros Syrer ausbeuten, die nach Europa auswandern wollen. Die Migranten werden mit Flügen nach Libyen gebracht, die in Zusammenarbeit mit der militärischen Investitionsbehörde der libyschen Nationalarmee unter dem Kommando des Warlords Khalifa Haftar durchgeführt werden.
El País: Der letzte europäische Vorposten für afrikanische Flüchtlinge. El Hierro, die westlichste der spanischen Kanarischen Inseln vor der afrikanischen Atlantikküste, hat innerhalb von zwei Tagen über 1200 Menschen aufgenommen, die vor der instabilen Lage in Senegal, Mali und Gambia flohen.
BBC: Mauritius hebt Gesetz aus der Kolonialzeit gegen LGBT auf. Das oberste Gericht von Mauritius hat gleichgeschlechtlichen Sex entkriminalisiert und erklärt, das Verbot entspreche eher den kolonialen als den einheimischen Werten. Das Urteil fällt in eine Zeit, in der in einigen afrikanischen Staaten die Gesetze gegen LGBT-Personen verschärft werden.
FAZ: Ex-CDU-Abgeordneter Huber zu postkolonialer Ausbeutung. In einem Interview kritisiert Charles Huber den postkolonialen Blick Europas auf Afrika. Bis heute setze man auf Abhängigkeit, nehme das Leid der Menschen in Kauf. Deutschland habe zwar seine Holocaust-, nicht aber seine Kolonialvergangenheit aufgearbeitet. Huber berät heute die Regierung Senegals. Der Schauspieler, von 2013 bis 2017 Mitglied im Bundestag, verließ die CDU im Jahr 2019, weil der Afrikabeauftragte der damaligen Kanzlerin Merkel, Günter Nooke, aus Hubers Sicht die Kolonialzeit verharmlost habe.

In Südafrika galt VW-Vorstand Thomas Schäfer als “der, der Chancen ermöglicht”. So oder so ähnlich würde er sich wohl auch gerne in seiner neuen Position als Vorsitzender der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI) sehen. Seit vergangenem Mittwoch steht Schäfer an der Spitze der Initiative und beerbt damit den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der B. Braun Melsungen AG, Heinz-Walter Große, der seit 2015 Vorsitzender der Initiative war. Einfach ist der Job nicht. Denn es gilt die vier Trägerverbände, die hinter der SAFRI-Initiative stehen, immer wieder aufs Neue zu einen. Zwar bringt BDI, BGE, DIHK und den Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft das Ziel zusammen, die deutsche Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken. Bei den Details kommt es jedoch immer wieder zu Reibereien.
Mit Schäfer an der Spitze – so scheinen sich aber alle einig zu sein – hat die Initiative ein exzellentes Aushängeschild gewinnen können. Denn mit Schäfer wird die SAFRI nicht nur von einem Top-Manager des größten deutschen Dax-Konzerns vertreten, Schäfer ist gleichzeitig ausgewiesener Afrika-Kenner. Wie sehr dem 53-Jährigen der Kontinent am Herzen liegt, hört man auch bei seiner Antrittsrede am Mittwoch im Haus der Deutschen Wirtschaft heraus: “Eigentlich hatten meine Frau und ich geplant, den Rest unseres Lebens in Südafrika zu verbringen. Das ist jetzt erst einmal nicht so.” Mehr als zehn Jahre hat Schäfer, der mit einer Südafrikanerin verheiratet ist, auf dem Kontinent gelebt.
Die erste Station auf dem Kontinent machte Schäfer noch für seinen alten Arbeitgeber Daimler. Nach dem Wechsel zu VW vor gut 10 Jahren folgte – nach einem Zwischenstopp in Deutschland – 2015 der zweite Aufenthalt in Südafrika als Vorsitzender der Volkswagen Group South Africa. In dieser Zeit war Schäfer maßgeblich an dem Aufbau des Afrikageschäfts von VW beteiligt. Schäfer erweiterte das Vertriebsnetzwerk und baute die Produktionsstandorte der Wolfsburger in Kenia und Ruanda, aber auch Nigeria und Ghana auf. 2020 kehrte Schäfer nach Europa zurück und wurde zunächst Vorstandsvorsitzender bei Škoda, seit 2022 ist er CEO der Pkw-Sparte bei Volkswagen sowie Leiter der Markengruppe Core.
Vielleicht ist Schäfer auch gerade deshalb ein Realist beim Thema Afrika. “Viele deutsche Leitmedien schreiben immer vom afrikanischen Traum. Für mich ist es kein Traum, es ist harte Arbeit. Diese Arbeit lohnt sich aber”, ist Schäfer überzeugt. Noch sei es ein weiter Weg für Subsahara-Afrika, bis es sich als global-wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort etabliert. Dennoch gebe es rasante Entwicklungen auf dem Kontinent, die es zu nutzen gelte. Als VW-Chef setzt Schäfer dabei wenig überraschend auf das Auto: “Die Automobilindustrie ist Treiber wirtschaftlicher Entwicklung.” Das Auto stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und wirtschaftliche Chancen für den Einzelnen. In Afrika, wo das Auto mangels Alternativen als das wichtigste Verkehrsmittel gilt, hat diese Ansicht durchaus noch Bestand.
Ein Grund für den Optimismus bei den vier Trägerverbänden dürfte außerdem sein, dass Schäfer auch die Verbandsarbeit kennt. In seiner Zeit in Südafrika war Schäfer Präsident der African Association of Automotive Manufacturers (AAAM), die sich zum Ziel gesetzt hat, regionale Wertschöpfungsketten für die Autoindustrie in Afrika aufzubauen. “Mit Thomas Schäfer kommt der richtige Mann zur richtigen Zeit”, ist Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, daher überzeugt.
Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit als SAFRI-Vorsitzender will “der neue im Team”, wie sich Schäfer selbst bezeichnet, den Ausbau des Handels zwischen Afrika und Deutschland stellen. Zudem soll der Bildungs- und Wissensaustausch gefördert und die sozial-ökologischen Herausforderungen “angegangen” werden. Und Schäfer hat auch einen Auftrag an die Politik, wenn gleich er diese nicht direkt nennt: “Es kann nur gelingen, wenn wir die vielen Institutionen, die sich bei uns mit Afrika beschäftigen, sortieren und eine verständliche Struktur mit klaren Zuständigkeiten schaffen.” Das bekämen andere deutlich besser hin als Deutschland.
Auch der Auftrag an Schäfer ist klar. “Wir wollen die Zusammenarbeit mit Afrika auf ein neues Level heben“, sagt Matthias Wachter, Abteilungsleiter für internationale Kooperationen beim BDI. Die erste Möglichkeit dafür bietet sich für Schäfer beim vierten G20-Investitionsgipfel “Compact with Africa”, der am 20. November in Berlin stattfindet. David Renke
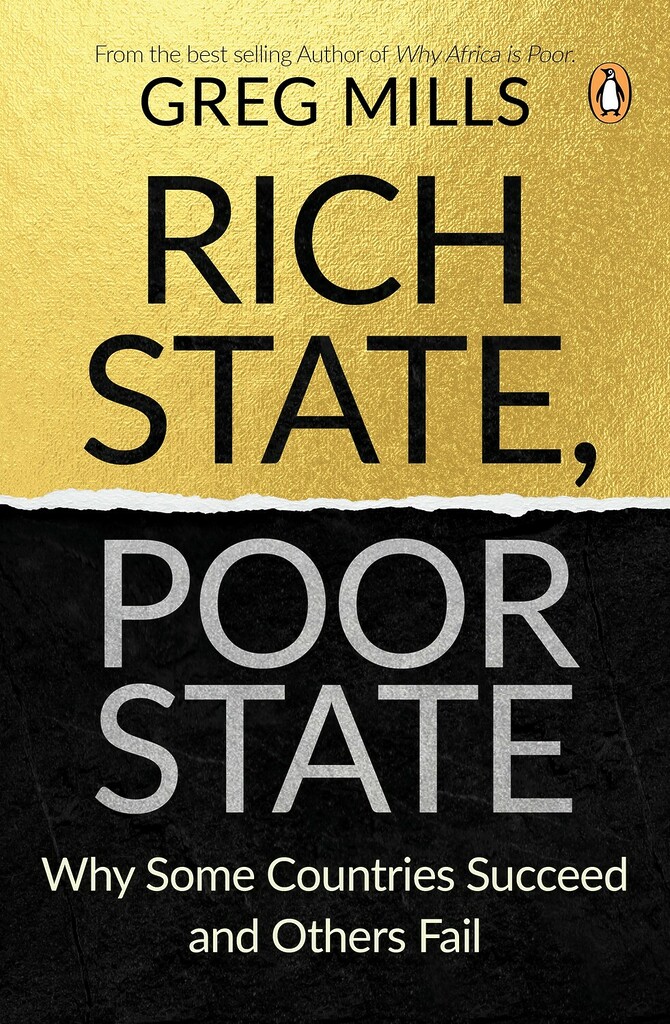
Warum sind Länder erfolgreich und steigen auf, während andere in der gleichen Lage wirtschaftlich stagnieren? Diese Frage beantwortet der südafrikanische Wissenschaftler und Bestsellerautor Greg Mills in seinem neuen Buch “Rich State, Poor State” in weltweiten Fallbeispielen. Dabei versucht er, Lehren für Afrika zu ziehen. Und er kommt zu überraschenden Ergebnissen.
Warum muss etwa in Togo trotz eines funktionierenden Seehafens und von China aufgebauter Infrastruktur ein Großteil der Bevölkerung täglich ums Überleben kämpfen, fragt sich Mills zu Recht. Seine Antwort ist einfach und überzeugend: weil Vetternwirtschaft die Interessen der politischen Elite bedient, anstatt Entwicklung für die breite Masse zu fördern. Togo ist ein “Poor State”. “Die Kosten des Verhaltens der jeweiligen Eliten sind in Afrika enorm”, schreibt der Autor. Mills zieht Vergleiche zu anderen Ländern in der Welt, etwa Vietnam, Mexiko oder die baltischen Staaten, die er alle zu den “Rich States” zählt – auch, wenn es zum Teil noch Entwicklungsländer sind.
Im Spannungsfeld zwischen Rich und Poor States verortet Mills Südafrika und nennt das Land dabei ein “Paradox”. Die Republik am Kap verfügt über wirtschaftliche Branchen, etwa das Bankenwesen oder die Autoindustrie, die international wettbewerbsfähig sind. Doch nicht nur Branchen, sondern auch Regionen wie die Westkapprovinz gelten als Erfolgsgeschichte. Andererseits leben die Hälfte der Südafrikaner unterhalb der Armutsgrenze und ein Großteil der Infrastruktur ist in einem katastrophalen Zustand. Südafrika sei “halb leer im Hinblick auf die wirtschaftliche Befreiung, und halb voll im Hinblick auf die Befreiung politischer Entscheidungen”, resümiert Mills.
“Rich State, Poor State” ist ein spannendes und gut recherchiertes Buch, das von den über Jahre gesammelten persönlichen Begegnungen Mills’ lebt und die Entwicklung Afrikas in eine globale Perspektive setzt. Der Blick über den Tellerrand tut Afrika gut und zeigt, wie wichtig es ist, sich Best Practices weltweit anzuschauen, um global wettbewerbsfähig zu werden. Ein solches selbstkritisches Buch würde Europa auch gutstehen. as
Greg Mills: Rich State, Poor State. Why Some Countries Succeed and Others Fail. Penguin Random House South Africa, September 2023.
