die Diplomaten in Afrika sind auch im neuen Jahr wieder stark beschäftigt. Das Abkommen Äthiopiens mit Somaliland verschärft die vielen Konflikte am Horn von Afrika und bringt neue Verbündete zusammen. Darüber berichtet Merga Yonas Bula.
Und natürlich schlägt auch hohe Wellen, dass Südafrika Israel wegen des Kriegs in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof gebracht hat. Was diese Anklage außenpolitisch bedeutet, analysiert Andreas Sieren.
Auch wirtschaftlich herrscht große Bewegung. Präsident Tinubu will die nigerianische Stahlindustrie wiederbeleben – anders als sein Vorgänger nicht mit russischer, sondern mit chinesischer Hilfe. Arne Schütte hat sich diese Pläne angeschaut.
Und wir stellen Ihnen Kendra Gaither vor, die Cheflobbyistin in der USA für intensivere Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika. Sie hat noch viel zu tun…
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Auch 2024 bleibt der Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt dramatisch. Eine Entspannung der Lage zeichnet sich auch für das kommende Jahr nicht ab. Im Gegenteil: Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts aus dem November sehen die deutschen Unternehmen die fehlenden Fachkräfte als größte Herausforderung an. Der US-amerikanische Personaldienstleister Manpower Group berichtete letzte Woche, Deutschland liege mittlerweile im internationalen Vergleich mit Griechenland und Israel auf Platz 2 der Länder mit dem größten Fachkräftemangel. Demnach haben 82 Prozent der deutschen Unternehmen Probleme, ihre offenen Stellen nachzubesetzen. Im Vergleich zu 2014 habe sich die Zahl der fehlenden Fachkräfte verdoppelt.
Wenn es nach der Berliner Politik geht, sollen künftig gezielt mehr Fachkräfte aus Afrika nach Deutschland kommen. Von der großen Zahl junger Afrikaner, die jährlich auf den Arbeitsmarkt in den afrikanischen Staaten drängen, könne auch Deutschland profitieren. So die Idee. Sowohl die Ampel als auch die Union haben zuletzt verschiedene Modelle vorgestellt. Eine umfassende Strategie gibt es allerdings nicht.
Die Unionsfraktion im Bundestag will laut ihrem neuen Strategiepapier zu Afrika junge Fachkräfte über Austausch- und Stipendienprogramme aus Afrika nach Deutschland holen. Das Strategiepapier soll die Grundlage für die Afrika-Politik der Union in den kommenden Jahren und einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2025 sein.
“Wir brauchen eine gezielte Fachkräfte- und Bildungsmigration, die deutschen, aber auch afrikanischen Interessen gerecht wird, ohne dabei dem ‘Brain-Drain’ Vorschub zu leisten”, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff, der die Projektgruppe Afrika der Unionsfraktion leitet. Daneben müsse die Zusammenarbeit der deutschen und afrikanischen Bildungseinrichtung intensiviert werden. “Der Ausbau solcher Programme kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Entwicklung in afrikanischen Staaten zu forcieren und die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu intensivieren. Andere Staaten setzen solche Instrumente bereits gezielt ein”, so Rouenhoff weiter.
Vorbild ist dabei wie so oft China, das jungen Afrikanern in großer Zahl Stipendienplätze an chinesischen Universitäten anbietet. Deutschland dürfe nach Auffassung der Union dabei den Anschluss nicht verlieren. Diese Austauschprogramme sollen demnach ausdrücklich nicht nur für Studienstipendien vorbehalten sein, sondern auch Berufsprogramme umfassen – allerdings mit einem eindeutigen Kriterienkatalog sowie verbindlichen Ein- und Ausreiseverfahren. Auf konkrete Zielmarken, wie viele Berufsstipendiaten künftig aus afrikanischen Ländern nach Deutschland kommen könnten, will sich die Union in ihrem Vorschlag jedoch noch nicht festlegen.
Arbeitsmarktexperte Steffen Angenendt von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist von den Vorschlägen der Union wenig überzeugt: “Ich habe für ein Strategiepapier, das für die kommenden Jahre angelegt sein soll, mehr erwartet, vor allem konkretere Vorschläge für die Arbeitsmigration.” Diese seien dringend notwendig, um das afrikanische Arbeitskräftepotenzial tatsächlich zu nutzen. Laut einem Bericht der Bertelsmann Stiftung machten Afrikanerinnen und Afrikaner 2022 lediglich sechs Prozent der Erwerbsmigration aus Nicht-EU-Ländern aus.
Doch auch bereits beschlossene Reformen wie die des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Sommer 2023 seien noch verbesserungsfähig, so Angenendt: “Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein großer Stritt nach vorne, die Umsetzung ist allerdings das Problem. Wenn die Ausstellung eines Arbeitstitels monatelang dauert, werden sich kaum Fachkräfte für Deutschland entscheiden.” Mit der Gesetzesnovelle sollen die Hürden für die Fachkräftezuwanderung gesenkt werden.
Indes will das BMZ künftig ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung von Fachkräften für die weltweite Energiewende legen. Mit einem Ende des letzten Jahres vorgestellten Aktionsplan will das BMZ die “grüne Ausbildung” fördern. Von dem Plan sollen auch 27 Länder in Afrika profitieren. In erster Linie sollen dabei junge Menschen für die Arbeitsmärkte in den afrikanischen Ländern ausgebildet werden. Das Ministerium hat in Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana und Nigeria Beratungsstellen eingerichtet, die auch Menschen bei der Migration nach Deutschland beraten sollen. Die Stellen bieten Interessenten Informationen über Qualifikationen sowie Sprachkurse. Um eine gezielte Fachkräfteabwerbung soll es laut einer Sprecherin des BMZ allerdings nicht gehen.
Dabei müssten diese Ansätze viel weitergehen und konkreter werden, sagt Angenendt: “Es steht und fällt alles mit dem Thema Ausbildung und diese muss bereits in den Herkunftsländern ermöglicht werden.” Sehr vielversprechend seien dabei Double-Track-Ausbildungsprogramme, bei denen die Auszubildenden zusätzlich zu einem Ausbildungsweg für den einheimischen Arbeitsmarkt einen “Foreign Track” wählen könnten. “So stellen die Herkunftsländer Arbeitskräfte für den heimischen Markt sicher, gleichzeitig betragen die Ausbildungskosten nur einen Bruchteil der in Deutschland anfallenden Kosten. Bislang gibt es allerdings nur Pilotprojekte vor allem im Gesundheitsbereich. Solche Programme wären beispielsweise auch bei den Green Skills möglich.”
Dass diese Fachkräfte auch für die deutsche Energiewende dringend gebraucht werden, belegt ebenfalls der Blick auf die Zahlen. Laut dem Jobmonitor der Bertelsmann Stiftung benötigt die Bundesrepublik zusätzliche 300.000 Arbeitskräfte, wenn in sieben Jahren 80 Prozent des Stromverbrauchs über grüne Energie abgedeckt sein soll.
Südafrika ist vergangenen Donnerstag in Den Haag beim Internationalen Gerichtshof (IGH), dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, mit seinen besten Rechtswissenschaftlern unter Führung von Justizminister Ronald Lamola angetreten. Der Kern der von Richterin Adila Hassim vorgetragenen 84 Seiten langen Klageschrift: Die Gewalt Israels gegenüber Palästinensern, vor allem im Gazastreifen, sei Völkermord. Das Land am Kap bezieht sich auf die UN-Völkermordkonvention von 1948, die beide Staaten unterzeichnet haben. Per Eilantrag versucht Südafrika, den IGH dazu zu bewegen, sechs konkrete Maßnahmen anzuordnen, um den Konflikt zu beenden. Darunter sind die Beendigung der Militäraktionen mit vielen zivilen Opfern und die Öffnung humanitärer Korridore.
Israel wies am Freitag die Anschuldigungen zurück und verwies auf sein Recht, sich zu verteidigen. Wenn der IGH Südafrikas Klage stattgeben würde, wäre Israel der Hamas schutzlos ausgeliefert. Das israelische Juristenteam konzentrierte die Verteidigung auf die Angriffe der Terrororganisation Hamas und deren enge Beziehungen zum Kläger. Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, forderte den IGH auf, Südafrika anzuweisen, seinen eigenen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht nachzukommen. Das Land solle seine Sprache der Delegitimierung der Existenz Israels sowie seine eigene Unterstützung für die Hamas beenden und seinen Einfluss nutzen, “damit die Hamas ihre völkermörderische Terrorkampagne dauerhaft beendet”.
Unbestritten ist: Seit Jahrzehnten haben Südafrika und Palästina enge solidarische Beziehungen. Während der Apartheid unterstützten die Palästinenser die damalige Befreiungsbewegung African National Congress (ANC) im Kampf gegen die Rassentrennung. Israel hingegen lieferte der unter Sanktionen stehenden weißen Nationalregierung Südafrikas Waffen. Ein Höhepunkt der Beziehungen: Die brüderliche Umarmung zwischen dem kurz zuvor freigelassenen Nelson Mandela und dem damaligen Palästinenserführer Jassir Arafat in Sambia 1990. Auch heute, zehn Jahre nach dem Tod von Mandela, sind die Beziehungen eng. Schon vor dem Terrorakt der Hamas und den israelischen Gegenschlägen haben hochrangige ANC-Politiker die “Apartheid-Politik Israels gegenüber Palästina” angeprangert. Und in Südafrika gibt es bis heute viele Unterstützer Palästinas.
Der Schritt Südafrikas, Israel vor den IGH zu zerren, basiert daher auf einer alten Überzeugung, dass “unsere Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist”, wie Mandela es 1994 ausdrückte. Dass Südafrika dies jetzt wagt, hat aber auch mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Brics-Länder zu tun. Es kann als sicher gelten, dass Südafrika sich eng mit den Brics-Partnern abgestimmt hat. Südafrika hat nach dem erfolgreichen Brics-Gipfel in Johannesburg im vergangenen Jahr an Einfluss gewonnen. Im Schutz der Brics hat die Regierung der westlichen Kritik an seiner Verbindung zu Russland getrotzt und sich international selbstbewusst für die Interessen Afrikas eingesetzt. Mit der ersten afrikanischen Friedensmission zur Lösung eines Konfliktes in Europa hat Südafrika Geschichte geschrieben, wenn auch mit wenig Erfolg.
Taktisch klug halten sich die Brics-Partner mit Stellungnahmen zurück, um die Anklage nicht geopolitisch aufzuladen. Dass sich der Vorstoß mit den Interessen von China, Indien und Brasilien deckt, ist auch so schon offensichtlich: Indien hat historisch eher die Palästinenser unterstützt. Brasilien spricht von “eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht”. Und der chinesische Außenminister Wang Yi fordert, Israel solle seine “kollektive Bestrafung der Menschen in Gaza stoppen”.
Die USA hingegen nennen die Klage Südafrikas “unbegründet und kontraproduktiv”. Sie entbehre “jeglicher faktischen Grundlage”, meint der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Die Vertretung der USA in Pretoria hielt sich aber mit Kritik zurück. Washington “respektiert” das Vorgehen Südafrikas, das “ein souveränes Land” sei. Beide Länder hätten “robuste Handelsbeziehungen”. Ähnlich Großbritannien: “Wir sind mit dem, was die Südafrikaner tun, nicht einverstanden”, kommentierte Außenminister David Cameron.
Die Europäische Union, die Schwierigkeiten hat, ihre 27 Mitgliedsländer im Nahost-Konflikt auf eine gemeinsame Position zu bringen, zeigte sich bedeckt. Stattdessen bemüht sich die EU um eine neutrale Linie, die sowohl Israel das Recht auf Verteidigung zugesteht als auch den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung verlangt. So forderte die EU regelmäßig “humanitäre Pausen” in Gaza. “In Bezug auf diesen konkreten Fall haben die Länder das Recht, Fälle oder Klagen einzureichen”, so EU-Sprecher Peter Stano. “Die Europäische Union ist nicht Teil dieser Klage. Es steht uns überhaupt nicht zu, dazu Stellung zu nehmen.” Also Unterstützung des IGH, aber keine Unterstützung für die Völkermordanklage der Südafrikaner. Für die USA, EU und Großbritannien ist die Hamas eine geächtete Terrororganisation. Aber auch für Deutschland, dem die historische Schuld des Holocaust den politischen Spielraum bis heute einschränkt.
Das Kanzleramt in Berlin ließ am Freitag über Sprecher Steffen Hebestreit eine Erklärung verbreiten, in der es gar vor einer “politischen Instrumentalisierung” des Völkerrechtes warnt. Israel verteidige sich gegen den “menschenverachtenden Angriff” der Hamas: “Den vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermords weist die Bundesregierung entschieden und ausdrücklich zurück.” Dieser Vorwurf entbehre jeder Grundlage. Die Bundesregierung unterstütze die Arbeit des IGH und habe vor, “in der Hauptverhandlung als Drittpartei zu intervenieren.”
Das nahm Südafrikas Nachbar Namibia zum Anlass, die Bundesregierung scharf zu kritisieren. Am Samstagabend erklärte Namibias Präsident Hage Geingob auf dem Kurznachrichtendienst X: “Namibia lehnt Deutschlands Unterstützung für die völkermörderischen Absichten des rassistischen israelischen Staates gegen unschuldige Zivilisten in Gaza ab”, und erinnerte Deutschland daran, “Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen” und auch den Völkermord auf namibischen Boden “vollständig zu sühnen.” Erst 2021 hatte Deutschland seine Gräueltaten an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 als Völkermord anerkannt. Berlin sagte Wiederaufbauhilfen von 1,1 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 30 Jahren zu. Namibia vertritt mit der Stellungnahme die eigenen Interessen gegenüber Deutschland und zeigt sich gleichzeitig solidarisch mit Südafrika. Sollte der IGH allerdings zugunsten Südafrikas entscheiden, wäre das auch ein Sieg des Globalen Südens gegen die Vorherrschaft des Westens.
Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Montag, man habe die Aussagen des namibischen Präsidenten zur Kenntnis genommen. Die Bundesrepublik erkenne die Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San in Namibia als Völkermord an. “Gerade deshalb sind wir der Aufarbeitung dieser Verbrechen und der historischen Verantwortung, zu einer deutsch-namibischen Aussöhnung zu kommen, verpflichtet”, sagte AA-Sprecher Christian Wagner. Die historische Gleichsetzung der Shoah mit dem aktuellen Vorgehen Israels in Gaza weise man zurück.
Äthiopien ist zwar die führende politische Macht am Horn von Afrika. Doch mangelt es dem Land seit der Unabhängigkeit Eritreas 1991 an einem eigenen Hafen. Äthiopien wickelt bisher 95 Prozent seiner Exporte und Importe über den Hafen von Dschibuti ab.
Die politischen und militärischen Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien sind nun eskaliert, nachdem Äthiopien am 1. Januar mit Somaliland eine Absichtserklärung über den Besitz eines Seehafens unterzeichnet hat. Das vorläufige Abkommen sieht vor, dass Äthiopien einen etwa 20 Kilometer langen Küstenstreifen am Golf von Aden für 50 Jahre für Marine- und Handelszwecke pachtet.
Im Gegenzug wird Äthiopien einen “gleichwertigen” Anteil an Ethiopian Airlines anbieten – der größten Fluggesellschaft Afrikas. Die Höhe des Anteils wurde nicht genannt. Redwan Hussien, Sicherheitsberater des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali, erklärte gegenüber staatlichen Medien, dass Äthiopien, sobald das Geschäft abgeschlossen ist, “eine Position zu seinen Bemühungen um Anerkennung einnehmen könnte”. Gemeint ist, dass Äthiopien das Bestreben des Regierungschefs von Somaliland, Muse Bihi Abdi, um internationale diplomatische Anerkennung unterstützen könnte.
Dieses vorläufige Abkommen verärgert Somalia, da es einen Verstoß gegen seine “Souveränität und territoriale Integrität” wertet. Somalia betrachtet Somaliland als Teil seines Territoriums, obwohl sich dieser Landesteil vor fast 33 Jahren abgespalten hatte. In der Kolonialzeit gehörte Somaliland zum britischen Empire, während die übrigen Regionen Somalias – Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Konfur Galbeed und Jubaland – Italienisch-Somalia bildeten. 1960 wurden Britisch-Somalia und Italienisch-Somalia als ein Staat unabhängig.
Immerhin kann sich Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud darauf berufen, dass bisher mit Ausnahme Taiwans kein einziges Land auf der Welt Somaliland als souveränen Staat anerkannt hat. Daher rief Somalia am Tag nach der Absichtsabklärung seinen Botschafter aus Addis Abeba zurück und unterzeichnete fünf Tage später ein Gesetz, das “die illegale Vereinbarung für nichtig erklärt”.
Auch in den sozialen Medien fiel die Reaktion der somalischen Regierung harsch aus: “Dieses Gesetz ist ein Beweis für unsere Verpflichtung, unsere Einheit, Souveränität und territoriale Integrität gemäß internationalem Recht zu schützen”, ließ Hassan Sheikh Mohamud auf X veröffentlichen.
Äthiopien wusste, dass dieser Ärger kommen würde. Laut einer offiziellen Erklärung werde das Abkommen Somalia und seinen Nachbarländern zwar keinen Schaden zufügen, “aber man kann nicht sagen, dass einige nicht beleidigt und schockiert sein werden und nicht versuchen werden, den positiven Fortschritt zu zerstören”.
Im Jahr 2018 schloss Äthiopien einen Vertrag über den Besitz von 19 Prozent des Hafens von Berbera ab, während Somaliland 30 Prozent behielt. DP World, ein führender Hafenbetreiber aus Dubai, sollte die übrigen 51 Prozent besitzen. Die Vereinbarung wurde jedoch nicht umgesetzt, weil Äthiopien ihr “nicht genügend Aufmerksamkeit” schenkte, fügte Redwan hinzu. Obwohl auch gegen dieses Geschäft protestiert wurde, “hatte dies kaum Auswirkungen auf die Beendigung des Projekts”.
Die Nachricht über die Nutzung der Häfen am Roten Meer und am Golf von Aden durch Verhandlungen mit Eritrea, Dschibuti und Somalia kam vom äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed in seiner Rede vor dem Parlament am 13. Oktober 2023. Mit Blick auf das Rote Meer bekräftigte Abiy, dass der Zugang zum Roten Meer “für Äthiopien eine Existenzfrage ist, kein Luxus”.
Unter Verweis auf eine UN-Studie aus dem Jahr 2018 argumentierte Abiy, dass der Zugang zu Seehäfen das BIP des Landes um bis zu 30 Prozent steigern könne, wodurch die für 2030 prognostizierte Bevölkerung von 150 Millionen Menschen ernährt werden könnte.
Die drei Anrainerstaaten haben das Angebot jedoch bisher mit Verweis auf ihre “territoriale Souveränität” abgelehnt. Die eritreische Regierung postete auf X, sie werde sich “wie immer nicht auf solche Gassen und Plattformen einlassen”.
Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung mit Somaliland erklärte Abiys Büro, das Abkommen sei “historisch”, da es “den Zugang zu den Seehäfen diversifiziert” und beiden Parteien wirtschaftlich und politisch zugutekomme. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Antrag wirklich aus wirtschaftlichen Gründen gestellt wurde oder ob er darauf abzielte, verlorenes Territorium zurückzuerobern. Der Verdacht auf Irredentismus ist in der historischen Tatsache verwurzelt, dass Äthiopien schon in der Vergangenheit Nachbarländer, vor allem Eritrea und Somalia, erobert und annektiert hatte.
Daher erklärte Präsident Hassan Sheikh Mohamud am 2. Januar: “Kein einziger Zentimeter Somalias kann und wird von irgendjemandem abgetreten werden. Somalia gehört dem somalischen Volk. Das ist endgültig.” Auch Ali Mohamud Rage, der Sprecher von Al-Shabab – einer militanten Gruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida – schloss sich Berichten zufolge den Worten des Präsidenten an. Er warnte Äthiopien: “Falls Sie dies versuchen sollten, werden Sie bittere Konsequenzen erleiden.”
Am Montag, den 8. Januar, traf sich Präsident Hassan Sheikh Mohamud Berichten zufolge mit Eritreas Präsident Isaias Afwerki. Nach Angaben des eritreischen Informationsministeriums kamen die beiden Staatsoberhäupter überein, “mit Geduld und konstruktivem Geist an regionalen Fragen zu arbeiten und gleichzeitig auf eine reaktive Haltung gegenüber verschiedenen provokativen Agenden zu verzichten.”
Nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter erklärte Hassan gegenüber staatlichen eritreischen Medien, Isaias habe bekräftigt, dass er “die Wahrung der Souveränität, Einheit und territorialen Integrität Somalias” unterstütze. Am selben Tag trafen sich die Generalstabschefs von Somaliland und Äthiopien, Generalmajor Nuh Ismail Tani und Feldmarschall Birhanu Jula, in Addis Abeba. Berichten zufolge erörterten beide “Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der militärischen Kooperation.”
Angesichts dieses diplomatischen Pendelns und des militärischen Kräftemessens stellt sich die Frage, wohin dies führen wird. Manche Beobachter warnen davor, sich auf ein weiteres militärisches Debakel einzulassen, da das Horn von Afrika bereits genügend Konflikte zu bewältigen hat.
Simbabwe steht kurz davor, erstmals in der Geschichte des Landes Gas zu fördern. Ermöglicht hat dies ein australisches Unternehmen, das an seinem Explorationsstandort im Norden des Landes diese Entdeckung bekanntgegeben hat.
Invictus Energy hat in vier Proben aus dem Upper Angwa-Abschnitt seiner Mukuyu-2-Bohrung im Muzarabani-Prospekt Gas gefunden. Invictus Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen in Australien, das auf die Exploration von Mineralöl und Erdgas in Afrika spezialisiert ist. Ungeachtet dieses Funds ist der Aktienkurs in den vergangenen vier Wochen um 49 Prozent auf rund 0,11 Austral-Dollar gefallen. Grund dafür ist jedoch, dass Invictus direkt nach der Entdeckung am 3. Januar das Kapital um mehr als 115 Millionen Aktien und knapp 58 Millionen Optionen erhöht. Insofern sind die Kursverluste eine technische Reaktion auf die Kapitalerhöhung.
“Die Entdeckung stellt eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Onshore-Öl- und Gasindustrie im südlichen Afrika seit Jahrzehnten dar”, sagte Scott Macmillian, Vorstand von Invictus Energy. Das Unternehmen hat mittlerweile Proben zur unabhängigen Bewertung in die USA geschickt. Außerdem will Invictus das Becken nach weiteren Bohrzielen erkunden. Invictus Energy exploriert in diesem Gebiet seit rund zehn Jahren.
Die Regierung von Simbabwe setzt große Hoffnungen in das Gasprojekt. Sie erwartet, dass es positive Auswirkungen auf das Land haben wird. “Diese Entdeckung wird die Wirtschaftslandschaft Simbabwes verändern”, sagte Simbabwes Bergbau- und Bergbauentwicklungsminister Soda Zhemu, der es als eine wichtige Entwicklung im Onshore-Öl- und Gassektor in der Region Südafrika beschrieb.
“Wir glauben, dass sich diese Entdeckung positiv auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Simbabwes auswirken wird“, fügte Zhemu hinzu. “Gas wird zur Diversifizierung des Energiemixes Simbabwes beitragen, die Energiesicherheit des Landes verbessern sowie Arbeitsplätze und Möglichkeiten für die lokalen Gemeinschaften schaffen.”
Der Gasfund ist eine positive Nachricht für Simbabwe. Aber es wird Jahre dauern, die Ressource zu erschließen. Das Land benötigt mehr Exploration, Infrastruktur und Märkte, um das Gas zu produzieren und zu verkaufen. Es muss sich auch mit Umwelt- und Sozialfragen befassen und die Gaseinnahmen transparent und gerecht verwalten.
Bis das Gas gefördert und zu den Märkten transportiert werden kann, werden Jahre weiterer Investitionen und Infrastrukturentwicklung erforderlich sein. Invictus Energy fand Gas früher als viele andere Explorationsunternehmen in neuen Gebieten, wo die Erfolgsaussichten Experten zufolge weniger als zehn Prozent betragen.
Die Gasentdeckung könnte jedoch Simbabwe in die Geopolitik der Energie katapultieren, da Simbabwe ein neuer Akteur auf dem globalen Gasmarkt und ein potenzieller Partner oder Konkurrent für andere Gasproduzenten und -verbraucher werden könnte. Wenn die Gasentdeckung vollständig ausgereift ist, könnte sie auch zur globalen Energiewende beitragen, da Erdgas im Allgemeinen sauberer als Kohle und Öl ist und erneuerbare Energiequellen ergänzen könnte.
Allerdings könnte die Ressource auch die globalen Kohlenstoffemissionen erhöhen und die Umstellung auf kohlenstoffarme Energiequellen verzögern. Es sei denn, das Gas wird in Kombination mit Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung oder zur Wasserstoffproduktion verwendet.
Simbabwe kann von seinen Nachbarländern lernen, die bei ihren Gasprojekten mit Herausforderungen und Verzögerungen konfrontiert waren. Angola und Mosambik sind die wichtigsten Gasproduzenten im südlichen Afrika. Ihre LNG-Exporte wurden jedoch durch verschiedene Probleme behindert. Südafrika und Tansania befinden sich noch im Anfangsstadium der Gasentwicklung.
Der deutsche Softwarekonzern SAP ist in einen Korruptionsskandal verwickelt. Das börsennotierte Unternehmen ist vergange Woche vom US-Justizministerium in einem Vergleich zu einer Strafe von umgerechnet rund 200 Millionen Euro verurteilt worden. Eine Untersuchung hat nachgewiesen, dass SAP South Africa, ein Tochterunternehmen von SAP, Bestechungsgelder unter anderem an südafrikanische Beamte gezahlt hat. Die Beamten sollen Finanzdokumente manipuliert haben, um SAP Wettbewerbsvorteile bei ihren Verträgen mit verschiedenen südafrikanischen Regierungsabteilungen zu verschaffen. Das zweite Land, das neben Südafrika untersucht wurde, ist Indonesien.
In Südafrika sind unter anderem Johannesburg, Pretoria, das nationale Wasseramt und das staatliche Stromunternehmen Eskom in den Skandal involviert. Die Bestechungen sollen zwischen 2013 und 2017 stattgefunden haben. “SAP hat die Verantwortung für korrupte Praktiken übernommen, die ehrlichen Unternehmen im globalen Handel schaden”, sagte US-Staatsanwältin Jessica Aber.
In einer Mitteilung begrüßte SAP die Vergleichsvereinbarungen, nachdem das Unternehmen eine “gründliche und umfassende Untersuchung des Fehlverhaltens durchgeführt” und “uneingeschränkt mit den Behörden kooperiert” hatte. Seitdem habe SAP “sein globales Compliance-Programm und die damit verbundenen internen Kontrollen deutlich verbessert.” SAP achte weiterhin auf die “Einhaltung höchster Ethik- und Compliance-Standards, damit SAP gemeinsam mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Lieferanten, Mitarbeitern und Vordenkern dazu beitragen kann, dass die Welt besser funktioniert und das Leben der Menschen verbessert.”
Neben Bestechungsgeldern wurden südafrikanische Beamte 2015 auf luxuriöse Golfreisen in die USA eingeladen und mit Luxusgütern beschenkt. SAP soll über Mittelsmänner und Berater mit den Beamten kommuniziert haben. Die Bestechungen fallen in die zweite Hälfte der Amtszeit des umstrittenen damaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma, der zwischenzeitlich wegen Korruption für zwei Jahre im Gefängnis saß. Vermittelt wurden auch Aufträge in Malawi, Kenia, Tansania und Ghana. as
Der chinesische Außenminister Wang Yi hat angekündigt, die Beziehungen zu Ägypten zu vertiefen. Die bilaterale Zusammenarbeit solle ein neues Level erreichen, sagte Wang laut des chinesischen Auslandssenders CGTN am Sonntag in Kairo. Wang sprach dort mit seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri. Ägypten zählt zu den sechs Ländern, die in diesem Jahr dem Brics-Wirtschaftsblock um China, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika als neue Mitglieder beitreten. Ägypten war die erste Station von Chinas Top-Diplomat bei seinem Afrika-Besuch, der vergangenen Freitag gestartet war. Bis zum 18. Januar will Außenminister Wang noch Tunesien sowie Togo und die Elfenbeinküste in Westafrika besuchen.
Die Außenminister Chinas und Ägyptens sprachen auch über den Krieg in Nahost und forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine umfassende Waffenruhe. Die Regierung in Kairo spielt eine wichtige Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Erst vor wenigen Tagen tauschte sich Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem ägyptischen Amtskollegen aus und übergab in der Nähe des Grenzübergangs Rafah ein Zehn-Tonnen-Hilfspaket für die Palästinenser in Gaza an den Ägyptischen Roten Halbmond.
Der Krieg in Nahost hat inzwischen auch Folgen für den internationalen Seehandel. Wang und Schukri appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich für eine Entspannung einzusetzen, sodass auch der Seeweg im Roten Meer wieder sicher genutzt werden könne. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Hamas mehrfach Schiffe im Roten Meer angegriffen. Die Huthis, die auf Seiten der radikal-islamistischen Hamas stehen, geben an, dass es um Schiffe gehe, die angeblich eine Verbindung zu Israel hätten. Inzwischen befahren einige große Reedereien den betroffenen Seeweg nicht mehr.
China ist inzwischen stark in Ägyptens Häfen aktiv und investiert seit einigen Jahren verstärkt in das Land. Zwischen 2017 und 2022 sind Chinas Investitionen in Ägypten um 317 Prozent gestiegen, wie ein Bericht des amerikanischen Middle East Institutes angibt. Die Afrika-Tour von Außenminister Wang hat großen Symbolwert: Es ist das 34. Jahr in Folge, dass Wangs erste Fernreise im neuen Jahr auf den afrikanischen Kontinent führt, wie ein Ministeriumssprecher sagte.
Außerdem lädt China in diesem Jahr nach Peking zu neunten Ausgabe des Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Auf der Konferenz (Datum noch unbekannt) wird es um die weitere Vertiefung der Beziehungen mit den Ländern Afrikas gehen. Im Fokus steht dabei das chinesische Infrastrukturprogramm Belt and Road Initiative (BRI), aber auch die Bereiche Industrialisierung, Landwirtschaft sowie die teils hohen Staatsschulden der afrikanischen Staaten. lcw
Nigerias vernachlässigte Stahlindustrie soll mit chinesischer Unterstützung neuen Schwung bekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des nigerianischen Minen- und Stahlministeriums hervor. Die Ankündigung kommt in Folge einer China-Reise des zuständigen Ministers Shuaibu Audu sowie des Verteidigungsministers Mohammed Badaru Abubakar. Die beiden hatten dort kürzlich Vertreter des staatlichen Stahlkonzerns Luan Steel Holding Group getroffen.
Luan Steel und Nigeria planen demnach den Bau eines neuen Stahlwerks in dem Land sowie die Rehabilitierung des maroden Ajaokuta-Stahlwerks. In Ajaokuta sollen erstmals Militärgüter produziert werden. Stahlminister Audu betonte, dies sei ein wichtiger strategischer Schritt für Nigeria im Kampf gegen Unsicherheit und Terrorismus.
Ajaokuta war schon in den 1980er-Jahren mit sowjetischer Unterstützung gebaut worden. Allerdings ist der Bau nach mehr als 40 Jahren noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Zwar wird in dem Werk inzwischen importierter Stahl gewalzt. Jedoch wurde bis heute noch kein nigerianisches Eisen zu Stahl verarbeitet. Auch das heruntergekommene Stahlwerk Delta Steel in Warri walzt bisher nur importierten Stahl.
Nigeria hat bereits in der Vergangenheit versucht, seine Stahlwerke durch die Übertragung an internationale Rohstoffkonzerne zum Laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Auf dem Russland-Afrika-Gipfel 2019 in Sotschi hatte sich der damalige Präsident Muhammadu Buhari mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine Revitalisierung des Ajaokuta-Werks mit russischer Hilfe verständigt. Durch die Covid-Pandemie wurden diese Pläne verzögert und konnten letztendlich nicht innerhalb von Buharis Amtszeit durchgeführt werden. Die neue nigerianische Regierung unter Bola Tinubu ist hingegen offenbar stärker an einer Kooperation mit China interessiert. ajs
Laut dem Global Cities Report 2023 haben soziale, geopolitische und technologische Verschiebung die traditionelle Rangordnung globaler Städte verändert. Metropolen des Globalen Südens, darunter Afrika, haben aufgeholt. Der Bericht der Unternehmensberatung Kearney hebt hervor, dass “führende globale Städte einer immer größeren Konkurrenz durch aufstrebende Zentren ausgesetzt sind, wobei diese sich erneuern, um Talent, Innovation und Investitionen anzuziehen.
In Afrika gehören Johannesburg (58. Platz), Kapstadt (84), Nairobi (86), Accra (104) und Lagos (109) zu den besten Städten, die vor allem beim Global Cities Index (GCI) gut angeschnitten haben. In Nordafrika hat sich Casablanca als Zentrum etabliert. Im globalen Durchschnitt verbesserten sich afrikanische Städte leicht auf Rang 104 von 156 untersuchten Metropolen, was vor allem an der Zunahme von Wirtschaftsaktivitäten liegt. Zudem legten die Städte in der Kategorie politisches Engagement zu. Die europäischen Städte kommen im Durchschnitt auf Rang 30.
Der GCI misst, inwieweit Städte Investitionen sichern, Menschen und Ideen anziehen und diese auch halten können. Die Städte werden hierbei in fünf Kategorien bewertet: Humankapital, Informationsaustausch, kulturelle Erfahrung politisches Engagement und Wirtschaftsaktivitäten. Zum Vergleich, global konnten sich New York, London, Paris, Tokio und Peking in den Top-5 behaupten. Beste deutsche Stadt ist Berlin an 16. Stelle, gefolgt von Frankfurt (27).
Globale Städte zeichnen sich durch ihre internationalen Verbindungen aus, deren dynamische Mikrokosmen die Welt prägen. “Angesichts der Tiefe ihrer globalen Vernetzung sind sie einerseits anfällig für globale Verschiebungen, die den Kapital-, Personen- und Ideenfluss der ganzen Welt stören”, heißt es. “Gleichzeitig profitieren sie aber auch von diesen Trends, ziehen überproportional viele Talente und Investitionen an und fungieren als Innovationszentren und Katalysatoren für Wirtschaftswachstum.“
Die Kluft zwischen diesen Städten und etablierten Metropolen hat sich verringert. “Gerade in diesem Jahr können wir sehen, wie eine ausgewogene politische und ökonomische Positionierung aufstrebender Zentren für Kapital, Handel und Menschen aus der ganzen Welt immer attraktiver gemacht hat”, kommentiert Rudolph Lohmeyer von Kearney. as
Die nigerianische Dangote-Ölraffinerie hat nach jahrelangen Verzögerungen beim Bau der Anlage die Produktion von Diesel und Flugbenzin aufgenommen, wie der Betreiber Dangote Group am Samstag mitteilte. Die größte Raffinerie Afrikas wurde von Aliko Dangote, dem reichsten Mann des Kontinents, in der Lekki Free Trade Zone am Rande der Handelshauptstadt Lagos gebaut. Die Baukosten für das Mega-Projekt betrugen 20 Milliarden Dollar.
Obwohl Nigeria der größte Energieproduzent Afrikas ist, ist das Land für den Großteil seines Kraftstoffverbrauchs bislang auf Importe angewiesen. Alle vier Raffinerien des staatlichen Ölkonzerns NNPC sind zurzeit außer Betrieb und müssen aufwändig renoviert und gewartet werden, bevor sie wieder funktionsfähig sind.
Die Dangote-Raffinerie ist die erste nigerianische Raffinerie in privater Hand. Sie soll das Land nicht nur unabhängig von Importen machen, sondern auch den Export von Treibstoff in die benachbarten westafrikanischen Länder ermöglichen. Das könnte den Ölmarkt in der Region nachhaltig verändern.
“Dies ist ein großer Tag für Nigeria. Wir freuen uns, diesen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben”, teilte das Unternehmen auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.
Experten zufolge könnte es Monate dauern, bis die Rohöl-Destillationsanlage der Raffinerie von den Testläufen zur Produktion hochwertiger Kraftstoffe bei voller Kapazität übergeht.
Dangote hat erklärt, dass die Raffinerie zunächst 350.000 Barrel pro Tag verarbeiten wird und hofft, die Produktion im Laufe des Jahres auf die volle Kapazität von 650.000 Barrel pro Tag hochfahren zu können. Die Raffinerie soll bis zu 53 Millionen Liter Benzin, 4 Millionen Liter Diesel und 2 Millionen Liter Kerosin täglich produzieren sowie 12.000 Megawatt Stromleistung. rtr/ajs

Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren ist Afrika bekanntlich der jüngste Kontinent. Wir Deutschen sind dagegen mit im Durchschnitt 44,6 Jahren mehr als doppelt so alt. Alternden Gesellschaften sagt man nach, am Bestehenden festzuhalten und sich nur träge zu entwickeln. Junge Gesellschaften gelten als dynamisch und innovativ. In Zeiten disruptiver Wirtschaftsentwicklungen ist dies ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Die junge Generation in Afrika ist gebildeter als ihre Eltern, aber sie ist dennoch häufiger ohne formalen Job. Die hohe Arbeitslosigkeit ist frustrierend und führt dazu, dass sich viele Jugendliche um ihre beruflichen Chancen betrogen fühlen. Eine kritische Konstellation, so Nathalie Delapalme, Chefin der Mo Ibrahim Foundation. Im schlechtesten Fall sorgt diese für einen Zulauf auf Terrorgruppen und Beifall für Putschisten, wie kürzlich im Sahel.
Dabei gäbe es gute Optionen, denn der Jugendarbeitslosigkeit steht ein großer Fachkräftemangel gegenüber. “Skilled Workers” gelten als Flaschenhals für alle Zukunftsmärkte, in der Fintech ebenso wie bei der Rohstoffverarbeitung oder in der Klimatechnologie. Es mangelt an Facharbeitern wie Ingenieuren, Handwerkern oder IT-Spezialisten, und überall an jungen Unternehmern. Die besten Karrieren liegen in der boomenden Gründerszene auf dem Kontinent. Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sieht in den afrikanischen Start-Ups den Schlüssel zur wirtschaftlichen Transformation, und verkündet auf dem The Africa Roundtable die Erweiterung entsprechender Förderprogramme.
Die Diskrepanz zwischen den Bildungsabschlüssen und den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt ist vielfach beschrieben. Das traditionelle Bildungssystem auf dem Kontinent braucht voraussichtlich viele Jahre, um sich zu reformieren. Gebraucht werden Skills – und damit neue Wege, um die Kluft zu überbrücken. Als Ideal gilt vielen das duale Bildungssystem in Deutschland. Es gibt Unternehmen, die nicht nur in den Bau von Fertigungsanlagen investieren, sondern auch ihre Ingenieurschulen mitbringen – ein bewährtes Konzept, das die großen deutschen Konzerne vor Jahrzehnten in China angewandt und bis heute beibehalten haben.
Der Technologiekonzern Voith hat dieses Vorgehen bereits in 25 Ländern auf dem Kontinent vorgemacht. Doch von Unternehmen wie ihnen gibt es auf dem afrikanischen Kontinent bisher zu wenig, und die staatliche berufliche Bildung bedient ebenfalls nur rund ein Prozent der jungen Menschen. Das African Center for Economic Transformation (ACET) fordert deshalb einen zügigen Ausbau in diesem Bereich.
Länder wie Ruanda, Ghana oder Südafrika unternehmen vorbildliche Anstrengungen, um die vier größten Herausforderungen zu bewältigen:
Sozialunternehmer haben diesen Bedarf entdeckt und bauen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und “Blended Learning”-Arrangements erfolgreich Brücken in die Wirtschaft. Weit über den afrikanischen Kontinent hinaus bekannt geworden sind die African Leadership Academy und die African Leadership University, gegründet vom McKinsey-Direktor Afrika Acha Leke und dem Social Entrepreneur Fred Swaniker, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2035 drei Millionen afrikanische Führungskräfte auszubilden.
Oder das soziale Netzwerk Goodwall der Brüdern Taha und Omar Bawa, das soziale Interaktion mit dem Aufbau von Skills erfolgreich verbindet. Der ehemalige BCG-Senior-Partner Martin Hecker hat mit Amali Tech in Ghana und Ruanda große Bildungszentren für angehende Softwareentwickler aufgebaut. Ihnen allen gelingt es, ihre Kandidaten in Jobs zu vermitteln.
Und alle setzen dabei auf “Talent over Education”. Taha Bawa nennt Skills sogar “die neue Währung in der Wirtschaft“. Mit dem Skalierungspotenzial der sozialen Netzwerke wollen er und viele andere das Zugangstor weit aufstoßen. Die digitale Revolution schafft auch neue Arbeitsmärkte. Remotes Arbeiten funktioniert in Addis Abeba und Nairobi ebenso wie in Lissabon, Toronto oder Bangalore, ganz gleich ob die Firmen in Seattle oder Singapur ihren Sitz haben.
Gute Aussichten für den jüngsten Kontinent, und eine Option für Europa, wo immer mehr Fachkräfte dringend gesucht werden. Europa wird ihnen schon bald den roten Teppich ausrollen, ist der afrikanische Unternehmer und Stifter Mo Ibrahim überzeugt. Arbeitsmigration ist hierzulande ein heikles Thema, das dringend einer rationalen Diskussion bedarf, um gerechte Lösungen zum beidseitigen Vorteil zu finden.
Dr. Ingrid Hamm ist Mitgründerin der Berliner Dialogplattform Global Perspectives Initiative. The Africa Roundtable zum Thema “The Path to Success: Education, Skills and Leadership” fand nach Stationen in Dakar und Nairobi wieder in Berlin statt. Lesen Sie die Handlungsempfehlungen hier.
Bloomberg: Ericsson will die Hälfte aller afrikanischen mobilen Zahlungen abwickeln. Die Software des schwedischen Unternehmens unterstützt schon heute zehn Prozent aller mobilen Transaktionen in Afrika sowie mehr als jede fünfte weltweit. Der neue Chef der Abteilung für mobile Finanzdienste strebt für Afrika eine Quote von 50 Prozent an. Ericsson hat darum seine zehnjährige Partnerschaft mit Afrikas größtem Mobilfunkbetreiber MTN verlängert.
Wall Street Journal: Wie Frankreich seine Afrika-Beziehungen verpatzte und eine geopolitische Krise auslöste. In weiten Teilen des frankophonen Afrikas ist die Verhöhnung der Franzosen zu einer mächtigen Parole geworden. Dem von Präsident Macron versprochenen Neuanfang zum Trotz nehmen viele Menschen das französische Vorgehen nach wie vor als Heuchelei und Bevormundung wahr. Der Vorwurf: Anstatt sich tatsächlich um eine verbesserte Sicherheitslage zu bemühen, unterstütze Frankreich aus Eigeninteresse weiterhin die frankophonen aber korrupten Eliten vor Ort.
Devex: Der MCC-Effekt – Wie eine Politik-Scorecard die Reformpläne der DR Kongo unterstützt. Die staatliche US-Hilfsorganisation Millenium Challenge Corporation (MCC) hat Anforderungen formuliert, die die Länder erfüllen müssen, um sich für Zuschüsse zu qualifizieren. In der Demokratischen Republik Kongo hat Präsident Félix Tshisekedi die MCC-Kriterien als Entwurf für die Reformagenda seines Landes übernommen. Nach Ansicht von Experten verdeutlicht dies das Potenzial der MCC-Scorecard, Reformanreize bei Regierungsführung, Korruption und Bürgerrechten zu geben.
Semafor: Russland bietet Afrikanern kostenlosen Sprachunterricht. Russland hat im vergangenen Jahr Hunderte von jungen Afrikanern für seine russischen Sprach- und Kulturprogramme auf dem gesamten Kontinent angeworben. Die Kurse werden im Rahmen eines umfassenderen Vorstoßes des Kremls angeboten, der darauf abzielt, die Beziehungen zu den Bürgern und Regierungen Afrikas zu vertiefen.
The East African: Was Ugandas Agoa-Ausschluss für Ostafrika bedeutet. Die USA haben Uganda wegen seines Anti-LGBTQ-Gesetzes aus dem African Growth and Opportunity Act (Agoa) ausgeschlossen. Das Gesetz ermöglicht afrikanischen Ländern präferentiellen Zugang zum amerikanischen Markt. Kenia und Tansania könnten profitieren, indem sie Strategien entwickeln, um US-Konzerne aus Uganda abzuwerben.
Bloomberg: Gewerkschaften stellen Bedingungen für Privatisierung des Hafens von Durban. Die südafrikanische Hafeninfrastruktur ist marode und ineffizient. Die geplante Übernahme des größten afrikanischen Containerhafens Durban durch die philippinische ICTSI soll das ändern. Zwei südafrikanische Gewerkschaften haben nun Forderungen an ICTSI gestellt.
Nation: Somaliland geht hart gegen Kritiker des Äthiopien-Deals vor. In der somaliländischen Hauptstadt Hargeisa haben Sicherheitskräfte die Büros eines Fernsehsenders durchsucht und Journalisten verhaftet. Einige Mitarbeiter wurden mit verbundenen Augen in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen abgeführt. Anlass war offenbar eine den Behörden unliebsame Diskussionsrunde zum geplanten Abkommen mit Äthiopien. Das Programm wurde durch die Razzia gewaltsam und abrupt unterbrochen.
DW: Äthiopiens schwerer Start in die Brics-Ära. Äthiopiens erste Tage als Brics-Mitglied sind alles andere als sorgenfrei. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Währung ist im Sinkflug und wegen des geplanten Abkommens mit Somaliland gibt es neue Verstimmungen mit dem Nachbarn Somalia. Dennoch gibt es Hoffnung für die Zukunft.
The Conversation: Afrika kann bei den vorgeschlagenen WTO-Instrumenten nur verlieren. Die Welthandelsorganisation hat während der COP28-Konferenz ihre “Trade Policy Tools for Climate Action” vorgestellt. Olabisi D. Akinkugbe, Experte für internationales Wirtschaftsrecht, erörtert, ob die neuen handelspolitischen Instrumente Afrika zugutekommen.
Financial Times: Die jungen Leute, die die schlimmsten Schrecken des Internets durchforsten. Die Moderation von Inhalten gehört zu den Hauptaufgaben sozialer Medien. Doch die damit verbundene Arbeit ist häufig schwer traumatisierend. Junge afrikanische Content-Moderatoren, die mit dem Versprechen auf Arbeitsplätze an der “Spitze der KI” gelockt wurden, kämpfen nun um ihre Rechte auf besseren Schutz. Die britische Finanzzeitung hat mit einigen der von Facebook und anderen beschäftigten Moderatoren gesprochen.

Für die USA spielen die Wirtschaftsbeziehungen zum afrikanischen Kontinent keine große Rolle. Zwar sind wohl die meisten großen Unternehmen in Afrika präsent, von Mars, Coca-Cola, Philip Morris und Kellogg’s über die Autohersteller bis zu den großen Tech-Konzernen Microsoft, Facebook oder Google. Auch die großen Ölkonzerne fehlen nicht. Doch eine echte Strategie für die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika haben die USA nie formuliert.
Es gab vereinzelte Versuche. Zuletzt hatte Barack Obama in seiner Zeit als US-Präsident (2009 bis 2017) unter dem Schlagwort Power Africa eine gigantische Strategie für den Aufbau der Stromversorgung in Afrika präsentiert. Der Ankündigung folgten keine greifbaren Ergebnisse. Immerhin haben die USA schon im Mai 2000 den African Growth and Opportunity Act (Agoa) beschlossen, der auch heute noch einen Rahmen für die amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika setzt.
Kendra Gaither will das Desinteresse amerikanischer Unternehmen für Afrika ändern. Seit Mitte Oktober ist sie bei der amerikanischen Handelskammer Präsidentin des US-Africa Business Center und damit die führende Lobbyistin für die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika. “Das Center repräsentiert die Überzeugung der Unternehmen, dass es die Chance und Notwendigkeit gibt, die Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den USA und Afrika auszubauen”, sagte Gaither denn auch nach ihrer Berufung.
Seit acht Jahren arbeitet Gaither für die amerikanische Handelskammer. Sie bringt eine ausgewiesene Expertise mit. So absolvierte sie in Washington einen Master in Internationaler Politik und einen MBA in internationaler Wirtschaft an der George Washington University.
Anschließend arbeitete sie zehn Jahre lang im amerikanischen Außenministerium, wo sie sich auf den Handel mit Lateinamerika und Subsahara-Afrika spezialisierte. Unter anderem arbeitete sie im Afrika-Referat, in der Südafrika-Abteilung und als Koordinatorin für den Agoa. Danach leitete sie das Zentrum für Internationale Politik und Innovation an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh und baute einen Campus der Hochschule in Kigali auf. Heute leitet sie neben ihrer neuen Aufgabe die Coalition for the Rule of Law in Global Markets und den US-South Africa Business Council.
Zwar hat Gaither nicht selbst in Afrika gelebt. Doch sie gilt angesichts ihrer tiefen Kenntnis internationaler Beziehungen als überzeugende Besetzung, um das Thema Afrika in der weltgrößten Unternehmensorganisation voranzutreiben. Das ist auch notwendig. Die USA haben im Jahr 2023 (Januar bis November) laut dem Census Bureau Waren im Wert 26,3 Milliarden Dollar nach Afrika exportiert und Waren im Wert von 35,7 Milliarden Dollar importiert. Für 2022 liegen die vergleichbaren Zahlen für Exporte bei 28,4 Milliarden Dollar (Gesamtjahr: 30,7 Milliarden Dollar) und für Importe bei 38,8 Milliarden Dollar (Gesamtjahr 41,8 Milliarden Dollar).
Angesichts von Exporten von 254 Milliarden Dollar und Importen von 317 Milliarden Dollar allein im November 2023 ist der Afrika-Handel eine vernachlässigbare Größe in der Außenwirtschaft der USA. Auch aus afrikanischer Sicht spielt der Handel mit den USA eine untergeordnete Rolle. Der afrikanische Außenhandel mit dem Rest der Welt ist im Jahr 2022 um rund 200 Milliarden Dollar auf 1,38 Billionen Dollar gestiegen. Den größten Anteil haben traditionell Erdöl und Erdgas.
Immerhin weiß Gaither, dass sie am selben Strang wie US-Präsident Joe Biden zieht. Dieser hatte im Dezember 2022 angekündigt, die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika ausbauen zu wollen. “Die Vereinigten Staaten werden die Mobilisierung von privatem Kapital unterstützen und erleichtern, um das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine stärkere Beteiligung der USA an der Zukunft Afrikas voranzutreiben”, hieß es damals in einer Mitteilung des Weißen Hauses.
Biden will den Schwerpunkt auf Infrastruktur, Mittelstand, auf Unternehmen der afrikanischen Diaspora in den USA und auf von Frauen geführte Unternehmen legen. So will er den “wechselseitigen Handel und die Investitionen ankurbeln”. Seit 2021, als Biden sein Amt antrat, habe die US-Regierung dazu beigetragen, mehr als 800 Handels- und Investitionsabkommen in 47 afrikanischen Ländern mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 18 Milliarden Dollar abzuschließen. US-Unternehmen hätten Investitionsabkommen im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar in Afrika vereinbart.
Immerhin kann sich Gaither in ihrer Lobbyarbeit für US-Engagements in Afrika auch auf die Unterstützung des State Department verlassen. Dieses richtete im Dezember 2022 den dreitägigen US-Africa Leaders Summit aus und im Juli 2023 den ebenfalls dreitägigen US Africa Business Summit in Gaborone. Diesen unterstützten führende US-Unternehmen wie Chevron, Exxon Mobil, Visa, Citi, General Electric, Caterpillar oder Pfizer. Darauf könnte sich aufbauen lassen. Christian v. Hiller
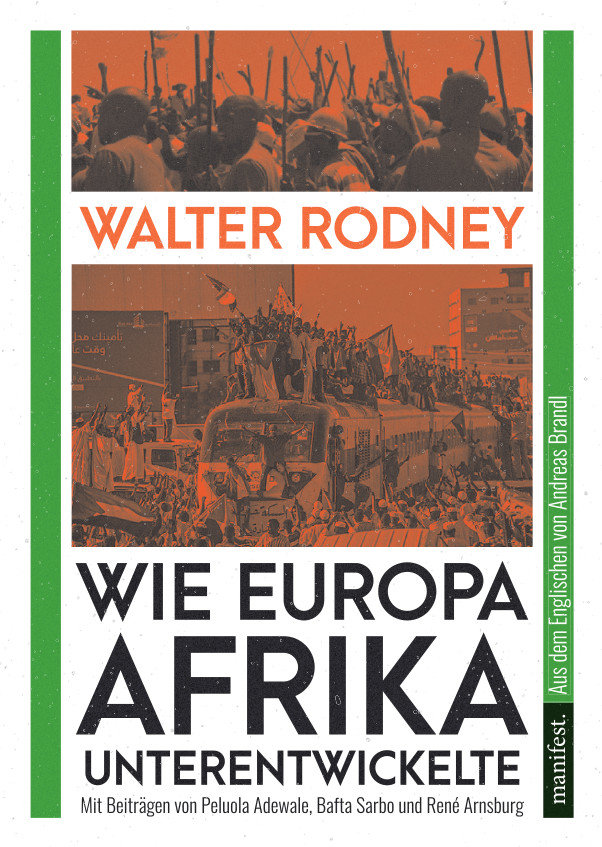
Walter Rodneys “How Europe Underdeveloped Africa” zählt zurecht zu den wichtigsten afrikahistorischen Werken des 20. Jahrhunderts. Doch seine Analyse der politischen Ökonomie von Kolonialismus und Imperialismus hat auch im Jahr 2024 noch Aussagekraft – gerade für ein Europa, das sich die Neuordnung der Beziehungen zum Nachbarkontinent auf die Fahnen geschrieben hat. Die komplett neue deutsche Fassung des Berliner Verlags Manifest unter dem Titel “Wie Europa Afrika unterentwickelte” kommt also genau zur rechten Zeit.
In dem 1972 erstmals erschienenen Band stellt der guyanische Historiker und panafrikanische Aktivist eindrücklich dar, wie Afrikas “Unterentwicklung” und die rapide Entwicklung der westlichen Kolonialmächte einander bedingten. So ist Rodneys Werk auch heute noch relevant, um die anhaltende Kluft der globalen Ungleichheit zu verstehen.
Rodney dokumentiert akribisch und anschaulich die ausbeuterische Natur der frühen euro-afrikanischen Beziehungen, sowie deren Effekte auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung: Die ständige Expatriierung des durch afrikanische Arbeit aus afrikanischen Ressourcen produzierten Überschusses mithilfe von monopolistischen Handelsgesellschaften ermöglicht die Entwicklung neuer Technologien, Materialien und Organisationsformen im Westen, die wiederum zur Ungleichheit beitragen. So erforderte beispielsweise der Transport großer Mengen von Rohstoffen Innovationen in der Schifffahrt und Logistik sowie in der Kühlung. Die Rohstoffe ermöglichten die Schaffung neuer Industrien für veredelte Güter in Europa, etwa fortgeschrittene Metallurgie, die petrochemische Industrie oder die Herstellung von Konsumgütern wie Schokolade. Afrikanisches Kupfer ermöglichte die Elektrifizierung Europas. So wuchs aus Ungleichheit mehr Ungleichheit.
Europas Schicksal war, ist und wird untrennbar mit dem seines Nachbarn Afrika verbunden bleiben. Um künftig als ebenbürtige Partner zu agieren, gilt es, zu verstehen, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Dafür bietet Walter Rodneys Klassiker auch mehr als 50 Jahre nach Erstveröffentlichung noch jede Menge Stoff. ajs
Walter Rodney: Wie Europa Afrika unterentwickelte. Manifest Verlag, Berlin, 2023, 418 Seiten, 20 Euro.
die Diplomaten in Afrika sind auch im neuen Jahr wieder stark beschäftigt. Das Abkommen Äthiopiens mit Somaliland verschärft die vielen Konflikte am Horn von Afrika und bringt neue Verbündete zusammen. Darüber berichtet Merga Yonas Bula.
Und natürlich schlägt auch hohe Wellen, dass Südafrika Israel wegen des Kriegs in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof gebracht hat. Was diese Anklage außenpolitisch bedeutet, analysiert Andreas Sieren.
Auch wirtschaftlich herrscht große Bewegung. Präsident Tinubu will die nigerianische Stahlindustrie wiederbeleben – anders als sein Vorgänger nicht mit russischer, sondern mit chinesischer Hilfe. Arne Schütte hat sich diese Pläne angeschaut.
Und wir stellen Ihnen Kendra Gaither vor, die Cheflobbyistin in der USA für intensivere Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika. Sie hat noch viel zu tun…
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Auch 2024 bleibt der Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt dramatisch. Eine Entspannung der Lage zeichnet sich auch für das kommende Jahr nicht ab. Im Gegenteil: Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts aus dem November sehen die deutschen Unternehmen die fehlenden Fachkräfte als größte Herausforderung an. Der US-amerikanische Personaldienstleister Manpower Group berichtete letzte Woche, Deutschland liege mittlerweile im internationalen Vergleich mit Griechenland und Israel auf Platz 2 der Länder mit dem größten Fachkräftemangel. Demnach haben 82 Prozent der deutschen Unternehmen Probleme, ihre offenen Stellen nachzubesetzen. Im Vergleich zu 2014 habe sich die Zahl der fehlenden Fachkräfte verdoppelt.
Wenn es nach der Berliner Politik geht, sollen künftig gezielt mehr Fachkräfte aus Afrika nach Deutschland kommen. Von der großen Zahl junger Afrikaner, die jährlich auf den Arbeitsmarkt in den afrikanischen Staaten drängen, könne auch Deutschland profitieren. So die Idee. Sowohl die Ampel als auch die Union haben zuletzt verschiedene Modelle vorgestellt. Eine umfassende Strategie gibt es allerdings nicht.
Die Unionsfraktion im Bundestag will laut ihrem neuen Strategiepapier zu Afrika junge Fachkräfte über Austausch- und Stipendienprogramme aus Afrika nach Deutschland holen. Das Strategiepapier soll die Grundlage für die Afrika-Politik der Union in den kommenden Jahren und einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2025 sein.
“Wir brauchen eine gezielte Fachkräfte- und Bildungsmigration, die deutschen, aber auch afrikanischen Interessen gerecht wird, ohne dabei dem ‘Brain-Drain’ Vorschub zu leisten”, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff, der die Projektgruppe Afrika der Unionsfraktion leitet. Daneben müsse die Zusammenarbeit der deutschen und afrikanischen Bildungseinrichtung intensiviert werden. “Der Ausbau solcher Programme kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Entwicklung in afrikanischen Staaten zu forcieren und die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu intensivieren. Andere Staaten setzen solche Instrumente bereits gezielt ein”, so Rouenhoff weiter.
Vorbild ist dabei wie so oft China, das jungen Afrikanern in großer Zahl Stipendienplätze an chinesischen Universitäten anbietet. Deutschland dürfe nach Auffassung der Union dabei den Anschluss nicht verlieren. Diese Austauschprogramme sollen demnach ausdrücklich nicht nur für Studienstipendien vorbehalten sein, sondern auch Berufsprogramme umfassen – allerdings mit einem eindeutigen Kriterienkatalog sowie verbindlichen Ein- und Ausreiseverfahren. Auf konkrete Zielmarken, wie viele Berufsstipendiaten künftig aus afrikanischen Ländern nach Deutschland kommen könnten, will sich die Union in ihrem Vorschlag jedoch noch nicht festlegen.
Arbeitsmarktexperte Steffen Angenendt von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist von den Vorschlägen der Union wenig überzeugt: “Ich habe für ein Strategiepapier, das für die kommenden Jahre angelegt sein soll, mehr erwartet, vor allem konkretere Vorschläge für die Arbeitsmigration.” Diese seien dringend notwendig, um das afrikanische Arbeitskräftepotenzial tatsächlich zu nutzen. Laut einem Bericht der Bertelsmann Stiftung machten Afrikanerinnen und Afrikaner 2022 lediglich sechs Prozent der Erwerbsmigration aus Nicht-EU-Ländern aus.
Doch auch bereits beschlossene Reformen wie die des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Sommer 2023 seien noch verbesserungsfähig, so Angenendt: “Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein großer Stritt nach vorne, die Umsetzung ist allerdings das Problem. Wenn die Ausstellung eines Arbeitstitels monatelang dauert, werden sich kaum Fachkräfte für Deutschland entscheiden.” Mit der Gesetzesnovelle sollen die Hürden für die Fachkräftezuwanderung gesenkt werden.
Indes will das BMZ künftig ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung von Fachkräften für die weltweite Energiewende legen. Mit einem Ende des letzten Jahres vorgestellten Aktionsplan will das BMZ die “grüne Ausbildung” fördern. Von dem Plan sollen auch 27 Länder in Afrika profitieren. In erster Linie sollen dabei junge Menschen für die Arbeitsmärkte in den afrikanischen Ländern ausgebildet werden. Das Ministerium hat in Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana und Nigeria Beratungsstellen eingerichtet, die auch Menschen bei der Migration nach Deutschland beraten sollen. Die Stellen bieten Interessenten Informationen über Qualifikationen sowie Sprachkurse. Um eine gezielte Fachkräfteabwerbung soll es laut einer Sprecherin des BMZ allerdings nicht gehen.
Dabei müssten diese Ansätze viel weitergehen und konkreter werden, sagt Angenendt: “Es steht und fällt alles mit dem Thema Ausbildung und diese muss bereits in den Herkunftsländern ermöglicht werden.” Sehr vielversprechend seien dabei Double-Track-Ausbildungsprogramme, bei denen die Auszubildenden zusätzlich zu einem Ausbildungsweg für den einheimischen Arbeitsmarkt einen “Foreign Track” wählen könnten. “So stellen die Herkunftsländer Arbeitskräfte für den heimischen Markt sicher, gleichzeitig betragen die Ausbildungskosten nur einen Bruchteil der in Deutschland anfallenden Kosten. Bislang gibt es allerdings nur Pilotprojekte vor allem im Gesundheitsbereich. Solche Programme wären beispielsweise auch bei den Green Skills möglich.”
Dass diese Fachkräfte auch für die deutsche Energiewende dringend gebraucht werden, belegt ebenfalls der Blick auf die Zahlen. Laut dem Jobmonitor der Bertelsmann Stiftung benötigt die Bundesrepublik zusätzliche 300.000 Arbeitskräfte, wenn in sieben Jahren 80 Prozent des Stromverbrauchs über grüne Energie abgedeckt sein soll.
Südafrika ist vergangenen Donnerstag in Den Haag beim Internationalen Gerichtshof (IGH), dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, mit seinen besten Rechtswissenschaftlern unter Führung von Justizminister Ronald Lamola angetreten. Der Kern der von Richterin Adila Hassim vorgetragenen 84 Seiten langen Klageschrift: Die Gewalt Israels gegenüber Palästinensern, vor allem im Gazastreifen, sei Völkermord. Das Land am Kap bezieht sich auf die UN-Völkermordkonvention von 1948, die beide Staaten unterzeichnet haben. Per Eilantrag versucht Südafrika, den IGH dazu zu bewegen, sechs konkrete Maßnahmen anzuordnen, um den Konflikt zu beenden. Darunter sind die Beendigung der Militäraktionen mit vielen zivilen Opfern und die Öffnung humanitärer Korridore.
Israel wies am Freitag die Anschuldigungen zurück und verwies auf sein Recht, sich zu verteidigen. Wenn der IGH Südafrikas Klage stattgeben würde, wäre Israel der Hamas schutzlos ausgeliefert. Das israelische Juristenteam konzentrierte die Verteidigung auf die Angriffe der Terrororganisation Hamas und deren enge Beziehungen zum Kläger. Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, forderte den IGH auf, Südafrika anzuweisen, seinen eigenen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht nachzukommen. Das Land solle seine Sprache der Delegitimierung der Existenz Israels sowie seine eigene Unterstützung für die Hamas beenden und seinen Einfluss nutzen, “damit die Hamas ihre völkermörderische Terrorkampagne dauerhaft beendet”.
Unbestritten ist: Seit Jahrzehnten haben Südafrika und Palästina enge solidarische Beziehungen. Während der Apartheid unterstützten die Palästinenser die damalige Befreiungsbewegung African National Congress (ANC) im Kampf gegen die Rassentrennung. Israel hingegen lieferte der unter Sanktionen stehenden weißen Nationalregierung Südafrikas Waffen. Ein Höhepunkt der Beziehungen: Die brüderliche Umarmung zwischen dem kurz zuvor freigelassenen Nelson Mandela und dem damaligen Palästinenserführer Jassir Arafat in Sambia 1990. Auch heute, zehn Jahre nach dem Tod von Mandela, sind die Beziehungen eng. Schon vor dem Terrorakt der Hamas und den israelischen Gegenschlägen haben hochrangige ANC-Politiker die “Apartheid-Politik Israels gegenüber Palästina” angeprangert. Und in Südafrika gibt es bis heute viele Unterstützer Palästinas.
Der Schritt Südafrikas, Israel vor den IGH zu zerren, basiert daher auf einer alten Überzeugung, dass “unsere Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist”, wie Mandela es 1994 ausdrückte. Dass Südafrika dies jetzt wagt, hat aber auch mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Brics-Länder zu tun. Es kann als sicher gelten, dass Südafrika sich eng mit den Brics-Partnern abgestimmt hat. Südafrika hat nach dem erfolgreichen Brics-Gipfel in Johannesburg im vergangenen Jahr an Einfluss gewonnen. Im Schutz der Brics hat die Regierung der westlichen Kritik an seiner Verbindung zu Russland getrotzt und sich international selbstbewusst für die Interessen Afrikas eingesetzt. Mit der ersten afrikanischen Friedensmission zur Lösung eines Konfliktes in Europa hat Südafrika Geschichte geschrieben, wenn auch mit wenig Erfolg.
Taktisch klug halten sich die Brics-Partner mit Stellungnahmen zurück, um die Anklage nicht geopolitisch aufzuladen. Dass sich der Vorstoß mit den Interessen von China, Indien und Brasilien deckt, ist auch so schon offensichtlich: Indien hat historisch eher die Palästinenser unterstützt. Brasilien spricht von “eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht”. Und der chinesische Außenminister Wang Yi fordert, Israel solle seine “kollektive Bestrafung der Menschen in Gaza stoppen”.
Die USA hingegen nennen die Klage Südafrikas “unbegründet und kontraproduktiv”. Sie entbehre “jeglicher faktischen Grundlage”, meint der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Die Vertretung der USA in Pretoria hielt sich aber mit Kritik zurück. Washington “respektiert” das Vorgehen Südafrikas, das “ein souveränes Land” sei. Beide Länder hätten “robuste Handelsbeziehungen”. Ähnlich Großbritannien: “Wir sind mit dem, was die Südafrikaner tun, nicht einverstanden”, kommentierte Außenminister David Cameron.
Die Europäische Union, die Schwierigkeiten hat, ihre 27 Mitgliedsländer im Nahost-Konflikt auf eine gemeinsame Position zu bringen, zeigte sich bedeckt. Stattdessen bemüht sich die EU um eine neutrale Linie, die sowohl Israel das Recht auf Verteidigung zugesteht als auch den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung verlangt. So forderte die EU regelmäßig “humanitäre Pausen” in Gaza. “In Bezug auf diesen konkreten Fall haben die Länder das Recht, Fälle oder Klagen einzureichen”, so EU-Sprecher Peter Stano. “Die Europäische Union ist nicht Teil dieser Klage. Es steht uns überhaupt nicht zu, dazu Stellung zu nehmen.” Also Unterstützung des IGH, aber keine Unterstützung für die Völkermordanklage der Südafrikaner. Für die USA, EU und Großbritannien ist die Hamas eine geächtete Terrororganisation. Aber auch für Deutschland, dem die historische Schuld des Holocaust den politischen Spielraum bis heute einschränkt.
Das Kanzleramt in Berlin ließ am Freitag über Sprecher Steffen Hebestreit eine Erklärung verbreiten, in der es gar vor einer “politischen Instrumentalisierung” des Völkerrechtes warnt. Israel verteidige sich gegen den “menschenverachtenden Angriff” der Hamas: “Den vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermords weist die Bundesregierung entschieden und ausdrücklich zurück.” Dieser Vorwurf entbehre jeder Grundlage. Die Bundesregierung unterstütze die Arbeit des IGH und habe vor, “in der Hauptverhandlung als Drittpartei zu intervenieren.”
Das nahm Südafrikas Nachbar Namibia zum Anlass, die Bundesregierung scharf zu kritisieren. Am Samstagabend erklärte Namibias Präsident Hage Geingob auf dem Kurznachrichtendienst X: “Namibia lehnt Deutschlands Unterstützung für die völkermörderischen Absichten des rassistischen israelischen Staates gegen unschuldige Zivilisten in Gaza ab”, und erinnerte Deutschland daran, “Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen” und auch den Völkermord auf namibischen Boden “vollständig zu sühnen.” Erst 2021 hatte Deutschland seine Gräueltaten an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 als Völkermord anerkannt. Berlin sagte Wiederaufbauhilfen von 1,1 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 30 Jahren zu. Namibia vertritt mit der Stellungnahme die eigenen Interessen gegenüber Deutschland und zeigt sich gleichzeitig solidarisch mit Südafrika. Sollte der IGH allerdings zugunsten Südafrikas entscheiden, wäre das auch ein Sieg des Globalen Südens gegen die Vorherrschaft des Westens.
Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Montag, man habe die Aussagen des namibischen Präsidenten zur Kenntnis genommen. Die Bundesrepublik erkenne die Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San in Namibia als Völkermord an. “Gerade deshalb sind wir der Aufarbeitung dieser Verbrechen und der historischen Verantwortung, zu einer deutsch-namibischen Aussöhnung zu kommen, verpflichtet”, sagte AA-Sprecher Christian Wagner. Die historische Gleichsetzung der Shoah mit dem aktuellen Vorgehen Israels in Gaza weise man zurück.
Äthiopien ist zwar die führende politische Macht am Horn von Afrika. Doch mangelt es dem Land seit der Unabhängigkeit Eritreas 1991 an einem eigenen Hafen. Äthiopien wickelt bisher 95 Prozent seiner Exporte und Importe über den Hafen von Dschibuti ab.
Die politischen und militärischen Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien sind nun eskaliert, nachdem Äthiopien am 1. Januar mit Somaliland eine Absichtserklärung über den Besitz eines Seehafens unterzeichnet hat. Das vorläufige Abkommen sieht vor, dass Äthiopien einen etwa 20 Kilometer langen Küstenstreifen am Golf von Aden für 50 Jahre für Marine- und Handelszwecke pachtet.
Im Gegenzug wird Äthiopien einen “gleichwertigen” Anteil an Ethiopian Airlines anbieten – der größten Fluggesellschaft Afrikas. Die Höhe des Anteils wurde nicht genannt. Redwan Hussien, Sicherheitsberater des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali, erklärte gegenüber staatlichen Medien, dass Äthiopien, sobald das Geschäft abgeschlossen ist, “eine Position zu seinen Bemühungen um Anerkennung einnehmen könnte”. Gemeint ist, dass Äthiopien das Bestreben des Regierungschefs von Somaliland, Muse Bihi Abdi, um internationale diplomatische Anerkennung unterstützen könnte.
Dieses vorläufige Abkommen verärgert Somalia, da es einen Verstoß gegen seine “Souveränität und territoriale Integrität” wertet. Somalia betrachtet Somaliland als Teil seines Territoriums, obwohl sich dieser Landesteil vor fast 33 Jahren abgespalten hatte. In der Kolonialzeit gehörte Somaliland zum britischen Empire, während die übrigen Regionen Somalias – Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Konfur Galbeed und Jubaland – Italienisch-Somalia bildeten. 1960 wurden Britisch-Somalia und Italienisch-Somalia als ein Staat unabhängig.
Immerhin kann sich Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud darauf berufen, dass bisher mit Ausnahme Taiwans kein einziges Land auf der Welt Somaliland als souveränen Staat anerkannt hat. Daher rief Somalia am Tag nach der Absichtsabklärung seinen Botschafter aus Addis Abeba zurück und unterzeichnete fünf Tage später ein Gesetz, das “die illegale Vereinbarung für nichtig erklärt”.
Auch in den sozialen Medien fiel die Reaktion der somalischen Regierung harsch aus: “Dieses Gesetz ist ein Beweis für unsere Verpflichtung, unsere Einheit, Souveränität und territoriale Integrität gemäß internationalem Recht zu schützen”, ließ Hassan Sheikh Mohamud auf X veröffentlichen.
Äthiopien wusste, dass dieser Ärger kommen würde. Laut einer offiziellen Erklärung werde das Abkommen Somalia und seinen Nachbarländern zwar keinen Schaden zufügen, “aber man kann nicht sagen, dass einige nicht beleidigt und schockiert sein werden und nicht versuchen werden, den positiven Fortschritt zu zerstören”.
Im Jahr 2018 schloss Äthiopien einen Vertrag über den Besitz von 19 Prozent des Hafens von Berbera ab, während Somaliland 30 Prozent behielt. DP World, ein führender Hafenbetreiber aus Dubai, sollte die übrigen 51 Prozent besitzen. Die Vereinbarung wurde jedoch nicht umgesetzt, weil Äthiopien ihr “nicht genügend Aufmerksamkeit” schenkte, fügte Redwan hinzu. Obwohl auch gegen dieses Geschäft protestiert wurde, “hatte dies kaum Auswirkungen auf die Beendigung des Projekts”.
Die Nachricht über die Nutzung der Häfen am Roten Meer und am Golf von Aden durch Verhandlungen mit Eritrea, Dschibuti und Somalia kam vom äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed in seiner Rede vor dem Parlament am 13. Oktober 2023. Mit Blick auf das Rote Meer bekräftigte Abiy, dass der Zugang zum Roten Meer “für Äthiopien eine Existenzfrage ist, kein Luxus”.
Unter Verweis auf eine UN-Studie aus dem Jahr 2018 argumentierte Abiy, dass der Zugang zu Seehäfen das BIP des Landes um bis zu 30 Prozent steigern könne, wodurch die für 2030 prognostizierte Bevölkerung von 150 Millionen Menschen ernährt werden könnte.
Die drei Anrainerstaaten haben das Angebot jedoch bisher mit Verweis auf ihre “territoriale Souveränität” abgelehnt. Die eritreische Regierung postete auf X, sie werde sich “wie immer nicht auf solche Gassen und Plattformen einlassen”.
Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung mit Somaliland erklärte Abiys Büro, das Abkommen sei “historisch”, da es “den Zugang zu den Seehäfen diversifiziert” und beiden Parteien wirtschaftlich und politisch zugutekomme. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Antrag wirklich aus wirtschaftlichen Gründen gestellt wurde oder ob er darauf abzielte, verlorenes Territorium zurückzuerobern. Der Verdacht auf Irredentismus ist in der historischen Tatsache verwurzelt, dass Äthiopien schon in der Vergangenheit Nachbarländer, vor allem Eritrea und Somalia, erobert und annektiert hatte.
Daher erklärte Präsident Hassan Sheikh Mohamud am 2. Januar: “Kein einziger Zentimeter Somalias kann und wird von irgendjemandem abgetreten werden. Somalia gehört dem somalischen Volk. Das ist endgültig.” Auch Ali Mohamud Rage, der Sprecher von Al-Shabab – einer militanten Gruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida – schloss sich Berichten zufolge den Worten des Präsidenten an. Er warnte Äthiopien: “Falls Sie dies versuchen sollten, werden Sie bittere Konsequenzen erleiden.”
Am Montag, den 8. Januar, traf sich Präsident Hassan Sheikh Mohamud Berichten zufolge mit Eritreas Präsident Isaias Afwerki. Nach Angaben des eritreischen Informationsministeriums kamen die beiden Staatsoberhäupter überein, “mit Geduld und konstruktivem Geist an regionalen Fragen zu arbeiten und gleichzeitig auf eine reaktive Haltung gegenüber verschiedenen provokativen Agenden zu verzichten.”
Nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter erklärte Hassan gegenüber staatlichen eritreischen Medien, Isaias habe bekräftigt, dass er “die Wahrung der Souveränität, Einheit und territorialen Integrität Somalias” unterstütze. Am selben Tag trafen sich die Generalstabschefs von Somaliland und Äthiopien, Generalmajor Nuh Ismail Tani und Feldmarschall Birhanu Jula, in Addis Abeba. Berichten zufolge erörterten beide “Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der militärischen Kooperation.”
Angesichts dieses diplomatischen Pendelns und des militärischen Kräftemessens stellt sich die Frage, wohin dies führen wird. Manche Beobachter warnen davor, sich auf ein weiteres militärisches Debakel einzulassen, da das Horn von Afrika bereits genügend Konflikte zu bewältigen hat.
Simbabwe steht kurz davor, erstmals in der Geschichte des Landes Gas zu fördern. Ermöglicht hat dies ein australisches Unternehmen, das an seinem Explorationsstandort im Norden des Landes diese Entdeckung bekanntgegeben hat.
Invictus Energy hat in vier Proben aus dem Upper Angwa-Abschnitt seiner Mukuyu-2-Bohrung im Muzarabani-Prospekt Gas gefunden. Invictus Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen in Australien, das auf die Exploration von Mineralöl und Erdgas in Afrika spezialisiert ist. Ungeachtet dieses Funds ist der Aktienkurs in den vergangenen vier Wochen um 49 Prozent auf rund 0,11 Austral-Dollar gefallen. Grund dafür ist jedoch, dass Invictus direkt nach der Entdeckung am 3. Januar das Kapital um mehr als 115 Millionen Aktien und knapp 58 Millionen Optionen erhöht. Insofern sind die Kursverluste eine technische Reaktion auf die Kapitalerhöhung.
“Die Entdeckung stellt eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Onshore-Öl- und Gasindustrie im südlichen Afrika seit Jahrzehnten dar”, sagte Scott Macmillian, Vorstand von Invictus Energy. Das Unternehmen hat mittlerweile Proben zur unabhängigen Bewertung in die USA geschickt. Außerdem will Invictus das Becken nach weiteren Bohrzielen erkunden. Invictus Energy exploriert in diesem Gebiet seit rund zehn Jahren.
Die Regierung von Simbabwe setzt große Hoffnungen in das Gasprojekt. Sie erwartet, dass es positive Auswirkungen auf das Land haben wird. “Diese Entdeckung wird die Wirtschaftslandschaft Simbabwes verändern”, sagte Simbabwes Bergbau- und Bergbauentwicklungsminister Soda Zhemu, der es als eine wichtige Entwicklung im Onshore-Öl- und Gassektor in der Region Südafrika beschrieb.
“Wir glauben, dass sich diese Entdeckung positiv auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Simbabwes auswirken wird“, fügte Zhemu hinzu. “Gas wird zur Diversifizierung des Energiemixes Simbabwes beitragen, die Energiesicherheit des Landes verbessern sowie Arbeitsplätze und Möglichkeiten für die lokalen Gemeinschaften schaffen.”
Der Gasfund ist eine positive Nachricht für Simbabwe. Aber es wird Jahre dauern, die Ressource zu erschließen. Das Land benötigt mehr Exploration, Infrastruktur und Märkte, um das Gas zu produzieren und zu verkaufen. Es muss sich auch mit Umwelt- und Sozialfragen befassen und die Gaseinnahmen transparent und gerecht verwalten.
Bis das Gas gefördert und zu den Märkten transportiert werden kann, werden Jahre weiterer Investitionen und Infrastrukturentwicklung erforderlich sein. Invictus Energy fand Gas früher als viele andere Explorationsunternehmen in neuen Gebieten, wo die Erfolgsaussichten Experten zufolge weniger als zehn Prozent betragen.
Die Gasentdeckung könnte jedoch Simbabwe in die Geopolitik der Energie katapultieren, da Simbabwe ein neuer Akteur auf dem globalen Gasmarkt und ein potenzieller Partner oder Konkurrent für andere Gasproduzenten und -verbraucher werden könnte. Wenn die Gasentdeckung vollständig ausgereift ist, könnte sie auch zur globalen Energiewende beitragen, da Erdgas im Allgemeinen sauberer als Kohle und Öl ist und erneuerbare Energiequellen ergänzen könnte.
Allerdings könnte die Ressource auch die globalen Kohlenstoffemissionen erhöhen und die Umstellung auf kohlenstoffarme Energiequellen verzögern. Es sei denn, das Gas wird in Kombination mit Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung oder zur Wasserstoffproduktion verwendet.
Simbabwe kann von seinen Nachbarländern lernen, die bei ihren Gasprojekten mit Herausforderungen und Verzögerungen konfrontiert waren. Angola und Mosambik sind die wichtigsten Gasproduzenten im südlichen Afrika. Ihre LNG-Exporte wurden jedoch durch verschiedene Probleme behindert. Südafrika und Tansania befinden sich noch im Anfangsstadium der Gasentwicklung.
Der deutsche Softwarekonzern SAP ist in einen Korruptionsskandal verwickelt. Das börsennotierte Unternehmen ist vergange Woche vom US-Justizministerium in einem Vergleich zu einer Strafe von umgerechnet rund 200 Millionen Euro verurteilt worden. Eine Untersuchung hat nachgewiesen, dass SAP South Africa, ein Tochterunternehmen von SAP, Bestechungsgelder unter anderem an südafrikanische Beamte gezahlt hat. Die Beamten sollen Finanzdokumente manipuliert haben, um SAP Wettbewerbsvorteile bei ihren Verträgen mit verschiedenen südafrikanischen Regierungsabteilungen zu verschaffen. Das zweite Land, das neben Südafrika untersucht wurde, ist Indonesien.
In Südafrika sind unter anderem Johannesburg, Pretoria, das nationale Wasseramt und das staatliche Stromunternehmen Eskom in den Skandal involviert. Die Bestechungen sollen zwischen 2013 und 2017 stattgefunden haben. “SAP hat die Verantwortung für korrupte Praktiken übernommen, die ehrlichen Unternehmen im globalen Handel schaden”, sagte US-Staatsanwältin Jessica Aber.
In einer Mitteilung begrüßte SAP die Vergleichsvereinbarungen, nachdem das Unternehmen eine “gründliche und umfassende Untersuchung des Fehlverhaltens durchgeführt” und “uneingeschränkt mit den Behörden kooperiert” hatte. Seitdem habe SAP “sein globales Compliance-Programm und die damit verbundenen internen Kontrollen deutlich verbessert.” SAP achte weiterhin auf die “Einhaltung höchster Ethik- und Compliance-Standards, damit SAP gemeinsam mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Lieferanten, Mitarbeitern und Vordenkern dazu beitragen kann, dass die Welt besser funktioniert und das Leben der Menschen verbessert.”
Neben Bestechungsgeldern wurden südafrikanische Beamte 2015 auf luxuriöse Golfreisen in die USA eingeladen und mit Luxusgütern beschenkt. SAP soll über Mittelsmänner und Berater mit den Beamten kommuniziert haben. Die Bestechungen fallen in die zweite Hälfte der Amtszeit des umstrittenen damaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma, der zwischenzeitlich wegen Korruption für zwei Jahre im Gefängnis saß. Vermittelt wurden auch Aufträge in Malawi, Kenia, Tansania und Ghana. as
Der chinesische Außenminister Wang Yi hat angekündigt, die Beziehungen zu Ägypten zu vertiefen. Die bilaterale Zusammenarbeit solle ein neues Level erreichen, sagte Wang laut des chinesischen Auslandssenders CGTN am Sonntag in Kairo. Wang sprach dort mit seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri. Ägypten zählt zu den sechs Ländern, die in diesem Jahr dem Brics-Wirtschaftsblock um China, Brasilien, Russland, Indien und Südafrika als neue Mitglieder beitreten. Ägypten war die erste Station von Chinas Top-Diplomat bei seinem Afrika-Besuch, der vergangenen Freitag gestartet war. Bis zum 18. Januar will Außenminister Wang noch Tunesien sowie Togo und die Elfenbeinküste in Westafrika besuchen.
Die Außenminister Chinas und Ägyptens sprachen auch über den Krieg in Nahost und forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine umfassende Waffenruhe. Die Regierung in Kairo spielt eine wichtige Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Erst vor wenigen Tagen tauschte sich Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem ägyptischen Amtskollegen aus und übergab in der Nähe des Grenzübergangs Rafah ein Zehn-Tonnen-Hilfspaket für die Palästinenser in Gaza an den Ägyptischen Roten Halbmond.
Der Krieg in Nahost hat inzwischen auch Folgen für den internationalen Seehandel. Wang und Schukri appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich für eine Entspannung einzusetzen, sodass auch der Seeweg im Roten Meer wieder sicher genutzt werden könne. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Hamas mehrfach Schiffe im Roten Meer angegriffen. Die Huthis, die auf Seiten der radikal-islamistischen Hamas stehen, geben an, dass es um Schiffe gehe, die angeblich eine Verbindung zu Israel hätten. Inzwischen befahren einige große Reedereien den betroffenen Seeweg nicht mehr.
China ist inzwischen stark in Ägyptens Häfen aktiv und investiert seit einigen Jahren verstärkt in das Land. Zwischen 2017 und 2022 sind Chinas Investitionen in Ägypten um 317 Prozent gestiegen, wie ein Bericht des amerikanischen Middle East Institutes angibt. Die Afrika-Tour von Außenminister Wang hat großen Symbolwert: Es ist das 34. Jahr in Folge, dass Wangs erste Fernreise im neuen Jahr auf den afrikanischen Kontinent führt, wie ein Ministeriumssprecher sagte.
Außerdem lädt China in diesem Jahr nach Peking zu neunten Ausgabe des Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Auf der Konferenz (Datum noch unbekannt) wird es um die weitere Vertiefung der Beziehungen mit den Ländern Afrikas gehen. Im Fokus steht dabei das chinesische Infrastrukturprogramm Belt and Road Initiative (BRI), aber auch die Bereiche Industrialisierung, Landwirtschaft sowie die teils hohen Staatsschulden der afrikanischen Staaten. lcw
Nigerias vernachlässigte Stahlindustrie soll mit chinesischer Unterstützung neuen Schwung bekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des nigerianischen Minen- und Stahlministeriums hervor. Die Ankündigung kommt in Folge einer China-Reise des zuständigen Ministers Shuaibu Audu sowie des Verteidigungsministers Mohammed Badaru Abubakar. Die beiden hatten dort kürzlich Vertreter des staatlichen Stahlkonzerns Luan Steel Holding Group getroffen.
Luan Steel und Nigeria planen demnach den Bau eines neuen Stahlwerks in dem Land sowie die Rehabilitierung des maroden Ajaokuta-Stahlwerks. In Ajaokuta sollen erstmals Militärgüter produziert werden. Stahlminister Audu betonte, dies sei ein wichtiger strategischer Schritt für Nigeria im Kampf gegen Unsicherheit und Terrorismus.
Ajaokuta war schon in den 1980er-Jahren mit sowjetischer Unterstützung gebaut worden. Allerdings ist der Bau nach mehr als 40 Jahren noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Zwar wird in dem Werk inzwischen importierter Stahl gewalzt. Jedoch wurde bis heute noch kein nigerianisches Eisen zu Stahl verarbeitet. Auch das heruntergekommene Stahlwerk Delta Steel in Warri walzt bisher nur importierten Stahl.
Nigeria hat bereits in der Vergangenheit versucht, seine Stahlwerke durch die Übertragung an internationale Rohstoffkonzerne zum Laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Auf dem Russland-Afrika-Gipfel 2019 in Sotschi hatte sich der damalige Präsident Muhammadu Buhari mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine Revitalisierung des Ajaokuta-Werks mit russischer Hilfe verständigt. Durch die Covid-Pandemie wurden diese Pläne verzögert und konnten letztendlich nicht innerhalb von Buharis Amtszeit durchgeführt werden. Die neue nigerianische Regierung unter Bola Tinubu ist hingegen offenbar stärker an einer Kooperation mit China interessiert. ajs
Laut dem Global Cities Report 2023 haben soziale, geopolitische und technologische Verschiebung die traditionelle Rangordnung globaler Städte verändert. Metropolen des Globalen Südens, darunter Afrika, haben aufgeholt. Der Bericht der Unternehmensberatung Kearney hebt hervor, dass “führende globale Städte einer immer größeren Konkurrenz durch aufstrebende Zentren ausgesetzt sind, wobei diese sich erneuern, um Talent, Innovation und Investitionen anzuziehen.
In Afrika gehören Johannesburg (58. Platz), Kapstadt (84), Nairobi (86), Accra (104) und Lagos (109) zu den besten Städten, die vor allem beim Global Cities Index (GCI) gut angeschnitten haben. In Nordafrika hat sich Casablanca als Zentrum etabliert. Im globalen Durchschnitt verbesserten sich afrikanische Städte leicht auf Rang 104 von 156 untersuchten Metropolen, was vor allem an der Zunahme von Wirtschaftsaktivitäten liegt. Zudem legten die Städte in der Kategorie politisches Engagement zu. Die europäischen Städte kommen im Durchschnitt auf Rang 30.
Der GCI misst, inwieweit Städte Investitionen sichern, Menschen und Ideen anziehen und diese auch halten können. Die Städte werden hierbei in fünf Kategorien bewertet: Humankapital, Informationsaustausch, kulturelle Erfahrung politisches Engagement und Wirtschaftsaktivitäten. Zum Vergleich, global konnten sich New York, London, Paris, Tokio und Peking in den Top-5 behaupten. Beste deutsche Stadt ist Berlin an 16. Stelle, gefolgt von Frankfurt (27).
Globale Städte zeichnen sich durch ihre internationalen Verbindungen aus, deren dynamische Mikrokosmen die Welt prägen. “Angesichts der Tiefe ihrer globalen Vernetzung sind sie einerseits anfällig für globale Verschiebungen, die den Kapital-, Personen- und Ideenfluss der ganzen Welt stören”, heißt es. “Gleichzeitig profitieren sie aber auch von diesen Trends, ziehen überproportional viele Talente und Investitionen an und fungieren als Innovationszentren und Katalysatoren für Wirtschaftswachstum.“
Die Kluft zwischen diesen Städten und etablierten Metropolen hat sich verringert. “Gerade in diesem Jahr können wir sehen, wie eine ausgewogene politische und ökonomische Positionierung aufstrebender Zentren für Kapital, Handel und Menschen aus der ganzen Welt immer attraktiver gemacht hat”, kommentiert Rudolph Lohmeyer von Kearney. as
Die nigerianische Dangote-Ölraffinerie hat nach jahrelangen Verzögerungen beim Bau der Anlage die Produktion von Diesel und Flugbenzin aufgenommen, wie der Betreiber Dangote Group am Samstag mitteilte. Die größte Raffinerie Afrikas wurde von Aliko Dangote, dem reichsten Mann des Kontinents, in der Lekki Free Trade Zone am Rande der Handelshauptstadt Lagos gebaut. Die Baukosten für das Mega-Projekt betrugen 20 Milliarden Dollar.
Obwohl Nigeria der größte Energieproduzent Afrikas ist, ist das Land für den Großteil seines Kraftstoffverbrauchs bislang auf Importe angewiesen. Alle vier Raffinerien des staatlichen Ölkonzerns NNPC sind zurzeit außer Betrieb und müssen aufwändig renoviert und gewartet werden, bevor sie wieder funktionsfähig sind.
Die Dangote-Raffinerie ist die erste nigerianische Raffinerie in privater Hand. Sie soll das Land nicht nur unabhängig von Importen machen, sondern auch den Export von Treibstoff in die benachbarten westafrikanischen Länder ermöglichen. Das könnte den Ölmarkt in der Region nachhaltig verändern.
“Dies ist ein großer Tag für Nigeria. Wir freuen uns, diesen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben”, teilte das Unternehmen auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.
Experten zufolge könnte es Monate dauern, bis die Rohöl-Destillationsanlage der Raffinerie von den Testläufen zur Produktion hochwertiger Kraftstoffe bei voller Kapazität übergeht.
Dangote hat erklärt, dass die Raffinerie zunächst 350.000 Barrel pro Tag verarbeiten wird und hofft, die Produktion im Laufe des Jahres auf die volle Kapazität von 650.000 Barrel pro Tag hochfahren zu können. Die Raffinerie soll bis zu 53 Millionen Liter Benzin, 4 Millionen Liter Diesel und 2 Millionen Liter Kerosin täglich produzieren sowie 12.000 Megawatt Stromleistung. rtr/ajs

Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren ist Afrika bekanntlich der jüngste Kontinent. Wir Deutschen sind dagegen mit im Durchschnitt 44,6 Jahren mehr als doppelt so alt. Alternden Gesellschaften sagt man nach, am Bestehenden festzuhalten und sich nur träge zu entwickeln. Junge Gesellschaften gelten als dynamisch und innovativ. In Zeiten disruptiver Wirtschaftsentwicklungen ist dies ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Die junge Generation in Afrika ist gebildeter als ihre Eltern, aber sie ist dennoch häufiger ohne formalen Job. Die hohe Arbeitslosigkeit ist frustrierend und führt dazu, dass sich viele Jugendliche um ihre beruflichen Chancen betrogen fühlen. Eine kritische Konstellation, so Nathalie Delapalme, Chefin der Mo Ibrahim Foundation. Im schlechtesten Fall sorgt diese für einen Zulauf auf Terrorgruppen und Beifall für Putschisten, wie kürzlich im Sahel.
Dabei gäbe es gute Optionen, denn der Jugendarbeitslosigkeit steht ein großer Fachkräftemangel gegenüber. “Skilled Workers” gelten als Flaschenhals für alle Zukunftsmärkte, in der Fintech ebenso wie bei der Rohstoffverarbeitung oder in der Klimatechnologie. Es mangelt an Facharbeitern wie Ingenieuren, Handwerkern oder IT-Spezialisten, und überall an jungen Unternehmern. Die besten Karrieren liegen in der boomenden Gründerszene auf dem Kontinent. Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sieht in den afrikanischen Start-Ups den Schlüssel zur wirtschaftlichen Transformation, und verkündet auf dem The Africa Roundtable die Erweiterung entsprechender Förderprogramme.
Die Diskrepanz zwischen den Bildungsabschlüssen und den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt ist vielfach beschrieben. Das traditionelle Bildungssystem auf dem Kontinent braucht voraussichtlich viele Jahre, um sich zu reformieren. Gebraucht werden Skills – und damit neue Wege, um die Kluft zu überbrücken. Als Ideal gilt vielen das duale Bildungssystem in Deutschland. Es gibt Unternehmen, die nicht nur in den Bau von Fertigungsanlagen investieren, sondern auch ihre Ingenieurschulen mitbringen – ein bewährtes Konzept, das die großen deutschen Konzerne vor Jahrzehnten in China angewandt und bis heute beibehalten haben.
Der Technologiekonzern Voith hat dieses Vorgehen bereits in 25 Ländern auf dem Kontinent vorgemacht. Doch von Unternehmen wie ihnen gibt es auf dem afrikanischen Kontinent bisher zu wenig, und die staatliche berufliche Bildung bedient ebenfalls nur rund ein Prozent der jungen Menschen. Das African Center for Economic Transformation (ACET) fordert deshalb einen zügigen Ausbau in diesem Bereich.
Länder wie Ruanda, Ghana oder Südafrika unternehmen vorbildliche Anstrengungen, um die vier größten Herausforderungen zu bewältigen:
Sozialunternehmer haben diesen Bedarf entdeckt und bauen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und “Blended Learning”-Arrangements erfolgreich Brücken in die Wirtschaft. Weit über den afrikanischen Kontinent hinaus bekannt geworden sind die African Leadership Academy und die African Leadership University, gegründet vom McKinsey-Direktor Afrika Acha Leke und dem Social Entrepreneur Fred Swaniker, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2035 drei Millionen afrikanische Führungskräfte auszubilden.
Oder das soziale Netzwerk Goodwall der Brüdern Taha und Omar Bawa, das soziale Interaktion mit dem Aufbau von Skills erfolgreich verbindet. Der ehemalige BCG-Senior-Partner Martin Hecker hat mit Amali Tech in Ghana und Ruanda große Bildungszentren für angehende Softwareentwickler aufgebaut. Ihnen allen gelingt es, ihre Kandidaten in Jobs zu vermitteln.
Und alle setzen dabei auf “Talent over Education”. Taha Bawa nennt Skills sogar “die neue Währung in der Wirtschaft“. Mit dem Skalierungspotenzial der sozialen Netzwerke wollen er und viele andere das Zugangstor weit aufstoßen. Die digitale Revolution schafft auch neue Arbeitsmärkte. Remotes Arbeiten funktioniert in Addis Abeba und Nairobi ebenso wie in Lissabon, Toronto oder Bangalore, ganz gleich ob die Firmen in Seattle oder Singapur ihren Sitz haben.
Gute Aussichten für den jüngsten Kontinent, und eine Option für Europa, wo immer mehr Fachkräfte dringend gesucht werden. Europa wird ihnen schon bald den roten Teppich ausrollen, ist der afrikanische Unternehmer und Stifter Mo Ibrahim überzeugt. Arbeitsmigration ist hierzulande ein heikles Thema, das dringend einer rationalen Diskussion bedarf, um gerechte Lösungen zum beidseitigen Vorteil zu finden.
Dr. Ingrid Hamm ist Mitgründerin der Berliner Dialogplattform Global Perspectives Initiative. The Africa Roundtable zum Thema “The Path to Success: Education, Skills and Leadership” fand nach Stationen in Dakar und Nairobi wieder in Berlin statt. Lesen Sie die Handlungsempfehlungen hier.
Bloomberg: Ericsson will die Hälfte aller afrikanischen mobilen Zahlungen abwickeln. Die Software des schwedischen Unternehmens unterstützt schon heute zehn Prozent aller mobilen Transaktionen in Afrika sowie mehr als jede fünfte weltweit. Der neue Chef der Abteilung für mobile Finanzdienste strebt für Afrika eine Quote von 50 Prozent an. Ericsson hat darum seine zehnjährige Partnerschaft mit Afrikas größtem Mobilfunkbetreiber MTN verlängert.
Wall Street Journal: Wie Frankreich seine Afrika-Beziehungen verpatzte und eine geopolitische Krise auslöste. In weiten Teilen des frankophonen Afrikas ist die Verhöhnung der Franzosen zu einer mächtigen Parole geworden. Dem von Präsident Macron versprochenen Neuanfang zum Trotz nehmen viele Menschen das französische Vorgehen nach wie vor als Heuchelei und Bevormundung wahr. Der Vorwurf: Anstatt sich tatsächlich um eine verbesserte Sicherheitslage zu bemühen, unterstütze Frankreich aus Eigeninteresse weiterhin die frankophonen aber korrupten Eliten vor Ort.
Devex: Der MCC-Effekt – Wie eine Politik-Scorecard die Reformpläne der DR Kongo unterstützt. Die staatliche US-Hilfsorganisation Millenium Challenge Corporation (MCC) hat Anforderungen formuliert, die die Länder erfüllen müssen, um sich für Zuschüsse zu qualifizieren. In der Demokratischen Republik Kongo hat Präsident Félix Tshisekedi die MCC-Kriterien als Entwurf für die Reformagenda seines Landes übernommen. Nach Ansicht von Experten verdeutlicht dies das Potenzial der MCC-Scorecard, Reformanreize bei Regierungsführung, Korruption und Bürgerrechten zu geben.
Semafor: Russland bietet Afrikanern kostenlosen Sprachunterricht. Russland hat im vergangenen Jahr Hunderte von jungen Afrikanern für seine russischen Sprach- und Kulturprogramme auf dem gesamten Kontinent angeworben. Die Kurse werden im Rahmen eines umfassenderen Vorstoßes des Kremls angeboten, der darauf abzielt, die Beziehungen zu den Bürgern und Regierungen Afrikas zu vertiefen.
The East African: Was Ugandas Agoa-Ausschluss für Ostafrika bedeutet. Die USA haben Uganda wegen seines Anti-LGBTQ-Gesetzes aus dem African Growth and Opportunity Act (Agoa) ausgeschlossen. Das Gesetz ermöglicht afrikanischen Ländern präferentiellen Zugang zum amerikanischen Markt. Kenia und Tansania könnten profitieren, indem sie Strategien entwickeln, um US-Konzerne aus Uganda abzuwerben.
Bloomberg: Gewerkschaften stellen Bedingungen für Privatisierung des Hafens von Durban. Die südafrikanische Hafeninfrastruktur ist marode und ineffizient. Die geplante Übernahme des größten afrikanischen Containerhafens Durban durch die philippinische ICTSI soll das ändern. Zwei südafrikanische Gewerkschaften haben nun Forderungen an ICTSI gestellt.
Nation: Somaliland geht hart gegen Kritiker des Äthiopien-Deals vor. In der somaliländischen Hauptstadt Hargeisa haben Sicherheitskräfte die Büros eines Fernsehsenders durchsucht und Journalisten verhaftet. Einige Mitarbeiter wurden mit verbundenen Augen in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen abgeführt. Anlass war offenbar eine den Behörden unliebsame Diskussionsrunde zum geplanten Abkommen mit Äthiopien. Das Programm wurde durch die Razzia gewaltsam und abrupt unterbrochen.
DW: Äthiopiens schwerer Start in die Brics-Ära. Äthiopiens erste Tage als Brics-Mitglied sind alles andere als sorgenfrei. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Währung ist im Sinkflug und wegen des geplanten Abkommens mit Somaliland gibt es neue Verstimmungen mit dem Nachbarn Somalia. Dennoch gibt es Hoffnung für die Zukunft.
The Conversation: Afrika kann bei den vorgeschlagenen WTO-Instrumenten nur verlieren. Die Welthandelsorganisation hat während der COP28-Konferenz ihre “Trade Policy Tools for Climate Action” vorgestellt. Olabisi D. Akinkugbe, Experte für internationales Wirtschaftsrecht, erörtert, ob die neuen handelspolitischen Instrumente Afrika zugutekommen.
Financial Times: Die jungen Leute, die die schlimmsten Schrecken des Internets durchforsten. Die Moderation von Inhalten gehört zu den Hauptaufgaben sozialer Medien. Doch die damit verbundene Arbeit ist häufig schwer traumatisierend. Junge afrikanische Content-Moderatoren, die mit dem Versprechen auf Arbeitsplätze an der “Spitze der KI” gelockt wurden, kämpfen nun um ihre Rechte auf besseren Schutz. Die britische Finanzzeitung hat mit einigen der von Facebook und anderen beschäftigten Moderatoren gesprochen.

Für die USA spielen die Wirtschaftsbeziehungen zum afrikanischen Kontinent keine große Rolle. Zwar sind wohl die meisten großen Unternehmen in Afrika präsent, von Mars, Coca-Cola, Philip Morris und Kellogg’s über die Autohersteller bis zu den großen Tech-Konzernen Microsoft, Facebook oder Google. Auch die großen Ölkonzerne fehlen nicht. Doch eine echte Strategie für die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika haben die USA nie formuliert.
Es gab vereinzelte Versuche. Zuletzt hatte Barack Obama in seiner Zeit als US-Präsident (2009 bis 2017) unter dem Schlagwort Power Africa eine gigantische Strategie für den Aufbau der Stromversorgung in Afrika präsentiert. Der Ankündigung folgten keine greifbaren Ergebnisse. Immerhin haben die USA schon im Mai 2000 den African Growth and Opportunity Act (Agoa) beschlossen, der auch heute noch einen Rahmen für die amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika setzt.
Kendra Gaither will das Desinteresse amerikanischer Unternehmen für Afrika ändern. Seit Mitte Oktober ist sie bei der amerikanischen Handelskammer Präsidentin des US-Africa Business Center und damit die führende Lobbyistin für die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika. “Das Center repräsentiert die Überzeugung der Unternehmen, dass es die Chance und Notwendigkeit gibt, die Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den USA und Afrika auszubauen”, sagte Gaither denn auch nach ihrer Berufung.
Seit acht Jahren arbeitet Gaither für die amerikanische Handelskammer. Sie bringt eine ausgewiesene Expertise mit. So absolvierte sie in Washington einen Master in Internationaler Politik und einen MBA in internationaler Wirtschaft an der George Washington University.
Anschließend arbeitete sie zehn Jahre lang im amerikanischen Außenministerium, wo sie sich auf den Handel mit Lateinamerika und Subsahara-Afrika spezialisierte. Unter anderem arbeitete sie im Afrika-Referat, in der Südafrika-Abteilung und als Koordinatorin für den Agoa. Danach leitete sie das Zentrum für Internationale Politik und Innovation an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh und baute einen Campus der Hochschule in Kigali auf. Heute leitet sie neben ihrer neuen Aufgabe die Coalition for the Rule of Law in Global Markets und den US-South Africa Business Council.
Zwar hat Gaither nicht selbst in Afrika gelebt. Doch sie gilt angesichts ihrer tiefen Kenntnis internationaler Beziehungen als überzeugende Besetzung, um das Thema Afrika in der weltgrößten Unternehmensorganisation voranzutreiben. Das ist auch notwendig. Die USA haben im Jahr 2023 (Januar bis November) laut dem Census Bureau Waren im Wert 26,3 Milliarden Dollar nach Afrika exportiert und Waren im Wert von 35,7 Milliarden Dollar importiert. Für 2022 liegen die vergleichbaren Zahlen für Exporte bei 28,4 Milliarden Dollar (Gesamtjahr: 30,7 Milliarden Dollar) und für Importe bei 38,8 Milliarden Dollar (Gesamtjahr 41,8 Milliarden Dollar).
Angesichts von Exporten von 254 Milliarden Dollar und Importen von 317 Milliarden Dollar allein im November 2023 ist der Afrika-Handel eine vernachlässigbare Größe in der Außenwirtschaft der USA. Auch aus afrikanischer Sicht spielt der Handel mit den USA eine untergeordnete Rolle. Der afrikanische Außenhandel mit dem Rest der Welt ist im Jahr 2022 um rund 200 Milliarden Dollar auf 1,38 Billionen Dollar gestiegen. Den größten Anteil haben traditionell Erdöl und Erdgas.
Immerhin weiß Gaither, dass sie am selben Strang wie US-Präsident Joe Biden zieht. Dieser hatte im Dezember 2022 angekündigt, die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika ausbauen zu wollen. “Die Vereinigten Staaten werden die Mobilisierung von privatem Kapital unterstützen und erleichtern, um das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine stärkere Beteiligung der USA an der Zukunft Afrikas voranzutreiben”, hieß es damals in einer Mitteilung des Weißen Hauses.
Biden will den Schwerpunkt auf Infrastruktur, Mittelstand, auf Unternehmen der afrikanischen Diaspora in den USA und auf von Frauen geführte Unternehmen legen. So will er den “wechselseitigen Handel und die Investitionen ankurbeln”. Seit 2021, als Biden sein Amt antrat, habe die US-Regierung dazu beigetragen, mehr als 800 Handels- und Investitionsabkommen in 47 afrikanischen Ländern mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 18 Milliarden Dollar abzuschließen. US-Unternehmen hätten Investitionsabkommen im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar in Afrika vereinbart.
Immerhin kann sich Gaither in ihrer Lobbyarbeit für US-Engagements in Afrika auch auf die Unterstützung des State Department verlassen. Dieses richtete im Dezember 2022 den dreitägigen US-Africa Leaders Summit aus und im Juli 2023 den ebenfalls dreitägigen US Africa Business Summit in Gaborone. Diesen unterstützten führende US-Unternehmen wie Chevron, Exxon Mobil, Visa, Citi, General Electric, Caterpillar oder Pfizer. Darauf könnte sich aufbauen lassen. Christian v. Hiller
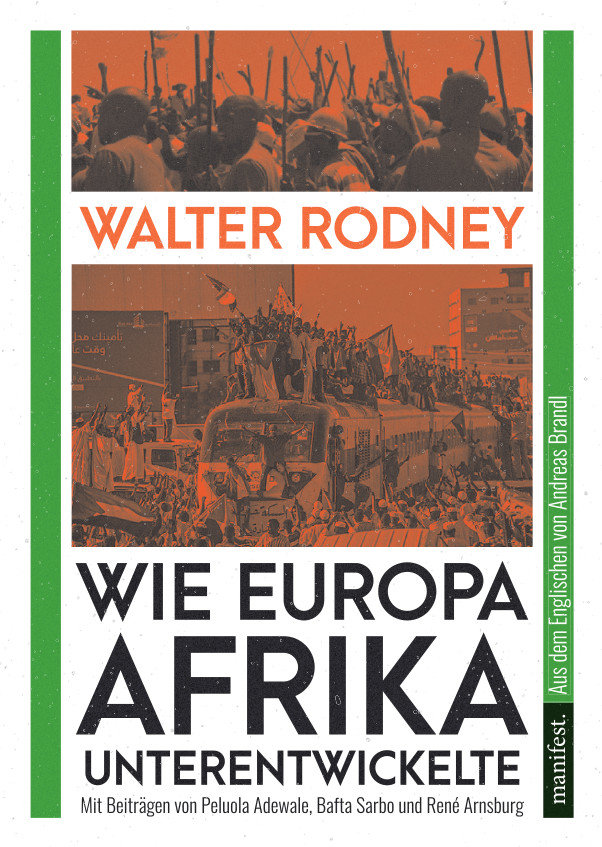
Walter Rodneys “How Europe Underdeveloped Africa” zählt zurecht zu den wichtigsten afrikahistorischen Werken des 20. Jahrhunderts. Doch seine Analyse der politischen Ökonomie von Kolonialismus und Imperialismus hat auch im Jahr 2024 noch Aussagekraft – gerade für ein Europa, das sich die Neuordnung der Beziehungen zum Nachbarkontinent auf die Fahnen geschrieben hat. Die komplett neue deutsche Fassung des Berliner Verlags Manifest unter dem Titel “Wie Europa Afrika unterentwickelte” kommt also genau zur rechten Zeit.
In dem 1972 erstmals erschienenen Band stellt der guyanische Historiker und panafrikanische Aktivist eindrücklich dar, wie Afrikas “Unterentwicklung” und die rapide Entwicklung der westlichen Kolonialmächte einander bedingten. So ist Rodneys Werk auch heute noch relevant, um die anhaltende Kluft der globalen Ungleichheit zu verstehen.
Rodney dokumentiert akribisch und anschaulich die ausbeuterische Natur der frühen euro-afrikanischen Beziehungen, sowie deren Effekte auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung: Die ständige Expatriierung des durch afrikanische Arbeit aus afrikanischen Ressourcen produzierten Überschusses mithilfe von monopolistischen Handelsgesellschaften ermöglicht die Entwicklung neuer Technologien, Materialien und Organisationsformen im Westen, die wiederum zur Ungleichheit beitragen. So erforderte beispielsweise der Transport großer Mengen von Rohstoffen Innovationen in der Schifffahrt und Logistik sowie in der Kühlung. Die Rohstoffe ermöglichten die Schaffung neuer Industrien für veredelte Güter in Europa, etwa fortgeschrittene Metallurgie, die petrochemische Industrie oder die Herstellung von Konsumgütern wie Schokolade. Afrikanisches Kupfer ermöglichte die Elektrifizierung Europas. So wuchs aus Ungleichheit mehr Ungleichheit.
Europas Schicksal war, ist und wird untrennbar mit dem seines Nachbarn Afrika verbunden bleiben. Um künftig als ebenbürtige Partner zu agieren, gilt es, zu verstehen, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Dafür bietet Walter Rodneys Klassiker auch mehr als 50 Jahre nach Erstveröffentlichung noch jede Menge Stoff. ajs
Walter Rodney: Wie Europa Afrika unterentwickelte. Manifest Verlag, Berlin, 2023, 418 Seiten, 20 Euro.
