das Wachstum afrikanischer Volkswirtschaften bleibt oft unter dem Potenzial – auch aufgrund von Staatsschulden. Zurecht steht das Thema immer wieder auf der Agenda, etwa bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in der vergangenen Woche. Doch das Problem liegt nicht unbedingt in der Höhe der Schulden, sondern ganz woanders, wie Christian von Hiller erklärt.
Der blutige Konflikt im Sudan geht nun in sein zweites Jahr. Die humanitäre Lage im Land ist fatal: elf Millionen Vertriebene, 18 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht. Internationale Geber haben zwar mehr Hilfe zugesagt, doch die politischen Rahmenbedingungen für Hilfslieferungen fehlen. Je länger der Krieg andauert, desto schwieriger wird es, ihn zu beenden, schlussfolgert Merga Yonas Bula in seiner Analyse.
Die anhaltende Dürre im Süden des Kontinents bedroht dort ebenfalls die Nahrungsmittelsicherheit. In Simbabwe, der Kornkammer Afrikas, gilt seit Anfang April ein nationaler Notstand. Die Hilfslieferungen eines russischen Konzerns wurden von der EU lange blockiert. Farayi Machamire berichtet aus Harare.
Bei der Suche nach einer neuen deutschen Sahel-Politik steht nicht etwa das Auswärtige Amt im Fokus, sondern Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Als Vorsitzende der Sahel-Allianz nutzt sie geschickt Spielräume, um außenpolitisch zu agieren. David Renke stellt Ihnen die neue Rolle der “Bundessahelministerin” vor.
Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank sind die hohen Schulden vieler afrikanischer Staaten diskutiert worden. Dabei ist die Verschuldung im Verhältnis zum BIP oft gar nicht exorbitant. Im Jahr 2022 (Daten für 2023 liegen noch nicht vor) lag die Schuldenquote aller afrikanischen Staaten bei 22,5 Prozent. Von einem solch niedrigen Schuldenlevel können viele europäische Staaten nur träumen. Insgesamt lagen die afrikanischen Auslandsschulden im Jahr 2022 bei 655,6 Milliarden Euro. Allein die deutschen Auslandsschulden betrugen 9,6 Billionen Euro Ende 2023.
Und dennoch: Einige afrikanischen Staaten können ihre Auslandsschulden nicht mehr oder nur noch unter großen Mühen bedienen. Es ist jedoch weniger die absolute Höhe, unter der die Länder leiden. Es ist vielmehr der Dollar. In vielen Ländern treibt die starke US-Währung den Schuldendienst in die Höhe und verschärft die Devisenknappheit. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt das Beispiel Südafrikas: Anfang 2011 kostete ein Dollar rund 6,50 Rand. Heute müssen Südafrikaner etwa 19 Rand auf den Tisch legen, um einen Dollar zu bekommen – Südafrikas Währung hat in diesen 13 Jahren rund zwei Drittel seines Werts verloren. Oder andersherum: Südafrika muss deutlich mehr nationale Währung aufbringen, um seine Auslandsschulden zu bedienen.
Die Folge der Schwäche ihrer Währungen belastet sämtliche Schwellenländer:
Die Ursachen der Schwäche der afrikanischen Währungen sind bekannt:
Nach der Theorie der ungedeckten Zinsparität, einem grundlegenden Konzept der Währungstheorie, sollten Zinsunterschiede die Wechselkursschwankungen zum großen Teil erklären. Dies ist jedoch zwischen dem Dollar und den Währungen der Schwellenländer nicht der Fall. Zinsunterschiede erklären nur zu einem geringen Teil die Abwertung der Schwellenländer-Währungen gegenüber dem Dollar.
Offenbar kommt bei den Schwellenländern eine zusätzliche Risikoprämie wesentlich zum Tragen. Diese Prämie korreliert mit verschiedenen Faktoren, die durch kurzfristige Zinsdifferenzen nicht gut erfasst werden, etwa die Risikobereitschaft von Investoren und Unternehmen oder die Marktvolatilität.
Adrien Verdelhan, Finanzökonom an der MIT Sloan School of Management, unterscheidet 2018 in einem Aufsatz für das Journal of Finance zwischen einem Dollar-Faktor und einem Carry-Faktor. Der Dollar-Faktor beschreibt, wie sich Faktoren, die den Dollar betreffen, auf die Schwellenmarkt-Währungen auswirken. Daneben identifiziert Verdelhan risikobedingte Bewegungen in den Wechselkursen der Schwellenmarkt-Währungen, die nicht direkt auf US-Schocks zurückzuführen sind.
Diese Schocks werden in der währungstheoretischen Literatur als “Carry-Faktor” bezeichnet. Dieser Faktor definiert sich als die Differenz zwischen Wechselkursänderungen von Währungen mit hohen Renditen und denen von Währungen mit niedrigen Renditen. Wenn Anleger Carry-Trades betreiben – also wenn sie Vermögenswerte in Währungen mit niedriger Rendite verkaufen, um Vermögenswerte in Währungen mit hoher Rendite zu kaufen – sind sie durch den Wechselkurs globalen Risiken ausgesetzt.
Hochzinswährungen verlieren in einem Wirtschaftsabschwung oder während einer ungünstigen Risikostimmung tendenziell an Wert. Währungen der Schwellenländer sind typischerweise Hochzinswährungen. Wenn die Investoren bereit sind, für höhere Renditen ins Risiko zu gehen, investieren sie stärker in Schwellenländer. Bei einem Anstieg des globalen Risikos ziehen sie aber auch als erstes ihr Kapital aus diesen Ländern wieder ab und transferieren es in vermeintlich sichere Märkte, in denen sie das Verlustrisiko als gering einschätzen.
Wenn das globale Risiko steigt, vergrößert sich somit der Unterschied in den Wechselkursrenditen. Auf diese Weise sind die Wechselkurse afrikanischer Währungen besonders stark mit dem globalen Risiko korreliert.
Die Folgen dieser Zusammenhänge bekam Südafrika zu spüren, wie Verdelhan beschreibt. Während des Ausverkaufs der Schwellenmarkt-Währungen im Jahr 2018 war die Zinsdifferenz Südafrikas zu den USA eigentlich positiv. Doch gleichzeitig war die globale Risikoprämie so hoch, dass Südafrikas Risikoprämie den Zinsunterschied mehr als kompensierte und die Anleger ihr Geld aus dem Rand abzogen.
Wie sehr die Dollar-Dominanz die Schwellenländer belastet, haben die Ökonomen Maurice Obstfeld und Haonan Zhou untersucht. Demnach führt eine Dollar-Aufwertung von zehn Prozent in den Schwellenländern innerhalb eines Jahres zu einer Verminderung ihrer Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent. In entwickelten Ländern ist dieser Effekt deutlich geringer: Nach einem Quartal beträgt der Rückgang 0,6 Prozent, und auch dieser ist nach einem Jahr verschwunden.
Die Angst vor Wechselkursschwankungen und eine mangelnde akkommodierende Geldpolitik verschärft Obstfeld und Zhou zufolge einen Rückgang der Investitionen in den Schwellenländern.
Eine große Rolle spielt in Schwellenländern der Einkommenskompressionskanal: Geringere Einkommen führen zu einem Rückgang des Kaufs importierter Artikel. Da aber lokales Angebot in Afrika den Rückgang von Importen oft nicht kompensieren kann, ist eine höhere Teuerungsrate die Folge. In Südafrika lag die Inflation im ersten Quartal 2024 bei 5,4 Prozent. Der Wert erscheint im afrikanischen Vergleich nicht besonders hoch. Er liegt jedoch klar über der US-Inflation von 3,8 Prozent im März 2024. Für den Kontinent sieht die Agence Française de Développement zwar einen Trend zur Disinflation, beziffert die Inflation im Jahr 2023 jedoch auf mehr als 20 Prozent.
Somit würde ein reiner Schuldenschnitt in Afrika zu kurz greifen. Ein Schuldenerlass würde nur die Länder mit hohen Schulden entlasten und die anderen nicht. Dabei leidet die gesamte afrikanische Wirtschaft unter der anhaltenden Dollar-Stärke.
Die Ursache für die Abwertung der afrikanischen Währungen ist im Wesentlichen ein Anstieg der globalen Risikoprämien. An dieser Stelle muss auch eine tiefgreifende Reform der globalen Finanzarchitektur ansetzen. Es tun somit Mechanismen not, die die Risikowahrnehmung Afrikas positiv beeinflussen. Eine echte Lösung der Schuldenproblematik erfordert deshalb Instrumente, die Afrika weniger den Schwankungen der globalen Risikoneigung aussetzen.
Mehr als 23.000 Tonnen kostenloser Dünger und 25.000 Tonnen Weizen des russischen Unternehmens Uralchem sind kürzlich in Simbabwe eingetroffen. Bei den Düngemitteln handelt es sich um Kali und NPK-Dünger, wobei N für Stickstoff steht, P für Phosphat und K für Kalium. Dies sei die fünfte humanitäre Lieferung von Uralchem zur Unterstützung der afrikanischen Landwirtschaft und zur Linderung der Auswirkungen der globalen Nahrungsmittelkrise gewesen, heißt es in einer Mitteilung des russischen Unternehmens. Die Lieferung sei am Hafen Beira in Mosambik per Schiff angekommen und anschließend auf Lastwagen nach Simbabwe transportiert worden.
Die Nachricht wäre nicht groß der Rede wert, hätte die Europäische Union nicht zuvor in europäischen Häfen mehr als 100.000 Tonnen Düngemittel von Uralchem zurückgehalten. Dahinter stand der Verdacht, dass die russische Regierung mit dieser humanitären Geste Verbündete für sich zu gewinnen versucht oder sie als diplomatisches Druckmittel einsetzt. Erst nach Gesprächen mit den Entwicklungspartnern stimmte die EU der Freigabe von zunächst 134.000 Tonnen zu. Insofern sind diese Lieferungen von Düngemittel ein großes Politikum, das nicht nur die Beziehungen zwischen der EU und Russland betrifft, sondern auch die der EU und Regierungen in Afrika.
“Simbabwe und die Russische Föderation sind weiterhin den abscheulichen und illegalen Sanktionen der westlichen Hegemonialmächte ausgesetzt“, sagte der Präsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa. “Während der 23 Jahre andauernden Sanktionen gegen Simbabwe war die Russische Föderation ein wahrer, vertrauenswürdiger und verlässlicher Verbündeter der Menschen in diesem Land.”
Die Beziehungen zwischen den westlichen Ländern und der aktuellen Regierung von Simbabwe sind zudem durch Reise- und Finanzsanktionen belastet, die der Westen Anfang der 2000er-Jahre gegen Führungspersonen des Landes und angeschlossener Unternehmen wegen angeblicher Wahlfälschung und Menschenrechtsverletzungen verhängt hatte.
Die USA haben zwar die Sanktionen gegen die meisten Simbabwer vor kurzem aufgehoben. Doch einige hochrangige Personen – darunter auch Staatspräsident Mnangagwa – stehen weiterhin auf der Sanktionsliste.
“EU-Sanktionen sind sorgfältig konzipiert, um unbeabsichtigte Folgen für die Ernährungssicherheit von Drittländern auf der ganzen Welt zu vermeiden”, weist eine Sprecherin der EU-Kommission die Anschuldigungen zurück. “Die EU-Sanktionen gegen Russland zielen in keiner Weise auf den Handel mit Agrar- und Nahrungsmittelprodukten, einschließlich Getreide und Düngemitteln, zwischen Russland und Drittländern ab.”
Wenn Drittländer russische Düngemittel kaufen wollten, gäbe es keine EU-Sanktionen, die dies verbieten würden. Im Gegenteil habe sich die EU aktiv dafür eingesetzt, den globalen Strom von Agrar- und Nahrungsmittelprodukten aufrechtzuerhalten, beispielsweise durch die Einführung sehr gezielter Ausnahmen von Verboten in den Russland-Sanktionen. “In ihrem 9. Sanktionspaket vom Dezember 2022, das noch heute gültig ist, führte die EU eine Ausnahmeregelung ein, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Lebensmittel- und Düngemitteltransaktionen mit sanktionierten Personen zu genehmigen, die vor ihrer Aufnahme in die Liste eine wichtige Rolle im internationalen Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten spielten”, sagte die Kommissionssprecherin weiter.
Die diplomatische Lage wird noch dadurch verwickelter, dass Russland diese letzte Lieferung mit Unterstützung des Welternährungsprogramms WFP der Vereinten Nationen durchführte. Das WFP hatte einen Massengutfrachter für den Transport des Düngemittels gechartert, während die Uralchem-Gruppe die Seefracht und andere Lieferkosten übernahm, so wie es das Unternehmen bei früheren gemeinsamen Lieferungen schon getan hatte.
Uralchem sei “erfreut, dass die humanitäre Lieferung Simbabwe erreicht, wo die Bauern vor Ort bald unsere Düngemittel nutzen und reiche Ernten anbauen können”, wird der CEO von Uralchem, Dmitrij Konjajew, in einer Mitteilung zitiert. Bis heute hat der Konzern besagte 134.000 Tonnen Düngemittel kostenlos auf den afrikanischen Kontinent geschickt. In Zusammenarbeit mit dem WFP wurden mehr als 111.000 Tonnen von europäischen Häfen und Lagerhäusern nach Malawi, Nigeria, Kenia und Simbabwe verschifft.
Uralchem ist einer der größten Hersteller von Stickstoffdüngern der Welt. Der Konzern hatte sich verpflichtet, rund 300.000 Tonnen Düngemittel zu spenden, um die durch den Konflikt in der Region verursachte weltweite Nahrungsmittelkrise zu lindern und Ernteausfälle in von Hungersnot betroffenen Ländern zu verhindern.
Der Dünger saß lange in europäischen Häfen fest, nachdem die EU im März 2022 Sanktionen gegen den damaligen Vorsitzenden der Uralchem Group, Dmitrij Masepin, verhängt hatte. Der russisch-belarussische Oligarch, der zuvor 100 Prozent an dem Unternehmen hielt, veräußerte daraufhin 52 Prozent der Anteile und trat als Geschäftsführer zurück. Masepins Einspruch gegen die Sanktionen hatte im November ein EU-Gericht abgewiesen.
“Obwohl Lebensmittel und Düngemittel offiziell von den gegen Russland verhängten internationalen Sanktionen ausgenommen sind, wurden Anfang 2022 mehr als 260.000 Tonnen Düngemittel der Uralchem Group in der EU im Wesentlichen blockiert”, sagte der Sprecher von Uralchem, Emin Bayramov. Die humanitären Initiativen der Uralchem Group lägen “jenseits der Politik”.
“Als wichtiger globaler Produzent und Exporteur von Mineraldüngern und als Unternehmen mit der kühnen Mission, zur Beseitigung des Hungers beizutragen, tut die Uralchem Group alles in ihrer Macht Stehende, um eine stabile Nahrungsmittelversorgung in den Teilen der Welt zu sichern, die mit Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen haben”, sagte er.
Uralchem erklärte, seine humanitäre Initiative sei nicht von politischen Motiven beeinflusst. Als weltweiter Anbieter von Mineraldüngern sei das Unternehmen bestrebt, die Ernährungsunsicherheit zu lindern und eine stabile Lebensmittelversorgung in gefährdeten Regionen zu gewährleisten.
Die simbabwische Regierung hatte einen nationalen Notstand ausgerufen, nachdem die anhaltende Dürre im südlichen Afrika rund die Hälfte der Maisernte vernichtet hatte. Präsident Mnangagwa erklärte, die Spende werde dazu beitragen, die Auswirkungen der Dürre zu lindern. Die simbabwische Regierung bezeichnete die Lieferung als Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden Ländern und als Erfüllung eines Versprechens des russischen Präsidenten Putin. Dieser hatte im Juli 2023 afrikanischen Staats- und Regierungschefs Zehntausende Tonnen Getreide versprochen.
Auf dem Russland-Afrika-Gipfel im Juli 2023 in St. Petersburg hatte Putin angekündigt, Russland sei bereit, die ukrainischen Getreideexporte nach Afrika sowohl auf kommerzieller als auch auf Hilfsbasis zu ersetzen. So werde Moskau seine entscheidende Rolle bei der weltweiten Ernährungssicherheit erfüllen.
Bei westlichen Politikern scheint der Sudan nach der Ukraine und Israel einen drittrangigen Platz einzunehmen. Sie setzen sich unbestritten für humanitäre Hilfe ein. Doch von der Geberkonferenz in Paris Mitte April ging nicht der notwendige Nachdruck für eine politische Lösung aus.
Am 15. April ging der Bürgerkrieg im Sudan in sein zweites Jahr. Schon jetzt hat er eine noch nie dagewesene politische und humanitäre Krise ausgelöst. Aus einem UN-Bericht geht hervor, dass 18 Millionen der 49,7 Millionen Einwohner des Sudan “akut von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.” “Der Konflikt hat eine der größten Vertreibungskrisen der Welt ausgelöst, bei der fast elf Millionen Menschen vertrieben wurden”, heißt es im Bericht weiter. Doch diese Krise hat, so zynisch es klingen mag, auch ihre Nutznießer.
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Hamdan Dagalo, dem Chef einer paramilitärischen Truppe – den Rapid Support Forces (RSF) – haben den Konflikt im April 2023 ausgelöst. Dagalo, der auch unter seinem Spitznamen “Hemedti” bekannt ist, hatte sich geweigert, die paramilitärische Truppe in die sudanesische Armee zu integrieren. “Es ist unklar, wer den ersten Schuss abgefeuert hat, aber was folgte, war eine unbestreitbare Katastrophe für das ganze Land”, schrieb die Crisis Group in ihrem Bericht vom 15. April 2024.
Beide Konfliktparteien werden beschuldigt, den Zugang zu humanitären Hilfsaktionen zu behindern. Die RSF verlange “himmelhohe Gebühren von den Hilfstransportern an den Kontrollpunkten oder stehle ihre Ladung, während die Armee versuche, die Hilfe in den von der RSF gehaltenen Gebieten zu blockieren”, heißt es im Bericht der Crisis Group.
Vor dem Hintergrund des Jahrestages haben sich die Länder Deutschland, Frankreich, die USA und die EU auf einer Geberkonferenz am 15. April 2024 in Paris verpflichtet, humanitäre Hilfe von mehr als 840 Millionen Euro zu spenden.
Das Norwegische Rettungskomitee NRC erklärte, die Zusage helfe “den Opfern des brutalen, vernachlässigten Konflikts im Sudan”. Auch andere Hilfsorganisationen begrüßten diese Zusage. Doch zugleich fordern sie mehr Anstrengungen, um die für den Sudan und seine Nachbarländer benötigten vier Milliarden Dollar zu erreichen.
So sehr humanitäre Hilfe nottut, so sehr stellt der Bürgerkrieg die internationale Staatengemeinschaft vor eine schwierige Entscheidung. Es ist unbestritten, wie sehr die Menschen auf Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterkünfte und sauberes Wasser angewiesen sind. Doch es fehlen die politischen Rahmenbedingungen, die Hilfe ermöglicht. Das birgt die Gefahr weiterer humanitärer Krisen – es sei denn, die westlichen Mächte hören auf, “Bedenken zu äußern“, und fangen an, politischen Lösungen die notwendige Priorität einzuräumen.
Jihad Mashamoun, ein sudanesischer Politikanalyst und ehrenamtlicher Forschungsbeauftragter am Institut für arabische und islamische Studien an der Universität Exeter, hat Verständnis für diese Bedenken. “Aber es ist eine Sache, etwas zu versprechen, und eine andere, es in die Tat umzusetzen”, sagte Jihad zu Table.Briefings.
Die Crisis Group bemängelt, dass “die USA, die UN und die Afrikanische Union ihre Diplomatie durch die Ernennung neuer Gesandter wiederbelebt haben, es den gemeinsamen Bemühungen zur Förderung des Friedens aber immer noch an Kohärenz und Dringlichkeit fehlt”. Daher müssten diejenigen, die Einfluss haben, “zusammenarbeiten, um die beiden Seiten zur Beendigung des Krieges zu drängen”.
Ende Februar ernannte das US-Außenministerium Tom Perriello zum Sondergesandten für den Sudan. Jihad bezeichnet diese Berufung als “zu spät”: Die Beauftragten, die das Außenministerium vor ihm ernannt habe, seien nicht in der Lage gewesen, viel zu tun. “Das US-Außenministerium hat keinen großen Fokus auf den Sudan“, lautet Jihads Urteil.
Es wird umso schwieriger, den Krieg zu beenden, je länger es dauert, eine politische Lösung zu finden, da der Krieg bereits ethnische und religiöse Formen angenommen habe, befürchtet die Crisis Group.
Eine politische Lösung wird auch durch die diplomatische Lage in der Region erschwert. Der Iran (der beschuldigt wird, al-Burhan mit Drohnen zu versorgen), Ägypten und Eritrea stehen angeblich auf der Seite der sudanesischen Armee, während die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Libyen und Äthiopien ihre Hand versteckt nach Hemedti ausstrecken.
Angeblich unterstützen die VAE Hemedti über den Tschad und Äthiopien, berichtet Jihad. Er wiederum beschuldigt die USA, “diese regionalen Verbündeten (zum Beispiel die VAE, Anm. der Redaktion) für Faktoren zu halten, die zur Stabilität in der Region beitragen könnten. “Leider halten diese Verbündeten die Stabilität nicht auf diese Weise aufrecht”, kritisiert Jihad. “Sie verursachen sogar noch mehr Instabilität.”
Ägypten stritt mit Äthiopien über den Bau des Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) am Blauen Nil, während Eritrea (dessen Regierung “besorgt darüber ist, dass die RSF weiter nach Osten in Richtung ihrer Grenzen vordringt”) und Äthiopien über Grenzfragen und den Zugang zum Roten Meer aneinandergeraten sind.
“Diese ausländischen Verstrickungen bergen das Potenzial für eine erhebliche Verschärfung der Gewalt, je weiter sich der Krieg und seine Auswirkungen über die Grenzen des Sudan hinaus ausbreiten, ein Prozess, der bereits in vollem Gange ist”, stellte die Crisis Group fest.
Jihad stimmt auch zu, dass diese Schwierigkeiten “Auswirkungen auf die Sicherheit des Sudan und des Roten Meeres haben”. Ein Grund mehr, dass es der Westen nicht bei Geberkonferenzen für die Verteilung humanitärer Hilfe belässt, sondern aktiv auf eine politische Lösung drängt.
Beim G7-Außenministertreffen auf der italienischen Ferieninsel Capri vergangene Woche nahm Afrika neben einer Deeskalation in Nahen Osten und weiterer Unterstützung der Ukraine eine zentrale Rolle ein. Besonders die Entwicklungen in Libyen, der Sahelzone, am Horn von Afrika, Somalia, Äthiopien, Sudan und der DR Kongo fanden Erwähnung in der Abschlusserklärung zu globalen Herausforderungen und Partnerschaften.
Die Außenminister kündigten an, die Partnerschaft mit afrikanischen Ländern und regionalen Organisationen wie der Afrikanischen Union (AU) “weiter zu vertiefen”. Hierzu wird die Aufnahme der AU als ständiges Mitglied der G20 begrüßt und die Unterstützung für den G20-Pakt mit Afrika bekräftigt. Die G7-Afrika-Partnerschaft orientiere sich an den Zielen der AU-Agenda 2063, der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Abkommen.
Besorgt zeigten sich die Außenminister über die Folgen des Krieges in der Ukraine und die “Nutzung von Nahrungsmitteln und Energieressourcen als Waffe”. Dies habe Afrika besonders getroffen. In Klimafragen bekräftigen die Außenminister die starke Partnerschaft für einen “gerechten, grünen Übergang zu Netto-Null-Emissionen. Dies sei Kern einer nachhaltigen Entwicklung” im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Die Schuldenanfälligkeit afrikanischer Länder wurde als “große Herausforderung” anerkannt. Sie erfordere eine Koordinierung zwischen offiziellen bilateralen und privaten Gläubigern, wobei die multilateralen Entwicklungsbanken weiterhin “eine Schlüsselrolle bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch mehr Finanzierung, politische Beratung und technische Hilfe” spielen sollen. Besorgt zeigten sich die Minister über die “Aktivitäten der vom Kreml unterstützten Wagner-Gruppe und anderer aufstrebender, von Russland unterstützter Kräfte”. Vor allem in Nordafrika, Zentralafrika und der Sahelzone hätten sie destabilisierende Auswirkungen.
Besonders die Verschlechterung der Sicherheitslage in der Sahelzone sei “sehr besorgniserregend”. Sie gehe einher mit “Rückschritten bei den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit”. Auch sei Ostafrika, darunter Somalia, Äthiopien, Somalia und der Sudan, von Konflikten, Armut, bewaffneter Gewalt und Nahrungsunsicherheit geprägt. Letztere werde durch extreme Wettersituationen verschärft. Die G7-Außenminister “verurteilen auf Schärfste” die Wiederaufnahmen der Angriffe der M23-Rebellen im Osten der DR Kongo und zeigten sich besorgt über ausländische militärische Unterstützung. as
Die Volkswagen Group Africa hat angekündigt, umgerechnet knapp 200 Millionen Euro in sein Montagewerk in Kariega in der Eastern Cape Provinz zu investieren. Die Investitionen soll für die Entwicklung und von 2027 an Montage eines neuen SUVs verwendet werden. Bisher baute Volkswagen mit dem Polo und Polo Vivo zwei erfolgreiche Modelle in Südafrika. Der neue SUV soll auf der Polo-Plattform basieren und wird mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor ausgestattet werden.
Obwohl die meisten globalen Fahrzeugmärkte auf Elektrofahrzeuge umstiegen, “werden afrikanische Märkte wie Südafrika weiter auf absehbare Zeit Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren produzieren und verkaufen,” sagte Martina Biene, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Volkswagen Group Africa. Bisher sei die Kundennachfrage nach Verbrennungsmotoren und die Einführung von E-Fahrzeugen in diesen Märkten langsam.
Der Konzern entwickelt das neue Modell in Zusammenarbeit zwischen Volkswagen Brasilien und Volkswagen Group Africa. Der Plan ist ganz auf die Märkte des Globalen Südens zugeschnitten. “Südafrika ist ein wichtiger Markt für den Volkswagen-Konzern, insbesondere in Hinblick auf unser langfristiges Ziel, unsere Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent zu etablieren, der als letzte Grenze für die Automobilentwicklung gilt”, sagt Biene.
VW liebäugelt somit mehr mit dem afrikanischen als mit dem europäischen Markt, wo Neuwagen mit Verbrennungsmotoren von 2035 an verboten sind. Damit stünde hinter der Entscheidung für das SUV aus Südafrika eine langfristig angelegte Strategie zur Erschließung neuer Märkte. Die “Reise zur Elektrifizierung” in Südafrika werde mit einer Flotte des ID.4-SUV beginnen, die der Konzern von der zweiten Jahreshälfte 2024 an testen würde. as
Die Teilnehmer der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank haben sich auf einige Initiativen geeinigt. Andere wichtige Reformen bleiben jedoch unerledigt. Weltbankpräsident Ajay Banga versprach auf der Tagung vergangene Woche in Washington D.C. unter anderem, die Projektgenehmigungen zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Die Weltbank hat außerdem einen Plan angekündigt, der bis 2030 den Zugang zu erschwinglicher Elektrizität für 250 Millionen Menschen in ganz Afrika ermöglichen soll. In Partnerschaft mit der Afrikanischen Entwicklungsbank sollen weitere 50 Millionen Menschen mit Strom versorgt werden. Die Bank will auch die Zahl der Menschen verdoppeln, die sie mit ihren Gesundheitsprogrammen erreicht. Bis 2030 sollen erschwingliche Gesundheitsdienste für 1,5 Milliarden Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereitgestellt werden. Beide Initiativen sind jedoch vom Engagement der Geber abhängig.
Mittel von etwa elf Milliarden US-Dollar wurden für neue Instrumente wie Hybridkapital und Garantien zugesagt. Die Bank geht davon aus, dass diese Summe in den nächsten zehn Jahren zu einer Aufstockung der Kreditvergabe um 70 Milliarden Dollar führen kann. Was die seit langem erwartete Kapitalerhöhung für die Bank angeht, sind allerdings keine Fortschritte zu verzeichnen.
Viele Beobachter fordern weitere Reformen – vor allem mit Blick auf die Verschuldung vieler einkommensschwacher Länder. Besonders die Länder des Globalen Südens hatten zuletzt auf eine neue globale Finanzarchitektur gedrängt. Schon auf dem Pariser Klimafinanzgipfel im Juni 2023 hatten Vertreter afrikanischer Staaten mehr Mitspracherecht gefordert. Dabei geht es um Themen wie Umschuldung, Klimafinanzierung und grüne Investitionen. ajs
Der Weltmarktpreis für Kakao hat ein Rekordniveau erreicht und liegt nun erstmals bei mehr als 10.000 Dollar pro Tonne. Der S&P GSCI Cocoa Index ist allein in diesem Jahr schon um 173 Prozent in die Höhe gegangen, in den vergangenen fünf Jahren um 383 Prozent. Der Preisanstieg ist auf die erwartete Verknappung von Kakaobohnen angesichts von Nutzpflanzenkrankheiten und extremen Wetterbedingungen in Westafrika zurückzuführen. In Erwartung des vierten schlechten Jahres in Folge haben die Schokoladenhersteller die Preise für die Verbraucher bereits erhöht.
Elfenbeinküste und Ghana sind die weltweit größten Kakaoproduzenten und machen zusammen etwa 60 Prozent des Weltmarktes aus. Zählt man noch Kamerun und Nigeria hinzu, produziert Westafrika mehr als Dreiviertel des globalen Kakaoangebots. Die Region hat jedoch aufgrund von Dürren, Bränden und anderen durch den Klimawandel bedingten Wetterphänomenen drastische Ertragseinbußen zu verzeichnen.
Darunter leiden vor allem die Bauern, denn die Probleme werden durch jahrzehntelange Unterinvestitionen in dem Sektor verschärft. Seit Jahren wird ein Großteil des Rohkakaos exportiert, ohne dass die Bohnen lokal verarbeitet würden. Nach Angaben des BMZ erhalten Hersteller und Händler für jeden Euro, der für eine Tafel Schokolade bezahlt wird, etwa 80 Cent, während die Kakaobauern nur rund sieben Cent erhalten.
Laut Internationaler Kakao-Organisation (ICCO) ist die in ivorischen und ghanaischen Häfen umgeschlagene Kakaomenge seit Beginn der Saison um 28 beziehungsweise 35 Prozent zurückgegangen. Die ICCO rechnet mit einem Defizit von 374.000 Tonnen in dieser Saison und geht davon aus, dass die Kakaobestände bis zum Ende der Saison auf den niedrigsten Stand seit 45 Jahren fallen werden.
Der Rückgang der Produktion wirkt sich auch auf die ohnehin geringe lokale Verarbeitung aus. Zwei der größten Verarbeitungsbetriebe in Afrika, die in Ghana und Elfenbeinküste angesiedelt sind, haben die Verarbeitung entweder eingestellt oder zurückgefahren, weil sie die Bohnen nicht mehr bezahlen können. Viele Bauern suchen inzwischen nach alternativen Einnahmequellen, etwa durch den Verkauf ihres Landes an Bergbauunternehmen.
Die kritische Lage auf dem Kakaomarkt war auch Thema auf der 5. Weltkakaokonferenz in Brüssel in der vergangenen Woche. Die NGO Oxfam veröffentlichte anlässlich der Konferenz einen Bericht. Darin machen die Autoren die großen Schokoladenproduzenten für die gegenwärtige Situation verantwortlich: “Die Explosion des Kakaopreises hätte verhindert werden können, wenn die Konzerne den Bauern einen fairen Preis gezahlt und ihnen geholfen hätten, ihre Farmen widerstandsfähiger gegen extreme Wetterbedingungen zu machen”, sagte Bart Van Biesen, politischer Berater bei Oxfam.
Weltmarktführer in der Kakaoverarbeitung ist der schweizerische Konzern Barry Callebaut mit einem Weltmarktanteil von 30 Prozent, gefolgt vom amerikanischen Verarbeiter Cargill, dem asiatischen Konzern Olam in Singapur, dem US-Marktführer Blommer Chocolate Company und dem chinesischen Unternehmen Guan Chong. ajs
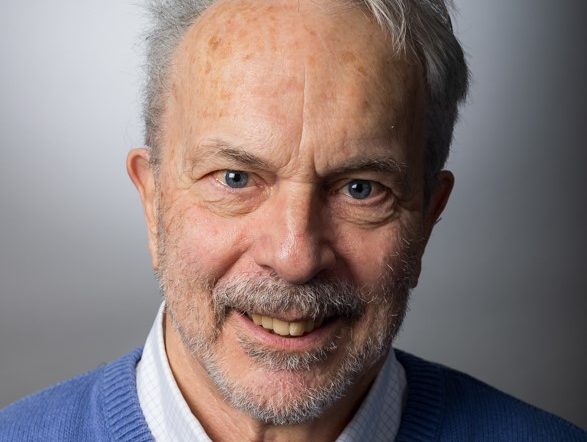
Das Wahlergebnis im November 2019 schwächte erstmals die Swapo als einstige Befreiungsbewegung an der Macht. Mit 65,5 Prozent und 63 der 96 Mandate büßte sie die Zwei-Drittel-Mehrheit ein. Fünf Jahre zuvor hatte sie mit 80,1 Prozent ihr bestes Ergebnis. Dank eines uneingeschränkt proportionalen Wahlrechts ergatterten insgesamt elf Parteien mindestens einen Sitz. Die Popular Democratic Movement (PDM) wurde mit 16 Abgeordneten stärkste Oppositionspartei.
Dem wiedergewählten Staats- und Parteipräsidenten Hage Geingob erging es noch schlimmer: Das Rekordergebnis 2019 von 86,7 Prozent schrumpfte auf 56,3 Prozent. Dies war dem Swapo-Dissidenten Panduleni Itula, geschuldet, der ihm als unabhängiger Kandidat 29,4 Prozent der Stimmen abknöpfte. Mit den Regional- und Kommunalwahlen 2020 wurde die Swapo-Dominanz außerhalb der nördlichen Bastionen beendet. Seither regieren Oppositionsparteien mehrere Regionen und nahezu alle städtischen Kommunen. Die von Itula gegründete Independent Patriots for Change (IPC) setzte der Swapo am meisten zu.
So wundert es nicht, dass die politische Stimmung angespannter ist als je zuvor seit der Unabhängigkeit 1990. Die Zeichen mehren sich, dass die heiße Phase des Wahlkampfs schon begonnen hat. Mit dem unerwarteten Tod Hage Geingobs am 4. Februar übernahm dessen Stellvertreter Nangolo Mbumba das Amt in einem nahtlosen Übergang, der die Rechtsstaatlichkeit des Landes eindrucksvoll unterstrich. Er wird bis Ende der Legislaturperiode am 21. März 2025 als viertes Staatsoberhaupt amtieren, während Netumbo Nandi-Ndaitwah als designierte Swapo-Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen seine Stellvertreterin wurde. Sie sieht sich von Itula wie die Swapo von der IPC herausgefordert, wenn es zum Urnengang kommt.
Dass dies zu Empfindsamkeiten führt und deshalb auch diplomatisches Geschick erfordert, wurde in der ersten April-Hälfte deutlich: Die Deutsche Botschaft präsentierte namens Botschafter Thorsten Hutter auf X ein Foto der Botschafter der EU-Länder an gedecktem Tisch. Die Unterschrift erklärte, es sei eine Ehre gewesen, sich mit dem IPC-Parteipräsidenten über aktuelle Angelegenheiten auszutauschen.
Eine IPC-Presseerklärung ergänzte, es seien die kommenden Wahlen und Klagen unter Veteranen des Befreiungskampfes diskutiert worden. Damit, so wurde behauptet, habe Swapos Hegemonie einen schweren Rückschlag erlitten. Die Windhoek Times als informelles Parteiorgan stilisierte das Gespräch auf X zu einer Diskussion der EU-Namibia Beziehungen und fügte hinzu, Itula würde weithin als nächster Präsident Namibias gelten.
Die Swapo-Führung reagierte entsprechend überzogen. So bestellte der Außenminister die Diplomaten ein. Er belehrte sie, dass die Wiener Konvention eine Einmischung in Regierungsangelegenheiten untersage. Netumbo Nandi-Ndaitwah witterte anlässlich einer Sitzung des Swapo-Zentralkomitees Spuren eines regime change. Sie wies darauf hin, dass die Rolle des deutschen Botschafters angesichts der bilateralen Verhandlungen zum Völkermord besonders ärgerlich sei. Der Führer der Swapo-Jugendliga forderte gar, die Diplomaten des Landes zu verweisen.
Der Sturm im Wasserglas veranlasste die EU-Vertretung zur Erklärung, dass keine Regierungsangelegenheiten behandelt worden seien. Vielleicht hätte mehr Fingerspitzengefühl bei der Bekanntmachung des Gesprächs (so diese im Sinne des diplomatischen Alltagsgeschäfts überhaupt nötig gewesen wäre) das Theater verhindert.
Ein weiteres Bemühen um Schadensbegrenzung folgte prompt: Am 15. April präsentierte Botschafter Hutter auf X ein Foto, das ihn händeschüttelnd mit Namibias Außenminister zeigt. Er erklärte, es hätte ein fruchtbares und freundliches Treffen zur Stärkung der Partnerschaft beider Länder gegeben. Während der Botschafter beim Blick in die Kamera ein Lächeln anzudeuten schien, wirkte der Außenminister deutlich reservierter.
Henning Melber ist Politikwissenschaftler, Entwicklungssoziologe und Afrikawissenschaftler. Als Sohn deutscher Einwanderer kam er 1967 als Jugendlicher nach Namibia. 1974 trat er der Befreiungsbewegung Swapo bei. Heute forscht er am Nordischen Afrika-Institut in Uppsala (Schweden). Zur Jahresmitte erscheint sein Buch “The Long Shadow of German Colonialism” im Londoner Verlag Hurst.
Washington Post: Verbleib in Niger macht US-Truppen verwundbar, beklagt ein Whistleblower. Ein ranghoher Angehöriger der US-Luftwaffe, der in Niger stationiert ist, schlägt Alarm wegen der langen Weigerung der Biden-Regierung, der Aufforderung der Militärjunta zum Abzug Folge zu leisten. Der Whistleblower beschuldigt die US-Botschafterin und die Verteidigungsattachée, die Sicherheit der etwa 1.100 amerikanischen Soldaten zu gefährden, die in Niger “als Geiseln gehalten” würden. Die Botschaft habe “absichtlich Geheimdienstinformationen zurückgehalten,” um die “Fassade guter bilateraler Beziehungen” aufrechtzuerhalten.
The Namibian: Wasserstoff-Stipendiaten beklagen Zahlungsverzögerungen. Die namibischen Stipendiaten eines von der Bundesregierung unterstützten Wasserstoff-Stipendiums haben ihre Frustration über Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer vierteljährlichen Stipendien zum Ausdruck gebracht. Das Programm Youth for Green Hydrogen führt das Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management (Sasscal) mit Unterstützung der deutschen und namibischen Regierung durch. Einige Studenten haben aufgrund der verspäteten Zahlungen Schwierigkeiten, ihre Lebenshaltungskosten zu decken.
TVC News: Kenianische Behörden beginnen mit Untersuchung des Helikopter-Absturzes. Die kenianische Regierung hat ein Team entsandt, um den Hubschrauberabsturz zu untersuchen, bei dem der oberste Militär General Francis Ogolla und neun weitere Menschen ums Leben kamen. Der Absturz ereignete sich am Donnerstag, 18. April, kurz nachdem der Hubschrauber in Chesegon abhob, wo Ogolla und seine Begleiter eine Schule besuchten.
AP: US-Truppen werden aus Niger abziehen. Die Vereinigten Staaten werden mit den Plänen zum Abzug ihrer Truppen aus Niger beginnen, teilten US-Beamte am Samstag mit. Noch gibt es keinen offiziellen Zeitplan für den Rückzug. Der Versuch seitens der USA, das Militärabkommen mit Niger zu überarbeiten, um den Verbleib im Land zu ermöglichen, ist offenbar gescheitert. Experten zufolge ist dies ein Schlag für Washington und seine Verbündeten, was die Durchführung von Sicherheitsoperationen in der Sahelzone betrifft.
Financial Times: Tony Blair: Westliche Staaten müssen mit Diktaturen im Sahel zusammenarbeiten. Ein aktueller Bericht des Tony Blair Institute for Global Change fordert einen “neuen Pakt” zwischen den Sahelstaaten und der internationalen Gemeinschaft. Der ehemalige britische Premierminister warnt, westliche Versuche, die Militärregime durch Sanktionen und den Entzug von Hilfsgeldern zu isolieren, liefen Gefahr, dass diese sich Moskau und anderen Akteuren weiter annäherten. Eine mögliche Lösung sei die Intensivierung der Bemühungen um die Elektrifizierung der Region, in der vier von fünf Familien keinen Zugang zum Stromnetz haben.
African Business: Europäische Visumsbestimmungen sind für Afrikaner viel strenger. Rund 30 Prozent aller afrikanischen Visumanträge für den Schengenraum werden abgewiesen, wie aus dem Henley & Partners Africa Wealth Report 2024 hervorgeht. Damit liegt die Ablehnungsrate für Afrikaner zehn Prozent über dem globalen Durchschnitt. Dem Bericht zufolge hängt die Ablehnungsrate auch mit der Rückkehr und Rückübernahme illegaler Migranten zusammen. Es werden afrikanische Länder bestraft, deren Bürger sich illegal in Europa aufhalten, sowie diejenigen mit der niedrigsten Rückkehr- und Rückübernahmequote.
Bloomberg: Südafrikas wichtigste Wahl seit der Apartheid. Wenn der regierende ANC gezwungen wird, die Macht zu teilen, könnte das zunächst schmerzhafte Folgen haben. Grundsätzlich sei das aber notwendig und gut, schreibt Bloomberg News-Chefredakteur John Micklethwait. Angesichts der Bemühungen Chinas und Russlands, Einfluss auf dem Kontinent zu gewinnen, habe der Westen ein großes Interesse daran, in Südafrika den politischen Wettbewerb zu stärken und die Demokratie zu festigen.
Al Jazeera: Versicherer sollten EACOP-Pipeline meiden. Noch ist die Finanzierung der East African Crude Oil Pipeline nicht gesichert. Die 1.443 Kilometer lange Leitung soll von den Ölfeldern in Westuganda zum tansanischen Hafen von Tanga verlaufen. Zivilgesellschaftliche Gruppen in Uganda und Tansania fordern mit Verweis auf schwere Klima-, Umwelt- und soziale Risiken, die Pipeline nicht zu bauen. Versicherungsgesellschaften sollten sich weigern, das Projekt zu unterstützen, meinen Myrto Tilianaki und Hellen Huang.
Semafor: Genetisch veränderte Moskitos könnten Malaria ausrotten. Abdoulaye Diabaté forscht am Institut de Recherche en Sciences de la Sante in Burkina Faso und steht an der Spitze der Bemühungen zur Ausrottung von Malaria. In einem Interview erklärt er, wie durch die Veränderung des Erbguts männlicher Moskitos die Verbreitung von Malaria ausgebremst werden kann. Nach ihrer Freisetzung in der Natur verhindern sie die Vermehrung weiblicher Moskitoarten, die Malaria übertragen.
Exportmanager: US-Konzern zieht von Polen nach Marokko. TE Connectivity, ein US-Technologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, hat 140 Mitarbeiter in seinem Werk im Ort Nowa Wieś Lęborska in Pommern entlassen. Nach 22 Jahren werde der Standort nach Marokko verlagert. Auch Werke in Deutschland und Frankreich sollen geschlossen werden, berichtet die Gewerkschaft Solidarność. Der Konzern produziert unter anderem elektronische Steckverbinder und Netzwerktechnik, vor allem für Kunden im Automobilsektor sowie im Bereich Luft- und Raumfahrt.

Der Besuch von Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Burkina Faso vor gut einem Monat war ein besonderer, im Rahmen der zahlreichen Besuche der Ministerin in Westafrika. Es war ein Besuch mit Signalwirkung: Seit den zwei Militärputschen 2022 hatte kein europäischer Minister zuvor das westafrikanische Land besucht.
Die Botschaft der Ministerin: Auch nach dem Zusammenbruch der Demokratie in Mali, Burkina Faso und zuletzt Niger will Deutschland den Kontakt zu den Putschregierungen im Sahel nicht vollends abbrechen und sucht nach Wegen, wie eine Kooperation künftig aussehen könnte. Die große Angst ist, China und Russland stoßen in das Vakuum, das der Westen bei einem vollständigen Rückzug aus der Region hinterlässt. “Wo wir nicht sind, sind sehr schnell andere”, warnte Schulze in einem Interview mit der Deutschen Welle während ihrer Reise.
Der Entwicklungsministerin kommt bei der aktuellen Neuaufstellung der Sahel-Politik der Bundesregierung seit dem Putsch im Niger eine zentrale außenpolitische Rolle zu. Kein anderer deutscher Politiker ist in der Region so präsent wie Schulze. Und die Aufmerksamkeit von Außenministerin Annalena Baerbock wird von den Konflikten in der Ukraine und Gaza gebunden.
In Schulzes Karten spielt, dass sie als amtierende Präsidentin der Sahel-Allianz über größere internationale Geltung verfügt, als ihr allein das Amt der deutschen Entwicklungsministerin zubilligt. In der entwicklungspolitischen Allianz haben sich 18 Länder und internationale Organisationen zusammengeschlossen, um die Länder der Sahel-Zone zu stabilisieren. Neben Deutschland, Frankreich und der EU gehören auch die USA, das UNDP und die Weltbank zu den Mitgliedern. Schulze wurde im vergangenen Juli für ein Jahr zur Präsidentin der Allianz gewählt.
Wie schwer der Neuanfang einer Zusammenarbeit in der Region derzeit trotz alledem ist, zeigt, dass die Putschregierung in Niger, Mali und Burkina Faso aus der Regionalorganisation G5 Sahel ausgetreten sind. Die G5 waren für die Koordination der internationalen EZ zuständig. Dennoch will Schulze das deutsche Engagement im Sahel so gut es geht weiterführen – und sich so auch von Partner Frankreich ein Stück weit unabhängiger werden. Das deutsche Angebot ist jedoch nicht neu: langfristige Kooperationen für ein erträgliches Auskommen, um den Zulauf zu terroristischen Gruppen in der Region zu stoppen und die Sahel-Staaten zu stabilisieren. Das hege Migration ein und nutze im Endeffekt auch Europa und Deutschland, ist Schulze überzeugt.
Schon vor dem Putsch im Niger hatte Schulze auf eine enge Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister Boris Pistorius gesetzt. Im April waren Schulze und Pistorius gemeinsam nach Mali und Niger gereist. Es war die erste gemeinsame Reise eines Verteidigungsministers und einer Entwicklungsministerin überhaupt. Damals hieß es, Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheitspolitik sollen in Niger Hand in Hand gehen.
Knapp ein Jahr später waren Schulze und Pistorius erneut bei einem gemeinsamen Auftritt. Diesmal bei einer Diskussionsrunde der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Den vernetzten Ansatz wollen Schulze und Pistorius trotz der veränderten Lage im Sahel nicht aufgeben. Dennoch bleibt unklar, wie dieser mit den Militärjuntas möglich sein kann. Das neue Credo lautet jedoch: zuhören, präsent bleiben und einen pragmatischen Umgang mit den Juntas pflegen, um auf lange Sicht die Rückkehr zur Demokratie begleiten.
Schnelle und vor allem sichtbare Erfolge erzielt diese Strategie allerdings nicht. Kritiker in Deutschland sind ohnehin überzeugt, dass mit der EZ der Zusammenbruch der Demokratie nicht verhindert wurde und darüber auch künftig die Rückkehr zur Demokratie nicht erreicht werden kann.
Daher wird Schulze innenpolitisch zur Erklärerin. Seit Anfang des Jahres stellt sie sich in Interviews der Kritik entgegen und legt dar, warum die Entwicklungspolitik in einer multipolaren Welt wichtig ist. Dennoch dürfte das Geld künftig noch knapper werden. Nach den schmerzhaften Kürzungen im Budget des BMZ im Rahmen des Haushalts für 2024 drohen in den Verhandlungen über die Etats für 2025 nochmals empfindliche Abstriche. Dabei ist man schon jetzt im BMZ überzeugt, dass ein Grund für das Scheitern des Westens und damit der deutschen EZ daran lag, dass die Mittel zu knapp bemessen waren. David Renke

Es geht um den Jollof-Reis, das wahrscheinlich bekannteste Gericht in Westafrika. Heiß geliebt von Einheimischen, Besuchern und Angehörigen der Diaspora – kein Wunder also, dass jedes Land den Ursprung des Jollof-Reises für sich reklamiert. Das Gericht wird typischerweise mit Fischsteak, Bruchreis, getrocknetem Fisch, Weichtieren und saisonalem Gemüse wie Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch, Chili, Tomaten, Karotten, Auberginen, Weißkohl, Maniok, Süßkartoffeln, Okra und Lorbeerblättern zubereitet, wie die Unesco schreibt.
Die UN-Organisation hat 2021 die Frage nach der Urheberschaft geklärt, als sie das Ceebu Jëen – wie der Jollof-Reis im Senegal auf Wolof heißt – in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufnahm. Darüber, wer genau wann das Ceeb im heutigen Senegal kreiert hat, haben Forscher verschiedene Theorien entwickelt. Bruchreis haben die französischen Kolonialherrscher in Westafrika eingeführt, als Nebenprodukt der Reisproduktion in einem anderen französischen Kolonialgebiet, im damaligen Indochina.
Nie klären lässt sich natürlich die Frage, wo der Jollof-Reis am besten schmeckt. Wer etwa nach Ghana oder Nigeria reist, bekommt bei der Bestellung zumeist die Frage aller Fragen gestellt: Kennen Sie Jollof-Reis? Ach ja? Und wo schmeckt es besser? Vorsicht ist geboten bei der Antwort, oder besser: Kulinarische Diplomatie ist gefragt. Meistens schmeckt’s ja eh am besten, wenn man gerade Hunger hat. Die Jollof-Wars, wie die spielerische Rivalität genannt wird, haben jedenfalls Potenzial für eine epische Dauer.
Regelmäßig finden rund um den Jollof-Reis Festivals statt, etwa in Nigeria oder in den USA. Das Gute am Jollof-Reis ist ja gerade, wie unterschiedlich das Gericht schmecken kann. Am besten also: sich durch jeden Jollof-Reis in Westafrika essen und sich selber eine Meinung bilden. Bon appétit! lcw
das Wachstum afrikanischer Volkswirtschaften bleibt oft unter dem Potenzial – auch aufgrund von Staatsschulden. Zurecht steht das Thema immer wieder auf der Agenda, etwa bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in der vergangenen Woche. Doch das Problem liegt nicht unbedingt in der Höhe der Schulden, sondern ganz woanders, wie Christian von Hiller erklärt.
Der blutige Konflikt im Sudan geht nun in sein zweites Jahr. Die humanitäre Lage im Land ist fatal: elf Millionen Vertriebene, 18 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht. Internationale Geber haben zwar mehr Hilfe zugesagt, doch die politischen Rahmenbedingungen für Hilfslieferungen fehlen. Je länger der Krieg andauert, desto schwieriger wird es, ihn zu beenden, schlussfolgert Merga Yonas Bula in seiner Analyse.
Die anhaltende Dürre im Süden des Kontinents bedroht dort ebenfalls die Nahrungsmittelsicherheit. In Simbabwe, der Kornkammer Afrikas, gilt seit Anfang April ein nationaler Notstand. Die Hilfslieferungen eines russischen Konzerns wurden von der EU lange blockiert. Farayi Machamire berichtet aus Harare.
Bei der Suche nach einer neuen deutschen Sahel-Politik steht nicht etwa das Auswärtige Amt im Fokus, sondern Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Als Vorsitzende der Sahel-Allianz nutzt sie geschickt Spielräume, um außenpolitisch zu agieren. David Renke stellt Ihnen die neue Rolle der “Bundessahelministerin” vor.
Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank sind die hohen Schulden vieler afrikanischer Staaten diskutiert worden. Dabei ist die Verschuldung im Verhältnis zum BIP oft gar nicht exorbitant. Im Jahr 2022 (Daten für 2023 liegen noch nicht vor) lag die Schuldenquote aller afrikanischen Staaten bei 22,5 Prozent. Von einem solch niedrigen Schuldenlevel können viele europäische Staaten nur träumen. Insgesamt lagen die afrikanischen Auslandsschulden im Jahr 2022 bei 655,6 Milliarden Euro. Allein die deutschen Auslandsschulden betrugen 9,6 Billionen Euro Ende 2023.
Und dennoch: Einige afrikanischen Staaten können ihre Auslandsschulden nicht mehr oder nur noch unter großen Mühen bedienen. Es ist jedoch weniger die absolute Höhe, unter der die Länder leiden. Es ist vielmehr der Dollar. In vielen Ländern treibt die starke US-Währung den Schuldendienst in die Höhe und verschärft die Devisenknappheit. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt das Beispiel Südafrikas: Anfang 2011 kostete ein Dollar rund 6,50 Rand. Heute müssen Südafrikaner etwa 19 Rand auf den Tisch legen, um einen Dollar zu bekommen – Südafrikas Währung hat in diesen 13 Jahren rund zwei Drittel seines Werts verloren. Oder andersherum: Südafrika muss deutlich mehr nationale Währung aufbringen, um seine Auslandsschulden zu bedienen.
Die Folge der Schwäche ihrer Währungen belastet sämtliche Schwellenländer:
Die Ursachen der Schwäche der afrikanischen Währungen sind bekannt:
Nach der Theorie der ungedeckten Zinsparität, einem grundlegenden Konzept der Währungstheorie, sollten Zinsunterschiede die Wechselkursschwankungen zum großen Teil erklären. Dies ist jedoch zwischen dem Dollar und den Währungen der Schwellenländer nicht der Fall. Zinsunterschiede erklären nur zu einem geringen Teil die Abwertung der Schwellenländer-Währungen gegenüber dem Dollar.
Offenbar kommt bei den Schwellenländern eine zusätzliche Risikoprämie wesentlich zum Tragen. Diese Prämie korreliert mit verschiedenen Faktoren, die durch kurzfristige Zinsdifferenzen nicht gut erfasst werden, etwa die Risikobereitschaft von Investoren und Unternehmen oder die Marktvolatilität.
Adrien Verdelhan, Finanzökonom an der MIT Sloan School of Management, unterscheidet 2018 in einem Aufsatz für das Journal of Finance zwischen einem Dollar-Faktor und einem Carry-Faktor. Der Dollar-Faktor beschreibt, wie sich Faktoren, die den Dollar betreffen, auf die Schwellenmarkt-Währungen auswirken. Daneben identifiziert Verdelhan risikobedingte Bewegungen in den Wechselkursen der Schwellenmarkt-Währungen, die nicht direkt auf US-Schocks zurückzuführen sind.
Diese Schocks werden in der währungstheoretischen Literatur als “Carry-Faktor” bezeichnet. Dieser Faktor definiert sich als die Differenz zwischen Wechselkursänderungen von Währungen mit hohen Renditen und denen von Währungen mit niedrigen Renditen. Wenn Anleger Carry-Trades betreiben – also wenn sie Vermögenswerte in Währungen mit niedriger Rendite verkaufen, um Vermögenswerte in Währungen mit hoher Rendite zu kaufen – sind sie durch den Wechselkurs globalen Risiken ausgesetzt.
Hochzinswährungen verlieren in einem Wirtschaftsabschwung oder während einer ungünstigen Risikostimmung tendenziell an Wert. Währungen der Schwellenländer sind typischerweise Hochzinswährungen. Wenn die Investoren bereit sind, für höhere Renditen ins Risiko zu gehen, investieren sie stärker in Schwellenländer. Bei einem Anstieg des globalen Risikos ziehen sie aber auch als erstes ihr Kapital aus diesen Ländern wieder ab und transferieren es in vermeintlich sichere Märkte, in denen sie das Verlustrisiko als gering einschätzen.
Wenn das globale Risiko steigt, vergrößert sich somit der Unterschied in den Wechselkursrenditen. Auf diese Weise sind die Wechselkurse afrikanischer Währungen besonders stark mit dem globalen Risiko korreliert.
Die Folgen dieser Zusammenhänge bekam Südafrika zu spüren, wie Verdelhan beschreibt. Während des Ausverkaufs der Schwellenmarkt-Währungen im Jahr 2018 war die Zinsdifferenz Südafrikas zu den USA eigentlich positiv. Doch gleichzeitig war die globale Risikoprämie so hoch, dass Südafrikas Risikoprämie den Zinsunterschied mehr als kompensierte und die Anleger ihr Geld aus dem Rand abzogen.
Wie sehr die Dollar-Dominanz die Schwellenländer belastet, haben die Ökonomen Maurice Obstfeld und Haonan Zhou untersucht. Demnach führt eine Dollar-Aufwertung von zehn Prozent in den Schwellenländern innerhalb eines Jahres zu einer Verminderung ihrer Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent. In entwickelten Ländern ist dieser Effekt deutlich geringer: Nach einem Quartal beträgt der Rückgang 0,6 Prozent, und auch dieser ist nach einem Jahr verschwunden.
Die Angst vor Wechselkursschwankungen und eine mangelnde akkommodierende Geldpolitik verschärft Obstfeld und Zhou zufolge einen Rückgang der Investitionen in den Schwellenländern.
Eine große Rolle spielt in Schwellenländern der Einkommenskompressionskanal: Geringere Einkommen führen zu einem Rückgang des Kaufs importierter Artikel. Da aber lokales Angebot in Afrika den Rückgang von Importen oft nicht kompensieren kann, ist eine höhere Teuerungsrate die Folge. In Südafrika lag die Inflation im ersten Quartal 2024 bei 5,4 Prozent. Der Wert erscheint im afrikanischen Vergleich nicht besonders hoch. Er liegt jedoch klar über der US-Inflation von 3,8 Prozent im März 2024. Für den Kontinent sieht die Agence Française de Développement zwar einen Trend zur Disinflation, beziffert die Inflation im Jahr 2023 jedoch auf mehr als 20 Prozent.
Somit würde ein reiner Schuldenschnitt in Afrika zu kurz greifen. Ein Schuldenerlass würde nur die Länder mit hohen Schulden entlasten und die anderen nicht. Dabei leidet die gesamte afrikanische Wirtschaft unter der anhaltenden Dollar-Stärke.
Die Ursache für die Abwertung der afrikanischen Währungen ist im Wesentlichen ein Anstieg der globalen Risikoprämien. An dieser Stelle muss auch eine tiefgreifende Reform der globalen Finanzarchitektur ansetzen. Es tun somit Mechanismen not, die die Risikowahrnehmung Afrikas positiv beeinflussen. Eine echte Lösung der Schuldenproblematik erfordert deshalb Instrumente, die Afrika weniger den Schwankungen der globalen Risikoneigung aussetzen.
Mehr als 23.000 Tonnen kostenloser Dünger und 25.000 Tonnen Weizen des russischen Unternehmens Uralchem sind kürzlich in Simbabwe eingetroffen. Bei den Düngemitteln handelt es sich um Kali und NPK-Dünger, wobei N für Stickstoff steht, P für Phosphat und K für Kalium. Dies sei die fünfte humanitäre Lieferung von Uralchem zur Unterstützung der afrikanischen Landwirtschaft und zur Linderung der Auswirkungen der globalen Nahrungsmittelkrise gewesen, heißt es in einer Mitteilung des russischen Unternehmens. Die Lieferung sei am Hafen Beira in Mosambik per Schiff angekommen und anschließend auf Lastwagen nach Simbabwe transportiert worden.
Die Nachricht wäre nicht groß der Rede wert, hätte die Europäische Union nicht zuvor in europäischen Häfen mehr als 100.000 Tonnen Düngemittel von Uralchem zurückgehalten. Dahinter stand der Verdacht, dass die russische Regierung mit dieser humanitären Geste Verbündete für sich zu gewinnen versucht oder sie als diplomatisches Druckmittel einsetzt. Erst nach Gesprächen mit den Entwicklungspartnern stimmte die EU der Freigabe von zunächst 134.000 Tonnen zu. Insofern sind diese Lieferungen von Düngemittel ein großes Politikum, das nicht nur die Beziehungen zwischen der EU und Russland betrifft, sondern auch die der EU und Regierungen in Afrika.
“Simbabwe und die Russische Föderation sind weiterhin den abscheulichen und illegalen Sanktionen der westlichen Hegemonialmächte ausgesetzt“, sagte der Präsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa. “Während der 23 Jahre andauernden Sanktionen gegen Simbabwe war die Russische Föderation ein wahrer, vertrauenswürdiger und verlässlicher Verbündeter der Menschen in diesem Land.”
Die Beziehungen zwischen den westlichen Ländern und der aktuellen Regierung von Simbabwe sind zudem durch Reise- und Finanzsanktionen belastet, die der Westen Anfang der 2000er-Jahre gegen Führungspersonen des Landes und angeschlossener Unternehmen wegen angeblicher Wahlfälschung und Menschenrechtsverletzungen verhängt hatte.
Die USA haben zwar die Sanktionen gegen die meisten Simbabwer vor kurzem aufgehoben. Doch einige hochrangige Personen – darunter auch Staatspräsident Mnangagwa – stehen weiterhin auf der Sanktionsliste.
“EU-Sanktionen sind sorgfältig konzipiert, um unbeabsichtigte Folgen für die Ernährungssicherheit von Drittländern auf der ganzen Welt zu vermeiden”, weist eine Sprecherin der EU-Kommission die Anschuldigungen zurück. “Die EU-Sanktionen gegen Russland zielen in keiner Weise auf den Handel mit Agrar- und Nahrungsmittelprodukten, einschließlich Getreide und Düngemitteln, zwischen Russland und Drittländern ab.”
Wenn Drittländer russische Düngemittel kaufen wollten, gäbe es keine EU-Sanktionen, die dies verbieten würden. Im Gegenteil habe sich die EU aktiv dafür eingesetzt, den globalen Strom von Agrar- und Nahrungsmittelprodukten aufrechtzuerhalten, beispielsweise durch die Einführung sehr gezielter Ausnahmen von Verboten in den Russland-Sanktionen. “In ihrem 9. Sanktionspaket vom Dezember 2022, das noch heute gültig ist, führte die EU eine Ausnahmeregelung ein, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Lebensmittel- und Düngemitteltransaktionen mit sanktionierten Personen zu genehmigen, die vor ihrer Aufnahme in die Liste eine wichtige Rolle im internationalen Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten spielten”, sagte die Kommissionssprecherin weiter.
Die diplomatische Lage wird noch dadurch verwickelter, dass Russland diese letzte Lieferung mit Unterstützung des Welternährungsprogramms WFP der Vereinten Nationen durchführte. Das WFP hatte einen Massengutfrachter für den Transport des Düngemittels gechartert, während die Uralchem-Gruppe die Seefracht und andere Lieferkosten übernahm, so wie es das Unternehmen bei früheren gemeinsamen Lieferungen schon getan hatte.
Uralchem sei “erfreut, dass die humanitäre Lieferung Simbabwe erreicht, wo die Bauern vor Ort bald unsere Düngemittel nutzen und reiche Ernten anbauen können”, wird der CEO von Uralchem, Dmitrij Konjajew, in einer Mitteilung zitiert. Bis heute hat der Konzern besagte 134.000 Tonnen Düngemittel kostenlos auf den afrikanischen Kontinent geschickt. In Zusammenarbeit mit dem WFP wurden mehr als 111.000 Tonnen von europäischen Häfen und Lagerhäusern nach Malawi, Nigeria, Kenia und Simbabwe verschifft.
Uralchem ist einer der größten Hersteller von Stickstoffdüngern der Welt. Der Konzern hatte sich verpflichtet, rund 300.000 Tonnen Düngemittel zu spenden, um die durch den Konflikt in der Region verursachte weltweite Nahrungsmittelkrise zu lindern und Ernteausfälle in von Hungersnot betroffenen Ländern zu verhindern.
Der Dünger saß lange in europäischen Häfen fest, nachdem die EU im März 2022 Sanktionen gegen den damaligen Vorsitzenden der Uralchem Group, Dmitrij Masepin, verhängt hatte. Der russisch-belarussische Oligarch, der zuvor 100 Prozent an dem Unternehmen hielt, veräußerte daraufhin 52 Prozent der Anteile und trat als Geschäftsführer zurück. Masepins Einspruch gegen die Sanktionen hatte im November ein EU-Gericht abgewiesen.
“Obwohl Lebensmittel und Düngemittel offiziell von den gegen Russland verhängten internationalen Sanktionen ausgenommen sind, wurden Anfang 2022 mehr als 260.000 Tonnen Düngemittel der Uralchem Group in der EU im Wesentlichen blockiert”, sagte der Sprecher von Uralchem, Emin Bayramov. Die humanitären Initiativen der Uralchem Group lägen “jenseits der Politik”.
“Als wichtiger globaler Produzent und Exporteur von Mineraldüngern und als Unternehmen mit der kühnen Mission, zur Beseitigung des Hungers beizutragen, tut die Uralchem Group alles in ihrer Macht Stehende, um eine stabile Nahrungsmittelversorgung in den Teilen der Welt zu sichern, die mit Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen haben”, sagte er.
Uralchem erklärte, seine humanitäre Initiative sei nicht von politischen Motiven beeinflusst. Als weltweiter Anbieter von Mineraldüngern sei das Unternehmen bestrebt, die Ernährungsunsicherheit zu lindern und eine stabile Lebensmittelversorgung in gefährdeten Regionen zu gewährleisten.
Die simbabwische Regierung hatte einen nationalen Notstand ausgerufen, nachdem die anhaltende Dürre im südlichen Afrika rund die Hälfte der Maisernte vernichtet hatte. Präsident Mnangagwa erklärte, die Spende werde dazu beitragen, die Auswirkungen der Dürre zu lindern. Die simbabwische Regierung bezeichnete die Lieferung als Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden Ländern und als Erfüllung eines Versprechens des russischen Präsidenten Putin. Dieser hatte im Juli 2023 afrikanischen Staats- und Regierungschefs Zehntausende Tonnen Getreide versprochen.
Auf dem Russland-Afrika-Gipfel im Juli 2023 in St. Petersburg hatte Putin angekündigt, Russland sei bereit, die ukrainischen Getreideexporte nach Afrika sowohl auf kommerzieller als auch auf Hilfsbasis zu ersetzen. So werde Moskau seine entscheidende Rolle bei der weltweiten Ernährungssicherheit erfüllen.
Bei westlichen Politikern scheint der Sudan nach der Ukraine und Israel einen drittrangigen Platz einzunehmen. Sie setzen sich unbestritten für humanitäre Hilfe ein. Doch von der Geberkonferenz in Paris Mitte April ging nicht der notwendige Nachdruck für eine politische Lösung aus.
Am 15. April ging der Bürgerkrieg im Sudan in sein zweites Jahr. Schon jetzt hat er eine noch nie dagewesene politische und humanitäre Krise ausgelöst. Aus einem UN-Bericht geht hervor, dass 18 Millionen der 49,7 Millionen Einwohner des Sudan “akut von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.” “Der Konflikt hat eine der größten Vertreibungskrisen der Welt ausgelöst, bei der fast elf Millionen Menschen vertrieben wurden”, heißt es im Bericht weiter. Doch diese Krise hat, so zynisch es klingen mag, auch ihre Nutznießer.
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Hamdan Dagalo, dem Chef einer paramilitärischen Truppe – den Rapid Support Forces (RSF) – haben den Konflikt im April 2023 ausgelöst. Dagalo, der auch unter seinem Spitznamen “Hemedti” bekannt ist, hatte sich geweigert, die paramilitärische Truppe in die sudanesische Armee zu integrieren. “Es ist unklar, wer den ersten Schuss abgefeuert hat, aber was folgte, war eine unbestreitbare Katastrophe für das ganze Land”, schrieb die Crisis Group in ihrem Bericht vom 15. April 2024.
Beide Konfliktparteien werden beschuldigt, den Zugang zu humanitären Hilfsaktionen zu behindern. Die RSF verlange “himmelhohe Gebühren von den Hilfstransportern an den Kontrollpunkten oder stehle ihre Ladung, während die Armee versuche, die Hilfe in den von der RSF gehaltenen Gebieten zu blockieren”, heißt es im Bericht der Crisis Group.
Vor dem Hintergrund des Jahrestages haben sich die Länder Deutschland, Frankreich, die USA und die EU auf einer Geberkonferenz am 15. April 2024 in Paris verpflichtet, humanitäre Hilfe von mehr als 840 Millionen Euro zu spenden.
Das Norwegische Rettungskomitee NRC erklärte, die Zusage helfe “den Opfern des brutalen, vernachlässigten Konflikts im Sudan”. Auch andere Hilfsorganisationen begrüßten diese Zusage. Doch zugleich fordern sie mehr Anstrengungen, um die für den Sudan und seine Nachbarländer benötigten vier Milliarden Dollar zu erreichen.
So sehr humanitäre Hilfe nottut, so sehr stellt der Bürgerkrieg die internationale Staatengemeinschaft vor eine schwierige Entscheidung. Es ist unbestritten, wie sehr die Menschen auf Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterkünfte und sauberes Wasser angewiesen sind. Doch es fehlen die politischen Rahmenbedingungen, die Hilfe ermöglicht. Das birgt die Gefahr weiterer humanitärer Krisen – es sei denn, die westlichen Mächte hören auf, “Bedenken zu äußern“, und fangen an, politischen Lösungen die notwendige Priorität einzuräumen.
Jihad Mashamoun, ein sudanesischer Politikanalyst und ehrenamtlicher Forschungsbeauftragter am Institut für arabische und islamische Studien an der Universität Exeter, hat Verständnis für diese Bedenken. “Aber es ist eine Sache, etwas zu versprechen, und eine andere, es in die Tat umzusetzen”, sagte Jihad zu Table.Briefings.
Die Crisis Group bemängelt, dass “die USA, die UN und die Afrikanische Union ihre Diplomatie durch die Ernennung neuer Gesandter wiederbelebt haben, es den gemeinsamen Bemühungen zur Förderung des Friedens aber immer noch an Kohärenz und Dringlichkeit fehlt”. Daher müssten diejenigen, die Einfluss haben, “zusammenarbeiten, um die beiden Seiten zur Beendigung des Krieges zu drängen”.
Ende Februar ernannte das US-Außenministerium Tom Perriello zum Sondergesandten für den Sudan. Jihad bezeichnet diese Berufung als “zu spät”: Die Beauftragten, die das Außenministerium vor ihm ernannt habe, seien nicht in der Lage gewesen, viel zu tun. “Das US-Außenministerium hat keinen großen Fokus auf den Sudan“, lautet Jihads Urteil.
Es wird umso schwieriger, den Krieg zu beenden, je länger es dauert, eine politische Lösung zu finden, da der Krieg bereits ethnische und religiöse Formen angenommen habe, befürchtet die Crisis Group.
Eine politische Lösung wird auch durch die diplomatische Lage in der Region erschwert. Der Iran (der beschuldigt wird, al-Burhan mit Drohnen zu versorgen), Ägypten und Eritrea stehen angeblich auf der Seite der sudanesischen Armee, während die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Libyen und Äthiopien ihre Hand versteckt nach Hemedti ausstrecken.
Angeblich unterstützen die VAE Hemedti über den Tschad und Äthiopien, berichtet Jihad. Er wiederum beschuldigt die USA, “diese regionalen Verbündeten (zum Beispiel die VAE, Anm. der Redaktion) für Faktoren zu halten, die zur Stabilität in der Region beitragen könnten. “Leider halten diese Verbündeten die Stabilität nicht auf diese Weise aufrecht”, kritisiert Jihad. “Sie verursachen sogar noch mehr Instabilität.”
Ägypten stritt mit Äthiopien über den Bau des Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) am Blauen Nil, während Eritrea (dessen Regierung “besorgt darüber ist, dass die RSF weiter nach Osten in Richtung ihrer Grenzen vordringt”) und Äthiopien über Grenzfragen und den Zugang zum Roten Meer aneinandergeraten sind.
“Diese ausländischen Verstrickungen bergen das Potenzial für eine erhebliche Verschärfung der Gewalt, je weiter sich der Krieg und seine Auswirkungen über die Grenzen des Sudan hinaus ausbreiten, ein Prozess, der bereits in vollem Gange ist”, stellte die Crisis Group fest.
Jihad stimmt auch zu, dass diese Schwierigkeiten “Auswirkungen auf die Sicherheit des Sudan und des Roten Meeres haben”. Ein Grund mehr, dass es der Westen nicht bei Geberkonferenzen für die Verteilung humanitärer Hilfe belässt, sondern aktiv auf eine politische Lösung drängt.
Beim G7-Außenministertreffen auf der italienischen Ferieninsel Capri vergangene Woche nahm Afrika neben einer Deeskalation in Nahen Osten und weiterer Unterstützung der Ukraine eine zentrale Rolle ein. Besonders die Entwicklungen in Libyen, der Sahelzone, am Horn von Afrika, Somalia, Äthiopien, Sudan und der DR Kongo fanden Erwähnung in der Abschlusserklärung zu globalen Herausforderungen und Partnerschaften.
Die Außenminister kündigten an, die Partnerschaft mit afrikanischen Ländern und regionalen Organisationen wie der Afrikanischen Union (AU) “weiter zu vertiefen”. Hierzu wird die Aufnahme der AU als ständiges Mitglied der G20 begrüßt und die Unterstützung für den G20-Pakt mit Afrika bekräftigt. Die G7-Afrika-Partnerschaft orientiere sich an den Zielen der AU-Agenda 2063, der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Abkommen.
Besorgt zeigten sich die Außenminister über die Folgen des Krieges in der Ukraine und die “Nutzung von Nahrungsmitteln und Energieressourcen als Waffe”. Dies habe Afrika besonders getroffen. In Klimafragen bekräftigen die Außenminister die starke Partnerschaft für einen “gerechten, grünen Übergang zu Netto-Null-Emissionen. Dies sei Kern einer nachhaltigen Entwicklung” im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Die Schuldenanfälligkeit afrikanischer Länder wurde als “große Herausforderung” anerkannt. Sie erfordere eine Koordinierung zwischen offiziellen bilateralen und privaten Gläubigern, wobei die multilateralen Entwicklungsbanken weiterhin “eine Schlüsselrolle bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch mehr Finanzierung, politische Beratung und technische Hilfe” spielen sollen. Besorgt zeigten sich die Minister über die “Aktivitäten der vom Kreml unterstützten Wagner-Gruppe und anderer aufstrebender, von Russland unterstützter Kräfte”. Vor allem in Nordafrika, Zentralafrika und der Sahelzone hätten sie destabilisierende Auswirkungen.
Besonders die Verschlechterung der Sicherheitslage in der Sahelzone sei “sehr besorgniserregend”. Sie gehe einher mit “Rückschritten bei den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit”. Auch sei Ostafrika, darunter Somalia, Äthiopien, Somalia und der Sudan, von Konflikten, Armut, bewaffneter Gewalt und Nahrungsunsicherheit geprägt. Letztere werde durch extreme Wettersituationen verschärft. Die G7-Außenminister “verurteilen auf Schärfste” die Wiederaufnahmen der Angriffe der M23-Rebellen im Osten der DR Kongo und zeigten sich besorgt über ausländische militärische Unterstützung. as
Die Volkswagen Group Africa hat angekündigt, umgerechnet knapp 200 Millionen Euro in sein Montagewerk in Kariega in der Eastern Cape Provinz zu investieren. Die Investitionen soll für die Entwicklung und von 2027 an Montage eines neuen SUVs verwendet werden. Bisher baute Volkswagen mit dem Polo und Polo Vivo zwei erfolgreiche Modelle in Südafrika. Der neue SUV soll auf der Polo-Plattform basieren und wird mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor ausgestattet werden.
Obwohl die meisten globalen Fahrzeugmärkte auf Elektrofahrzeuge umstiegen, “werden afrikanische Märkte wie Südafrika weiter auf absehbare Zeit Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren produzieren und verkaufen,” sagte Martina Biene, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Volkswagen Group Africa. Bisher sei die Kundennachfrage nach Verbrennungsmotoren und die Einführung von E-Fahrzeugen in diesen Märkten langsam.
Der Konzern entwickelt das neue Modell in Zusammenarbeit zwischen Volkswagen Brasilien und Volkswagen Group Africa. Der Plan ist ganz auf die Märkte des Globalen Südens zugeschnitten. “Südafrika ist ein wichtiger Markt für den Volkswagen-Konzern, insbesondere in Hinblick auf unser langfristiges Ziel, unsere Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent zu etablieren, der als letzte Grenze für die Automobilentwicklung gilt”, sagt Biene.
VW liebäugelt somit mehr mit dem afrikanischen als mit dem europäischen Markt, wo Neuwagen mit Verbrennungsmotoren von 2035 an verboten sind. Damit stünde hinter der Entscheidung für das SUV aus Südafrika eine langfristig angelegte Strategie zur Erschließung neuer Märkte. Die “Reise zur Elektrifizierung” in Südafrika werde mit einer Flotte des ID.4-SUV beginnen, die der Konzern von der zweiten Jahreshälfte 2024 an testen würde. as
Die Teilnehmer der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank haben sich auf einige Initiativen geeinigt. Andere wichtige Reformen bleiben jedoch unerledigt. Weltbankpräsident Ajay Banga versprach auf der Tagung vergangene Woche in Washington D.C. unter anderem, die Projektgenehmigungen zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Die Weltbank hat außerdem einen Plan angekündigt, der bis 2030 den Zugang zu erschwinglicher Elektrizität für 250 Millionen Menschen in ganz Afrika ermöglichen soll. In Partnerschaft mit der Afrikanischen Entwicklungsbank sollen weitere 50 Millionen Menschen mit Strom versorgt werden. Die Bank will auch die Zahl der Menschen verdoppeln, die sie mit ihren Gesundheitsprogrammen erreicht. Bis 2030 sollen erschwingliche Gesundheitsdienste für 1,5 Milliarden Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereitgestellt werden. Beide Initiativen sind jedoch vom Engagement der Geber abhängig.
Mittel von etwa elf Milliarden US-Dollar wurden für neue Instrumente wie Hybridkapital und Garantien zugesagt. Die Bank geht davon aus, dass diese Summe in den nächsten zehn Jahren zu einer Aufstockung der Kreditvergabe um 70 Milliarden Dollar führen kann. Was die seit langem erwartete Kapitalerhöhung für die Bank angeht, sind allerdings keine Fortschritte zu verzeichnen.
Viele Beobachter fordern weitere Reformen – vor allem mit Blick auf die Verschuldung vieler einkommensschwacher Länder. Besonders die Länder des Globalen Südens hatten zuletzt auf eine neue globale Finanzarchitektur gedrängt. Schon auf dem Pariser Klimafinanzgipfel im Juni 2023 hatten Vertreter afrikanischer Staaten mehr Mitspracherecht gefordert. Dabei geht es um Themen wie Umschuldung, Klimafinanzierung und grüne Investitionen. ajs
Der Weltmarktpreis für Kakao hat ein Rekordniveau erreicht und liegt nun erstmals bei mehr als 10.000 Dollar pro Tonne. Der S&P GSCI Cocoa Index ist allein in diesem Jahr schon um 173 Prozent in die Höhe gegangen, in den vergangenen fünf Jahren um 383 Prozent. Der Preisanstieg ist auf die erwartete Verknappung von Kakaobohnen angesichts von Nutzpflanzenkrankheiten und extremen Wetterbedingungen in Westafrika zurückzuführen. In Erwartung des vierten schlechten Jahres in Folge haben die Schokoladenhersteller die Preise für die Verbraucher bereits erhöht.
Elfenbeinküste und Ghana sind die weltweit größten Kakaoproduzenten und machen zusammen etwa 60 Prozent des Weltmarktes aus. Zählt man noch Kamerun und Nigeria hinzu, produziert Westafrika mehr als Dreiviertel des globalen Kakaoangebots. Die Region hat jedoch aufgrund von Dürren, Bränden und anderen durch den Klimawandel bedingten Wetterphänomenen drastische Ertragseinbußen zu verzeichnen.
Darunter leiden vor allem die Bauern, denn die Probleme werden durch jahrzehntelange Unterinvestitionen in dem Sektor verschärft. Seit Jahren wird ein Großteil des Rohkakaos exportiert, ohne dass die Bohnen lokal verarbeitet würden. Nach Angaben des BMZ erhalten Hersteller und Händler für jeden Euro, der für eine Tafel Schokolade bezahlt wird, etwa 80 Cent, während die Kakaobauern nur rund sieben Cent erhalten.
Laut Internationaler Kakao-Organisation (ICCO) ist die in ivorischen und ghanaischen Häfen umgeschlagene Kakaomenge seit Beginn der Saison um 28 beziehungsweise 35 Prozent zurückgegangen. Die ICCO rechnet mit einem Defizit von 374.000 Tonnen in dieser Saison und geht davon aus, dass die Kakaobestände bis zum Ende der Saison auf den niedrigsten Stand seit 45 Jahren fallen werden.
Der Rückgang der Produktion wirkt sich auch auf die ohnehin geringe lokale Verarbeitung aus. Zwei der größten Verarbeitungsbetriebe in Afrika, die in Ghana und Elfenbeinküste angesiedelt sind, haben die Verarbeitung entweder eingestellt oder zurückgefahren, weil sie die Bohnen nicht mehr bezahlen können. Viele Bauern suchen inzwischen nach alternativen Einnahmequellen, etwa durch den Verkauf ihres Landes an Bergbauunternehmen.
Die kritische Lage auf dem Kakaomarkt war auch Thema auf der 5. Weltkakaokonferenz in Brüssel in der vergangenen Woche. Die NGO Oxfam veröffentlichte anlässlich der Konferenz einen Bericht. Darin machen die Autoren die großen Schokoladenproduzenten für die gegenwärtige Situation verantwortlich: “Die Explosion des Kakaopreises hätte verhindert werden können, wenn die Konzerne den Bauern einen fairen Preis gezahlt und ihnen geholfen hätten, ihre Farmen widerstandsfähiger gegen extreme Wetterbedingungen zu machen”, sagte Bart Van Biesen, politischer Berater bei Oxfam.
Weltmarktführer in der Kakaoverarbeitung ist der schweizerische Konzern Barry Callebaut mit einem Weltmarktanteil von 30 Prozent, gefolgt vom amerikanischen Verarbeiter Cargill, dem asiatischen Konzern Olam in Singapur, dem US-Marktführer Blommer Chocolate Company und dem chinesischen Unternehmen Guan Chong. ajs
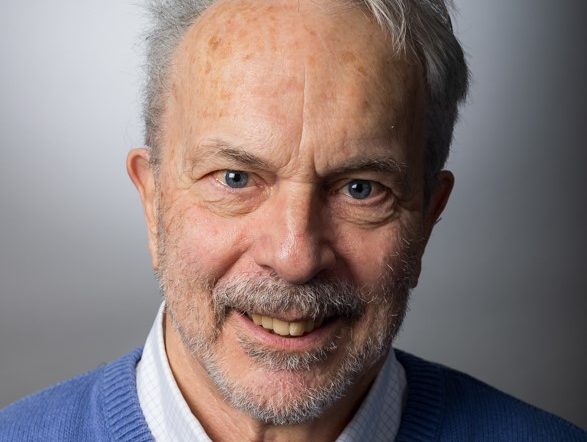
Das Wahlergebnis im November 2019 schwächte erstmals die Swapo als einstige Befreiungsbewegung an der Macht. Mit 65,5 Prozent und 63 der 96 Mandate büßte sie die Zwei-Drittel-Mehrheit ein. Fünf Jahre zuvor hatte sie mit 80,1 Prozent ihr bestes Ergebnis. Dank eines uneingeschränkt proportionalen Wahlrechts ergatterten insgesamt elf Parteien mindestens einen Sitz. Die Popular Democratic Movement (PDM) wurde mit 16 Abgeordneten stärkste Oppositionspartei.
Dem wiedergewählten Staats- und Parteipräsidenten Hage Geingob erging es noch schlimmer: Das Rekordergebnis 2019 von 86,7 Prozent schrumpfte auf 56,3 Prozent. Dies war dem Swapo-Dissidenten Panduleni Itula, geschuldet, der ihm als unabhängiger Kandidat 29,4 Prozent der Stimmen abknöpfte. Mit den Regional- und Kommunalwahlen 2020 wurde die Swapo-Dominanz außerhalb der nördlichen Bastionen beendet. Seither regieren Oppositionsparteien mehrere Regionen und nahezu alle städtischen Kommunen. Die von Itula gegründete Independent Patriots for Change (IPC) setzte der Swapo am meisten zu.
So wundert es nicht, dass die politische Stimmung angespannter ist als je zuvor seit der Unabhängigkeit 1990. Die Zeichen mehren sich, dass die heiße Phase des Wahlkampfs schon begonnen hat. Mit dem unerwarteten Tod Hage Geingobs am 4. Februar übernahm dessen Stellvertreter Nangolo Mbumba das Amt in einem nahtlosen Übergang, der die Rechtsstaatlichkeit des Landes eindrucksvoll unterstrich. Er wird bis Ende der Legislaturperiode am 21. März 2025 als viertes Staatsoberhaupt amtieren, während Netumbo Nandi-Ndaitwah als designierte Swapo-Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen seine Stellvertreterin wurde. Sie sieht sich von Itula wie die Swapo von der IPC herausgefordert, wenn es zum Urnengang kommt.
Dass dies zu Empfindsamkeiten führt und deshalb auch diplomatisches Geschick erfordert, wurde in der ersten April-Hälfte deutlich: Die Deutsche Botschaft präsentierte namens Botschafter Thorsten Hutter auf X ein Foto der Botschafter der EU-Länder an gedecktem Tisch. Die Unterschrift erklärte, es sei eine Ehre gewesen, sich mit dem IPC-Parteipräsidenten über aktuelle Angelegenheiten auszutauschen.
Eine IPC-Presseerklärung ergänzte, es seien die kommenden Wahlen und Klagen unter Veteranen des Befreiungskampfes diskutiert worden. Damit, so wurde behauptet, habe Swapos Hegemonie einen schweren Rückschlag erlitten. Die Windhoek Times als informelles Parteiorgan stilisierte das Gespräch auf X zu einer Diskussion der EU-Namibia Beziehungen und fügte hinzu, Itula würde weithin als nächster Präsident Namibias gelten.
Die Swapo-Führung reagierte entsprechend überzogen. So bestellte der Außenminister die Diplomaten ein. Er belehrte sie, dass die Wiener Konvention eine Einmischung in Regierungsangelegenheiten untersage. Netumbo Nandi-Ndaitwah witterte anlässlich einer Sitzung des Swapo-Zentralkomitees Spuren eines regime change. Sie wies darauf hin, dass die Rolle des deutschen Botschafters angesichts der bilateralen Verhandlungen zum Völkermord besonders ärgerlich sei. Der Führer der Swapo-Jugendliga forderte gar, die Diplomaten des Landes zu verweisen.
Der Sturm im Wasserglas veranlasste die EU-Vertretung zur Erklärung, dass keine Regierungsangelegenheiten behandelt worden seien. Vielleicht hätte mehr Fingerspitzengefühl bei der Bekanntmachung des Gesprächs (so diese im Sinne des diplomatischen Alltagsgeschäfts überhaupt nötig gewesen wäre) das Theater verhindert.
Ein weiteres Bemühen um Schadensbegrenzung folgte prompt: Am 15. April präsentierte Botschafter Hutter auf X ein Foto, das ihn händeschüttelnd mit Namibias Außenminister zeigt. Er erklärte, es hätte ein fruchtbares und freundliches Treffen zur Stärkung der Partnerschaft beider Länder gegeben. Während der Botschafter beim Blick in die Kamera ein Lächeln anzudeuten schien, wirkte der Außenminister deutlich reservierter.
Henning Melber ist Politikwissenschaftler, Entwicklungssoziologe und Afrikawissenschaftler. Als Sohn deutscher Einwanderer kam er 1967 als Jugendlicher nach Namibia. 1974 trat er der Befreiungsbewegung Swapo bei. Heute forscht er am Nordischen Afrika-Institut in Uppsala (Schweden). Zur Jahresmitte erscheint sein Buch “The Long Shadow of German Colonialism” im Londoner Verlag Hurst.
Washington Post: Verbleib in Niger macht US-Truppen verwundbar, beklagt ein Whistleblower. Ein ranghoher Angehöriger der US-Luftwaffe, der in Niger stationiert ist, schlägt Alarm wegen der langen Weigerung der Biden-Regierung, der Aufforderung der Militärjunta zum Abzug Folge zu leisten. Der Whistleblower beschuldigt die US-Botschafterin und die Verteidigungsattachée, die Sicherheit der etwa 1.100 amerikanischen Soldaten zu gefährden, die in Niger “als Geiseln gehalten” würden. Die Botschaft habe “absichtlich Geheimdienstinformationen zurückgehalten,” um die “Fassade guter bilateraler Beziehungen” aufrechtzuerhalten.
The Namibian: Wasserstoff-Stipendiaten beklagen Zahlungsverzögerungen. Die namibischen Stipendiaten eines von der Bundesregierung unterstützten Wasserstoff-Stipendiums haben ihre Frustration über Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer vierteljährlichen Stipendien zum Ausdruck gebracht. Das Programm Youth for Green Hydrogen führt das Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management (Sasscal) mit Unterstützung der deutschen und namibischen Regierung durch. Einige Studenten haben aufgrund der verspäteten Zahlungen Schwierigkeiten, ihre Lebenshaltungskosten zu decken.
TVC News: Kenianische Behörden beginnen mit Untersuchung des Helikopter-Absturzes. Die kenianische Regierung hat ein Team entsandt, um den Hubschrauberabsturz zu untersuchen, bei dem der oberste Militär General Francis Ogolla und neun weitere Menschen ums Leben kamen. Der Absturz ereignete sich am Donnerstag, 18. April, kurz nachdem der Hubschrauber in Chesegon abhob, wo Ogolla und seine Begleiter eine Schule besuchten.
AP: US-Truppen werden aus Niger abziehen. Die Vereinigten Staaten werden mit den Plänen zum Abzug ihrer Truppen aus Niger beginnen, teilten US-Beamte am Samstag mit. Noch gibt es keinen offiziellen Zeitplan für den Rückzug. Der Versuch seitens der USA, das Militärabkommen mit Niger zu überarbeiten, um den Verbleib im Land zu ermöglichen, ist offenbar gescheitert. Experten zufolge ist dies ein Schlag für Washington und seine Verbündeten, was die Durchführung von Sicherheitsoperationen in der Sahelzone betrifft.
Financial Times: Tony Blair: Westliche Staaten müssen mit Diktaturen im Sahel zusammenarbeiten. Ein aktueller Bericht des Tony Blair Institute for Global Change fordert einen “neuen Pakt” zwischen den Sahelstaaten und der internationalen Gemeinschaft. Der ehemalige britische Premierminister warnt, westliche Versuche, die Militärregime durch Sanktionen und den Entzug von Hilfsgeldern zu isolieren, liefen Gefahr, dass diese sich Moskau und anderen Akteuren weiter annäherten. Eine mögliche Lösung sei die Intensivierung der Bemühungen um die Elektrifizierung der Region, in der vier von fünf Familien keinen Zugang zum Stromnetz haben.
African Business: Europäische Visumsbestimmungen sind für Afrikaner viel strenger. Rund 30 Prozent aller afrikanischen Visumanträge für den Schengenraum werden abgewiesen, wie aus dem Henley & Partners Africa Wealth Report 2024 hervorgeht. Damit liegt die Ablehnungsrate für Afrikaner zehn Prozent über dem globalen Durchschnitt. Dem Bericht zufolge hängt die Ablehnungsrate auch mit der Rückkehr und Rückübernahme illegaler Migranten zusammen. Es werden afrikanische Länder bestraft, deren Bürger sich illegal in Europa aufhalten, sowie diejenigen mit der niedrigsten Rückkehr- und Rückübernahmequote.
Bloomberg: Südafrikas wichtigste Wahl seit der Apartheid. Wenn der regierende ANC gezwungen wird, die Macht zu teilen, könnte das zunächst schmerzhafte Folgen haben. Grundsätzlich sei das aber notwendig und gut, schreibt Bloomberg News-Chefredakteur John Micklethwait. Angesichts der Bemühungen Chinas und Russlands, Einfluss auf dem Kontinent zu gewinnen, habe der Westen ein großes Interesse daran, in Südafrika den politischen Wettbewerb zu stärken und die Demokratie zu festigen.
Al Jazeera: Versicherer sollten EACOP-Pipeline meiden. Noch ist die Finanzierung der East African Crude Oil Pipeline nicht gesichert. Die 1.443 Kilometer lange Leitung soll von den Ölfeldern in Westuganda zum tansanischen Hafen von Tanga verlaufen. Zivilgesellschaftliche Gruppen in Uganda und Tansania fordern mit Verweis auf schwere Klima-, Umwelt- und soziale Risiken, die Pipeline nicht zu bauen. Versicherungsgesellschaften sollten sich weigern, das Projekt zu unterstützen, meinen Myrto Tilianaki und Hellen Huang.
Semafor: Genetisch veränderte Moskitos könnten Malaria ausrotten. Abdoulaye Diabaté forscht am Institut de Recherche en Sciences de la Sante in Burkina Faso und steht an der Spitze der Bemühungen zur Ausrottung von Malaria. In einem Interview erklärt er, wie durch die Veränderung des Erbguts männlicher Moskitos die Verbreitung von Malaria ausgebremst werden kann. Nach ihrer Freisetzung in der Natur verhindern sie die Vermehrung weiblicher Moskitoarten, die Malaria übertragen.
Exportmanager: US-Konzern zieht von Polen nach Marokko. TE Connectivity, ein US-Technologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, hat 140 Mitarbeiter in seinem Werk im Ort Nowa Wieś Lęborska in Pommern entlassen. Nach 22 Jahren werde der Standort nach Marokko verlagert. Auch Werke in Deutschland und Frankreich sollen geschlossen werden, berichtet die Gewerkschaft Solidarność. Der Konzern produziert unter anderem elektronische Steckverbinder und Netzwerktechnik, vor allem für Kunden im Automobilsektor sowie im Bereich Luft- und Raumfahrt.

Der Besuch von Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Burkina Faso vor gut einem Monat war ein besonderer, im Rahmen der zahlreichen Besuche der Ministerin in Westafrika. Es war ein Besuch mit Signalwirkung: Seit den zwei Militärputschen 2022 hatte kein europäischer Minister zuvor das westafrikanische Land besucht.
Die Botschaft der Ministerin: Auch nach dem Zusammenbruch der Demokratie in Mali, Burkina Faso und zuletzt Niger will Deutschland den Kontakt zu den Putschregierungen im Sahel nicht vollends abbrechen und sucht nach Wegen, wie eine Kooperation künftig aussehen könnte. Die große Angst ist, China und Russland stoßen in das Vakuum, das der Westen bei einem vollständigen Rückzug aus der Region hinterlässt. “Wo wir nicht sind, sind sehr schnell andere”, warnte Schulze in einem Interview mit der Deutschen Welle während ihrer Reise.
Der Entwicklungsministerin kommt bei der aktuellen Neuaufstellung der Sahel-Politik der Bundesregierung seit dem Putsch im Niger eine zentrale außenpolitische Rolle zu. Kein anderer deutscher Politiker ist in der Region so präsent wie Schulze. Und die Aufmerksamkeit von Außenministerin Annalena Baerbock wird von den Konflikten in der Ukraine und Gaza gebunden.
In Schulzes Karten spielt, dass sie als amtierende Präsidentin der Sahel-Allianz über größere internationale Geltung verfügt, als ihr allein das Amt der deutschen Entwicklungsministerin zubilligt. In der entwicklungspolitischen Allianz haben sich 18 Länder und internationale Organisationen zusammengeschlossen, um die Länder der Sahel-Zone zu stabilisieren. Neben Deutschland, Frankreich und der EU gehören auch die USA, das UNDP und die Weltbank zu den Mitgliedern. Schulze wurde im vergangenen Juli für ein Jahr zur Präsidentin der Allianz gewählt.
Wie schwer der Neuanfang einer Zusammenarbeit in der Region derzeit trotz alledem ist, zeigt, dass die Putschregierung in Niger, Mali und Burkina Faso aus der Regionalorganisation G5 Sahel ausgetreten sind. Die G5 waren für die Koordination der internationalen EZ zuständig. Dennoch will Schulze das deutsche Engagement im Sahel so gut es geht weiterführen – und sich so auch von Partner Frankreich ein Stück weit unabhängiger werden. Das deutsche Angebot ist jedoch nicht neu: langfristige Kooperationen für ein erträgliches Auskommen, um den Zulauf zu terroristischen Gruppen in der Region zu stoppen und die Sahel-Staaten zu stabilisieren. Das hege Migration ein und nutze im Endeffekt auch Europa und Deutschland, ist Schulze überzeugt.
Schon vor dem Putsch im Niger hatte Schulze auf eine enge Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister Boris Pistorius gesetzt. Im April waren Schulze und Pistorius gemeinsam nach Mali und Niger gereist. Es war die erste gemeinsame Reise eines Verteidigungsministers und einer Entwicklungsministerin überhaupt. Damals hieß es, Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheitspolitik sollen in Niger Hand in Hand gehen.
Knapp ein Jahr später waren Schulze und Pistorius erneut bei einem gemeinsamen Auftritt. Diesmal bei einer Diskussionsrunde der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Den vernetzten Ansatz wollen Schulze und Pistorius trotz der veränderten Lage im Sahel nicht aufgeben. Dennoch bleibt unklar, wie dieser mit den Militärjuntas möglich sein kann. Das neue Credo lautet jedoch: zuhören, präsent bleiben und einen pragmatischen Umgang mit den Juntas pflegen, um auf lange Sicht die Rückkehr zur Demokratie begleiten.
Schnelle und vor allem sichtbare Erfolge erzielt diese Strategie allerdings nicht. Kritiker in Deutschland sind ohnehin überzeugt, dass mit der EZ der Zusammenbruch der Demokratie nicht verhindert wurde und darüber auch künftig die Rückkehr zur Demokratie nicht erreicht werden kann.
Daher wird Schulze innenpolitisch zur Erklärerin. Seit Anfang des Jahres stellt sie sich in Interviews der Kritik entgegen und legt dar, warum die Entwicklungspolitik in einer multipolaren Welt wichtig ist. Dennoch dürfte das Geld künftig noch knapper werden. Nach den schmerzhaften Kürzungen im Budget des BMZ im Rahmen des Haushalts für 2024 drohen in den Verhandlungen über die Etats für 2025 nochmals empfindliche Abstriche. Dabei ist man schon jetzt im BMZ überzeugt, dass ein Grund für das Scheitern des Westens und damit der deutschen EZ daran lag, dass die Mittel zu knapp bemessen waren. David Renke

Es geht um den Jollof-Reis, das wahrscheinlich bekannteste Gericht in Westafrika. Heiß geliebt von Einheimischen, Besuchern und Angehörigen der Diaspora – kein Wunder also, dass jedes Land den Ursprung des Jollof-Reises für sich reklamiert. Das Gericht wird typischerweise mit Fischsteak, Bruchreis, getrocknetem Fisch, Weichtieren und saisonalem Gemüse wie Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch, Chili, Tomaten, Karotten, Auberginen, Weißkohl, Maniok, Süßkartoffeln, Okra und Lorbeerblättern zubereitet, wie die Unesco schreibt.
Die UN-Organisation hat 2021 die Frage nach der Urheberschaft geklärt, als sie das Ceebu Jëen – wie der Jollof-Reis im Senegal auf Wolof heißt – in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufnahm. Darüber, wer genau wann das Ceeb im heutigen Senegal kreiert hat, haben Forscher verschiedene Theorien entwickelt. Bruchreis haben die französischen Kolonialherrscher in Westafrika eingeführt, als Nebenprodukt der Reisproduktion in einem anderen französischen Kolonialgebiet, im damaligen Indochina.
Nie klären lässt sich natürlich die Frage, wo der Jollof-Reis am besten schmeckt. Wer etwa nach Ghana oder Nigeria reist, bekommt bei der Bestellung zumeist die Frage aller Fragen gestellt: Kennen Sie Jollof-Reis? Ach ja? Und wo schmeckt es besser? Vorsicht ist geboten bei der Antwort, oder besser: Kulinarische Diplomatie ist gefragt. Meistens schmeckt’s ja eh am besten, wenn man gerade Hunger hat. Die Jollof-Wars, wie die spielerische Rivalität genannt wird, haben jedenfalls Potenzial für eine epische Dauer.
Regelmäßig finden rund um den Jollof-Reis Festivals statt, etwa in Nigeria oder in den USA. Das Gute am Jollof-Reis ist ja gerade, wie unterschiedlich das Gericht schmecken kann. Am besten also: sich durch jeden Jollof-Reis in Westafrika essen und sich selber eine Meinung bilden. Bon appétit! lcw
