im Senegal wurde gewählt. Obwohl das amtliche Endergebnis noch aussteht, deutet alles auf einen Machtwechsel in dem westafrikanischen Land hin – trotz oder vielleicht gerade wegen der kurzfristigen Wahlverschiebung durch Noch-Präsident Macky Sall, die das Land in eine schwere politische Krise gestürzt hatte. Unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß informiert Sie über den aktuellen Stand.
Andreas Sieren, unser Korrespondent in Johannesburg, hat sich nach dem Südafrika-Besuch des SPD-Parteischefs Lars Klingbeil Anfang März die Neuauflage der Nord-Süd-Politik genauer angeschaut. Er erklärt, wie Klingbeil einerseits die Parallelen zu Willy Brandts visionärer Nord-Süd-Politik der 70er-Jahre sucht, gleichzeitig aber einen modernisierten Ansatz versucht.
Für Wirtschaftsminister Robert Habeck stehen in Afrika Energiepartnerschaften im Mittelpunkt. Dafür ist der Minister am Anfang des Jahres nach Nordafrika gereist, um Wasserstofflieferungen aus Algerien nach Süddeutschland anzubahnen. Unser Autor Felix Wadewitz hat sich kritisch angeschaut, wie sinnvoll diese Initiative tatsächlich ist.
In Ostafrika sorgt eine Initiative der EU für Kritik. Die Union hat mit Ruanda ein MoU über nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor unterzeichnet. Warum das für weitere Spannungen im Verhältnis Ruandas mit dem ohnehin schon belasteten Beziehungen mit dem Nachbarn DR Kongo sorgt, erklärt unser Autor Harrison Mwilima.
Außerdem blicken wir in unseren News darauf, wie die KfW künftig verstärkt privates Kapital in ihr Geschäft einbeziehen will und wie die Union um einen sachlicheren Kurs in der Debatte um Entwicklungspolitik ringt.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Nur Tage zuvor war SPD-Chef Lars Klingbeil von einer fünftägigen Reise aus Afrika zurückgekehrt, wo er Namibia, Südafrika und Ghana besuchte – jetzt die Zusammenarbeit mit dem Kontinent vertiefen. Auf der großen Nord-Süd-Konferenz “Nord-Süd – Neu denken” vergangene Woche im Willy-Brandt-Haus in Berlin hielt der SPD-Chef eine Grundsatzrede, die die Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden neu definiert. Klingbeil skizzierte die Neuausrichtung und plädierte für Dialoge und Kooperation auf Augenhöhe und eine stärkere Einbeziehung des Globalen Südens, vor allem im Kampf gegen die Klimakrise und die Demokratisierung der internationalen Ordnung.
Für Klingbeil ist die westliche Hegemonie schon lange vorbei, auch wenn der Westen noch politisch und wirtschaftlich einflussreich bleiben wird. Denn die wirtschaftlichen Machtverhältnisse in die Welt haben sich geändert, was auch an dem zunehmenden Einfluss der Brics-Staaten, die mehr Mitspracherecht in der Welt einfordern, zu sehen ist.
“Während die EU und die USA 1990 mit zusammen über 44 Prozent der globalen Wirtschaftskraft noch das wirtschaftliche Zentrum der Welt waren, ist der Anteil heute auf knapp ein Drittel gesunken. Tendenz fallend. China hat im gleichen Zeitraum seine Wirtschaftskraft von vier auf 19 Prozent der globalen Wirtschaftskraft fast verfünffacht. Tendenz steigend”, bemerkt Klingbeil. “Fast 60 Prozent der globalen Wirtschaftskraft und Bevölkerung entfällt heute auf Asien. Auch hier die Tendenz steigend. Vom Jahr 2050 an wird zudem ein Viertel der Weltbevölkerung in Afrika leben.” Der SPD-Chef nimmt die neuen Realitäten wahr und zieht die richtigen Schlussfolgerungen. Ob das zu einen Dialog auf Augenhöhe führen wird, bleibt abzuwarten.
Lars Klingbeil sieht Handlungsbedarf und die Notwendigkeit eines Umdenkens im Globalen Norden. Das kann nur ohne moralischen Unterton geschehen, der nach wie vor in Afrika mit Irritation registriert wird. Er hat zur Kenntnis genommen, dass auch in Afrika andere Sichtweisen existieren, sei es zum Ukrainekrieg, dem Israel-Gaza-Konflikt oder auch bei der Verteilung von Impfstoffen während der Covid-Pandemie, die vor allem afrikanische Regierungen als ungerecht empfanden.
In seinem Treffen mit der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor Anfang März erkannte Klingbeil bei Israel und Palästina unterschiedliche historische Perspektiven. Diese würden heutige Wahrnehmungen und Standpunkte prägen. Beide zielten jedoch auf nachhaltigen Frieden und Sicherheit im Nahen Osten ab, was Kern einer gemeinsamen Politik sein sollte.
Der Parteichef würdigte das Vermächtnis von Willy Brandt, der mit der SPD in den 1970er-Jahren “großes Vertrauen” im Globalen Süden aufgebaut und mehr Respekt gegenüber den Entwicklungsländern gefordert hat. Erstaunt zeigte sich Klingbeil, wie sehr sich hochrangige Politiker, die er auf seinen Reisen in der Welt während der vergangenen zwei Jahren in Ländern wie Brasilien, Südafrika oder China getroffen hatte, an ihre Begegnungen und Gespräche mit Brandt wohlwollend erinnern.
“Die Beschlüsse, die Willy Brandt mit seiner achtzehnköpfigen Kommission 1980 und 1983 vorgelegt hat, lesen sich auch aus heutiger Sicht visionär. Sie sind eine Handlungsanleitung für das gemeinsame Überleben in einer globalisierten Welt. Der Bericht forderte etwa eine stärkere Integration der ärmeren Länder in die Weltwirtschaft oder auch Reformen der internationalen Organisationen.”
Viele der Forderungen Brandts würden sich in den heutigen zunehmenden globalen Krisen wie Klimawandel, Flüchtlinge, Armut und Ungleichheit spiegeln und seien bis heute in einer Welt, die unübersichtlicher geworden ist, noch nicht entschieden umgesetzt worden. Denn während Länder des Globalen Nordens Wohlstand, Frieden und Sicherheit erleben konnten, haben sich die Krisen im Globalen Süden fortgesetzt: “Die politischen und wirtschaftlichen Verheißungen des westlichen Entwicklungsmodells haben aus heutiger Sicht für viele Staaten des globalen Südens nicht funktioniert”, stellt Klingbeil nüchtern fest.
Bundeskanzler Olaf Scholz habe bereits aus der “Zeitenwende wichtige Schlüsse gezogen” und Taten folgen lassen, etwa mit der Einladung von Ländern des Globalen Südens zum G7-Gipfel oder der Mitgliedschaft der Afrikanischen Union (AU) bei der G20. Auch sei der Versöhnungsprozess und die Anerkennung der kolonialen Schuld Deutschlands in Ländern wie Namibia sei eine ‘wichtige Grundlage’ der erneuerten Nord-Süd-Politik.
Dass sich die G7-Staaten in Zukunft am Gästetisch des Globalen Südens, etwa bei Brics, finden könnten, ignoriert Klingbeil. Stattdessen sieht er den Versöhnungsprozess und die Anerkennung der kolonialen Schuld Deutschlands in Ländern wie Namibia als “wichtige Grundlage” der neuen Nord-Süd-Politik, auch wenn sich der Eindruck stellt, dass diesen Ländern wirtschaftliche Beziehungen wichtiger sind.
So ist für Klingbeil einer der Eckpfeiler für eine moderne Nord-Süd-Politik der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise, zu der es nur eine “globale Antwort” geben kann. Wie in Deutschland müsse auch auf internationaler Ebene die Verbindung zwischen Klima und Wirtschaft hergestellt werden, ohne die Sozialverträglichkeit für die jeweilige lokale Bevölkerung außer Acht zu lassen. Wichtig sei auch Wertschöpfung vor Ort, das notwendige Wachstum und Jobs bringen und über transparente Lieferketten wirtschaftlich mit dem Globalen Norden verbunden werden soll.
Der zweite Pfeiler bezieht auf die Demokratisierung der internationalen Ordnung, zu der auch eine “bessere afrikanische Repräsentation” im UN-Sicherheitsrat gehört. Wichtig sei die Reform der internationalen Finanzsituation, die unter anderem die Arbeit regionaler Entwicklungsbanken stärken und wichtige Themen wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur sowie eine gemeinsame Lösung der Schuldenkriesen miteinbeziehen. “Damit die Vereinten Nationen als Hüter einer regelbasierten internationalen Ordnung eine Zukunft haben, braucht es Reformen, die die Machtverhältnisse einer multipolaren Welt von heute besser abbilden,” so Lars Klingbeil.
Algerien bereitet den Einstieg in die Produktion von Wasserstoff vor. Doch das Land will nicht – wie es zu erwarten wäre – seine riesigen Gasreserven nutzen, um blauen Wasserstoff zu produzieren. Vielmehr soll grüner Wasserstoff hergestellt werden.
Algerien besitzt riesige Reserven an fossilen Energieträgern. Es ist der größte Gasexporteur Afrikas und besitzt 0,7 Prozent der weltweiten Ölreserven. Darüber hinaus gilt das Potenzial im Solarbereich als sehr groß. Das Land besteht zu 90 Prozent aus Wüste und bietet 3.000 Sonnenstunden jährlich. Das sind ideale Voraussetzungen für die Produktion grünen Wasserstoffs.
Doch bei der Entwicklung von nachhaltiger Energie und der Wasserstoff-Produktion steht Algerien noch ganz am Anfang. Nur ein Prozent der algerischen Energieproduktion ist derzeit nachhaltig, und von diesem einen Prozent entfallen 90 Prozent auf Sonnenenergie.
Um das Projekt “Grüner Wasserstoff” voranzutreiben, ist der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Februar nach Algier gereist. In Anwesenheit von Mohamed Arkab, dem algerischen Energieminister, hat er eine Absichtserklärung unterschrieben. Teil der Vereinbarung ist es, dass Deutschland Algerien 20 Millionen Euro für eine 50-MW-Pilotanlage für grünen Wasserstoff in der Hafenstadt Arzew zahlt. Betreuen soll sie der staatliche Öl-Konzern Sonatrach.
Von 2030 an soll der Wasserstoff durch den sogenannten SoutH2-Korridor fließen. Diese Pipeline führt von Algerien über Tunesien nach Italien, Österreich und schließlich nach Süddeutschland. Ein großer Teil der Pipeline steht bereits und wird bisher für den Gasexport genutzt.
Zu den deutschen Kooperationsunternehmen zählen RWE und der Betreiber von Gas-Fernleitungsnetzen Bayernets GmbH in München. Auch das bayerische Energieministerium ist eingebunden. Im Jahr 2040 sollen zehn Prozent des Wasserstoffs für die EU aus Algerien kommen. Derzeit sind Kosten von vier Milliarden Euro und eine Kapazität von mehr als vier Millionen Tonnen im Jahr geplant.
Politisch unterscheiden sich Algerien und Deutschland sehr. Das lässt sich an zwei der größten Konflikte festmachen: den Kriegen in der Ukraine und in Gaza. Algerien pflegt gute Beziehungen zu Russland. Diese sind in der Sowjetzeit entstanden, als auch Algerien von einem sozialistischen Regime regiert war.
Nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 wurde die Nationale Befreiungsfront FNL zur sozialistischen Einheitspartei. Das ist lange her. Doch Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune hat die enge Verbindung zu Russland, die sein Vorgänger Abdelaziz Bouteflika pflegte, fortgeführt. Vor allem hat Russland keine Ambitionen, sich in die inneren Angelegenheiten Algeriens einzumischen.
Ein Großteil der Ausstattung des algerischen Militärs kommt heute noch aus Russland. Den Staat Israel erkannt Algier nicht an. Die ausschließliche Solidarität mit Palästina ist Teil der Staatsräson. Meinungs- und Religionsfreiheit sind in Algerien eingeschränkt. Mehrere hundert politische Gegner sitzen derzeit im Gefängnis.
Dennoch läuft das Geschäft mit Gas für Algerien mehr als gut. Anfang März fand der siebte GECF (Forum Gas exportierender Länder) in Algier statt. Mit dabei waren Iran, Katar und Libyen. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage aus Europa nach algerischem Erdgas gestiegen, zuletzt auch aus Deutschland. Anfang Februar schloss der Leipziger Gashändler VNG einen Gasliefervertrag mit Sonatrach.
Solange die Nachfrage nach Gas am Weltmarkt vorhanden ist – in Asien und Afrika dürfte sie noch steigen – wird Algerien an der Gaswirtschaft als Grundlage seiner Wirtschaft festhalten. Gleiches gilt aber auch für Wasserstoff. Vergleichbar ist das mit dem Kauf eines Autos: Ein klimabewusster Kunde (Deutschland), der früher einen Verbrenner gekauft hat, kauft sich aktuell lieber ein Elektroauto. Der Anbieter (Algerien) macht dann das maximale Geschäft, wenn er auch das nachhaltigere Auto im Sortiment führt.
Das hat am Ende weniger mit Klimabewusstsein und mehr mit Geschäftssinn zu tun. Genau darin besteht auch eine Chance: Wenn Europa ankündigt, irgendwann kein Gas mehr zu kaufen, sondern nachhaltig produzierten Wasserstoff, dann werden sich auch andere nicht-demokratische Länder darauf einstellen und versuchen, das alternative Produkt zu liefern.
Dennoch: Politisch gesehen wirft eine Kooperation mit einem autoritären Land wie Algerien Fragen nach der Nachhaltigkeit dieser Beziehung auf. Ebenso könnte die enge Verbindung Algiers zu Moskau zum Problem werden.
Das Memorandum of Understanding zwischen der EU und Ruanda über nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor, das die EU-Kommissarin Jutta Urpilainen und Ruandas Außenminister Vincent Biruta am 19. Februar unterzeichnet haben, könnte die Spannungen in der Region weiter erhöhen. In den vergangenen Tagen beispielsweise gingen Kongolesen, die in London leben, auf die Straße. Sie protestierten gegen die Rolle der ruandischen Regierung im Handel mit Rohstoffen.
Das Abkommen zielt unter anderem darauf ab, mit Ruanda bei der Erreichung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Produktion und Verwertung kritischer und strategischer Rohstoffe zusammenzuarbeiten. Doch der Zeitpunkt der Unterzeichnung ist von entscheidender Bedeutung und könnte zu weiteren Spannungen in der Region führen.
Für Ruanda hat die Vereinbarung über kritische Rohstoffe strategische Bedeutung. Das Memorandum of Understanding legt eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU und Ruanda im Bereich kritischer Mineralien fest. Die Regierung in Kigali hat ohnehin die Ambition, ein Land mit grüner Wirtschaft zu werden. Auch will Ruanda die Emission von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 38 Prozent senken.
Kritische Rohstoffe gelten als entscheidend für die europäische Wirtschaft, weil sie für die Produktion einer breiten Palette von Gütern und Anwendungen für den Alltag und moderne Technologien benötigt werden. Ruanda ist einer der Hauptakteure weltweit beim Export kritischer Mineralien wie Tantal, Wolfram und Zinn. Diese haben große Bedeutung in der Herstellung von Alltagsprodukten wie Mobiltelefonen und Autos.
Neben Ruanda hat die EU weitere Abkommen über nachhaltige Rohstoffwertschöpfungsketten mit anderen afrikanischen Ländern unterzeichnet. Am 26. Oktober 2023 kam ein Abkommen mit der DR Kongo und Sambia zustande, mit Namibia am 8. November 2022.
Als die EU das Abkommen mit Ruanda unterzeichnete, stellten kongolesische Staats- und Regierungschefs und NGOs die Legitimität eines solchen Bündnisses infrage. Sie verwiesen auf die Probleme im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit Mineralien aus der DR Kongo und dem Transit durch Ruanda.
Während eines Live-Austauschs mit Reportern des nationalen Fernsehsenders RTNC Ende Februar kritisierte der Präsident der DR Kongo, Felix Tshisekedi, das EU-Ruanda-Abkommen. Die Vorwürfe lauteten: Ruanda plündere die Bodenschätze des Kongo und exportiere Reichtum, über den das Land selbst nicht verfüge. Ruanda fördert im Land Zinn, Tantalum und Tingsten. Nach dem Tourismus ist der Export von Rohstoffen Ruandas wichtigster Wirtschaftsfaktor.
Tshisekedi warf Ruanda außerdem vor, die Rebellengruppe M23 zu unterstützen. Diese verübt weiter im Osten des Kongos regelmäßig Angriffe. Der illegale Verkauf kritischer Mineralien ermögliche es Ruanda, seine Armee aufzurüsten und die DR Kongo weiter zu destabilisieren.
Auch der kongolesische Gynäkologe und Friedensnobelpreisträger von 2018, Denis Mukwege, veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er das Abkommen zwischen der EU und Ruanda kritisierte. In einer Erklärung, die seine Organisation Panzi Foundation veröffentlichte, rügte er die EU, im Widerspruch zu ihren eigenen Grundwerten – der Förderung von Frieden und Menschenrechten – zu handeln.
Ruandas Präsident Paul Kagame weist Vorwürfe, die M23-Rebellen zu unterstützen, konsequent zurück. Umgekehrt wirft Ruanda der DR Kongo vor, die Rebellengruppe FDLR zu unterstützen, zu deren Mitgliedern mutmaßliche Täter des Völkermords in Ruanda von 1994 gehören.
Im Jahr 2021 hat die EU eine Verordnung verabschiedet, die dazu beitragen soll, den Handel mit Mineralien aus politisch instabilen Regionen zu stoppen. Grund ist, dass dieser zur Finanzierung bewaffneter Gruppen, zur Förderung von Zwangsarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen genutzt werden kann. Außerdem kann der Handel von Konfliktmineralien Korruption und Geldwäsche unterstützen. Die Verordnung deckt hauptsächlich vier Mineralien ab – Zinn, Tantal, Wolfram und Gold – und soll sicherstellen, dass europäische Unternehmen diese aus verantwortungsvollen Quellen beziehen.
Doch trotz der Bemühungen der EU und anderer internationaler Organisationen zur Gewährleistung der Verantwortung in den Lieferketten des Bergbaus ist der illegale Handel mit Konfliktmineralien dadurch nicht endgültig besiegt. Besonders in Krisengebieten wie dem Osten der DR Kongo wird mit Konfliktmineralien weiter gehandelt.
Der Kampf gegen den illegalen Handel mit Mineralien bleibt eine große Herausforderung, um nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor zu gewährleisten. Es ist nahezu unmöglich sicherzustellen, dass die importierten kritischen Mineralien aus einer konfliktfreien Wertschöpfungskette stammen.
Die EU könnte jedoch zumindest einen Beitrag leisten, indem sie für eine transparente und verantwortungsvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure sorgt. Dies bedeutet auch, die lokalen Zusammenhänge stärker zu berücksichtigen und eine weitere Eskalation der Spannungen zwischen der DR Kongo und Ruanda zu verhindern.
Der Oppositionsführer Bassirou Diomaye Faye ist überraschend als Wahlsieger aus der Präsidentschaftswahl im Senegal hervorgegangen. Am späten Montagabend hat sich Faye bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Wahlen für eine Stärkung der Ecowas ausgesprochen.
“Ich rufe unsere afrikanischen Brüder und Schwestern dazu auf, gemeinsam die Errungenschaften zu festigen, die wir durch die regionale Integration in der Ecowas gewonnen haben“, sagte Faye am Montag auf einer Pressekonferenz in Dakar. “Dabei sollten wir gleichzeitig ihre Schwächen ausgleichen und bestimmte Methoden, Strategien und politische Prioritäten ändern.” Er werde sich außerdem für die Einheit und den politischen sowie wirtschaftlichen Zusammenhalt in ganz Afrika einsetzen, so Faye weiter.
Der Senegal wählte am Sonntag mit gut einem Monat Verspätung einen neuen Staatspräsidenten, nach einer schweren politischen Krise, die seit mehr als einem Jahr andauerte. Das Land grenzt an den Sahel und hat enge wirtschaftliche, historische, ethnische und kulturelle Beziehungen in die Region, besonders zu seinem östlichen Nachbarland Mali. 1959/1960 waren die beiden Länder sogar kurzzeitig in einem gemeinsamen Staat, der Mali-Föderation, vereint. Vor gut zwei Monaten traten Mali, Burkina Faso und Niger aus der Ecowas aus. Zuvor hatten diese drei Länder einen neuen Staatenbund geschlossen.
In seiner gut zehnminütigen Ansprache auf Französisch – die er anschließend in der Landessprache Wolof wiederholte – betonte Faye am Montag die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft. “Der Senegal wird immer seinen Platz behaupten. Er bleibt ein befreundetes Land und ein sicherer und verlässlicher Verbündeter für alle Partner, die sich mit uns in für eine tugendhafte, respektvolle und beiderseits produktive Zusammenarbeit einsetzen.”
Faye war für die verbotene Partei Pastef angetreten und gilt als frankreich-kritisch. Allerdings betonte er schon vor den Wahlen, dass er mit Frankreich gute Beziehungen pflegen wolle, trotz schwieriger Aspekte. Frankreichs Präsident Emanuel Macron gratulierte Faye am späten Montagabend zu seinem Wahlsieg auf der Plattform X, sowohl auf Französisch als auch auf Wolof.
Der 44 Jahre alte Faye ist ein politischer Newcomer und arbeitete bisher in der Steuerverwaltung. Er gilt als konservativer Muslim und ist mit zwei Frauen verheiratet. Im muslimisch geprägten Senegal ist Polygamie erlaubt. Im Wahlkampf hatte sich Faye als “Kandidat für den Systemwechsel” und als Vertreter eines “linken Panafrikanismus” bezeichnet. Im Senegal hat der Panafrikanismus eine lange Tradition. So war der 1986 verstorbene Historiker und Anthropologe Cheikh Anta Diop ein gemäßigter Führer dieser Bewegung.
Faye will die nationale “Souveränität” im Senegal wiederherstellen, die Korruption bekämpfen, den Wohlstand im Land gerechter verteilen und die Verträge über Bergbau und die Nutzung kürzlich entdeckter Erdöl- und Gasvorkommen vor der Küste neu verhandeln.
Der künftige Präsident hat laut dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission 53,7 Prozent der Stimmen gewonnen und sich damit deutlich gegen seinen Hauptkonkurrenten Amadou Ba von der Regierungsmehrheit durchgesetzt. Ba vereinte nur 36,2 Prozent der Stimmen auf sich. Die Angaben beruhen auf einer Auszählung von 90 Prozent der Wahlbüros. Ba erkannte seine Niederlage an und gratulierte Faye, ebenso wie der scheidende Präsident Macky Sall. Laut internationalen und nationalen Beobachtern (EU, AU, Ecowas, COSCE) verliefen die Wahlen frei und fair.
Nach Angaben des zivilgesellschaftlichen Bündnisses COSCE lag die Wahlbeteiligung bei 61,6 Prozent der 7,3 Millionen Wahlberechtigten. 2019 hatten 66,2 Prozent der Wähler ihr Wahlrecht wahrgenommen. Endgültige Ergebnisse werden bis spätestens Freitag erwartet. Die Amtsübergabe von Macky Sall auf Faye könnte schon Ende dieser Woche geschehen. lcw
Die KfW will über verschiedene Ansätze innerhalb der Bankengruppe mehr privates Kapital in die Finanzierung ihres Förderauftrags einbinden. Die KfW selbst macht dies, indem sie sich verstärkt an Verbriefungen privater Fonds und Banken beteiligt. Auf diese Weise will die KfW einen Beitrag dazu leisten, dass sich dieser Markt wieder in Europa etabliert.
“Angesichts enger fiskalischer Spielräume ist die weitere Mobilisierung privaten Kapitals zentral für uns”, sagte der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels bei der Vorlage des Jahresergebnisses der KfW. Die staatliche Förderbank wolle sich stärker am Markt für Verbriefungen engagieren, auch um die Bilanzen der Geschäftsbanken zu entlasten. Das setze allerdings voraus, dass bei den Banken im Voraus der Kreditschöpfungsprozess ordentlich gelaufen sei.
Vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 seien die Verbriefungsmärkte in den USA und Europa in etwa gleichauf gelegen, führte Finanzvorstand Bernd Loewen aus. Heute mache der europäische Markt nur noch rund zehn Prozent des amerikanischen Marktes aus. Verbriefungsinstrumente wie Collateralized Debt Obligations (CDO) oder Mortgage Backed Securities (MBS) sind im Zuge ihres Beitrags zum Ausbruch der damaligen Finanzkrise besonders in Europa in Diskredit geraten.
Allerdings ist die Aufsicht über diese Instrumente in den USA und der EU seitdem verschärft worden. Auch wurden bestimmte, besonders risikoreiche Konstruktionen untersagt. Heute ist nach Meinung Loewens allerdings die Finanzaufsicht in der EU über Verbriefungen zu restriktiv. Die Regulierung in Europa sei zu komplex, sagte Loewen. Die Dokumentationsanforderungen seien zu hoch. Auch dürften Verbriefungen bei den Anforderungen an die Kapitalunterlegung nicht penalisiert werden. Durch ihre verstärkte Beteiligung an Verbriefungen will die KfW auch dazu beitragen, dass sich dieses Kapitalmarktsegment wieder in Europa etabliert.
Auch die DEG Invest, eine Konzerngesellschaft der KfW, mobilisiert stärker privates Kapital, um ihre Förderziele in der Privatwirtschaft zu erreichen. So gelang es ihr im vergangenen Jahr 613 Millionen Euro privates Kapital in ihre Projekte einzubinden. Dies kam zum eigenen Fördervolumen von 1,9 Milliarden Euro hinzu. Das war ein höherer Anteil als im Jahr 2022. Damals stand einem Fördervolumen von 1,6 Milliarden Euro privates Kapital von 487 Millionen Euro gegen. Somit ist der Anteil privaten Kapitals am addierten Fördervolumen von 23,3 Prozent im Jahr 2022 auf 24,4 Prozent im Jahr 2023 gestiegen. Die DEG Invest wolle künftig noch mehr privates Kapital für ihre Projekte mobilisieren, kündigte Roland Siller, der Vorsitzende der DEG-Geschäftsführung an.
Die Ertragsrechnung der KfW-Bankengruppe war im vergangenen Jahr auch dadurch belastet, dass die DEG Invest die höheren Zinsen an den internationalen Kapitalmarkt nicht immer in vollem Umfang an ihre Kreditnehmer weitergereicht hat. Diese Finanzierungen werden laut Loewen in der Regel variabel vereinbart. Angesichts der Belastungen aus dem höheren Zinsniveau hätten Kunden die DEG gebeten, auf Zinsmarge zu verzichten. “Damit wollten wir in diesen Ländern die gestiegenen Zinsen zumindest teilweise abfedern”, sagte Loewen. hlr
In einem internen Schreiben an die Unionsfraktion mahnen der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Hermann Gröhe und der entwicklungspolitische Sprecher Volkmar Klein zu mehr Sachlichkeit in der Debatte um Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit. In dem Schreiben, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, beziehen sich Gröhe und Klein unter anderem auf die Debatte um “Radwege in Peru“.
Auf der Plattform X hatte CSU-Generalsekretär Martin Huber mehrere Projekte der Entwicklungszusammenarbeit aufgeführt und diese in den Kontext der Bauernproteste gestellt. Huber hatte kritisiert, die Ampelkoalition verteile Geld in aller Welt, könne aber gleichzeitig offenbar die Bauern im eigenen Land nicht entlasten. Auch innerhalb der Ampelregierung hatte es im Rahmen der Haushaltsdebatten Kritik von der FDP am Einsatz von EZ-Mitteln gegeben. Angesichts des Sparkurses der Ampel infolge des Verfassungsgerichtsurteils zum Nachtragshaushalt 2021 musste das BMZ eine Haushaltskürzung von knapp einer Milliarde Euro hinnehmen.
In dem Rundschreiben hieß es nun, das mit 20 Millionen Euro geförderte Entwicklungsprojekt in Peru sei noch vom unionsgeführten BMZ bewilligt worden. Die AfD hatte in der Debatte offenbar fälschlich von einer Unterstützung von 315 Millionen Euro gesprochen. Auch das BMZ hatte 20 Millionen Euro an zugesagten Zuschüssen bestätigt.
Angesichts der Unionsdebatte um eine strategische Neuausrichtung der EZ wiesen Gröhe und Klein in ihrem Schreiben auf die Bedeutung der EZ für die “internationale Handlungsfähigkeit Deutschlands” hin. “Inaktivität im Krisenfall, zum Beispiel bei Ernährungssicherheit, kann weitere illegale Migrationsbewegung auslösen”, heißt es in dem Papier weiter. Dies sei auch Hintergrund der Flüchtlingsbewegung 2015 gewesen. Zudem diene die EZ häufig als “Türöffner für die deutsche Wirtschaft”. In Zeiten der globalen Systemkonkurrenz mit China, Russland aber auch den Golfstaaten sei die deutsche internationale Präsenz und das Werben für ein liberales Weltbild umso wichtiger. dre
Deutschland will seine Hochschulkooperationen mit Südafrika ausbauen. BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring hat sich dafür in der vergangenen Woche in Pretoria mit dem stellvertretenden Forschungsminister Buti Manamela getroffen. Dabei ging es laut einer Sprecherin des BMBF unter anderem um die Einrichtung des DAAD-Fachzentrums für Ernährungssysteme und Agrar- und Ernährungsdatenwissenschaft. Daneben eröffnete die Staatssekretärin gemeinsam mit dem südafrikanischen Minister für Höhere Bildung, Wissenschaft und Technologie Blade Nzimande die “German Research Days” im Rahmen des zwanzigjährigen Jubiläums des African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Kapstadt.
Vor rund einem Jahr war bereits Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger nach Südafrika und Namibia gereist. Damals hatte die Ministerin mit Nzimande eine Absichtserklärung über die Einrichtung eines Forschungslehrstuhls im Bereich “Just Energy Transition” unterzeichnet. Dem Ministerium zufolge seien nun die Gespräche zur Umsetzung des Vorhabens fortgeführt worden.
Darüber hinaus habe es weitere Gespräche bezüglich es geplanten Beitritts Deutschlands zum Square Kilometre Array Observatory (SKAO) gegeben. SKAO ist eine internationale Organisation mit Sitz in Großbritannien und Standorten in Südafrika und Australien. Die Radioteleskop-Netzwerke stellen Forschern detailliertere Informationen über das Weltall zur Verfügung. Die Netzwerke sollen bei der Erforschung von dunkler Materie, der Entstehung von Galaxien sowie der Suche nach außerirdischen Lebensformen unterstützen. Das Bundeskabinett hatte den Deutschen Beitritt zu SKAO Ende 2023 beschlossen. dre
Afrika nimmt beim neuesten Weltglücksbericht mittlere bis untere Positionen ein. Die fünf glücklichsten Länder auf dem Kontinent sind demnach Libyen (globaler Platz 66), Mauritius (70), Südafrika (83), Algerien (85) und die Republik Kongo (89). Trotz Herausforderungen wie Stromausfall, Korruption und Kriminalität konnte sich Südafrika verbessern. Aber die untersten Plätze belegen fast nur afrikanische Nationen: Botsuana (137), Simbabwe (138), die DR Kongo (139), Sierra Leone (140) und Lesotho (141). Nur der Libanon und Afghanistan schneiden noch schlechter ab. Die weltweite Ungleichheit des Glücklichseins, so eine Kernaussage des Berichts, hat in den vergangenen 12 Jahren um 20 Prozent zugenommen, vor allem zu Ungunsten von Sub-Sahara Afrika.
Der 2024 World Happiness Report wurde am Weltglückstag vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Wissenschaftler des amerikanischen Gallop-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Oxford Wellbeing Research Centre und den Vereinten Nationen untersuchen alljährlich in rund 140 Ländern die Selbsteinschätzung der Menschen zu ihrer Lebenszufriedenheit. In die Bewertung fließen Daten wie Lebenserwartung, BIP, wirtschaftliche Stellung, aber auch persönliche Einschätzung von Korruption oder Freiheit ein. Wie schon zuvor belegen die nordischen Länder die Spitzenpositionen, mit Finnland auf dem ersten Platz. Deutschland fiel aus den Top-20 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt heraus und rutschte auf Platz 24 hinter die USA, die ebenfalls Federn ließen. Zum ersten Mal wurden für den Bericht altersspezifische Umfragen angewendet. John F. Helliwell, Professor an der Vancouver School of Economics und Mitherausgeber des Berichtes, erkennt große Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich des Glücks der jüngeren und älteren Bevölkerung: “Daher sind die globalen Glücksrankings für Jung und Alt recht unterschiedlich, und zwar in einem Ausmaß, das sich in den letzten zwölf Jahren stark verändert hat.” as
Digitale Nomaden haben Afrika entdeckt. Aufgrund der immer besseren Internetverbindungen, attraktiven und kostengünstigen Destinationen, rückt der Kontinent immer mehr ins Visier von flexiblen Freiberuflern. Diese brauchen zum Arbeiten nur schnelles Internet. Sie profitieren von “Digitial Nomad Visa”-Programmen, mit denen verlängerte Arbeitsaufenthalte von sechs bis zwölf Monaten erlaubt werden.
In Afrika bieten bisher vier Länder diese Visa, die in Europa weitverbreitet sind, an: die Kapverdischen Inseln, die Seychellen, Mauritius und Namibia. Mauritius war das erste Land auf dem Kontinent, dass im Oktober 2020 die Erleichterung der Einreise für digitale Nomaden ankündigte. Südafrika soll noch in diesem Jahr folgen. Den Ländern geht es vor allem darum, gut ausgebildete Menschen mit Einkommen ins Land zu locken. Sie sollen Geld in die lokale Wirtschaft pumpen und möglicherweise weitere Investitionen nach sich ziehen. “Um in einer sich ständig veränderten Weltwirtschaft erfolgreich zu sein, braucht unser Land weit mehr Menschen mit den richtigen Fähigkeiten”, sagte kürzlich der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. Er will die Visabestimmungen erleichtern und Unternehmertum fördern, etwa in der Tech-Industrie, die von einer innovativen Startup-Szene angetrieben wird. Im Land am Kap finden sich günstige Lebenshaltungskosten und ein hoher Freizeitwert.
Genau das ist es, was Europäer anzieht, denen eine Work-Life-Balance wichtig ist. Die Kapverdischen Inseln vor der Küste von Westafrika haben alles, wovon Besucher träumen können: Gutes Wetter, Sehenswürdigkeiten und eine lebendige Kultur. Die Seychellen im Indischen Ozean östlich von Afrika preisen sich als Inselgruppe mit tiefblauem Meer, unberührten Stränden und einem kulturellen Schmelztiegel an. Namibia im Südwesten von Afrika wirbt mit atemberaubenden Landschaften, beeindruckender Tierwelt und ausgezeichneter Infrastruktur. Und der Inselstaat Mauritius vor Ostafrika präsentiert sich als “beruhigend, euphorisch, neugierig, abenteuerlustig”.
Eine Gemeinsamkeit haben alle fünf Länder: Sie sind wirtschaftliche und politische Vorreiter in Afrika und wollen Investitionen anlocken. “Wir wollten Namibia als einen großartigen Ort zum Leben, Arbeiten und Investieren positionieren”, so Margareth Gustavo vom Namibia Investment Promotion Development Board über das Digital-Nomad-Visum. as

Der Mangel an Fachkräften in Deutschland ist alarmierend: Gemäß dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fehlen derzeit 630.000 Fachkräfte. Im vierten Quartal 2023 blieben insgesamt 1,725 Millionen Stellen unbesetzt. Besonders in Bereichen wie der Altenpflege dauert es im Durchschnitt 251 Tage, bis Stellen besetzt werden. Zusätzlich waren im Jahr 2022 fast die Hälfte aller Unternehmen von Fachkräftemangel betroffen, was einen bisherigen Höchststand darstellt.
Um dieser Situation entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung im Jahr 2023 das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung verabschiedet. Das Gesetz hatte zum Ziel, ein Signal der Willkommenskultur und der Wertschätzung gegenüber Fachkräften zu senden. Die entscheidende Frage, die wir uns nun stellen müssen, lautet: Werden die durch das Gesetz eingeführten Änderungen ausreichen, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern?
Die Entscheidung für einen bestimmten Migrationsort wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel bevorzugen potenzielle Migrantinnen Länder, in denen sie bereits bestehende familiäre Verbindungen haben. Andererseits können einige Migrantinnen und Migranten ihre Entscheidung aufgrund der gebotenen Chancen in den Zielländern treffen. Die OECD-Indikatoren für die Attraktivität von Talenten (ITA) messen seit 2019 die Fähigkeit der Länder, qualifizierte Migranten anzuziehen und zu halten. Die ITA-Daten für hochqualifizierte Arbeitskräfte zeigen, dass Deutschland derzeit nicht zu den Ländern gehört, die ein besonders attraktives Rahmenwerk bieten.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat die OECD auch den Werdegang von hochqualifizierten Personen verfolgt, die als Arbeitsmigranten und -migrantinnen nach Deutschland kommen wollten. Die OECD-Studie zeigte, dass es nur wenigen Menschen, die im Ausland leben und Interesse haben, nach Deutschland zu migrieren, innerhalb eines Jahres gelingt, dies zu tun. Potenzielle Migranten schätzen insbesondere die guten Arbeits- und Karrierechancen sowie die Sicherheit in Deutschland, klagen jedoch gleichzeitig über die langen Wartezeiten für ein Visum und die komplizierten Verfahren. Viele potenzielle Migrantinnen und Migranten würden sich auch mehr Unterstützung bei der Arbeitssuche und dem Erlernen der deutschen Sprache wünschen. Diskriminierung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da eine große Anzahl potenzieller Migranten glaubt, dass sie in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden.
Ein Wort taucht immer wieder in Debatten über Fachkräftemangel und Migration auf: Komplexität. Migrantinnen und Migranten beklagen sich über ein System, das sehr schwierig zu navigieren ist. Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen wollen, verstehen die Regulierungen nicht, die sie umsetzen müssen, und finden auch keine Ansprechpartner in den Institutionen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Migrationsverwaltungen (z.B. Ausländerbehörden) leiden unter Gesetzen und Verordnungen, die sich ständig ändern.
Wir hatten noch nie ein so komplexes Migrationssystem in Deutschland, und die neue Komplexität der Regulierungen bringt uns nicht weiter. Wir müssen versuchen, die Komplexität des Systems zu reduzieren. Zum Beispiel durch weniger und klarere Zugangswege (allgemeines Visum mit weniger Anforderungen) oder durch eine stärkere Zentralisierung der Verwaltung.
Laut dem Rassismus-Monitor, veröffentlicht vom DeZIM-Institut im Jahr 2023, sind Diskriminierungserfahrungen allgemein weitverbreitet. Das kann Deutschland sich nicht leisten, wenn wir Fachkräfte aus dem Ausland anziehen wollen. Deutschland muss seine Integrationspolitik verbessern, interkulturelle Kompetenzen am Arbeitsplatz fördern, und eine ernsthafte Strategie gegen Diskriminierung und Rassismus entwickeln.
Um meine ursprüngliche Frage zu beantworten, ob die durch das Gesetz eingeführten Änderungen ausreichen, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern, lautet meine Antwort: nur teilweise. Das neue Gesetz bringt positive Veränderungen mit sich, aber es adressiert nicht die strukturellen Probleme wie die Komplexität des Systems (tatsächlich verschlimmert es die Situation) oder die schwache deutsche Willkommenskultur.
Dennoch ist in den letzten Jahren etwas sehr Positives passiert: Immer mehr Akteure haben erkannt, dass die Perspektive der Migranten im Mittelpunkt jeder Lösung stehen muss. Es geht nicht nur darum, “Make it Germany” (wie das Portal der Regierung für potenzielle Migranten heißt), sondern auch darum, wie “Germany makes it”.
Dr. Pau Palop-García ist Politikwissenschaftler und Migrationsforscher mit Spezialisierung auf Migrationspolitiken und der politischen Repräsentation von Migrant*innen in transnationalen Räumen. Er forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin.
Stiftung Wissenschaft und Politik: Wie weiter in der Sahelpolitik? Die Militärregime in Mali, Burkina Faso und Niger stellen Deutschland und die EU vor Zielkonflikte und Dilemmata. Der Klärungsbedarf besteht laut SWP vor allem in der Frage, welche Probleme und Ziele vorrangig sein sollen. Unter dem AU-Vorsitz Mauretaniens, das nicht Mitglied der Ecowas ist, ergeben sich möglicherweise neue Spielräume für afrikanische Vermittlungsversuche.
L’Économiste: Die marokkanische Börsenaufsicht legt ihre neue Strategie vor. Die Börse Casablanca soll sich künftig um vier Themenfelder herum entwickeln: Effizienz, Marktzugang, Verbreiterung der Investorenbasis und Diversifizierung der Finanzinstrumente. Das geht aus der neuen Strategie 2024 bis 2028 hervor, die die Börsenaufsicht AMMC vorgelegt hat.
Financial Times: EU plant Unterstützung für Tunesien, um Migration zu begrenzen. Über drei Jahre will die EU insgesamt knapp 165 Millionen Euro für tunesische Sicherheitskräfte bereitstellen, die die Migration über das Mittelmeer begrenzen sollen. NGOs und Menschenrechtsgruppen protestieren, da auch Sicherheitskräfte profitieren könnten, die in rechtswidrige Verhaftungen und Abschiebungen von Migranten von europäischem Geld profitieren könnten.
The East African: Ruanda und Tansania wollen neuen Grenzübergang eröffnen. Mit einem neuen Grenzübergang soll der Warenverkehr zwischen Ruanda und Tansania gefördert werden, sagte der tansanische Außenminister January Makamba in Ruanda. Zudem soll der bestehende Übergang Rusumo entlastet werden.
Bloomberg: 50-Milliarden-Dollar-Rettung aus UAE macht Ausmaß ägyptischer Wirtschaftskrise deutlich. Bloomberg analysiert die Auswirkung des finanziellen Rettungsschirms aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die kriselnde Wirtschaft Ägyptens. Trotz der Finanzspritze müssen sich die Ägypter auf weiter steigende Preise einstellen.
The Economist: Nigerias Ölindustrie ist auf dem absteigenden Ast. Nachdem Ölriese Shell seine nigerianische On-Shore-Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company (SPCD) an ein lokales Konsortium verkauft hat, zeigt sich der Absturz der nigerianischen Ölindustrie. Auch Total hat angekündigt, seine Anteile an SPDC zu veräußern.
FAZ: Der Westen als Täter. Mit dem Verhältnis zwischen Postkolonialismus und Antisemitismus beschäftigt sich Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Er bemängelt, dass die postkolonialistischen Ansätze wenig zur Analyse der nichtwestlichen Kultur beitragen. Auch hebt er hervor, wie viel der Westen bei allen Widersprüchlichkeiten an emanzipativen Fortschritten in Bezug auf Frauen- und Minderheitenrechte erreicht habe.
Stiftung Wissenschaft und Politik: Machtbeziehungen in Sudan nach dem Fall Bashirs. Seit einem Jahr währt schon der Bürgerkrieg im Sudan, ein Konflikt, den der Krieg in der Ukraine und der in Gaza überdeckt. Viele internationale und sudanesische Bemühungen krankten daran, dass sie entweder nur auf Einbindung oder nur auf Ausschluss der Sicherheitskräfte abstellten. Ein neuer Elitendeal allein mit Sudans Gewaltunternehmern wird keinen Frieden bringen, solange keine zivilen Kräfte am Tisch sitzen, lautet das Fazit der Studie.

Auf dem felsigen Untergrund am Meer in einem Vorort des schmucken Städtchens Hermanus südöstlich von Kapstadt, war am Wochenende noch etwas Blut zu sehen. Hier wurde Markus Jooste, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Steinhoff International Holdings, vergangenen Donnerstag mit einer tödlichen Schussverletzung aufgefunden. Vieles spricht für Selbstmord, doch das wurde noch nicht zweifelsfrei ermittelt. Jemand hatte vergeblich versucht, die Spuren mit Sand zu überdecken. Ein Anwohner, wenngleich bestürzt über das tragische Ende des Top-Managers, bezeichnete Jooste als “arrogante Person”. Der 63-Jährige verstarb kurz nach seiner Ankunft in einer Privatklinik. Niemand legte Blumen vor sein Haus.
Der mutmaßliche Suizid von Markus Jooste war das zweite einschneidende Ereignis innerhalb einer Woche im Rahmen des größten Unternehmensskandals in der Geschichte Südafrikas, bei dem 6,5 Milliarden Euro veruntreut wurden. Der Fall reicht bis nach Deutschland. Bruno Steinhoff hatte das Möbelunternehmen im 1964 in seinem Geburtsort Westerstede im Ammerland gegründet. Bis im vergangenen Jahr waren die Aktien von Steinhoff International in Frankfurt börsennotiert.
Einen Tag vor seinem Ableben war der ehemalige Konzernchef Jooste zusammen mit seinem europäischen Finanzvorstand, Dirk Schreiber, zu einer Rekordstrafe von umgerechnet 23 Millionen Euro von der Finanzaufsichtsbehörde FSCA verurteilt worden, zu zahlen innerhalb eines Monats: ein tiefer Fall des ehemaligen, äußerst erfolgreichen Managers, der den Ruf hatte, gewinnbringende Unternehmen zu erkennen, wo andere kein Potenzial sahen. Jooste wurde damit reich, 2015 schätze Forbes sein Vermögen auf 370 Millionen Euro.
Der Manager war ein Pferdenarr und hatte zwischenzeitlich die zweitgrößte Sammlung von Rennpferden in der Welt. Er konnte Mitarbeiter begeistern und mit sich ziehen. Andere warfen ihm Manipulation und Größenwahn vor. Die Stricke hielt Jooste immer in der Hand. Noch vor zwei Jahren war Steinhoff das siebtgrößte Unternehmen in Afrika, größer als der Bergbauriese Anglo American Platinum. Aber schon Jahre zuvor hatte das Imperium zu bröckeln begonnen.
Lange konnte Jooste die sich häufenden Misserfolge übertünchen. Steinhoff schrieb zunehmend rote Zahlen. Er ließ Gewinne von Tochterunternehmen künstlich in die Höhe treiben. Er deckte die Verluste mit fiktiven Transaktionen. So verschleierte er ein Minus 1,5 Milliarden Euro. Ende 2017 kam der Bilanzskandal des Konzerns ans Licht. Jooste habe “falsche und irreführende” Aussagen in den Geschäftsberichten von 2015 bis 2017 gemacht, lautete der Vorwurf.
Der Steinhoff-Konzern hat seinem Ursprung in der deutschen Möbelindustrie in Westerstede bei Oldenburg, gegründet von Bruno Steinhoff. Dieser baute die Firma mit Möbelimporten aus dem damaligen Ostblock auf. Dann expandierte er nach Südafrika.
Nach einem Studium an der Stellenbosch University bekam Jooste 1988 bei Steinhoff einen Job. Zwei Jahre nachdem der Konzern in Johannesburg an die Börse gegangen war, wurde Jooste im Jahr 2002 der CEO des Unternehmens. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen zu einem Großkonzern. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg Steinhoff in Europa zum zweitgrößten Möbelhändler nach Ikea auf. In Deutschland gehörten dem Unternehmen die Poco-Billigmöbelmärkte. Mitte 2015 wurde die Hauptbörsennotierung vom Johannesburg nach Frankfurt verlegt. Die Zentrale blieb in Südafrika.
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte schon im Dezember 2015 die Fahnder zur europäischen Tochtergesellschaft von Steinhoff geschickt. Tage später ging Steinhoff International an die Börse in Frankfurt. “Börsengang ohne Chef”, schrieb damals das Handelsblatt, denn Markus Jooste kam nicht, wegen “Nackenschmerzen”, und ließ per Pressemitteilung verkünden: “Heute ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte von Steinhoff. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse zusammen mit einer Zweitnotierung an der Börse in Johannesburg wird das internationale Profil der Gruppe stärken.”
Wenige Monate später kaufte der Steinhoff-Chef den amerikanischen Matratzenhändler Mattress Firm zum Preis von 2,2 Milliarden Euro. Die verlustreiche Übernahme brachte den Konzern zu Fall, auch wenn Jooste noch ein Jahr nach diesem Zukauf auf einen “Game Changer” hoffte. Im Dezember 2017 tauchten dann Ungereimtheiten in den Büchern des Konzerns auf. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte weigerten sich, die Geschäftsberichte abzuzeichnen. Unter Druck gab Markus Jooste Regelverstöße zu, sprach von “einigen großen Fehlern”. Er trat als CEO zurück. In kurzer Zeit verlor die Steinhoff-Aktie in Südafrika mehr als 90 Prozent an Wert und vernichtete Kapital von umgerechnet rund zehn Milliarden Euro an der Börse von Johannesburg.
Am größten Unternehmensbetrug Südafrikas verloren Großaktionäre, darunter der Government Employees Fund (GEPF), Afrikas größter Pensionsfonds, riesige Beträge. Auch an der Frankfurter Börse sackten die Wertpapiere um 60 Prozent ab. Steinhoff beauftragte Wirtschaftsprüfer von PwC, die Bilanzen des Unternehmens zu untersuchen. 14 Monate später legten diese einen 7000 Seiten langen Bericht vor, der unter Verschluss blieb. Steinhoff veröffentlichte lediglich eine elfseitige Übersicht. Die fehlenden Finanzberichte legte der strauchelnde Konzern erst Mitte 2019 vor.
Bereits 2020 wurde Jooste zu einer Strafe von rund acht Millionen Euro verurteilt, doch er kämpfte hart und schaffte es, dass diese auf eine Million Euro reduziert wurde. Seit seinem Abgang mied er die Öffentlichkeit, hüllte sich meist in Schweigen, und beteuerte, dass er von Unregelmäßigkeiten nichts wusste. Es dauerte weitere zwei Jahre, bis die südafrikanische Zentralbank alle mit Jooste verbundenen Vermögen einfrieren ließ, darunter ein exklusives Weingut und der Familienbesitz von geschätzten rund 50 Millionen Euro.
Auch in Deutschland schritten die Ermittlungen weiter voran. 2022 verhängte die Finanzaufsicht Bafin in Frankfurt eine Rekordbuße von 11,29 Millionen Euro gegen Steinhoff wegen Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten. Das Landgericht Oldenburg begann im April 2023 der Prozess gegen Steinhoff. Jooste erschien nicht, und Deutschland stellte einen Haftbefehl gegen ihn aus. Vier Monate später gab es das erste Urteil im Prozess gegen Steinhoff: Zwei Ex-Manager wurden zu Haftstrafen verurteilt, darunter der ehemalige Europa-Finanzchef, Dirk Schreiber. Im Oktober vergangenen Jahres wurde Steinhoff schließlich liquidiert und von der Börse genommen.
In Südafrika wurde der Strick ebenfalls enger gezogen, auch wenn es sieben Jahre dauerte. Die National Prosecuting Authority (NPA) hatte ein Top-Team von Anwälten zusammengestellt und wollte Jooste und hochrangige Steinhoff-Manager diese Woche wegen Aktienkursmanipulation und Falschangaben in Jahresberichten anklagen. Einen Tag vor seinem mutmaßlichen Selbstmord sollte der Ex-Manager sich den Behörden stellen. “Er ergriff drastische Maßnahmen, wenn er in die Enge getrieben wurde und keinen Ausweg mehr sah”, erinnert sich Autor James-Brent Styan in der Sunday Times, der über den Steinhoffskandal ein Buch geschrieben hatte. Der Tod Markus Joostes kam einem Verfahren zuvor. Er hinterlässt seine Frau Ingrid und drei erwachsene Kinder. Andreas Sieren
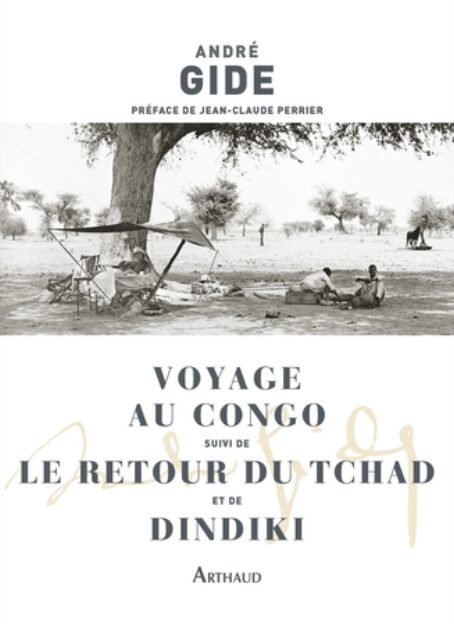
Fast hundert Jahre liegt die legendäre Reise des französischen Schriftstellers André Gide in den Kongo zurück. Trotz ihres Alters haben seine Aufzeichnungen kaum an Aktualität eingebüßt, so wenig, dass der französische Verlag Éditions Arthaud diese Tagebücher, mit bisher unveröffentlichten Dokumenten angereichert, neu editiert hat.
Von Juli 1926 bis Mai 1927 bereiste Gide Französisch-Äquatorialafrika. Von Kinshasa den Kongo flussaufwärts nach Coquilhatville, der heutigen Millionenstadt Mbandaka, dann nach Norden abbiegend nach Carnot in der heutigen Zentralafrikanischen Republik. Weiter ging die Reise in den Tschad, nach Bangui, Sarh, das damals Fort Archambault hieß, und Fort-Lamy, dem heutigen N’Djaména, der Hauptstadt des Tschad. Anschließend führte die Reise Gide durch Kamerun nach Douala an die Küste zurück.
Die Neuausgabe umfasst neben Voyage au Congo die Fortsetzungen Le Retour du Tschad und Dindiki. Lesenswert ist das fast 580 Seiten dicke Werk allein wegen der Präzision der Beobachtungen und der Aufrichtigkeit der Beschreibungen, die Gide liefert. Bemerkenswert ist auch, wie sich Gides Haltung zur Kolonialwirtschaft im Laufe seiner Reise verändert.
Das Buch Reise in den Kongo löste damals heftige Emotionen in Frankreich aus und zwang die Regierung sogar zu Reformen in der Kolonialverwaltung.
Gide, 1860 in eine puritanische protestantische Familie geboren, war einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts dank Werken wie La Symphonie pastorale oder Les Nourritures terrestres. 1947 erhielt er den Literaturnobelpreis, wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1951. Seine Tagebücher über seine Kongo-Reise haben ihn überdauert und bleiben ein literarisches Standardwerk über Afrika. hlr
André Gide: Voyage au Congo suivi de Le Retour du Tchad et de Dindiki. Édition enrichie de documents rares ou inédits. Neu herausgegeben von Jean-Claude Perrier. Éditions Arthaud, 2022. 576 Seiten. 28 Euro (in Frankreich).
im Senegal wurde gewählt. Obwohl das amtliche Endergebnis noch aussteht, deutet alles auf einen Machtwechsel in dem westafrikanischen Land hin – trotz oder vielleicht gerade wegen der kurzfristigen Wahlverschiebung durch Noch-Präsident Macky Sall, die das Land in eine schwere politische Krise gestürzt hatte. Unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß informiert Sie über den aktuellen Stand.
Andreas Sieren, unser Korrespondent in Johannesburg, hat sich nach dem Südafrika-Besuch des SPD-Parteischefs Lars Klingbeil Anfang März die Neuauflage der Nord-Süd-Politik genauer angeschaut. Er erklärt, wie Klingbeil einerseits die Parallelen zu Willy Brandts visionärer Nord-Süd-Politik der 70er-Jahre sucht, gleichzeitig aber einen modernisierten Ansatz versucht.
Für Wirtschaftsminister Robert Habeck stehen in Afrika Energiepartnerschaften im Mittelpunkt. Dafür ist der Minister am Anfang des Jahres nach Nordafrika gereist, um Wasserstofflieferungen aus Algerien nach Süddeutschland anzubahnen. Unser Autor Felix Wadewitz hat sich kritisch angeschaut, wie sinnvoll diese Initiative tatsächlich ist.
In Ostafrika sorgt eine Initiative der EU für Kritik. Die Union hat mit Ruanda ein MoU über nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor unterzeichnet. Warum das für weitere Spannungen im Verhältnis Ruandas mit dem ohnehin schon belasteten Beziehungen mit dem Nachbarn DR Kongo sorgt, erklärt unser Autor Harrison Mwilima.
Außerdem blicken wir in unseren News darauf, wie die KfW künftig verstärkt privates Kapital in ihr Geschäft einbeziehen will und wie die Union um einen sachlicheren Kurs in der Debatte um Entwicklungspolitik ringt.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Nur Tage zuvor war SPD-Chef Lars Klingbeil von einer fünftägigen Reise aus Afrika zurückgekehrt, wo er Namibia, Südafrika und Ghana besuchte – jetzt die Zusammenarbeit mit dem Kontinent vertiefen. Auf der großen Nord-Süd-Konferenz “Nord-Süd – Neu denken” vergangene Woche im Willy-Brandt-Haus in Berlin hielt der SPD-Chef eine Grundsatzrede, die die Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden neu definiert. Klingbeil skizzierte die Neuausrichtung und plädierte für Dialoge und Kooperation auf Augenhöhe und eine stärkere Einbeziehung des Globalen Südens, vor allem im Kampf gegen die Klimakrise und die Demokratisierung der internationalen Ordnung.
Für Klingbeil ist die westliche Hegemonie schon lange vorbei, auch wenn der Westen noch politisch und wirtschaftlich einflussreich bleiben wird. Denn die wirtschaftlichen Machtverhältnisse in die Welt haben sich geändert, was auch an dem zunehmenden Einfluss der Brics-Staaten, die mehr Mitspracherecht in der Welt einfordern, zu sehen ist.
“Während die EU und die USA 1990 mit zusammen über 44 Prozent der globalen Wirtschaftskraft noch das wirtschaftliche Zentrum der Welt waren, ist der Anteil heute auf knapp ein Drittel gesunken. Tendenz fallend. China hat im gleichen Zeitraum seine Wirtschaftskraft von vier auf 19 Prozent der globalen Wirtschaftskraft fast verfünffacht. Tendenz steigend”, bemerkt Klingbeil. “Fast 60 Prozent der globalen Wirtschaftskraft und Bevölkerung entfällt heute auf Asien. Auch hier die Tendenz steigend. Vom Jahr 2050 an wird zudem ein Viertel der Weltbevölkerung in Afrika leben.” Der SPD-Chef nimmt die neuen Realitäten wahr und zieht die richtigen Schlussfolgerungen. Ob das zu einen Dialog auf Augenhöhe führen wird, bleibt abzuwarten.
Lars Klingbeil sieht Handlungsbedarf und die Notwendigkeit eines Umdenkens im Globalen Norden. Das kann nur ohne moralischen Unterton geschehen, der nach wie vor in Afrika mit Irritation registriert wird. Er hat zur Kenntnis genommen, dass auch in Afrika andere Sichtweisen existieren, sei es zum Ukrainekrieg, dem Israel-Gaza-Konflikt oder auch bei der Verteilung von Impfstoffen während der Covid-Pandemie, die vor allem afrikanische Regierungen als ungerecht empfanden.
In seinem Treffen mit der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor Anfang März erkannte Klingbeil bei Israel und Palästina unterschiedliche historische Perspektiven. Diese würden heutige Wahrnehmungen und Standpunkte prägen. Beide zielten jedoch auf nachhaltigen Frieden und Sicherheit im Nahen Osten ab, was Kern einer gemeinsamen Politik sein sollte.
Der Parteichef würdigte das Vermächtnis von Willy Brandt, der mit der SPD in den 1970er-Jahren “großes Vertrauen” im Globalen Süden aufgebaut und mehr Respekt gegenüber den Entwicklungsländern gefordert hat. Erstaunt zeigte sich Klingbeil, wie sehr sich hochrangige Politiker, die er auf seinen Reisen in der Welt während der vergangenen zwei Jahren in Ländern wie Brasilien, Südafrika oder China getroffen hatte, an ihre Begegnungen und Gespräche mit Brandt wohlwollend erinnern.
“Die Beschlüsse, die Willy Brandt mit seiner achtzehnköpfigen Kommission 1980 und 1983 vorgelegt hat, lesen sich auch aus heutiger Sicht visionär. Sie sind eine Handlungsanleitung für das gemeinsame Überleben in einer globalisierten Welt. Der Bericht forderte etwa eine stärkere Integration der ärmeren Länder in die Weltwirtschaft oder auch Reformen der internationalen Organisationen.”
Viele der Forderungen Brandts würden sich in den heutigen zunehmenden globalen Krisen wie Klimawandel, Flüchtlinge, Armut und Ungleichheit spiegeln und seien bis heute in einer Welt, die unübersichtlicher geworden ist, noch nicht entschieden umgesetzt worden. Denn während Länder des Globalen Nordens Wohlstand, Frieden und Sicherheit erleben konnten, haben sich die Krisen im Globalen Süden fortgesetzt: “Die politischen und wirtschaftlichen Verheißungen des westlichen Entwicklungsmodells haben aus heutiger Sicht für viele Staaten des globalen Südens nicht funktioniert”, stellt Klingbeil nüchtern fest.
Bundeskanzler Olaf Scholz habe bereits aus der “Zeitenwende wichtige Schlüsse gezogen” und Taten folgen lassen, etwa mit der Einladung von Ländern des Globalen Südens zum G7-Gipfel oder der Mitgliedschaft der Afrikanischen Union (AU) bei der G20. Auch sei der Versöhnungsprozess und die Anerkennung der kolonialen Schuld Deutschlands in Ländern wie Namibia sei eine ‘wichtige Grundlage’ der erneuerten Nord-Süd-Politik.
Dass sich die G7-Staaten in Zukunft am Gästetisch des Globalen Südens, etwa bei Brics, finden könnten, ignoriert Klingbeil. Stattdessen sieht er den Versöhnungsprozess und die Anerkennung der kolonialen Schuld Deutschlands in Ländern wie Namibia als “wichtige Grundlage” der neuen Nord-Süd-Politik, auch wenn sich der Eindruck stellt, dass diesen Ländern wirtschaftliche Beziehungen wichtiger sind.
So ist für Klingbeil einer der Eckpfeiler für eine moderne Nord-Süd-Politik der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise, zu der es nur eine “globale Antwort” geben kann. Wie in Deutschland müsse auch auf internationaler Ebene die Verbindung zwischen Klima und Wirtschaft hergestellt werden, ohne die Sozialverträglichkeit für die jeweilige lokale Bevölkerung außer Acht zu lassen. Wichtig sei auch Wertschöpfung vor Ort, das notwendige Wachstum und Jobs bringen und über transparente Lieferketten wirtschaftlich mit dem Globalen Norden verbunden werden soll.
Der zweite Pfeiler bezieht auf die Demokratisierung der internationalen Ordnung, zu der auch eine “bessere afrikanische Repräsentation” im UN-Sicherheitsrat gehört. Wichtig sei die Reform der internationalen Finanzsituation, die unter anderem die Arbeit regionaler Entwicklungsbanken stärken und wichtige Themen wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur sowie eine gemeinsame Lösung der Schuldenkriesen miteinbeziehen. “Damit die Vereinten Nationen als Hüter einer regelbasierten internationalen Ordnung eine Zukunft haben, braucht es Reformen, die die Machtverhältnisse einer multipolaren Welt von heute besser abbilden,” so Lars Klingbeil.
Algerien bereitet den Einstieg in die Produktion von Wasserstoff vor. Doch das Land will nicht – wie es zu erwarten wäre – seine riesigen Gasreserven nutzen, um blauen Wasserstoff zu produzieren. Vielmehr soll grüner Wasserstoff hergestellt werden.
Algerien besitzt riesige Reserven an fossilen Energieträgern. Es ist der größte Gasexporteur Afrikas und besitzt 0,7 Prozent der weltweiten Ölreserven. Darüber hinaus gilt das Potenzial im Solarbereich als sehr groß. Das Land besteht zu 90 Prozent aus Wüste und bietet 3.000 Sonnenstunden jährlich. Das sind ideale Voraussetzungen für die Produktion grünen Wasserstoffs.
Doch bei der Entwicklung von nachhaltiger Energie und der Wasserstoff-Produktion steht Algerien noch ganz am Anfang. Nur ein Prozent der algerischen Energieproduktion ist derzeit nachhaltig, und von diesem einen Prozent entfallen 90 Prozent auf Sonnenenergie.
Um das Projekt “Grüner Wasserstoff” voranzutreiben, ist der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Februar nach Algier gereist. In Anwesenheit von Mohamed Arkab, dem algerischen Energieminister, hat er eine Absichtserklärung unterschrieben. Teil der Vereinbarung ist es, dass Deutschland Algerien 20 Millionen Euro für eine 50-MW-Pilotanlage für grünen Wasserstoff in der Hafenstadt Arzew zahlt. Betreuen soll sie der staatliche Öl-Konzern Sonatrach.
Von 2030 an soll der Wasserstoff durch den sogenannten SoutH2-Korridor fließen. Diese Pipeline führt von Algerien über Tunesien nach Italien, Österreich und schließlich nach Süddeutschland. Ein großer Teil der Pipeline steht bereits und wird bisher für den Gasexport genutzt.
Zu den deutschen Kooperationsunternehmen zählen RWE und der Betreiber von Gas-Fernleitungsnetzen Bayernets GmbH in München. Auch das bayerische Energieministerium ist eingebunden. Im Jahr 2040 sollen zehn Prozent des Wasserstoffs für die EU aus Algerien kommen. Derzeit sind Kosten von vier Milliarden Euro und eine Kapazität von mehr als vier Millionen Tonnen im Jahr geplant.
Politisch unterscheiden sich Algerien und Deutschland sehr. Das lässt sich an zwei der größten Konflikte festmachen: den Kriegen in der Ukraine und in Gaza. Algerien pflegt gute Beziehungen zu Russland. Diese sind in der Sowjetzeit entstanden, als auch Algerien von einem sozialistischen Regime regiert war.
Nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 wurde die Nationale Befreiungsfront FNL zur sozialistischen Einheitspartei. Das ist lange her. Doch Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune hat die enge Verbindung zu Russland, die sein Vorgänger Abdelaziz Bouteflika pflegte, fortgeführt. Vor allem hat Russland keine Ambitionen, sich in die inneren Angelegenheiten Algeriens einzumischen.
Ein Großteil der Ausstattung des algerischen Militärs kommt heute noch aus Russland. Den Staat Israel erkannt Algier nicht an. Die ausschließliche Solidarität mit Palästina ist Teil der Staatsräson. Meinungs- und Religionsfreiheit sind in Algerien eingeschränkt. Mehrere hundert politische Gegner sitzen derzeit im Gefängnis.
Dennoch läuft das Geschäft mit Gas für Algerien mehr als gut. Anfang März fand der siebte GECF (Forum Gas exportierender Länder) in Algier statt. Mit dabei waren Iran, Katar und Libyen. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage aus Europa nach algerischem Erdgas gestiegen, zuletzt auch aus Deutschland. Anfang Februar schloss der Leipziger Gashändler VNG einen Gasliefervertrag mit Sonatrach.
Solange die Nachfrage nach Gas am Weltmarkt vorhanden ist – in Asien und Afrika dürfte sie noch steigen – wird Algerien an der Gaswirtschaft als Grundlage seiner Wirtschaft festhalten. Gleiches gilt aber auch für Wasserstoff. Vergleichbar ist das mit dem Kauf eines Autos: Ein klimabewusster Kunde (Deutschland), der früher einen Verbrenner gekauft hat, kauft sich aktuell lieber ein Elektroauto. Der Anbieter (Algerien) macht dann das maximale Geschäft, wenn er auch das nachhaltigere Auto im Sortiment führt.
Das hat am Ende weniger mit Klimabewusstsein und mehr mit Geschäftssinn zu tun. Genau darin besteht auch eine Chance: Wenn Europa ankündigt, irgendwann kein Gas mehr zu kaufen, sondern nachhaltig produzierten Wasserstoff, dann werden sich auch andere nicht-demokratische Länder darauf einstellen und versuchen, das alternative Produkt zu liefern.
Dennoch: Politisch gesehen wirft eine Kooperation mit einem autoritären Land wie Algerien Fragen nach der Nachhaltigkeit dieser Beziehung auf. Ebenso könnte die enge Verbindung Algiers zu Moskau zum Problem werden.
Das Memorandum of Understanding zwischen der EU und Ruanda über nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor, das die EU-Kommissarin Jutta Urpilainen und Ruandas Außenminister Vincent Biruta am 19. Februar unterzeichnet haben, könnte die Spannungen in der Region weiter erhöhen. In den vergangenen Tagen beispielsweise gingen Kongolesen, die in London leben, auf die Straße. Sie protestierten gegen die Rolle der ruandischen Regierung im Handel mit Rohstoffen.
Das Abkommen zielt unter anderem darauf ab, mit Ruanda bei der Erreichung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Produktion und Verwertung kritischer und strategischer Rohstoffe zusammenzuarbeiten. Doch der Zeitpunkt der Unterzeichnung ist von entscheidender Bedeutung und könnte zu weiteren Spannungen in der Region führen.
Für Ruanda hat die Vereinbarung über kritische Rohstoffe strategische Bedeutung. Das Memorandum of Understanding legt eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU und Ruanda im Bereich kritischer Mineralien fest. Die Regierung in Kigali hat ohnehin die Ambition, ein Land mit grüner Wirtschaft zu werden. Auch will Ruanda die Emission von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 38 Prozent senken.
Kritische Rohstoffe gelten als entscheidend für die europäische Wirtschaft, weil sie für die Produktion einer breiten Palette von Gütern und Anwendungen für den Alltag und moderne Technologien benötigt werden. Ruanda ist einer der Hauptakteure weltweit beim Export kritischer Mineralien wie Tantal, Wolfram und Zinn. Diese haben große Bedeutung in der Herstellung von Alltagsprodukten wie Mobiltelefonen und Autos.
Neben Ruanda hat die EU weitere Abkommen über nachhaltige Rohstoffwertschöpfungsketten mit anderen afrikanischen Ländern unterzeichnet. Am 26. Oktober 2023 kam ein Abkommen mit der DR Kongo und Sambia zustande, mit Namibia am 8. November 2022.
Als die EU das Abkommen mit Ruanda unterzeichnete, stellten kongolesische Staats- und Regierungschefs und NGOs die Legitimität eines solchen Bündnisses infrage. Sie verwiesen auf die Probleme im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit Mineralien aus der DR Kongo und dem Transit durch Ruanda.
Während eines Live-Austauschs mit Reportern des nationalen Fernsehsenders RTNC Ende Februar kritisierte der Präsident der DR Kongo, Felix Tshisekedi, das EU-Ruanda-Abkommen. Die Vorwürfe lauteten: Ruanda plündere die Bodenschätze des Kongo und exportiere Reichtum, über den das Land selbst nicht verfüge. Ruanda fördert im Land Zinn, Tantalum und Tingsten. Nach dem Tourismus ist der Export von Rohstoffen Ruandas wichtigster Wirtschaftsfaktor.
Tshisekedi warf Ruanda außerdem vor, die Rebellengruppe M23 zu unterstützen. Diese verübt weiter im Osten des Kongos regelmäßig Angriffe. Der illegale Verkauf kritischer Mineralien ermögliche es Ruanda, seine Armee aufzurüsten und die DR Kongo weiter zu destabilisieren.
Auch der kongolesische Gynäkologe und Friedensnobelpreisträger von 2018, Denis Mukwege, veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er das Abkommen zwischen der EU und Ruanda kritisierte. In einer Erklärung, die seine Organisation Panzi Foundation veröffentlichte, rügte er die EU, im Widerspruch zu ihren eigenen Grundwerten – der Förderung von Frieden und Menschenrechten – zu handeln.
Ruandas Präsident Paul Kagame weist Vorwürfe, die M23-Rebellen zu unterstützen, konsequent zurück. Umgekehrt wirft Ruanda der DR Kongo vor, die Rebellengruppe FDLR zu unterstützen, zu deren Mitgliedern mutmaßliche Täter des Völkermords in Ruanda von 1994 gehören.
Im Jahr 2021 hat die EU eine Verordnung verabschiedet, die dazu beitragen soll, den Handel mit Mineralien aus politisch instabilen Regionen zu stoppen. Grund ist, dass dieser zur Finanzierung bewaffneter Gruppen, zur Förderung von Zwangsarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen genutzt werden kann. Außerdem kann der Handel von Konfliktmineralien Korruption und Geldwäsche unterstützen. Die Verordnung deckt hauptsächlich vier Mineralien ab – Zinn, Tantal, Wolfram und Gold – und soll sicherstellen, dass europäische Unternehmen diese aus verantwortungsvollen Quellen beziehen.
Doch trotz der Bemühungen der EU und anderer internationaler Organisationen zur Gewährleistung der Verantwortung in den Lieferketten des Bergbaus ist der illegale Handel mit Konfliktmineralien dadurch nicht endgültig besiegt. Besonders in Krisengebieten wie dem Osten der DR Kongo wird mit Konfliktmineralien weiter gehandelt.
Der Kampf gegen den illegalen Handel mit Mineralien bleibt eine große Herausforderung, um nachhaltige Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor zu gewährleisten. Es ist nahezu unmöglich sicherzustellen, dass die importierten kritischen Mineralien aus einer konfliktfreien Wertschöpfungskette stammen.
Die EU könnte jedoch zumindest einen Beitrag leisten, indem sie für eine transparente und verantwortungsvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure sorgt. Dies bedeutet auch, die lokalen Zusammenhänge stärker zu berücksichtigen und eine weitere Eskalation der Spannungen zwischen der DR Kongo und Ruanda zu verhindern.
Der Oppositionsführer Bassirou Diomaye Faye ist überraschend als Wahlsieger aus der Präsidentschaftswahl im Senegal hervorgegangen. Am späten Montagabend hat sich Faye bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Wahlen für eine Stärkung der Ecowas ausgesprochen.
“Ich rufe unsere afrikanischen Brüder und Schwestern dazu auf, gemeinsam die Errungenschaften zu festigen, die wir durch die regionale Integration in der Ecowas gewonnen haben“, sagte Faye am Montag auf einer Pressekonferenz in Dakar. “Dabei sollten wir gleichzeitig ihre Schwächen ausgleichen und bestimmte Methoden, Strategien und politische Prioritäten ändern.” Er werde sich außerdem für die Einheit und den politischen sowie wirtschaftlichen Zusammenhalt in ganz Afrika einsetzen, so Faye weiter.
Der Senegal wählte am Sonntag mit gut einem Monat Verspätung einen neuen Staatspräsidenten, nach einer schweren politischen Krise, die seit mehr als einem Jahr andauerte. Das Land grenzt an den Sahel und hat enge wirtschaftliche, historische, ethnische und kulturelle Beziehungen in die Region, besonders zu seinem östlichen Nachbarland Mali. 1959/1960 waren die beiden Länder sogar kurzzeitig in einem gemeinsamen Staat, der Mali-Föderation, vereint. Vor gut zwei Monaten traten Mali, Burkina Faso und Niger aus der Ecowas aus. Zuvor hatten diese drei Länder einen neuen Staatenbund geschlossen.
In seiner gut zehnminütigen Ansprache auf Französisch – die er anschließend in der Landessprache Wolof wiederholte – betonte Faye am Montag die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft. “Der Senegal wird immer seinen Platz behaupten. Er bleibt ein befreundetes Land und ein sicherer und verlässlicher Verbündeter für alle Partner, die sich mit uns in für eine tugendhafte, respektvolle und beiderseits produktive Zusammenarbeit einsetzen.”
Faye war für die verbotene Partei Pastef angetreten und gilt als frankreich-kritisch. Allerdings betonte er schon vor den Wahlen, dass er mit Frankreich gute Beziehungen pflegen wolle, trotz schwieriger Aspekte. Frankreichs Präsident Emanuel Macron gratulierte Faye am späten Montagabend zu seinem Wahlsieg auf der Plattform X, sowohl auf Französisch als auch auf Wolof.
Der 44 Jahre alte Faye ist ein politischer Newcomer und arbeitete bisher in der Steuerverwaltung. Er gilt als konservativer Muslim und ist mit zwei Frauen verheiratet. Im muslimisch geprägten Senegal ist Polygamie erlaubt. Im Wahlkampf hatte sich Faye als “Kandidat für den Systemwechsel” und als Vertreter eines “linken Panafrikanismus” bezeichnet. Im Senegal hat der Panafrikanismus eine lange Tradition. So war der 1986 verstorbene Historiker und Anthropologe Cheikh Anta Diop ein gemäßigter Führer dieser Bewegung.
Faye will die nationale “Souveränität” im Senegal wiederherstellen, die Korruption bekämpfen, den Wohlstand im Land gerechter verteilen und die Verträge über Bergbau und die Nutzung kürzlich entdeckter Erdöl- und Gasvorkommen vor der Küste neu verhandeln.
Der künftige Präsident hat laut dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission 53,7 Prozent der Stimmen gewonnen und sich damit deutlich gegen seinen Hauptkonkurrenten Amadou Ba von der Regierungsmehrheit durchgesetzt. Ba vereinte nur 36,2 Prozent der Stimmen auf sich. Die Angaben beruhen auf einer Auszählung von 90 Prozent der Wahlbüros. Ba erkannte seine Niederlage an und gratulierte Faye, ebenso wie der scheidende Präsident Macky Sall. Laut internationalen und nationalen Beobachtern (EU, AU, Ecowas, COSCE) verliefen die Wahlen frei und fair.
Nach Angaben des zivilgesellschaftlichen Bündnisses COSCE lag die Wahlbeteiligung bei 61,6 Prozent der 7,3 Millionen Wahlberechtigten. 2019 hatten 66,2 Prozent der Wähler ihr Wahlrecht wahrgenommen. Endgültige Ergebnisse werden bis spätestens Freitag erwartet. Die Amtsübergabe von Macky Sall auf Faye könnte schon Ende dieser Woche geschehen. lcw
Die KfW will über verschiedene Ansätze innerhalb der Bankengruppe mehr privates Kapital in die Finanzierung ihres Förderauftrags einbinden. Die KfW selbst macht dies, indem sie sich verstärkt an Verbriefungen privater Fonds und Banken beteiligt. Auf diese Weise will die KfW einen Beitrag dazu leisten, dass sich dieser Markt wieder in Europa etabliert.
“Angesichts enger fiskalischer Spielräume ist die weitere Mobilisierung privaten Kapitals zentral für uns”, sagte der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels bei der Vorlage des Jahresergebnisses der KfW. Die staatliche Förderbank wolle sich stärker am Markt für Verbriefungen engagieren, auch um die Bilanzen der Geschäftsbanken zu entlasten. Das setze allerdings voraus, dass bei den Banken im Voraus der Kreditschöpfungsprozess ordentlich gelaufen sei.
Vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 seien die Verbriefungsmärkte in den USA und Europa in etwa gleichauf gelegen, führte Finanzvorstand Bernd Loewen aus. Heute mache der europäische Markt nur noch rund zehn Prozent des amerikanischen Marktes aus. Verbriefungsinstrumente wie Collateralized Debt Obligations (CDO) oder Mortgage Backed Securities (MBS) sind im Zuge ihres Beitrags zum Ausbruch der damaligen Finanzkrise besonders in Europa in Diskredit geraten.
Allerdings ist die Aufsicht über diese Instrumente in den USA und der EU seitdem verschärft worden. Auch wurden bestimmte, besonders risikoreiche Konstruktionen untersagt. Heute ist nach Meinung Loewens allerdings die Finanzaufsicht in der EU über Verbriefungen zu restriktiv. Die Regulierung in Europa sei zu komplex, sagte Loewen. Die Dokumentationsanforderungen seien zu hoch. Auch dürften Verbriefungen bei den Anforderungen an die Kapitalunterlegung nicht penalisiert werden. Durch ihre verstärkte Beteiligung an Verbriefungen will die KfW auch dazu beitragen, dass sich dieses Kapitalmarktsegment wieder in Europa etabliert.
Auch die DEG Invest, eine Konzerngesellschaft der KfW, mobilisiert stärker privates Kapital, um ihre Förderziele in der Privatwirtschaft zu erreichen. So gelang es ihr im vergangenen Jahr 613 Millionen Euro privates Kapital in ihre Projekte einzubinden. Dies kam zum eigenen Fördervolumen von 1,9 Milliarden Euro hinzu. Das war ein höherer Anteil als im Jahr 2022. Damals stand einem Fördervolumen von 1,6 Milliarden Euro privates Kapital von 487 Millionen Euro gegen. Somit ist der Anteil privaten Kapitals am addierten Fördervolumen von 23,3 Prozent im Jahr 2022 auf 24,4 Prozent im Jahr 2023 gestiegen. Die DEG Invest wolle künftig noch mehr privates Kapital für ihre Projekte mobilisieren, kündigte Roland Siller, der Vorsitzende der DEG-Geschäftsführung an.
Die Ertragsrechnung der KfW-Bankengruppe war im vergangenen Jahr auch dadurch belastet, dass die DEG Invest die höheren Zinsen an den internationalen Kapitalmarkt nicht immer in vollem Umfang an ihre Kreditnehmer weitergereicht hat. Diese Finanzierungen werden laut Loewen in der Regel variabel vereinbart. Angesichts der Belastungen aus dem höheren Zinsniveau hätten Kunden die DEG gebeten, auf Zinsmarge zu verzichten. “Damit wollten wir in diesen Ländern die gestiegenen Zinsen zumindest teilweise abfedern”, sagte Loewen. hlr
In einem internen Schreiben an die Unionsfraktion mahnen der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Hermann Gröhe und der entwicklungspolitische Sprecher Volkmar Klein zu mehr Sachlichkeit in der Debatte um Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit. In dem Schreiben, das Table.Briefings exklusiv vorliegt, beziehen sich Gröhe und Klein unter anderem auf die Debatte um “Radwege in Peru“.
Auf der Plattform X hatte CSU-Generalsekretär Martin Huber mehrere Projekte der Entwicklungszusammenarbeit aufgeführt und diese in den Kontext der Bauernproteste gestellt. Huber hatte kritisiert, die Ampelkoalition verteile Geld in aller Welt, könne aber gleichzeitig offenbar die Bauern im eigenen Land nicht entlasten. Auch innerhalb der Ampelregierung hatte es im Rahmen der Haushaltsdebatten Kritik von der FDP am Einsatz von EZ-Mitteln gegeben. Angesichts des Sparkurses der Ampel infolge des Verfassungsgerichtsurteils zum Nachtragshaushalt 2021 musste das BMZ eine Haushaltskürzung von knapp einer Milliarde Euro hinnehmen.
In dem Rundschreiben hieß es nun, das mit 20 Millionen Euro geförderte Entwicklungsprojekt in Peru sei noch vom unionsgeführten BMZ bewilligt worden. Die AfD hatte in der Debatte offenbar fälschlich von einer Unterstützung von 315 Millionen Euro gesprochen. Auch das BMZ hatte 20 Millionen Euro an zugesagten Zuschüssen bestätigt.
Angesichts der Unionsdebatte um eine strategische Neuausrichtung der EZ wiesen Gröhe und Klein in ihrem Schreiben auf die Bedeutung der EZ für die “internationale Handlungsfähigkeit Deutschlands” hin. “Inaktivität im Krisenfall, zum Beispiel bei Ernährungssicherheit, kann weitere illegale Migrationsbewegung auslösen”, heißt es in dem Papier weiter. Dies sei auch Hintergrund der Flüchtlingsbewegung 2015 gewesen. Zudem diene die EZ häufig als “Türöffner für die deutsche Wirtschaft”. In Zeiten der globalen Systemkonkurrenz mit China, Russland aber auch den Golfstaaten sei die deutsche internationale Präsenz und das Werben für ein liberales Weltbild umso wichtiger. dre
Deutschland will seine Hochschulkooperationen mit Südafrika ausbauen. BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring hat sich dafür in der vergangenen Woche in Pretoria mit dem stellvertretenden Forschungsminister Buti Manamela getroffen. Dabei ging es laut einer Sprecherin des BMBF unter anderem um die Einrichtung des DAAD-Fachzentrums für Ernährungssysteme und Agrar- und Ernährungsdatenwissenschaft. Daneben eröffnete die Staatssekretärin gemeinsam mit dem südafrikanischen Minister für Höhere Bildung, Wissenschaft und Technologie Blade Nzimande die “German Research Days” im Rahmen des zwanzigjährigen Jubiläums des African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Kapstadt.
Vor rund einem Jahr war bereits Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger nach Südafrika und Namibia gereist. Damals hatte die Ministerin mit Nzimande eine Absichtserklärung über die Einrichtung eines Forschungslehrstuhls im Bereich “Just Energy Transition” unterzeichnet. Dem Ministerium zufolge seien nun die Gespräche zur Umsetzung des Vorhabens fortgeführt worden.
Darüber hinaus habe es weitere Gespräche bezüglich es geplanten Beitritts Deutschlands zum Square Kilometre Array Observatory (SKAO) gegeben. SKAO ist eine internationale Organisation mit Sitz in Großbritannien und Standorten in Südafrika und Australien. Die Radioteleskop-Netzwerke stellen Forschern detailliertere Informationen über das Weltall zur Verfügung. Die Netzwerke sollen bei der Erforschung von dunkler Materie, der Entstehung von Galaxien sowie der Suche nach außerirdischen Lebensformen unterstützen. Das Bundeskabinett hatte den Deutschen Beitritt zu SKAO Ende 2023 beschlossen. dre
Afrika nimmt beim neuesten Weltglücksbericht mittlere bis untere Positionen ein. Die fünf glücklichsten Länder auf dem Kontinent sind demnach Libyen (globaler Platz 66), Mauritius (70), Südafrika (83), Algerien (85) und die Republik Kongo (89). Trotz Herausforderungen wie Stromausfall, Korruption und Kriminalität konnte sich Südafrika verbessern. Aber die untersten Plätze belegen fast nur afrikanische Nationen: Botsuana (137), Simbabwe (138), die DR Kongo (139), Sierra Leone (140) und Lesotho (141). Nur der Libanon und Afghanistan schneiden noch schlechter ab. Die weltweite Ungleichheit des Glücklichseins, so eine Kernaussage des Berichts, hat in den vergangenen 12 Jahren um 20 Prozent zugenommen, vor allem zu Ungunsten von Sub-Sahara Afrika.
Der 2024 World Happiness Report wurde am Weltglückstag vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Wissenschaftler des amerikanischen Gallop-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Oxford Wellbeing Research Centre und den Vereinten Nationen untersuchen alljährlich in rund 140 Ländern die Selbsteinschätzung der Menschen zu ihrer Lebenszufriedenheit. In die Bewertung fließen Daten wie Lebenserwartung, BIP, wirtschaftliche Stellung, aber auch persönliche Einschätzung von Korruption oder Freiheit ein. Wie schon zuvor belegen die nordischen Länder die Spitzenpositionen, mit Finnland auf dem ersten Platz. Deutschland fiel aus den Top-20 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt heraus und rutschte auf Platz 24 hinter die USA, die ebenfalls Federn ließen. Zum ersten Mal wurden für den Bericht altersspezifische Umfragen angewendet. John F. Helliwell, Professor an der Vancouver School of Economics und Mitherausgeber des Berichtes, erkennt große Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich des Glücks der jüngeren und älteren Bevölkerung: “Daher sind die globalen Glücksrankings für Jung und Alt recht unterschiedlich, und zwar in einem Ausmaß, das sich in den letzten zwölf Jahren stark verändert hat.” as
Digitale Nomaden haben Afrika entdeckt. Aufgrund der immer besseren Internetverbindungen, attraktiven und kostengünstigen Destinationen, rückt der Kontinent immer mehr ins Visier von flexiblen Freiberuflern. Diese brauchen zum Arbeiten nur schnelles Internet. Sie profitieren von “Digitial Nomad Visa”-Programmen, mit denen verlängerte Arbeitsaufenthalte von sechs bis zwölf Monaten erlaubt werden.
In Afrika bieten bisher vier Länder diese Visa, die in Europa weitverbreitet sind, an: die Kapverdischen Inseln, die Seychellen, Mauritius und Namibia. Mauritius war das erste Land auf dem Kontinent, dass im Oktober 2020 die Erleichterung der Einreise für digitale Nomaden ankündigte. Südafrika soll noch in diesem Jahr folgen. Den Ländern geht es vor allem darum, gut ausgebildete Menschen mit Einkommen ins Land zu locken. Sie sollen Geld in die lokale Wirtschaft pumpen und möglicherweise weitere Investitionen nach sich ziehen. “Um in einer sich ständig veränderten Weltwirtschaft erfolgreich zu sein, braucht unser Land weit mehr Menschen mit den richtigen Fähigkeiten”, sagte kürzlich der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. Er will die Visabestimmungen erleichtern und Unternehmertum fördern, etwa in der Tech-Industrie, die von einer innovativen Startup-Szene angetrieben wird. Im Land am Kap finden sich günstige Lebenshaltungskosten und ein hoher Freizeitwert.
Genau das ist es, was Europäer anzieht, denen eine Work-Life-Balance wichtig ist. Die Kapverdischen Inseln vor der Küste von Westafrika haben alles, wovon Besucher träumen können: Gutes Wetter, Sehenswürdigkeiten und eine lebendige Kultur. Die Seychellen im Indischen Ozean östlich von Afrika preisen sich als Inselgruppe mit tiefblauem Meer, unberührten Stränden und einem kulturellen Schmelztiegel an. Namibia im Südwesten von Afrika wirbt mit atemberaubenden Landschaften, beeindruckender Tierwelt und ausgezeichneter Infrastruktur. Und der Inselstaat Mauritius vor Ostafrika präsentiert sich als “beruhigend, euphorisch, neugierig, abenteuerlustig”.
Eine Gemeinsamkeit haben alle fünf Länder: Sie sind wirtschaftliche und politische Vorreiter in Afrika und wollen Investitionen anlocken. “Wir wollten Namibia als einen großartigen Ort zum Leben, Arbeiten und Investieren positionieren”, so Margareth Gustavo vom Namibia Investment Promotion Development Board über das Digital-Nomad-Visum. as

Der Mangel an Fachkräften in Deutschland ist alarmierend: Gemäß dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fehlen derzeit 630.000 Fachkräfte. Im vierten Quartal 2023 blieben insgesamt 1,725 Millionen Stellen unbesetzt. Besonders in Bereichen wie der Altenpflege dauert es im Durchschnitt 251 Tage, bis Stellen besetzt werden. Zusätzlich waren im Jahr 2022 fast die Hälfte aller Unternehmen von Fachkräftemangel betroffen, was einen bisherigen Höchststand darstellt.
Um dieser Situation entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung im Jahr 2023 das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung verabschiedet. Das Gesetz hatte zum Ziel, ein Signal der Willkommenskultur und der Wertschätzung gegenüber Fachkräften zu senden. Die entscheidende Frage, die wir uns nun stellen müssen, lautet: Werden die durch das Gesetz eingeführten Änderungen ausreichen, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern?
Die Entscheidung für einen bestimmten Migrationsort wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel bevorzugen potenzielle Migrantinnen Länder, in denen sie bereits bestehende familiäre Verbindungen haben. Andererseits können einige Migrantinnen und Migranten ihre Entscheidung aufgrund der gebotenen Chancen in den Zielländern treffen. Die OECD-Indikatoren für die Attraktivität von Talenten (ITA) messen seit 2019 die Fähigkeit der Länder, qualifizierte Migranten anzuziehen und zu halten. Die ITA-Daten für hochqualifizierte Arbeitskräfte zeigen, dass Deutschland derzeit nicht zu den Ländern gehört, die ein besonders attraktives Rahmenwerk bieten.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat die OECD auch den Werdegang von hochqualifizierten Personen verfolgt, die als Arbeitsmigranten und -migrantinnen nach Deutschland kommen wollten. Die OECD-Studie zeigte, dass es nur wenigen Menschen, die im Ausland leben und Interesse haben, nach Deutschland zu migrieren, innerhalb eines Jahres gelingt, dies zu tun. Potenzielle Migranten schätzen insbesondere die guten Arbeits- und Karrierechancen sowie die Sicherheit in Deutschland, klagen jedoch gleichzeitig über die langen Wartezeiten für ein Visum und die komplizierten Verfahren. Viele potenzielle Migrantinnen und Migranten würden sich auch mehr Unterstützung bei der Arbeitssuche und dem Erlernen der deutschen Sprache wünschen. Diskriminierung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da eine große Anzahl potenzieller Migranten glaubt, dass sie in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden.
Ein Wort taucht immer wieder in Debatten über Fachkräftemangel und Migration auf: Komplexität. Migrantinnen und Migranten beklagen sich über ein System, das sehr schwierig zu navigieren ist. Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen wollen, verstehen die Regulierungen nicht, die sie umsetzen müssen, und finden auch keine Ansprechpartner in den Institutionen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Migrationsverwaltungen (z.B. Ausländerbehörden) leiden unter Gesetzen und Verordnungen, die sich ständig ändern.
Wir hatten noch nie ein so komplexes Migrationssystem in Deutschland, und die neue Komplexität der Regulierungen bringt uns nicht weiter. Wir müssen versuchen, die Komplexität des Systems zu reduzieren. Zum Beispiel durch weniger und klarere Zugangswege (allgemeines Visum mit weniger Anforderungen) oder durch eine stärkere Zentralisierung der Verwaltung.
Laut dem Rassismus-Monitor, veröffentlicht vom DeZIM-Institut im Jahr 2023, sind Diskriminierungserfahrungen allgemein weitverbreitet. Das kann Deutschland sich nicht leisten, wenn wir Fachkräfte aus dem Ausland anziehen wollen. Deutschland muss seine Integrationspolitik verbessern, interkulturelle Kompetenzen am Arbeitsplatz fördern, und eine ernsthafte Strategie gegen Diskriminierung und Rassismus entwickeln.
Um meine ursprüngliche Frage zu beantworten, ob die durch das Gesetz eingeführten Änderungen ausreichen, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern, lautet meine Antwort: nur teilweise. Das neue Gesetz bringt positive Veränderungen mit sich, aber es adressiert nicht die strukturellen Probleme wie die Komplexität des Systems (tatsächlich verschlimmert es die Situation) oder die schwache deutsche Willkommenskultur.
Dennoch ist in den letzten Jahren etwas sehr Positives passiert: Immer mehr Akteure haben erkannt, dass die Perspektive der Migranten im Mittelpunkt jeder Lösung stehen muss. Es geht nicht nur darum, “Make it Germany” (wie das Portal der Regierung für potenzielle Migranten heißt), sondern auch darum, wie “Germany makes it”.
Dr. Pau Palop-García ist Politikwissenschaftler und Migrationsforscher mit Spezialisierung auf Migrationspolitiken und der politischen Repräsentation von Migrant*innen in transnationalen Räumen. Er forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin.
Stiftung Wissenschaft und Politik: Wie weiter in der Sahelpolitik? Die Militärregime in Mali, Burkina Faso und Niger stellen Deutschland und die EU vor Zielkonflikte und Dilemmata. Der Klärungsbedarf besteht laut SWP vor allem in der Frage, welche Probleme und Ziele vorrangig sein sollen. Unter dem AU-Vorsitz Mauretaniens, das nicht Mitglied der Ecowas ist, ergeben sich möglicherweise neue Spielräume für afrikanische Vermittlungsversuche.
L’Économiste: Die marokkanische Börsenaufsicht legt ihre neue Strategie vor. Die Börse Casablanca soll sich künftig um vier Themenfelder herum entwickeln: Effizienz, Marktzugang, Verbreiterung der Investorenbasis und Diversifizierung der Finanzinstrumente. Das geht aus der neuen Strategie 2024 bis 2028 hervor, die die Börsenaufsicht AMMC vorgelegt hat.
Financial Times: EU plant Unterstützung für Tunesien, um Migration zu begrenzen. Über drei Jahre will die EU insgesamt knapp 165 Millionen Euro für tunesische Sicherheitskräfte bereitstellen, die die Migration über das Mittelmeer begrenzen sollen. NGOs und Menschenrechtsgruppen protestieren, da auch Sicherheitskräfte profitieren könnten, die in rechtswidrige Verhaftungen und Abschiebungen von Migranten von europäischem Geld profitieren könnten.
The East African: Ruanda und Tansania wollen neuen Grenzübergang eröffnen. Mit einem neuen Grenzübergang soll der Warenverkehr zwischen Ruanda und Tansania gefördert werden, sagte der tansanische Außenminister January Makamba in Ruanda. Zudem soll der bestehende Übergang Rusumo entlastet werden.
Bloomberg: 50-Milliarden-Dollar-Rettung aus UAE macht Ausmaß ägyptischer Wirtschaftskrise deutlich. Bloomberg analysiert die Auswirkung des finanziellen Rettungsschirms aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die kriselnde Wirtschaft Ägyptens. Trotz der Finanzspritze müssen sich die Ägypter auf weiter steigende Preise einstellen.
The Economist: Nigerias Ölindustrie ist auf dem absteigenden Ast. Nachdem Ölriese Shell seine nigerianische On-Shore-Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company (SPCD) an ein lokales Konsortium verkauft hat, zeigt sich der Absturz der nigerianischen Ölindustrie. Auch Total hat angekündigt, seine Anteile an SPDC zu veräußern.
FAZ: Der Westen als Täter. Mit dem Verhältnis zwischen Postkolonialismus und Antisemitismus beschäftigt sich Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Er bemängelt, dass die postkolonialistischen Ansätze wenig zur Analyse der nichtwestlichen Kultur beitragen. Auch hebt er hervor, wie viel der Westen bei allen Widersprüchlichkeiten an emanzipativen Fortschritten in Bezug auf Frauen- und Minderheitenrechte erreicht habe.
Stiftung Wissenschaft und Politik: Machtbeziehungen in Sudan nach dem Fall Bashirs. Seit einem Jahr währt schon der Bürgerkrieg im Sudan, ein Konflikt, den der Krieg in der Ukraine und der in Gaza überdeckt. Viele internationale und sudanesische Bemühungen krankten daran, dass sie entweder nur auf Einbindung oder nur auf Ausschluss der Sicherheitskräfte abstellten. Ein neuer Elitendeal allein mit Sudans Gewaltunternehmern wird keinen Frieden bringen, solange keine zivilen Kräfte am Tisch sitzen, lautet das Fazit der Studie.

Auf dem felsigen Untergrund am Meer in einem Vorort des schmucken Städtchens Hermanus südöstlich von Kapstadt, war am Wochenende noch etwas Blut zu sehen. Hier wurde Markus Jooste, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Steinhoff International Holdings, vergangenen Donnerstag mit einer tödlichen Schussverletzung aufgefunden. Vieles spricht für Selbstmord, doch das wurde noch nicht zweifelsfrei ermittelt. Jemand hatte vergeblich versucht, die Spuren mit Sand zu überdecken. Ein Anwohner, wenngleich bestürzt über das tragische Ende des Top-Managers, bezeichnete Jooste als “arrogante Person”. Der 63-Jährige verstarb kurz nach seiner Ankunft in einer Privatklinik. Niemand legte Blumen vor sein Haus.
Der mutmaßliche Suizid von Markus Jooste war das zweite einschneidende Ereignis innerhalb einer Woche im Rahmen des größten Unternehmensskandals in der Geschichte Südafrikas, bei dem 6,5 Milliarden Euro veruntreut wurden. Der Fall reicht bis nach Deutschland. Bruno Steinhoff hatte das Möbelunternehmen im 1964 in seinem Geburtsort Westerstede im Ammerland gegründet. Bis im vergangenen Jahr waren die Aktien von Steinhoff International in Frankfurt börsennotiert.
Einen Tag vor seinem Ableben war der ehemalige Konzernchef Jooste zusammen mit seinem europäischen Finanzvorstand, Dirk Schreiber, zu einer Rekordstrafe von umgerechnet 23 Millionen Euro von der Finanzaufsichtsbehörde FSCA verurteilt worden, zu zahlen innerhalb eines Monats: ein tiefer Fall des ehemaligen, äußerst erfolgreichen Managers, der den Ruf hatte, gewinnbringende Unternehmen zu erkennen, wo andere kein Potenzial sahen. Jooste wurde damit reich, 2015 schätze Forbes sein Vermögen auf 370 Millionen Euro.
Der Manager war ein Pferdenarr und hatte zwischenzeitlich die zweitgrößte Sammlung von Rennpferden in der Welt. Er konnte Mitarbeiter begeistern und mit sich ziehen. Andere warfen ihm Manipulation und Größenwahn vor. Die Stricke hielt Jooste immer in der Hand. Noch vor zwei Jahren war Steinhoff das siebtgrößte Unternehmen in Afrika, größer als der Bergbauriese Anglo American Platinum. Aber schon Jahre zuvor hatte das Imperium zu bröckeln begonnen.
Lange konnte Jooste die sich häufenden Misserfolge übertünchen. Steinhoff schrieb zunehmend rote Zahlen. Er ließ Gewinne von Tochterunternehmen künstlich in die Höhe treiben. Er deckte die Verluste mit fiktiven Transaktionen. So verschleierte er ein Minus 1,5 Milliarden Euro. Ende 2017 kam der Bilanzskandal des Konzerns ans Licht. Jooste habe “falsche und irreführende” Aussagen in den Geschäftsberichten von 2015 bis 2017 gemacht, lautete der Vorwurf.
Der Steinhoff-Konzern hat seinem Ursprung in der deutschen Möbelindustrie in Westerstede bei Oldenburg, gegründet von Bruno Steinhoff. Dieser baute die Firma mit Möbelimporten aus dem damaligen Ostblock auf. Dann expandierte er nach Südafrika.
Nach einem Studium an der Stellenbosch University bekam Jooste 1988 bei Steinhoff einen Job. Zwei Jahre nachdem der Konzern in Johannesburg an die Börse gegangen war, wurde Jooste im Jahr 2002 der CEO des Unternehmens. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen zu einem Großkonzern. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg Steinhoff in Europa zum zweitgrößten Möbelhändler nach Ikea auf. In Deutschland gehörten dem Unternehmen die Poco-Billigmöbelmärkte. Mitte 2015 wurde die Hauptbörsennotierung vom Johannesburg nach Frankfurt verlegt. Die Zentrale blieb in Südafrika.
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte schon im Dezember 2015 die Fahnder zur europäischen Tochtergesellschaft von Steinhoff geschickt. Tage später ging Steinhoff International an die Börse in Frankfurt. “Börsengang ohne Chef”, schrieb damals das Handelsblatt, denn Markus Jooste kam nicht, wegen “Nackenschmerzen”, und ließ per Pressemitteilung verkünden: “Heute ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte von Steinhoff. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse zusammen mit einer Zweitnotierung an der Börse in Johannesburg wird das internationale Profil der Gruppe stärken.”
Wenige Monate später kaufte der Steinhoff-Chef den amerikanischen Matratzenhändler Mattress Firm zum Preis von 2,2 Milliarden Euro. Die verlustreiche Übernahme brachte den Konzern zu Fall, auch wenn Jooste noch ein Jahr nach diesem Zukauf auf einen “Game Changer” hoffte. Im Dezember 2017 tauchten dann Ungereimtheiten in den Büchern des Konzerns auf. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte weigerten sich, die Geschäftsberichte abzuzeichnen. Unter Druck gab Markus Jooste Regelverstöße zu, sprach von “einigen großen Fehlern”. Er trat als CEO zurück. In kurzer Zeit verlor die Steinhoff-Aktie in Südafrika mehr als 90 Prozent an Wert und vernichtete Kapital von umgerechnet rund zehn Milliarden Euro an der Börse von Johannesburg.
Am größten Unternehmensbetrug Südafrikas verloren Großaktionäre, darunter der Government Employees Fund (GEPF), Afrikas größter Pensionsfonds, riesige Beträge. Auch an der Frankfurter Börse sackten die Wertpapiere um 60 Prozent ab. Steinhoff beauftragte Wirtschaftsprüfer von PwC, die Bilanzen des Unternehmens zu untersuchen. 14 Monate später legten diese einen 7000 Seiten langen Bericht vor, der unter Verschluss blieb. Steinhoff veröffentlichte lediglich eine elfseitige Übersicht. Die fehlenden Finanzberichte legte der strauchelnde Konzern erst Mitte 2019 vor.
Bereits 2020 wurde Jooste zu einer Strafe von rund acht Millionen Euro verurteilt, doch er kämpfte hart und schaffte es, dass diese auf eine Million Euro reduziert wurde. Seit seinem Abgang mied er die Öffentlichkeit, hüllte sich meist in Schweigen, und beteuerte, dass er von Unregelmäßigkeiten nichts wusste. Es dauerte weitere zwei Jahre, bis die südafrikanische Zentralbank alle mit Jooste verbundenen Vermögen einfrieren ließ, darunter ein exklusives Weingut und der Familienbesitz von geschätzten rund 50 Millionen Euro.
Auch in Deutschland schritten die Ermittlungen weiter voran. 2022 verhängte die Finanzaufsicht Bafin in Frankfurt eine Rekordbuße von 11,29 Millionen Euro gegen Steinhoff wegen Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten. Das Landgericht Oldenburg begann im April 2023 der Prozess gegen Steinhoff. Jooste erschien nicht, und Deutschland stellte einen Haftbefehl gegen ihn aus. Vier Monate später gab es das erste Urteil im Prozess gegen Steinhoff: Zwei Ex-Manager wurden zu Haftstrafen verurteilt, darunter der ehemalige Europa-Finanzchef, Dirk Schreiber. Im Oktober vergangenen Jahres wurde Steinhoff schließlich liquidiert und von der Börse genommen.
In Südafrika wurde der Strick ebenfalls enger gezogen, auch wenn es sieben Jahre dauerte. Die National Prosecuting Authority (NPA) hatte ein Top-Team von Anwälten zusammengestellt und wollte Jooste und hochrangige Steinhoff-Manager diese Woche wegen Aktienkursmanipulation und Falschangaben in Jahresberichten anklagen. Einen Tag vor seinem mutmaßlichen Selbstmord sollte der Ex-Manager sich den Behörden stellen. “Er ergriff drastische Maßnahmen, wenn er in die Enge getrieben wurde und keinen Ausweg mehr sah”, erinnert sich Autor James-Brent Styan in der Sunday Times, der über den Steinhoffskandal ein Buch geschrieben hatte. Der Tod Markus Joostes kam einem Verfahren zuvor. Er hinterlässt seine Frau Ingrid und drei erwachsene Kinder. Andreas Sieren
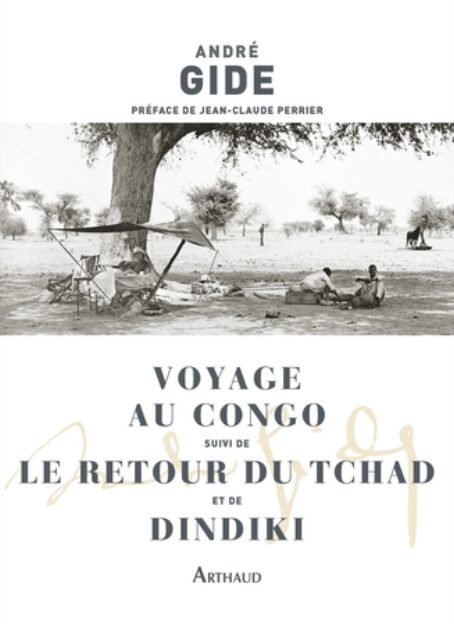
Fast hundert Jahre liegt die legendäre Reise des französischen Schriftstellers André Gide in den Kongo zurück. Trotz ihres Alters haben seine Aufzeichnungen kaum an Aktualität eingebüßt, so wenig, dass der französische Verlag Éditions Arthaud diese Tagebücher, mit bisher unveröffentlichten Dokumenten angereichert, neu editiert hat.
Von Juli 1926 bis Mai 1927 bereiste Gide Französisch-Äquatorialafrika. Von Kinshasa den Kongo flussaufwärts nach Coquilhatville, der heutigen Millionenstadt Mbandaka, dann nach Norden abbiegend nach Carnot in der heutigen Zentralafrikanischen Republik. Weiter ging die Reise in den Tschad, nach Bangui, Sarh, das damals Fort Archambault hieß, und Fort-Lamy, dem heutigen N’Djaména, der Hauptstadt des Tschad. Anschließend führte die Reise Gide durch Kamerun nach Douala an die Küste zurück.
Die Neuausgabe umfasst neben Voyage au Congo die Fortsetzungen Le Retour du Tschad und Dindiki. Lesenswert ist das fast 580 Seiten dicke Werk allein wegen der Präzision der Beobachtungen und der Aufrichtigkeit der Beschreibungen, die Gide liefert. Bemerkenswert ist auch, wie sich Gides Haltung zur Kolonialwirtschaft im Laufe seiner Reise verändert.
Das Buch Reise in den Kongo löste damals heftige Emotionen in Frankreich aus und zwang die Regierung sogar zu Reformen in der Kolonialverwaltung.
Gide, 1860 in eine puritanische protestantische Familie geboren, war einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts dank Werken wie La Symphonie pastorale oder Les Nourritures terrestres. 1947 erhielt er den Literaturnobelpreis, wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1951. Seine Tagebücher über seine Kongo-Reise haben ihn überdauert und bleiben ein literarisches Standardwerk über Afrika. hlr
André Gide: Voyage au Congo suivi de Le Retour du Tchad et de Dindiki. Édition enrichie de documents rares ou inédits. Neu herausgegeben von Jean-Claude Perrier. Éditions Arthaud, 2022. 576 Seiten. 28 Euro (in Frankreich).
