um Afrika herum scheint sich eine rege Gipfeldiplomatie entwickelt zu haben. Kurz nach der Brics-Konferenz und der Weltbanktagung reisten viele afrikanische Delegationen nach Peking zum Dritten Forum der Belt and Road Initiative, auch als die Neue Seidenstraße, bekannt. Andreas Sieren berichtet über diese Konferenz, die neue Akzente setzte.
Unterdessen ist Ägypten in Zahlungsnot geraten. Die Währungsreserven der Zentralbank genügen jedenfalls nicht, um die zahlreichen Auslandsanleihen zurückzuzahlen, die in den nächsten Monaten fällig werden. Zwar waren viele amerikanische und europäischen Politiker im Rahmen der neuen Nahostkrise in Kairo. Doch über Geld sprachen sie offenbar nicht. Ägypten bekommt Hilfe aus unerwarteten Quellen.
Auch neben diesen Berichten bieten wir Ihnen wieder eine breite Auswahl an Analysen, News, Porträts und einer internationalen Presseschau. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Alle wichtigen Volkswirtschaften aus Afrika waren vergangene Woche in China präsent, als der chinesische Präsident Xi Jinping die Meilensteine der ersten Dekade der Belt and Road Initiative (BRI) präsentierte. Während Chinas Beziehungen mit westlichen Staaten meist schwierig sind und diese die BRI kritisieren, suchten afrikanische Regierungen beim dritten BRI-Forum nach 2017 und 2019 die Nähe zu China.
Rund 130 hochrangige Staatsvertreter waren der Einladung Chinas gefolgt, darunter 23 Staatsoberhäupter oder Regierungschefs. Das war ein deutlicher Rückgang von 37 Top-Gästen im Vergleich zum Forum von 2019. Die afrikanischen Vertreter hingegen kamen in etwa gleicher Stärke:
Dies entsprach etwa der afrikanischen Repräsentation im Vergleich zum vergangenen Forum. Im Fall Europas ging die Teilnahme jedoch stark zurück. Von dort kamen nur zwei Staatsvertreter, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der serbische Präsident Aleksandar Vučić.
Das Forum zeigte, wie sehr China auf gute Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens setzt. Schon beim 15. Brics-Gipfel in Südafrika und dem G20-Gipfel in Indien in diesem Jahr machte die Regierung dies deutlich. Eigentlich stand bei der BRI, die Präsident Xi vor zehn Jahren in Kasachstan vorgestellt hatte, zunächst Zentralasien im Vordergrund. Doch inzwischen hat Peking mehr als 200 Kooperationsabkommen mit 150 Ländern und 30 internationalen Organisationen, vor allem in Afrika, unterzeichnet.
Forscher der US-amerikanischen Boston University schätzen, dass China zwischen 2013 und 2021 rund 331 Milliarden US-Dollar im Rahmen der BRI investiert hat. Sie betonen aber auch, dass zahlreiche Empfänger chinesischer Finanzmittel einer “erheblichen Schuldenkrise ausgesetzt sind”. Trotzdem unterstützte Peking laut einer Weltbankstudie die Schuldnerländer mit Finanzspritzen von 240 Milliarden US-Dollar zwischen 2008 und 2021.
So befindet sich Kenia in akuten Zahlungsschwierigkeiten. Derzeit schuldet Kenia China rund 6 Milliarden US-Dollar, was Präsident William Ruto zwang, die Staatsausgaben um 10 Prozent zu reduzieren. “Der größte Teil unserer Einnahmen wird für die Rückzahlung chinesischer Kredite verwendet, was nicht nachhaltig ist”, bemerkt Karuti Kanyinga, Professor an der University of Nairobi.
Mit chinesischen Krediten baute Kenia eine neue Eisenbahnlinie von Mombasa über Nairobi zum Rift Valley. Ursprünglich sollte die 4,7 Milliarden US-Dollar teure Bahnstrecke nach Uganda verlängert werden und weitere Binnenländer in Ostafrika anbinden. Allerdings nahm die Regierung in Kampala Abstand von China und setzte auf eine Partnerschaft mit der Türkei.
Ruto zählte zu den führenden afrikanischen Staatsoberhäuptern, die beim Belt and Road Forum anwesend waren. Er bat China um eine weitere Finanzspritze von 1 Milliarde US-Dollar und vereinbarte mit Xi Jinping die Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte aus Kenia, um nach Rutos Worten “den Abschluss von Infrastrukturprogrammen zu gewährleisten”.
Auch Brics-Neumitglied Äthiopien machen die Schulden gegenüber China zu schaffen. China war das erste Land, das Addis Abeba mehr Luft ließ. China verhandelt derzeit auch mit anderen Ländern in Afrika. “Das ist sehr ermutigend”, sagt Annalisa Fedelino, die stellvertretende Afrika-Chefin des US-dominierten IWF. Insgesamt spielt China jedoch eine geringere Rolle in Afrikas Schulden als gemeinhin angenommen. Nur 12 Prozent der afrikanischen Schulden kommen von Krediten aus China. Die meisten chinesischen Kredite in Afrika hat die China Eximbank gewährt.
China ist auch vorsichtiger bei der Kreditvergabe geworden. Während es 2016 noch 28 Milliarden US-Dollar jährlich waren, schrumpften die Kredite bereits 2019, also vor Covid und dem Ukrainekrieg, auf 7 Milliarden US-Dollar. “Es gibt keine Schuldenfallen bei der BRI”, fasst zum Beispiel Jean Louis Robinson, der Botschafter von Madagaskar in China, die Lage zusammen. Vielmehr böte die BRI “für manche Schwellenländer weiterhin große Möglichkeiten.”
Dass China in Afrika auch stark kulturpolitisch engagiert ist, zeigen zwei Studien, die das Ifa-Institut für Auslandsbeziehungen zu Wochenbeginn veröffentlicht hat. Diesen zufolge besteht eine Strategie Chinas darin, Kapazitäten zur Förderung von Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und als Partner für Entwicklung wahrgenommen zu werden. Dieser Logik folgend habe China kulturelle Initiativen innerhalb von Organisationen wie der Unesco gegründet. Gleichzeitig umgehe es diese und stärke eigenständige Vereinigungen wie BRI und Brics. Ziel der chinesischen Kulturdiplomatie sei es, eigene Narrative zu etablieren.
Fast zweieinhalbmal so viel Wald wurde 2022 in der Elfenbeinküste abgeholzt als noch im Jahr zuvor: Ein Sprung von 26.000 Hektar (2021) auf 62.000 Hektar, so stellte es kürzlich der Jahresbericht der UN-unterstützten Cocoa and Forests Initiative (CFI) fest. Worauf diese Trendumkehr zurückzuführen ist, werde noch untersucht, hieß es bei der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang des Monats.
Fest steht: Rund ein Jahr vor dem de facto Start der neuen EU-Gesetzgebung für abholzungsfreie Produkte ist das keine gute Nachricht. Noch bis Ende 2024 haben Unternehmen Zeit, die Regeln der neuen EU-Gesetzgebung in einer Übergangsphase zu implementieren. Schaffen die Firmen das nicht, drohen hohe Strafzahlungen auf ihre Produkte – was den Export in die EU unrentabel machen würde.
Derzeit ist die Elfenbeinküste mit einer durchschnittlichen Menge von 2 Millionen Tonnen Kakao der weltgrößte Produzent – und die EU ihr größter Abnehmer. Jedoch werden schätzungsweise 20 bis 30 Prozent des Kakaos illegal in geschützten Wäldern angebaut, oft werden Kinder zur Arbeit auf den Kakaoplantagen gezwungen.
EU-Kreise hegen nach Reuters-Recherchen die Befürchtung, dass die Elfenbeinküste auf keinem guten Weg ist, die neuen Umweltschutz-Regeln in der Kakaoproduktion umzusetzen. Offiziell hieß es nach einem Treffen von EU- und ivorischen Branchenvertretern in Brüssel Mitte September, alles sei in bester Ordnung.
In bester Ordnung ist in der nun angelaufenen Erntesaison allerdings wenig: Nach schlechtem Wetter rechnet der Generaldirektor des ivorischen Kaffee- und Kakaorats (Conseil du Café-Cacao, CCC) Yves Brahima Kone mit einem Einbruch bei den Mengen – zumindest am Anfang der Erntesaison.
Seit Juli wurden sogar die Terminverkäufe gestoppt. Man sei nicht sicher, die Nachfrage bedienen zu können, sagte Kone. Er hoffe auf einen Ausgleich durch die Erträge Anfang kommenden Jahres. Üblicherweise werden die Kakaobohnen ab Ende Oktober für den weltweiten Handel verschifft.
Manche Analysten schätzen, die Elfenbeinküste könnte den Druck auf die EU durch die ausgesetzten Kakao-Lieferungen erhöhen, um mehr EU-Subventionen für den Anbau von nachhaltigem Kakao herauszuschlagen. Die Frage ist, wer am Ende für den fairen Schokoriegel draufzahlt.
Auch wenn der Kakaopreis auf einem Hoch und seit dem letzten Jahr um rund 46 Prozent gestiegen ist, zeigen sich die Erzeuger mit dem aktuellen Abnahmepreis für ihren Rohstoff unzufrieden. Dieser stieg um rund 11 Prozent für die aktuelle Kakao-Saison – von 900 Francs CFA (umgerechnet etwa 1,40 Euro) auf 1000 Francs CFA (etwa 1,50 Euro) pro Kilo.
Die ivorische Plattform für nachhaltigen Kakao (Plateforme ivoirienne pour le cacao durable) hatte sich für einen Erzeugerpreis von 1300 Francs CFA (etwa 2 Euro) pro Kilo eingesetzt. Für die Menschen, die Kakao anbauten, bliebe so gut wie nichts übrig nach Abzug aller Kosten, vor allem da die Preise für Lebensmittel und den täglichen Bedarf so stark gestiegen seien, hieß es in einer Stellungnahme.
Der Druck auf das Kakaogeschäft in der Elfenbeinküste ist also hoch. Sollte das aufstrebende westafrikanische Land es nicht schaffen, die Regeln für nachhaltigen Anbau rechtzeitig umzusetzen, droht es einen großen Kunden zu verlieren – und die EU ihren wichtigsten Lieferanten. Europäische Unternehmen dürfte das mit Blick auf das lukrative Weihnachtsgeschäft nervös machen.
Langfristig könnte das eine lose-lose-Situation für alle Beteiligten werden: Die Elfenbeinküste, die rund 15 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes durch den Kakao erwirtschaftet, riskiert ihren Status als Weltmarktführer und eine wichtige Einkommensquelle für die Bevölkerung. Und die EU ihren politischen Anspruch als transformative Kraft für eine klimafreundlichere Weltwirtschaft.
Im Bereich der europäischen Investoren, die in Afrika Gutes mit Rendite verknüpfen wollen, zählt die Fondsgesellschaft Goodwell Investments in Amsterdam bereits zu den größeren. Rund 400 Millionen Euro verwaltet Goodwell in verschiedenen Fonds, die ausschließlich auf der Basis von Eigenkapital arbeiten, ohne das eingesammelte Kapital durch Darlehen von Banken zu hebeln.
Das ist nicht schlecht für einen Fonds, der sich auf Early-Stage-Investments konzentriert. Goodwell investiert in junge Unternehmen, die schon die ersten Schritte nach der Gründung hinter sich gebracht haben und erste Umsätze erzielen. “Die Unternehmer sollen gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, Freunde und Familienmitglieder von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen”, sagt Els Boerhof. Sie leitet zusammen mit dem Goodwell-Gründer Wim van der Beek die Fondsgesellschaft.
Wenn die Unternehmen die Hürden vor einer Investition genommen haben, kann Goodwell mit einem Investment in Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro in Ostafrika, oder höher (500.000 US-Dollar) in West- oder Südafrika einsteigen. In rund 40 Unternehmen ist Goodwell investiert, davon rund 30 in Afrika und etwa zehn in Indien, wo Goodwell nach der Gründung 2006 die ersten Beteiligungen einging.
“Unsere Investoren, das sind hauptsächlich private Anleger”, sagt Boerhof. Allerdings sind dies keine Kleinanleger, sondern selbst erfolgreiche Unternehmer, die ihr Vermögen meist über ein Family Office verwalten. Doch auch einige institutionelle Investoren zählen zu den Geldgebern von Goodwell. In Deutschland zählt etwa der Rückversicherer Hannover Rück dazu. Auch die KfW unterstützte Goodwell zu Beginn.
Wie viele Fondsinvestoren aus Europa knüpft Goodwell seine Beteiligungen an Unternehmen, die sich den ESG-Zielen verpflichten und mit ihrem Unternehmen die Gesellschaften in Afrika in sozialer oder umweltpolitischer Hinsicht voranbringen wollen. So konzentrierte sich Goodwell zunächst auf das Thema Finanzinklusion und investierte in Mikrofinanz- oder Fintech-Unternehmen, die Bankdienstleistungen für Menschen ohne Bankkonto anbieten. Dann weitete Goodwell seine Investments auf Landwirtschaft, Ernährung, Mobilität und Logistik aus.
Gleichzeitig erfüllen die Anlagevehikel die Kriterien, die institutionelle Investoren typischerweise von Early-Stage-Investments fordern: Sie haben eine Laufzeit von zehn Jahren, auch wenn diese Vorgabe für Afrika in der Regel zu kurz ist. Und Goodwell stellt eine Rendite von 15 Prozent jährlich in Aussicht, gemessen nach der Methode des internen Zinsfußes (IRR). Auch Fonds, die sich auf eine soziale oder ökologische Mission verpflichten, müssen in Afrika mindestens einen zweistelligen IRR erreichen, um den Risikoaufschlag für Investments in Afrika, vor allem in Early-Stage-Unternehmen, zu rechtfertigen.
Mit diesem Ansatz und dem starken Fokus auf Finanzinklusion schließt Goodwell eine Lücke. Zu den großen Impact-Investoren in Deutschland zählt beispielsweise Finance in Motion in Frankfurt. Doch dieser Investor hat für den Finanzsektor in Afrika nur den Sanad-Fonds im Angebot, der allerdings neben dem Nahen Osten nur in Nordafrika investiert und sich beim Thema Finanzinklusion auf Osteuropa und den Kaukasus beschränkt.
Am nächsten kommen Goodwell vielleicht noch LGT Capital Investing der Liechtensteiner Bank LGT und der Luxembourg Microfinance and Development Fund (LMDF), der mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank in Mikrofinanzinstitute in Schwellenländern investiert.
Doch im Vergleich zum LMDF ist der Goodwell-Ansatz breiter, da die Niederländer beispielsweise auch in Fintech-Unternehmen wie Paga in Nigeria investiert sind. Paga ist auf den Online-Zahlungsverkehr spezialisiert, ohne dass die Kunden zwingend ein Bankkonto besitzen müssen.
Als Nächstes will Boerhof den Versicherungsmarkt angehen. Besonders bei Krankenversicherungen sieht sie großen Bedarf. “Aber das wird eine besonders harte Nuss, die wir dann zu knacken haben”, räumt die Fondsmanagerin ein. Denn gerade die Versicherungsbranche habe bei den afrikanischen Verbrauchern viel Vertrauen verspielt, weil die Versicherer entweder keine angemessenen Lösungen anbieten oder nicht halten, was sie versprechen.
Eine der größten Volkswirtschaften auf dem afrikanischen Kontinent ist in Zahlungsnot geraten: In Ägypten werden in den kommenden zwölf Monaten fällig Anleihen von umgerechnet 47 Milliarden Dollar. Dieser Betrag übersteigt jedoch die Währungsreserven der Zentralbank. Somit wird Ägypten die zur Zurückzahlung anstehenden Anleihen nur zurückzahlen können, wenn es der Regierung gelingt, internationale Investoren für neue Investments zu gewinnen. Dabei kann sie bisher nicht auf Hilfe aus dem Westen hoffen. Private Investoren aus Europa und Nordamerika halten sich zurück, da sie eine Abwertung des ägyptischen Pfund befürchten. Anfang März hatte die Zentralbank zwar den Wechselkurs bei 30,90 Pfund für einen US-Dollar festgezurrt. Doch nach den Präsidentschaftswahlen Mitte Dezember droht eine Währungsabwertung von mehr als zehn Prozent.
Nun sucht Ägypten anderswo Unterstützung, um den drohenden Zahlungsausfall abzuwenden. So könnte nun China einspringen. Am Donnerstag vergangener Woche haben die beiden Regierungen eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über einen Schulden-Swap für Entwicklungsprojekte unterzeichnet. Der ägyptische Premierminister Mostafa Madbouly war in der vergangenen Woche zu Gesprächen nach Peking gereist und traf dort auch den Präsidenten Xi Jinping.
Wenige Tage zuvor hatte Ägypten erstmals einen in chinesischen Yuan denominierten Panda-Bond mit dreijähriger Laufzeit über umgerechnet 479 Millionen Dollar begeben. Die Anleihe trägt einen jährlichen Kupon von 3,5 Prozent. Der Zinssatz ist damit laut Finanzminister Mohamed Maait günstiger als der Zins, den Ägypten für eine Dollar-Anleihe zahlen müsste. Im vergangenen Monat vereinbarte Ägypten mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Währungsswap über 1,3 Milliarden Dollar. Im August begab die Regierung in japanischen Yen fünfjährige Samurai-Anleihen im Volumen von umgerechnet 500 Millionen Dollar.
Ägyptens Auslandsschulden haben sich in den vergangenen acht Jahren vervierfacht und lagen Ende März bei 11,8 Milliarden Dollar. Somit begannen die Schuldenprobleme Ägyptens lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Am 20. November wird eine Euro-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Dollar fällig. hlr
Ende Oktober reisen sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Afrika. Wie das Bundespresseamt am Freitag bekannt gab, will der Kanzler Afrikas größte Volkswirtschaft Nigeria sowie Ghana besuchen. Die Reise ist vom 29. bis zum 31. Oktober 2023 geplant. Für den Kanzler ist es nach Besuchen im Senegal, Niger und Südafrika 2022 und in Kenia und Äthiopien 2023 bereits die dritte Reise als Regierungschef auf den Nachbarkontinent.
Bei seinem Besuch wird sich der Kanzler zu Gesprächen mit den Staatspräsidenten Nigerias, Bola Tinubu, und Ghanas, Nana Akufo-Addo, treffen. Zudem steht ein Gespräch mit dem Präsidenten der Ecowas-Kommission, Omar Touray, auf dem Programm. Die Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas leitet den Vermittlungsprozess mit der Militärjunta im Niger, die im Juli die Macht in dem westafrikanischen Land übernommen hat. Auf der Reise des Kanzlers nach Westafrika soll neben dem Ausbau der bilateralen Beziehungen vor allem die regionale Sicherheit, Wirtschaftsentwicklung, aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands mit den westafrikanischen Staaten im Mittelpunkt stehen.
Einen Tag nach dem Kanzler beginnt Bundespräsident Steinmeier eine fünftägige Reise nach Tansania und Sambia (30. Oktober bis 5. November). Letzteres wird zum ersten Mal von einem deutschen Staatsoberhaupt besucht. Neben den Gesprächen mit Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan und Sambias Präsident Hakainde Hichilema liegt der Fokus der Reise dabei vor allem auf den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen der beiden Länder mit Deutschland. In Tansania trifft sich der Bundespräsident unter anderem mit Vertretern der deutschen und tansanischen Wirtschaft und besucht ein Zementwerk. Zudem ist ein Treffen mit Unternehmern aus der Start-up-Szene Tansanias geplant.
In Sambia besichtigt Steinmeier die Fountain Gate Crafts and Trades-School, an der auch die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main beteiligt ist. Weitere Themen der Reise soll die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit in Tansania sowie der Naturschutz in Sambia sein.
Begleitet werden Scholz und Steinmeier von Wirtschaftsdelegationen, denen jeweils rund 10 Unternehmen angehören, wie es aus Wirtschaftskreisen hieß. Den Kanzler sollen demnach unter anderem Vertreter von Siemens, Thyssen Krupp und DHL begleiten. dre
Unterstützung durch Entwicklungshilfe kann irreguläre Migration allenfalls vorübergehend senken. In den instabilsten Ländern wirkt sie zu diesem Zweck überhaupt nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Demnach senkten Hilfszahlungen zwar kurzzeitig die Migration von Asylsuchenden. In einem durchschnittlichen Herkunftsland mit einer durchschnittlichen jährlichen Entwicklungshilfezahlung von 130 Millionen Dollar stellen die Autoren eine vorübergehende Reduktion der Asylerstanträge um 8 Prozent fest. Der dämpfende Effekt verschwinde jedoch bereits nach zwei Jahren. Darüber hinaus sei die Entwicklungshilfe in Subsahara-Afrika zu diesem Zweck unwirksam und senke die Zahl der Asylsuchenden überhaupt nicht.
Entgegen einem scheinbaren Konsens unter politisch Verantwortlichen in den Industriestaaten stellen die Autoren der Studie fest, dass Entwicklungshilfe im Laufe der Zeit sogar zu einem Anstieg der regulären Migration führen kann. Sofern die Hilfszahlungen wichtige Migrationsursachen wie den Lebensstandard und das Einkommen der Menschen erhöhe, ermögliche dies in der Zukunft mehr Menschen, mit einem Arbeitsvisum, für das Studium oder die Familienzusammenführung zu migrieren.
Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass nur eine unrealistisch starke Erhöhung der Entwicklungshilfe einen Großteil der irregulären Migration verhindern würde. Entgegen den Vorstellungen politischer Entscheidungsträger sei Entwicklungshilfe kein Allheilmittel gegen Migration und sollte nicht überschätzt werden, meinen die Studienautoren.
“Das Problem ist komplex – und erfordert daher einen umfassenden, mehrschichtigen Ansatz”, sagt Tobias Heidland, Leiter des IfW-Forschungszentrums Internationale Entwicklung und Mitautor der Studie. Entwicklungshilfe sei nicht die Lösung. “Zäune zu bauen und Grenzen zu überwachen, wird irreguläre Migration ebenfalls nicht vollständig stoppen – insbesondere angesichts der Situation am Mittelmeer”. Seiner Auffassung nach müssten mehr Flüchtlingsschutz in der Nähe von Konfliktzonen geboten und gleichzeitig die Anreize für irreguläre Migration gesenkt werden. “Stattdessen sollten wir dafür mehr legale Kanäle öffnen.” ajs
Afrika benötigt zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund 194 Milliarden Dollar jährlich, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030 zu erreichen. Dies geht aus einem neuen Report der OECD mit dem Titel “Africa’s Development Dynamics 2023” hervor, der in der vergangenen Woche im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin vorgestellt wurde. Demnach fehlen afrikanischen Staaten insgesamt 1,6 Billionen Dollar zur Erreichung der SDGs.
Die zunächst gigantisch wirkende Summe entspricht nur etwa 0,2 Prozent der globalen Finanzanlagen. Laut den Autoren des Reports ist die Finanzierungslücke damit überbrückbar. Dafür müssten jedoch Verbesserungen in drei Schlüsselbereichen vorangetrieben werden:
Im Anschluss an die Vorstellung der Studie diskutierte die Direktorin des OECD Development Centre, Ragnheiður Elín Árnadóttir, die wichtigsten Erkenntnisse des Reports mit einem international besetzen Panel. Sie betonte dabei unter anderem das große Potenzial der unzureichend genutzten afrikanischen Institutionen zur Entwicklungsfinanzierung. Auch eine verbesserte Datenlage halte sie für vielversprechend. Bienvenue Angui, Geschäftsführerin der Stiftung Greentec Capital Africa, beklagte hingegen die Voreingenommenheit der internationalen Ratingagenturen. Investoren seien besser beraten, sich an lokale afrikanische Ratingagenturen zu wenden, die die tatsächlichen Risiken viel genauer bewerten könnten. ajs
Amazon hat angekündigt, 2024 in den südafrikanischen Markt einzusteigen. Für den US-amerikanischen Handelsgiganten ist Südafrika nach Ägypten erst das zweite Land in Afrika, in dem es eine lokale Präsenz aufbaut. Nigeria hat Amazon ebenfalls im Visier. Dort könnte Amazon auf internationale Konkurrenz stoßen: Elon Musk will gemeinsam mit Jumia den Onlinehandel in Westafrika aufrollen.
Der Onlinehandel wuchs 2022 in Südafrika um 35 Prozent, laut einer Studie von World Wide Worx und Mastercard. Er macht derzeit allerdings erst 4,7 Prozent des Einzelhandels aus. In Deutschland ist der Anteil mehr als doppelt so hoch. In den USA liegt der Wert sogar bei mehr als 20 Prozent. Derzeit dominieren in Südafrika Unternehmen wie Takealot, Makro oder Bob Shop den Onlinehandel. Marktführer Takealot, das dem südafrikanischen Medienkonzern Naspers gehört, schreibt allerdings auch nach zehn Jahren rote Zahlen und erlitt im vergangenen Geschäftsjahr einen herben Verlust von umgerechnet 20 Millionen Euro. Zudem wird das Unternehmen von der südafrikanischen Wettbewerbskommission angehalten, den “Marketplace”, der nach einer im August veröffentlichen Studie viele Händler benachteiligt, vom Kerngeschäft zu trennen.
In den USA sieht sich Amazon ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt und wird sich wohl auch am Kap mit dem Thema beschäftigen müssen. Amazon hat angekündigt, dass die eigenständigen Kleinhändler in Südafrika im Zentrum des Angebots stehen werden. Es wird politisch nicht einfach sein, Amazon auf dem Markt zu etablieren, ohne die strauchelnden lokalen Anbieter in Not zu bringen. Gleichzeitig muss die Regierung an die Konsumenten denken. Eine große Herausforderung sind derzeit die schwächelnde Wirtschaft und die steigenden Lebenshaltungskosten, die den Konsumenten zu schaffen machen und den Einzelhandel unter Druck setzen. Deswegen wird der Preis der Produkte entscheidend dafür sein, ob Amazon sich in dem neuen Markt etablieren kann.
Amazon will in Südafrika auch seinen “Marketplace” aufmachen, auf dem externe lokale Anbieter ihre Produkte anbieten können. Über den “Marketplace” wickelt Amazon 60 Prozent seines Geschäftes ab und stellt hierzu die Internetplattform sowie die Logistik für die Lieferung bereit. Am Kap würden sich so für einheimische Händler neue Marktchancen ergeben. “Wir freuen uns darauf, Amazon.co.za in Südafrika zu starten und lokalen Verkäufern, Markeninhabern und Unternehmern die Möglichkeit zu bieten, ihr Geschäft mit Amazon auszubauen und Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein bequemes Einkaufserlebnis zu bieten”, sagte der General Manager für Amazon Subsahara Afrika, Robert Koen.
Vielen Unternehmen gilt Südafrika als Brückenkopf, von dem aus weitere Märkte in der Region erschlossen werden. Der Onlinehandel erreichte in Afrika 2021 einen Umsatz von 38 Milliarden US-Dollar und soll sich bis 2025 verdoppeln, so Statista. Die wichtigsten Länder sind Ägypten, Kenia, Nigeria und Südafrika. Amazon wird auch seinen “Prime”-Schnelllieferservice anbieten wie auch den Streamingdienst “Prime Video”, den Amazon als Konkurrenz zu Netflix und Showmax entwickelt hat. as

Als die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Welt vom 9. bis 15. Oktober in Marrakesch, Marokko, zur Jahrestagung von Weltbank und IWF zusammenkamen, erörterten sie ein breites Spektrum von Reformen des globalen Finanzsystems. Dazu gehören etwa die Umstrukturierung von Schulden, die Umwidmung von Sonderziehungsrechten (der “Währung” des IWF, die von den Mitgliedern gehalten wird) und die Aufstockung des Kapitals der multilateralen Entwicklungsbanken, damit diese mehr vergünstigte Kredite vergeben können. Diese Reformen sind für Afrika unerlässlich, um die Schuldenkrise zu überwinden, in Gesundheit und Bildung zu investieren und eine Agenda für grünes Wachstum zu verfolgen.
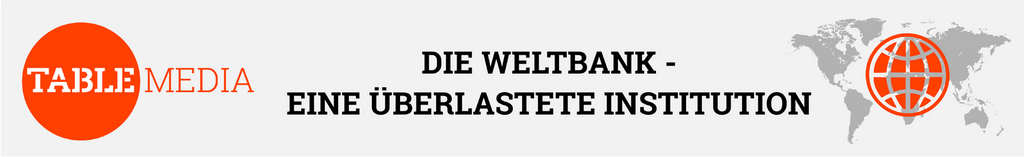
Es ist nicht das erste Mal, dass solche Reformen auf globaler Ebene ins Rampenlicht gerückt werden. Der italienische G20-Vorsitz setzte 2021 ein unabhängiges Gremium zur Überprüfung der Kapitaladäquanz der multilateralen Entwicklungsbanken ein. Der daraufhin erstellte Bericht bildete die Grundlage für die Forderung der US-Finanzministerin Janet Yellen nach Reformen der multilateralen Entwicklungsbanken. Im selben Jahr gründete die Premierministerin von Barbados Mia Mottley die Bridgetown-Agenda als Plattform, um sich für Änderungen im globalen Finanzwesen einzusetzen, insbesondere für klimagefährdete Staaten. Auch andere Staats- und Regierungschefs haben sich bemüht, wie etwa der französische Präsident Emmanuel Macron. Er organisierte im Juli 2023 ein Gipfeltreffen, das dazu beitrug, die Spannungen zwischen den Ansätzen der Klima- und Entwicklungsfinanzierung zu beseitigen.
Die Reform der globalen Finanzarchitektur ist komplex und sehr technisch. Es handelt sich um ein Thema, das nicht unbedingt die Aufmerksamkeit der führenden Politiker auf der ganzen Welt auf sich zieht und das Wählern und Gesetzgebern nur schwer zu vermitteln ist. Aber es handelt sich nicht einfach um technische Fragen, die ohne politischen Druck gelöst werden können.
Hier geht es um Leben und Tod, um Gerechtigkeit und Würde, um Frieden und Sicherheit, von denen Hunderte von Millionen Menschen in Afrika und darüber hinaus betroffen sind. Kostengünstige Finanzierungen für ärmere Länder sind in einer Zeit zurückgegangen, in der ihr Bedarf aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds, der Versorgungsprobleme, der steigenden Lebensmittelpreise und der steigenden Zinssätze größer geworden ist als zuvor.
Doch der Wandel vollzieht sich nicht schnell genug. Die Reformen werden durch politische Herausforderungen auf nationaler und globaler Ebene gebremst. So sind sich beispielsweise China und andere Länder uneinig darüber, wie die Umstrukturierung der Schulden armer Länder koordiniert werden soll. Die Regeln der Europäischen Zentralbank hindern die EU-Länder daran, ihre Sonderziehungsrechte an afrikanische Finanzinstitute weiterzuleiten. Und die Dysfunktion im US-Kongress wird wahrscheinlich einen erheblichen Beitrag zu einer Kapitalerhöhung der Weltbank blockieren. Indes sorgen Russlands Krieg in der Ukraine, Naturkatastrophen, das anhaltend niedrige globale Wirtschaftswachstum und der Krieg im Nahen Osten dafür, dass die begrenzten Ressourcen und die Aufmerksamkeit weiter aufgeteilt werden.
Dies sind größtenteils politische Probleme, die politische Lösungen erfordern, aber es fehlt an politischen Vorkämpfern, die sich für die internationale Entwicklung einsetzen werden. Aus diesem Grund kamen die afrikanischen Finanzminister und andere Interessenvertreter in Marrakesch zusammen, um eine Erklärung zu unterstützen, die ihre wichtigsten Prioritäten für globale Reformen zusammenfasst und einen Handlungsrahmen für diese Reformen bietet.
Die Erklärung von Marrakesch ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Sie ist ein Instrument zur Mobilisierung von Unterstützung, Druck und Rechenschaftspflicht für eine globale Finanzreform, die Afrika zugute kommt, und wurde von politischen Instituten, Denkfabriken und bedeutenden Persönlichkeiten auf dem ganzen Kontinent befürwortet. Das African Center for Economic Transformation hat während des gesamten Jahres 2023 daran gearbeitet, die von den afrikanischen Staats- und Regierungschefs formulierten Prioritäten zusammenzutragen, die wichtigsten Handlungsbereiche zu ermitteln und Partner aus Regierungen, internationalen und regionalen Organisationen, Interessenvertretungen und der Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um einen gemeinsamen Weg zu finden.
In der Erklärung von Marrakesch wird zu Maßnahmen in fünf Bereichen aufgerufen:
Wenn die in der Erklärung von Marrakesch hervorgehobenen Prioritäten nicht angegangen werden, wird es unweigerlich zu weiterer Unsicherheit, Verschuldung und wirtschaftlichem Niedergang kommen – anstelle von wirtschaftlichem Wandel und Chancen für bessere Bildung, Gesundheit und Beschäftigung. Führende Persönlichkeiten – sowohl gewählte, als auch solche, die aufgrund ihrer Positionen in der Kunst, in religiösen Organisationen und in der Zivilgesellschaft eine Stimme haben – müssen vortreten, miteinander arbeiten und sich für diese Reformen einsetzen.
Rob Floyd ist Direktor für Innovation und Digitalpolitik beim Thinktank African Center for Economic Transformation (ACET) in Accra. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen für die Weltbank in Afrika tätig.
Weitere Artikel der Table.Media-Redaktion über die Weltbanktagung finden Sie hier.
African Business: Afrika im Visier von Indiens Großmachtstreben. Indiens Beziehungen zu Afrika sind in einer emotionalen gemeinsamen Geschichte verwurzelt. Doch da Indien sich zum Ziel gesetzt hat, die Supermacht des Jahrhunderts zu werden, werden Handel, Geschäftsbeziehungen und die Neugestaltung internationaler Institutionen im Mittelpunkt der künftigen Beziehungen stehen.
The East African: Kann eine Umschuldung Afrikas Probleme lösen? Afrikanische Finanzminister haben eine Reihe von Reformen der Bretton-Woods-Institutionen vorgeschlagen. Sie sollen den Liquiditätsbedarf des Kontinents und den Zugang zu billigeren, längerfristigen Darlehen verbessern. Die Weltbank scheint nach der Verabschiedung eines neuen Leitbilds entschlossen, diese Reformen durchzuführen.
Bloomberg: DP World wird Hafen von Daressalam betreiben. DP World erhielt den Zuschlag für den Betrieb eines Teils des tansanischen Hafens Daressalam und wird mehr als 250 Millionen Dollar in die Modernisierung der Anlage investieren. Das in Dubai ansässige Unternehmen weitet damit seine Präsenz in Ostafrika aus, wo es bereits von Somalia bis Mosambik vertreten ist.
Financial Times: Wie Südafrikas staatliches Eisenbahnnetz Transnet an den Rand des Abgrunds geriet. Ähnlich wie der staatliche Stromversorger Eskom leidet auch Transnet unter mutmaßlicher Korruption. Das Unternehmen wird von Vandalismus an Bahnstrecken, Kabeldiebstählen und Blockaden in Häfen heimgesucht. Die Krise hat Südafrikas wichtige Rohstoffexporte gebremst, Tausende von Arbeitsplätzen im Bergbau gefährdet und die dringend benötigten Steuereinnahmen beeinträchtigt.
Business Insider: Unesco genehmigt Wasserkraftwerk in der Nähe der Victoriafälle. Die Vereinten Nationen haben Sambia und Simbabwe die Erlaubnis erteilt, einen 5 Milliarden Dollar teuren Staudamm flussabwärts der zum Unesco-Welterbe gehörenden Victoriafälle zu bauen. Umweltschützer kritisieren das 2.400-Megawatt-Projekt, das nur 47 Kilometer vom größten Wasserfall der Welt entfernt liegt. Sie fürchten, der Damm könnte die in beiden Ländern als Touristenziel beliebten Wasserfälle beeinflussen.
The Economist: Wie Liberia und Sierra Leone den Kreislauf der Gewalt durchbrochen haben. Liberia und Sierra Leone sind arme, problembehaftete Länder mit wackligen Demokratien. Dennoch geht es beiden Ländern heute viel besser als vor 20 Jahren. Das Ausmaß der extremen Armut ist drastisch gesunken. Seit den Kriegen in der Region hat die Macht einmal in Liberia und zweimal in Sierra Leone friedlich zwischen rivalisierenden Parteien gewechselt.
Africa Intelligence: Nach dem Sturz Ali Bongos emanzipiert sich die Freimaurer-Loge. Seit 2009 stand der gestürzte Präsident von Gabun, Ali Bongo, der mächtigen Großen Loge der Freimaurer in Gabun vor. Nun wurde der Gouverneur von Haut-Ogooué, der Lehrer für Geschichte und Erdkunde Jacques-Denis Tsanga, zu Bongos Nachfolger gewählt. Diese Wahl zeige, dass auch nach dem Putsch der Einfluss des Politikers Lin Mombo auf die Politik im Land unverändert groß sei.

Eigentlich wollte Katrin Dietzold mit ihrem Mann nur nach Tansania auswandern. Jetzt bauen sie über ihre Gesellschaft CPS eine neue Stadt auf Sansibar. Dietzold steht auf der Dachterrasse ihres Büros und blickt hinab auf Fumba Town. 20 Kilometer südlich der sansibarischen Hauptstadt Zanzibar City soll hier bis 2036 eine Stadt entstehen, die Wohnraum für etwa 20.000 Menschen bietet.
Einen Bezug zu Tansania hat die Familie schon lange. “2002 haben wir angefangen, Sansibar zu entdecken und ein kleines Hostel-Backpacker-Projekt begonnen”, erzählt Dietzold. “Wir waren jedes Jahr mehrfach hier.” Im Jahr 2010 beschlossen Katrin Dietzold und ihr Mann, ihre Immobiliengesellschaft in Leipzig aufzugeben und in Tansania neu zu beginnen. Ein Projekt wie Fumba Town war aber gar nicht ihr Plan. “Wir kamen hierher, und uns wurde die Idee quasi nahegelegt, weil die Regierung in Sansibar schon seit den Neunzigern den Plan hatte, die wachsende Bevölkerung in Sansibar städtisch irgendwo aufzufangen”, sagt Dietzold. 2012 gründeten sie CPS mit Katrin Dietzold als COO und ihrem Mann Sebastian als CEO.
Weil die lokale Kaufkraft nicht reichte, um ein Großprojekt wie Fumba Town zu stemmen, verhandelte CPS mit der Regierung, dass erstmals auch Ausländer auf Sansibar Eigentum kaufen dürfen. “Was dann geschah, war für uns alle unvorhersehbar”, sagt Dietzold. “Mit einem Schlag wurde die internationale Gemeinschaft auf das Projekt aufmerksam.” Zunächst kauften Menschen aus dem Oman, die Wurzeln auf Sansibar haben. Inzwischen sind mehr als 1000 Einheiten verkauft, an Kunden aus mehr als 40 Ländern. “Leute aus der ganzen Welt kommen hierher und verbringen Zeit, investieren hier oder vermieten dauerhaft”, erzählt Dietzold.
2015 begann der Bau für Fumba Town. Heute sind zahlreiche Apartments bewohnt. Doch die ursprüngliche Zielgruppe, die Mittelklasse aus Sansibar, kann sich Fumba Town kaum leisten. Studio-Apartments starten aktuell bei knapp 40.000 US-Dollar. Dietzold und CPS haben das Problem erkannt und versuchen, die Preise niedrig zu halten. “Wir machen das nicht wegen des Geldes”, sagt Dietzold. “Wenn man es macht, weil man reich werden will, dann braucht man nicht kommen.”
Niedrigere Preise seien für ein wirtschaftlich profitables Unternehmen angesichts der hohen Baukosten und langen Bauzeiten nicht möglich. “Die Bauindustrie ist steckengeblieben, wo sie vor 500 Jahren war”, sagt Dietzold. “Wir müssen digitalisieren, wir müssen skalieren, wir müssen mit nachwachsenden Rohstoffen bauen.” Denn Dietzold will mit CPS nicht nur viel Wohnraum schaffen, sondern das auch möglichst nachhaltig und umweltschonend.
CPS arbeitet in Fumba Town an Lösungen. Das Unternehmen produziert die Holzelemente für die Häuser in einer eigenen Fabrik vor Ort und experimentiert mit neuen Holz- und Klebstoffarten, um die Produktionskosten langfristig zu reduzieren. “Das Ziel muss sein, dass wir eine Einheit für 5000 US-Dollar hinstellen können”, sagt Dietzold. “Das ist, was sich der Markt leisten kann. Das haben wir in Fumba Town natürlich nicht geschafft.”
Diese Marke von 5000 US-Dollar zu nehmen, ist Dietzolds großes Ziel. Denn der Bedarf für Wohnraum ist riesig. Die Bevölkerung im Westen Sansibars wächst um sieben Prozent im Jahr. “Immer mehr Menschen leben auf immer engerem Raum, aber dieser Markt ist nicht formalisiert. Was wir hier machen, ist ja im Prinzip der Versuch, dass man Wohnraum schafft, formalisierten Wohnraum schafft, der wirklich ordentlich mit Mietverträgen gestützt ist.”
Und dabei beschränkt sich Dietzold nicht auf Sansibar. Die Unternehmerin will über die CPS auch auf dem tansanischen Festland vergleichbare Bauprojekte starten – und vielleicht darüber hinaus. In der rasant wachsenden Hafenmetropole Daressalam ist der Bedarf besonders groß. Auch in der nördlichen Region um Arusha steigt die Bevölkerungszahl enorm. Dort wollen sich Katrin Dietzold und ihre Familie langfristig niederlassen. Julian Hilgers

In Afrika zählt sich die Dichte der Reichen in Tausendern. So lebten in Südafrika im vergangenen 37.800 High Net Worth Individuals (HNWI), knapp ein Drittel aller Dollar-Millionäre auf dem afrikanischen Kontinent. Dies geht aus dem 2023 Africa Wealth Report der Beratungsgesellschaft Henley & Partners hervor.
An zweiter Stelle folgt Ägypten mit 16.100 HNWIs, Nigeria belegt Platz drei mit 9.800 HNWIs. Insgesamt leben in Afrika 138.000 Dollar-Millionäre. Gemessen werden Nettovermögen, die sich aus Bargeld, Immobilien oder Geschäftsanteilen zusammensetzen. Verglichen mit 2020 hat die Anzahl der Reichen in Afrika um fast neun Prozent zugenommen.
Der reichste Unternehmer Afrikas ist Aliko Dangote aus Nigeria, der sein Geld mit Zement, Mehl und Zucker gemacht hat (13,5 Milliarden Dollar, Dangote Group). Ihm folgen Johann Rupert aus Südafrika (10,7 Milliarden Dollar, Richemont) und Nicky Oppenheimer (8,4 Milliarden Dollar, Anglo American).
Auf 2,4 Billionen Dollar summieren sich die Privatvermögen auf dem Kontinent. Auch hier liegt Südafrika vorne, gefolgt von Ägypten, Nigeria, Kenia und Marokko und Kenia. Die “Big Five” machen rund 50 Prozent des Privatvermögens in Afrika aus. In diesen Ländern leben auch 90 Prozent aller Milliardäre. Als aufstrebendes Land gilt Mauritius, wo innerhalb der kommenden Dekade Privatvermögen um 75 Prozent zulegen sollen. Schon jetzt ist es Spitzenreiter beim Durchschnittsvermögen in Afrika – mit beachtlichen 37.500 Dollar. as
um Afrika herum scheint sich eine rege Gipfeldiplomatie entwickelt zu haben. Kurz nach der Brics-Konferenz und der Weltbanktagung reisten viele afrikanische Delegationen nach Peking zum Dritten Forum der Belt and Road Initiative, auch als die Neue Seidenstraße, bekannt. Andreas Sieren berichtet über diese Konferenz, die neue Akzente setzte.
Unterdessen ist Ägypten in Zahlungsnot geraten. Die Währungsreserven der Zentralbank genügen jedenfalls nicht, um die zahlreichen Auslandsanleihen zurückzuzahlen, die in den nächsten Monaten fällig werden. Zwar waren viele amerikanische und europäischen Politiker im Rahmen der neuen Nahostkrise in Kairo. Doch über Geld sprachen sie offenbar nicht. Ägypten bekommt Hilfe aus unerwarteten Quellen.
Auch neben diesen Berichten bieten wir Ihnen wieder eine breite Auswahl an Analysen, News, Porträts und einer internationalen Presseschau. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Alle wichtigen Volkswirtschaften aus Afrika waren vergangene Woche in China präsent, als der chinesische Präsident Xi Jinping die Meilensteine der ersten Dekade der Belt and Road Initiative (BRI) präsentierte. Während Chinas Beziehungen mit westlichen Staaten meist schwierig sind und diese die BRI kritisieren, suchten afrikanische Regierungen beim dritten BRI-Forum nach 2017 und 2019 die Nähe zu China.
Rund 130 hochrangige Staatsvertreter waren der Einladung Chinas gefolgt, darunter 23 Staatsoberhäupter oder Regierungschefs. Das war ein deutlicher Rückgang von 37 Top-Gästen im Vergleich zum Forum von 2019. Die afrikanischen Vertreter hingegen kamen in etwa gleicher Stärke:
Dies entsprach etwa der afrikanischen Repräsentation im Vergleich zum vergangenen Forum. Im Fall Europas ging die Teilnahme jedoch stark zurück. Von dort kamen nur zwei Staatsvertreter, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der serbische Präsident Aleksandar Vučić.
Das Forum zeigte, wie sehr China auf gute Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens setzt. Schon beim 15. Brics-Gipfel in Südafrika und dem G20-Gipfel in Indien in diesem Jahr machte die Regierung dies deutlich. Eigentlich stand bei der BRI, die Präsident Xi vor zehn Jahren in Kasachstan vorgestellt hatte, zunächst Zentralasien im Vordergrund. Doch inzwischen hat Peking mehr als 200 Kooperationsabkommen mit 150 Ländern und 30 internationalen Organisationen, vor allem in Afrika, unterzeichnet.
Forscher der US-amerikanischen Boston University schätzen, dass China zwischen 2013 und 2021 rund 331 Milliarden US-Dollar im Rahmen der BRI investiert hat. Sie betonen aber auch, dass zahlreiche Empfänger chinesischer Finanzmittel einer “erheblichen Schuldenkrise ausgesetzt sind”. Trotzdem unterstützte Peking laut einer Weltbankstudie die Schuldnerländer mit Finanzspritzen von 240 Milliarden US-Dollar zwischen 2008 und 2021.
So befindet sich Kenia in akuten Zahlungsschwierigkeiten. Derzeit schuldet Kenia China rund 6 Milliarden US-Dollar, was Präsident William Ruto zwang, die Staatsausgaben um 10 Prozent zu reduzieren. “Der größte Teil unserer Einnahmen wird für die Rückzahlung chinesischer Kredite verwendet, was nicht nachhaltig ist”, bemerkt Karuti Kanyinga, Professor an der University of Nairobi.
Mit chinesischen Krediten baute Kenia eine neue Eisenbahnlinie von Mombasa über Nairobi zum Rift Valley. Ursprünglich sollte die 4,7 Milliarden US-Dollar teure Bahnstrecke nach Uganda verlängert werden und weitere Binnenländer in Ostafrika anbinden. Allerdings nahm die Regierung in Kampala Abstand von China und setzte auf eine Partnerschaft mit der Türkei.
Ruto zählte zu den führenden afrikanischen Staatsoberhäuptern, die beim Belt and Road Forum anwesend waren. Er bat China um eine weitere Finanzspritze von 1 Milliarde US-Dollar und vereinbarte mit Xi Jinping die Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte aus Kenia, um nach Rutos Worten “den Abschluss von Infrastrukturprogrammen zu gewährleisten”.
Auch Brics-Neumitglied Äthiopien machen die Schulden gegenüber China zu schaffen. China war das erste Land, das Addis Abeba mehr Luft ließ. China verhandelt derzeit auch mit anderen Ländern in Afrika. “Das ist sehr ermutigend”, sagt Annalisa Fedelino, die stellvertretende Afrika-Chefin des US-dominierten IWF. Insgesamt spielt China jedoch eine geringere Rolle in Afrikas Schulden als gemeinhin angenommen. Nur 12 Prozent der afrikanischen Schulden kommen von Krediten aus China. Die meisten chinesischen Kredite in Afrika hat die China Eximbank gewährt.
China ist auch vorsichtiger bei der Kreditvergabe geworden. Während es 2016 noch 28 Milliarden US-Dollar jährlich waren, schrumpften die Kredite bereits 2019, also vor Covid und dem Ukrainekrieg, auf 7 Milliarden US-Dollar. “Es gibt keine Schuldenfallen bei der BRI”, fasst zum Beispiel Jean Louis Robinson, der Botschafter von Madagaskar in China, die Lage zusammen. Vielmehr böte die BRI “für manche Schwellenländer weiterhin große Möglichkeiten.”
Dass China in Afrika auch stark kulturpolitisch engagiert ist, zeigen zwei Studien, die das Ifa-Institut für Auslandsbeziehungen zu Wochenbeginn veröffentlicht hat. Diesen zufolge besteht eine Strategie Chinas darin, Kapazitäten zur Förderung von Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und als Partner für Entwicklung wahrgenommen zu werden. Dieser Logik folgend habe China kulturelle Initiativen innerhalb von Organisationen wie der Unesco gegründet. Gleichzeitig umgehe es diese und stärke eigenständige Vereinigungen wie BRI und Brics. Ziel der chinesischen Kulturdiplomatie sei es, eigene Narrative zu etablieren.
Fast zweieinhalbmal so viel Wald wurde 2022 in der Elfenbeinküste abgeholzt als noch im Jahr zuvor: Ein Sprung von 26.000 Hektar (2021) auf 62.000 Hektar, so stellte es kürzlich der Jahresbericht der UN-unterstützten Cocoa and Forests Initiative (CFI) fest. Worauf diese Trendumkehr zurückzuführen ist, werde noch untersucht, hieß es bei der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang des Monats.
Fest steht: Rund ein Jahr vor dem de facto Start der neuen EU-Gesetzgebung für abholzungsfreie Produkte ist das keine gute Nachricht. Noch bis Ende 2024 haben Unternehmen Zeit, die Regeln der neuen EU-Gesetzgebung in einer Übergangsphase zu implementieren. Schaffen die Firmen das nicht, drohen hohe Strafzahlungen auf ihre Produkte – was den Export in die EU unrentabel machen würde.
Derzeit ist die Elfenbeinküste mit einer durchschnittlichen Menge von 2 Millionen Tonnen Kakao der weltgrößte Produzent – und die EU ihr größter Abnehmer. Jedoch werden schätzungsweise 20 bis 30 Prozent des Kakaos illegal in geschützten Wäldern angebaut, oft werden Kinder zur Arbeit auf den Kakaoplantagen gezwungen.
EU-Kreise hegen nach Reuters-Recherchen die Befürchtung, dass die Elfenbeinküste auf keinem guten Weg ist, die neuen Umweltschutz-Regeln in der Kakaoproduktion umzusetzen. Offiziell hieß es nach einem Treffen von EU- und ivorischen Branchenvertretern in Brüssel Mitte September, alles sei in bester Ordnung.
In bester Ordnung ist in der nun angelaufenen Erntesaison allerdings wenig: Nach schlechtem Wetter rechnet der Generaldirektor des ivorischen Kaffee- und Kakaorats (Conseil du Café-Cacao, CCC) Yves Brahima Kone mit einem Einbruch bei den Mengen – zumindest am Anfang der Erntesaison.
Seit Juli wurden sogar die Terminverkäufe gestoppt. Man sei nicht sicher, die Nachfrage bedienen zu können, sagte Kone. Er hoffe auf einen Ausgleich durch die Erträge Anfang kommenden Jahres. Üblicherweise werden die Kakaobohnen ab Ende Oktober für den weltweiten Handel verschifft.
Manche Analysten schätzen, die Elfenbeinküste könnte den Druck auf die EU durch die ausgesetzten Kakao-Lieferungen erhöhen, um mehr EU-Subventionen für den Anbau von nachhaltigem Kakao herauszuschlagen. Die Frage ist, wer am Ende für den fairen Schokoriegel draufzahlt.
Auch wenn der Kakaopreis auf einem Hoch und seit dem letzten Jahr um rund 46 Prozent gestiegen ist, zeigen sich die Erzeuger mit dem aktuellen Abnahmepreis für ihren Rohstoff unzufrieden. Dieser stieg um rund 11 Prozent für die aktuelle Kakao-Saison – von 900 Francs CFA (umgerechnet etwa 1,40 Euro) auf 1000 Francs CFA (etwa 1,50 Euro) pro Kilo.
Die ivorische Plattform für nachhaltigen Kakao (Plateforme ivoirienne pour le cacao durable) hatte sich für einen Erzeugerpreis von 1300 Francs CFA (etwa 2 Euro) pro Kilo eingesetzt. Für die Menschen, die Kakao anbauten, bliebe so gut wie nichts übrig nach Abzug aller Kosten, vor allem da die Preise für Lebensmittel und den täglichen Bedarf so stark gestiegen seien, hieß es in einer Stellungnahme.
Der Druck auf das Kakaogeschäft in der Elfenbeinküste ist also hoch. Sollte das aufstrebende westafrikanische Land es nicht schaffen, die Regeln für nachhaltigen Anbau rechtzeitig umzusetzen, droht es einen großen Kunden zu verlieren – und die EU ihren wichtigsten Lieferanten. Europäische Unternehmen dürfte das mit Blick auf das lukrative Weihnachtsgeschäft nervös machen.
Langfristig könnte das eine lose-lose-Situation für alle Beteiligten werden: Die Elfenbeinküste, die rund 15 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes durch den Kakao erwirtschaftet, riskiert ihren Status als Weltmarktführer und eine wichtige Einkommensquelle für die Bevölkerung. Und die EU ihren politischen Anspruch als transformative Kraft für eine klimafreundlichere Weltwirtschaft.
Im Bereich der europäischen Investoren, die in Afrika Gutes mit Rendite verknüpfen wollen, zählt die Fondsgesellschaft Goodwell Investments in Amsterdam bereits zu den größeren. Rund 400 Millionen Euro verwaltet Goodwell in verschiedenen Fonds, die ausschließlich auf der Basis von Eigenkapital arbeiten, ohne das eingesammelte Kapital durch Darlehen von Banken zu hebeln.
Das ist nicht schlecht für einen Fonds, der sich auf Early-Stage-Investments konzentriert. Goodwell investiert in junge Unternehmen, die schon die ersten Schritte nach der Gründung hinter sich gebracht haben und erste Umsätze erzielen. “Die Unternehmer sollen gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, Freunde und Familienmitglieder von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen”, sagt Els Boerhof. Sie leitet zusammen mit dem Goodwell-Gründer Wim van der Beek die Fondsgesellschaft.
Wenn die Unternehmen die Hürden vor einer Investition genommen haben, kann Goodwell mit einem Investment in Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro in Ostafrika, oder höher (500.000 US-Dollar) in West- oder Südafrika einsteigen. In rund 40 Unternehmen ist Goodwell investiert, davon rund 30 in Afrika und etwa zehn in Indien, wo Goodwell nach der Gründung 2006 die ersten Beteiligungen einging.
“Unsere Investoren, das sind hauptsächlich private Anleger”, sagt Boerhof. Allerdings sind dies keine Kleinanleger, sondern selbst erfolgreiche Unternehmer, die ihr Vermögen meist über ein Family Office verwalten. Doch auch einige institutionelle Investoren zählen zu den Geldgebern von Goodwell. In Deutschland zählt etwa der Rückversicherer Hannover Rück dazu. Auch die KfW unterstützte Goodwell zu Beginn.
Wie viele Fondsinvestoren aus Europa knüpft Goodwell seine Beteiligungen an Unternehmen, die sich den ESG-Zielen verpflichten und mit ihrem Unternehmen die Gesellschaften in Afrika in sozialer oder umweltpolitischer Hinsicht voranbringen wollen. So konzentrierte sich Goodwell zunächst auf das Thema Finanzinklusion und investierte in Mikrofinanz- oder Fintech-Unternehmen, die Bankdienstleistungen für Menschen ohne Bankkonto anbieten. Dann weitete Goodwell seine Investments auf Landwirtschaft, Ernährung, Mobilität und Logistik aus.
Gleichzeitig erfüllen die Anlagevehikel die Kriterien, die institutionelle Investoren typischerweise von Early-Stage-Investments fordern: Sie haben eine Laufzeit von zehn Jahren, auch wenn diese Vorgabe für Afrika in der Regel zu kurz ist. Und Goodwell stellt eine Rendite von 15 Prozent jährlich in Aussicht, gemessen nach der Methode des internen Zinsfußes (IRR). Auch Fonds, die sich auf eine soziale oder ökologische Mission verpflichten, müssen in Afrika mindestens einen zweistelligen IRR erreichen, um den Risikoaufschlag für Investments in Afrika, vor allem in Early-Stage-Unternehmen, zu rechtfertigen.
Mit diesem Ansatz und dem starken Fokus auf Finanzinklusion schließt Goodwell eine Lücke. Zu den großen Impact-Investoren in Deutschland zählt beispielsweise Finance in Motion in Frankfurt. Doch dieser Investor hat für den Finanzsektor in Afrika nur den Sanad-Fonds im Angebot, der allerdings neben dem Nahen Osten nur in Nordafrika investiert und sich beim Thema Finanzinklusion auf Osteuropa und den Kaukasus beschränkt.
Am nächsten kommen Goodwell vielleicht noch LGT Capital Investing der Liechtensteiner Bank LGT und der Luxembourg Microfinance and Development Fund (LMDF), der mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank in Mikrofinanzinstitute in Schwellenländern investiert.
Doch im Vergleich zum LMDF ist der Goodwell-Ansatz breiter, da die Niederländer beispielsweise auch in Fintech-Unternehmen wie Paga in Nigeria investiert sind. Paga ist auf den Online-Zahlungsverkehr spezialisiert, ohne dass die Kunden zwingend ein Bankkonto besitzen müssen.
Als Nächstes will Boerhof den Versicherungsmarkt angehen. Besonders bei Krankenversicherungen sieht sie großen Bedarf. “Aber das wird eine besonders harte Nuss, die wir dann zu knacken haben”, räumt die Fondsmanagerin ein. Denn gerade die Versicherungsbranche habe bei den afrikanischen Verbrauchern viel Vertrauen verspielt, weil die Versicherer entweder keine angemessenen Lösungen anbieten oder nicht halten, was sie versprechen.
Eine der größten Volkswirtschaften auf dem afrikanischen Kontinent ist in Zahlungsnot geraten: In Ägypten werden in den kommenden zwölf Monaten fällig Anleihen von umgerechnet 47 Milliarden Dollar. Dieser Betrag übersteigt jedoch die Währungsreserven der Zentralbank. Somit wird Ägypten die zur Zurückzahlung anstehenden Anleihen nur zurückzahlen können, wenn es der Regierung gelingt, internationale Investoren für neue Investments zu gewinnen. Dabei kann sie bisher nicht auf Hilfe aus dem Westen hoffen. Private Investoren aus Europa und Nordamerika halten sich zurück, da sie eine Abwertung des ägyptischen Pfund befürchten. Anfang März hatte die Zentralbank zwar den Wechselkurs bei 30,90 Pfund für einen US-Dollar festgezurrt. Doch nach den Präsidentschaftswahlen Mitte Dezember droht eine Währungsabwertung von mehr als zehn Prozent.
Nun sucht Ägypten anderswo Unterstützung, um den drohenden Zahlungsausfall abzuwenden. So könnte nun China einspringen. Am Donnerstag vergangener Woche haben die beiden Regierungen eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über einen Schulden-Swap für Entwicklungsprojekte unterzeichnet. Der ägyptische Premierminister Mostafa Madbouly war in der vergangenen Woche zu Gesprächen nach Peking gereist und traf dort auch den Präsidenten Xi Jinping.
Wenige Tage zuvor hatte Ägypten erstmals einen in chinesischen Yuan denominierten Panda-Bond mit dreijähriger Laufzeit über umgerechnet 479 Millionen Dollar begeben. Die Anleihe trägt einen jährlichen Kupon von 3,5 Prozent. Der Zinssatz ist damit laut Finanzminister Mohamed Maait günstiger als der Zins, den Ägypten für eine Dollar-Anleihe zahlen müsste. Im vergangenen Monat vereinbarte Ägypten mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Währungsswap über 1,3 Milliarden Dollar. Im August begab die Regierung in japanischen Yen fünfjährige Samurai-Anleihen im Volumen von umgerechnet 500 Millionen Dollar.
Ägyptens Auslandsschulden haben sich in den vergangenen acht Jahren vervierfacht und lagen Ende März bei 11,8 Milliarden Dollar. Somit begannen die Schuldenprobleme Ägyptens lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Am 20. November wird eine Euro-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Dollar fällig. hlr
Ende Oktober reisen sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Afrika. Wie das Bundespresseamt am Freitag bekannt gab, will der Kanzler Afrikas größte Volkswirtschaft Nigeria sowie Ghana besuchen. Die Reise ist vom 29. bis zum 31. Oktober 2023 geplant. Für den Kanzler ist es nach Besuchen im Senegal, Niger und Südafrika 2022 und in Kenia und Äthiopien 2023 bereits die dritte Reise als Regierungschef auf den Nachbarkontinent.
Bei seinem Besuch wird sich der Kanzler zu Gesprächen mit den Staatspräsidenten Nigerias, Bola Tinubu, und Ghanas, Nana Akufo-Addo, treffen. Zudem steht ein Gespräch mit dem Präsidenten der Ecowas-Kommission, Omar Touray, auf dem Programm. Die Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas leitet den Vermittlungsprozess mit der Militärjunta im Niger, die im Juli die Macht in dem westafrikanischen Land übernommen hat. Auf der Reise des Kanzlers nach Westafrika soll neben dem Ausbau der bilateralen Beziehungen vor allem die regionale Sicherheit, Wirtschaftsentwicklung, aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands mit den westafrikanischen Staaten im Mittelpunkt stehen.
Einen Tag nach dem Kanzler beginnt Bundespräsident Steinmeier eine fünftägige Reise nach Tansania und Sambia (30. Oktober bis 5. November). Letzteres wird zum ersten Mal von einem deutschen Staatsoberhaupt besucht. Neben den Gesprächen mit Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan und Sambias Präsident Hakainde Hichilema liegt der Fokus der Reise dabei vor allem auf den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen der beiden Länder mit Deutschland. In Tansania trifft sich der Bundespräsident unter anderem mit Vertretern der deutschen und tansanischen Wirtschaft und besucht ein Zementwerk. Zudem ist ein Treffen mit Unternehmern aus der Start-up-Szene Tansanias geplant.
In Sambia besichtigt Steinmeier die Fountain Gate Crafts and Trades-School, an der auch die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main beteiligt ist. Weitere Themen der Reise soll die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit in Tansania sowie der Naturschutz in Sambia sein.
Begleitet werden Scholz und Steinmeier von Wirtschaftsdelegationen, denen jeweils rund 10 Unternehmen angehören, wie es aus Wirtschaftskreisen hieß. Den Kanzler sollen demnach unter anderem Vertreter von Siemens, Thyssen Krupp und DHL begleiten. dre
Unterstützung durch Entwicklungshilfe kann irreguläre Migration allenfalls vorübergehend senken. In den instabilsten Ländern wirkt sie zu diesem Zweck überhaupt nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Demnach senkten Hilfszahlungen zwar kurzzeitig die Migration von Asylsuchenden. In einem durchschnittlichen Herkunftsland mit einer durchschnittlichen jährlichen Entwicklungshilfezahlung von 130 Millionen Dollar stellen die Autoren eine vorübergehende Reduktion der Asylerstanträge um 8 Prozent fest. Der dämpfende Effekt verschwinde jedoch bereits nach zwei Jahren. Darüber hinaus sei die Entwicklungshilfe in Subsahara-Afrika zu diesem Zweck unwirksam und senke die Zahl der Asylsuchenden überhaupt nicht.
Entgegen einem scheinbaren Konsens unter politisch Verantwortlichen in den Industriestaaten stellen die Autoren der Studie fest, dass Entwicklungshilfe im Laufe der Zeit sogar zu einem Anstieg der regulären Migration führen kann. Sofern die Hilfszahlungen wichtige Migrationsursachen wie den Lebensstandard und das Einkommen der Menschen erhöhe, ermögliche dies in der Zukunft mehr Menschen, mit einem Arbeitsvisum, für das Studium oder die Familienzusammenführung zu migrieren.
Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass nur eine unrealistisch starke Erhöhung der Entwicklungshilfe einen Großteil der irregulären Migration verhindern würde. Entgegen den Vorstellungen politischer Entscheidungsträger sei Entwicklungshilfe kein Allheilmittel gegen Migration und sollte nicht überschätzt werden, meinen die Studienautoren.
“Das Problem ist komplex – und erfordert daher einen umfassenden, mehrschichtigen Ansatz”, sagt Tobias Heidland, Leiter des IfW-Forschungszentrums Internationale Entwicklung und Mitautor der Studie. Entwicklungshilfe sei nicht die Lösung. “Zäune zu bauen und Grenzen zu überwachen, wird irreguläre Migration ebenfalls nicht vollständig stoppen – insbesondere angesichts der Situation am Mittelmeer”. Seiner Auffassung nach müssten mehr Flüchtlingsschutz in der Nähe von Konfliktzonen geboten und gleichzeitig die Anreize für irreguläre Migration gesenkt werden. “Stattdessen sollten wir dafür mehr legale Kanäle öffnen.” ajs
Afrika benötigt zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund 194 Milliarden Dollar jährlich, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030 zu erreichen. Dies geht aus einem neuen Report der OECD mit dem Titel “Africa’s Development Dynamics 2023” hervor, der in der vergangenen Woche im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin vorgestellt wurde. Demnach fehlen afrikanischen Staaten insgesamt 1,6 Billionen Dollar zur Erreichung der SDGs.
Die zunächst gigantisch wirkende Summe entspricht nur etwa 0,2 Prozent der globalen Finanzanlagen. Laut den Autoren des Reports ist die Finanzierungslücke damit überbrückbar. Dafür müssten jedoch Verbesserungen in drei Schlüsselbereichen vorangetrieben werden:
Im Anschluss an die Vorstellung der Studie diskutierte die Direktorin des OECD Development Centre, Ragnheiður Elín Árnadóttir, die wichtigsten Erkenntnisse des Reports mit einem international besetzen Panel. Sie betonte dabei unter anderem das große Potenzial der unzureichend genutzten afrikanischen Institutionen zur Entwicklungsfinanzierung. Auch eine verbesserte Datenlage halte sie für vielversprechend. Bienvenue Angui, Geschäftsführerin der Stiftung Greentec Capital Africa, beklagte hingegen die Voreingenommenheit der internationalen Ratingagenturen. Investoren seien besser beraten, sich an lokale afrikanische Ratingagenturen zu wenden, die die tatsächlichen Risiken viel genauer bewerten könnten. ajs
Amazon hat angekündigt, 2024 in den südafrikanischen Markt einzusteigen. Für den US-amerikanischen Handelsgiganten ist Südafrika nach Ägypten erst das zweite Land in Afrika, in dem es eine lokale Präsenz aufbaut. Nigeria hat Amazon ebenfalls im Visier. Dort könnte Amazon auf internationale Konkurrenz stoßen: Elon Musk will gemeinsam mit Jumia den Onlinehandel in Westafrika aufrollen.
Der Onlinehandel wuchs 2022 in Südafrika um 35 Prozent, laut einer Studie von World Wide Worx und Mastercard. Er macht derzeit allerdings erst 4,7 Prozent des Einzelhandels aus. In Deutschland ist der Anteil mehr als doppelt so hoch. In den USA liegt der Wert sogar bei mehr als 20 Prozent. Derzeit dominieren in Südafrika Unternehmen wie Takealot, Makro oder Bob Shop den Onlinehandel. Marktführer Takealot, das dem südafrikanischen Medienkonzern Naspers gehört, schreibt allerdings auch nach zehn Jahren rote Zahlen und erlitt im vergangenen Geschäftsjahr einen herben Verlust von umgerechnet 20 Millionen Euro. Zudem wird das Unternehmen von der südafrikanischen Wettbewerbskommission angehalten, den “Marketplace”, der nach einer im August veröffentlichen Studie viele Händler benachteiligt, vom Kerngeschäft zu trennen.
In den USA sieht sich Amazon ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt und wird sich wohl auch am Kap mit dem Thema beschäftigen müssen. Amazon hat angekündigt, dass die eigenständigen Kleinhändler in Südafrika im Zentrum des Angebots stehen werden. Es wird politisch nicht einfach sein, Amazon auf dem Markt zu etablieren, ohne die strauchelnden lokalen Anbieter in Not zu bringen. Gleichzeitig muss die Regierung an die Konsumenten denken. Eine große Herausforderung sind derzeit die schwächelnde Wirtschaft und die steigenden Lebenshaltungskosten, die den Konsumenten zu schaffen machen und den Einzelhandel unter Druck setzen. Deswegen wird der Preis der Produkte entscheidend dafür sein, ob Amazon sich in dem neuen Markt etablieren kann.
Amazon will in Südafrika auch seinen “Marketplace” aufmachen, auf dem externe lokale Anbieter ihre Produkte anbieten können. Über den “Marketplace” wickelt Amazon 60 Prozent seines Geschäftes ab und stellt hierzu die Internetplattform sowie die Logistik für die Lieferung bereit. Am Kap würden sich so für einheimische Händler neue Marktchancen ergeben. “Wir freuen uns darauf, Amazon.co.za in Südafrika zu starten und lokalen Verkäufern, Markeninhabern und Unternehmern die Möglichkeit zu bieten, ihr Geschäft mit Amazon auszubauen und Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein bequemes Einkaufserlebnis zu bieten”, sagte der General Manager für Amazon Subsahara Afrika, Robert Koen.
Vielen Unternehmen gilt Südafrika als Brückenkopf, von dem aus weitere Märkte in der Region erschlossen werden. Der Onlinehandel erreichte in Afrika 2021 einen Umsatz von 38 Milliarden US-Dollar und soll sich bis 2025 verdoppeln, so Statista. Die wichtigsten Länder sind Ägypten, Kenia, Nigeria und Südafrika. Amazon wird auch seinen “Prime”-Schnelllieferservice anbieten wie auch den Streamingdienst “Prime Video”, den Amazon als Konkurrenz zu Netflix und Showmax entwickelt hat. as

Als die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Welt vom 9. bis 15. Oktober in Marrakesch, Marokko, zur Jahrestagung von Weltbank und IWF zusammenkamen, erörterten sie ein breites Spektrum von Reformen des globalen Finanzsystems. Dazu gehören etwa die Umstrukturierung von Schulden, die Umwidmung von Sonderziehungsrechten (der “Währung” des IWF, die von den Mitgliedern gehalten wird) und die Aufstockung des Kapitals der multilateralen Entwicklungsbanken, damit diese mehr vergünstigte Kredite vergeben können. Diese Reformen sind für Afrika unerlässlich, um die Schuldenkrise zu überwinden, in Gesundheit und Bildung zu investieren und eine Agenda für grünes Wachstum zu verfolgen.
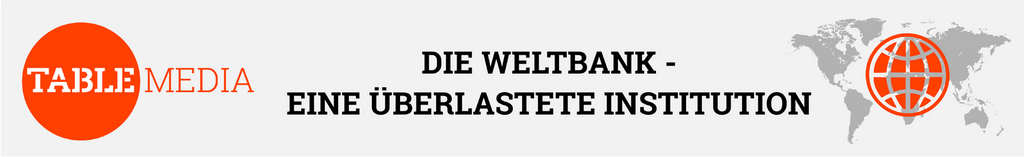
Es ist nicht das erste Mal, dass solche Reformen auf globaler Ebene ins Rampenlicht gerückt werden. Der italienische G20-Vorsitz setzte 2021 ein unabhängiges Gremium zur Überprüfung der Kapitaladäquanz der multilateralen Entwicklungsbanken ein. Der daraufhin erstellte Bericht bildete die Grundlage für die Forderung der US-Finanzministerin Janet Yellen nach Reformen der multilateralen Entwicklungsbanken. Im selben Jahr gründete die Premierministerin von Barbados Mia Mottley die Bridgetown-Agenda als Plattform, um sich für Änderungen im globalen Finanzwesen einzusetzen, insbesondere für klimagefährdete Staaten. Auch andere Staats- und Regierungschefs haben sich bemüht, wie etwa der französische Präsident Emmanuel Macron. Er organisierte im Juli 2023 ein Gipfeltreffen, das dazu beitrug, die Spannungen zwischen den Ansätzen der Klima- und Entwicklungsfinanzierung zu beseitigen.
Die Reform der globalen Finanzarchitektur ist komplex und sehr technisch. Es handelt sich um ein Thema, das nicht unbedingt die Aufmerksamkeit der führenden Politiker auf der ganzen Welt auf sich zieht und das Wählern und Gesetzgebern nur schwer zu vermitteln ist. Aber es handelt sich nicht einfach um technische Fragen, die ohne politischen Druck gelöst werden können.
Hier geht es um Leben und Tod, um Gerechtigkeit und Würde, um Frieden und Sicherheit, von denen Hunderte von Millionen Menschen in Afrika und darüber hinaus betroffen sind. Kostengünstige Finanzierungen für ärmere Länder sind in einer Zeit zurückgegangen, in der ihr Bedarf aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds, der Versorgungsprobleme, der steigenden Lebensmittelpreise und der steigenden Zinssätze größer geworden ist als zuvor.
Doch der Wandel vollzieht sich nicht schnell genug. Die Reformen werden durch politische Herausforderungen auf nationaler und globaler Ebene gebremst. So sind sich beispielsweise China und andere Länder uneinig darüber, wie die Umstrukturierung der Schulden armer Länder koordiniert werden soll. Die Regeln der Europäischen Zentralbank hindern die EU-Länder daran, ihre Sonderziehungsrechte an afrikanische Finanzinstitute weiterzuleiten. Und die Dysfunktion im US-Kongress wird wahrscheinlich einen erheblichen Beitrag zu einer Kapitalerhöhung der Weltbank blockieren. Indes sorgen Russlands Krieg in der Ukraine, Naturkatastrophen, das anhaltend niedrige globale Wirtschaftswachstum und der Krieg im Nahen Osten dafür, dass die begrenzten Ressourcen und die Aufmerksamkeit weiter aufgeteilt werden.
Dies sind größtenteils politische Probleme, die politische Lösungen erfordern, aber es fehlt an politischen Vorkämpfern, die sich für die internationale Entwicklung einsetzen werden. Aus diesem Grund kamen die afrikanischen Finanzminister und andere Interessenvertreter in Marrakesch zusammen, um eine Erklärung zu unterstützen, die ihre wichtigsten Prioritäten für globale Reformen zusammenfasst und einen Handlungsrahmen für diese Reformen bietet.
Die Erklärung von Marrakesch ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Sie ist ein Instrument zur Mobilisierung von Unterstützung, Druck und Rechenschaftspflicht für eine globale Finanzreform, die Afrika zugute kommt, und wurde von politischen Instituten, Denkfabriken und bedeutenden Persönlichkeiten auf dem ganzen Kontinent befürwortet. Das African Center for Economic Transformation hat während des gesamten Jahres 2023 daran gearbeitet, die von den afrikanischen Staats- und Regierungschefs formulierten Prioritäten zusammenzutragen, die wichtigsten Handlungsbereiche zu ermitteln und Partner aus Regierungen, internationalen und regionalen Organisationen, Interessenvertretungen und der Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um einen gemeinsamen Weg zu finden.
In der Erklärung von Marrakesch wird zu Maßnahmen in fünf Bereichen aufgerufen:
Wenn die in der Erklärung von Marrakesch hervorgehobenen Prioritäten nicht angegangen werden, wird es unweigerlich zu weiterer Unsicherheit, Verschuldung und wirtschaftlichem Niedergang kommen – anstelle von wirtschaftlichem Wandel und Chancen für bessere Bildung, Gesundheit und Beschäftigung. Führende Persönlichkeiten – sowohl gewählte, als auch solche, die aufgrund ihrer Positionen in der Kunst, in religiösen Organisationen und in der Zivilgesellschaft eine Stimme haben – müssen vortreten, miteinander arbeiten und sich für diese Reformen einsetzen.
Rob Floyd ist Direktor für Innovation und Digitalpolitik beim Thinktank African Center for Economic Transformation (ACET) in Accra. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen für die Weltbank in Afrika tätig.
Weitere Artikel der Table.Media-Redaktion über die Weltbanktagung finden Sie hier.
African Business: Afrika im Visier von Indiens Großmachtstreben. Indiens Beziehungen zu Afrika sind in einer emotionalen gemeinsamen Geschichte verwurzelt. Doch da Indien sich zum Ziel gesetzt hat, die Supermacht des Jahrhunderts zu werden, werden Handel, Geschäftsbeziehungen und die Neugestaltung internationaler Institutionen im Mittelpunkt der künftigen Beziehungen stehen.
The East African: Kann eine Umschuldung Afrikas Probleme lösen? Afrikanische Finanzminister haben eine Reihe von Reformen der Bretton-Woods-Institutionen vorgeschlagen. Sie sollen den Liquiditätsbedarf des Kontinents und den Zugang zu billigeren, längerfristigen Darlehen verbessern. Die Weltbank scheint nach der Verabschiedung eines neuen Leitbilds entschlossen, diese Reformen durchzuführen.
Bloomberg: DP World wird Hafen von Daressalam betreiben. DP World erhielt den Zuschlag für den Betrieb eines Teils des tansanischen Hafens Daressalam und wird mehr als 250 Millionen Dollar in die Modernisierung der Anlage investieren. Das in Dubai ansässige Unternehmen weitet damit seine Präsenz in Ostafrika aus, wo es bereits von Somalia bis Mosambik vertreten ist.
Financial Times: Wie Südafrikas staatliches Eisenbahnnetz Transnet an den Rand des Abgrunds geriet. Ähnlich wie der staatliche Stromversorger Eskom leidet auch Transnet unter mutmaßlicher Korruption. Das Unternehmen wird von Vandalismus an Bahnstrecken, Kabeldiebstählen und Blockaden in Häfen heimgesucht. Die Krise hat Südafrikas wichtige Rohstoffexporte gebremst, Tausende von Arbeitsplätzen im Bergbau gefährdet und die dringend benötigten Steuereinnahmen beeinträchtigt.
Business Insider: Unesco genehmigt Wasserkraftwerk in der Nähe der Victoriafälle. Die Vereinten Nationen haben Sambia und Simbabwe die Erlaubnis erteilt, einen 5 Milliarden Dollar teuren Staudamm flussabwärts der zum Unesco-Welterbe gehörenden Victoriafälle zu bauen. Umweltschützer kritisieren das 2.400-Megawatt-Projekt, das nur 47 Kilometer vom größten Wasserfall der Welt entfernt liegt. Sie fürchten, der Damm könnte die in beiden Ländern als Touristenziel beliebten Wasserfälle beeinflussen.
The Economist: Wie Liberia und Sierra Leone den Kreislauf der Gewalt durchbrochen haben. Liberia und Sierra Leone sind arme, problembehaftete Länder mit wackligen Demokratien. Dennoch geht es beiden Ländern heute viel besser als vor 20 Jahren. Das Ausmaß der extremen Armut ist drastisch gesunken. Seit den Kriegen in der Region hat die Macht einmal in Liberia und zweimal in Sierra Leone friedlich zwischen rivalisierenden Parteien gewechselt.
Africa Intelligence: Nach dem Sturz Ali Bongos emanzipiert sich die Freimaurer-Loge. Seit 2009 stand der gestürzte Präsident von Gabun, Ali Bongo, der mächtigen Großen Loge der Freimaurer in Gabun vor. Nun wurde der Gouverneur von Haut-Ogooué, der Lehrer für Geschichte und Erdkunde Jacques-Denis Tsanga, zu Bongos Nachfolger gewählt. Diese Wahl zeige, dass auch nach dem Putsch der Einfluss des Politikers Lin Mombo auf die Politik im Land unverändert groß sei.

Eigentlich wollte Katrin Dietzold mit ihrem Mann nur nach Tansania auswandern. Jetzt bauen sie über ihre Gesellschaft CPS eine neue Stadt auf Sansibar. Dietzold steht auf der Dachterrasse ihres Büros und blickt hinab auf Fumba Town. 20 Kilometer südlich der sansibarischen Hauptstadt Zanzibar City soll hier bis 2036 eine Stadt entstehen, die Wohnraum für etwa 20.000 Menschen bietet.
Einen Bezug zu Tansania hat die Familie schon lange. “2002 haben wir angefangen, Sansibar zu entdecken und ein kleines Hostel-Backpacker-Projekt begonnen”, erzählt Dietzold. “Wir waren jedes Jahr mehrfach hier.” Im Jahr 2010 beschlossen Katrin Dietzold und ihr Mann, ihre Immobiliengesellschaft in Leipzig aufzugeben und in Tansania neu zu beginnen. Ein Projekt wie Fumba Town war aber gar nicht ihr Plan. “Wir kamen hierher, und uns wurde die Idee quasi nahegelegt, weil die Regierung in Sansibar schon seit den Neunzigern den Plan hatte, die wachsende Bevölkerung in Sansibar städtisch irgendwo aufzufangen”, sagt Dietzold. 2012 gründeten sie CPS mit Katrin Dietzold als COO und ihrem Mann Sebastian als CEO.
Weil die lokale Kaufkraft nicht reichte, um ein Großprojekt wie Fumba Town zu stemmen, verhandelte CPS mit der Regierung, dass erstmals auch Ausländer auf Sansibar Eigentum kaufen dürfen. “Was dann geschah, war für uns alle unvorhersehbar”, sagt Dietzold. “Mit einem Schlag wurde die internationale Gemeinschaft auf das Projekt aufmerksam.” Zunächst kauften Menschen aus dem Oman, die Wurzeln auf Sansibar haben. Inzwischen sind mehr als 1000 Einheiten verkauft, an Kunden aus mehr als 40 Ländern. “Leute aus der ganzen Welt kommen hierher und verbringen Zeit, investieren hier oder vermieten dauerhaft”, erzählt Dietzold.
2015 begann der Bau für Fumba Town. Heute sind zahlreiche Apartments bewohnt. Doch die ursprüngliche Zielgruppe, die Mittelklasse aus Sansibar, kann sich Fumba Town kaum leisten. Studio-Apartments starten aktuell bei knapp 40.000 US-Dollar. Dietzold und CPS haben das Problem erkannt und versuchen, die Preise niedrig zu halten. “Wir machen das nicht wegen des Geldes”, sagt Dietzold. “Wenn man es macht, weil man reich werden will, dann braucht man nicht kommen.”
Niedrigere Preise seien für ein wirtschaftlich profitables Unternehmen angesichts der hohen Baukosten und langen Bauzeiten nicht möglich. “Die Bauindustrie ist steckengeblieben, wo sie vor 500 Jahren war”, sagt Dietzold. “Wir müssen digitalisieren, wir müssen skalieren, wir müssen mit nachwachsenden Rohstoffen bauen.” Denn Dietzold will mit CPS nicht nur viel Wohnraum schaffen, sondern das auch möglichst nachhaltig und umweltschonend.
CPS arbeitet in Fumba Town an Lösungen. Das Unternehmen produziert die Holzelemente für die Häuser in einer eigenen Fabrik vor Ort und experimentiert mit neuen Holz- und Klebstoffarten, um die Produktionskosten langfristig zu reduzieren. “Das Ziel muss sein, dass wir eine Einheit für 5000 US-Dollar hinstellen können”, sagt Dietzold. “Das ist, was sich der Markt leisten kann. Das haben wir in Fumba Town natürlich nicht geschafft.”
Diese Marke von 5000 US-Dollar zu nehmen, ist Dietzolds großes Ziel. Denn der Bedarf für Wohnraum ist riesig. Die Bevölkerung im Westen Sansibars wächst um sieben Prozent im Jahr. “Immer mehr Menschen leben auf immer engerem Raum, aber dieser Markt ist nicht formalisiert. Was wir hier machen, ist ja im Prinzip der Versuch, dass man Wohnraum schafft, formalisierten Wohnraum schafft, der wirklich ordentlich mit Mietverträgen gestützt ist.”
Und dabei beschränkt sich Dietzold nicht auf Sansibar. Die Unternehmerin will über die CPS auch auf dem tansanischen Festland vergleichbare Bauprojekte starten – und vielleicht darüber hinaus. In der rasant wachsenden Hafenmetropole Daressalam ist der Bedarf besonders groß. Auch in der nördlichen Region um Arusha steigt die Bevölkerungszahl enorm. Dort wollen sich Katrin Dietzold und ihre Familie langfristig niederlassen. Julian Hilgers

In Afrika zählt sich die Dichte der Reichen in Tausendern. So lebten in Südafrika im vergangenen 37.800 High Net Worth Individuals (HNWI), knapp ein Drittel aller Dollar-Millionäre auf dem afrikanischen Kontinent. Dies geht aus dem 2023 Africa Wealth Report der Beratungsgesellschaft Henley & Partners hervor.
An zweiter Stelle folgt Ägypten mit 16.100 HNWIs, Nigeria belegt Platz drei mit 9.800 HNWIs. Insgesamt leben in Afrika 138.000 Dollar-Millionäre. Gemessen werden Nettovermögen, die sich aus Bargeld, Immobilien oder Geschäftsanteilen zusammensetzen. Verglichen mit 2020 hat die Anzahl der Reichen in Afrika um fast neun Prozent zugenommen.
Der reichste Unternehmer Afrikas ist Aliko Dangote aus Nigeria, der sein Geld mit Zement, Mehl und Zucker gemacht hat (13,5 Milliarden Dollar, Dangote Group). Ihm folgen Johann Rupert aus Südafrika (10,7 Milliarden Dollar, Richemont) und Nicky Oppenheimer (8,4 Milliarden Dollar, Anglo American).
Auf 2,4 Billionen Dollar summieren sich die Privatvermögen auf dem Kontinent. Auch hier liegt Südafrika vorne, gefolgt von Ägypten, Nigeria, Kenia und Marokko und Kenia. Die “Big Five” machen rund 50 Prozent des Privatvermögens in Afrika aus. In diesen Ländern leben auch 90 Prozent aller Milliardäre. Als aufstrebendes Land gilt Mauritius, wo innerhalb der kommenden Dekade Privatvermögen um 75 Prozent zulegen sollen. Schon jetzt ist es Spitzenreiter beim Durchschnittsvermögen in Afrika – mit beachtlichen 37.500 Dollar. as
