im Vorfeld der Jahrestagung von IWF und Weltbank hatten afrikanische Länder immer wieder auf Reformen der globalen Finanzarchitektur gedrängt. Auf der vergangene Woche in Marrakesch ausgerichteten Tagung wurden afrikanische Anliegen zwar nun teilweise erhört. Doch von einer nachhaltigen Lösung kann noch keine Rede sein. Wir haben für Sie Kritikpunkte und Lösungsansätze zusammengetragen.
Auch an die bevorstehende Konferenz zum Compact with Africa sind hohe Erwartungen gerichtet – aus Afrika ebenso wie aus Deutschland. Die Einschätzungen der Experten unseres Table.Live-Briefings zum Thema hat David Renke zusammengefasst.
In Frankreichs Afrika-Politik hingegen klafft eine Lücke: Der Posten des Afrika-Beraters im Élysée-Palast ist seit Monaten unbesetzt. Welche Gefahren dieses Vakuum birgt, beschreibt Christian von Hiller.
Eine Lücke füllen will auch Elon Musk, der mit seinem Satelliteninternet-Anbieter Starlink munter in Afrika expandiert. Lucia Weiß hat sich angeschaut, was es mit Starlinks neuer Partnerschaft mit dem afrikanischen Onlinehändler Jumia auf sich hat.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Zwei Ereignisse haben das Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Marrakesch überschattet: der Ausbruch der Gewalt im Nahen Osten und das schwere Erdbeben in Marokko, dem Land, in dem das Treffen dieses Mal stattfand. An diesem Wochenende ging die einwöchige Jahrestagung von IWF und Weltbank zu Ende. In Marrakesch diskutierten Delegationen aus 189 Ländern die Aussichten für eine durch Schulden, Inflation, hohe Zinsen und Konflikte belastete Weltwirtschaft, die wachsende Wohlstandskluft zwischen reichen und armen Ländern sowie die scheiternden Bemühungen bei der Bekämpfung des Klimawandels.
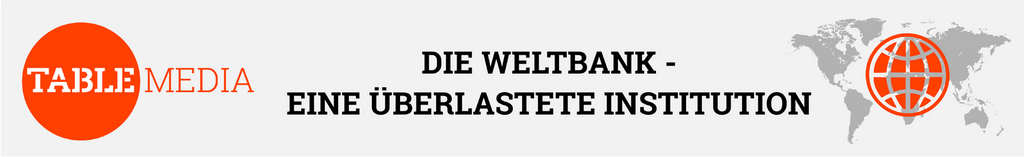
“Das große Thema in dieser Woche ist, dass die G7-Länder die Risse der zerbrochenen Versprechen übertünchen”, sagte Kate Donald, Leiterin des Büros von Oxfam International in Washington im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Trotz des Händeringens über die Milliarden von Dollar, die zur Bekämpfung von Armut und Klimazusammenbruch benötigt werden, gab es keine Anzeichen für neues Geld.”
Der in Accra ansässige Thinktank African Center for Economic Transformation fordert in seinem vergangene Woche veröffentlichten Marrakech Framework eine neue globale Finanzarchitektur, in der afrikanischen Stimmen mehr Gewicht zukommt. Dazu brauche es eine echte Lösung für die Schuldenkrise, mehr Zuschüsse und vergünstigte Darlehen sowie eine Verpflichtung zu einer ehrgeizigen Agenda für grünes Wachstum in Afrika. Zudem sollten mindestens fünf Länder ihre IWF-Sonderziehungsrechte an die Afrikanische Entwicklungsbank und andere afrikanische Finanzinstitutionen weiterleiten.
Am Rande der Jahrestagung gab es auch Erfolge für Afrika. Neben je einem neuen Sitz für afrikanische Länder im Vorstand von IWF und Weltbank hat sich etwa das hoch verschuldete Sambia mit seinen bilateralen Gläubigern über eine Restrukturierung seiner Staatschulden verständigt. Demnach wird Sambia in den nächsten zehn Jahren nur etwa 750 Millionen Dollar zahlen müssen, während vor der Umschuldung fast sechs Milliarden Dollar fällig waren. Die Unterzeichnung des entsprechenden Memorandum of Understanding steht allerdings noch aus. “Der nächste Schritt besteht darin, eine vergleichbare Vereinbarung mit unseren privaten Gläubigern zu treffen”, sagte Sambias Finanzminister Situmbeko Musokotwane.
Auch Äthiopien ersucht seine Gläubiger um einen Schuldenerlass. China hat dem Land bereits einen Zahlungsaufschub bis Juli 2024 gewährt, weitere Gläubiger führen noch Gespräche. Nach Angaben einer IWF-Offiziellen steht der Fonds kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung über ein Darlehensprogramm mit Äthiopien. Und auch in Ghana scheint eine Umschuldung näher zu rücken. Der IWF hoffe auf eine Einigung in den nächsten sechs bis acht Wochen, sagte der Direktor der Afrika-Abteilung.
Unterdessen hat eine Gruppe von afrikanischen Länderdirektoren der internationalen NGO Action Aid die Weltbank und den IWF dazu aufgefordert, die Schuldenlast und die den afrikanischen Ländern auferlegte Sparpolitik zu beenden. Dies soll sicherstellen, dass sie wachsen und nicht weiter leiden. Action Aid schlägt vor, allen afrikanischen Ländern die Schulden zu erlassen und ehrgeizige und progressive Steuerreformen in diesen Ländern zu unterstützen. Laut dem veröffentlichten Report habe die Austeritätspolitik von IWF und Weltbank die wirtschaftliche und menschliche Entwicklung in ganz Afrika abgewürgt.
Allerdings birgt ein Schuldenerlass für Afrika auch Risiken, etwa die Gefahr, dass die Kreditwürdigkeit der afrikanischen Schuldner so leidet, dass sie auf Jahre hinaus nicht mehr kapitalmarktfähig sind. Die Gläubiger haben sich in der inoffiziellen Gruppe Pariser Club zusammengeschlossen, die zwischen den Schuldnerregierungen und den Geberländern vermitteln will.
Die Bundesregierung hat auch im vergangenen Jahr einer Reihe afrikanischer Schuldnerländer zumindest einen Teil der Forderungen erlassen, so zum Beispiel Äthiopien, Benin und Elfenbeinküste im Rahmen der HIPC-Initiative für die ärmsten Länder. Außerhalb der HIPC-Initiative hat die Bundesregierung zudem Ägypten einen Schuldenerlass von mehr als einer Milliarde Euro gewährt. Auch Burkina Faso, Botswana und Burundi haben von einem deutschen Schuldenerlass profitiert. Insgesamt hat die Bundesregierung afrikanischen Schuldnern rund 12,1 Milliarden Euro erlassen. Somit findet schon regelmäßig ein Erlass von Schulden statt. Eine andere Frage ist selbstverständlich, ob dies genügt.
Bei der wichtigen Neuverhandlung der IWF-Quoten, von denen etwa die Stimmrechte der Mitgliedsstaaten abhängen, konnten die Tagungsteilnehmer keine Einigung erzielen. Ein von den USA unterstützter Plan zur Aufstockung der IWF-Mittel, ohne China und anderen großen Schwellenländern mehr Anteile zu geben, fand nicht genügend Unterstützung. Die Mitgliedsländer verpflichteten sich jedoch zu einer “bedeutenden Erhöhung” der Darlehensmittel bis zum Jahresende. In einem Statement forderte der IWF neue Quotenbeiträge, die “zumindest die derzeitige Mittelausstattung des Fonds aufrechterhalten”. Ein Beamter des US-Finanzministeriums erklärte gegenüber Reportern, dass es trotz der fehlenden Einigung gute Fortschritte in der Quotenfrage gebe. Eine Einigung im Oktober werde “immer wahrscheinlicher”.
Auch das Leitungsgremium der Weltbank hat kein gemeinsames Kommuniqué herausgegeben. Dies ist Meinungsverschiedenheiten über das Wording mit Blick auf die laufenden Konflikte geschuldet. In einer Erklärung wurde immerhin festgestellt, dass “die meisten Mitglieder” die Äußerungen der G20-Führer zum Krieg in der Ukraine unterstützten.
Anlässlich der Jahrestagung hat der IWF neue Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Afrika veröffentlicht. Laut Report wird Afrika im laufenden Jahr um voraussichtlich 3,2 Prozent wachsen. Damit setzt sich die Verlangsamung des afrikanischen Wachstums seit 2021 fort. Dennoch wächst der Kontinent schneller als der globale Durchschnitt von 2,9 Prozent. Für 2024 prognostizieren die IWF-Ökonomen eine Trendwende in Afrika mit einem Zuwachs von 3,8 Prozent.
Zwischen den afrikanischen Ländern bestehen jedoch erhebliche Unterschiede. Einige der diversifizierteren und dynamischeren Volkswirtschaften des Kontinents sind nicht-rohstoffintensive Länder, etwa Kenia, Ruanda und Senegal. Für diese Länder wird 2024 ein Wachstum von 5,9 Prozent erwartet. In Nordafrika hingegen dürfte das Wachstum in den Nicht-Rohstoffländern im nächsten Jahr relativ gedämpft sein, was vor allem auf die Konjunkturflaute in Ägypten zurückzuführen ist.
Weitere Artikel der Table.Media-Redaktion über die Weltbanktagung finden Sie hier.
Der französische Präsident Emmanuel Macron leidet an einer empfindlichen Personallücke in seiner Afrika-Politik. Sein Afrika-Berater Franck Paris hat nach sechs Jahren den Élysée-Palast verlassen und ist Anfang August zum Leiter von Frankreichs Vertretung in Taiwans Hauptstadt Taipeh ernannt worden. Diese wird offiziell nicht als Botschaft geführt, sondern als “Französisches Büro in Taipeh”. Dementsprechend bezeichnet sich Franck Paris auf der Website der Vertretung als “Büroleiter”.
Doch auf der Website des Élysée ist Franck Paris weiterhin als “Afrika-Berater” aufgeführt. Tatsächlich jedoch ist die Leitung der sogenannten Afrika-Zelle (cellule africaine) seit gut zwei Monaten unbesetzt. Paris’ Stellvertreterin Marie Audouard war schon vor einem Jahr zur Hotelgruppe Accor gewechselt. Sie war maßgeblich an Macrons berühmter Rede von Ouagadougou beteiligt, die er Ende November 2017 vor Studenten in Burkina Faso hielt und die einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika einleiten sollten. “Ich will an Eurer Seite stehen”, rief Macron damals den Studenten zu.
Paris’ Wechsel muss nicht im Zusammenhang mit den Rückschlägen Frankreichs in der Sahelzone in Verbindung stehen. Tatsächlich wollte der Vertraute des Präsidenten schon direkt nach Macrons Wiederwahl im April 2022 seinen Posten als Leiter der Afrika-Zelle aufgeben.
Doch nun ist in einer der schwierigsten Phasen der französischen Afrika-Politik eine Schlüsselposition vakant. Das betrifft zunächst den Élysée-Palast: Unter dem Generalsekretär Alexis Kohler arbeitet Emmanuel Bonne als Außenpolitischer Berater. Unter dem vakanten Posten des Afrika-Beraters ist Nadège Chouat für die Betreuung der Diaspora zuständig und ihr Kollege Patrik Durel für Nordafrika und den Nahen Osten. Damit werden zwar noch untergeordnete Afrika-Themen im Élysée abgedeckt, aber nicht mehr die entscheidenden Weichenstellungen.
Die Afrika-Zelle war stets die zentrale Schaltstelle für Frankreichs Afrika-Politik und damit für eine Politik, die Frankreichs Rang in der Welt sichern sollte. Sie wurde ursprünglich von Jacques Foccart geleitet, einem Vertrauensmann Charles de Gaulles’ aus Zeiten der résistance, der auch unter dem Präsidenten Pompidou sowie unter Jacques Chirac, als dieser Premierminister war, die Frankreichs Politik auf dem Kontinent maßgeblich prägte.
War die Afrika-Zelle unter de Gaulle direkt im Élysée-Palast untergebracht, musste sie 1967 einige hundert Meter entfernt ins Hôtel de Hirsch in der Rue de l’Élysée Nummer 2 umziehen, benannt nach dem bayerischen Finanzier Moritz Baron von Hirsch auf Gereuth oder auch Maurice baron de Hirsch de Gereuth. Als Nicolas Sarkozy 2007 in den Élysée-Palast einzog, löste er die Afrika-Zelle offiziell auf. Faktisch bestand sie jedoch weiterhin. Allerdings setzte sich der Bedeutungsschwund fort. Franck Paris wurde vorgehalten, dass er in Afrika zu wenig persönliches Gewicht besaß und die anti-französische Stimmung in Westafrika nie in den Griff bekam.
“Wenn die ehemalige Kolonialmacht den Eindruck erweckt, von den Ereignissen in Afrika erschüttert zu sein, dann deshalb, weil sie den Wandel der Zeiten dort nicht rechtzeitig erkannt hat“, kritisierte jüngst Luc de Barochez, Ressortleiter Außenpolitik beim Magazin Le Point. “Der Zeitenwechsel in Afrika erfordert mutige Entscheidungen.” Auch hatten im Sommer 94 Senatoren und Abgeordnete verschiedener Parteien in einem offenen Brief einen Neuanfang gefordert: “Ist es nicht an der Zeit, unsere Vision von Afrika und seiner Verbindung mit Frankreich zu überdenken?”, fragten sie.
Es wäre somit möglich, dass Macron die Afrika-Zelle nun tatsächlich auflöst. Die cellule africaine doppelt ohnehin die Afrika-Abteilung des Außenministeriums. Dort leitet Christophe Bigot die Direktion für Afrika und den Indischen Ozean mit Clément Leclerc als Stellvertreter. Unter ihnen agieren vier “sous-directeurs” für die Unterregionen des Kontinents.
Hinzu kommen Abteilungen im Außenministerium, die ebenfalls Afrika im Blick behalten, etwa die Abteilung Globalisierung, die Abteilung Auslandsfranzosen oder die Abteilung für Entwicklungspolitik, in der das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit aufgegangen ist und die heute die Staatssekretärin Chrysoula Zacharopoulou leitet.
Dass Frankreichs Außenpolitik künftig allein im Außenministerium am Quai d’Orsay betreut wird, gilt als unwahrscheinlich. Schließlich gilt die Bestimmung der Außenpolitik als Vorrecht des Präsidenten. Allerdings lässt Macron derzeit einen zentralen Posten im Élysée unbesetzt. Das erhöht die Gefahr der Orientierungslosigkeit in einer kritischen Phase der Beziehungen zu Afrika.
Einig waren sich beim Table.Live Briefing eigentlich alle: Von Compact with Africa (CwA) haben alle teilnehmenden zwölf afrikanischen Länder profitiert – insbesondere nach der Corona-Pandemie. Die Erwartungen gut einen Monat vor der G20 Compact with Africa-Chancellors’ Conference am 20. November in Berlin sind allerdings unterschiedlich. Am vergangenen Mittwoch diskutierten neben Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana), Igor César (Botschafter von Ruanda) und Christoph Kannengießer (Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft), auch Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG) im Table.Live Briefing, was von dem Gipfel zu erwarten ist.
Die Zahlen sprechen zunächst für sich. Laut dem Bericht der Africa Advisory Group der Weltbank haben die CwA-Länder nach der Pandemie ein stärkeres Wirtschaftswachstum als die übrigen afrikanischen Staaten. Offen bleibt allerdings, wie groß der tatsächliche Anteil der CwA-Initiative an dem Erfolg der Mitgliedsländer ist. Diese seien ohnehin bereits vor der Initiative dem Handel und ausländischen Direktinvestitionen aufgeschlossen gewesen. Im vergangenen Jahr stiegen die angekündigten Direktinvestitionen in den CwA-Ländern auf 133 Milliarden Dollar – und überragen bei weitem das Vorpandemie-Niveau (rund 80 Milliarden Dollar).
Trotz aller Erfolge hält sich jedoch das Interesse an der Initiative insbesondere südlich des Äquators in Grenzen. Nur Ruanda hat sich als einziges Land auf der Südhalbkugel bislang angeschlossen. Das Angebot der 2017 auf Betreiben Deutschlands ins Leben gerufen G20-Initiative richtet sich jedoch ausdrücklich an alle afrikanischen Länder. Ziel ist es, durch bessere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen mehr private Investitionen in die teilnehmenden Länder zu locken. Am 20. November lädt Bundeskanzler Olaf Scholz die teilnehmenden Staatschefs des CwA nach Berlin ein, um der Initiative neuen Schwung zu verleihen.
Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana):
“Der G20-CwA hat ohne Frage eine Plattform für private Investoren geschaffen, um in Afrika zu investieren. Als Folge sehen wir, dass unsere Wirtschaft wächst. Ich bin zuversichtlich, dass mit der Fortsetzung des Compacts ähnliche Partnerschaften und Investitionen weiter blühen werden.”
“Die Aufnahme der Afrikanischen Union als ständiges Mitglied der G20 ist der Beweis für Afrikas zunehmenden Einfluss auf der Weltbühne. Afrika ist reif für Investitionen. Das enorme wirtschaftliche Potenzial des afrikanischen Kontinents wird durch das afrikanische Freihandelsabkommen AfCFTA unterstrichen. Mit Partnern wie Deutschland und den G20 können alle Beteiligten die Vorteile der Umsetzung von AfCFTA voll ausschöpfen und Geschäfte in ganz Afrika machen – zum gegenseitigen Vorteil.”
Steffen Meyer (Bundeskanzleramt):
“Der G20 Compact with Africa hat sich als zentrale multilaterale Initiative auf Augenhöhe zwischen G20 und afrikanischen Ländern etabliert. Das Beitrittsinteresse weiterer afrikanischer Länder unterstreicht dessen anhaltende Attraktivität. Mit der G20-CwA-Konferenz am 20. November in Berlin setzt der Bundeskanzler einen wichtigen Impuls für den CwA sowie für das deutsche Engagement und die Kooperationsbereitschaft mit Afrika.
Die CwA-Länder haben ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und die Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen verbessert. Mehr private Investitionen in lokale Wertschöpfung sind der Schlüssel zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand vor Ort.”
Christoph Kannengießer (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft):
“Der CwA ist aus unserer Sicht ein sinnvoller Ansatz. Er verknüpft erstmals sehr konsequent die Themen Investitionsförderung und Entwicklung miteinander. Die verstärkte Investitionstätigkeit in vielen CwA-Ländern zeigt, dass der Weg richtig ist und weitergeführt werden sollte.”
“Investitionen aus Deutschland kommen häufig aus mittelständischen Firmen, für die Finanzierungsthemen und Risikoabsicherung eine wesentliche Rolle spielen. Das im Rahmen des CwA entwickelte Kreditprogramm “Africa Connect” für kleinere Investitionsprojekte hat einiges erleichtert und sollte gezielt weiterentwickelt werden. Außerdem kann bei staatlichen Garantien noch mehr gemacht werden.”
Anna Rainer (Bayer AG):
“Die erneute Ausrichtung des “Compact with Africa”-Gipfels in Berlin ist begrüßenswert, ich hoffe nun auf eine pragmatische und unternehmerisch orientierte Zusammenarbeit mit Afrika, der Kontinent kann sich seine Partner mittlerweile aussuchen und wird nicht auf Deutschland warten.”
“Die Impulse von Gina Ama Blay und Igor César haben klar gezeigt, dass die Bereiche Gesundheit und Landwirtschaft bei unseren afrikanischen Partnern ganz oben stehen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, brauchen jedoch verlässliche Rahmenbedingungen.”
“Dein Starlink-Kit kommt mit allem, was Du brauchst, um innerhalb von Minuten online zu gehen. Dazu gehören Dein Starlink, ein Wifi-Router, Kabel und eine Basisstation”, so steht es in der Produktanzeige auf der Handelsplattform Jumia Nigeria. Lieferung in Lagos möglich in den kommenden vier bis fünf Tagen.
Jumia, nach eigenen Angaben die größte Plattform für E-Commerce auf dem afrikanischen Kontinent, hat sich mit Elon Musks niedrig fliegendem Satelliteninternet Starlink verbandelt. Der Umfang der Zusammenarbeit klingt bescheiden: Die Handelsplattform wird das Hardware-Kit für den Zugang zu Starlink vertreiben. Zunächst in Nigeria, bald dann auch in Kenia und perspektivisch in allen elf Ländern, in denen Jumia aktiv ist, so heißt es in der Pressemitteilung von Jumia Anfang Oktober.
Doch in dieser Partnerschaft steckt viel mehr, sie könnte das next big thing auf dem Kontinent werden. Starlink ging vor wenigen Tagen in Sambia online. Außerdem ist es in Nigeria, Kenia, Mosambik, Ruanda und Malawi verfügbar. Bis Jahresende sollen mindestens Angola und Eswatini dazukommen.
Die Idee: Musks niedrig fliegende Satelliten ermöglichen Menschen auch in ländlichen und entlegenen Gebieten den Internetzugang, aber auch in Städten, wo die Daten nicht schnell genug fließen. “Für das Wachstum und die Entwicklung in Afrika ist das an sich eine sehr gute Nachricht. Es gibt zahlreiche Startups aus dem Tech-Bereich, die nicht durchstarten können, weil es kein schnelles Internet in manchen Gegenden gibt”, analysiert der senegalesische Tech-Unternehmer Boubacar Ba im Gespräch mit Table.Media.
Und was ist für Jumia drin? So einiges, wenn es gut läuft. Denn die Plattform, die Handel, Logistik und Online-Zahlungen zusammenbringt, steht derzeit nicht besonders gut da. Um satte Minus 40 Prozent rauschte die im Nasdaq notierte Aktie der Jumia Technologies AG, in den vergangenen drei Monaten nach unten. Ein verbesserter Zugang zum Internet könnte den E-Commerce-Giganten Jumia in der Gunst der Anleger steigen lassen.
“Jumia ist vor allem in den Hauptstädten präsent, aber wer 200 oder 300 Kilometer weit weg ist, der hat es schwieriger mit Bestellen und Liefernlassen. Stell’ Dir vor, Du bist auf einem Dorf, egal ob im Senegal oder Nigeria, und Du hast ein Smartphone und kannst die App von Jumia installieren. Aber dann geht das Internet nicht richtig. Sehr schnelles Internet bereitzustellen, wird Jumia helfen, mehr Menschen den Zugang zu ihrer Plattform zu ermöglichen”, glaubt der Informatiker Ba.
Jumia ist derzeit in Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste, Senegal, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Kenia, Uganda und Südafrika aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Menschen. Das Wachstum des Unternehmens könnte weitere Arbeitsplätze schaffen. Das Potenzial der Märkte ist auf jeden Fall riesig: Mit der wachsenden Bevölkerung und steigendem Wohlstand in der Mittelschicht wird auch die Lust auf Konsumgüter und die Kaufkraft der Menschen in Afrika größer.
Aber, so findet Tech-Unternehmer Ba, gesunde Skepsis ist angebracht: “Elon Musk macht nichts ohne Hintergedanken. Da muss man sehen, was dahinter steckt als Strategie. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Musk irgendwann Jumia übernehmen will.”
Musks sprunghaftes Verhalten, seine Eingriffe ins unternehmerische Tagesgeschäft sowie politische Kommentare sorgen schon bei anderen seiner Unternehmen, wie dem Kurznachrichtendienst X – früher Twitter – für Aufsehen und geben Grund zur Beunruhigung. Denn als Internet-Provider hat Musk auch Zugriff auf sensible Daten.
Fest steht: Die Partnerschaft von Jumia und Starlink dürfte den Auftakt zur großflächigen Expansion von Musk in Afrika darstellen. Google und Facebook waren zuvor mit ihren Internet-Initiativen gescheitert. Mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung ist Afrika allerdings wichtig für die Zukunft – und nicht ohne Grund ein umkämpfter Markt.
In Baden-Württemberg ist man stolz darauf, seit mehr als 40 Jahren Verbindungen und Partnerschaften mit Afrika zu pflegen. Bereits in den 1980er Jahren schloss die Landesregierung eine Partnerschaft mit Burundi. Diese hält bis heute an. Erst im Juli besuchte Staatssekretär Rudi Hoogvliet, der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund, das Land in Ostafrika. Dort besichtigte er ein von der Landesregierung gefördertes Kaffeeprojekt. Doch klassische Entwicklungspolitik reicht nicht aus, ist man in Stuttgart überzeugt.
Deshalb will die Landesregierung den Handel und privatwirtschaftliche Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent fördern. “Afrika ist der Kontinent der Zukunft: Seine junge Bevölkerung sprüht vor Wissensdurst und Unternehmergeist. Das ist für Baden-Württemberg, gerade auch für unsere Unternehmen und Hochschulen, attraktiv”, sagt Hoogvliet.
Zur Wahrheit gehöre trotz aller Partnerschaft aber auch, dass Europa etwas schlafmützig gegenüber seinem afrikanischen Nachbarn war. “Andere Länder wie China oder Indien, die Türkei oder Saudi-Arabien haben uns zwischenzeitlich mit ihrem Engagement überholt“, kritisiert der Staatssekretär. Doch Baden-Württemberg will den Anschluss nicht verlieren. “Wir sind seit 2019 neben Bayern das einzige deutsche Land, das eine Afrika-Strategie aufgestellt hat und diese auch konsequent verfolgt – mit drei Schwerpunkten: Wirtschaft, Wissenschaft und eben auch: Partnerschaft.”
Seit sechs Jahren unterstützt die Regierung daher auch das Global Partnership for African Development Forum (G-PAD), das vom Verein Lead Africa International veranstaltet wird. Am 20. Oktober findet die sechste Ausgabe in der Landesvertretung Baden-Württemberg statt. “Das Ziel ist es, Interessensgruppen aus Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft zusammenzubringen”, sagt Timi Olanrewaju, Geschäftsführer von Lead Africa International. Dabei solle auch der Fokus verschoben werden: Die Frage für den Westen dürfe nicht länger sein, was können wir für Afrika tun, sondern vielmehr, wie kann eine Zusammenarbeit mit Afrika aussehen. Dabei soll dem Wunsch vieler afrikanischer Länder nach Investitionen statt Entwicklungshilfen Sorge getragen werden. “Die Hilfen haben nicht wirklich funktioniert und Afrika weitergebracht”, sagt Olanrewaju.
Seit einem Jahr findet G-PAD in Berlin statt. Zuvor hatte es vier Foren in Baden-Württemberg gegeben. Mit dem Umzug in die Hauptstadt erhoffen sich die Veranstalter noch mehr öffentliche Sichtbarkeit und eine Internationalisierung. Bislang werden rund 600 Teilnehmer zur Veranstaltung erwartet – sowohl online als auch vor Ort.
Am kommenden Freitag werden neben den Botschaftern von Ruanda, Südafrika, Lesotho und Simbabwe auch der streitbare und in Ostafrika sehr populäre Anwalt und Aktivist Patrick Lumumba erwartet. Unter dem Namen Professor Lumumba betreibt einen regierungskritischen Blog, den unzählige Menschen in Ostafrika lesen, teilen und diskutieren. Der Kenianer, der zwischen 2010 und 2011 Direktor der Antikorruptionskommission seines Landes war, wird per Video von Nairobi zugeschaltet sein.
Auch Philipp Keil, Geschäftsführer der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), wird als Redner auf dem Forum zu hören sein. Sein Ziel für die Konferenz ist es, dass das Thema Afrika auch in der Berliner Politik und den Institutionen stärker wahrgenommen wird. “60 Prozent der Zukunftsressourcen kommen vom afrikanischen Kontinent. Er ist der reichste Kontinent überhaupt. Wir müssen in Politik und Gesellschaft viel mehr Bewusstsein für unseren Nachbarkontinent schaffen”, sagt Keil zu Table.Media.
Die SEZ ist einer der wichtigsten Geldgeber des G-PADs. Die Stiftung wurde Anfang der 1990er Jahre vom baden-württembergischen Landtag gegründet, um Netzwerke in die Länder des globalen Südens aufzubauen. Mit der Partnerschaft mit Burundi stand Afrika seit Beginn der Stiftung im Mittelpunkt. dre
Die US-amerikanische Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda will 40 Millionen Dollar in die Herstellung von Impfstoffen in Afrika investieren. Dabei soll es vorrangig um die Produktion von mRNA-Impfstoffen gehen, wie die Stiftung in der vergangenen Woche in Dakar am Rande ihrer jährlichen Großveranstaltung “Global Challenges” mitteilte.
mRNA-Impfstoffe seien für die Bekämpfung vieler Krankheiten wie etwa dem Rift-Valley-Fieber oder Tuberkulose vielversprechend, sagte Gates der Associated Press. Das Institut Pasteur im Senegal sowie das Forschungsinstitut Biovac in Südafrika erhalten nach Angaben der Stiftung jeweils fünf Millionen Dollar, um mRNA-Technologie von der Gesellschaft Quantoom Bioscience zu erwerben und dann für die lokale Impfstoffproduktion zu nutzen. Das belgische Unternehmen Quantoom Bioscience, das die Gates-Stiftung bereits in der Vergangenheit gefördert hat, erhält nochmals 20 Millionen Dollar für die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung seiner Produkte. Zehn Millionen Dollar sollen an ein weiteres mRNA-Impfstoff-Unternehmen fließen, das noch bekanntgegeben werden soll.
“Die Ausweitung unserer Fähigkeit, günstige mRNA-Impfstoffe in Afrika zu entwickeln und herzustellen, ist eine wichtige und notwendige Etappe, um eine Selbstversorgung mit Impfstoffen der Region zu erreichen”, sagte der Direktor des Pasteur-Instituts in Dakar, Amadou Sall, in der lokalen Presse. Das Pasteur-Institut stellt unter anderem seit Jahrzehnten Impfstoff gegen Gelbfieber her.
Die Gates-Stiftung will sich nach Berichten in der senegalesischen Presse künftig stärker an das Land binden: In Dakar soll das Westafrika-Büro der einflussreichen Stiftung entstehen, die bereits Dependancen in Abuja, Nairobi und Johannesburg unterhält. Die Gates-Stiftung ist nach eigenen Angaben in 49 Ländern auf dem Kontinent mit Projekten in den Bereichen Gesundheit, Ungleichheit und Armutsbekämpfung aktiv. lcw
Der erste Jahrgang des von Deutschland mitgeförderten Masterstudiengangs zu erneuerbaren Energien an vier westafrikanischen Universitäten hat erfolgreich abgeschlossen. Die 59 Studierenden aus 15 Ländern der Ecowas feierten in der vergangenen Woche die Übergabe ihrer Zeugnisse, wie das Forschungszentrum Jülich gegenüber Table.Media bestätigte.
Ein Forschungszentrum in Accra, Ghana (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) koordiniert den zweijährigen internationalen Master in “Energie und Grünem Wasserstoff”. Die Studierenden können zwischen vier Schwerpunkten je nach Universität wählen: Photovoltaik in Niger (Université Abdou Moumouni de Niamey), Georessourcen in der Elfenbeinküste (Université Félix Houphouët-Boigny), Bioenergie in Togo (Université de Lomé) sowie Wirtschaft im Senegal (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).
Während des Masters absolvierten die Studierenden einen sechsmonatigen Aufenthalt an deutschen Partneruniversitäten, entweder an der RWTH Aachen oder am Forschungszentrum Jülich.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert den innovativen Studiengang zunächst noch bis 2025, mit acht Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Energieforschungsprogramms “Innovationen für die Energiewende”. Weitere Informationen über den Termin für die nächste Bewerbungsrunde 2024 lagen noch nicht vor.
Inwiefern die Zusammenarbeit mit der Partneruniversität in Niamey nach dem Staatstreich in Niger betroffen sein könnte, war bis Redaktionsschluss nicht zu klären. lcw

Die Entfremdung zwischen BMZ und Privatwirtschaft sei “nie größer gewesen”, konstatierte jüngst ein Berater, der seit Jahrzehnten im Afrika-Geschäft aktiv ist. Mit diesem Urteil steht er nicht alleine: Wer Wirtschaftsvertreter auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anspricht, sollte auf Unmutsbekundungen gefasst sein.
Hausherrin Svenja Schulze (SPD) wäre gut beraten, solche Aussagen nicht als Lobby-Getöse abzutun. Denn Unmut äußern nicht nur die üblichen Verdächtigen aus Verbänden und Konzernen, die gerne politischen Druck aufbauen. Auch Mittelständler, Gründer und Sozialunternehmer sind schlecht auf das BMZ zu sprechen.
Damit steht Schulzes Strategie auf tönernen Füßen. Schließlich soll die Wirtschaft eine zentrale Rolle in ihrer Entwicklungspolitik spielen. Das BMZ werde “einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor setzen”, heißt es etwa in der überarbeiteten Afrika-Strategie. Unternehmen sollen demnach verstärkt vor Ort investieren und Jobs schaffen.
Wer kooperieren will, muss Partnern allerdings Wertschätzung zeigen. Und hier liegt das Problem: In ihren Reden, Interviews und Social-Media-Posts erweckt Schulze allzu oft den Eindruck, sie wolle Unternehmen an die Kandare nehmen statt ihnen den Weg zu ebnen. Wie schwer es ihr fällt, den richtigen Ton zu treffen, illustrierte sie Ende September auf X (ehemals Twitter):
“Ziel der neuen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist, dass mehr Menschen von den Ergebnissen profitieren”, schrieb Schulze. “Mir ist wichtig, dass Frauen & Gewerkschaften eine größere Rolle bekommen. Künftig werden wir zudem alle Projekte auf Klimaschutz, Sozial- & Umweltstandards überprüfen.”
Klar, das klingt gut. Aber ist das eine Botschaft, mit der Schulze Manager für Investitionen in Afrika und das neue BMZ-Programm “Partners in Transformation” gewinnen kann? Natürlich nicht. Man muss weder verblendeter Lobbyist noch beinharter Wirtschaftsliberaler sein, um diesen Post als Ermahnung und als Ankündigung zusätzlicher Bürokratie zu lesen.
Was, um Himmels Willen, ist so schwer daran, in der zentralen Botschaft zum neuen BMZ-Kooperationsangebot wenigstens einen Hauch Wertschätzung für Unternehmertum auszudrücken? Kommunikatoren wissen: Wer Menschen überzeugen will, muss eine emotionale Verbindung aufbauen – und Themen ansprechen, die sie bewegen.
Dieser Post und andere Botschaften sind dafür nicht geeignet. Im Gegenteil: Schulze erweckt den Eindruck, als adressiere sie statt der Wirtschaft vor allem das eigene Lager. Das muss sich ändern, wenn sie mehr Privatkapital für Entwicklungsziele mobilisieren will. Ohne besseren Draht zu Unternehmen dürften die guten konzeptionellen Ansätze des BMZ verpuffen.
Da gute Kommunikation mit Zuhören beginnt, sollte die Ministerin jetzt auf ihre Kritiker zugehen. Nur auf Basis eines Verständnisses dafür, was Entscheider bewegt, kann sie bessere Botschaften senden und bestenfalls einen partnerschaftlichen Geist etablieren. Dafür muss sie übrigens nicht von ihren Prinzipien abrücken: Weite Teile der Wirtschaft stehen hinter ambitionierten ESG-Zielen und haben bereits viele Hebel in Bewegung gesetzt. Anerkennung und Ansporn sind in diesen Fällen effektiver als erhobene Zeigefinger.
Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen ist von Daniel Schönwitz und Martin A. Schoeller das Buch: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft”.
South China Morning Post: China verteidigt Afrika-Investitionen im Vorfeld des Belt and Road Forum. In dieser Woche findet in China das dritte Belt and Road Forum for International Cooperation statt. 52 afrikanische Länder haben bereits eine Vereinbarung oder ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Doch einem Bericht der Universität Peking zufolge, der im Vorfeld des Forums veröffentlicht wurde, hat der afrikanische Kontinent ein Schuldenproblem, das China nicht ignorieren kann.
Nikkei Asia: Chinas Belt and Road kommt für Afrika zur rechten Zeit, sagt AU-Offizieller. Peking hat angekündigt, seine Infrastrukturinitiative Belt and Road auszuweiten und in den digitalen Bereich vorzudringen. Das milliardenschwere Programm wird zu Chinas wichtigstem außenpolitischen Instrument zur Einflussnahme in Entwicklungsländern. Die Initiative sei förderlich für die Entwicklung Afrikas, und die Bedenken um eine Schuldenfalle übertrieben, sagte ein hochrangiger AU-Beamter im Gespräch mit Nikkei.
Bloomberg: Südafrika fordert “gerechten” Übergang zu grüner Technologie. Auf der Tagung des IWF und der Weltbank forderte der südafrikanische Zentralbankchef die wohlhabenden Länder auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sie müssten sich an den Kosten für den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft beteiligen und dürften wichtige Technologien für den Klimawandel nicht “horten”.
The Guardian: Afrikas “optimist-in-chief”. Die Aussichten für Afrika, einen Kontinent mit den Arbeitskräften der Zukunft und den besten Investitionsmöglichkeiten, seien gut, sagt Akinwumi Adesina, Chef der Afrikanischen Entwicklungsbank, in einem Interview mit der britischen Tageszeitung. “Glauben Sie nicht mir, glauben Sie den Daten!”
The East African: Samia perfektioniert Rutos Spiel, um Handel und Investitionen anzuziehen. Die tansanische Präsidentin Samia Suluhu kehrte vergangene Woche von einem Staatsbesuch in Indien mit dem Versprechen zurück, die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Ihre diplomatische Strategie, sowohl im Westen als auch im Osten Freunde zu halten und einzubinden, spiegelt die des kenianischen Präsidenten William Ruto wider.
Wall Street Journal: Ägypten lieferte Drohnen an Sudans Armee. Mit einer Lieferung türkischer Bayraktar-Drohnen unterstützt Ägypten das sudanesische Militär im Kampf gegen den Warlord Hemeti. Die Lieferung ist der jüngste Fall einer Einmischung regionaler Mächte in den Bürgerkrieg im Sudan. Das Land wird seit langem wegen seiner strategischen Lage am Roten Meer, seines Zugangs zum Nil und seiner riesigen Goldreserven begehrt.
Al Jazeera: Frankreich zieht Truppen aus Niger ab. Der Abzug der französischen Streitkräfte wurde von Nigers Putschgenerälen nach ihrer Machtübernahme am 26. Juli rasch gefordert. Auch die USA haben inzwischen offiziell erklärt, dass der demokratisch gewählte Präsident Nigers durch einen Militärputsch abgesetzt wurde, was zur Folge hat, dass die Hilfe für Niger offiziell eingestellt wird. Eine Änderung der US-Truppenpräsenz in dem Land ist jedoch nicht geplant.
Bloomberg: Angeschlagene Transnet bittet Südafrika um Unterstützung. Südafrikas kränkelnde staatliche Güterbahn- und Hafengesellschaft hat der Regierung einen Sanierungsplan vorgelegt, der Bereiche identifiziert, die sofortige staatliche Unterstützung benötigen. Der Zusammenbruch von Transnet hat die südafrikanische Wirtschaft seit 2010 mindestens 26,7 Milliarden Dollar gekostet.
Financial Times: Nachhaltige Safari. Im Gespräch mit der Londoner Finanzzeitung erzählt ein botswanischer Student von seinen Plänen für die Tourismusbranche. Neuman Vasco strebt nach einer Wirtschaft, die die Umwelt und die Menschen in Botswana unterstützt.

Es sind alltägliche Geschichten, die Tsitsi Dangarembga erzählt. Sie sollen ihren Landsleuten Anstöße geben, sich mit den Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen. Die Geschichten handeln von komplexen Lebensumständen, Schnittstellen zwischen Tradition und Moderne, kolonialen Altlasten und sozialer Ungerechtigkeit. Für ihre jahrzehntelange Arbeit bekam sie jetzt den Afrika-Friedenspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung verliehen.
2021 bereits wurde Dangarembga mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Sie “zeigt soziale und moralische Konflikte auf, die weit über den regionalen Bezug hinausgehen und Resonanzräume für globale Gerechtigkeitsfragen eröffnen”, begründete die Jury die Auszeichnung.
Dangarembga lebt in Simbabwe, wo sie 1959, damals die britische Kronkolonie Südrhodesien, geboren wurde. Ihre Kindheit verbrachte sie zum Teil in England. An der Eliteschule Arundel School in Salisbury (heute Harare) machte Dangarembga ihren Abschluss. Sie studierte zunächst Medizin in Cambridge und Psychologie in Harare. Dann wechselte sie das Fach. Sie begann Drehbücher zu schreiben, studierte Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). Das Studium hat sie mit Auszeichnung abgeschlossen.
1988 gelang Dangarembga zwar der Durchbruch nicht im Film, aber als Schriftstellerin mit dem Roman “Nervous Conditions” (“Aufbrechen”), der vom Kampf des Dorfmädchens Tamba vom Shona-Volk im Rhodesien der 1960er Jahre handelt. Das Mädchen versucht, dem traditionellen Stammesleben zu entschlüpfen und durch Bildung sozial aufzusteigen. Das Buch der damals 25 Jahre alten Autorin, das sich mit Postkolonialismus und Frauenidentität beschäftigt, war autobiographisch gefärbt und wurde als erster Roman einer schwarzen Simbabwerin weltweit ein Erfolg. Die BBC nahm es 2018 in die Liste der 100 Bücher auf, die die Welt verändern. In Deutschland wurde das Buch ein Bestseller. Es folgten The Book of Not (2006) und This Mournable Body (2018), die die Trilogie abschlossen. “Ich hoffe, dass die Leser meine Bücher sinnvoll finden”, sagte Dangarembga im Gespräch mit Table.Media.
Trotz des Erfolges ihrer Bücher hat sich Dangarembga vom Film nie verabschiedet. Sie war an zahlreichen simbabwischen Filmen beteiligt, darunter Neria (1992), dem erfolgreichsten Film in der Geschichte Simbabwes, zu dem sie das Drehbuch schrieb. Der weltbekannte Musiker Oliver Mtukudzi schrieb den Soundtrack. Seine Lieder kennt jeder in Simbabwe. Vier Jahre später kam Everyone’s Child. Es war der erste Film, den eine schwarze Regisseurin in Simbabwe drehte, und handelte von den Herausforderungen durch Aids.
In ihren Büchern und Filmen setzt sich Dangarembga für soziale Gerechtigkeit ein, gegen willkürliche Diskriminierung und Verfolgung, prangert Korruption an. Die Autorin wurde nun für “ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement für politische Reformen und Freiheit in Simbabwe” ausgezeichnet, sagte Inge Herbert, die Regionaldirektorin für Subsahara Afrika der Friedrich-Naumann-Stiftung. Zu den ehemaligen Preisträgern zählen die Oppositionspolitiker Mmusi Maimane (Südafrika), Bobi Wine (Uganda) und Hakainde Hichilema (Sambia).
In ihrer Dankesrede im bis auf den letzten Platz gefüllten Market Theatre in Johannesburg wandte sich Dangarembga gegen ein Afrikabild, in dem korrupte Diktatoren Bürgerrechte zerreiben: “Ich glaube nicht, dass die bürgerlichen Freiheiten bedroht sind. Ich gehe davon aus, dass sie im Entstehen begriffen sind und noch etabliert werden müssen”, sagte sie. Es freue sie, einen Preis auf afrikanischem Boden in Anwesenheit vieler ihrer Mitstreiter verliehen zu bekommen.
Doch Dangarembga weiß auch, dass wirtschaftliche Freiheit eine Vorbedingung für politische Freiheit ist. Denn wer täglich damit kämpft, Essen zu finden, habe wenig Energie, sich für politische Rechte einzusetzen. Die wachsende Ungleichheit und die angespannte wirtschaftliche Lage im südlichen Afrika mache ihr Sorgen. In Simbabwe beobachtet sie zunehmende Repression durch die Führungselite. Nach den umstrittenen Wahlen im August, die zur Wiederwahl des Präsidenten Emmerson Mnangagwa führten, hätten die Staats- und Regierungschefs der Southern African Development Community (SADC) deutlicher Kritik üben müssen, findet die Autorin.
Wegen friedlicher Proteste mit der Aktivistin Julie Barnes gegen die weitverbreitete Korruption in Simbabwe, verurteilte 2022 ein Gericht vor Ort die Bestsellerautorin zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Allerdings hob der Oberste Gerichtshof das Urteil im Mai dieses Jahres nach erfolgreicher Berufung auf. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Andreas Sieren

Zum Willkommen ein Glas Moët & Chandon, Statussymbol in Südafrika. Das lenkt kurz vom 360-Grad Blick ab. Es ist sehr windig auf der schicken Dachterrasse. Die grau-beigen Fliesen gehen nahtlos in den Holzboden am Rand der Bar über. Die knapp zwei Meter hohen Glasscheiben dienen als Geländer und lassen den Blick über die Stadt ungehindert frei.
Das Alto234 (“Alto” Latein für Höhe, “234” Höhe in Metern) liegt im Johannesburger Geschäftsviertel Sandton im 57. Stockwerk des Leonardo, des ehemals höchsten Wolkenkratzers in Afrika. Dieser ist kürzlich vom Iconic Tower in der Neuen Hauptstadt Ägyptens abgelöst worden, einem 394 Meter hohen Büroturm, den ein chinesisches Bauunternehmen gebaut hat.
Der Blick von der Spitze ist atemberaubend. Im Westen reihen sich die Magaliesberge am Horizont auf. Im Norden liegt die Hauptstadt Pretoria, im Osten der Flughafen und im Süden die beeindruckende Skyline des alten Johannesburgs, der ehemaligen Wirkungsstätte von Nelson Mandala. Während sich in den unteren Etagen des Leonardo 232 Luxus-Apartments, acht Penthouse-Suiten, neun Konferenzräume, ein Gourmetrestaurant mit Pool und zahlreiche Büroräume befinden, ist das Alto234 das Wahrzeichen des Gebäudes.
Das Zentrum des Alto234 bildet eine kleine Theke, darum herum einige gemütliche Sitzecken und Bistrotische, alles in unaufdringlichen Farben. Auf dem Dach von Afrika treffen sich die gehobene Mittelschicht und Geschäftsleute, aber auch Touristen. Man muss vorher buchen, denn das Alto234 ist begehrt. Deshalb können die Betreiber es sich leisten, fast 20 Euro Eintritt zu nehmen. Das Alto234 hat auch schon mittags geöffnet. Zum endlosen Blick gibt es Tapas, Cocktails und edle Weine. Der Clou: Neben der Theke steht ein Kühlschrank mit kleinen Moët-Flaschen, der “Moët Mini Machine”. In den kleinen Flaschen bleibt der Moët länger kühl und prickelnd. as
im Vorfeld der Jahrestagung von IWF und Weltbank hatten afrikanische Länder immer wieder auf Reformen der globalen Finanzarchitektur gedrängt. Auf der vergangene Woche in Marrakesch ausgerichteten Tagung wurden afrikanische Anliegen zwar nun teilweise erhört. Doch von einer nachhaltigen Lösung kann noch keine Rede sein. Wir haben für Sie Kritikpunkte und Lösungsansätze zusammengetragen.
Auch an die bevorstehende Konferenz zum Compact with Africa sind hohe Erwartungen gerichtet – aus Afrika ebenso wie aus Deutschland. Die Einschätzungen der Experten unseres Table.Live-Briefings zum Thema hat David Renke zusammengefasst.
In Frankreichs Afrika-Politik hingegen klafft eine Lücke: Der Posten des Afrika-Beraters im Élysée-Palast ist seit Monaten unbesetzt. Welche Gefahren dieses Vakuum birgt, beschreibt Christian von Hiller.
Eine Lücke füllen will auch Elon Musk, der mit seinem Satelliteninternet-Anbieter Starlink munter in Afrika expandiert. Lucia Weiß hat sich angeschaut, was es mit Starlinks neuer Partnerschaft mit dem afrikanischen Onlinehändler Jumia auf sich hat.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Zwei Ereignisse haben das Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Marrakesch überschattet: der Ausbruch der Gewalt im Nahen Osten und das schwere Erdbeben in Marokko, dem Land, in dem das Treffen dieses Mal stattfand. An diesem Wochenende ging die einwöchige Jahrestagung von IWF und Weltbank zu Ende. In Marrakesch diskutierten Delegationen aus 189 Ländern die Aussichten für eine durch Schulden, Inflation, hohe Zinsen und Konflikte belastete Weltwirtschaft, die wachsende Wohlstandskluft zwischen reichen und armen Ländern sowie die scheiternden Bemühungen bei der Bekämpfung des Klimawandels.
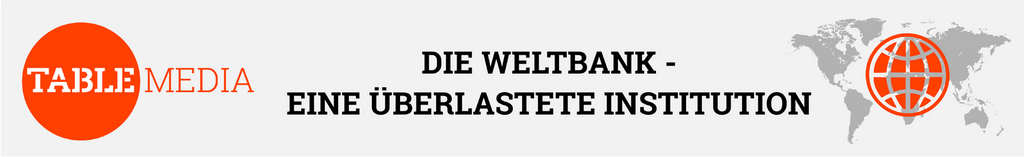
“Das große Thema in dieser Woche ist, dass die G7-Länder die Risse der zerbrochenen Versprechen übertünchen”, sagte Kate Donald, Leiterin des Büros von Oxfam International in Washington im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. “Trotz des Händeringens über die Milliarden von Dollar, die zur Bekämpfung von Armut und Klimazusammenbruch benötigt werden, gab es keine Anzeichen für neues Geld.”
Der in Accra ansässige Thinktank African Center for Economic Transformation fordert in seinem vergangene Woche veröffentlichten Marrakech Framework eine neue globale Finanzarchitektur, in der afrikanischen Stimmen mehr Gewicht zukommt. Dazu brauche es eine echte Lösung für die Schuldenkrise, mehr Zuschüsse und vergünstigte Darlehen sowie eine Verpflichtung zu einer ehrgeizigen Agenda für grünes Wachstum in Afrika. Zudem sollten mindestens fünf Länder ihre IWF-Sonderziehungsrechte an die Afrikanische Entwicklungsbank und andere afrikanische Finanzinstitutionen weiterleiten.
Am Rande der Jahrestagung gab es auch Erfolge für Afrika. Neben je einem neuen Sitz für afrikanische Länder im Vorstand von IWF und Weltbank hat sich etwa das hoch verschuldete Sambia mit seinen bilateralen Gläubigern über eine Restrukturierung seiner Staatschulden verständigt. Demnach wird Sambia in den nächsten zehn Jahren nur etwa 750 Millionen Dollar zahlen müssen, während vor der Umschuldung fast sechs Milliarden Dollar fällig waren. Die Unterzeichnung des entsprechenden Memorandum of Understanding steht allerdings noch aus. “Der nächste Schritt besteht darin, eine vergleichbare Vereinbarung mit unseren privaten Gläubigern zu treffen”, sagte Sambias Finanzminister Situmbeko Musokotwane.
Auch Äthiopien ersucht seine Gläubiger um einen Schuldenerlass. China hat dem Land bereits einen Zahlungsaufschub bis Juli 2024 gewährt, weitere Gläubiger führen noch Gespräche. Nach Angaben einer IWF-Offiziellen steht der Fonds kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung über ein Darlehensprogramm mit Äthiopien. Und auch in Ghana scheint eine Umschuldung näher zu rücken. Der IWF hoffe auf eine Einigung in den nächsten sechs bis acht Wochen, sagte der Direktor der Afrika-Abteilung.
Unterdessen hat eine Gruppe von afrikanischen Länderdirektoren der internationalen NGO Action Aid die Weltbank und den IWF dazu aufgefordert, die Schuldenlast und die den afrikanischen Ländern auferlegte Sparpolitik zu beenden. Dies soll sicherstellen, dass sie wachsen und nicht weiter leiden. Action Aid schlägt vor, allen afrikanischen Ländern die Schulden zu erlassen und ehrgeizige und progressive Steuerreformen in diesen Ländern zu unterstützen. Laut dem veröffentlichten Report habe die Austeritätspolitik von IWF und Weltbank die wirtschaftliche und menschliche Entwicklung in ganz Afrika abgewürgt.
Allerdings birgt ein Schuldenerlass für Afrika auch Risiken, etwa die Gefahr, dass die Kreditwürdigkeit der afrikanischen Schuldner so leidet, dass sie auf Jahre hinaus nicht mehr kapitalmarktfähig sind. Die Gläubiger haben sich in der inoffiziellen Gruppe Pariser Club zusammengeschlossen, die zwischen den Schuldnerregierungen und den Geberländern vermitteln will.
Die Bundesregierung hat auch im vergangenen Jahr einer Reihe afrikanischer Schuldnerländer zumindest einen Teil der Forderungen erlassen, so zum Beispiel Äthiopien, Benin und Elfenbeinküste im Rahmen der HIPC-Initiative für die ärmsten Länder. Außerhalb der HIPC-Initiative hat die Bundesregierung zudem Ägypten einen Schuldenerlass von mehr als einer Milliarde Euro gewährt. Auch Burkina Faso, Botswana und Burundi haben von einem deutschen Schuldenerlass profitiert. Insgesamt hat die Bundesregierung afrikanischen Schuldnern rund 12,1 Milliarden Euro erlassen. Somit findet schon regelmäßig ein Erlass von Schulden statt. Eine andere Frage ist selbstverständlich, ob dies genügt.
Bei der wichtigen Neuverhandlung der IWF-Quoten, von denen etwa die Stimmrechte der Mitgliedsstaaten abhängen, konnten die Tagungsteilnehmer keine Einigung erzielen. Ein von den USA unterstützter Plan zur Aufstockung der IWF-Mittel, ohne China und anderen großen Schwellenländern mehr Anteile zu geben, fand nicht genügend Unterstützung. Die Mitgliedsländer verpflichteten sich jedoch zu einer “bedeutenden Erhöhung” der Darlehensmittel bis zum Jahresende. In einem Statement forderte der IWF neue Quotenbeiträge, die “zumindest die derzeitige Mittelausstattung des Fonds aufrechterhalten”. Ein Beamter des US-Finanzministeriums erklärte gegenüber Reportern, dass es trotz der fehlenden Einigung gute Fortschritte in der Quotenfrage gebe. Eine Einigung im Oktober werde “immer wahrscheinlicher”.
Auch das Leitungsgremium der Weltbank hat kein gemeinsames Kommuniqué herausgegeben. Dies ist Meinungsverschiedenheiten über das Wording mit Blick auf die laufenden Konflikte geschuldet. In einer Erklärung wurde immerhin festgestellt, dass “die meisten Mitglieder” die Äußerungen der G20-Führer zum Krieg in der Ukraine unterstützten.
Anlässlich der Jahrestagung hat der IWF neue Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Afrika veröffentlicht. Laut Report wird Afrika im laufenden Jahr um voraussichtlich 3,2 Prozent wachsen. Damit setzt sich die Verlangsamung des afrikanischen Wachstums seit 2021 fort. Dennoch wächst der Kontinent schneller als der globale Durchschnitt von 2,9 Prozent. Für 2024 prognostizieren die IWF-Ökonomen eine Trendwende in Afrika mit einem Zuwachs von 3,8 Prozent.
Zwischen den afrikanischen Ländern bestehen jedoch erhebliche Unterschiede. Einige der diversifizierteren und dynamischeren Volkswirtschaften des Kontinents sind nicht-rohstoffintensive Länder, etwa Kenia, Ruanda und Senegal. Für diese Länder wird 2024 ein Wachstum von 5,9 Prozent erwartet. In Nordafrika hingegen dürfte das Wachstum in den Nicht-Rohstoffländern im nächsten Jahr relativ gedämpft sein, was vor allem auf die Konjunkturflaute in Ägypten zurückzuführen ist.
Weitere Artikel der Table.Media-Redaktion über die Weltbanktagung finden Sie hier.
Der französische Präsident Emmanuel Macron leidet an einer empfindlichen Personallücke in seiner Afrika-Politik. Sein Afrika-Berater Franck Paris hat nach sechs Jahren den Élysée-Palast verlassen und ist Anfang August zum Leiter von Frankreichs Vertretung in Taiwans Hauptstadt Taipeh ernannt worden. Diese wird offiziell nicht als Botschaft geführt, sondern als “Französisches Büro in Taipeh”. Dementsprechend bezeichnet sich Franck Paris auf der Website der Vertretung als “Büroleiter”.
Doch auf der Website des Élysée ist Franck Paris weiterhin als “Afrika-Berater” aufgeführt. Tatsächlich jedoch ist die Leitung der sogenannten Afrika-Zelle (cellule africaine) seit gut zwei Monaten unbesetzt. Paris’ Stellvertreterin Marie Audouard war schon vor einem Jahr zur Hotelgruppe Accor gewechselt. Sie war maßgeblich an Macrons berühmter Rede von Ouagadougou beteiligt, die er Ende November 2017 vor Studenten in Burkina Faso hielt und die einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika einleiten sollten. “Ich will an Eurer Seite stehen”, rief Macron damals den Studenten zu.
Paris’ Wechsel muss nicht im Zusammenhang mit den Rückschlägen Frankreichs in der Sahelzone in Verbindung stehen. Tatsächlich wollte der Vertraute des Präsidenten schon direkt nach Macrons Wiederwahl im April 2022 seinen Posten als Leiter der Afrika-Zelle aufgeben.
Doch nun ist in einer der schwierigsten Phasen der französischen Afrika-Politik eine Schlüsselposition vakant. Das betrifft zunächst den Élysée-Palast: Unter dem Generalsekretär Alexis Kohler arbeitet Emmanuel Bonne als Außenpolitischer Berater. Unter dem vakanten Posten des Afrika-Beraters ist Nadège Chouat für die Betreuung der Diaspora zuständig und ihr Kollege Patrik Durel für Nordafrika und den Nahen Osten. Damit werden zwar noch untergeordnete Afrika-Themen im Élysée abgedeckt, aber nicht mehr die entscheidenden Weichenstellungen.
Die Afrika-Zelle war stets die zentrale Schaltstelle für Frankreichs Afrika-Politik und damit für eine Politik, die Frankreichs Rang in der Welt sichern sollte. Sie wurde ursprünglich von Jacques Foccart geleitet, einem Vertrauensmann Charles de Gaulles’ aus Zeiten der résistance, der auch unter dem Präsidenten Pompidou sowie unter Jacques Chirac, als dieser Premierminister war, die Frankreichs Politik auf dem Kontinent maßgeblich prägte.
War die Afrika-Zelle unter de Gaulle direkt im Élysée-Palast untergebracht, musste sie 1967 einige hundert Meter entfernt ins Hôtel de Hirsch in der Rue de l’Élysée Nummer 2 umziehen, benannt nach dem bayerischen Finanzier Moritz Baron von Hirsch auf Gereuth oder auch Maurice baron de Hirsch de Gereuth. Als Nicolas Sarkozy 2007 in den Élysée-Palast einzog, löste er die Afrika-Zelle offiziell auf. Faktisch bestand sie jedoch weiterhin. Allerdings setzte sich der Bedeutungsschwund fort. Franck Paris wurde vorgehalten, dass er in Afrika zu wenig persönliches Gewicht besaß und die anti-französische Stimmung in Westafrika nie in den Griff bekam.
“Wenn die ehemalige Kolonialmacht den Eindruck erweckt, von den Ereignissen in Afrika erschüttert zu sein, dann deshalb, weil sie den Wandel der Zeiten dort nicht rechtzeitig erkannt hat“, kritisierte jüngst Luc de Barochez, Ressortleiter Außenpolitik beim Magazin Le Point. “Der Zeitenwechsel in Afrika erfordert mutige Entscheidungen.” Auch hatten im Sommer 94 Senatoren und Abgeordnete verschiedener Parteien in einem offenen Brief einen Neuanfang gefordert: “Ist es nicht an der Zeit, unsere Vision von Afrika und seiner Verbindung mit Frankreich zu überdenken?”, fragten sie.
Es wäre somit möglich, dass Macron die Afrika-Zelle nun tatsächlich auflöst. Die cellule africaine doppelt ohnehin die Afrika-Abteilung des Außenministeriums. Dort leitet Christophe Bigot die Direktion für Afrika und den Indischen Ozean mit Clément Leclerc als Stellvertreter. Unter ihnen agieren vier “sous-directeurs” für die Unterregionen des Kontinents.
Hinzu kommen Abteilungen im Außenministerium, die ebenfalls Afrika im Blick behalten, etwa die Abteilung Globalisierung, die Abteilung Auslandsfranzosen oder die Abteilung für Entwicklungspolitik, in der das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit aufgegangen ist und die heute die Staatssekretärin Chrysoula Zacharopoulou leitet.
Dass Frankreichs Außenpolitik künftig allein im Außenministerium am Quai d’Orsay betreut wird, gilt als unwahrscheinlich. Schließlich gilt die Bestimmung der Außenpolitik als Vorrecht des Präsidenten. Allerdings lässt Macron derzeit einen zentralen Posten im Élysée unbesetzt. Das erhöht die Gefahr der Orientierungslosigkeit in einer kritischen Phase der Beziehungen zu Afrika.
Einig waren sich beim Table.Live Briefing eigentlich alle: Von Compact with Africa (CwA) haben alle teilnehmenden zwölf afrikanischen Länder profitiert – insbesondere nach der Corona-Pandemie. Die Erwartungen gut einen Monat vor der G20 Compact with Africa-Chancellors’ Conference am 20. November in Berlin sind allerdings unterschiedlich. Am vergangenen Mittwoch diskutierten neben Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana), Igor César (Botschafter von Ruanda) und Christoph Kannengießer (Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft), auch Steffen Meyer (Bundeskanzleramt) und Anna Rainer (Bayer AG) im Table.Live Briefing, was von dem Gipfel zu erwarten ist.
Die Zahlen sprechen zunächst für sich. Laut dem Bericht der Africa Advisory Group der Weltbank haben die CwA-Länder nach der Pandemie ein stärkeres Wirtschaftswachstum als die übrigen afrikanischen Staaten. Offen bleibt allerdings, wie groß der tatsächliche Anteil der CwA-Initiative an dem Erfolg der Mitgliedsländer ist. Diese seien ohnehin bereits vor der Initiative dem Handel und ausländischen Direktinvestitionen aufgeschlossen gewesen. Im vergangenen Jahr stiegen die angekündigten Direktinvestitionen in den CwA-Ländern auf 133 Milliarden Dollar – und überragen bei weitem das Vorpandemie-Niveau (rund 80 Milliarden Dollar).
Trotz aller Erfolge hält sich jedoch das Interesse an der Initiative insbesondere südlich des Äquators in Grenzen. Nur Ruanda hat sich als einziges Land auf der Südhalbkugel bislang angeschlossen. Das Angebot der 2017 auf Betreiben Deutschlands ins Leben gerufen G20-Initiative richtet sich jedoch ausdrücklich an alle afrikanischen Länder. Ziel ist es, durch bessere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen mehr private Investitionen in die teilnehmenden Länder zu locken. Am 20. November lädt Bundeskanzler Olaf Scholz die teilnehmenden Staatschefs des CwA nach Berlin ein, um der Initiative neuen Schwung zu verleihen.
Gina Ama Blay (Botschafterin von Ghana):
“Der G20-CwA hat ohne Frage eine Plattform für private Investoren geschaffen, um in Afrika zu investieren. Als Folge sehen wir, dass unsere Wirtschaft wächst. Ich bin zuversichtlich, dass mit der Fortsetzung des Compacts ähnliche Partnerschaften und Investitionen weiter blühen werden.”
“Die Aufnahme der Afrikanischen Union als ständiges Mitglied der G20 ist der Beweis für Afrikas zunehmenden Einfluss auf der Weltbühne. Afrika ist reif für Investitionen. Das enorme wirtschaftliche Potenzial des afrikanischen Kontinents wird durch das afrikanische Freihandelsabkommen AfCFTA unterstrichen. Mit Partnern wie Deutschland und den G20 können alle Beteiligten die Vorteile der Umsetzung von AfCFTA voll ausschöpfen und Geschäfte in ganz Afrika machen – zum gegenseitigen Vorteil.”
Steffen Meyer (Bundeskanzleramt):
“Der G20 Compact with Africa hat sich als zentrale multilaterale Initiative auf Augenhöhe zwischen G20 und afrikanischen Ländern etabliert. Das Beitrittsinteresse weiterer afrikanischer Länder unterstreicht dessen anhaltende Attraktivität. Mit der G20-CwA-Konferenz am 20. November in Berlin setzt der Bundeskanzler einen wichtigen Impuls für den CwA sowie für das deutsche Engagement und die Kooperationsbereitschaft mit Afrika.
Die CwA-Länder haben ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und die Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen verbessert. Mehr private Investitionen in lokale Wertschöpfung sind der Schlüssel zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand vor Ort.”
Christoph Kannengießer (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft):
“Der CwA ist aus unserer Sicht ein sinnvoller Ansatz. Er verknüpft erstmals sehr konsequent die Themen Investitionsförderung und Entwicklung miteinander. Die verstärkte Investitionstätigkeit in vielen CwA-Ländern zeigt, dass der Weg richtig ist und weitergeführt werden sollte.”
“Investitionen aus Deutschland kommen häufig aus mittelständischen Firmen, für die Finanzierungsthemen und Risikoabsicherung eine wesentliche Rolle spielen. Das im Rahmen des CwA entwickelte Kreditprogramm “Africa Connect” für kleinere Investitionsprojekte hat einiges erleichtert und sollte gezielt weiterentwickelt werden. Außerdem kann bei staatlichen Garantien noch mehr gemacht werden.”
Anna Rainer (Bayer AG):
“Die erneute Ausrichtung des “Compact with Africa”-Gipfels in Berlin ist begrüßenswert, ich hoffe nun auf eine pragmatische und unternehmerisch orientierte Zusammenarbeit mit Afrika, der Kontinent kann sich seine Partner mittlerweile aussuchen und wird nicht auf Deutschland warten.”
“Die Impulse von Gina Ama Blay und Igor César haben klar gezeigt, dass die Bereiche Gesundheit und Landwirtschaft bei unseren afrikanischen Partnern ganz oben stehen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, brauchen jedoch verlässliche Rahmenbedingungen.”
“Dein Starlink-Kit kommt mit allem, was Du brauchst, um innerhalb von Minuten online zu gehen. Dazu gehören Dein Starlink, ein Wifi-Router, Kabel und eine Basisstation”, so steht es in der Produktanzeige auf der Handelsplattform Jumia Nigeria. Lieferung in Lagos möglich in den kommenden vier bis fünf Tagen.
Jumia, nach eigenen Angaben die größte Plattform für E-Commerce auf dem afrikanischen Kontinent, hat sich mit Elon Musks niedrig fliegendem Satelliteninternet Starlink verbandelt. Der Umfang der Zusammenarbeit klingt bescheiden: Die Handelsplattform wird das Hardware-Kit für den Zugang zu Starlink vertreiben. Zunächst in Nigeria, bald dann auch in Kenia und perspektivisch in allen elf Ländern, in denen Jumia aktiv ist, so heißt es in der Pressemitteilung von Jumia Anfang Oktober.
Doch in dieser Partnerschaft steckt viel mehr, sie könnte das next big thing auf dem Kontinent werden. Starlink ging vor wenigen Tagen in Sambia online. Außerdem ist es in Nigeria, Kenia, Mosambik, Ruanda und Malawi verfügbar. Bis Jahresende sollen mindestens Angola und Eswatini dazukommen.
Die Idee: Musks niedrig fliegende Satelliten ermöglichen Menschen auch in ländlichen und entlegenen Gebieten den Internetzugang, aber auch in Städten, wo die Daten nicht schnell genug fließen. “Für das Wachstum und die Entwicklung in Afrika ist das an sich eine sehr gute Nachricht. Es gibt zahlreiche Startups aus dem Tech-Bereich, die nicht durchstarten können, weil es kein schnelles Internet in manchen Gegenden gibt”, analysiert der senegalesische Tech-Unternehmer Boubacar Ba im Gespräch mit Table.Media.
Und was ist für Jumia drin? So einiges, wenn es gut läuft. Denn die Plattform, die Handel, Logistik und Online-Zahlungen zusammenbringt, steht derzeit nicht besonders gut da. Um satte Minus 40 Prozent rauschte die im Nasdaq notierte Aktie der Jumia Technologies AG, in den vergangenen drei Monaten nach unten. Ein verbesserter Zugang zum Internet könnte den E-Commerce-Giganten Jumia in der Gunst der Anleger steigen lassen.
“Jumia ist vor allem in den Hauptstädten präsent, aber wer 200 oder 300 Kilometer weit weg ist, der hat es schwieriger mit Bestellen und Liefernlassen. Stell’ Dir vor, Du bist auf einem Dorf, egal ob im Senegal oder Nigeria, und Du hast ein Smartphone und kannst die App von Jumia installieren. Aber dann geht das Internet nicht richtig. Sehr schnelles Internet bereitzustellen, wird Jumia helfen, mehr Menschen den Zugang zu ihrer Plattform zu ermöglichen”, glaubt der Informatiker Ba.
Jumia ist derzeit in Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste, Senegal, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Kenia, Uganda und Südafrika aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Menschen. Das Wachstum des Unternehmens könnte weitere Arbeitsplätze schaffen. Das Potenzial der Märkte ist auf jeden Fall riesig: Mit der wachsenden Bevölkerung und steigendem Wohlstand in der Mittelschicht wird auch die Lust auf Konsumgüter und die Kaufkraft der Menschen in Afrika größer.
Aber, so findet Tech-Unternehmer Ba, gesunde Skepsis ist angebracht: “Elon Musk macht nichts ohne Hintergedanken. Da muss man sehen, was dahinter steckt als Strategie. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Musk irgendwann Jumia übernehmen will.”
Musks sprunghaftes Verhalten, seine Eingriffe ins unternehmerische Tagesgeschäft sowie politische Kommentare sorgen schon bei anderen seiner Unternehmen, wie dem Kurznachrichtendienst X – früher Twitter – für Aufsehen und geben Grund zur Beunruhigung. Denn als Internet-Provider hat Musk auch Zugriff auf sensible Daten.
Fest steht: Die Partnerschaft von Jumia und Starlink dürfte den Auftakt zur großflächigen Expansion von Musk in Afrika darstellen. Google und Facebook waren zuvor mit ihren Internet-Initiativen gescheitert. Mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung ist Afrika allerdings wichtig für die Zukunft – und nicht ohne Grund ein umkämpfter Markt.
In Baden-Württemberg ist man stolz darauf, seit mehr als 40 Jahren Verbindungen und Partnerschaften mit Afrika zu pflegen. Bereits in den 1980er Jahren schloss die Landesregierung eine Partnerschaft mit Burundi. Diese hält bis heute an. Erst im Juli besuchte Staatssekretär Rudi Hoogvliet, der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund, das Land in Ostafrika. Dort besichtigte er ein von der Landesregierung gefördertes Kaffeeprojekt. Doch klassische Entwicklungspolitik reicht nicht aus, ist man in Stuttgart überzeugt.
Deshalb will die Landesregierung den Handel und privatwirtschaftliche Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent fördern. “Afrika ist der Kontinent der Zukunft: Seine junge Bevölkerung sprüht vor Wissensdurst und Unternehmergeist. Das ist für Baden-Württemberg, gerade auch für unsere Unternehmen und Hochschulen, attraktiv”, sagt Hoogvliet.
Zur Wahrheit gehöre trotz aller Partnerschaft aber auch, dass Europa etwas schlafmützig gegenüber seinem afrikanischen Nachbarn war. “Andere Länder wie China oder Indien, die Türkei oder Saudi-Arabien haben uns zwischenzeitlich mit ihrem Engagement überholt“, kritisiert der Staatssekretär. Doch Baden-Württemberg will den Anschluss nicht verlieren. “Wir sind seit 2019 neben Bayern das einzige deutsche Land, das eine Afrika-Strategie aufgestellt hat und diese auch konsequent verfolgt – mit drei Schwerpunkten: Wirtschaft, Wissenschaft und eben auch: Partnerschaft.”
Seit sechs Jahren unterstützt die Regierung daher auch das Global Partnership for African Development Forum (G-PAD), das vom Verein Lead Africa International veranstaltet wird. Am 20. Oktober findet die sechste Ausgabe in der Landesvertretung Baden-Württemberg statt. “Das Ziel ist es, Interessensgruppen aus Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft zusammenzubringen”, sagt Timi Olanrewaju, Geschäftsführer von Lead Africa International. Dabei solle auch der Fokus verschoben werden: Die Frage für den Westen dürfe nicht länger sein, was können wir für Afrika tun, sondern vielmehr, wie kann eine Zusammenarbeit mit Afrika aussehen. Dabei soll dem Wunsch vieler afrikanischer Länder nach Investitionen statt Entwicklungshilfen Sorge getragen werden. “Die Hilfen haben nicht wirklich funktioniert und Afrika weitergebracht”, sagt Olanrewaju.
Seit einem Jahr findet G-PAD in Berlin statt. Zuvor hatte es vier Foren in Baden-Württemberg gegeben. Mit dem Umzug in die Hauptstadt erhoffen sich die Veranstalter noch mehr öffentliche Sichtbarkeit und eine Internationalisierung. Bislang werden rund 600 Teilnehmer zur Veranstaltung erwartet – sowohl online als auch vor Ort.
Am kommenden Freitag werden neben den Botschaftern von Ruanda, Südafrika, Lesotho und Simbabwe auch der streitbare und in Ostafrika sehr populäre Anwalt und Aktivist Patrick Lumumba erwartet. Unter dem Namen Professor Lumumba betreibt einen regierungskritischen Blog, den unzählige Menschen in Ostafrika lesen, teilen und diskutieren. Der Kenianer, der zwischen 2010 und 2011 Direktor der Antikorruptionskommission seines Landes war, wird per Video von Nairobi zugeschaltet sein.
Auch Philipp Keil, Geschäftsführer der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), wird als Redner auf dem Forum zu hören sein. Sein Ziel für die Konferenz ist es, dass das Thema Afrika auch in der Berliner Politik und den Institutionen stärker wahrgenommen wird. “60 Prozent der Zukunftsressourcen kommen vom afrikanischen Kontinent. Er ist der reichste Kontinent überhaupt. Wir müssen in Politik und Gesellschaft viel mehr Bewusstsein für unseren Nachbarkontinent schaffen”, sagt Keil zu Table.Media.
Die SEZ ist einer der wichtigsten Geldgeber des G-PADs. Die Stiftung wurde Anfang der 1990er Jahre vom baden-württembergischen Landtag gegründet, um Netzwerke in die Länder des globalen Südens aufzubauen. Mit der Partnerschaft mit Burundi stand Afrika seit Beginn der Stiftung im Mittelpunkt. dre
Die US-amerikanische Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda will 40 Millionen Dollar in die Herstellung von Impfstoffen in Afrika investieren. Dabei soll es vorrangig um die Produktion von mRNA-Impfstoffen gehen, wie die Stiftung in der vergangenen Woche in Dakar am Rande ihrer jährlichen Großveranstaltung “Global Challenges” mitteilte.
mRNA-Impfstoffe seien für die Bekämpfung vieler Krankheiten wie etwa dem Rift-Valley-Fieber oder Tuberkulose vielversprechend, sagte Gates der Associated Press. Das Institut Pasteur im Senegal sowie das Forschungsinstitut Biovac in Südafrika erhalten nach Angaben der Stiftung jeweils fünf Millionen Dollar, um mRNA-Technologie von der Gesellschaft Quantoom Bioscience zu erwerben und dann für die lokale Impfstoffproduktion zu nutzen. Das belgische Unternehmen Quantoom Bioscience, das die Gates-Stiftung bereits in der Vergangenheit gefördert hat, erhält nochmals 20 Millionen Dollar für die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung seiner Produkte. Zehn Millionen Dollar sollen an ein weiteres mRNA-Impfstoff-Unternehmen fließen, das noch bekanntgegeben werden soll.
“Die Ausweitung unserer Fähigkeit, günstige mRNA-Impfstoffe in Afrika zu entwickeln und herzustellen, ist eine wichtige und notwendige Etappe, um eine Selbstversorgung mit Impfstoffen der Region zu erreichen”, sagte der Direktor des Pasteur-Instituts in Dakar, Amadou Sall, in der lokalen Presse. Das Pasteur-Institut stellt unter anderem seit Jahrzehnten Impfstoff gegen Gelbfieber her.
Die Gates-Stiftung will sich nach Berichten in der senegalesischen Presse künftig stärker an das Land binden: In Dakar soll das Westafrika-Büro der einflussreichen Stiftung entstehen, die bereits Dependancen in Abuja, Nairobi und Johannesburg unterhält. Die Gates-Stiftung ist nach eigenen Angaben in 49 Ländern auf dem Kontinent mit Projekten in den Bereichen Gesundheit, Ungleichheit und Armutsbekämpfung aktiv. lcw
Der erste Jahrgang des von Deutschland mitgeförderten Masterstudiengangs zu erneuerbaren Energien an vier westafrikanischen Universitäten hat erfolgreich abgeschlossen. Die 59 Studierenden aus 15 Ländern der Ecowas feierten in der vergangenen Woche die Übergabe ihrer Zeugnisse, wie das Forschungszentrum Jülich gegenüber Table.Media bestätigte.
Ein Forschungszentrum in Accra, Ghana (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) koordiniert den zweijährigen internationalen Master in “Energie und Grünem Wasserstoff”. Die Studierenden können zwischen vier Schwerpunkten je nach Universität wählen: Photovoltaik in Niger (Université Abdou Moumouni de Niamey), Georessourcen in der Elfenbeinküste (Université Félix Houphouët-Boigny), Bioenergie in Togo (Université de Lomé) sowie Wirtschaft im Senegal (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).
Während des Masters absolvierten die Studierenden einen sechsmonatigen Aufenthalt an deutschen Partneruniversitäten, entweder an der RWTH Aachen oder am Forschungszentrum Jülich.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert den innovativen Studiengang zunächst noch bis 2025, mit acht Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Energieforschungsprogramms “Innovationen für die Energiewende”. Weitere Informationen über den Termin für die nächste Bewerbungsrunde 2024 lagen noch nicht vor.
Inwiefern die Zusammenarbeit mit der Partneruniversität in Niamey nach dem Staatstreich in Niger betroffen sein könnte, war bis Redaktionsschluss nicht zu klären. lcw

Die Entfremdung zwischen BMZ und Privatwirtschaft sei “nie größer gewesen”, konstatierte jüngst ein Berater, der seit Jahrzehnten im Afrika-Geschäft aktiv ist. Mit diesem Urteil steht er nicht alleine: Wer Wirtschaftsvertreter auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anspricht, sollte auf Unmutsbekundungen gefasst sein.
Hausherrin Svenja Schulze (SPD) wäre gut beraten, solche Aussagen nicht als Lobby-Getöse abzutun. Denn Unmut äußern nicht nur die üblichen Verdächtigen aus Verbänden und Konzernen, die gerne politischen Druck aufbauen. Auch Mittelständler, Gründer und Sozialunternehmer sind schlecht auf das BMZ zu sprechen.
Damit steht Schulzes Strategie auf tönernen Füßen. Schließlich soll die Wirtschaft eine zentrale Rolle in ihrer Entwicklungspolitik spielen. Das BMZ werde “einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor setzen”, heißt es etwa in der überarbeiteten Afrika-Strategie. Unternehmen sollen demnach verstärkt vor Ort investieren und Jobs schaffen.
Wer kooperieren will, muss Partnern allerdings Wertschätzung zeigen. Und hier liegt das Problem: In ihren Reden, Interviews und Social-Media-Posts erweckt Schulze allzu oft den Eindruck, sie wolle Unternehmen an die Kandare nehmen statt ihnen den Weg zu ebnen. Wie schwer es ihr fällt, den richtigen Ton zu treffen, illustrierte sie Ende September auf X (ehemals Twitter):
“Ziel der neuen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist, dass mehr Menschen von den Ergebnissen profitieren”, schrieb Schulze. “Mir ist wichtig, dass Frauen & Gewerkschaften eine größere Rolle bekommen. Künftig werden wir zudem alle Projekte auf Klimaschutz, Sozial- & Umweltstandards überprüfen.”
Klar, das klingt gut. Aber ist das eine Botschaft, mit der Schulze Manager für Investitionen in Afrika und das neue BMZ-Programm “Partners in Transformation” gewinnen kann? Natürlich nicht. Man muss weder verblendeter Lobbyist noch beinharter Wirtschaftsliberaler sein, um diesen Post als Ermahnung und als Ankündigung zusätzlicher Bürokratie zu lesen.
Was, um Himmels Willen, ist so schwer daran, in der zentralen Botschaft zum neuen BMZ-Kooperationsangebot wenigstens einen Hauch Wertschätzung für Unternehmertum auszudrücken? Kommunikatoren wissen: Wer Menschen überzeugen will, muss eine emotionale Verbindung aufbauen – und Themen ansprechen, die sie bewegen.
Dieser Post und andere Botschaften sind dafür nicht geeignet. Im Gegenteil: Schulze erweckt den Eindruck, als adressiere sie statt der Wirtschaft vor allem das eigene Lager. Das muss sich ändern, wenn sie mehr Privatkapital für Entwicklungsziele mobilisieren will. Ohne besseren Draht zu Unternehmen dürften die guten konzeptionellen Ansätze des BMZ verpuffen.
Da gute Kommunikation mit Zuhören beginnt, sollte die Ministerin jetzt auf ihre Kritiker zugehen. Nur auf Basis eines Verständnisses dafür, was Entscheider bewegt, kann sie bessere Botschaften senden und bestenfalls einen partnerschaftlichen Geist etablieren. Dafür muss sie übrigens nicht von ihren Prinzipien abrücken: Weite Teile der Wirtschaft stehen hinter ambitionierten ESG-Zielen und haben bereits viele Hebel in Bewegung gesetzt. Anerkennung und Ansporn sind in diesen Fällen effektiver als erhobene Zeigefinger.
Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen ist von Daniel Schönwitz und Martin A. Schoeller das Buch: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft”.
South China Morning Post: China verteidigt Afrika-Investitionen im Vorfeld des Belt and Road Forum. In dieser Woche findet in China das dritte Belt and Road Forum for International Cooperation statt. 52 afrikanische Länder haben bereits eine Vereinbarung oder ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Doch einem Bericht der Universität Peking zufolge, der im Vorfeld des Forums veröffentlicht wurde, hat der afrikanische Kontinent ein Schuldenproblem, das China nicht ignorieren kann.
Nikkei Asia: Chinas Belt and Road kommt für Afrika zur rechten Zeit, sagt AU-Offizieller. Peking hat angekündigt, seine Infrastrukturinitiative Belt and Road auszuweiten und in den digitalen Bereich vorzudringen. Das milliardenschwere Programm wird zu Chinas wichtigstem außenpolitischen Instrument zur Einflussnahme in Entwicklungsländern. Die Initiative sei förderlich für die Entwicklung Afrikas, und die Bedenken um eine Schuldenfalle übertrieben, sagte ein hochrangiger AU-Beamter im Gespräch mit Nikkei.
Bloomberg: Südafrika fordert “gerechten” Übergang zu grüner Technologie. Auf der Tagung des IWF und der Weltbank forderte der südafrikanische Zentralbankchef die wohlhabenden Länder auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sie müssten sich an den Kosten für den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft beteiligen und dürften wichtige Technologien für den Klimawandel nicht “horten”.
The Guardian: Afrikas “optimist-in-chief”. Die Aussichten für Afrika, einen Kontinent mit den Arbeitskräften der Zukunft und den besten Investitionsmöglichkeiten, seien gut, sagt Akinwumi Adesina, Chef der Afrikanischen Entwicklungsbank, in einem Interview mit der britischen Tageszeitung. “Glauben Sie nicht mir, glauben Sie den Daten!”
The East African: Samia perfektioniert Rutos Spiel, um Handel und Investitionen anzuziehen. Die tansanische Präsidentin Samia Suluhu kehrte vergangene Woche von einem Staatsbesuch in Indien mit dem Versprechen zurück, die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Ihre diplomatische Strategie, sowohl im Westen als auch im Osten Freunde zu halten und einzubinden, spiegelt die des kenianischen Präsidenten William Ruto wider.
Wall Street Journal: Ägypten lieferte Drohnen an Sudans Armee. Mit einer Lieferung türkischer Bayraktar-Drohnen unterstützt Ägypten das sudanesische Militär im Kampf gegen den Warlord Hemeti. Die Lieferung ist der jüngste Fall einer Einmischung regionaler Mächte in den Bürgerkrieg im Sudan. Das Land wird seit langem wegen seiner strategischen Lage am Roten Meer, seines Zugangs zum Nil und seiner riesigen Goldreserven begehrt.
Al Jazeera: Frankreich zieht Truppen aus Niger ab. Der Abzug der französischen Streitkräfte wurde von Nigers Putschgenerälen nach ihrer Machtübernahme am 26. Juli rasch gefordert. Auch die USA haben inzwischen offiziell erklärt, dass der demokratisch gewählte Präsident Nigers durch einen Militärputsch abgesetzt wurde, was zur Folge hat, dass die Hilfe für Niger offiziell eingestellt wird. Eine Änderung der US-Truppenpräsenz in dem Land ist jedoch nicht geplant.
Bloomberg: Angeschlagene Transnet bittet Südafrika um Unterstützung. Südafrikas kränkelnde staatliche Güterbahn- und Hafengesellschaft hat der Regierung einen Sanierungsplan vorgelegt, der Bereiche identifiziert, die sofortige staatliche Unterstützung benötigen. Der Zusammenbruch von Transnet hat die südafrikanische Wirtschaft seit 2010 mindestens 26,7 Milliarden Dollar gekostet.
Financial Times: Nachhaltige Safari. Im Gespräch mit der Londoner Finanzzeitung erzählt ein botswanischer Student von seinen Plänen für die Tourismusbranche. Neuman Vasco strebt nach einer Wirtschaft, die die Umwelt und die Menschen in Botswana unterstützt.

Es sind alltägliche Geschichten, die Tsitsi Dangarembga erzählt. Sie sollen ihren Landsleuten Anstöße geben, sich mit den Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen. Die Geschichten handeln von komplexen Lebensumständen, Schnittstellen zwischen Tradition und Moderne, kolonialen Altlasten und sozialer Ungerechtigkeit. Für ihre jahrzehntelange Arbeit bekam sie jetzt den Afrika-Friedenspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung verliehen.
2021 bereits wurde Dangarembga mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Sie “zeigt soziale und moralische Konflikte auf, die weit über den regionalen Bezug hinausgehen und Resonanzräume für globale Gerechtigkeitsfragen eröffnen”, begründete die Jury die Auszeichnung.
Dangarembga lebt in Simbabwe, wo sie 1959, damals die britische Kronkolonie Südrhodesien, geboren wurde. Ihre Kindheit verbrachte sie zum Teil in England. An der Eliteschule Arundel School in Salisbury (heute Harare) machte Dangarembga ihren Abschluss. Sie studierte zunächst Medizin in Cambridge und Psychologie in Harare. Dann wechselte sie das Fach. Sie begann Drehbücher zu schreiben, studierte Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). Das Studium hat sie mit Auszeichnung abgeschlossen.
1988 gelang Dangarembga zwar der Durchbruch nicht im Film, aber als Schriftstellerin mit dem Roman “Nervous Conditions” (“Aufbrechen”), der vom Kampf des Dorfmädchens Tamba vom Shona-Volk im Rhodesien der 1960er Jahre handelt. Das Mädchen versucht, dem traditionellen Stammesleben zu entschlüpfen und durch Bildung sozial aufzusteigen. Das Buch der damals 25 Jahre alten Autorin, das sich mit Postkolonialismus und Frauenidentität beschäftigt, war autobiographisch gefärbt und wurde als erster Roman einer schwarzen Simbabwerin weltweit ein Erfolg. Die BBC nahm es 2018 in die Liste der 100 Bücher auf, die die Welt verändern. In Deutschland wurde das Buch ein Bestseller. Es folgten The Book of Not (2006) und This Mournable Body (2018), die die Trilogie abschlossen. “Ich hoffe, dass die Leser meine Bücher sinnvoll finden”, sagte Dangarembga im Gespräch mit Table.Media.
Trotz des Erfolges ihrer Bücher hat sich Dangarembga vom Film nie verabschiedet. Sie war an zahlreichen simbabwischen Filmen beteiligt, darunter Neria (1992), dem erfolgreichsten Film in der Geschichte Simbabwes, zu dem sie das Drehbuch schrieb. Der weltbekannte Musiker Oliver Mtukudzi schrieb den Soundtrack. Seine Lieder kennt jeder in Simbabwe. Vier Jahre später kam Everyone’s Child. Es war der erste Film, den eine schwarze Regisseurin in Simbabwe drehte, und handelte von den Herausforderungen durch Aids.
In ihren Büchern und Filmen setzt sich Dangarembga für soziale Gerechtigkeit ein, gegen willkürliche Diskriminierung und Verfolgung, prangert Korruption an. Die Autorin wurde nun für “ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement für politische Reformen und Freiheit in Simbabwe” ausgezeichnet, sagte Inge Herbert, die Regionaldirektorin für Subsahara Afrika der Friedrich-Naumann-Stiftung. Zu den ehemaligen Preisträgern zählen die Oppositionspolitiker Mmusi Maimane (Südafrika), Bobi Wine (Uganda) und Hakainde Hichilema (Sambia).
In ihrer Dankesrede im bis auf den letzten Platz gefüllten Market Theatre in Johannesburg wandte sich Dangarembga gegen ein Afrikabild, in dem korrupte Diktatoren Bürgerrechte zerreiben: “Ich glaube nicht, dass die bürgerlichen Freiheiten bedroht sind. Ich gehe davon aus, dass sie im Entstehen begriffen sind und noch etabliert werden müssen”, sagte sie. Es freue sie, einen Preis auf afrikanischem Boden in Anwesenheit vieler ihrer Mitstreiter verliehen zu bekommen.
Doch Dangarembga weiß auch, dass wirtschaftliche Freiheit eine Vorbedingung für politische Freiheit ist. Denn wer täglich damit kämpft, Essen zu finden, habe wenig Energie, sich für politische Rechte einzusetzen. Die wachsende Ungleichheit und die angespannte wirtschaftliche Lage im südlichen Afrika mache ihr Sorgen. In Simbabwe beobachtet sie zunehmende Repression durch die Führungselite. Nach den umstrittenen Wahlen im August, die zur Wiederwahl des Präsidenten Emmerson Mnangagwa führten, hätten die Staats- und Regierungschefs der Southern African Development Community (SADC) deutlicher Kritik üben müssen, findet die Autorin.
Wegen friedlicher Proteste mit der Aktivistin Julie Barnes gegen die weitverbreitete Korruption in Simbabwe, verurteilte 2022 ein Gericht vor Ort die Bestsellerautorin zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Allerdings hob der Oberste Gerichtshof das Urteil im Mai dieses Jahres nach erfolgreicher Berufung auf. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Andreas Sieren

Zum Willkommen ein Glas Moët & Chandon, Statussymbol in Südafrika. Das lenkt kurz vom 360-Grad Blick ab. Es ist sehr windig auf der schicken Dachterrasse. Die grau-beigen Fliesen gehen nahtlos in den Holzboden am Rand der Bar über. Die knapp zwei Meter hohen Glasscheiben dienen als Geländer und lassen den Blick über die Stadt ungehindert frei.
Das Alto234 (“Alto” Latein für Höhe, “234” Höhe in Metern) liegt im Johannesburger Geschäftsviertel Sandton im 57. Stockwerk des Leonardo, des ehemals höchsten Wolkenkratzers in Afrika. Dieser ist kürzlich vom Iconic Tower in der Neuen Hauptstadt Ägyptens abgelöst worden, einem 394 Meter hohen Büroturm, den ein chinesisches Bauunternehmen gebaut hat.
Der Blick von der Spitze ist atemberaubend. Im Westen reihen sich die Magaliesberge am Horizont auf. Im Norden liegt die Hauptstadt Pretoria, im Osten der Flughafen und im Süden die beeindruckende Skyline des alten Johannesburgs, der ehemaligen Wirkungsstätte von Nelson Mandala. Während sich in den unteren Etagen des Leonardo 232 Luxus-Apartments, acht Penthouse-Suiten, neun Konferenzräume, ein Gourmetrestaurant mit Pool und zahlreiche Büroräume befinden, ist das Alto234 das Wahrzeichen des Gebäudes.
Das Zentrum des Alto234 bildet eine kleine Theke, darum herum einige gemütliche Sitzecken und Bistrotische, alles in unaufdringlichen Farben. Auf dem Dach von Afrika treffen sich die gehobene Mittelschicht und Geschäftsleute, aber auch Touristen. Man muss vorher buchen, denn das Alto234 ist begehrt. Deshalb können die Betreiber es sich leisten, fast 20 Euro Eintritt zu nehmen. Das Alto234 hat auch schon mittags geöffnet. Zum endlosen Blick gibt es Tapas, Cocktails und edle Weine. Der Clou: Neben der Theke steht ein Kühlschrank mit kleinen Moët-Flaschen, der “Moët Mini Machine”. In den kleinen Flaschen bleibt der Moët länger kühl und prickelnd. as
