die Tinte unter dem Vertrag über die Brics-Erweiterung ist noch nicht trocken, da gibt es schon ein erstes konkretes Ergebnis: China wird Südafrika dabei unterstützen, seine klimaschädlichen Kraftwerke zu modernisieren. Das Land sei ein dominierender Akteur bei Erneuerbaren Energien und habe sein eigenes Netz erfolgreich modernisiert. Andreas Sieren, der für uns auch den Brics-Gipfel begleitete, kennt die Details.
Simbabwe hat gewählt, und Präsident Emmerson Mnangagwa damit seine zweite Amtszeit. Doch die Umstände der Wahl werden von internationalen Beobachtern heftig kritisiert: Von mangelnder Transparenz, Einschüchterung und Gewalt ist die Rede. Unter diesen Umständen ist fraglich, ob das Land wieder Anschluss an die internationale Gemeinschaft findet und vor allem seine enormen wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommt.
Der Afrika-Experte Robert Kappel bilanziert in seinem Standpunkt für uns die Brics-Erweiterung, die dem Staatenbund sechs neue Mitglieder bringt, darunter mit Ägypten und Äthiopien zwei afrikanische. Kappel vertritt die Ansicht, dass damit eine weltwirtschaftliche Neuvermessung beginne, von der zunächst vor allem China profitiere. Die deutsche Außenpolitik sei illusionär und habe bis heute kein attraktives Gegenangebot für Staaten, die dem Westen eher ablehnend gegenüber stehen.
Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Während des Brics-Gipfels vergangene Woche hat der südafrikanische Elektrizitätsminister Kgosientsho Ramokgopa zur Eile aufgerufen. Denn Südafrika produziert derzeit regelmäßig bis zu rund zehn Prozent weniger Strom, als es braucht. Ein Großteil der vom staatlichen Stromkonzern Eskom betriebenen Kraftwerke sind marode. Jahrelang hat Eskom die Wartung vernachlässigt. Hinzu kamen Korruption und Missmanagement, die das Stromnetz fast zum Zusammenbruch brachten. Zudem mangelt es an Überland-Stromleitungen. Seit Jahren gibt es in Südafrika “Load shedding”, den gesteuerten Lastabwurf, bei dem der Strom planmäßig für Stunden abgeschaltet wird: Der wirtschaftliche Schaden allein in diesem Jahr wird nach Schätzungen der Zentralbank rund 650 Millionen Euro betragen.
Jetzt wollen China und Südafrika enger zusammenarbeiten. Die Vorarbeit wurde bereits im Juni geleistet, als Ramokgopa zu Gesprächen nach China reiste. Am Rande des Brics-Gipfels vergangene Woche in Johannesburg wurde die Gemeinsame Kooperationsvereinbarung im Bereich Grüner Energie unterzeichnet. Acht Staatsunternehmen aus China, darunter die State Grid Corporation of China (SGCC) und die China Energy International Group (CIEG), sollen über drei Jahre lang mit der klimafreundlichen Sanierung der angeschlagenen Kraftwerke helfen. Außerdem sollen sie nach modernen Umweltstandards aufgerüstet werden, zudem will China Südafrika bei der schrittweisen Einführung von erneuerbaren Energiequellen unterstützen. “Die Energiekooperation mit China ist eine neue Entwicklung”, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. “Wir wollen sie vertiefen, insbesondere in Hinsicht auf unsere jeweiligen Verpflichtungen für eine CO2-arme und klimafreundliche Entwicklung.”
Bei seinem Staatsbesuch in Pretoria vergangene Woche vor dem Brics-Gipfel versprach der chinesische Präsident Xi Jinping außerdem Soforthilfe von rund acht Millionen Euro, darunter Stromgeneratoren und Solarstromsysteme, die vor allem in Krankenhäusern und Polizeistationen verwendet werden sollen. Hinzu kommen 25 Millionen Euro Entwicklungshilfe für verschiedene dringende Maßnahmen. So sagte Elektrizitätsminister Ramokgopa bei einem Pressebriefing am Sonntag: “Der Grund, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, liegt darin, dass sie ein dominierender Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien sind.” China habe das eigene Netz so modernisiert, das es die Produktionsschwankungen von Erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt.
Südafrika hatte zu Beginn des Jahres auch Deutschland um Hilfe gebeten, um die angespannte Stromversorgung unter Kontrolle zu bekommen (Africa.Table berichtete). Spezialisten eines Konsortiums von fünf deutschen Unternehmen, darunter die RWE Technology International GmbH, erstellten nach einem Besuch ein Gutachten über den Zustand der existierenden Kraftwerke.
Das Ergebnis war ernüchternd, ist aus Botschaftskreisen in Pretoria zu hören. Der Bericht wurde allerdings bisher nicht veröffentlicht. Die Kraftwerke, die derzeit fast 80 Prozent des Strombedarfes des Landes abdecken, haben den Ruf, zu den dreckigsten und klimaschädlichsten der Welt zu gehören. Zusammen mit der Europäischen Union sowie Frankreich, Großbritannien und den USA, ist Deutschland Teil der “Just Energy Transition Partnership”, einer rund acht Milliarden Euro schweren Partnerschaft, die Südafrika bei der Abkehr von Kohle und dem Übergang zu einer emissionsarmen und klimaresistenten Wirtschaft unterstützen soll. Mittlerweile liegt in einer ersten Version des South Africa Renewable Energy Plan Masterplan (SAREM) vor, der die Energiewende voranbringen soll. Der Anteil von erneuerbaren Energien liegt derzeit in Südafrika bei nur 7,3 Prozent. Allerdings ist die Tendenz steigend.
Vergangenen Sonntag berichtete Minister Ramokgopa, dass Eskom im Winter die Stromversorgung leicht verbessern konnte. Er warnte aber auch, dass mit “Load shedding” im Sommer, der im September beginnt, weiter zu rechnen ist. Die Regierung müsse die Kohlekraftwerke regelmäßig warten. Seit der Minister seinen Posten im März übernommen hatte, stieg die Leistung der Kraftwerke von 40 auf 60 Prozent: Zu wenig für ein Land, das wirtschaftlich wachsen möchte und den Anspruch hat, wirtschaftlich und international eine größere Rolle zu spielen. Dennoch: Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobte Südafrika für seine Widerstandfähigkeit. Beobachter gingen ursprünglich davon aus, dass das Land am Kap wegen seiner Stromkrise 2023 in eine Rezension abrutschen würde. Stattdessen wurde die Wirtschaft durch den Dienstleistungssektor angetrieben, der sich von der Covid-Pandemie erholt hatte. Im ersten Quartal konnte ein Wachstum von 0,4 Prozent erreicht werden. Ohne die Stromkrise könnten es laut IWF 2,5 bis drei Prozent sein. Grund genug, weiter auf die Partnerschaft sowohl mit China als auch mit den westlichen Ländern zu setzen.
Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa hat bei den Wahlen am 23. und 24. August in dem Land im südlichen Afrika mit 52,6 Prozent der Stimmen eine zweite Amtszeit gewonnen. Inländische wie internationale Beobachter haben die Wahl jedoch als unfair und fehlerhaft kritisiert. Der Oppositionsführer Nelson Chamisa, der 44 Prozent der Stimmen erhielt, hat das offizielle Ergebnis nicht anerkannt und angekündigt, es vor Gericht anzufechten.
Die Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union (EU EOM) teilte mit, der Wahlprozess sei durch mangelnde Transparenz, Einschüchterung und Gewalt beeinträchtigt worden. Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats, der Commonwealth und die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) äußerten ebenfalls ernste Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses.
Ein langwieriger Streit nach den Wahlen könnte die Bemühungen Simbabwes um eine Lösung seiner langjährigen Wirtschaftskrise untergraben, die teilweise mit der Geschichte der umstrittenen Wahlen zusammenhängt. Das an Bodenschätzen reiche Land hatte gehofft, mit den Wahlen einen wichtigen Schritt in Richtung regionale und internationale Integration zu machen. Faire Wahlen waren auch entscheidend für das Streben des Landes nach internationaler Unterstützung und der Erleichterung seiner enormen Schuldenlast von fast 8,3 Milliarden Dollar.
Im Mai dieses Jahres hatte der ehemalige mosambikanische Präsident Joaquim Chissano seine Einschätzung geteilt, die Situation in Simbabwe schade dem gesamten südlichen Afrika. “Die Krise im Land hat schreckliche Folgen für die Region, da Simbabwe im Herzen des südlichen Afrikas liegt. Viele regionale Pläne zur Entwicklung der Infrastruktur, einschließlich Straßen, Eisenbahnen und Stromübertragungsleitungen, sind zum Stillstand gekommen, da sie durch das Land verlaufen müssen. Auch der kontinentale Freihandel wird durch die Situation in Simbabwe unterminiert”, so Chissano.
Auch Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), hatte Anfang des Jahres betont, dass “die internationale Gemeinschaft die Entwicklung sehr genau beobachten wird”. “Das volle Gewicht der Wiederaufnahme der Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft wird davon abhängen. Es wird auch nicht nur von den Wahlen abhängen, sondern von dem gesamten Wahlprozess, der eine glaubwürdige Wahl garantiert”, drängte Adesina.
Internationale Wirtschaftssanktionen haben Simbabwe weiter in einen Teufelskreis von unhaltbaren Schulden getrieben. So hatte Adesina vor der Wahl betont, dass ein umfassender Prozess zur Begleichung von Zahlungsrückständen und zur Lösung der Schuldenkrise für eine nachhaltige Wirtschaftserholung Simbabwes von entscheidender Bedeutung sei. Dieser müsse von den internationalen Finanzinstitutionen und der globalen Gemeinschaft unterstützt werden. Es sei wichtig, dass Simbabwe einen glaubwürdigen Wahlprozess durchführe, um wieder mit der internationalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten.
Neben Repression und der Einschüchterung von Wählern werfen Kritiker Präsident Mnangagwa und seiner Partei Zanu PF vor, durch das krampfhafte Festhalten an der Macht das simbabwische Wirtschaftswachstum lahmzulegen. In seiner Siegesrede nach dem Wahlergebnis rief der alte und neue Präsident die Konfliktparteien im Land dazu auf, sich zu vereinen und gemeinsam ein größeres Simbabwe zu schmieden. Im komplizierten Zusammenspiel von politischer, wirtschaftlicher und regionaler Dynamik bleibt Simbabwes Weg beschwerlich. Die Zukunft des Landes hängt davon ab, wie es diese Herausforderungen meistert und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung, internationale Partnerschaften und die Ausschöpfung seines reichen Potenzials anstrebt.
Farayi Machamire ist Journalist aus Simbabwe. Derzeit arbeitet er über die Internationalen Journalisten-Programme (IJP) in der Redaktion von Table.Media in Berlin.
Sambias Vorstellung des Zwischenberichts zur nachhaltigen Entwicklung auf dem UN-Nachhaltigkeitsforum hat gleich doppelt überrascht. Erstens gewährte die Regierung als eines der wenigen Länder auch einem Vertreter der Zivilgesellschaft Redezeit. Zweitens durfte dieser Redebeitrag auch noch kritisch ausfallen.
“Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderung und andere Minderheitsgruppen werden weiterhin vernachlässigt”, sagte Glenda Mulenga von der Nichtregierungsorganisation Sightsavers mit Blick auf die doch recht positive Präsentation der sambischen Regierung auf dem UN-Nachhaltigkeitsforum in New York. Dass ein afrikanisches Land diese Bemerkungen zulässt, ist nicht selbstverständlich. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Sambia zwar noch immer nur auf Rang 87, hat sich seit 2021 aber um 28 Plätze verbessert.
Überhaupt bewegen sich in Sambia einige Dinge in eine positive Richtung, seitdem Hakainde Hichilema nach fünf erfolglosen Versuchen im August 2021 zu Sambias Präsident gewählt wurde. Die Regierung setzt stark auf Bildung. Seit 2022 ist der Unterricht für alle Kinder bis zur siebten Klasse an allen staatlichen Schulen kostenlos. Alleine im vergangenen Jahr rekrutierte der Staat 30.000 neue Lehrerinnen und Lehrer.
“Wir haben die Zahl der Lehrer in einem einzigen Jahr um 25 Prozent erhöht. Und wir bemühen uns, die Zahl weiterhin zu erhöhen, ebenso wie in der Gesundheitsversorgung”, sagt Chola Milambo, Botschafter Sambias bei den Vereinten Nationen im Interview am Rande des Nachhaltigkeitsforums. Im Jahr 2021 hatte die Regierung bereits 11.000 zusätzliche Beschäftigte im Gesundheitssektor eingestellt.
Welche Wirkung diese Maßnahmen haben, lässt sich für die sambische Regierung und externe Beobachter aktuell nur schwer nachvollziehen. Verlässliche Datenerhebungen stellen Sambia wie viele afrikanische Staaten vor große Herausforderungen. “Oft sind die verfügbaren Daten veraltet, unvollständig oder widersprüchlich, sodass es schwierig ist, die Ergebnisse genau zu messen”, schreibt die Regierung in ihrem Zwischenbericht zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. Immerhin: Nach langen Problemen mit der Finanzierung konnte Sambia 2022 seine erste digitale Volkszählung durchführen. Weitere umfangreiche Datenerhebungen sollen in diesem Jahr folgen.
Dafür aber braucht Sambia Geld. Das Land befindet sich in akuter Zahlungsnot. Die Auslandsschulden beliefen sich Ende 2022 auf 20,9 Milliarden US-Dollar. Doch auch hier konnte Sambia zuletzt beachtliche Fortschritte erzielen. Für Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar, vor allem gegenüber China, handelte Sambia ein Umschuldungsabkommen aus. Dank neuer Kredite vom IWF soll Sambia so bis 2026 insgesamt 7,65 Milliarden Dollar einsparen.
Als erster Staat mit einem solchen Deal gilt Sambia als Hoffnungsträger für hoch verschuldete Staaten. Rob Floyd vom African Center for Economic Transformation (ACET) warnt dennoch vor zu großem Optimismus: “Dieser Prozess hat drei Jahre gedauert. Das ist zwar ein Fortschritt, aber nicht ausreichend. Daher muss ein neues System eingeführt werden.”
Auch Sambias UN-Botschafter klagt über das unfaire Finanzsystem. “Die Risikoprämie, die auf Darlehen an afrikanische Länder erhoben wird, ist zu hoch”, so Milambo. Da eine Umwälzung im globalen Finanzsystem aber eher eine langfristige Herausforderung ist, setzt Sambia auf private Investitionen. Um Geldgeber anzuziehen, braucht Sambia verlässlichere Wirtschaftsdaten. So will die Regierung unter anderem genauere Daten zur BIP-Entwicklung auf regionaler Ebene erheben. Aber auch die Infrastruktur soll ausgebaut und der Gesetzes- und Genehmigungsrahmen verbessert werden.
Im Video zu Sambias Zwischenbericht appelliert Präsident Hichilema zudem an den Multilateralismus und die Unterstützung der reichen Staaten, um eine wirtschaftliche Transformation zu ermöglichen. “Die vorgeschlagene zusätzliche Finanzierungshilfe von 500 Milliarden Dollar pro Jahr für Entwicklungsländer beinhaltet ein großes Potenzial für einen echten Wandel”, sagte Hichilema.
Das Geld könnte Sambia auch gut nutzen, um die akute Armut weiter zu bekämpfen. Bereits seit 2003 zahlt Sambia mit Unterstützung der UN und der Weltbank besonders vulnerablen Gruppen eine Art Grundeinkommen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl Empfänger-Haushalte des sogenannten Social-Cash-Transfers (SCT) auf mehr als eine Million und der monatliche Betrag auf 200 Kwacha (rund 9,30 Euro). Haushalte mit Menschen mit Schwerbehinderung erhalten das doppelte. Doch das reicht noch lange nicht. Wie die meisten Staaten würde Sambia trotz leichter Verbesserungen nach aktuellem Stand keines der 17 Nachhaltigkeitsziele erreichen.
Transparenzhinweis: Die Reise zum UN-Nachhaltigkeitsforum (HLPF) nach New York fand im Rahmen eines Workshops der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und des Pressenetzwerks für Jugendthemen statt und wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert.
Die Afrikanische Union (AU) hat die Mitgliedschaft Nigers in Reaktion auf den Militärputsch in dem Land suspendiert. Die Entscheidung wurde nach einer Sitzung des AU Peace and Security Council in Addis Abeba in der vergangenen Woche verkündet. Auch die anderen von Militärjuntas regierten Länder in Westafrika – Mali, Guinea und Burkina Faso – sind derzeit aus der AU ausgeschlossen, ebenso wie Sudan.
Auch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat Niger bereits suspendiert und mit Sanktionen belegt. Am vergangenen Montag hatte Ecowas einen Vorschlag der nigrischen Putschregierung abgelehnt, innerhalb von drei Jahren Wahlen durchzuführen. Die Regionalorganisation hat mit einer militärischen Intervention in Niger gedroht und bereitet eine Eingreiftruppe vor. Gewalt sei allerdings das letzte Mittel, zuvor sollten diplomatische Möglichkeiten ausgeschöpft werden, so die Ecowas.
Niger hat seinerseits ein Militärbündnis mit den benachbarten Juntas in Mali und Burkina Faso geschlossen. Demnach wollen sie gemeinsam ihre Grenzen sichern. Das Abkommen sieht auch vor, dass Mali und Burkina Faso militärischen Beistand leisten, sollte es zu einer militärischen Intervention gegen die Putschisten im Niger kommen. Am Samstag befahl der von der nigrischen Junta ernannte Generalstabschef, alle Streitkräfte in “höchste Alarmbereitschaft” zu versetzen, um sich auf eine mögliche Eskalation vorzubereiten.
Die nigrische Junta hat am Freitag den französischen Botschafter Sylvain Itté aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Paris wies die Forderung zurück. Die Putschisten hätten keine Befugnis dazu, Botschafter des Landes zu verweisen. Kurzzeitig kursierten Berichte, nach denen auch die Botschafter aus Deutschland, Nigeria und den USA des Landes verwiesen wurden. Die Junta dementierte dies. Kurz vor Ablauf des Ultimatums protestierten am Sonntag Unterstützer der Militärregierung nahe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey gegen die französische Militärpräsenz im Land. Dieser grenzt an einen Luftwaffenstützpunkt der nigrischen Armee, der auch ein französisches Militärlager beherbergt. Etwa 1500 französische Soldaten sind derzeit in Niger stationiert. ajs
Die EU will verhindern, dass sich die Instabilität von der Sahelzone weiter in die Region der Staaten am Golf von Guinea ausweitet. Die Außenminister der EU-Staaten sollen voraussichtlich bei ihrem Treffen im Oktober den formellen Start für eine sogenannte zivil-militärische Mission in Westafrika beschließen. Die Welt am Sonntag berichtete am Wochenende darüber. Die Botschafter der Mitgliedstaaten haben sich bereits vor der Sommerpause auf den Rahmen der sogenannten European Stability and Defence Initiative (EUSDI) geeinigt.
Die vorerst auf zwei Jahre befristete Mission soll flexibel reagieren können und bei Bedarf ausgebaut werden. Es wird in erster Linie um Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte in Benin, Ghana, Togo und Elfenbeinküste gehen. Die Streitkräfte sollen in die Lage versetzt werden, terroristische Gruppierungen einzudämmen und zurückzudrängen, so Diplomaten. Neben Beratung und Training soll es auch um konkrete Einsatzvorbereitungen für Anti-Terror-Operationen, technische Hilfe, vertrauensbildende Maßnahmen und Kontrolle der Sicherheitskräfte gehen.
Die EU-Staaten werden dafür Polizisten und Soldaten als mobile Teams von Ausbildern und Experten entsenden müssen. Vorgesehen ist im ersten Halbjahr nach Start der Mission ein Budget von 1,2 Millionen Euro. Die Mission dürfte vorerst nur in Benin und Ghana beginnen. Nur die Präsidenten der beiden Länder haben die formelle Einladung schon ausgesprochen, während das grüne Licht der Elfenbeinküste und Togos noch aussteht. Die EU hatte mit ihrem Engagement weiter nördlich in Mali und Niger zuletzt wenig Erfolg. Erst Ende 2022 hatten die Mitgliedstaaten eine Militärmission in Niger beschlossen, wichtiges Transitland für Migration und im Fokus des islamistischen Terrors. Seit dem Militärputsch vom 26. Juli musste die EU die Zusammenarbeit aussetzen. sti
Sicherheitsanalyst John Lechner schätzt den Tod Prigoschins für die Präsenz der Wagner-Truppe in Afrika als nicht entscheidend ein. “Ich denke, wir werden eher viel Kontinuität von Wagner in Afrika sehen”, sagte Lechner im Gespräch mit Table.Media. “Denn Wagner war auch eine Folge des Unwillens und Unfähigkeit Russlands, reguläre Truppen nach Afrika zu entsenden. Wagner-Strukturen sind etabliert, die Truppe hat Kontakte und Erfahrung vor Ort. Es wird schwierig, sie ganz zu ersetzen.”
Genau das scheint das russische Verteidigungsministeriums zumindest in Libyen und in Syrien zu versuchen. Einen Tag vor Prigoschins Tod berichteten russische Medien über den Besuch des stellvertretenden Verteidigungsministers Junus-Bek Jewkurow in Libyen. Dabei soll die künftige militärische Zusammenarbeit besprochen worden sein. Laut dem im Exil lebenden russischen Investigativjournalisten Andrej Sacharow war Jewkurow vor seiner Libyen-Reise bereits in Syrien, wo es darum ging, die Zusammenarbeit mit Wagner zu beenden. In Syrien unterhält Russland einen Militärhafen in Tartus und einen Militärflughafen in Hmeimim.
Neben Libyen ist Wagner auf dem afrikanischen Kontinent in Sudan, Mali und besonders in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Eine Studie der NGO “Global Initiative” bezeichnet das Wagner-Modell dort als “staatliche Übernahme”. Im Austausch für Bodenschätze – Gold und Diamanten vor allem – liefere Wagner dem Regime von Präsident Touadéra politische und militärische Unterstützung. In Mali hat die Militärregierung von Assimi Goïta die Wagner-Präsenz nie offiziell bestätigt, sondern spricht von russischen Militärausbildern. Regelmäßig telefoniert er mit Putin.
Ende Juni gab der russische Präsident zum ersten Mal öffentlich zu, dass der Kreml Wagner finanziert. Demnach erhielt die Gruppe von Mai 2022 bis Mai 2023 umgerechnet rund 930 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt.
Russland pflegt mit vielen afrikanischen Ländern enge Beziehungen. Erst im Juli lud Putin afrikanische Staats- und Regierungschefs nach St. Petersburg zum Afrika-Russland-Gipfel ein. Es kamen zwar weniger Teilnehmer als geplant, doch Putin positionierte sich wieder einmal erfolgreich als Afrikas Freund und Helfer und knüpft an das alte sowjetische Narrativ des antikolonialen Kampfes an. Wagner-Chef Prigoschin war in St. Petersburg zugegen. Dort ließ er sich mit afrikanischen Teilnehmern ablichten, unter anderem mit dem Protokollchef der Zentralafrikanischen Republik.
Für die militärischen Einsätze in Afrika und die daran hängenden wirtschaftlichen Aktivitäten bedeute der Tod Prigoschins erst einmal nicht viel, meint Lechner. “Prigoschin als Person wird schwer zu ersetzen sein. Nur wenige Menschen haben so ein Charisma. Aber Wagners Geschäfte laufen weiter. Und Prigoschin selbst war nie ein Anführer direkt vor Ort. Es wird wohl langfristig davon abhängen, wie das Verhältnis zwischen Wagner und dem russischen Staat geregelt wird.”
Der Einfluss von Wagner könnte sich im fragilen Sahel sogar noch ausdehnen, vermutet Lechner. “Niger hat nicht wirklich eine andere Option. Ich denke, wir werden dort Wagner-Kräfte sehen. Und andere russische Privatmilizen, die dieses Lücke füllen könnten, gibt es nicht.” Da westliche Partner laut den Regierungen in Mali, Burkina Faso und Niger nicht die Wünsche nach großflächiger militärischer Unterstützung erfüllten, wird Russland vorerst weiter als Alternative gesehen. lcw/vf
Nach einem Treffen der libyschen Außenministerin Najla Mangoush mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen in Rom ist es in der Nacht zu Montag im Westen Libyens zu Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Tripoli sowie der Hafenstadt Zauwia brannten Autoreifen. Premierminister Abdulhamid Dabaiba reagierte prompt: Ab sofort werde der Minister für Kultur und Jugend, Mohamed Mehdi Bensaid, das Außenministerium leiten, so eine Regierungserklärung auf Facebook. Außenministerin Mangoush sei so lange freigestellt, bis eine Untersuchung die Umstände des Treffens aufgeklärt habe.
Es habe sich um kein formelles, sondern um ein spontanes Treffen ohne Vorbereitung gehandelt, sagte ein Sprecher des libyschen Außenministeriums am Montag. Najla Mangoush erklärte, sie sei nach einem Austausch mit italienischen Regierungsvertretern zufällig auf Cohen getroffen und dann nach London weitergereist.
In ihrer Heimat droht der 50-Jährigen nun die Verhaftung, da jede Kontaktaufnahme mit offiziellen Vertretern Israels wie im benachbarten Tunesien ein gesellschaftliches Tabu ist. Libyen und Israel unterhalten zwar keinerlei offizielle Beziehungen, stehen jedoch durch die ehemals über 30.000 jüdischen Libyer in Kontakt. Angehörige der jüdischen Minderheit Libyens mussten nach dem von Israel gewonnenen Sechs-Tage-Krieg 1967 Nordafrika verlassen.
Am Sonntagnachmittag hatte der israelische Außenminister Cohen das Treffen mit der früheren Menschenrechtlerin Mangoush als historisch bezeichnet und als ersten Schritt auf dem Weg zur Neuschaffung einer Beziehung beider Länder. Man habe sich über die Erhaltung des jüdischen Kulturerbes in Libyen unterhalten, so Cohen gegenüber israelischen Medien, die ausführlich über das erste Treffen libyscher und israelischer Spitzendiplomaten berichteten.
Wie brenzlig die Proteste für Premierminister Dabaiba persönlich sind, zeigen nächtliche Aufnahmen von einem Angriff auf dessen Privathaus. Unbekannte warfen Steine und Molotowcocktails auf das von bewaffneten Milizen geschützte Gebäude in Tripolis, ohne es jedoch zu beschädigen. mk

Bis heute hat der Westen nicht wahrgenommen, dass Ansehen und Attraktion des westlichen Modells gelitten haben. Die Brics-Erweiterung ist Ausdruck dessen, dass vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer mit der herrschenden internationalen Ordnung unzufrieden sind. In internationalen Gremien haben sie oft keine Stimme und kein Gewicht. Brics glänzt nicht durch eigenes Handeln, sondern weil der Westen die Steilvorlagen dazu liefert.
Deshalb ist es auch nicht entscheidend, wenn sich der Zusammenhalt in der erweiterten Staatengruppe derzeit auf wenige Kernaspekte reduziert: Wirtschaft und Finanzen ja, aber zum Beispiel keine gemeinsame Sicherheitsstrategie. Einige sind sich aber alle in der Ablehnung westlicher Hegemonie und gegenüber dem Dollar als Leitwährung. Diese anti-westliche Stimmung verfängt und ist auch für viele andere Länder attraktiv. Brics hat einen Punkt aufgenommen, den Entwicklungs- und Schwellenländer seit langem fordern: Der Westen muss sich umstellen und anerkennen: Eine Dominanz der USA und Europas wird künftig nicht mehr hingenommen.
Was wir jetzt sehen, ist die beginnende weltwirtschaftliche Neuvermessung, bei der China der große Gewinner ist. Mit noch immer beachtlichen Wachstumsraten und hoher Nachfrage nach Energie und Rohstoffen ist das Land, ebenso wie Indien, für die Brics-Gruppe extrem attraktiv. Auch wenn China oft selbst imperial auftritt, ist es eine Art wirtschaftliches Zukunftsversprechen für die Brics-Staaten.
Wir sollten nicht davon ausgehen, dass dieser Club in nächster Zeit von alleine verschwinden wird. China bildet den großen Rückhalt und das macht Brics für weitere Länder interessant. Ob China dann die Kohäsionskraft hat, unterschiedlichste Mitglieder und Interessen zusammen zu bringen, muss sich noch zeigen. Wenn die Erweiterung im Moment auch noch keine Gefahr für den Westen darstellt, so ist doch ein Shift erkennbar.
Wie kann, wie soll der Westen jetzt reagieren? Wir müssen eine ganz andere Agenda für die Kooperation mit Schwellen- und Entwicklungsländern entwickeln. Dazu zählt auch die Frage: Wie gehen wir künftig mit autoritären Regimen um und wahren trotzdem unsere eigenen Interessen? Welche Strategie haben wir zum Beispiel für den Nahen Osten, eine sehr schwierige Weltregion? Und dann natürlich Afrika, der zentrale Fokus für Neuorientierung. Für diesen Kontinent eröffnen wir bis heute viel zu wenig Chancen für einen nachhaltigen Entwicklungspfad. China bringt jetzt Hunderttausende junge Menschen in eigene Berufsbildungskonzepte für Afrika. Das zeigt doch, welche Art von Attraktivität dieses Modell hat. Wir haben es dagegen nicht geschafft, in diesem Bereich Zeichen zu setzen. Bis heute gibt es kein zu Ende verhandeltes Konzept für die Afrikanische Freihandelszone.
Wir sollten Impulse für die Weltwirtschaft setzen, durch Kooperationsbeziehungen, technologische Zusammenarbeit, fairen Handel und ein Mitsprache- und Vertretungsrecht der aufstrebenden Länder in internationalen Organisationen. Und natürlich müssen wir selbst innerhalb Europas unsere Krisen in den Griff bekommen.
Die erste Reaktion der deutschen Außenministerin Baerbock auf die Brics-Erweiterung zeigt, wie wenig substanziell unsere Außenpolitik noch immer aufgestellt ist. Natürlich: Miteinander sprechen muss man immer, gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Aber wichtig ist ja nicht nur, dass man redet, sondern auch wie und worüber. Was wollen wir: Systemkonkurrenz, strategische Zusammenarbeit, De-Risking? Ich sehe nicht einmal einen Diskurs darüber. Für mich zeigt es, dass die Debatte über strategische Außenpolitik in unseren Ministerien bis heute nicht angekommen ist. Sie ist von Illusionen geprägt.
Robert Kappel ist emeritierter Professor für Ökonomie in Afrika an der Universität Leipzig und ein renommierter Afrika-Kenner.
Politico: Frankreichs Zeit in Afrika ist abgelaufen. Was immer Frankreich tut, ob gut oder schlecht, löst in Afrika eine allergische Reaktion aus. Ein Rückzug aus dem Kontinent würde in gewissem Maße das Ansehen Frankreichs in der Welt schmälern, so der Westafrika-Experte Michael Shurkin in einem Meinungsbeitrag. Für französische Interessen sei jedoch besser gesorgt, würden die Prioritäten anders gesetzt.
Wall Street Journal: Kann Wagners Reich in Afrika Prigoschin überleben? Ein Großteil der Aktivitäten der Gruppe Wagner fand bisher in Afrika statt. Ihr Anführer war noch kurz vor seinem Tod vom Kontinent zurückgekehrt. Nun ist offen, wie es mit dem Wagner-Geschäft in Afrika weitergeht.
Foreign Policy: In Afrika ist Demographie Schicksal. Die Hälfte des globalen Bevölkerungswachstums bis 2050 wird in Afrika südlich der Sahara stattfinden. Die Bevölkerung der Region wächst derzeit dreimal so schnell wie die der übrigen Welt, und bis zum Ende des Jahrhunderts wird ein Drittel aller Menschen auf der Welt dort leben.
The Economist: Westafrikanischer Blick nach dem Putsch in Niger. Eine Umfrage zeigt, dass die meisten Menschen in Westafrika den jüngsten Staatsstreich in Niger gutheißen. Die Befragten in Elfenbeinküste, Ghana, Mali und Nigeria hinterfragen auch generell die Forderung nach einem militärischen Eingreifen der Ecowas.
AP: Ägypten, Äthiopien und Sudan nehmen Verhandlungen über umstrittenen Staudamm wieder auf. Nachdem Ägypten und Äthiopien Mitglieder der Brics-Gruppe werden, haben sich die beiden Länder darauf verständigt, wieder über den GERD-Damm am Nil zu verhandeln. Wie viel Wasser Äthiopien flussabwärts ablassen wird, ist noch unklar.
Al Jazeera: Modi schlägt G20-Mitgliedschaft für AU vor. Der indische Premierminister Narendra Modi hat vorgeschlagen, die Afrikanische Union (AU) als Vollmitglied in die G20 aufzunehmen. Im Vorfeld des G20-Gipfels im nächsten Monat in Neu-Delhi pries er außerdem sein Land als Lösung für die Probleme in den Lieferketten an.
France 24: Tik Tok in Kenia wird künftig moderiert. Tik Tok hat zugestimmt, die Inhalte seiner App in Kenia zu moderieren, so das Präsidentenbüro. Die Ankündigung kommt einige Tage, nachdem das kenianische Parlament eine Petition zum Verbot der beliebten Video-Sharing-Plattform erhalten hatte.
African Business: Kenias “Hustler Fund” sucht Unterstützung durch Weltbank und EU. Kenia führt derzeit Gespräche mit der Weltbank und der EU, um finanzielle Unterstützung für das Vorzeige-Wirtschaftsprogramm von Präsident Ruto zu erhalten. Es wurde Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufen, um Kenianern den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern.
Financial Times: Namibia, der nächste Petrostaat? Shell und Total verstärken ihre Bemühungen um die Erschließung eines potenziell riesigen Ölfeldes vor der Küste Namibias. Sollte es ihnen gelingen, kommerziell nutzbare Ölmengen zu identifizieren, könnte das Land im südlichen Afrika zu einem der neuesten Petrostaaten der Welt werden.
Bloomberg: Verteilung ist Schwachstelle von Südafrikas Stromnetz. Das südafrikanische Stromverteilungssystem werde von Streits zwischen Eskom und den Gemeinden heimgesucht, so Stromminister Ramokgopa. Bislang hat sich Eskom darauf konzentriert, die Leistung der hauptsächlich mit Kohle betriebenen Kraftwerke zu verbessern.
Financial Times: Der Westen hat seine Hilfsversprechen nicht eingehalten. In einem Meinungsbeitrag beklagt der Ökonom Adam Tooze die bisher leeren Versprechen der EU und der USA gegenüber dem globalen Süden. Die Versuche, auf Chinas Belt and Road-Initiative zu reagieren, seien kläglich gescheitert.

Mahamadou Issoufou hat in seinem Leben reichlich Lorbeeren bekommen. “Im Angesicht schwierigster politischer und wirtschaftlicher Probleme, darunter gewalttätiger Extremismus und die voranschreitende Wüstenbildung, hat Präsident Mahamadou Issoufou die Menschen in seinem Land auf einen Weg des Fortschritts geführt”, lautete beispielsweise das Lob des Vorsitzendens des Mo-Ibrahim-Preises. Issoufou gewann 2020 die Auszeichnung für seine herausragende politische Führungskraft auf dem afrikanischen Kontinent. Fünf Millionen Dollar gab es auf die blumigen Worte obendrauf.
Ob er sich die Lorbeeren jedoch redlich verdiente, ist eine andere Frage. Anlässlich der Preisverleihung meldeten Experten Zweifel an den demokratischen Verdiensten Issoufous an. 2011 ging er als Sieger der Wahlen hervor, die nach einem Putsch 2010 organisiert worden waren. 2016 wurde Issoufou mit der überragenden Mehrheit von offiziell 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Doch die Opposition hatte die Wahlen angesichts von Kritik an Issoufous harter Hand boykottiert. Oppositionsführer Hama Amadou ging direkt nach der Wahl nach Frankreich ins Exil.
Issoufou, der lange Frankreichs Mann in Niamey war, ermöglichte 2021 schließlich den ersten friedlichen Machtwechsel in Niger. Der von ihm ausgesuchte Kandidat Mohamed Bazoum gewann prompt diese Wahl. Die unerwartete Entmachtung und Gefangennahme Bazoums Ende Juli wirft inzwischen einen Schatten auf Issoufou und die angeblich freundschaftliche Beziehung, die die beiden Politiker öffentlich stets betonten.
Issoufou war als Vermittler von der ersten Minute an in das Geschehen nach dem Putsch involviert. US-Außenminister Blinken appellierte an Issoufous Geschick für eine friedliche Verhandlungslösung nach Telefonaten mit dem abgesetzten Bazoum und dem Ex-Präsidenten. In einem kurzen Interview im französischen Magazin Jeune Afrique forderte Issoufou drei Wochen nach dem Coup Bazoums Freilassung.
Issoufou, geboren 1952 rund 500 Kilometer nordöstlich von Nigers Hauptstadt Niamey, ist seit den Anfängen der Demokratie in seinem Land eine feste Größe in der Politik. Nur wenige Jahre nach der Unabhängigkeit Nigers von Frankreich ging Issoufou nach einem ersten Abschluss in Niger im Land der Kolonialherren studieren. Sein Vater, Dorfchef in der von Hausa geprägten Region, diente noch in der französischen Kolonialarmee, und gehörte damit zu den sogenannten tirailleurs.
Sein Vater war Analphabet. Der Sohn kehrte als ausgebildeter Mathematiker und Bergbauingenieur aus Frankreich zurück – im Dienst des französischen Bergbauunternehmens Somair (Uran).1990 gründete er die Partei Tarayya (Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme) mit und widmete sich von 1992 an ganz der Politik.Mehrfach kandidierte Issoufou erfolglos – bis zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten 2010.
Die EU und Deutschland setzten fest auf Issoufou. Den Ton setzte Alt-Bundespräsident Horst Köhler, Jury-Mitglied für den Mo-Ibrahim-Preis. Er verteidigte die Entscheidung in einem Interview mit der Deutschen Welle: “Präsident Issoufou hat sich an die Landesverfassung gehalten, die nur zwei Amtsperioden vorsieht. Damit hat er den Weg für den ersten demokratischen Regierungswechsel in der Geschichte Nigers geöffnet. Und ich finde, das ist wirklich preiswürdig. Für mich war das ein entscheidender Punkt, weil mich das an ein Gespräch mit Nelson Mandela erinnerte, den ich als Bundespräsident 2006 in Maputo traf und fragte, was aus seiner Sicht das Wichtigste für die Entwicklung Afrikas sei. Seine Antwort war klar, ich sage das in seinen Worten in Englisch: ,Rule of law and respect for the constitution.’ Das war seine Antwort. Und das prägte mich auch bei dieser Diskussion zur Verleihung des Preises.”
Auch nach seinem verfassungsgemäßen Abgang blieb Issoufou eine Einfussgröße in Niger. Manche halten seinen Einfluss für so groß, dass sie ihm eine Rolle in dem Putsch zuschreiben. Belegt ist nur, dass der neue Machthaber Abdourahamane Tiani die Präsidentengarde unter Issoufou befehligte und ihm unter Bazoum die Ablösung drohte.
Issoufou gründete eine eigene Stiftung, die sich unter anderem mit ökologischen Fragen befassen sollte, war gern gesehener und regelmäßiger Gast auf internationalen Konferenzen, beispielsweise auf dem Sicherheitsforum in Dakar 2022, auf dem er sich nach seinem Auftritt kaum vor Selfieanfragen retten konnte.
Dass Deutschland sich in seiner Bewertung von Niger als Stabilitätsanker im Sahel verschätzt hat, steht fest (Africa.Table berichtete). Welche Rolle Issoufou im jüngsten Coup spielte, ist weiter unklar. Die Gerüchte reißen jedenfalls nicht ab. So berichtete etwa der Journalist Seiddik Abba auf X (ehemals Twitter) von einer Auseinandersetzung am Vorabend des Coups zwischen Issoufous Sohn, Issoufou und Bazoum um die Besetzung des Chefpostens des staatlichen Ölunternehmens Petro Niger. Lucia Weiß, Dakar
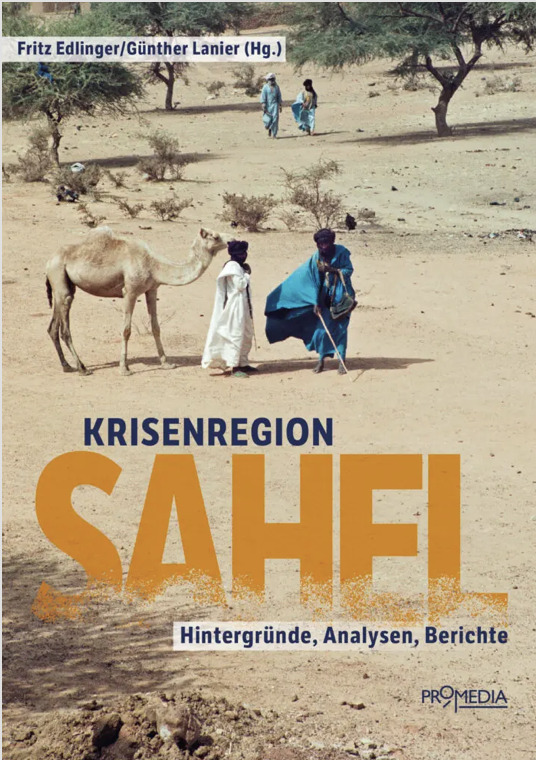
Das Interesse der Deutschen an der Sahel-Region war bisher gering. Selbst für die Kultur dieser so vielfältigen Gegend der Erde konnten sich nur wenige begeistern. Entsprechend gering ist das Angebot an Büchern über den Sahel. Insofern schließt der Sammelband “Krisenregion Sahel”, den der Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen Fritz Edlinger und der in Ouagadougou lebende Ökonom Günther Lanier herausgegeben haben, eine wichtige Lücke.
In detaillierten Länderanalysen stellen die Autoren neun Länder der Region vor. Geschrieben wurden sie von Journalisten, Vertretern von NGOs oder Entwicklungshelfern, meistens von Autorinnen und Autoren aus Europa. In einem zweiten Teil behandelt das Buch Themen wie den Islam im Sahel, Ethnizitäten, Terrorismus, Migration, Sicherheitspolitik… Eine Lücke lässt allerdings auch dieses Buch offen: Die Tuareg werden an fünf, vielleicht sechs Stellen erwähnt und einmal auf immerhin neuneinhalb Zeilen behandelt. Damit bleiben sie die große Unbekannte in diesem Buch. Auch Rohstoffe hätten eine Berücksichtigung verdient.
Dennoch liefert das Buch spannende Einblicke und fördert das Verständnis für die Region. Hilfreich wäre es, bei einer Neuauflage weiterführende Literatur zu empfehlen. hlr
Fritz Edlinger, Günther Lanier (Hg.): Krisenregion Sahel. Hintergründe, Analysen, Berichte. Promedia Verlag, Wien, 2022, 256 Seiten, 22 Euro (E-Book 18,99 Euro).
die Tinte unter dem Vertrag über die Brics-Erweiterung ist noch nicht trocken, da gibt es schon ein erstes konkretes Ergebnis: China wird Südafrika dabei unterstützen, seine klimaschädlichen Kraftwerke zu modernisieren. Das Land sei ein dominierender Akteur bei Erneuerbaren Energien und habe sein eigenes Netz erfolgreich modernisiert. Andreas Sieren, der für uns auch den Brics-Gipfel begleitete, kennt die Details.
Simbabwe hat gewählt, und Präsident Emmerson Mnangagwa damit seine zweite Amtszeit. Doch die Umstände der Wahl werden von internationalen Beobachtern heftig kritisiert: Von mangelnder Transparenz, Einschüchterung und Gewalt ist die Rede. Unter diesen Umständen ist fraglich, ob das Land wieder Anschluss an die internationale Gemeinschaft findet und vor allem seine enormen wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommt.
Der Afrika-Experte Robert Kappel bilanziert in seinem Standpunkt für uns die Brics-Erweiterung, die dem Staatenbund sechs neue Mitglieder bringt, darunter mit Ägypten und Äthiopien zwei afrikanische. Kappel vertritt die Ansicht, dass damit eine weltwirtschaftliche Neuvermessung beginne, von der zunächst vor allem China profitiere. Die deutsche Außenpolitik sei illusionär und habe bis heute kein attraktives Gegenangebot für Staaten, die dem Westen eher ablehnend gegenüber stehen.
Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Während des Brics-Gipfels vergangene Woche hat der südafrikanische Elektrizitätsminister Kgosientsho Ramokgopa zur Eile aufgerufen. Denn Südafrika produziert derzeit regelmäßig bis zu rund zehn Prozent weniger Strom, als es braucht. Ein Großteil der vom staatlichen Stromkonzern Eskom betriebenen Kraftwerke sind marode. Jahrelang hat Eskom die Wartung vernachlässigt. Hinzu kamen Korruption und Missmanagement, die das Stromnetz fast zum Zusammenbruch brachten. Zudem mangelt es an Überland-Stromleitungen. Seit Jahren gibt es in Südafrika “Load shedding”, den gesteuerten Lastabwurf, bei dem der Strom planmäßig für Stunden abgeschaltet wird: Der wirtschaftliche Schaden allein in diesem Jahr wird nach Schätzungen der Zentralbank rund 650 Millionen Euro betragen.
Jetzt wollen China und Südafrika enger zusammenarbeiten. Die Vorarbeit wurde bereits im Juni geleistet, als Ramokgopa zu Gesprächen nach China reiste. Am Rande des Brics-Gipfels vergangene Woche in Johannesburg wurde die Gemeinsame Kooperationsvereinbarung im Bereich Grüner Energie unterzeichnet. Acht Staatsunternehmen aus China, darunter die State Grid Corporation of China (SGCC) und die China Energy International Group (CIEG), sollen über drei Jahre lang mit der klimafreundlichen Sanierung der angeschlagenen Kraftwerke helfen. Außerdem sollen sie nach modernen Umweltstandards aufgerüstet werden, zudem will China Südafrika bei der schrittweisen Einführung von erneuerbaren Energiequellen unterstützen. “Die Energiekooperation mit China ist eine neue Entwicklung”, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. “Wir wollen sie vertiefen, insbesondere in Hinsicht auf unsere jeweiligen Verpflichtungen für eine CO2-arme und klimafreundliche Entwicklung.”
Bei seinem Staatsbesuch in Pretoria vergangene Woche vor dem Brics-Gipfel versprach der chinesische Präsident Xi Jinping außerdem Soforthilfe von rund acht Millionen Euro, darunter Stromgeneratoren und Solarstromsysteme, die vor allem in Krankenhäusern und Polizeistationen verwendet werden sollen. Hinzu kommen 25 Millionen Euro Entwicklungshilfe für verschiedene dringende Maßnahmen. So sagte Elektrizitätsminister Ramokgopa bei einem Pressebriefing am Sonntag: “Der Grund, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, liegt darin, dass sie ein dominierender Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien sind.” China habe das eigene Netz so modernisiert, das es die Produktionsschwankungen von Erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt.
Südafrika hatte zu Beginn des Jahres auch Deutschland um Hilfe gebeten, um die angespannte Stromversorgung unter Kontrolle zu bekommen (Africa.Table berichtete). Spezialisten eines Konsortiums von fünf deutschen Unternehmen, darunter die RWE Technology International GmbH, erstellten nach einem Besuch ein Gutachten über den Zustand der existierenden Kraftwerke.
Das Ergebnis war ernüchternd, ist aus Botschaftskreisen in Pretoria zu hören. Der Bericht wurde allerdings bisher nicht veröffentlicht. Die Kraftwerke, die derzeit fast 80 Prozent des Strombedarfes des Landes abdecken, haben den Ruf, zu den dreckigsten und klimaschädlichsten der Welt zu gehören. Zusammen mit der Europäischen Union sowie Frankreich, Großbritannien und den USA, ist Deutschland Teil der “Just Energy Transition Partnership”, einer rund acht Milliarden Euro schweren Partnerschaft, die Südafrika bei der Abkehr von Kohle und dem Übergang zu einer emissionsarmen und klimaresistenten Wirtschaft unterstützen soll. Mittlerweile liegt in einer ersten Version des South Africa Renewable Energy Plan Masterplan (SAREM) vor, der die Energiewende voranbringen soll. Der Anteil von erneuerbaren Energien liegt derzeit in Südafrika bei nur 7,3 Prozent. Allerdings ist die Tendenz steigend.
Vergangenen Sonntag berichtete Minister Ramokgopa, dass Eskom im Winter die Stromversorgung leicht verbessern konnte. Er warnte aber auch, dass mit “Load shedding” im Sommer, der im September beginnt, weiter zu rechnen ist. Die Regierung müsse die Kohlekraftwerke regelmäßig warten. Seit der Minister seinen Posten im März übernommen hatte, stieg die Leistung der Kraftwerke von 40 auf 60 Prozent: Zu wenig für ein Land, das wirtschaftlich wachsen möchte und den Anspruch hat, wirtschaftlich und international eine größere Rolle zu spielen. Dennoch: Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobte Südafrika für seine Widerstandfähigkeit. Beobachter gingen ursprünglich davon aus, dass das Land am Kap wegen seiner Stromkrise 2023 in eine Rezension abrutschen würde. Stattdessen wurde die Wirtschaft durch den Dienstleistungssektor angetrieben, der sich von der Covid-Pandemie erholt hatte. Im ersten Quartal konnte ein Wachstum von 0,4 Prozent erreicht werden. Ohne die Stromkrise könnten es laut IWF 2,5 bis drei Prozent sein. Grund genug, weiter auf die Partnerschaft sowohl mit China als auch mit den westlichen Ländern zu setzen.
Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa hat bei den Wahlen am 23. und 24. August in dem Land im südlichen Afrika mit 52,6 Prozent der Stimmen eine zweite Amtszeit gewonnen. Inländische wie internationale Beobachter haben die Wahl jedoch als unfair und fehlerhaft kritisiert. Der Oppositionsführer Nelson Chamisa, der 44 Prozent der Stimmen erhielt, hat das offizielle Ergebnis nicht anerkannt und angekündigt, es vor Gericht anzufechten.
Die Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union (EU EOM) teilte mit, der Wahlprozess sei durch mangelnde Transparenz, Einschüchterung und Gewalt beeinträchtigt worden. Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats, der Commonwealth und die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) äußerten ebenfalls ernste Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses.
Ein langwieriger Streit nach den Wahlen könnte die Bemühungen Simbabwes um eine Lösung seiner langjährigen Wirtschaftskrise untergraben, die teilweise mit der Geschichte der umstrittenen Wahlen zusammenhängt. Das an Bodenschätzen reiche Land hatte gehofft, mit den Wahlen einen wichtigen Schritt in Richtung regionale und internationale Integration zu machen. Faire Wahlen waren auch entscheidend für das Streben des Landes nach internationaler Unterstützung und der Erleichterung seiner enormen Schuldenlast von fast 8,3 Milliarden Dollar.
Im Mai dieses Jahres hatte der ehemalige mosambikanische Präsident Joaquim Chissano seine Einschätzung geteilt, die Situation in Simbabwe schade dem gesamten südlichen Afrika. “Die Krise im Land hat schreckliche Folgen für die Region, da Simbabwe im Herzen des südlichen Afrikas liegt. Viele regionale Pläne zur Entwicklung der Infrastruktur, einschließlich Straßen, Eisenbahnen und Stromübertragungsleitungen, sind zum Stillstand gekommen, da sie durch das Land verlaufen müssen. Auch der kontinentale Freihandel wird durch die Situation in Simbabwe unterminiert”, so Chissano.
Auch Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), hatte Anfang des Jahres betont, dass “die internationale Gemeinschaft die Entwicklung sehr genau beobachten wird”. “Das volle Gewicht der Wiederaufnahme der Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft wird davon abhängen. Es wird auch nicht nur von den Wahlen abhängen, sondern von dem gesamten Wahlprozess, der eine glaubwürdige Wahl garantiert”, drängte Adesina.
Internationale Wirtschaftssanktionen haben Simbabwe weiter in einen Teufelskreis von unhaltbaren Schulden getrieben. So hatte Adesina vor der Wahl betont, dass ein umfassender Prozess zur Begleichung von Zahlungsrückständen und zur Lösung der Schuldenkrise für eine nachhaltige Wirtschaftserholung Simbabwes von entscheidender Bedeutung sei. Dieser müsse von den internationalen Finanzinstitutionen und der globalen Gemeinschaft unterstützt werden. Es sei wichtig, dass Simbabwe einen glaubwürdigen Wahlprozess durchführe, um wieder mit der internationalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten.
Neben Repression und der Einschüchterung von Wählern werfen Kritiker Präsident Mnangagwa und seiner Partei Zanu PF vor, durch das krampfhafte Festhalten an der Macht das simbabwische Wirtschaftswachstum lahmzulegen. In seiner Siegesrede nach dem Wahlergebnis rief der alte und neue Präsident die Konfliktparteien im Land dazu auf, sich zu vereinen und gemeinsam ein größeres Simbabwe zu schmieden. Im komplizierten Zusammenspiel von politischer, wirtschaftlicher und regionaler Dynamik bleibt Simbabwes Weg beschwerlich. Die Zukunft des Landes hängt davon ab, wie es diese Herausforderungen meistert und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung, internationale Partnerschaften und die Ausschöpfung seines reichen Potenzials anstrebt.
Farayi Machamire ist Journalist aus Simbabwe. Derzeit arbeitet er über die Internationalen Journalisten-Programme (IJP) in der Redaktion von Table.Media in Berlin.
Sambias Vorstellung des Zwischenberichts zur nachhaltigen Entwicklung auf dem UN-Nachhaltigkeitsforum hat gleich doppelt überrascht. Erstens gewährte die Regierung als eines der wenigen Länder auch einem Vertreter der Zivilgesellschaft Redezeit. Zweitens durfte dieser Redebeitrag auch noch kritisch ausfallen.
“Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderung und andere Minderheitsgruppen werden weiterhin vernachlässigt”, sagte Glenda Mulenga von der Nichtregierungsorganisation Sightsavers mit Blick auf die doch recht positive Präsentation der sambischen Regierung auf dem UN-Nachhaltigkeitsforum in New York. Dass ein afrikanisches Land diese Bemerkungen zulässt, ist nicht selbstverständlich. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Sambia zwar noch immer nur auf Rang 87, hat sich seit 2021 aber um 28 Plätze verbessert.
Überhaupt bewegen sich in Sambia einige Dinge in eine positive Richtung, seitdem Hakainde Hichilema nach fünf erfolglosen Versuchen im August 2021 zu Sambias Präsident gewählt wurde. Die Regierung setzt stark auf Bildung. Seit 2022 ist der Unterricht für alle Kinder bis zur siebten Klasse an allen staatlichen Schulen kostenlos. Alleine im vergangenen Jahr rekrutierte der Staat 30.000 neue Lehrerinnen und Lehrer.
“Wir haben die Zahl der Lehrer in einem einzigen Jahr um 25 Prozent erhöht. Und wir bemühen uns, die Zahl weiterhin zu erhöhen, ebenso wie in der Gesundheitsversorgung”, sagt Chola Milambo, Botschafter Sambias bei den Vereinten Nationen im Interview am Rande des Nachhaltigkeitsforums. Im Jahr 2021 hatte die Regierung bereits 11.000 zusätzliche Beschäftigte im Gesundheitssektor eingestellt.
Welche Wirkung diese Maßnahmen haben, lässt sich für die sambische Regierung und externe Beobachter aktuell nur schwer nachvollziehen. Verlässliche Datenerhebungen stellen Sambia wie viele afrikanische Staaten vor große Herausforderungen. “Oft sind die verfügbaren Daten veraltet, unvollständig oder widersprüchlich, sodass es schwierig ist, die Ergebnisse genau zu messen”, schreibt die Regierung in ihrem Zwischenbericht zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. Immerhin: Nach langen Problemen mit der Finanzierung konnte Sambia 2022 seine erste digitale Volkszählung durchführen. Weitere umfangreiche Datenerhebungen sollen in diesem Jahr folgen.
Dafür aber braucht Sambia Geld. Das Land befindet sich in akuter Zahlungsnot. Die Auslandsschulden beliefen sich Ende 2022 auf 20,9 Milliarden US-Dollar. Doch auch hier konnte Sambia zuletzt beachtliche Fortschritte erzielen. Für Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar, vor allem gegenüber China, handelte Sambia ein Umschuldungsabkommen aus. Dank neuer Kredite vom IWF soll Sambia so bis 2026 insgesamt 7,65 Milliarden Dollar einsparen.
Als erster Staat mit einem solchen Deal gilt Sambia als Hoffnungsträger für hoch verschuldete Staaten. Rob Floyd vom African Center for Economic Transformation (ACET) warnt dennoch vor zu großem Optimismus: “Dieser Prozess hat drei Jahre gedauert. Das ist zwar ein Fortschritt, aber nicht ausreichend. Daher muss ein neues System eingeführt werden.”
Auch Sambias UN-Botschafter klagt über das unfaire Finanzsystem. “Die Risikoprämie, die auf Darlehen an afrikanische Länder erhoben wird, ist zu hoch”, so Milambo. Da eine Umwälzung im globalen Finanzsystem aber eher eine langfristige Herausforderung ist, setzt Sambia auf private Investitionen. Um Geldgeber anzuziehen, braucht Sambia verlässlichere Wirtschaftsdaten. So will die Regierung unter anderem genauere Daten zur BIP-Entwicklung auf regionaler Ebene erheben. Aber auch die Infrastruktur soll ausgebaut und der Gesetzes- und Genehmigungsrahmen verbessert werden.
Im Video zu Sambias Zwischenbericht appelliert Präsident Hichilema zudem an den Multilateralismus und die Unterstützung der reichen Staaten, um eine wirtschaftliche Transformation zu ermöglichen. “Die vorgeschlagene zusätzliche Finanzierungshilfe von 500 Milliarden Dollar pro Jahr für Entwicklungsländer beinhaltet ein großes Potenzial für einen echten Wandel”, sagte Hichilema.
Das Geld könnte Sambia auch gut nutzen, um die akute Armut weiter zu bekämpfen. Bereits seit 2003 zahlt Sambia mit Unterstützung der UN und der Weltbank besonders vulnerablen Gruppen eine Art Grundeinkommen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl Empfänger-Haushalte des sogenannten Social-Cash-Transfers (SCT) auf mehr als eine Million und der monatliche Betrag auf 200 Kwacha (rund 9,30 Euro). Haushalte mit Menschen mit Schwerbehinderung erhalten das doppelte. Doch das reicht noch lange nicht. Wie die meisten Staaten würde Sambia trotz leichter Verbesserungen nach aktuellem Stand keines der 17 Nachhaltigkeitsziele erreichen.
Transparenzhinweis: Die Reise zum UN-Nachhaltigkeitsforum (HLPF) nach New York fand im Rahmen eines Workshops der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und des Pressenetzwerks für Jugendthemen statt und wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert.
Die Afrikanische Union (AU) hat die Mitgliedschaft Nigers in Reaktion auf den Militärputsch in dem Land suspendiert. Die Entscheidung wurde nach einer Sitzung des AU Peace and Security Council in Addis Abeba in der vergangenen Woche verkündet. Auch die anderen von Militärjuntas regierten Länder in Westafrika – Mali, Guinea und Burkina Faso – sind derzeit aus der AU ausgeschlossen, ebenso wie Sudan.
Auch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat Niger bereits suspendiert und mit Sanktionen belegt. Am vergangenen Montag hatte Ecowas einen Vorschlag der nigrischen Putschregierung abgelehnt, innerhalb von drei Jahren Wahlen durchzuführen. Die Regionalorganisation hat mit einer militärischen Intervention in Niger gedroht und bereitet eine Eingreiftruppe vor. Gewalt sei allerdings das letzte Mittel, zuvor sollten diplomatische Möglichkeiten ausgeschöpft werden, so die Ecowas.
Niger hat seinerseits ein Militärbündnis mit den benachbarten Juntas in Mali und Burkina Faso geschlossen. Demnach wollen sie gemeinsam ihre Grenzen sichern. Das Abkommen sieht auch vor, dass Mali und Burkina Faso militärischen Beistand leisten, sollte es zu einer militärischen Intervention gegen die Putschisten im Niger kommen. Am Samstag befahl der von der nigrischen Junta ernannte Generalstabschef, alle Streitkräfte in “höchste Alarmbereitschaft” zu versetzen, um sich auf eine mögliche Eskalation vorzubereiten.
Die nigrische Junta hat am Freitag den französischen Botschafter Sylvain Itté aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Paris wies die Forderung zurück. Die Putschisten hätten keine Befugnis dazu, Botschafter des Landes zu verweisen. Kurzzeitig kursierten Berichte, nach denen auch die Botschafter aus Deutschland, Nigeria und den USA des Landes verwiesen wurden. Die Junta dementierte dies. Kurz vor Ablauf des Ultimatums protestierten am Sonntag Unterstützer der Militärregierung nahe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey gegen die französische Militärpräsenz im Land. Dieser grenzt an einen Luftwaffenstützpunkt der nigrischen Armee, der auch ein französisches Militärlager beherbergt. Etwa 1500 französische Soldaten sind derzeit in Niger stationiert. ajs
Die EU will verhindern, dass sich die Instabilität von der Sahelzone weiter in die Region der Staaten am Golf von Guinea ausweitet. Die Außenminister der EU-Staaten sollen voraussichtlich bei ihrem Treffen im Oktober den formellen Start für eine sogenannte zivil-militärische Mission in Westafrika beschließen. Die Welt am Sonntag berichtete am Wochenende darüber. Die Botschafter der Mitgliedstaaten haben sich bereits vor der Sommerpause auf den Rahmen der sogenannten European Stability and Defence Initiative (EUSDI) geeinigt.
Die vorerst auf zwei Jahre befristete Mission soll flexibel reagieren können und bei Bedarf ausgebaut werden. Es wird in erster Linie um Unterstützung bei der Ausbildung der Streitkräfte in Benin, Ghana, Togo und Elfenbeinküste gehen. Die Streitkräfte sollen in die Lage versetzt werden, terroristische Gruppierungen einzudämmen und zurückzudrängen, so Diplomaten. Neben Beratung und Training soll es auch um konkrete Einsatzvorbereitungen für Anti-Terror-Operationen, technische Hilfe, vertrauensbildende Maßnahmen und Kontrolle der Sicherheitskräfte gehen.
Die EU-Staaten werden dafür Polizisten und Soldaten als mobile Teams von Ausbildern und Experten entsenden müssen. Vorgesehen ist im ersten Halbjahr nach Start der Mission ein Budget von 1,2 Millionen Euro. Die Mission dürfte vorerst nur in Benin und Ghana beginnen. Nur die Präsidenten der beiden Länder haben die formelle Einladung schon ausgesprochen, während das grüne Licht der Elfenbeinküste und Togos noch aussteht. Die EU hatte mit ihrem Engagement weiter nördlich in Mali und Niger zuletzt wenig Erfolg. Erst Ende 2022 hatten die Mitgliedstaaten eine Militärmission in Niger beschlossen, wichtiges Transitland für Migration und im Fokus des islamistischen Terrors. Seit dem Militärputsch vom 26. Juli musste die EU die Zusammenarbeit aussetzen. sti
Sicherheitsanalyst John Lechner schätzt den Tod Prigoschins für die Präsenz der Wagner-Truppe in Afrika als nicht entscheidend ein. “Ich denke, wir werden eher viel Kontinuität von Wagner in Afrika sehen”, sagte Lechner im Gespräch mit Table.Media. “Denn Wagner war auch eine Folge des Unwillens und Unfähigkeit Russlands, reguläre Truppen nach Afrika zu entsenden. Wagner-Strukturen sind etabliert, die Truppe hat Kontakte und Erfahrung vor Ort. Es wird schwierig, sie ganz zu ersetzen.”
Genau das scheint das russische Verteidigungsministeriums zumindest in Libyen und in Syrien zu versuchen. Einen Tag vor Prigoschins Tod berichteten russische Medien über den Besuch des stellvertretenden Verteidigungsministers Junus-Bek Jewkurow in Libyen. Dabei soll die künftige militärische Zusammenarbeit besprochen worden sein. Laut dem im Exil lebenden russischen Investigativjournalisten Andrej Sacharow war Jewkurow vor seiner Libyen-Reise bereits in Syrien, wo es darum ging, die Zusammenarbeit mit Wagner zu beenden. In Syrien unterhält Russland einen Militärhafen in Tartus und einen Militärflughafen in Hmeimim.
Neben Libyen ist Wagner auf dem afrikanischen Kontinent in Sudan, Mali und besonders in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Eine Studie der NGO “Global Initiative” bezeichnet das Wagner-Modell dort als “staatliche Übernahme”. Im Austausch für Bodenschätze – Gold und Diamanten vor allem – liefere Wagner dem Regime von Präsident Touadéra politische und militärische Unterstützung. In Mali hat die Militärregierung von Assimi Goïta die Wagner-Präsenz nie offiziell bestätigt, sondern spricht von russischen Militärausbildern. Regelmäßig telefoniert er mit Putin.
Ende Juni gab der russische Präsident zum ersten Mal öffentlich zu, dass der Kreml Wagner finanziert. Demnach erhielt die Gruppe von Mai 2022 bis Mai 2023 umgerechnet rund 930 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt.
Russland pflegt mit vielen afrikanischen Ländern enge Beziehungen. Erst im Juli lud Putin afrikanische Staats- und Regierungschefs nach St. Petersburg zum Afrika-Russland-Gipfel ein. Es kamen zwar weniger Teilnehmer als geplant, doch Putin positionierte sich wieder einmal erfolgreich als Afrikas Freund und Helfer und knüpft an das alte sowjetische Narrativ des antikolonialen Kampfes an. Wagner-Chef Prigoschin war in St. Petersburg zugegen. Dort ließ er sich mit afrikanischen Teilnehmern ablichten, unter anderem mit dem Protokollchef der Zentralafrikanischen Republik.
Für die militärischen Einsätze in Afrika und die daran hängenden wirtschaftlichen Aktivitäten bedeute der Tod Prigoschins erst einmal nicht viel, meint Lechner. “Prigoschin als Person wird schwer zu ersetzen sein. Nur wenige Menschen haben so ein Charisma. Aber Wagners Geschäfte laufen weiter. Und Prigoschin selbst war nie ein Anführer direkt vor Ort. Es wird wohl langfristig davon abhängen, wie das Verhältnis zwischen Wagner und dem russischen Staat geregelt wird.”
Der Einfluss von Wagner könnte sich im fragilen Sahel sogar noch ausdehnen, vermutet Lechner. “Niger hat nicht wirklich eine andere Option. Ich denke, wir werden dort Wagner-Kräfte sehen. Und andere russische Privatmilizen, die dieses Lücke füllen könnten, gibt es nicht.” Da westliche Partner laut den Regierungen in Mali, Burkina Faso und Niger nicht die Wünsche nach großflächiger militärischer Unterstützung erfüllten, wird Russland vorerst weiter als Alternative gesehen. lcw/vf
Nach einem Treffen der libyschen Außenministerin Najla Mangoush mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen in Rom ist es in der Nacht zu Montag im Westen Libyens zu Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Tripoli sowie der Hafenstadt Zauwia brannten Autoreifen. Premierminister Abdulhamid Dabaiba reagierte prompt: Ab sofort werde der Minister für Kultur und Jugend, Mohamed Mehdi Bensaid, das Außenministerium leiten, so eine Regierungserklärung auf Facebook. Außenministerin Mangoush sei so lange freigestellt, bis eine Untersuchung die Umstände des Treffens aufgeklärt habe.
Es habe sich um kein formelles, sondern um ein spontanes Treffen ohne Vorbereitung gehandelt, sagte ein Sprecher des libyschen Außenministeriums am Montag. Najla Mangoush erklärte, sie sei nach einem Austausch mit italienischen Regierungsvertretern zufällig auf Cohen getroffen und dann nach London weitergereist.
In ihrer Heimat droht der 50-Jährigen nun die Verhaftung, da jede Kontaktaufnahme mit offiziellen Vertretern Israels wie im benachbarten Tunesien ein gesellschaftliches Tabu ist. Libyen und Israel unterhalten zwar keinerlei offizielle Beziehungen, stehen jedoch durch die ehemals über 30.000 jüdischen Libyer in Kontakt. Angehörige der jüdischen Minderheit Libyens mussten nach dem von Israel gewonnenen Sechs-Tage-Krieg 1967 Nordafrika verlassen.
Am Sonntagnachmittag hatte der israelische Außenminister Cohen das Treffen mit der früheren Menschenrechtlerin Mangoush als historisch bezeichnet und als ersten Schritt auf dem Weg zur Neuschaffung einer Beziehung beider Länder. Man habe sich über die Erhaltung des jüdischen Kulturerbes in Libyen unterhalten, so Cohen gegenüber israelischen Medien, die ausführlich über das erste Treffen libyscher und israelischer Spitzendiplomaten berichteten.
Wie brenzlig die Proteste für Premierminister Dabaiba persönlich sind, zeigen nächtliche Aufnahmen von einem Angriff auf dessen Privathaus. Unbekannte warfen Steine und Molotowcocktails auf das von bewaffneten Milizen geschützte Gebäude in Tripolis, ohne es jedoch zu beschädigen. mk

Bis heute hat der Westen nicht wahrgenommen, dass Ansehen und Attraktion des westlichen Modells gelitten haben. Die Brics-Erweiterung ist Ausdruck dessen, dass vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer mit der herrschenden internationalen Ordnung unzufrieden sind. In internationalen Gremien haben sie oft keine Stimme und kein Gewicht. Brics glänzt nicht durch eigenes Handeln, sondern weil der Westen die Steilvorlagen dazu liefert.
Deshalb ist es auch nicht entscheidend, wenn sich der Zusammenhalt in der erweiterten Staatengruppe derzeit auf wenige Kernaspekte reduziert: Wirtschaft und Finanzen ja, aber zum Beispiel keine gemeinsame Sicherheitsstrategie. Einige sind sich aber alle in der Ablehnung westlicher Hegemonie und gegenüber dem Dollar als Leitwährung. Diese anti-westliche Stimmung verfängt und ist auch für viele andere Länder attraktiv. Brics hat einen Punkt aufgenommen, den Entwicklungs- und Schwellenländer seit langem fordern: Der Westen muss sich umstellen und anerkennen: Eine Dominanz der USA und Europas wird künftig nicht mehr hingenommen.
Was wir jetzt sehen, ist die beginnende weltwirtschaftliche Neuvermessung, bei der China der große Gewinner ist. Mit noch immer beachtlichen Wachstumsraten und hoher Nachfrage nach Energie und Rohstoffen ist das Land, ebenso wie Indien, für die Brics-Gruppe extrem attraktiv. Auch wenn China oft selbst imperial auftritt, ist es eine Art wirtschaftliches Zukunftsversprechen für die Brics-Staaten.
Wir sollten nicht davon ausgehen, dass dieser Club in nächster Zeit von alleine verschwinden wird. China bildet den großen Rückhalt und das macht Brics für weitere Länder interessant. Ob China dann die Kohäsionskraft hat, unterschiedlichste Mitglieder und Interessen zusammen zu bringen, muss sich noch zeigen. Wenn die Erweiterung im Moment auch noch keine Gefahr für den Westen darstellt, so ist doch ein Shift erkennbar.
Wie kann, wie soll der Westen jetzt reagieren? Wir müssen eine ganz andere Agenda für die Kooperation mit Schwellen- und Entwicklungsländern entwickeln. Dazu zählt auch die Frage: Wie gehen wir künftig mit autoritären Regimen um und wahren trotzdem unsere eigenen Interessen? Welche Strategie haben wir zum Beispiel für den Nahen Osten, eine sehr schwierige Weltregion? Und dann natürlich Afrika, der zentrale Fokus für Neuorientierung. Für diesen Kontinent eröffnen wir bis heute viel zu wenig Chancen für einen nachhaltigen Entwicklungspfad. China bringt jetzt Hunderttausende junge Menschen in eigene Berufsbildungskonzepte für Afrika. Das zeigt doch, welche Art von Attraktivität dieses Modell hat. Wir haben es dagegen nicht geschafft, in diesem Bereich Zeichen zu setzen. Bis heute gibt es kein zu Ende verhandeltes Konzept für die Afrikanische Freihandelszone.
Wir sollten Impulse für die Weltwirtschaft setzen, durch Kooperationsbeziehungen, technologische Zusammenarbeit, fairen Handel und ein Mitsprache- und Vertretungsrecht der aufstrebenden Länder in internationalen Organisationen. Und natürlich müssen wir selbst innerhalb Europas unsere Krisen in den Griff bekommen.
Die erste Reaktion der deutschen Außenministerin Baerbock auf die Brics-Erweiterung zeigt, wie wenig substanziell unsere Außenpolitik noch immer aufgestellt ist. Natürlich: Miteinander sprechen muss man immer, gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Aber wichtig ist ja nicht nur, dass man redet, sondern auch wie und worüber. Was wollen wir: Systemkonkurrenz, strategische Zusammenarbeit, De-Risking? Ich sehe nicht einmal einen Diskurs darüber. Für mich zeigt es, dass die Debatte über strategische Außenpolitik in unseren Ministerien bis heute nicht angekommen ist. Sie ist von Illusionen geprägt.
Robert Kappel ist emeritierter Professor für Ökonomie in Afrika an der Universität Leipzig und ein renommierter Afrika-Kenner.
Politico: Frankreichs Zeit in Afrika ist abgelaufen. Was immer Frankreich tut, ob gut oder schlecht, löst in Afrika eine allergische Reaktion aus. Ein Rückzug aus dem Kontinent würde in gewissem Maße das Ansehen Frankreichs in der Welt schmälern, so der Westafrika-Experte Michael Shurkin in einem Meinungsbeitrag. Für französische Interessen sei jedoch besser gesorgt, würden die Prioritäten anders gesetzt.
Wall Street Journal: Kann Wagners Reich in Afrika Prigoschin überleben? Ein Großteil der Aktivitäten der Gruppe Wagner fand bisher in Afrika statt. Ihr Anführer war noch kurz vor seinem Tod vom Kontinent zurückgekehrt. Nun ist offen, wie es mit dem Wagner-Geschäft in Afrika weitergeht.
Foreign Policy: In Afrika ist Demographie Schicksal. Die Hälfte des globalen Bevölkerungswachstums bis 2050 wird in Afrika südlich der Sahara stattfinden. Die Bevölkerung der Region wächst derzeit dreimal so schnell wie die der übrigen Welt, und bis zum Ende des Jahrhunderts wird ein Drittel aller Menschen auf der Welt dort leben.
The Economist: Westafrikanischer Blick nach dem Putsch in Niger. Eine Umfrage zeigt, dass die meisten Menschen in Westafrika den jüngsten Staatsstreich in Niger gutheißen. Die Befragten in Elfenbeinküste, Ghana, Mali und Nigeria hinterfragen auch generell die Forderung nach einem militärischen Eingreifen der Ecowas.
AP: Ägypten, Äthiopien und Sudan nehmen Verhandlungen über umstrittenen Staudamm wieder auf. Nachdem Ägypten und Äthiopien Mitglieder der Brics-Gruppe werden, haben sich die beiden Länder darauf verständigt, wieder über den GERD-Damm am Nil zu verhandeln. Wie viel Wasser Äthiopien flussabwärts ablassen wird, ist noch unklar.
Al Jazeera: Modi schlägt G20-Mitgliedschaft für AU vor. Der indische Premierminister Narendra Modi hat vorgeschlagen, die Afrikanische Union (AU) als Vollmitglied in die G20 aufzunehmen. Im Vorfeld des G20-Gipfels im nächsten Monat in Neu-Delhi pries er außerdem sein Land als Lösung für die Probleme in den Lieferketten an.
France 24: Tik Tok in Kenia wird künftig moderiert. Tik Tok hat zugestimmt, die Inhalte seiner App in Kenia zu moderieren, so das Präsidentenbüro. Die Ankündigung kommt einige Tage, nachdem das kenianische Parlament eine Petition zum Verbot der beliebten Video-Sharing-Plattform erhalten hatte.
African Business: Kenias “Hustler Fund” sucht Unterstützung durch Weltbank und EU. Kenia führt derzeit Gespräche mit der Weltbank und der EU, um finanzielle Unterstützung für das Vorzeige-Wirtschaftsprogramm von Präsident Ruto zu erhalten. Es wurde Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufen, um Kenianern den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern.
Financial Times: Namibia, der nächste Petrostaat? Shell und Total verstärken ihre Bemühungen um die Erschließung eines potenziell riesigen Ölfeldes vor der Küste Namibias. Sollte es ihnen gelingen, kommerziell nutzbare Ölmengen zu identifizieren, könnte das Land im südlichen Afrika zu einem der neuesten Petrostaaten der Welt werden.
Bloomberg: Verteilung ist Schwachstelle von Südafrikas Stromnetz. Das südafrikanische Stromverteilungssystem werde von Streits zwischen Eskom und den Gemeinden heimgesucht, so Stromminister Ramokgopa. Bislang hat sich Eskom darauf konzentriert, die Leistung der hauptsächlich mit Kohle betriebenen Kraftwerke zu verbessern.
Financial Times: Der Westen hat seine Hilfsversprechen nicht eingehalten. In einem Meinungsbeitrag beklagt der Ökonom Adam Tooze die bisher leeren Versprechen der EU und der USA gegenüber dem globalen Süden. Die Versuche, auf Chinas Belt and Road-Initiative zu reagieren, seien kläglich gescheitert.

Mahamadou Issoufou hat in seinem Leben reichlich Lorbeeren bekommen. “Im Angesicht schwierigster politischer und wirtschaftlicher Probleme, darunter gewalttätiger Extremismus und die voranschreitende Wüstenbildung, hat Präsident Mahamadou Issoufou die Menschen in seinem Land auf einen Weg des Fortschritts geführt”, lautete beispielsweise das Lob des Vorsitzendens des Mo-Ibrahim-Preises. Issoufou gewann 2020 die Auszeichnung für seine herausragende politische Führungskraft auf dem afrikanischen Kontinent. Fünf Millionen Dollar gab es auf die blumigen Worte obendrauf.
Ob er sich die Lorbeeren jedoch redlich verdiente, ist eine andere Frage. Anlässlich der Preisverleihung meldeten Experten Zweifel an den demokratischen Verdiensten Issoufous an. 2011 ging er als Sieger der Wahlen hervor, die nach einem Putsch 2010 organisiert worden waren. 2016 wurde Issoufou mit der überragenden Mehrheit von offiziell 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Doch die Opposition hatte die Wahlen angesichts von Kritik an Issoufous harter Hand boykottiert. Oppositionsführer Hama Amadou ging direkt nach der Wahl nach Frankreich ins Exil.
Issoufou, der lange Frankreichs Mann in Niamey war, ermöglichte 2021 schließlich den ersten friedlichen Machtwechsel in Niger. Der von ihm ausgesuchte Kandidat Mohamed Bazoum gewann prompt diese Wahl. Die unerwartete Entmachtung und Gefangennahme Bazoums Ende Juli wirft inzwischen einen Schatten auf Issoufou und die angeblich freundschaftliche Beziehung, die die beiden Politiker öffentlich stets betonten.
Issoufou war als Vermittler von der ersten Minute an in das Geschehen nach dem Putsch involviert. US-Außenminister Blinken appellierte an Issoufous Geschick für eine friedliche Verhandlungslösung nach Telefonaten mit dem abgesetzten Bazoum und dem Ex-Präsidenten. In einem kurzen Interview im französischen Magazin Jeune Afrique forderte Issoufou drei Wochen nach dem Coup Bazoums Freilassung.
Issoufou, geboren 1952 rund 500 Kilometer nordöstlich von Nigers Hauptstadt Niamey, ist seit den Anfängen der Demokratie in seinem Land eine feste Größe in der Politik. Nur wenige Jahre nach der Unabhängigkeit Nigers von Frankreich ging Issoufou nach einem ersten Abschluss in Niger im Land der Kolonialherren studieren. Sein Vater, Dorfchef in der von Hausa geprägten Region, diente noch in der französischen Kolonialarmee, und gehörte damit zu den sogenannten tirailleurs.
Sein Vater war Analphabet. Der Sohn kehrte als ausgebildeter Mathematiker und Bergbauingenieur aus Frankreich zurück – im Dienst des französischen Bergbauunternehmens Somair (Uran).1990 gründete er die Partei Tarayya (Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme) mit und widmete sich von 1992 an ganz der Politik.Mehrfach kandidierte Issoufou erfolglos – bis zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten 2010.
Die EU und Deutschland setzten fest auf Issoufou. Den Ton setzte Alt-Bundespräsident Horst Köhler, Jury-Mitglied für den Mo-Ibrahim-Preis. Er verteidigte die Entscheidung in einem Interview mit der Deutschen Welle: “Präsident Issoufou hat sich an die Landesverfassung gehalten, die nur zwei Amtsperioden vorsieht. Damit hat er den Weg für den ersten demokratischen Regierungswechsel in der Geschichte Nigers geöffnet. Und ich finde, das ist wirklich preiswürdig. Für mich war das ein entscheidender Punkt, weil mich das an ein Gespräch mit Nelson Mandela erinnerte, den ich als Bundespräsident 2006 in Maputo traf und fragte, was aus seiner Sicht das Wichtigste für die Entwicklung Afrikas sei. Seine Antwort war klar, ich sage das in seinen Worten in Englisch: ,Rule of law and respect for the constitution.’ Das war seine Antwort. Und das prägte mich auch bei dieser Diskussion zur Verleihung des Preises.”
Auch nach seinem verfassungsgemäßen Abgang blieb Issoufou eine Einfussgröße in Niger. Manche halten seinen Einfluss für so groß, dass sie ihm eine Rolle in dem Putsch zuschreiben. Belegt ist nur, dass der neue Machthaber Abdourahamane Tiani die Präsidentengarde unter Issoufou befehligte und ihm unter Bazoum die Ablösung drohte.
Issoufou gründete eine eigene Stiftung, die sich unter anderem mit ökologischen Fragen befassen sollte, war gern gesehener und regelmäßiger Gast auf internationalen Konferenzen, beispielsweise auf dem Sicherheitsforum in Dakar 2022, auf dem er sich nach seinem Auftritt kaum vor Selfieanfragen retten konnte.
Dass Deutschland sich in seiner Bewertung von Niger als Stabilitätsanker im Sahel verschätzt hat, steht fest (Africa.Table berichtete). Welche Rolle Issoufou im jüngsten Coup spielte, ist weiter unklar. Die Gerüchte reißen jedenfalls nicht ab. So berichtete etwa der Journalist Seiddik Abba auf X (ehemals Twitter) von einer Auseinandersetzung am Vorabend des Coups zwischen Issoufous Sohn, Issoufou und Bazoum um die Besetzung des Chefpostens des staatlichen Ölunternehmens Petro Niger. Lucia Weiß, Dakar
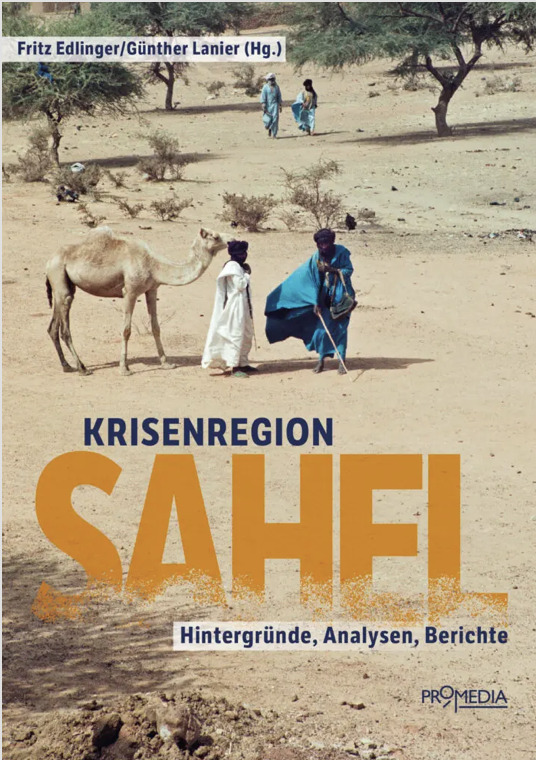
Das Interesse der Deutschen an der Sahel-Region war bisher gering. Selbst für die Kultur dieser so vielfältigen Gegend der Erde konnten sich nur wenige begeistern. Entsprechend gering ist das Angebot an Büchern über den Sahel. Insofern schließt der Sammelband “Krisenregion Sahel”, den der Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen Fritz Edlinger und der in Ouagadougou lebende Ökonom Günther Lanier herausgegeben haben, eine wichtige Lücke.
In detaillierten Länderanalysen stellen die Autoren neun Länder der Region vor. Geschrieben wurden sie von Journalisten, Vertretern von NGOs oder Entwicklungshelfern, meistens von Autorinnen und Autoren aus Europa. In einem zweiten Teil behandelt das Buch Themen wie den Islam im Sahel, Ethnizitäten, Terrorismus, Migration, Sicherheitspolitik… Eine Lücke lässt allerdings auch dieses Buch offen: Die Tuareg werden an fünf, vielleicht sechs Stellen erwähnt und einmal auf immerhin neuneinhalb Zeilen behandelt. Damit bleiben sie die große Unbekannte in diesem Buch. Auch Rohstoffe hätten eine Berücksichtigung verdient.
Dennoch liefert das Buch spannende Einblicke und fördert das Verständnis für die Region. Hilfreich wäre es, bei einer Neuauflage weiterführende Literatur zu empfehlen. hlr
Fritz Edlinger, Günther Lanier (Hg.): Krisenregion Sahel. Hintergründe, Analysen, Berichte. Promedia Verlag, Wien, 2022, 256 Seiten, 22 Euro (E-Book 18,99 Euro).
